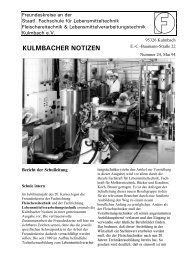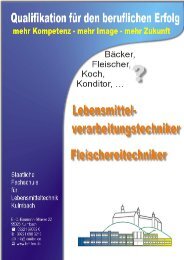Schule aktuell Kulmbacher Notizen - Fachschule für ...
Schule aktuell Kulmbacher Notizen - Fachschule für ...
Schule aktuell Kulmbacher Notizen - Fachschule für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Korrelation der<br />
Flüssigkeitsaufnahmekapazität<br />
mit<br />
der Stampfdichte von<br />
Trägerstoffen<br />
Florian Huber, Claudia<br />
Schmidkonz, Thomas<br />
Sommer<br />
Betreuer: Dr. F. Kögel<br />
Partner: Fa. Raps GmbH &<br />
Co KG, Gewürzwerke,<br />
Kulmbach<br />
Aufgabenstellung /<br />
Zielsetzung<br />
In Zusammenarbeit mit der TU München<br />
/ Weihenstephan entwickelte die<br />
Firma Raps ein spezielles Verfahren zur<br />
Beladung rieselfähiger Trägerstoffe mit<br />
Flüssigkeiten (CPF-Verfahren). Dabei<br />
stellte sich heraus, dass die<br />
Flüssigkeitsaufnahmekapazität der<br />
Trägerstoffe eindeutig mit deren<br />
Stampfdichte korrelierte. Unsere Aufgabe<br />
war es nun zu untersuchen, ob<br />
dieser Zusammenhang auch bei dem in<br />
Werk I üblichen Verfahren des<br />
Flüssigkeitseintrages mit dem<br />
Pflugscharmischer existiert. Sollte dies<br />
der Fall sein, so wäre es auch hier möglich,<br />
künftig ohne weitere Tests allein<br />
anhand der Stampfdichte des Trägerstoffes<br />
auf seine maximale Beladbarkeit<br />
zu schließen.<br />
Bereits im Vorjahr hatte sich eine Gruppe<br />
der Klasse VT12 mit diesem Thema<br />
beschäftigt und hatte in zahlreichen<br />
Versuchen die Verfahren und<br />
Untersuchungsmethoden optimiert.<br />
Die Ergebnisse deuteten auf eine Korrelation<br />
hin, allerdings ohne statistische<br />
Absicherung. Die Folgearbeit unserer<br />
obengenannten Gruppe sollte durch<br />
Anwendung der optimierten Verfahren<br />
auf eine Vielzahl von Beladungsversuchen<br />
die Verhältnisse klären.<br />
Ergebnisse<br />
In den ersten beiden Versuchsreihen<br />
wurden Monoträgerstoffe und Trägerstoffgemische<br />
mit steigenden Mengen<br />
an Speiseöl beladen bis sie nicht mehr<br />
siebbar waren. Die Proben wurden einem<br />
Ausöltest unterzogen und die Ergebnisse<br />
in Diagramme übertragen. Die<br />
Auswertung der Ausöltests hinsichtlich<br />
der maximalen Beladbarkeit der<br />
<strong>Kulmbacher</strong> <strong>Notizen</strong> - Projektarbeiten Verarbeitungstechnik<br />
Trägerstoffe gestaltete sich schwierig,<br />
so dass die maximale Beladung letztlich<br />
anhand der Siebbarkeit beurteilt<br />
werden mußte.<br />
Nach der Bestimmung der Stampfdichten<br />
zeigte sich eine gute Korrelation<br />
mit der Flüssigkeitsaufnahmekapazität.<br />
Lediglich Diphosphat bildet<br />
hier eine Ausnahme, dessen<br />
Beladbarkeit weit größer war, als seine<br />
Stampfdichte vermuten ließ.<br />
In der dritten Versuchsreihe wurden<br />
Gewürzmischungen mit unterschiedlichen<br />
Kochsalz/Dextrose-Gehalten als<br />
Trägerstoff verwendet. Die Gewürzmischungen<br />
waren nicht sehr gut<br />
beladbar und erreichten nicht die theoretisch<br />
zu erwartende maximale Beladung<br />
mit Speiseöl.<br />
Resümierend läßt sich sagen, dass die<br />
Stampfdichte der untersuchten Trägerstoffproben<br />
eine gute Korrelation mit<br />
der maximalen Flüssigkeitsaufnahmekapazität<br />
zeigen. Lediglich Diphosphat<br />
bildet eine deutliche Ausnahme – die<br />
Gründe hier<strong>für</strong> sind uns nicht bekannt.<br />
Gushing-Vorhersage<br />
bei<br />
Apfelsaftkonzentraten<br />
Petra Hoffmann, Stefan<br />
Öttinger<br />
Betreuer: Dipl.-Ing. T. Birus<br />
Partner: Fa. Wild,<br />
Eppelheim; Fa. Mütek,<br />
München<br />
Aufgabenstellung /<br />
Zielsetzung<br />
Fertige Schorlen haben durch ihre erfrischenden<br />
und prickelnden Eigenschaften<br />
bei den Verbrauchern in den<br />
letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen.<br />
Der steigende Bedarf hatte zur Folge,<br />
dass die Herstellung von Konzentraten<br />
zunahm. Das den Schorlen zugesetzte<br />
Kohlendioxid besitzt u.A. eine<br />
keimhemmende Wirkung. Jedoch kann<br />
das CO in Verbindung mit verschiede-<br />
2<br />
nen Faktoren beim Öffnen der Schorle<br />
zur spontanen Schaumbildung<br />
(Gushing) führen. So wurde bereits<br />
entdeckt, dass Fruchtsaftschorlen mit<br />
einem hohen Phenol- und Eiweißgehalt<br />
ein verstärkteres Schäumen verursacht.<br />
Durch Messmethoden kann das beim<br />
Öffnen auftretende Schaumvolumen<br />
vorhergesagt werden.<br />
13<br />
Die Facharbeit mit dem<br />
Partikelladungsdetekor PCD 03 pH der<br />
Firma Mütek diente der Überprüfung<br />
der neuen Testmethode auf ihre Effektivität.<br />
Dabei wird die zu untersuchende<br />
Probe in eine einseitig geschlossene<br />
Messzelle aus PTFE gefüllt. Der<br />
eingepasste PTFE- Verdrängerkolben<br />
bewegt sich mit konstanter Frequenz<br />
von 4 Hz periodisch. Es wird eine oszillierende<br />
Flüssigkeitsströmung innerhalb<br />
der Messprobe hervorgerufen.<br />
Diese Flüssigkeitsströmung führt zur<br />
Ausbildung eines Potenzials, das einen<br />
Zusammenhang zur Schaumhöhe aufweist.<br />
Ergebnisse<br />
Wie sich in der Arbeit zeigte, ist der<br />
Partikelladungsdetektor PCD pH 03<br />
dazu geeignet, das Gushingverhalten<br />
von Fertiggetränken und Apfelsaftkonzentraten<br />
zu beurteilen.<br />
IST-Aufnahme des<br />
Druckluftnetzes und<br />
Planung eines ölfreien<br />
Netzes <strong>für</strong> ein<br />
Unternehmen der<br />
Gewürzindustrie<br />
Heinz-Josef Ingenerf, Steffen<br />
Pult, Franz-Josef Bauer<br />
Betreuer: Dr. S. Günther<br />
Partner: Raps GmbH & Co<br />
KG, Kulmbach<br />
Ausgehend von der Kompressoranlage<br />
wurde das Druckleitungsnetz aufgenommen<br />
und gekennzeichnet. Dabei<br />
wurde besonderer Wert auf die Absperrventile,<br />
Druckminderer, Steckkupplungen<br />
und Schlauchverbindungen<br />
gelegt. Die Drücke an den<br />
Druckminderern wurden festgehalten<br />
und produktberührende Stellen farbig<br />
markiert. Mit Hilfe der Aufnahmen wurde<br />
ein Übersichtsplan in einen<br />
Gebäudequerschnitt eingezeichnet und<br />
die genauen Leitungsverläufe mit Auto<br />
CAD 2002 in die Grundrisspläne der<br />
einzelnen Stockwerke übertragen. Die<br />
Berührungspunkte der Druckluft mit<br />
Lebensmittel wurde Verbrauchern zugeordnet<br />
und mit dem anliegenden<br />
Druck in eine Tabelle eingetragen. Aus<br />
diesen Daten wurde die Möglichkeit<br />
einer ölfreien Druckluftversorgung untersucht.<br />
Generell stehen zur ölfreien Druckluft-