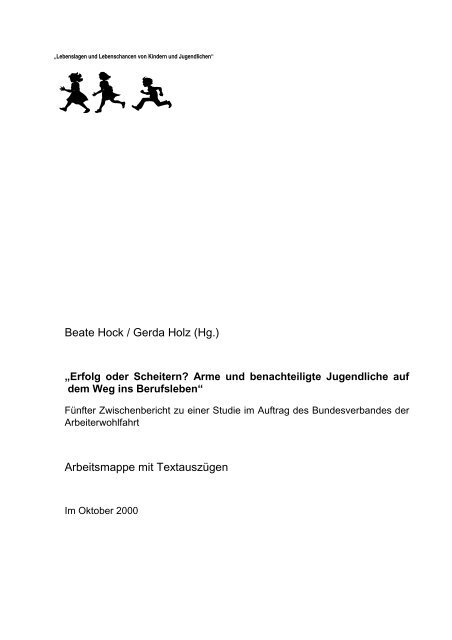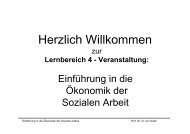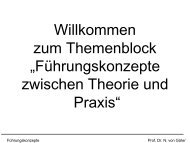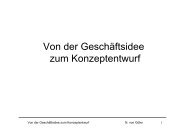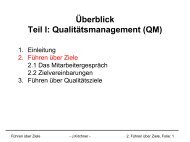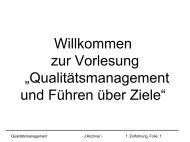Beate Hock / Gerda Holz (Hg.) Arbeitsmappe mit Textauszügen
Beate Hock / Gerda Holz (Hg.) Arbeitsmappe mit Textauszügen
Beate Hock / Gerda Holz (Hg.) Arbeitsmappe mit Textauszügen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Lebenslagen und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen“<br />
<strong>Beate</strong> <strong>Hock</strong> / <strong>Gerda</strong> <strong>Holz</strong> (<strong>Hg</strong>.)<br />
„Erfolg oder Scheitern? Arme und benachteiligte Jugendliche auf<br />
dem Weg ins Berufsleben“<br />
Fünfter Zwischenbericht zu einer Studie im Auftrag des Bundesverbandes der<br />
Arbeiterwohlfahrt<br />
<strong>Arbeitsmappe</strong> <strong>mit</strong> <strong>Textauszügen</strong><br />
Im Oktober 2000
INHALT<br />
1 Zur weiteren Nutzung der Textauszüge 1<br />
2 Zur Untersuchung / Einführung 2<br />
3 Faktoren und Prozesse der Verfestigung von Armut 5<br />
4 Armutsgefährdung durch ein Scheitern im Übergang ins Berufsleben 7<br />
5 „Erfolgreiche“ Wege aus der Armut – Zwei Fallbeispiele 10<br />
6 Zum allgemeinen Verständnis:<br />
Konzepte und Definitionen zum Aufwachsen in Armut 39<br />
II
1 Zur weiteren Nutzung der Textauszüge<br />
Die dreijährige Studie „Lebenslagen und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen“, die<br />
das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) im Auftrag des Bundesverbandes der<br />
Arbeiterwohlfahrt (Kurztitel der Studie: AWO-ISS-Studie) von September 1997 bis Ende August<br />
2000 durchgeführt hat, diente neben der Gewinnung neuer Erkenntnisse vor allem der<br />
Problematisierung des Themas „Kinder-/Jugendarmut“ in Deutschland und der Sensibilisierung<br />
von Praxis, Politik, Öffentlichkeit und Forschung.<br />
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, neben der regelmäßigen und zeitnahen<br />
Veröffentlichung von Zwischenberichten zusätzlich praxisorientierte Handreichungen für die<br />
Fachkräfte der Sozialen Arbeit und für die breite Öffentlichkeit zusammenzustellen. Wir erhoffen<br />
uns, daß diese regen Gebrauch davon machen.<br />
Die hier vorgelegten Textauszüge zu Armut und Benachteiligung im Übergang ins Berufsleben<br />
sollen einen Einblick in das Thema geben und vor allem Beispiele für „gelungene“ Armutsbewältigung<br />
liefern, die nur allzu oft übersehen werden, aber wichtige Hinweise für die<br />
Praxis liefern können.<br />
Da<strong>mit</strong> ist jeder angesprochen, Armut von Kindern und Jugendlichen als ein bedeutsames<br />
individuelles, soziales und gesellschaftliches Problem in Deutschland produktiv und innovativ<br />
zu bearbeiten.<br />
1
2 Zur Untersuchung / Einführung 1<br />
Mit der Umsetzung der dreijährigen Studie „Lebenslagen und Lebenschancen von (armen)<br />
Kindern und Jugendlichen“ (Kurztitel AWO-ISS-Studie), die vom Institut für Sozialarbeit und<br />
Sozialpädagogik e.V. (ISS) seit 1997 realisiert wird, verfolgt der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt<br />
(AWO) mehrere Ziele: Zum einen sollen Öffentlichkeit und Verband für das lange<br />
Zeit weitgehend vergessene Problem der „Armut von Kindern und Jugendlichen“ sensibilisiert<br />
werden. Zum zweiten gilt es, <strong>mit</strong> Hilfe der Forschungsergebnisse die (Sozial-)Arbeit in<br />
den AWO-Einrichtungen weiterzuentwickeln und fachliche Innovationen zu initiieren. Zum<br />
dritten soll <strong>mit</strong> Hilfe der Ergebnisse die Anwaltfunktion des Wohlfahrtsverbandes für die<br />
Gruppe der armen Kinder und Jugendlichen auf eine fundiertere Grundlage gestellt und so<br />
gestärkt werden.<br />
Vor dem Hintergrund dieser Hauptziele sowie zu konstatierender deutlicher Forschungslükken<br />
kristallisierten sich von Beginn an zwei zentrale Forschungskernpunkte heraus:<br />
a) Die Bedeutung des Problems Armut bei Kindern und Jugendlichen<br />
b) Die Armutsbewältigung durch Kinder und Jugendliche<br />
Beide Schwerpunkte wurden in den zurückliegenden Projektjahren in unterschiedlicher Intensität<br />
behandelt. Das Hauptaugenmerk der ersten, bereits ausführlich dokumentierten<br />
Projektteile 2 lag bei Kindern, insbesondere Kindern im Vorschulalter. Im Mittelpunkt stand<br />
der Aspekt der frühen Folgen von Armut. Dabei zeigte sich unter anderem (vgl.<br />
<strong>Hock</strong>/<strong>Holz</strong>/Wüstendörfer 2000a und b), daß Armut vielfach schon sehr früh <strong>mit</strong> Auffälligkeiten<br />
beziehungsweise Benachteiligungen bei den betroffenen Kindern einhergeht. Es zeigte sich<br />
aber genauso, daß ein Teil durchaus im Wohlergehen lebt und positive Lebenschancen besitzt.<br />
Diese Unterschiedlichkeit der Lebenslagen und folglich der Lebenschancen eines unter Armutsbedingungen<br />
lebenden Vorschulkindes wurde und wird von seiten des ISS-Projektteams<br />
auch für ältere Kinder und für Jugendliche unterstellt. So war bei der weiteren Konzeption<br />
des hier dokumentierten letzten Untersuchungsteils zu (armen) Jugendlichen von<br />
Anfang an arbeitsleitend, daß sowohl die negativen Folgen und die Verstetigung von Armut,<br />
aber auch das Ausbleiben dieser Effekte und schließlich die Wege aus der Armut betrachtet<br />
werden sollten. Das heißt, es wird – um Dramatisierungen oder gar Verharmlosungen des<br />
Problems zu vermeiden – auch im vorliegenden „Jugendteil“ erneut nicht nur eine ausgewählte<br />
Gruppe von Armen genauer betrachtet. Gleichzeitig sollten wenig bearbeitete Fragen<br />
Gegenstand eigener Erhebungen werden. Die vor diesem Hintergrund erfolgte Sichtung<br />
1<br />
2<br />
= Textauszug 5. Zwischenbericht, Kapitel 1.<br />
2 Vgl. die im Vorwort beschriebenen, bereits erschienenen vier Zwischenberichte zur AWO-ISS-Studie (<strong>Hock</strong>/<strong>Holz</strong> 1998,<br />
<strong>Hock</strong>/<strong>Holz</strong>/Wüstendörfer 1999, <strong>Hock</strong>/<strong>Holz</strong>/Wüstendörfer 2000a und <strong>Hock</strong>/<strong>Holz</strong>/Wüstendörfer 2000b).
der Datenlage und Forschungsliteratur zum Thema „Armut im Jugendalter“ zeigte, daß bislang<br />
vor allem folgende Fragestellungen bearbeitet wurden:<br />
• Vererbung von Armut<br />
• Abstiegskarrieren (zum Beispiel von Straßenkindern/-jugendlichen)<br />
• Armut, Konsumgesellschaft und Kriminalität<br />
• Jugendliche Subkulturen (zum Beispiel Punks) und Randgruppen (zum Beispiel<br />
rechtsextreme Jugendliche)<br />
• Jugendarbeitslosigkeit<br />
Hierbei zeigt sich, daß fast ausschließlich Abstiegskarrieren beziehungsweise negative Verläufe<br />
von Betroffenen zum Thema von Öffentlichkeit, Politik und Praxis gemacht werden.<br />
Nicht selten greifen vor allem die Medien dies auf, um zu skandalisieren und zu stigmatisieren.<br />
Daneben erfolgt eine intensive Auseinandersetzung <strong>mit</strong> einem seit mehr als einem Jahrzehnt<br />
allgemeinen Gesellschaftsproblem: die strukturelle Arbeitslosigkeit und die da<strong>mit</strong> verbundene<br />
hohe Jugendarbeitslosigkeit.<br />
Während die Faktoren und Wege eines Abstiegs beziehungsweise des Verharrens in Armut<br />
sehr wohl untersucht werden und die negativen Konsequenzen eines (zumindest zeitweiligen)<br />
Aufwachsens in Armut im kulturellen und sozialen Bereich bekannt sind (vgl. unter anderem<br />
<strong>Hock</strong>/<strong>Holz</strong> 1998), bleibt bisher systematisch ungeklärt, wie es zu „erfolgreichen“ Lebenswegen<br />
der zumindest zeitweilig in Armut lebenden Heranwachsenden kommt. Diese<br />
Forschungslücke bestärkte das ISS-Projektteam in der Einschätzung, daß gerade die Betrachtung<br />
positiver Lebensverläufe unter Armutsbedingungen dazu beitragen könnte, für<br />
Praxis und Sozialpolitik neue Erkenntnisse zu gewinnen. Da<strong>mit</strong> fiel die erste Entscheidung,<br />
sich „erfolgreiche“ Lebenswege unter Armutsbedingungen näher zu betrachten. Das<br />
bedeutete zugleich, es sollten die Bedingungen „erfolgreicher“ Bewältigung von Armut während<br />
Kindheit und Jugend untersucht werden. Nicht ex negativo, also auf Basis von Abstiegen<br />
oder negativen Verläufen, wird auf notwendige Hilfestellungen für die Zielgruppe geschlossen,<br />
sondern anhand positiver Beispiele. Diese, die auf Basis offener biographischer<br />
Interviews er<strong>mit</strong>telt wurden, bilden die Basis des empirischen Teils II.<br />
Die zweite untersuchungsleitende Entscheidung fiel ebenfalls aufgrund der skizzierten<br />
Daten- und Forschungslage: Es liegt eine stattliche Zahl von Veröffentlichungen vor zum<br />
Thema „Jugendausbildungslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit“ und da<strong>mit</strong> zu den weniger<br />
„erfolgreichen“ Lebenswegen Jugendlicher, in denen sich familiäre Armut potentiell fortsetzt<br />
oder neu konstituiert. Die vielfältigen quantitativen und qualitativen Untersuchungen zum<br />
Scheitern beim Übergang in das Berufsleben thematisieren jedoch nur selten explizit familiäre<br />
Armut als möglichen Einflußfaktor. So entstand die Idee, die hierzu verstreut vorhandenen<br />
Erkenntnisse zusammenzutragen. In Form einer Expertise (vgl. Teil I) sollte daher das aktuelle<br />
Wissen über die an der ersten Schwelle von der Schule in die Ausbildung gescheiterten<br />
Jugendlichen gebündelt werden. Diese Jugendlichen sind nicht selten die armen<br />
3
Kinder von gestern und möglicherweise die armen Erwachsenen und Senioren von morgen<br />
und übermorgen.<br />
Mit diesem doppelten empirischen Ansatz geraten neben den bislang vernachlässigten „erfolgreichen“<br />
Lebenswegen (vgl. Teil II) auch die (zunächst) „weniger erfolgreichen“ in den<br />
Blick von Forschung und Öffentlichkeit, ohne auf „Extrembeispiele“ wie Straßenjugendliche<br />
oder kriminelle Jugendliche zu rekurrieren. Vielmehr verkörpern die beim Eintritt in das Erwerbsleben<br />
Gescheiterten heute eine alltägliche gesellschaftliche Normalität in Deutschland.<br />
Die beiden empirischen Teile konzentrieren sich aber nicht nur auf unterschiedlich verlaufene<br />
Lebenswege (armer) Jugendlicher, sie repräsentieren auch unterschiedliche Blickwinkel<br />
im Zusammenhang <strong>mit</strong> der Frage von Armut und deren langfristigen Folgen für den Lebenslauf<br />
der Betroffenen. In Teil I stehen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, innerhalb<br />
derer sich die Jugendlichen bewegen, im Mittelpunkt: die allgemeine Situation auf dem<br />
Arbeits- und Ausbildungsmarkt, der Marktwert der verschiedenen Schulabschlüsse, die Diskriminierungen<br />
verschiedener Gruppen auf dem Arbeitsmarkt (zum Beispiel Frauen und MigrantInnen)<br />
und nicht zuletzt die Angebote und Maßnahmen der Jugendhilfe, die den Jugendlichen<br />
zur Verfügung stehen. Diese – sich in der letzten Dekade kontinuierlich verschlechternden<br />
– Rahmenbedingungen gelten zunächst für alle Jugendlichen. Sie sind jedoch<br />
vor allem für solche Jugendlichen relevant, die sich aus unterschiedlichen Gründen<br />
nicht so gut und flexibel an verändernde beziehungsweise erhöhte Anforderungen anpassen<br />
können, das heißt für „benachteiligte“ Jugendliche, unter denen wiederum die „Armen“ eine<br />
Teilgruppe ausmachen.<br />
In Teil II spielen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eher eine untergeordnete Rolle.<br />
Zentral sind hier die konkreten individuellen Lebens- und Sozialisationsbedingungen im<br />
Elternhaus und im sozialen Umfeld, vor deren Hintergrund sich das Erleben, die Einschätzungen,<br />
Haltungen und Handlungen der Interviewten entwickeln. In den Blick geraten „normale“<br />
Sozialisationsleistungen sowie potentiell krisenhafte Ereignisse und deren Bewältigung<br />
durch die jeweiligen Jugendlichen. Der ganz konkrete Einzelfall und die ganz individuelle<br />
Sichtweise stehen im Mittelpunkt der Beschreibung und Analyse. Die Spielräume des Einzelnen<br />
unter den gegebenen Strukturen treten in den Vordergrund. Die gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen aber bilden die Folie respektive den Hintergrund der Analyse.<br />
Mit einem solchen Zugang werden zum einen die restriktiven und den Einzelnen einengenden<br />
gesellschaftlichen Vorgaben aufgezeigt. Zum anderen lassen sich so individuelle Spielräume<br />
und da<strong>mit</strong> auch Spielräume für Handlungs- beziehungsweise Unterstützungsmöglichkeiten<br />
aufzeigen. Als Leitfrage läßt sich formulieren: „Was macht der Mensch aus dem, was<br />
die Verhältnisse aus ihm gemacht haben?“ (Hildenbrand 1990, 234)<br />
4
3 Faktoren und Prozesse der Verfestigung von Armut 3<br />
Armut ist ein wichtiger Belastungsfaktor nicht nur für Erwachsene, sondern genauso für Kinder<br />
und Jugendliche. Armut bedeutet gerade für sie mehr als ein Mangel an materiellen Ressourcen.<br />
Arme Kinder und Jugendliche sind zumeist in mehreren Lebensbereichen benachteiligt,<br />
zum Teil sogar ausgegrenzt. Armut ist deshalb – darüber herrscht weitgehender Konsens<br />
– als ein mehrdimensionales Problem zu begreifen. Kinder und Jugendliche, die in einer<br />
armen Familie aufwachsen, sind nicht nur in bezug auf die materielle Teilhabe beeinträchtigt,<br />
sondern oft auch in ihren kulturellen, sozialen und gesundheitlichen Ressourcen<br />
benachteiligt (vgl. Kapitel 2). Dies gilt – wie Untersuchungen im Rahmen der AWO-ISS-<br />
Studie gezeigt haben – bereits im frühen Kindesalter (vgl. Kapitel 4).<br />
Durch die Mehrdimensionalität des Phänomens Armut stehen davon betroffene Kinder und<br />
Jugendliche vor dem Problem, ihre Sozialisation unter (deutlich) erschwerten Bedingungen<br />
bewältigen zu müssen. Die allgemeinen Entwicklungsaufgaben in der Kinder- und Jugendphase<br />
sind unter diesen Voraussetzungen schwerer zu bewerkstelligen (vgl. Dangschat<br />
1996, 165-167).<br />
„Mehrdimensionalität von Armut konkret“ ���� (Beispiele für) Faktoren, die dazu beitra-<br />
gen, Armut zu verfestigen<br />
• Geringe (schulische und berufliche) Qualifikation der Eltern<br />
• Emotional belastende soziale Probleme im Elternhaus<br />
• Ausschluß der Eltern aus dem „normalen“ Erwerbsleben<br />
• Geringe oder fehlende Förderung im Elternhaus<br />
• Bestrafendes, autoritäres Erziehungsverhalten, wenig Förderung von Autonomie<br />
• Bildungsentscheidungen, die vom Wunsch nach frühem Geldverdienen geprägt sind<br />
• Unzureichender Wohnraum<br />
• Benachteiligendes Wohnumfeld<br />
• Von der gesellschaftlichen Norm abweichende familiäre Lebensmuster, abweichende<br />
Normen und Werte in der Familie und im Umfeld<br />
• Ausgrenzung in der Schule durch Mittelschichtorientierung des Bildungssystems<br />
3<br />
= Textauszug Endbericht, Kapitel 5.1.<br />
5
Eine Marginalisierung der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen, die Verfestigung<br />
und Vererbung der familiären Armut sowie das Scheitern beim Übergang ins Berufsleben<br />
entstehen vor allem dann, wenn zur materiellen Mangellage der Familie problematische Sozialisationsbedingungen<br />
im Elternhaus kommen, die Schule (und der Arbeitsmarkt) ausgrenzend<br />
wirkt, eine Einbindung in „abweichende“ Peergruppen stattfindet und schließlich öffentliche<br />
Instanzen problematische Entscheidungen treffen. Dies belegt eindrücklich eine Untersuchung<br />
von Helsper u. a. (1991), die sich <strong>mit</strong> gescheiterten Bildungs- und Ausbildungsverläufen<br />
von (armen) Jugendlichen beschäftigt. In den ausführlich dokumentierten, eindrucksvollen<br />
Biographien „marginalisierter“ Jugendlicher wird deutlich, daß das „Scheitern“ als das<br />
Ergebnis einer längeren und komplexen biographischen Entwicklung betrachtet werden muß,<br />
die nicht erst <strong>mit</strong> dem Ende der Schulzeit beginnt. Um eine Marginalisierung zu verhindern,<br />
die Verfestigung von Armut von einer Generation zur nächsten zu vermeiden, muß also<br />
schon früh im Leben betroffener Kinder agiert werden.<br />
6
4 Armutsgefährdung durch ein Scheitern im Übergang<br />
ins Berufsleben 4<br />
Nicht nur Kinder aus armen Familien haben Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule<br />
in den Beruf, was die folgenden Zahlen belegen: 1997 verließen rund neun Prozent der<br />
SchulabgängerInnen oder zirka 80.000 Jugendliche die Schule ohne einen Abschluß. Von<br />
den 1997 etwa 240.000 Jugendlichen <strong>mit</strong> Hauptschulabschluß (= 25 Prozent der SchulabgängerInnen<br />
dieses Jahres) wechselten nur knapp drei Viertel direkt in eine betriebliche<br />
Ausbildung über (vgl. zu den Übergangsquoten Althoff 1999, 9). Der Anteil von Übergängen<br />
in un- und angelernte Erwerbstätigkeiten, schulische und außerbetriebliche Ausbildungen,<br />
Berufsvorbereitungsmaßnahmen, Haushaltstätigkeiten und/oder Arbeitslosigkeit insgesamt<br />
ist seit Anfang der neunziger Jahre deutlich gestiegen (vgl. BMBF 1999, 31). 1998 waren<br />
etwa 1,3 Millionen Jugendliche zwischen 20 und 29 Jahren oder etwa jede/r achte in<br />
dieser Altersgruppe (zwölf Prozent in Westdeutschland, acht Prozent in Ostdeutschland)<br />
ohne abgeschlossene Berufsausbildung (vgl. BMBF 1999, 8/9). Das bedeutet: Die Gruppe<br />
der Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung muß unter den gegebenen<br />
(Arbeitsmarkt-)Bedingungen als extrem armutsgefährdet betrachtet werden. Es ist zu fragen,<br />
wer zu dieser Gruppe gehört und welche Faktoren zum Scheitern des Übergangs führen.<br />
Die Abbildungen 1 bis 3 geben Aufschluß über die Gruppen von Jugendlichen, die besonders<br />
häufig keinen Ausbildungsabschluß aufweisen können. Überdurchschnittlich oft betroffen<br />
sind folgende Gruppen, die zugleich als armutsgefährdet betrachtet werden müssen:<br />
(1) Junge Frauen <strong>mit</strong> Kindern: Je nach Familienstand (vgl. Abbildung 1) haben zwischen<br />
29 Prozent (geschiedene) und elf Prozent (<strong>mit</strong> Partner zusammenlebende) junge Frauen<br />
<strong>mit</strong> Kind(ern) keinen Ausbildungsabschluß.<br />
(2) Junge AusländerInnen, insbesondere Jugendliche türkischer Herkunft: Während<br />
„nur“ acht Prozent der deutschen Jugendlichen zwischen 20 und 29 Jahren keinen Abschluß<br />
aufweisen, sind es unter den Jugendlichen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ein<br />
Drittel, unter den jungen TürkInnen sogar knapp 40 Prozent (vgl. Abbildung 2).<br />
(3) Jugendliche <strong>mit</strong> Sonderschulabschluß respektive ohne Abschluß: Etwa ein Drittel<br />
der deutschen Jugendlichen und über vier von fünf (!) ausländischen Jugendlichen (zwischen<br />
20 und 29 Jahren), die keinen Schulabschluß oder nur den Sonderschulabschluß<br />
erreichen, sind ohne Berufsabschluß (vgl. Abbildung 3).<br />
4 = Textauszug Endbericht, Kapitel 5.2; es basiert auf einer Expertise, die von Helmut Lukas, Ute Krieter und Veronika Lukas<br />
erstellt wurde (vgl. 5. Zwischenbericht, Teil I).<br />
7
Abb. 1: Anteil der Jugendlichen ohne Berufsabschluß nach Geschlecht und<br />
Familienstand (in Prozent; Zahlen von 1998)<br />
Quelle: BMBF 1999, 36.<br />
Abb. 2: Anteil der Jugendlichen ohne Berufsabschluß nach Staatsangehörigkeit und Altersgruppen<br />
(in Prozent; Zahlen von 1998; nur Westdeutschland)<br />
Quelle: BMBF 1999, 33.<br />
8<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
%<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
28<br />
22<br />
29<br />
geschieden, <strong>mit</strong><br />
Kind<br />
33<br />
27<br />
23<br />
20<br />
24<br />
verheiratet, <strong>mit</strong><br />
Kind<br />
38<br />
20- bis 29jährige<br />
ausländischer Herkunft<br />
16<br />
16<br />
16<br />
ledig,<br />
alleinstehend, <strong>mit</strong><br />
12<br />
14<br />
11<br />
ledig, <strong>mit</strong> Partner<br />
zusammenlebend,<br />
12<br />
12<br />
11<br />
Jugendliche Kind 20- bis 29jährige, <strong>mit</strong> Kind ohne Berufsabschluß männlich Kinderweiblich<br />
25<br />
22<br />
27<br />
ohne Zuzüge nach dem 10.<br />
Lebensjahr<br />
12<br />
13<br />
11<br />
Durchschnitt verheiratet, ohne<br />
Kinder<br />
20 bis 29 Jahre 20 bis 24 Jahre 25 bis 29 Jahre<br />
40<br />
33<br />
47<br />
9<br />
10<br />
8<br />
ledig,<br />
alleinstehend, ohne<br />
8<br />
12<br />
5<br />
6<br />
4<br />
ledig, <strong>mit</strong> Partner<br />
lebend, ohne<br />
Kinder<br />
türkische junge Erwachsene deutsche junge Erwachsene<br />
6
Abb. 3: Anteil der Jugendlichen ohne Berufsabschluß nach Art des Schulabschlusses und Nationalität<br />
(in Prozent; Zahlen von 1998)<br />
%<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
10<br />
21<br />
9<br />
11<br />
24<br />
Hochschulreife Fachhochschulreife<br />
9<br />
6<br />
18<br />
5<br />
17<br />
59 58<br />
Lesehilfe: 17 Prozent aller 20- bis 29jährigen <strong>mit</strong> Hauptschulabschluß hatten im Jahr 1998 keinen Berufsabschluß; ausländischer<br />
Herkunft in dieser Gruppe waren 33 Prozent, Deutsche aber „nur“ 12 Prozent.<br />
Quelle: BMBF 1999, 41.<br />
War früher das katholische Arbeitermädchen vom Lande in bezug auf Bildung und Ausbildung<br />
am deutlichsten benachteiligt, so ist es heute die junge Türkin (aus dem städtischen<br />
Ballungszentrum), die zu den am klarsten Benachteiligten zählt. Der erhoffte Aufstieg der<br />
Töchter (aber auch der Söhne) von ZuwandererInnen der ersten Generation ist weitgehend<br />
ausgeblieben (vgl. hierzu auch Frick/Wagner 1999). So entsteht – nicht zuletzt durch das<br />
Versagen des Bildungswesens, durch mangelnde gesamtgesellschaftliche Integration von<br />
MigrantInnen und durch den stetigen Abbau von Arbeitsplätzen für Geringqualifizierte – eine<br />
neue, besonders armutsgefährdete Gruppe.<br />
48<br />
33 34 33<br />
12<br />
20<br />
<strong>mit</strong>tlere Reife Hauptschule anderer/<br />
ausländischer<br />
Abschluß<br />
83<br />
ohne Abschluß/<br />
Sonderschule<br />
Durchschnitt (ohne Schüler) 20- bis 29jährige ausländischer Herkunft deutsche 20- bis 29jährige<br />
12<br />
8<br />
Durchschnitt<br />
9
5 „Erfolgreiche“ Wege aus der Armut –<br />
Zwei Fallbeispiele 5<br />
Gordana 6 ���� „Erfolg“ durch Verantwortungsübernahme?<br />
„... Ich hab’ mir vorgenommen, daß ich, wenn ich mal älter bin, daß ich auf jeden<br />
Fall was erreichen will ...“<br />
1. Fallbeschreibung<br />
Gordana ist zum Zeitpunkt des Interviews 25 Jahre alt. Sie arbeitet ganztags als Filialleiterin<br />
in einem Wäschegeschäft. Sie ist ledig und lebt <strong>mit</strong> ihrem Freund zusammen.<br />
Sie wird 1974 in einem Arbeiter- und Zuwandererstadtteil von B., einer Großstadt in Westdeutschland,<br />
geboren. Ihre Eltern kommen beide aus Kroatien, sind 1970 eingewandert und<br />
haben 1971 geheiratet. 1973 wird die erste der drei Töchter geboren. 1974 kommt Gordana<br />
und 1985 die jüngste Tochter der Familie zur Welt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Vater, der<br />
vorwiegend als Metzger arbeitet, Alleinverdiener. Ab 1985 arbeitet auch die Mutter, zunächst<br />
als Zimmermädchen, dann als Reinigungskraft.<br />
Als Gordana im Kleinkindalter ist, geht es der Familie wirtschaftlich recht gut. Sie macht dies<br />
an Kinderbildern und Erzählungen der Mutter fest, die berichtet, daß sie die Kinderkleider in<br />
Kinderboutiquen gekauft hat. Der Vater arbeitet zu dieser Zeit in einer Dauerstellung, die Art<br />
der Tätigkeit bleibt unklar. Dem schließt sich eine schlechte Phase an, in der der Vater<br />
wechselnde Jobs hat und recht wenig verdient. In Gordanas Kindergartenzeit (1978 bis<br />
1981) fällt eine familiäre Krise, die zur kurzzeitigen Trennung der Eltern und zum Auszug der<br />
Mutter <strong>mit</strong> den Kindern führt. Ob sie im Frauenhaus waren oder in einer anderen Einrichtung<br />
unterkamen, kann Gordana nicht mehr sagen. Die Familie bleibt jedoch nicht lange vom Vater<br />
getrennt. Die Zeit im Kindergarten scheint generell durch größere Unsicherheiten geprägt:<br />
Es kommt des öfteren vor, daß Gordana und ihre Schwester dort „vergessen“ werden oder<br />
daß die Mutter nicht zu Hause ist und die Kinder vor geschlossener Tür stehen (in einem<br />
Viertel, in dem es viele Drogenabhängige gibt). Es ist zu vermuten, daß schon zu dieser Zeit<br />
Alkoholmißbrauch auf seiten der Eltern vorliegt, über den Gordana in bezug auf spätere Lebensabschnitte<br />
offen berichtet. Noch vor der Einschulung zieht die Familie in ein anderes<br />
sogenanntes Arbeiterviertel in der Nähe um. Sie leben dort fortan (zunächst zu viert, dann zu<br />
fünft) in einer Zwei-Zimmer-Wohnung.<br />
5<br />
10<br />
= Textauszug 5. Zwischenbericht, Kapitel 3.3 und 3.2.; ausgewählt wurden zwei Jugendliche, die aus Multiproblemfamilien<br />
kommen; Erläuterungen zu Konzepten und Definitionen finden sich im nachfolgenden Kapitel dieser <strong>Arbeitsmappe</strong>; weitere<br />
Fälle, sowie Auswertungen und Interpretationen sind im 5. Zwischenbericht zu finden.<br />
6 Obwohl Gordana zur Gruppe der MigrantInnen zählt, ist ihr „Fall“ aufgrund der Problematik der familiären Verhältnisse in<br />
dieses Kapitel (Kinder aus Multiproblemfamilien) eingeordnet.
Der Vater bekommt zu dieser Zeit (Anfang der achtziger Jahre) eine Stelle als Metzger 7 in<br />
einem Familienbetrieb, die er bis zum Interviewzeitpunkt durchgehend innehat. Der Vater<br />
verdient dort (bis heute!) extrem wenig (heute: 1.300 DM netto). Zum Sozialamt gehen die<br />
Eltern nicht. Sogar das Kindergeld wird von den Eltern nie beansprucht. Hinzu kommt der<br />
Alkoholismus beider Eltern. Entsprechend lebt Gordana <strong>mit</strong> ihrer Familie lange Zeit in extremer<br />
Armut. Die finanzielle Situation der Familie ist zeitweilig so prekär, daß der Strom abgestellt<br />
und zu Hause oft kein Essen da ist. Kleidung und Wohnungsausstattung sind nur auf<br />
einem dürftigen Niveau vorhanden, es gibt bestenfalls gebrauchte Sachen (die nicht gepfändet<br />
werden können), Telefon hat die Familie nicht. Der Haushalt wird laut Gordana von der<br />
Mutter weitgehend vernachlässigt. Der Vater steht nach Arbeitsende meist am Kiosk und<br />
trinkt dort <strong>mit</strong> Bekannten, was für Gordana als Kind – außer der Tatsache, daß sie niemanden<br />
<strong>mit</strong> nach Hause bringen kann – das Schlimmste ist, denn sie wird im „Kiez“ von anderen<br />
auf sein öffentliches Trinken angesprochen. Die Eltern werden als „unfähig“, aber liebevoll<br />
beschrieben. Aggressivität und Schläge gibt es nicht. Der Vater ist fleißig, aber unfähig, sich<br />
zu wehren und sein Recht einzufordern.<br />
Gordana besucht die Grundschule im Stadtteil. Sie hat Freunde im näheren Umfeld, insbesondere<br />
eine gute Freundin. Diese ist die einzige, die die familiäre Situation halbwegs kennt.<br />
Vor anderen Außenstehenden wird alles – soweit möglich – geheimgehalten. Als sie etwa<br />
zehn Jahre alt ist, verschlimmert sich die Situation im Elternhaus: Die Mutter geht abends<br />
zumeist weg und kommt häufiger nachts nicht nach Hause. Kommt sie zurück, ist sie betrunken.<br />
Der Vater bleibt alleine <strong>mit</strong> seinen beiden Töchtern, die Angst davor haben, daß die<br />
Mutter sie ganz verlassen könnte. Diese lang andauernde Krise wird 1985 durch die erneute<br />
Schwangerschaft der Mutter beendet.<br />
Kurz nach der Geburt der jüngsten Schwester nimmt Gordanas Mutter erstmals selber eine<br />
Arbeit auf und verdient das dringend notwendige Geld hinzu. Die Beziehung der Eltern und<br />
das Familienklima bessern sich im folgenden. Die jüngste Tochter wird nun unter anderem<br />
von Babysittern und <strong>mit</strong> Hilfe der älteren Töchter betreut.<br />
Nach der vierten Klasse besucht Gordana eine Gesamtschule in einem anderen, aber nahegelegen<br />
Stadtteil. Schulische Probleme hat sie – wie schon in der Grundschule – zunächst<br />
keine. In der Pubertät, <strong>mit</strong> etwa vierzehn Jahren, kommt sie in eine „schwierige Phase“: Sie<br />
hat Kontakte zu kriminellen Jungen. Sie hängt <strong>mit</strong> diesen und ihrer Freundin zusammen herum,<br />
fährt in gestohlenen Autos <strong>mit</strong> und versteckt Diebesgut (Kleidung) für sie. Dies kommt<br />
schließlich heraus. Mit fünfzehn wird sie wegen Hehlerei zu sechzig Arbeitsstunden verurteilt,<br />
wovon ihre Eltern natürlich erfahren. Vor allem aus Scham vor den Eltern entfernt sie<br />
sich in der Folge aus diesem Kreis. Zur gleichen Zeit erfolgen der Schulwechsel in eine andere<br />
Gesamtschule, der jedoch im Interview nicht näher erläutert wird, und die Wiederholung<br />
einer Klasse. Nach dieser Phase schafft sie ohne größere Probleme ihren Realschulabschluß.<br />
7 Da nichts über eine Ausbildung des Vaters bekannt ist, handelt es sich wohl um eine Anstellung als Metzgergehilfe.<br />
11
Schon während der Schulzeit arbeitet Gordana nebenher (unter anderem Zeitung austragen,<br />
Aushilfe in einer Boutique). Nach Schulabschluß (1992) kommt eine Ausbildung für sie nicht<br />
in Frage: In der elterlichen Zwei-Zimmer-Wohnung sind infolge des Bürgerkrieges in Kroatien<br />
bis zu dreizehn (!) Personen untergebracht, und Gordana muß <strong>mit</strong> zum Haushaltsunterhalt<br />
beitragen. So arbeitet sie die folgenden beiden Jahre ganztags in einer Boutique. Sie verdient<br />
etwa 1.700 DM pro Monat netto, wovon sie etwa 1.000 DM für sich zur Verfügung hat.<br />
In der Boutique wird ihr relativ bald Verantwortung übertragen. Sie kann beispielsweise zu<br />
Messen im In- und Ausland <strong>mit</strong>reisen. Nach einigen Auseinandersetzungen <strong>mit</strong> dem (koksenden)<br />
Chef kündigt sie und ist zunächst fünf Monate arbeitslos. Gordana arbeitet aber<br />
„schwarz“ weiter. Dann findet sie eine neue Stelle, wiederum in einer Boutique. Etwa um<br />
diese Zeit beginnt Gordanas Beziehung zu ihrem heutigen Freund, einem Griechen aus der<br />
Nachbarschaft, den sie schon lange kennt. Nach fast drei Jahren, und nach Rückkehr der<br />
Verwandten, bemüht sich Gordana – nun schon zwanzigjährig – schließlich um einen Ausbildungsplatz.<br />
Ihr Freund und eine Sozialarbeiterin, die im nahen Jugendladen arbeitet, den<br />
Gordana schon lange kennt und besucht, (unter)stützen sie dabei. Nach nur wenigen Bewerbungen<br />
findet sie einen Ausbildungsplatz zur Einzelhandelskauffrau in einem größeren<br />
Wäschegeschäft (1995). Sie fühlt sich dort wohl und strengt sich an, so daß sie die Ausbildung<br />
um ein Jahr verkürzen kann und schon 1997 beendet. Bald danach zieht sie <strong>mit</strong> ihrem<br />
Freund zusammen in eine der elterlichen Wohnung nahegelegene Drei-Zimmer-Wohnung.<br />
Direkt im Anschluß an die Ausbildung wird sie Filialleiterin in einer kleinen, neu eröffneten<br />
Filiale ihres Ausbildungsbetriebes. Aufgrund des Auszugs und der da<strong>mit</strong> verbundenen hohen<br />
Ausgaben nimmt sie zusätzlich eine Putzstelle an, die sie erst Ende 1999 – kurz vor dem<br />
Interview – aufgibt. Gordana und ihr Freund, der als Marktleiter in einem Lebens<strong>mit</strong>telmarkt<br />
arbeitet, müssen weiterhin einen (allerdings überschaubaren) Kredit abbezahlen.<br />
Der Kontakt zu den Eltern und den Schwestern ist bis heute sehr gut. Alle wohnen „um die<br />
Ecke“. Gordana telefoniert täglich <strong>mit</strong> ihnen und organisiert viel für die Eltern. Sie und die<br />
älteste Schwester unterstützen die Eltern gelegentlich finanziell und schenken der kleineren<br />
Schwester die Sachen, die sie sich wünscht und nicht bekommen kann. Die Probleme der<br />
Eltern im materiellen Bereich und in bezug auf Alkohol usw. dauern an, sind aber – nicht zuletzt<br />
wegen der Unterstützung durch die beiden älteren Schwestern – nicht mehr so dramatisch.<br />
Insbesondere die Mutter habe gelernt, sich auch mal zu wehren und ihr Recht gegenüber<br />
Dritten (Personen und Institutionen) einzufordern.<br />
Die übrigen sozialen Kontakte Gordanas – also jenseits ihrer Familie, der ihres Freundes<br />
und des Freundeskreis ihres Freundes – sind begrenzt. Bislang hat sie wegen der beiden<br />
Jobs dafür wenig Zeit gehabt.<br />
Sie möchte gerne bald, in den nächsten zwei bis drei Jahren, heiraten und dann auch Kinder<br />
bekommen. Zuvor möchte sich das Paar (vor allem der Freund) noch einige Wünsche<br />
(Australienreise, Ferienhaus in Griechenland) erfüllen.<br />
12
2. Fallanalyse: Probleme, Problembewältigung und Fallstruktur<br />
a) Probleme und Problembewältigung in der Kindheit (bis etwa 13. Lebensjahr):<br />
„... Ich weiß nicht, was wir hätten tun sollen ...“<br />
Wie die einführende Falldarstellung nur ansatzweise beschreiben kann, hatten Gordana und<br />
ihre ältere Schwester eine wahrlich „bescheidene“ Kindheit. Gordana kommt schon in den<br />
ersten Minuten des Interviews auf die wesentlichen Probleme der Familie zu sprechen: „...<br />
Das war ’ne sehr schwere Zeit. Also es war dann auch so teilweise, daß, die konnten halt die<br />
Stromrechnung nicht bezahlen, wir dann wirklich auch ’ne Zeitlang ohne Strom gelebt haben.<br />
Natürlich im Verhältnis zu anderen Kindern, die dann schon ’n bißchen mehr hatten, war das<br />
schon doof. Also ich konnt’ mir nichts leisten ... Meine Mutter konnte uns nix kaufen. Es war<br />
dann auch so, daß ’n bißchen Alkohol <strong>mit</strong> im Spiel war, von beiden Eltern. Meine Eltern haben<br />
uns nie geschlagen oder so, aber ich nehme an, daß sie eben dadurch schon beide sehr<br />
viel getrunken hatten – mein Vater mehr, meine Mutter weniger, aber schon. Ich würde heute<br />
sagen, sie sind beide irgendwie so ’n bißchen alkoholsüchtig, auch wenn sie es so nicht zugeben.<br />
Und das war dann auch im Freundeskreis so – ich mein’, die, die uns kannten, die<br />
wußten dann auch, daß mein Vater immer am Kiosk steht. Und entsprechend war natürlich<br />
die Reaktion von anderen ... Wir war’n so ’n bißchen abgestempelt.<br />
Meine Schule war dann später ab der fünften Klasse in B. die G.-Schule. Und die kannten so<br />
mein Umfeld nicht, da war das immer ganz gut eigentlich. Aber so vom Lebensraum her<br />
ging’s uns eigentlich wirklich schlecht. Also manchmal waren wir wirklich froh, wenn wir mal<br />
Brot daheim hatten, weil meine Mutter hat nicht gearbeitet und die sind auch nie zum Sozialamt<br />
gegangen, weil die kannten sich ja überhaupt nicht aus ... Ich weiß nicht, ob sie zu faul<br />
waren, sich darüber zu kümmern, eigentlich gab es ja genug Möglichkeiten. Aber wir waren<br />
noch zu jung, meine Schwester und ich, und unerfahren. Und die wollten nich’. Und das ...<br />
war eigentlich so für mich die schlimmste Zeit ...“<br />
Obgleich der Mangel im hier beschriebenen Zeitraum absolut ist (das heißt kein Strom, kein<br />
Essen), stellt Gordana im Rückblick vor allem das schlechte Abschneiden der Familie im<br />
sozialen Vergleich als belastend dar. Sie schämt sich, daß sich ihre Familie nichts leisten<br />
kann: „Die konnten sich alles leisten. Wir hatten ja nichts.“ Das soziale Auffälligwerden ist<br />
auch in bezug auf den Alkoholkonsum der Eltern das Hauptproblem: „Wir war’n so ’n bißchen<br />
abgestempelt.“ Zwar hilft ihr der Schulwechsel in einen anderen Stadtteil ein wenig, da<br />
die Familie dort ja nicht bekannt ist, im Umfeld bleiben sie jedoch die abgestempelte Familie.<br />
Mit diesem Problem der Stigmatisierung (offene Armut und Alkoholprobleme der Eltern, vor<br />
allem des Vaters) und der sozialen Ausgrenzung (durch verhinderte Partizipation) muß sie<br />
umzugehen lernen.<br />
Noch bedrohlicher wird die Situation, als die Mutter eine Zeitlang sehr häufig weggeht: „...<br />
Also die schlimmste Zeit war wirklich, wo dann auch kein Strom war und meine jüngste<br />
Schwester noch nicht auf der Welt war ... Also das war so schlimm, das war für mich das<br />
schlimmste Erlebnis. Da war sicherlich Alkoholismus. Oder meine Mutter ist dann abends oft<br />
13
noch rausgegangen. Wir waren eigentlich noch viel zu jung, daß sie uns so alleine läßt. Mein<br />
Vater war dann ja eigentlich immer <strong>mit</strong> uns allein. Ich nehme an, daß sie so ein bißchen geflüchtet<br />
ist vor alledem, und versteh’ das heute ein bißchen. Aber es war schon schlimm zu<br />
seh’n, die Mutter geht abends weg, und der Vater sitzt daheim und paßt auf seine Kinder auf.<br />
Was weiß ich, wo, die ist Tanzen gegangen oder so. Und wir saßen halt daheim und haben<br />
eigentlich immer gebetet, hoffentlich kommt sie gleich. Und wenn sie dann noch mal ’ne<br />
Nacht nicht gekommen ist, war das schon ätzend.“<br />
Wie kann sie, als (kleines) Kind, <strong>mit</strong> diesen beiden Problemkomplexen – Armut/Ausgrenzung/Stigmatisierung<br />
und Angst vor Trennung – überhaupt umgehen? Es sind sowohl intrapsychische<br />
als auch aktionale Copingformen denkbar. Gordana könnte <strong>mit</strong> Armut und Ausgrenzung<br />
folgendermaßen umgehen:<br />
• Die Situation nach innen und außen verharmlosen/verleugnen (� „Abwehr“)<br />
• Flüchten und/oder aggressiv reagieren (� „Abwehr“/Flucht)<br />
• Sich zurückziehen, den Kontakt <strong>mit</strong> anderen meiden (� „Anpassung“)<br />
• Hilfe beziehungsweise Unterstützung von außen suchen, also selber aktiv werden, Verantwortung<br />
übernehmen (� „Meisterung“)<br />
Mit Blick auf die drohende Trennung könnten ihr besonders zwei Optionen zur Verfügung<br />
stehen, der Versuch,<br />
• Aufmerksamkeit zu erregen oder Hilfebedürftigkeit zu signalisieren und<br />
• eine besonders günstige/angenehme Situation zu Hause zu schaffen.<br />
Im folgenden wird anhand verschiedener Interviewstellen herausgearbeitet, wie Gordana<br />
tatsächlich (re)agiert hat.<br />
Zunächst fällt an ihren Formulierungen auf, daß sie die Lebensbedingungen und deren Folgen<br />
eher verharmlost, beispielsweise: „Natürlich im Verhältnis zu anderen Kindern, die dann<br />
schon ’n bißchen mehr hatten, war das schon doof.“ Sie benutzt regelmäßig sehr abmildernde<br />
Begriffe: „so ’n bißchen alkoholsüchtig“. Wahrscheinlich gelingt es ihr, die Situation nur<br />
über Verharmlosungen zu ertragen, um nicht in tiefe Verzweiflung oder in Handlungsunfähigkeit<br />
zu verfallen. Sie nimmt dabei ihre Eltern extrem in Schutz.<br />
Im Zusammenhang <strong>mit</strong> der für Gordana so dramatischen Phase, als ihre Mutter vor der<br />
häuslichen Situation und ihrer mütterlichen Rolle flüchtet und sich die Kinder (trotz des verbleibenden<br />
Vaters) alleingelassen fühlen, wird recht deutlich, was Gordana psychisch durchlebt<br />
hat: „... Du spielst halt dauernd da<strong>mit</strong>: hau ich ab, hau ich ab, hau ich ab. Das ist schon<br />
so wie bei andern Leuten auch, daß du sagst, du mußt da jetzt einfach raus, das gibt’s überhaupt<br />
nicht. Und man denkt dann immer: Wieso ist das bei mir so, ja? Wieso, was hab’ ich<br />
getan, daß ich so bestraft werde <strong>mit</strong> denen, ja? Oder: Warum tun sie das? Warum geht meine<br />
Mutter einfach abends weg ...? Aber andererseits denk’ ich mir, du kannst ja auch nicht<br />
14
alles stehenlassen, du weißt auch nicht wohin, du bist ja eigentlich viel zu ängstlich, um irgendwohin<br />
zu gehen ...“<br />
Gordana fühlt sich demnach schon früh verantwortlich für die Situation. Sie hat zwar auch<br />
Fluchtgedanken, weiß aber nicht wohin. Zumindest ex post verwirft sie diesen Gedanken<br />
aber nicht nur aufgrund fehlender Alternativen, sondern auch, weil man eben nicht alles stehenlassen<br />
kann.<br />
Welche alltäglichen Fluchtmöglichkeiten hat Gordana? „... Wir war’n alle den ganzen Tag<br />
irgendwo unterwegs, bei ’ner Freundin oder so, da hast du dann auch mal was Warmes gekriegt.<br />
Aber du hast es nicht erzählt. Willst nicht nach Hause, weil was willst’e zu Hause, sitzt<br />
ja doch nur im Dunkeln ...“ Oder: „... Freundinnen hatte ich eigentlich immer. Ich war jetzt nie<br />
so alleine oder so. Ich hatte auch, wie gesagt, ’ne Nachbarin hier, die vor ein paar Jahren<br />
ausgezogen ist. Also wir kennen uns vom Kindesalter, wirklich <strong>mit</strong> fünf, sechs Jahren. Und<br />
dann bist du halt zu ihr gegangen, weil das einfach meine Nachbarin war oder irgendwie<br />
Umgebung. Also hier, wo ich wohne, in dem Viertel, da gibt’s wirklich genug Leute, genug<br />
Kinder, die irgendwie rummachen. Und <strong>mit</strong> denen triffst du dich dann und gehst raus ...“<br />
Gordana (und ihrer Schwester) gelingt es durchaus, stundenweise von zu Hause zu flüchten.<br />
Sowohl auf der Straße als auch bei Freundinnen und Freunden zu Hause kann sie sich aufhalten<br />
und dort zum Teil ihre Basisversorgung sicherstellen. Gleichaltrige und deren Eltern<br />
stellen also eine wichtige soziale Unterstützung dar, die Gordana auch aktiv nutzt.<br />
Eine weitere Stütze ist ihre nur etwa eineinhalb Jahre ältere Schwester: „... Ja, wie haben wir<br />
uns da geholfen? Ja, eigentlich nur so, daß wir halt dann füreinander da war’n oder mal zusammen<br />
geweint haben ...“ Obgleich Gordana im Rückblick die Tatsache nicht besonders<br />
betont, daß sie zu zweit waren und so<strong>mit</strong> das Schicksal teilten, ist doch anzunehmen, daß<br />
gerade in der Zeit, als die Mutter oft abwesend war, die Anwesenheit der Schwester und ihre<br />
Gemeinschaft wichtig waren. Diese günstige innerfamiliale Konstellation, die Möglichkeit,<br />
sich im Leid zu verbünden, ist nicht zu unterschätzen.<br />
Aus Gordanas Sicht eindeutig positiv und entscheidend für die Besserung der häuslichen<br />
Situation ist die Geburt ihrer jüngsten Schwester: „... Und 1985, dann kam meine jüngste<br />
Schwester auf die Welt, und dann ist eigentlich alles auch ’n bißchen besser geworden <strong>mit</strong><br />
ihr. Das hat uns dann sehr geholfen, auch meiner Mutter. Ich mein’, die war schon Mitte<br />
dreißig zu der Zeit, und sie ist der Lebensinhalt meiner Eltern im Moment ... Meine Mutter ist<br />
dann so richtig arbeiten gegangen, direkt nach der Geburt, also zwei, drei Monate später hat<br />
sie dann als Zimmermädchen angefangen ...“<br />
Ohne konkret benennbares Bewältigungshandeln oder -verhalten von seiten Gordanas<br />
kommt es also 1984/85 durch Schwangerschaft und Geburt sowie anschließende Erwerbstätigkeit<br />
der Mutter zur Entschärfung der Krisensituation „Trennungsgefahr“.<br />
Das neue Kind „kittet“ offensichtlich die vorher gefährdete elterliche Beziehung, das Familienleben<br />
wird wieder sicher. Es ist besonders für die Mutter der Auslöser für eine grundle-<br />
15
gende Veränderung ihres Lebens und Handelns. Das Fluchtverhalten geht über in ein Annehmen<br />
der Situation und vor allem in die tatsächliche Übernahme elterlichen Verhaltens.<br />
Auch mag der Wunsch tragend gewesen sein, dem „neuen“ Kind bessere Lebensbedingungen<br />
zu bieten als den beiden älteren Töchtern. So scheint die sehr schnelle Arbeitsaufnahme<br />
der Mutter nach vielen Jahren zu Hause erklärbar zu werden. Hilfreich dürfte in bezug auf<br />
diese „ungewöhnliche“ Entscheidung gewesen sein, daß Gordana und ihre Schwester zu<br />
diesem Zeitpunkt bereits alt genug waren, ihr einen Teil der häuslichen Aufgaben abzunehmen.<br />
Über die Art und den Umfang der Aufgabenübernahme berichtet Gordana jedoch vorerst<br />
nichts.<br />
1985 entschärft sich die Situation für das Mädchen auch dadurch, daß sie von der Grundschule<br />
im eigenen Viertel in eine Gesamtschule in einem anderen Stadtteil wechselt, wo<br />
kaum einer ihre Familienverhältnisse kennt. Dies nimmt sie als positiv wahr, auch wenn sich<br />
dadurch im näheren Umfeld nichts Wesentliches ändert. Es ist unklar, ob es eine bewußte<br />
Entscheidung für eine entfernter gelegene Schule gibt oder durch wen die Entscheidung für<br />
die Schule gefällt wird.<br />
Die Kindheitssituation beschreibt die nachfolgende Interviewpassage sehr anschaulich: „...<br />
Wir haben das nach außen nicht so ausgetragen. Also wir haben bestimmt nicht irgendwo<br />
erzählt, uns geht’s schlecht, meine Mutter, die kümmert sich gar nicht. Sie hat uns geliebt,<br />
abgöttisch, ja. Aber irgendwie war sie einfach nicht in der Lage dazu, das irgendwie auszudingsen,<br />
auszufüllen, diese Pflichten alle. Aber das haben wir nie nach draußen getragen,<br />
das kam überhaupt nicht in Frage, um Gottes willen. Also der Gedanke allein, daß wir nicht<br />
bei unsern Eltern sind ... das wär’ dann der Untergang für uns alle gewesen. Unsere Eltern<br />
konnten uns weiß Gott nicht viel bieten, aber bestimmt haben sie uns geliebt, abgöttisch. Die<br />
haben uns auch nie geschlagen, wir haben nie Schläge gekriegt, nie. Und die haben uns<br />
auch nie was verboten oder so. Das käm’ überhaupt nicht in Frage. Und natürlich, ich bin<br />
schon überzeugt davon, daß die wissen, was sie für ’n Mist verbaut haben. Aber ich denk’<br />
halt, die waren selbst noch so hilflos, die waren wirklich selbst hilflos ...“<br />
Deutlich wird: Gordana erlebt in ihrer Kindheit schwache, unfähige, aber offensichtlich liebevolle<br />
Eltern. Diese klagt sie wohl zu keinem Zeitpunkt – auch heute nicht – für ihr Verhalten<br />
an. Trotz des Trinkens und vieler sonstiger Probleme ver<strong>mit</strong>teln die Eltern ihren Kindern offensichtlich<br />
ein ausreichendes Maß an Zuwendung, so daß diese an ihren Problemen nicht<br />
zerbrechen. Der Zusammenhalt zwischen den Eltern ist offensichtlich krisenhaft, aber stabil.<br />
Offenkundig wird auch, daß der Erziehungsstil der Eltern durch „Laisser-faire“ geprägt ist,<br />
so daß Gordana vieles selbst ausprobieren und selbst machen kann, was ihr nicht zuletzt<br />
Anerkennung – von seiten der Eltern und anderer – bringt.<br />
Zusammenfassend läßt sich in bezug auf die Probleme und die Problembewältigung<br />
während Gordanas Kindheit (bis zum Alter von etwa zwölf Jahren) folgendes festhalten:<br />
16
• Die Hauptbelastung in dieser Zeit stellen Ausgrenzung und Stigmatisierung durch Armut<br />
und offenen Alkoholismus dar. Die Hauptbedrohung entsteht durch die „Fluchtphase“ der<br />
Mutter, die bei Gordana Trennungs- beziehungsweise Verlustangst auslöst.<br />
• Sie ist aufgrund ihres Alters und der enormen Belastungen überfordert, aktiv ihre Situation<br />
zu meistern.<br />
• Ihr aktives Bewältigungshandeln konzentriert sich darauf, nach draußen zu gehen, die<br />
Familie beziehungsweise die Wohnung für bestimmte Zeit hinter sich zu lassen.<br />
• Weiterhin versucht sie, möglichst wenig über ihre Situation nach außen dringen zu lassen,<br />
um nicht noch weiter stigmatisiert zu werden und Gefahr zu laufen, ihre Eltern, die<br />
sie liebt, zu verlieren.<br />
• Die befürchtete Trennung von der Mutter als der schlimmsten Situation löst sich ohne<br />
Gordanas Zutun.<br />
Im Übergang zur Pubertät beziehungsweise Jugendphase ist die Situation im Elternhaus<br />
finanziell weiterhin prekär, aber durch die Berufstätigkeit der Mutter abgemildert. Der familiäre<br />
Zusammenhalt und da<strong>mit</strong> die Liebe beider Eltern ist durch das neue Kind stabiler und sicherer.<br />
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Gordana durch die jüngere Schwester.<br />
b) Probleme und Problembewältigung in der Jugend (bis etwa 21. Lebensjahr):<br />
„... Ich war immer so, immer so sich kümmern ...“<br />
„Der [Vater; B. H.], hat sich einfach nicht dadrum [Pässe/Aufenthalt; B. H.] gekümmert. Und<br />
meine Mutter auch nicht, ’ne ganze Zeitlang. Aber wie wir dann älter geworden sind, so fünfzehn,<br />
sechzehn, meine Schwester und ich, und dann ha’m wir das mal selbst in die Hand<br />
genommen, so daß ich meinen Paß gemacht habe und meinen Aufenthalt. Ging ja zu der<br />
Zeit auch nicht anders, wir mußten das ja auch machen, da wir beide dann auch gearbeitet<br />
haben. Ich glaub’, ich hab’ <strong>mit</strong> vierzehn das erste Mal Zeitungen ausgeteilt, weil ich mir dann<br />
auch endlich mal was leisten wollte. Die andern, die ha’m wirklich alles gehabt. Ich habe ’ne<br />
Freundin, die war ’n Einzelkind ...– die hat alles gekriegt, wirklich alles. Und wir haben immer<br />
dagestanden und ... gedacht, hm, so. Ich hab’ mir das auch gewünscht. Aber es war jetzt<br />
nicht so, daß ich eifersüchtig war oder gedacht hab’, oh, meine Eltern, die können mir nix<br />
kaufen. Es war nicht so, daß ich gesagt hab’, ihr seid schuld, ihr seid schuld, ihr seid schuld,<br />
daß wir jetzt so ’n Schicksal hatten oder so. Aber ich habe mir vorgenommen, daß, wenn ich<br />
mal älter bin, daß ich auf jeden Fall was erreichen will ...“<br />
Mit Gordanas Eintritt in die Pubertät wächst die Bedeutung sozialer Vergleichsprozesse,<br />
wachsen die materiellen Wünsche. Sie realisiert außerdem zunehmend, daß sie sich in vielen<br />
Dingen nicht auf die Eltern verlassen kann. Dies macht sie ihnen jedoch nicht zum Vorwurf.<br />
Sie entschuldigt deren Unfähigkeit, weil sie ihre Eltern liebt und ihnen keine Bösartigkeit<br />
unterstellen kann. Gleichzeitig kommt sie in ein Alter, in dem ihre eigenen Bewälti-<br />
17
gungsmöglichkeiten zunehmen. Es drängt sie zu eigener Aktivität, denn so wie die Eltern will<br />
sie nicht leben. Die Triebfeder ist, einmal selbst etwas mehr beziehungsweise etwas Besseres<br />
zu erreichen. So werden Gordana und die älteste Schwester zur „Bastion der Vernunft“ in<br />
der Familie. Insbesondere Gordana übernimmt die „brachliegende“ Verantwortung. Sie ist<br />
dazu einerseits gezwungen, andererseits stehen ihr über ihre Sozialisation in der deutschen<br />
Gesellschaft im Gegensatz zu ihren Eltern auch die nötigsten Kompetenzen zur Verfügung.<br />
Sie beherrscht die deutsche Sprache perfekt und hat – zumindest bis zur achten Klasse –<br />
auch schulisch keine Schwierigkeiten. So fällt es ihr nicht schwer, sich schon <strong>mit</strong> vierzehn<br />
Jahren einen Job zu suchen und Ämterangelegenheiten anzugehen. Sie sorgt also selber<br />
dafür, daß sie materiell „<strong>mit</strong>halten“ kann und existenzsichernde Dinge erledigt werden.<br />
„Ja, und in der achten Klasse bin ich dann das erste Mal, da kam die pubertäre Phase, da<br />
bin ich sitzengeblieben. Ich hatte dann auch ’n schlechten Freundeskreis, was alles so ein<br />
bißchen dazu beigetragen hat. Und da hatte ich irgendwie so ’n Deutschen, den ich auch von<br />
der Schule kannte, der hatte irgendwie ’n kriminellen Freund, irgendwie war’n sie dann beide<br />
kriminell. Aber ich fand das alles ganz toll, daß die so etwas machten. Ich persönlich hätte<br />
das nie gemacht ... Die haben, <strong>mit</strong> vierzehn, fünfzehn Jahren, schon Drogen genommen. Ich<br />
fand auch ganz toll, mich darum ein bißchen zu kümmern ... Ich hab’ mich immer mehr darum<br />
gekümmert, immer mehr <strong>mit</strong> denen zu irgendwelchen Drogenberatern zu rennen ... Vielleicht<br />
hab’ ich mir das so gesagt, vielleicht ist es auch daher, daß ich gedacht hab’, naja<br />
komm’, diesem Menschen mußt du helfen. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben.“<br />
Gordana ist in dieser Lebensphase keineswegs nur vernünftig, im Gegenteil: Sie fühlt sich<br />
angezogen durch ein Umfeld, das – im Gegensatz zu ihrem häuslichen – dadurch gekennzeichnet<br />
ist, recht gut zu wissen, wie man sich schnell und effektiv (materiell) besserstellen<br />
kann. Ihre beiden kriminellen Freunde sind aufregend, nicht so langweilig wie andere. Geklaute<br />
Klamotten, Autos und Drogen versprechen den Ausbruch aus der Welt des Elternhauses.<br />
Doch Gordana verfällt offensichtlich weniger dem Reiz des Ausbrechens und Davonschwebens,<br />
denn auch hier – wie bei ihren Eltern – fällt sie wohl recht schnell in die Rolle<br />
der „Sich-Kümmernden“, der Vernünftigen. Diese Rolle hat sie offensichtlich für sich akzeptiert<br />
und mehr und mehr zu eigen gemacht. Sie fährt zwar gerne mal im gestohlenen<br />
Auto <strong>mit</strong> und nimmt auch Hehlerware entgegen, schreckt aber (im Gegensatz zu ihrer beteiligten<br />
Freundin) vor den eigentlich kriminellen Handlungen und Drogen 8 zurück.<br />
Der Ausstieg aus diesem Umfeld erfolgt, als ihre Eltern von den illegalen Aktivitäten der<br />
Tochter erfahren: „... Und dann hat das mein Vater <strong>mit</strong>gekriegt. Also ich hab’ mich geschämt,<br />
zutiefst geschämt ... Ich wollte nie, daß meine Eltern denken, daß wir mal kriminell werden.<br />
Also ich hab’ mich sofort geschämt, und es war sofort klar, daß es überhaupt nie wieder vorkommt.<br />
Ich mußte ja damals auch ins Gericht, wir hatten ja auch Verhandlung gehabt. Das<br />
war ja noch schlimmer, daß ich ja diese Verhandlung hatte ... Und damals haben uns der<br />
Udo und die Petra schon betreut. Da ist der Udo auch <strong>mit</strong>gegangen und meine Mutter, zur<br />
8 Joints hat sie wohl auch <strong>mit</strong>geraucht. Im Gegensatz zu ihrer Freundin nimmt sie aber keine härteren Drogen.<br />
18
Verhandlung. Also ich hab’ mich sehr schlecht gefühlt, und ich hatte ’n ganz, ganz, ganz,<br />
ganz schlechtes Gewissen ...“<br />
Die hier von Gordana berichtete Enttäuschung der Eltern über ihr Verhalten belegt zweierlei:<br />
zum einen, daß diese sich an den geltenden Normen orientieren, und zum anderen,<br />
daß ihnen ihre Tochter und deren Werdegang auch wichtig ist. Sie selbst will aufgrund ihrer<br />
Liebe zu den Eltern diese keinesfalls enttäuschen und läßt deshalb recht schnell von diesem<br />
Umfeld ab. Auch könnte eine Rolle gespielt haben, daß die Familie und sie als Ausländer in<br />
Deutschland leben und Angst vor weiterreichenden Sanktionen haben. In dieser Phase erfährt<br />
Gordana professionelle Unterstützung: Udo und Petra sind zwei SozialarbeiterInnen<br />
in einem nahen Jugendladen, den sie oft besucht. Sie helfen ihr nicht nur im Zusammenhang<br />
<strong>mit</strong> der Gerichtsverhandlung. Der Jugendladen ist für sie und andere im Viertel eine wichtige<br />
Anlaufstelle: „... Das war eigentlich ganz schön. Also die Zeit <strong>mit</strong> Petra war eh immer ganz<br />
schön. Sind wir von der Schule da hin. Das ... Jugendhaus, das war so unser Abhängding.<br />
War immer schön gemütlich, und die zwei, der Udo und Petra, haben immer viel <strong>mit</strong> uns gemacht<br />
...“<br />
Gordana bekommt letztlich sechzig Arbeitsstunden auferlegt und verabschiedet sich aus<br />
diesem Umfeld. Auch das etwa zeitgleiche Sitzenbleiben wirft sie nicht weiter aus der Bahn.<br />
Nach einem Schulwechsel macht sie schließlich 1992, <strong>mit</strong> knapp achtzehn Jahren, ihre <strong>mit</strong>tlere<br />
Reife. Über die Phase zwischen dem 15./16. und 18. Lebensjahr berichtet Gordana wenig.<br />
Ihre ursprünglichen beruflichen Ambitionen bleiben im Interview ebenfalls im Hintergrund,<br />
nur nebenbei erwähnt sie, daß sie gerne Erzieherin oder Sozialarbeiterin geworden<br />
wäre. Beide Berufswünsche verwirft sie jedoch, da sie zu faul sei, „so lange auf die Schule<br />
zu gehen“. Es fällt jedoch auf, daß beide Berufe den „helfende Berufen“ zuzurechnen sind.<br />
Ihre gewohnte Rolle und ihr prägendes Copingmuster zeigen sich hier erneut.<br />
Letztlich macht die junge Frau keine Ausbildung, sondern geht Geld verdienen, oder besser:<br />
sie setzt ihre Erwerbstätigkeit fort. „... Da [1988, B. H.] habe ich angefangen, Zeitungen auszuteilen,<br />
und dann habe ich auch nicht mehr aufgehört zu arbeiten. Also das ist mir dann nie<br />
wieder passiert, daß ich kein Geld mehr hatte. Ich mußte ja dann auch meine Eltern unterstützen.<br />
1989 hat der Krieg in Kroatien angefangen, dann kamen die alle hierher, meine<br />
ganzen Verwandten. Da waren wir dann – wir ha’m nur ’ne Zweizimmerwohnung – dreizehn<br />
Leute. Dreizehn waren wir zu der Zeit, bestimmt ’n halbes Jahr. Also es war ’ne Katastrophe.<br />
Aber es ging halt zu dem Zeitpunkt nicht anders. Und dann konnte ich auch keine Ausbildung<br />
gleich anfangen, weil ich das Geld gebraucht hab’. Dann hab’ ich nach der Schule direkt<br />
gearbeitet ... Es kam überhaupt nicht in Frage <strong>mit</strong> der Ausbildung, weil wir hatten so viel<br />
Leute zu Hause. Meine Eltern konnten nicht für dreizehn Leute sorgen, die konnten kaum<br />
noch für sich sorgen. Und dann habe ich gearbeitet, hab’ natürlich schon gutes Geld verdient<br />
und das dann daheim halt aufgeteilt. Es war nicht so, daß die gesagt haben, Du mußt mir<br />
was geben oder so. Aber du siehst, wenn’s fehlt, was willst ’n da machen?“ Sie arbeitet<br />
„...als Verkäuferin in ’ner Boutique. Da hatt’ ich vorher schon ein Praktikum von der Schule<br />
aus gemacht. Und dann haben die mich behalten, mußt’ ich noch ’n halbes Jahr warten, bis<br />
ich wenigstens fünfzehn Jahre alt war. Dann konnte ich dort als Aushilfe arbeiten, erst mal<br />
19
übers Ostergeschäft. Aber dann haben die mich behalten, und so ging das halt. Dort hab’ ich<br />
gearbeitet, bis ich <strong>mit</strong> der Schule fertig war, nur als Aushilfe. Danach hab’ ich dort fest gearbeitet,<br />
zwei Jahre oder so. Als die zumachten, bin ich in ’ne andere Boutique gegangen ...“<br />
In diesem wie in vielen anderen Interviewausschnitten wird überdeutlich, daß Gordana finanzielle<br />
Sicherheit über alles geht. Aufgrund ihrer Erfahrung im Elternhaus faßt sie irgendwann<br />
den Entschluß: „Das passiert mir nie.“ So erarbeitet sie sich schon während der Schulzeit<br />
das, was sie braucht, um bei ihren Freunden und Bekannten bestehen zu können. Sie arbeitet,<br />
um der Familie bei der Versorgung der kriegsflüchtigen Verwandten zu helfen. Mit ihrem<br />
inzwischen voll entwickelten Verantwortungsgefühl und ihrer Rolle als „Macherin“ kann sie zu<br />
diesem Zeitpunkt nicht – wie es in ihrem Alter naheliegend, „normal“ wäre – nur oder zumindest<br />
nicht in erster Linie an sich denken. So ergreift sie die Gelegenheit, ihren Aushilfsjob in<br />
eine feste Stelle umzuwandeln. Dies bringt ihr nicht nur für sich mehr Geld als in einer Ausbildung,<br />
sondern stellt auch den Unterhalt der Verwandten <strong>mit</strong> sicher. 9 So werden ihr<br />
Wunsch nach Sicherheit und ihr Bedürfnis zu helfen befriedigt.<br />
Im Rahmen der Arbeit in der Boutique übernimmt Gordana trotz ihres jugendlichen Alters<br />
und der fehlenden Ausbildung bald erneut Verantwortung. So fährt sie auf Messen <strong>mit</strong> und<br />
kann selbständig Aushilfen einstellen. Von diesen wird sie jedoch oft enttäuscht, und auch<br />
<strong>mit</strong> ihrem Chef gibt es nach einiger Zeit Schwierigkeiten, so daß sie schließlich nach etwa<br />
zwei Jahren Festanstellung kündigt. Der folgende Interviewausschnitt gibt Auskunft über diese<br />
Zeit und die von ihr thematisierten Probleme: „... Also da hat dann mal ’ne Freundin bei<br />
mir gearbeitet, die kannte wiederum die Freundin, die hat dringend ’n Job gesucht. Und ich<br />
hab’ denen allen geholfen, ich durfte die ja auch einstellen, Aushilfen. Das war ganz gut, ich<br />
hatte also <strong>mit</strong> siebzehn ’n Riesenfreiraum gehabt in dieser Boutique, wo ich gearbeitet hab’<br />
... Fand ich schon ganz toll ... Da bin ich schon das erste Mal in meinem Leben verreist, da<br />
war ich also dann fünf Mal in London und in Paris und in Holland auf den Messen, und das<br />
war natürlich ganz toll für mich. Nur: Mein Chef war ’n Kokser, was sich irgendwann rumgesprochen<br />
hat. Dann hatte ich noch Aushilfen aus diesem Umfeld. Das waren Leute, die die<br />
Petra auch kannte, die auch zu ihr in die Streetwork gegangen sind. Und die haben ... mich<br />
beklaut und gedacht, ich seh’ das nicht. Das hat mich so enttäuscht. Ich hab’ denen ja wirklich<br />
geholfen, ja, die ha’m gesagt, wir brauchen ’n Job und kann ich nicht ... Ich hab’ immer<br />
gesagt, bitte, Leute, seht zu, daß ihr nix klaut und so, macht das nicht. Und ich stell’ euch<br />
ein, aber wenn ich euch dabei erwisch’. Ich verzeih immer alles, tut mir immer weh, wenn ich<br />
dann jemand rausschmeißen mußte. Und ich wußte ganz genau, die beklau’n mich. Und die<br />
ha’m mich beklaut, und ich hab’s mir <strong>mit</strong> angesehen. Da hab’ ich gedacht, dann hinterher –<br />
also es hat mich schon enttäuscht ... Und dann hab’ ich gesagt, nee. Der Laden war eh kurz<br />
vor’m Zumachen, der hatte noch nicht zugemacht. Da hab’ ich dann aber schon in ’ner anderen<br />
Boutique angefangen, weil ich mich da <strong>mit</strong> ’m Chef so ’n bißchen in die Haare gekriegt<br />
hab’. Und ich wollt’ dann auch nicht auf seine Macken reagieren ... wenn der auf Koks war,<br />
dann hat er da rumgebrüllt. Da hab’ ich gesagt, nee, also man kann sich ja alles bieten las-<br />
9 Sie hat wohl etwa 1.000 DM für sich und gibt etwa 700 DM der Familie.<br />
20
sen, aber das muß ich mir nicht bieten lassen, ist mir jetzt auch egal. Dann hab’ ich da aufgehört<br />
und war dann fünf Monate arbeitslos, wobei ich dann nebenbei ... schwarzgearbeitet<br />
hab’. Hab’ mir schon nebenbei Geld verdient, hatt’ das Arbeitslosengeld. War natürlich gut,<br />
hatte dann genug Geld. Und dann hab’ ich in ’ner andern Boutique was gekriegt ...“<br />
Ganz deutlich kommt auch hier wieder ihr Helferwille zum Tragen. Gordana nutzt ihren<br />
Handlungsspielraum weniger für sich als für andere. Dabei erfährt sie jedoch deutliche<br />
Enttäuschungen, sie wird ausgenutzt. Im Zusammenhang <strong>mit</strong> den Auseinandersetzungen <strong>mit</strong><br />
ihrem Chef beweist sie zum einen, daß sie nicht gleich davonläuft, sich schon eine Zeitlang<br />
einer schwierigen Situation stellt, zum anderen aber, daß ihre Toleranz – zumindest<br />
gegenüber Nicht-Familien<strong>mit</strong>gliedern – zwar lange, aber nicht unendlich währt: Sein<br />
Herumbrüllen kann und will sie irgendwann nicht mehr ertragen. So kündigt sie.<br />
An dieser Stelle sollen Gordanas Probleme und ihr Coping während der Jugendphase kurz<br />
zusammengefaßt werden:<br />
• Ein Hauptproblem bleibt die Bewältigung der materiellen Lage innerhalb der Familie und<br />
ihrer Begleiterscheinungen und Folgen im Vergleich zu anderen.<br />
• Ein weiteres wichtiges Handlungs- und Entscheidungsproblem stellt die Auseinandersetzung<br />
<strong>mit</strong> den abweichenden Normen und Verhaltensmustern ihrer Peergroup dar.<br />
• Sie übernimmt in ihrer Jugend in der Familie und außerhalb schnell mehr Verantwortung<br />
und sichert die finanzielle Existenzgrundlage der Familie <strong>mit</strong>.<br />
• Ihre eigene Entwicklung und die Ablösung von der Familie geraten dadurch in den Hintergrund.<br />
Dem Wohl der Familie und der finanziellen Sicherung ordnet sie alles unter:<br />
„Also ich leb’ bestimmt für alle anderen, nur nicht für mich.“ Ihr ist dies wohl nur selten<br />
bewußt.<br />
• Auch in anderen Kontexten (zum Beispiel in der Peergroup) zeigt sie nur sehr begrenzt<br />
jugendtypische Verhaltensweisen und Copingformen (zum Beispiel Rebellion, Flucht, ...).<br />
Anstatt „voll <strong>mit</strong>zumischen“ ist sie – wie zu Hause – diejenige, die sich kümmert und vernünftig<br />
ist. Normbrüche kommen zwar vor, werden aber, sobald die Eltern, ihre moralische<br />
Instanz, und das Gericht, die staatliche Kontroll-/Sanktionsinstanz, davon erfahren,<br />
sofort eingestellt.<br />
• Sie greift in dieser Phase aktiv und gerne auf professionelle Unterstützung zurück.<br />
Gordanas erfolgreicher eigener Beitrag zur Lösung der finanziellen Probleme in der Familie<br />
führt letztlich zu einer „gebremsten“ Adoleszenz und einer bis zum 21. Lebensjahr noch nicht<br />
erfolgten emotionalen und räumlichen Ablösung von der Familie.<br />
21
c) Probleme und Problembewältigung in der Ablösephase:<br />
„... Ich leb’ immer, daß meine Eltern ruhiggestellt sind und daß mein Freund zufrieden ist<br />
und daß es auf der Arbeit gut läuft ...“<br />
Erst <strong>mit</strong> der Zeit reift bei Gordana der Wille, eine Ausbildung zu machen: „... Und dann hab’<br />
ich gedacht, ja, Scheiße, so kannst du nicht bleiben, du mußt was tun. Ich hatte ’n Superjob,<br />
ich hatte es ehrlich, ich hatte so viel Geld eigentlich <strong>mit</strong> siebzehn ... Es war also schon viel<br />
Überwindung, diese Ausbildung zu machen. Aber ich hab’ mich dann doch überzeugen lassen<br />
von meinem Freund, jetzt eine zu machen.“<br />
Durch den Druck ihres Freundes sieht Gordana ein, daß sie etwas für sich tun muß, und<br />
verabschiedet sich widerwillig vom guten Einkommen. Es sind aber keine eigenen Karriereüberlegungen,<br />
die sie dazu bringen, <strong>mit</strong> 21 Jahren schließlich doch noch eine Ausbildung zu<br />
machen. Gordana reicht es eigentlich, ein sicheres, geregeltes Einkommen zu haben. Die<br />
schließlich gewählte Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel ist die naheliegendste und<br />
einfachste Option für sie, sie geht da<strong>mit</strong> kein Risiko ein, denn die Arbeit kennt sie schon. Die<br />
Ausbildungsstelle bekommt sie ohne größere Probleme: Petra, die ihr schon lange vertraute<br />
Sozialarbeiterin, inzwischen in der Streetwork arbeitend, hilft ihr bei den Bewerbungen. Auch<br />
an dieser Schwelle sucht sie professionelle Hilfe von außen. Die Stelle bekommt sie unter<br />
anderem – wie sie selbst betont –, weil ihr neuer Chef ein „Familienmensch“ ist, der ihre vorherige<br />
Erwerbstätigkeit und ihr Engagement für die (erweiterte) Familie während des Krieges<br />
positiv würdigt.<br />
Das eigentliche Minus im bisherigen Lebenslauf – <strong>mit</strong> 21 Jahren noch keine Ausbildung –<br />
wird dadurch aufgewogen. Der Chef bringt ihr Vertrauen entgegen, das sie im folgenden<br />
auch nicht enttäuscht: Sie engagiert sich und verkürzt sogar die Ausbildung um ein Jahr.<br />
Dafür wird sie am Ende der Ausbildung <strong>mit</strong> dem Angebot einer Filialleiterstelle belohnt.<br />
Nicht nur in bezug auf die Ausbildung, sondern auch in bezug auf den Auszug aus dem Elternhaus<br />
spielt ihr Freund eine größere Rolle: „... Und dann, wo ich dann <strong>mit</strong> meinem Freund<br />
zusammengekommen bin – wir kennen uns jetzt schon fünfzehn Jahre, aber wir sind jetzt<br />
seit fünf Jahren zusammen –, und er wollte dann auch gleich von zu Hause raus, irgendwie.<br />
Und ich wollte aber nicht von zu Hause raus, ich hatte so ’n bissel das Gefühl, wenn ich geh’,<br />
dann lasse ich meine Eltern so ’n bißchen im Stich. Ich wollt also gar nicht so mein eigenes<br />
Leben. Ich habe gedacht, ich müßte halt jetzt noch zu Hause ’n bißchen helfen. Wenn<br />
die das so halbwegs im Griff haben, dann kann ich raus ...“<br />
Gordana formuliert an dieser Stelle überdeutlich, daß ihr die Loslösung vom Elternhaus sehr<br />
schwerfällt, wenn nicht sogar unmöglich erscheint. Ihr muß nach all den Jahren klar sein,<br />
daß die Eltern ihr Leben nie richtig im Griff haben werden. Das Zitat zeugt auf der einen<br />
Seite von einem weiterhin großen Verantwortungsbewußtsein und großer Zuneigung zu den<br />
Eltern, auf der anderen Seite aber auch davon, daß sie noch nicht gelernt hat, sich abzugrenzen<br />
und ihr eigenes Leben zu leben. Nur auf Druck ihres Freundes zieht sie also 1997<br />
aus dem Elternhaus aus. Entgegen seinem Wunsch, eine Wohnung etwas außerhalb zu su-<br />
22
chen, bleiben sie auf Drängen Gordanas weiterhin im angestammten Viertel: Sie ziehen in<br />
eine Drei-Zimmer-Wohnung in die Nähe ihres Elternhauses: „... Ich bin heute wirklich stolz<br />
drauf, ja, wir haben hier die eigene Wohnung. Und wir haben alles, was hier in meiner Wohnung<br />
steht – wir haben ’ne sehr schöne Wohnung ..., das haben wir alles aus eigener Tasche<br />
bezahlt. Ich mein’, ich zahle den Kredit heute noch ab, so ist es nicht. Aber ich weiß, es<br />
ist alles mir, ja, und ihm. Und wenn meine Eltern kommen, und ich rede viel von meinen Eltern,<br />
so wichtig sind die mir, meine Eltern sind auch ganz, ganz stolz auf mich ...“<br />
Demnach bleibt der sehr enge Kontakt zu den Eltern auch nach dem Auszug bestehen. Sie<br />
telefonieren täglich. Ihre materielle und immaterielle Unterstützung der Eltern und der jüngeren<br />
Schwester reißen ebenfalls nicht ab. Grenzen erfährt die unbegrenzte Hilfsbereitschaft<br />
allenfalls durch die Anforderungen der beiden Jobs, die Gordana bis vor kurzem ausgeübt<br />
hat, und stellenweise durch Klagen des Freundes, dem diese engen Familienbande manchmal<br />
etwas viel werden.<br />
Insgesamt beschreibt Gordana die Beziehung zu ihrem Freund als harmonisch. Sie ergänzen<br />
sich in ihren Augen gut: „Der ist da immer ganz ruhig, während ich natürlich immer aus<br />
der Haut fahr’ und denk’, aach, nee.“ Obgleich er ruhig und durchaus lebenstüchtig ist (er ist<br />
immerhin Marktleiter!), scheint er doch vom Typ her so zu sein, daß Gordana ihre bewährten<br />
Copingkapazitäten des öfteren einsetzen kann: „... Er ist da immer so, das machen wir mal<br />
irgendwie, obwohl er gar nicht weiter drüber nachdenkt, so ein Kurzzeitdenker. Der denkt<br />
jetzt für jetzt, und was morgen ist oder auf langer Hinsicht so, das ergänzt sich dann, das<br />
mach’ ich dann. Aber er ist so. Ich hab’ da wirklich ’n guten Fang gemacht.“<br />
Weil sie in ihrer Beziehung des öfteren die „Macherin“ sein kann, bekommt sie auch hier die<br />
Bestätigung als „Sich-Kümmernde“. Dies zeigt sich gut in der Situation, als beide in eine dubiose<br />
„Time-Sharing“-Geschichte (Kauf von Hotelanteilen) hineinrutschen und einen Kaufvertrag<br />
unterschreiben: „... Hab’ ich gesagt, oh Scheiße. Hab’ ich gleich ... ’n Brief aufgesetzt.<br />
Wir wußten ja ganz genau, was wir da gemacht haben. Egal, was ist, es war auf jeden<br />
Fall falsch, und es kommt auf jeden Fall was nach. Also da gibt’s bestimmt noch Probleme.<br />
Da hab’ ich gleich ’ne Kündigung geschrieben, also diesen Widerruf ... Den hab’ ich geschrieben,<br />
bin gleich dienstags zur Rechtsberatung beim Amtsgericht gegangen und hab’<br />
gleich nachgefragt. Die haben mir dann gesagt, also normalerweise, wenn Sie das gleich<br />
abgeschickt haben, dann dürften Sie da keine Probleme haben. Aber wie ’s so ist, gab’s natürlich<br />
Probleme. Die wollten irgendwie 10.000 Mark von uns, 10.000 Mark – ich war in der<br />
Ausbildung. Von diesem Geld träume ich ja heute noch. Also, es kam ja überhaupt nicht in<br />
Frage. Hab’ ich gesagt, oh, Scheiße. Und da bin ich mal wieder zu Petra, die einzige Rettung,<br />
die da in der Nähe ist. Und wir ha’m geguckt, was machen wir ...“<br />
Aktiv wird also wieder Gordana. Unter Inanspruchnahme von professioneller Hilfe und der<br />
vertrauten Beraterin Petra gelingt es ihr, das Unheil in Form von Schulden gerade noch abzuwenden.<br />
Gordana stellt ihre Lebenstüchtigkeit erfolgreich unter Beweis. Gleichwohl kann<br />
sie kein autonomes Leben ohne Freund und Familie führen: „... Da war der [Freund; B. H.]<br />
zwei Wochen in Urlaub jetzt, das war ’ne Katastrophe für mich. Da war die Wohnung leer –<br />
23
konnte gar nicht hier bleiben, ich mußt zwei Wochen zu meinen Eltern zieh’n, weil ich nicht<br />
alleine bleiben konnte in dieser Wohnung hier. Es war schrecklich. Also absolut, ich kann<br />
nicht alleine sein. Ich kann tagsüber schon kaum alleine sein, ich muß dann irgendwie was<br />
wurschteln oder machen oder tun. Aber ganz alleine sein kann ich nicht ... Und zwar, wo der<br />
jetzt in Griechenland war, da mußt’ er <strong>mit</strong> seinem Vater was regeln ... da mußten entweder<br />
meine Geschwister hier schlafen, oder ich mußte da so weggehen. Ich war überhaupt nicht<br />
in der Lage dazu, hier alleine zu schlafen. Das geht nicht.“<br />
Die Stärke Gordanas ist also gepaart <strong>mit</strong> Schwäche: Der Preis für das Sich-Kümmern und<br />
Agieren scheint zu sein, daß sie <strong>mit</strong> sich alleine nicht zurechtkommt, nicht alleine sein kann.<br />
Ein Grund dafür könnte in der unbewältigten Trennungsangst liegen, einem Charakteristikum<br />
in ihrer Kindheit.<br />
Die junge Frau möchte gerne (möglichst in den nächsten zwei bis drei Jahren) heiraten und<br />
dann Kinder bekommen. Eigene Kinder sind ihr sehr wichtig: „Das ist die Erfüllung meines<br />
Lebens, und mehr brauch’ ich nicht.“ Bis dahin möchte sie ihre jetzige Stelle behalten und<br />
sich zusammen <strong>mit</strong> ihrem Freund einige (materielle) Wünsche erfüllen.<br />
3. Fallbewertung<br />
Gordana ist erfolgreich der Armut ihres Elternhauses entronnen. Sie ist vorwiegend aktiv, <strong>mit</strong><br />
eigener Kraft und nur punktueller Unterstützung von außen, durch alle bisherigen Probleme<br />
gegangen.<br />
Eine wichtige Voraussetzung dieses erfolgreichen Bewältigungshandelns war die allen Widrigkeiten<br />
zum Trotz gute Eltern-Kind-Beziehung, die (bei aller „Unfähigkeit“) glaubhaft ver<strong>mit</strong>telte<br />
Liebe der Eltern zu ihren Kindern.<br />
Aufgrund ihrer Ausbildung und Berufserfahrung scheint Gordana keinen außergewöhnlichen<br />
Risiken, jenseits der „normalen“, ausgesetzt zu sein. Das Risiko, daß sie beziehungsweise<br />
ihre zukünftige eigene Familie in Armut abrutscht, scheint eher gering. Sollte sich die familiäre<br />
Situation durch Kinder oder aus anderen Gründen deutlich verschlechtern, würde Gordana<br />
<strong>mit</strong> ziemlicher Sicherheit ihre ganze Kraft dazu verwenden, eine materiell akzeptable und<br />
sichere Situation zu schaffen.<br />
Problematisch erscheinen Gordanas extrem enge Familienbindung, ihre nur beschränkt entwickelte<br />
Autonomie und das offensichtlich zumindest unterschwellig vorhandene Gefühl,<br />
ausgenutzt zu werden. Sie lebt zu sehr für andere und ist zu wenig eigeninteressiert. Auch<br />
wenn aktuell hierdurch keine größeren Probleme existieren, so liegt darin doch eine latente<br />
Gefahr für die Stabilität ihrer Person und ihres Lebens.<br />
24
Tab. 1: Zusammenfassende Übersicht (Gordana)<br />
1. Besondere Bewältigungsaufgaben, Ressourcen und Coping in der Kindheit<br />
Bewältigungsaufgaben<br />
(Belastungen und Probleme)<br />
• (Extreme) Armut<br />
• Ausgrenzung und Stigmatisierung<br />
• Trennungs- und Verlustangst<br />
(phasenweise)<br />
Ressourcen/positive Einflüsse Copingstrategie<br />
• Liebe der Eltern, gutes Eltern-<br />
Kind-Verhältnis<br />
• Fast gleichaltrige Schwester als<br />
Bündnispartnerin<br />
• Viele Kinder im Umfeld, gute<br />
soziale Kontakte<br />
• Geburt der kleinen Schwester/<br />
des „Kittkindes“<br />
2. Besondere Bewältigungsaufgaben, Ressourcen und Coping in der Jugend<br />
Bewältigungsaufgaben<br />
(Belastungen und Probleme)<br />
• Sicherung der materiellen Existenz<br />
• Sicherung der sozialen Teilhabe<br />
• Abweichende Normen und Verhaltensmuster<br />
in der Peergroup<br />
• Geheimhalten/verdecken der<br />
Probleme<br />
• Zusammenhalten<br />
• Verharmlosung<br />
Ressourcen/positive Einflüsse Copingstrategie<br />
• Mutter wird aktiver, lebenstüchtiger<br />
• Gutes Eltern-Kind-Verhältnis<br />
• Eltern als „funktionierende moralische<br />
Instanz“<br />
• Handlungskompetenz<br />
• Jugendladen als Anlaufstelle,<br />
feste Kontaktpersonen<br />
3. Bewältigungsaufgaben, Ressourcen und Handlungsmuster in der Ablösephase<br />
Bewältigungsaufgaben<br />
(Belastungen und Probleme)<br />
• „Absprung“ von der angelernten<br />
Tätigkeit<br />
• „Absprung“ von zu Hause<br />
• Materielle Absicherung der<br />
Haushaltsgründung<br />
• Auf die Straße/zu anderen gehen<br />
� zeitweilige Flucht<br />
• Aktiv werden (u. a. früh selbst<br />
Geld verdienen)<br />
• Sich selbst kümmern<br />
• Übernahme von Verantwortung<br />
• Eigene Entwicklung/Wünsche<br />
zurückstellen<br />
• Verharmlosen?<br />
Ressourcen/positive Einflüsse Handlungsmuster<br />
• Freund/Partner als treibende<br />
Kraft<br />
• Sozialarbeiterin als kompetente<br />
Vertrauensperson<br />
• Verständnisvoller Arbeitgeber<br />
• Hohe Eigenaktivität in bezug auf<br />
materielle Absicherung<br />
• Die Vernünftige, Sorgende bzw.<br />
Sich-Kümmernde sein<br />
• Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse<br />
• Wenig Bemühungen um Abgrenzung/Autonomie,Weiterentwicklung<br />
nur durch Anstoß von<br />
außen<br />
• Klare und realistische Zukunftsplanung<br />
25
Peter ���� „Erfolg“ durch Konsequenz?<br />
„... Ich hab’ das halt immer sehr konsequent durchgezogen ...“<br />
1. Fallbeschreibung<br />
Peter ist zum Zeitpunkt des Interviews 27 Jahre alt (1972 geboren). Er lebt in B., einer <strong>mit</strong>telgroßen<br />
Stadt am Rande eines Ballungsgebietes in Westdeutschland, und arbeitet als Laborassistent<br />
in einem Umweltlabor. Er wohnt <strong>mit</strong> einem Freund zusammen in einer Wohngemeinschaft<br />
im Zentrum von B.<br />
Bis zu seinem fünfzehnten Lebensjahr lebt Peter <strong>mit</strong> seiner Familie in A., einer nahegelegenen<br />
Großstadt. Er wächst zunächst <strong>mit</strong> vier älteren Halbgeschwistern, die jeweils andere<br />
Väter haben, und seiner alleinerziehenden Mutter auf (vgl. auch Abbildung 4). Die Mutter ist<br />
Hausfrau; die gesamte Familie lebt von Sozialhilfe. Seinen leiblichen Vater sieht er in den<br />
ersten Jahren regelmäßig, dieser lebt aber nie in der Familie. Über die Schul- und Ausbildung<br />
seiner Eltern ist nichts bekannt. Die Familie zieht in A. öfters um, in „einfache“ Wohngegenden<br />
<strong>mit</strong> vielen Sozialwohnungen.<br />
Abb. 4: Familiäre Konstellation bis zu Peters 7. Lebensjahr (1979)<br />
Gabi P. (1960 geb.),<br />
Peters Halbschwester<br />
außerhalb des Haushalts lebend<br />
26<br />
jeweils unterschiedliche Väter<br />
Paul P. (1963 geb.),<br />
Peters Halbbruder<br />
Frau P. (1940 geb.),<br />
Peters Mutter<br />
Sabine P. (1967 geb.),<br />
Peters Halbschwester<br />
Uschi P. (1969 geb.),<br />
Peters Halbschwester<br />
Peter P. (1972 geb.)<br />
Herr L. (ca. 1935 geb.),<br />
Peters leiblicher Vater
Als Peter etwa sieben Jahre alt ist (1979), zieht ein neuer Partner der Mutter in den Haushalt.<br />
Dieser bringt zwei eigene Kinder in Peters Alter <strong>mit</strong> in die Familie. Etwa zu dieser Zeit<br />
zieht die älteste Stiefschwester aus, da sie volljährig ist. Zeitweilig leben sechs Kinder im<br />
Haushalt. Der Kontakt <strong>mit</strong> Peters leiblichem Vater reißt zu dieser Zeit ab.<br />
Der Stiefvater ist gelernter Werkzeugmacher, arbeitet aber als Lkw-Fahrer für einen Getränkemarkt.<br />
10 Er ist Alkoholiker und sehr gewalttätig. Infolge der heftigen Auseinandersetzungen<br />
<strong>mit</strong> dem Stiefvater gehen nach und nach die älteren Geschwister Peters aus dem Haus beziehungsweise<br />
wechseln in Heime, so daß er als einziges Kind seiner Mutter im Haushalt<br />
übrigbleibt. 1985, als Peter dreizehn Jahre alt ist, kommt die Tochter seiner jüngsten, erst<br />
sechzehnjährigen Halbschwester hinzu, die die Mutter fortan betreut (vgl. Abbildung 5).<br />
Abb. 5: Familiäre Konstellation Peters zwischen 7. und 15. Lebensjahr (ab Einzug Stiefvater, 1979<br />
bis 1987)<br />
Gabi P. (1960 geb.),<br />
Peters Halbschwester<br />
Paul P. (1963 geb.),<br />
Peters Halbbruder<br />
Sabine P. (1967 geb.),<br />
Peters Halbschwester<br />
nach und nach Auszug/Weggang in Heime (Zeitpunkt(e) unklar)<br />
Frau P. (1940 geb.),<br />
Peters Mutter<br />
Klaus Z. (1971 geb.),<br />
Peters Stiefbruder<br />
Jutta Z. (1974 geb.),<br />
Peters Stiefschwester<br />
Uschi P. (1969 geb.),<br />
Peters Halbschwester<br />
Peter P. (1972 geb.)<br />
Herr Z. (ca. 1942 geb.),<br />
Peters Stiefvater<br />
Silvia P. (1985 geb.),<br />
Peters Nichte<br />
Für den Teenager ist die Situation immer unerträglicher. Mit fünfzehn Jahren schließlich eskaliert<br />
der Streit <strong>mit</strong> dem Stiefvater, und Peter verläßt von sich aus die Familie. Nach einer<br />
kurzen Übergangslösung geht er in ein Heim nach B., wo er schnell Freunde findet und sich<br />
gut einlebt. Er besucht nun nicht mehr die Gesamtschule, sondern eine Realschule. Im Anschluß<br />
an die <strong>mit</strong>tlere Reife beginnt Peter eine Ausbildung als Gas-Wasser-Installateur.<br />
Nach der Ausbildung zieht er aus dem Heim aus in eine eigene Wohnung. Er arbeitet weiterhin<br />
bei seiner Ausbildungsfirma, macht Zivildienst und kehrt in seine Ausbildungsfirma zurück.<br />
1998 zieht er <strong>mit</strong> einem Freund zusammen. 1999 wechselt er aus verschiedenen<br />
10 Als die Mutter ihn (per Briefkontakt) kennenlernt, sitzt er gerade im Gefängnis. Der Grund für seine damalige Haftstrafe ist<br />
unklar.<br />
27
Gründen den Arbeitsplatz und Arbeitsbereich und arbeitet seither als angelernte Kraft in einem<br />
Umweltlabor.<br />
2. Fallanalyse: Probleme, Problembewältigung und Fallstruktur<br />
a) Probleme und Problembewältigung in Kindheit und früher<br />
15. Lebensjahr):<br />
Jugend (bis etwa<br />
„... Ich hab’ eben versucht, das so lang wie möglich aufzuhalten, und dann bin ich halt<br />
gegangen ...“<br />
„Ich bin geboren in A. und hab’ da bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr gelebt, bis<br />
eben ich nicht mehr <strong>mit</strong> meinem Stiefvater klarkam. Um die Familienverhältnisse zu<br />
klären, ist es halt so: Ich hab’ fünf Geschwister, sind auch alle nacheinander so in<br />
Heime gegangen wegen meinem Stiefvater. Und ich hab’ eben versucht, das so lang<br />
wie möglich aufzuhalten. Und es ging dann nicht mehr, es ist dann eskaliert. Ich hab’<br />
dann ’ne Auseinandersetzung <strong>mit</strong> meinem Stiefvater gehabt und hab’ dann meiner<br />
Mutter als Bedingung gestellt, entweder geht er oder ich geh’. Und ich bin dann halt<br />
gegangen.“<br />
Soweit Peters Zusammenfassung seiner ersten fünfzehn Lebensjahre in der Familie. Es wird<br />
deutlich, daß diese wichtige Zeit durch die Erfahrung des „Eindringens“ des Stiefvaters in die<br />
Familie und durch den Weggang der (älteren) Geschwister geprägt ist. Gleichwohl erlebt er<br />
die erste Hälfte seiner Kindheit, die ersten sieben Lebensjahre zu Hause ganz anders: „... Ich<br />
muß sagen, an die Zeit davor kann ich mich nur sehr dunkel erinnern. Da war halt kein Mann<br />
im Haus, aber uns ging’s eigentlich so weit ganz gut, muß ich sagen. Und wir hatten auch<br />
nicht so diese familiären Probleme. Also da war der familiäre Zusammenhalt wesentlich besser<br />
als in der Zeit, wo mein Stiefvater dann in die Familie gekommen ist.“<br />
Peter lebt in dieser Zeit alleine <strong>mit</strong> der Mutter und seinen fünf Halbgeschwistern, die familiäre<br />
Situation ist eher unproblematisch. Sein leiblicher Vater kommt regelmäßig zu Besuch. 11 In<br />
jedem Falle erlebt er in den ersten Lebensjahren sowohl zu seiner Mutter und bedingt auch<br />
zu seinem Vater ein stabiles Verhältnis. Da keine kleineren Geschwister mehr nachkommen,<br />
findet er als Jüngster ausreichend Aufmerksamkeit, zumal die Mutter anscheinend – inzwischen<br />
fast Mitte 30 – in eine Phase eingetreten ist, die weniger von wechselnden Beziehungen,<br />
sondern durch den Status der Alleinerziehenden geprägt ist. Die Grundversorgung der<br />
Kinder und die Mutter-Kind(er)-Beziehung scheinen gut zu sein.<br />
Dann (1979) aber tritt der (spätere) Stiefvater ins Leben der Familie ein, und aus der Sicht<br />
Peters und der anderen Kinder verändert sich die Situation dramatisch zum Schlechten:<br />
„Das Problem <strong>mit</strong> dem Stiefvater war einfach nur, daß er Alkoholiker war. Und er hat auch<br />
’ne kriminelle Ader gehabt, sag’ ich mal. Der hat ’n paar Jahre eingesessen, und durch Brief-<br />
11 Es ist unklar, ob auch zu den Vätern der Geschwister Kontakt besteht.<br />
28
kontakt hat meine Mutter den Mann kennengelernt. Und der wurde dann Freigänger und kam<br />
dann am Wochenende zu uns. Das hat mir eigentlich schon damals, sieben oder sechs Jahre<br />
alt, ... gar nicht so gepaßt. Also ich hatte schon irgendwie so das Gefühl, daß das nicht<br />
der Richtige ist. Er hat mich dann auch schon, da war er noch gar nicht in die Familie aufgenommen,<br />
da hat er schon angefangen, da hab’ ich schon die erste Ohrfeige kassiert. Ich<br />
hab’ dann vieles über mich ergehen lassen. Der Stiefvater hatte dann auch im Laufe der Zeit<br />
seine anderen beiden Kinder noch <strong>mit</strong> in die Familie gebracht ... Mein Stiefbruder und meine<br />
Stiefschwester, die wurden häufig von meinem Stiefvater verprügelt, also richtig drastisch<br />
und heftig verprügelt <strong>mit</strong> der Faust und <strong>mit</strong> der flachen Hand und getreten, und ganz abartige<br />
Sachen sind da vorgefallen. 12 Und ich muß sagen, meine Mutter ist immer bei mir dazwischengegangen,<br />
also ich hab’ eigentlich immer am wenigsten abbekommen, wobei ich nicht<br />
unbedingt sagen kann, daß es mir seelisch dann besser ging. Also es war schon ’ne harte<br />
Zeit. Es ging sieben Jahre lang. Es ging mal zwei Monate gut, und dann hat er wieder angefangen<br />
zu trinken, und dann war wieder dasselbe in Grün. Ja, und meine Geschwister sind<br />
dann so langsam, nach und nach, jeder aus ’m Haus gegangen, weil sie es einfach nicht<br />
mehr auf die Reihe gekriegt haben, weil er hat auch versucht, meine Geschwister zu vergewaltigen.<br />
Und, ja, hat auch wohl ein oder zwei von meinen Geschwistern vergewaltigt, daß<br />
es dann auch zur Anklage kam und Gerichtsverfahren und so. Also er hat dafür schon seine<br />
Strafe bekommen. 13 Wobei Strafe natürlich eigentlich nicht ausreicht. Und, ja, ich hab’ dann<br />
bis zum Schluß ausgehalten ... bis zum bitteren Ende, bis es wirklich nicht mehr ging.“<br />
Der Alkoholismus des Stiefvaters macht das häusliche Leben für alle – besonders für Peters<br />
ältere Schwestern und seine eigenen Kinder (!) – zur Hölle. Die Mutter versucht zwar das<br />
Schlimmste, insbesondere ihrem Jüngsten gegenüber, zu verhindern, ist aber wohl relativ<br />
hilflos. Auch sie erhält Schläge. Aus dem Weggang der ersten Kinder aus der Familie, die<br />
zum Teil in Heime wechseln, zieht die Mutter keine Konsequenzen. Für Peter verschlimmert<br />
sich die häusliche Situation zunehmend: Es gibt immer weniger potentielle Verbündete, da<br />
die Geschwister weniger werden, und ebenso weniger potentielle Sündenböcke, die vor ihm<br />
die Aggressionen des Stiefvaters abbekommen.<br />
Die finanziell beengte Situation der Familie rückt angesichts dieser Situation eher in den<br />
Hintergrund. Peter erlebt die materiellen Einschränkungen als wenig dramatisch: „... Meine<br />
Mutter hat Sozialhilfe empfangen. Und ja, es war so, ... man hat die Sachen von den Geschwistern<br />
aufgetragen, wie es auch früher eigentlich üblich war. Und ist ja auch eigentlich<br />
nix gegen zu sagen. Aber wenn man dann andere Klassenkameraden sah, dann war man<br />
schon irgendwie benachteiligt. Es war nicht immer so viel möglich, wenn es jetzt zum Beispiel<br />
auch um Schulausflüge oder Klassenfahrten ging, weil man mußt’ wirklich aufs Geld<br />
12 Der Stiefbruder gerät ebenfalls auf die schiefe Bahn, indem er unter anderem Autos aufbricht, stiehlt usw. Er kommt <strong>mit</strong><br />
rund siebzehn Jahren in Untersuchungshaft und begeht Selbstmord. Peter kommentiert dies so: „... Also der hat auch keinen<br />
Ausweg mehr irgendwie gefunden, weil ja vom Vater eigentlich nix kam ... Und der hat’s halt meistens abbekommen,<br />
wenn irgendwas war.“<br />
13 Der Stiefvater ist vor einigen Jahren im Gefängnis verstorben, was Peter <strong>mit</strong> den Worten formuliert: „... dann meine anderen<br />
beiden Schwestern, eine oder beide, vergewaltigt hat. Ja gut, das eine kam dann sogar vor Gericht. Dafür hat er jetzt auch<br />
noch eingesessen und ist zum Glück im Knast verreckt. Also, so empfind’ ich’s halt.“<br />
29
gucken ... Ich durft’ schon <strong>mit</strong>, das wurde dann auch unterstützt vom Jugendamt. Da war<br />
dieser Herr D., der hat sich auch sehr für unsere Familie eingesetzt. Dann wurden Zuschüsse<br />
beantragt, wie das so läuft in diesem sozialen Umfeld ... Da<strong>mit</strong> hatte ich auch eigentlich<br />
nicht so ’n Problem. Nur wenn man dann mal zur Klassenfahrt aufgefordert wurde, es wurd’<br />
ja immer geplant für alle, und dann waren’s fünfhundert Mark oder so, und jeder legt die<br />
Kohle einfach locker auf ’n Tisch, und wir mußten da teilweise rumkrebsen, daß wir die Kohle<br />
dann zusammengekriegt haben. Und meine Mutter hat dann auch noch nebenher geputzt<br />
und was man noch so machen kann, um einfach noch nebenher ’n bißchen Geld zu verdienen.<br />
Ja, das war die familiäre finanzielle Situation.“<br />
Im Gegensatz zu ihren familiären Beziehungsproblemen kann Peters Mutter <strong>mit</strong> finanziellen<br />
Engpässen und Problemen wohl gut umgehen. Mögliche sozialstaatliche Hilfen werden in<br />
Anspruch genommen, das Haushaltsbudget wird bei Bedarf <strong>mit</strong> Putzjobs aufgebessert. Auf<br />
diese Weise hält sich der materielle Mangel in Grenzen. Außerdem ist zu beachten, daß im<br />
Umfeld von Peter weitere Kinder beziehungsweise Familien in ähnlicher sozialer Lage leben,<br />
so daß das Leben von Sozialhilfe und <strong>mit</strong> geringen Mitteln keine Besonderheit darstellt.<br />
Die Beziehung zur Mutter beschreibt Peter als gut. Sie kümmert sich zwar nicht allzu sehr<br />
um die Kinder und kann beispielsweise wenig schulische Unterstützung bieten, sie ist aber<br />
eine zuverlässige, wenn auch schwache Verbündete und verkörpert einige grundsätzliche<br />
Werte: „... Ja, und so jetzt vom Schulischen her, wie gesagt, konnte meine Mutter mir und<br />
meinen Geschwistern weniger helfen. Aber so halt, daß man ehrlich ist und aufrichtig und<br />
nicht kriminell werden muß, um irgendwie weiterleben zu können – also das hat sie schon<br />
irgendwie so ver<strong>mit</strong>telt, daß man ’s eben nicht braucht.“ Und weiter: „... Mein Verhältnis [zu<br />
meiner Mutter; B. H.] war eigentlich immer gut. Wir hatten nie Probleme, ich konnte eigentlich<br />
immer machen, was ich wollte. Es kam aber auch daher, daß ich eigentlich sehr zuverlässig<br />
bin und auch sehr überlegt immer handele ... Ja, ich lieb’ meine Mutter, und das war<br />
damals auch so, sonst hätt’ ich’s auch nicht so lang dort ausgehalten, weil die Angst war ja<br />
auch immer da, daß er mich schlägt.“<br />
Der von ihr praktizierte Erziehungsstil, ihr Laisser-faire, wirkt sich in Peters Fall offensichtlich<br />
nicht negativ aus. Er ist schon früh „vernünftig“. In der Schule wählt er den Mittelweg, den<br />
Realschulzweig. Er hat keine schulischen Schwierigkeiten: „... hatte ich keine Probleme. Also<br />
das hab’ ich eigentlich auch immer ganz gut trennen können, daß ich privat und Schule oder<br />
Beruf immer getrennt hab’. Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Und war kein Spitzenschüler,<br />
aber ich hab’ meine <strong>mit</strong>tlere Reife dort auch, hätte meine <strong>mit</strong>tlere Reife dort auch<br />
<strong>mit</strong>telmäßig bestanden.“<br />
Nur die Kontaktaufnahme <strong>mit</strong> Gleichaltrigen macht ihm in dieser Zeit Probleme. Durch häufigere<br />
Umzüge und seine eher scheue, zurückhaltende Art ist er nach seinen eigenen Worten<br />
eher Einzelgänger. In der Schule ist er jedoch kein Außenseiter: „... Ich muß sagen – um<br />
jetzt mal als Beispiel zu bringen –, ich bin im Sport nicht immer als letzter ausgesucht worden<br />
... ich war immer einer der ersten. Also ich war eigentlich nie unbeliebt oder so. Und ich<br />
30
denk’ mal, das war auch wohl etwas, was mir Selbstbewußtsein gebracht hat und mich da<br />
auch bestärkt hat.“<br />
Peter gelingt es offenbar die ganze Zeit über recht gut, nicht außerhalb der Familie seinen<br />
Frust abzubauen, und wird dort wohl auch nicht auffällig. Vielmehr lernt er, „auszuhalten, bis<br />
es nicht mehr geht“, „dicht zu machen“ und sich um sich selbst und seine Angelegenheiten<br />
zu kümmern. Später, als Jugendlicher, richtet er seinen Zorn direkt gegen den Aggressor,<br />
seinen Stiefvater. Dies macht das folgende Zitat sehr gut deutlich: „... Und die letzten zwei<br />
Jahre zu Hause waren auch so, wenn mein Stiefvater gekommen ist, dann hab’ ich immer ’n<br />
aufgeklapptes Messer gehabt, immer. Das war schon ganz schön hart.“<br />
Eines Tages, Peter ist <strong>mit</strong>tlerweile fünfzehn, eskaliert die Situation: „... Und, ja, dann kam’s<br />
zu dieser Auseinandersetzung. Da kam er auch betrunken nach Hause und hat rumgepöbelt.<br />
Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Und dann ist’s eskaliert. Ja, ich hab’ ihn,<br />
mal ganz kraß gesagt, fast abgestochen ... Und dann kam’s so dazu, daß ich zu meiner<br />
Mutter dann gesagt hab’, entweder muß er gehen oder ich muß gehen. Also ich hab’ von ihr<br />
sozusagen ’ne Entscheidung verlangt. Na gut, das hat sich dann so ’n bißchen hingezogen,<br />
so zwei, drei Tage, bis sie die Entscheidung getroffen hat. Und, ja, sie hat sich dann für den<br />
Mann entschieden, und dann bin ich eben gegangen.“<br />
Peter erträgt die Situation, die er seit fast acht Jahren <strong>mit</strong> angesehen und viel länger als seine<br />
Geschwister ertragen hat, nicht mehr. Auch die Liebe zur Mutter kann ihn nicht mehr dazu<br />
bringen, weiterhin den Stiefvater zu ertragen. Wie groß oder klein seine Hoffnung ist, seine<br />
Mutter könnte sich nach all der Zeit und dem Weggang der Geschwister noch für ihn und<br />
gegen ihren Mann entscheiden, ist unklar. Klar ist in jedem Falle, daß die Entscheidung der<br />
Mutter gegen ihn eine große Enttäuschung für ihn darstellt. Dennoch nimmt Peter seine<br />
Mutter noch heute in Schutz und stellt da<strong>mit</strong> den von Anfang an abgelehnten Stiefvater mehr<br />
oder weniger als alleinigen Sündenbock dar: „... Also ich muß schon zugeben, daß da ’n gewisser<br />
Bruch da war, was ich aber nie so gezeigt habe. Seit dem Zeitpunkt hab’ ich eigentlich<br />
nie mehr bei meiner Mutter übernachtet ...“<br />
Seine Lebenssituation bis zum Auszug faßt er kurz, aber präzise zusammen: „... daß mein<br />
leiblicher Vater das Feld räumen mußte, dann die schlechte Zeit <strong>mit</strong> dem Stiefvater, dann die<br />
Entscheidung, daß sie sich für den Stiefvater, also für ihren Mann entschieden hat, der im<br />
Laufe der Zeit alle ihre Kinder rausgeekelt hat. Aber gut, ich denk’ heute so darüber: Sie war<br />
halt verliebt und hatte auch die Angst gehabt, wenn die Kinder mal außer Haus sind, dann ist<br />
sie alleine.“<br />
Was läßt sich in bezug auf seine Probleme und Bewältigungsformen und -strategien bis<br />
zu diesem Zeitpunkt festhalten?<br />
• In der Kindheit und frühen Jugend gibt es für Peter rückblickend ein Hauptproblem: den<br />
trinkenden, gewalttätigen Eindringling in seine Familie, den Stiefvater. Alles andere –<br />
materielle Beschränkungen und Kontaktschwierigkeiten – spielt nur eine Nebenrolle.<br />
31
• Weiterhin erlebt er, daß ihn der leibliche Vater sowie nach und nach die Halbgeschwister<br />
verlassen beziehungsweise im Stich lassen.<br />
• In der Auseinandersetzung <strong>mit</strong> dem Stiefvater schlägt er zunächst eine Durchhaltestrategie<br />
ein. Dies wird ihm zum Teil dadurch erleichtert, daß die älteren Halb- und Stiefgeschwister<br />
immer wieder ein Schutzschild gegenüber dem gewalttätigen Stiefvater sind.<br />
Auffallend ist, daß er nicht von geschwisterlichen Bündnissen gegen den Stiefvater berichtet.<br />
Peter zeigt keine Fluchttendenzen und keine expressiven Reaktionen.<br />
• Mit zunehmendem Alter und <strong>mit</strong> Eintritt in die Pubertät wandelt sich sein Verhalten: Die<br />
ihm (durch den „Wegfall“ der Geschwister) zunehmend entgegengebrachten Aggressionen<br />
werden nun direkt zurückgespiegelt. Er setzt sich zur Wehr und zieht schließlich<br />
nach langer Zeit, als er merkt, daß alles immer nur noch schlimmer wird, die Konsequenz,<br />
daß er diese Situation beenden muß. Er unternimmt einen letzten Versuch, sein<br />
Leben in der Familie zu retten, und als dieser – aufgrund der „Schwäche“ der Mutter –<br />
scheitert, wagt er den endgültigen Bruch.<br />
• Günstig wirkt in dieser Zeit, daß das Verhältnis Peters zu seiner Mutter sehr gut ist und er<br />
in den ersten Lebensjahren zu ihr, aber auch dem leiblichen Vater eine längere Phase sicherer<br />
Bindungen erlebt hat. Das lange Durchhalten wird dadurch begünstigt, daß Peter<br />
als jüngstes Kind seiner Mutter den meisten Schutz genießt.<br />
• Die Schule, in der Peter – unter anderem aufgrund seiner offensichtlich guten kognitiven<br />
Fähigkeiten – keine Schwierigkeiten hat, hat er angesichts der häuslichen Situation wohl<br />
eher als Schonraum empfunden, so daß ein Verhalten, das dies gefährdet hätte, eher<br />
kontraproduktiv gewesen wäre. Er trennt konsequent seine Welten: hier das „Private“ und<br />
dort die „Schule“. In der Schule erlebt er Positives, gewinnt Freunde und Selbstbewußtsein.<br />
Möglicherweise förderte dies das insgesamt unauffällige Verhalten Peters.<br />
b) Probleme und Problembewältigung nach dem Auszug von zu Hause bis heute<br />
(15. bis 27. Lebensjahr):<br />
„... Wenn ich was anfange, bringe ich es auch zu Ende, also da muß schon was ganz<br />
Krasses passieren ...“<br />
Nach der Entscheidung seiner Mutter gegen ihn und wegen der extremen Gewaltsituation in<br />
der Familie geht Peter direkt zum Jugendamt. Er weiß, wo er hingehen muß. Er kennt sogar<br />
den zuständigen Sozialarbeiter und dieser wiederum die Familienproblematik. So läuft der<br />
Übergang in die Heimunterbringung relativ glatt. Trotz seines relativ souveränen Umgangs<br />
<strong>mit</strong> der Situation und dem schnellen Agieren des zuständigen Amtes fühlt sich Peter zunächst<br />
„abgeliefert“, wahrscheinlich sogar der Situation ausgeliefert: „... Bin dann zum Jugendamt<br />
gegangen, wir war’n dort auch ... bekannt, durch die Geschwister auch. Und da<br />
gab’s einen Herrn D., bei dem hab’ ich auch Englischnachhilfe gemacht, das war auch ’n<br />
Sozialarbeiter. Ja, zu dem bin ich dann hin, hab’ dem die ganze Situation geschildert. Ja,<br />
32
dann hab’ ich erst mal bei meiner ältesten Schwester gewohnt für ’n paar Tage, und dann bin<br />
ich in dieses Übergangswohnheim nach E. gekommen. Dort hab’ ich dann eben vier Wochen<br />
gewohnt, hat mir auch sehr gut gefallen dort. Die Leute war’n okay. Man hat dort viel unternommen.“<br />
Und weiter: „... und hab’ mir dann diverse Heime angeguckt. Und da hat mir das<br />
hier in B. eigentlich ganz gut gefallen. Wobei ich eigentlich erst nach J. wollte und mich dann<br />
aber wieder umentschieden hab’, und bin dann hier in B. geblieben. Da bin ich hier in B. abgeliefert<br />
worden und hab’ mich dann eingerichtet, hab’ Leute kennengelernt. Dann ging’s los:<br />
hab’ ich meine Schule weitergemacht, Realschule gemacht und hab’ dann auch ’n Jahr wiederholt,<br />
weil es <strong>mit</strong>ten im Jahr war, und die Umstellung war problematisch ...“<br />
Alles in allem bedeutet der Bruch respektive die Lösung von seiner Familie in vielen Bereichen<br />
eine Verbesserung für Peter: „... Die Leute dort war’n zu der Zeit sehr offen und alle<br />
sehr nett. Ha’m mich erst mal ausgefragt, wie das so is’ in so ’m Heim ... Und ich muß sagen,<br />
ich hatte ’ne ziemlich tolle Zeit dort. Und die Betreuer war’n einfach super ... Die Mitbewohner<br />
dort waren auch größtenteils sehr in Ordnung. Ja, die letzten zwei Jahre in dem Heim<br />
waren dann dadurch, daß viele ausgezogen sind, ... nicht mehr so toll. Ich muß sagen, das<br />
Positive jetzt im Heim war, daß ich eben andere Leute, neue Freunde gefunden hab’ ... Und<br />
was wir uns damals zu Hause nicht leisten konnten, Urlaub zum Beispiel oder mal schwimmen<br />
gehen oder so, das war bei uns in der Familie eigentlich nicht so drin. Und das war so<br />
was sehr Positives, einfach mal andere Kulturen kennenzulernen, einfach mal was anderes<br />
sehen. Das ist schon ganz wichtig für mich. Wir waren in Italien erst, dann waren wir in<br />
Frankreich, Portugal ...“ Unter weiter: „... Und im Heim, wir haben da eigentlich anfangs, wie<br />
ich dort war, ... gelebt wie die Maden im Speck ... Also es gab immer Superessen ... Und<br />
dann war’s auch so im Heim geregelt, man hat Kleidergeld bekommen, man hat Taschengeld<br />
bekommen, was ich vorher eigentlich nie gekannt hab’ ... Mit seinem Taschengeld<br />
konnte man machen, was man wollte.“<br />
Im Heim beziehungsweise in der Jugendwohngruppe 14 findet Peter nicht nur mehr Sicherheit,<br />
sondern auch neue Bezugspersonen und vor allem neue Freunde. Auch seine materiellen<br />
Lebensbedingungen verbessern sich deutlich. Er kommt in eine Gemeinschaft von<br />
fünfzehn Gleichaltrigen, die ihn gerne aufnimmt. Das Klima und die Lebensbedingungen im<br />
Heim sind gut. Peter erhält Möglichkeiten für neue, wichtige Erfahrungsmöglichkeiten.<br />
In der Schule hat er nach der einmaligen Klassenwiederholung keine Schwierigkeiten mehr:<br />
„... Ich mußt’ mich eigentlich nie großartig drum bemüh’n, ich hab’ die Schule eigentlich recht<br />
locker geschafft. Ich mußt’ nicht immer büffeln wie ’n Ochs, um die Arbeiten zu schaffen. Ich<br />
mußt’ mich jetzt auch nicht großartig bemüh’n, um ’ne Lehrstelle zu bekommen. Da muß ich<br />
sagen, das ist mir so ziemlich in ’n Schoß gefallen. Aber das hängt, nehm’ ich mal an, da<strong>mit</strong><br />
zusammen, daß ich da auch recht konsequent bin.“<br />
14 Peter spricht im Interview – außer an einer Stelle – immer von „Heim“, nur an einer Stelle benutzt er den Ausdruck Jugendwohngruppe.<br />
Sein Sprachgebrauch wird beibehalten.<br />
33
Peter muß sich also nicht sonderlich anstrengen oder disziplinieren, um die Schule zu besuchen<br />
und erfolgreich <strong>mit</strong> dem Realschulabschluß zu beenden. Auch <strong>mit</strong> der Berufsfindung<br />
hat er keine Probleme: „... Ja, also das kam so: Im Heim, das ist ’ne Villa, ist ’ne Heizung<br />
drin. Da wurd’ mal was repariert an der Heizung, das hab’ ich mir angeschaut und war eigentlich<br />
recht begeistert von dem Beruf. Und hab’ mich dann bei der Firma beworben. Ich bin<br />
direkt genommen worden, hab’ dort meine Ausbildung [als Gas-Wasser-Installateur; B. H.]<br />
gemacht – was nicht immer ganz leicht war. Da war ’n Geselle, der war ... ziemlich ähnlich<br />
wie mein Stiefvater. Und das war auch ziemlich kraß. Im zweiten Lehrjahr, da wollt’ ich dann<br />
die Lehre abbrechen wegen diesem Gesellen. Und ich hab’ dann die Zähne zusammengebissen<br />
und bin dann durch.“<br />
Peter entscheidet sich bei seiner Berufswahl also danach, was er aus eigener Anschauung<br />
kennt und was ihn interessiert. Daß er <strong>mit</strong> einem Realschulabschluß auch einen statusträchtigeren<br />
und besser bezahlten Beruf als den des Gas-Wasser-Installateurs hätte wählen können,<br />
interessiert ihn offensichtlich wenig. Geld und Prestige sind ihm weniger wichtig. Er hat<br />
Glück und bekommt eine Lehrstelle in der Firma, die er als erste anspricht.<br />
In der Ausbildung hat er weniger Glück, hält jedoch trotz der Probleme <strong>mit</strong> seinem Gesellen-<br />
Kollegen 15 und harter Arbeitsbedingungen auf den Baustellen die Ausbildung durch. Er bleibt<br />
danach noch weitere acht Jahre bei seinem Arbeitgeber, obwohl diese Stelle kein „Zuckerschlecken“<br />
bedeutet. Er muß in Nässe und Kälte arbeiten und verdient wenig Geld.<br />
Nach und nach verschlechtert sich das Betriebsklima, irgendwann reicht es Peter, und er<br />
geht: „... Der hauptsächliche Grund war der, daß es in der Firma ... vom Betriebsklima einfach<br />
nicht mehr so toll war. Der Chef hat nur noch rumgeschrien. Da wurd’ dann abgezogen<br />
und gemacht und getan ... Als Arbeitnehmer im Handwerk ist man schon ’n bißchen unterdrückt,<br />
weil man auch viele Sachen nicht weiß, wo man eigentlich ’n Recht drauf hat. Es gab<br />
eine Sache, da hab’ ich, muß ich zugeben, einen Fehler begangen ... Habe ’n Abwasserkanal<br />
überprüft und dabei einen Bogen übersehen. Ich hab’ eine Skizze angefertigt, wo das<br />
Abwasserrohr aufgegraben werden soll ... da kam nachher ’ne Baufirma, hat den Kanal freigelegt,<br />
aber da war überhaupt gar kein Kanal. Also das war mein Fehler. Wir ha’m uns dann<br />
geeinigt, daß ich den Schaden durch Überstunden ableiste. Heute würd’ ich’s nicht mehr tun,<br />
weil ich jetzt denk’, wo bleibt das unternehmerische Risiko? ... Und es war eigentlich schon<br />
so ’n Grund, warum ich dann auch aus dem Beruf raus bin. Ich wollt’ auch mal was anderes<br />
machen als auf ’m Bau zu arbeiten ...“<br />
An dieser Stelle zeigt sich wieder, daß Peter bei Schwierigkeiten nicht gleich das Handtuch<br />
wirft oder den Kopf in den Sand steckt. Solange das Betriebsklima halbwegs erträglich ist,<br />
hat er <strong>mit</strong> Widrigkeiten weniger Probleme. Weiterhin wird deutlich, daß er Fehler, die er<br />
macht, auch eingestehen und <strong>mit</strong> den Konsequenzen umgehen kann. Fast scheint es, daß<br />
15 Peter berichtet an anderer Stelle, daß der Geselle während der Arbeit auch getrunken hat, was er nicht gut ertragen konnte,<br />
so daß teilweise eine recht gestörte Arbeitsatmosphäre zwischen beiden bestand. Gleichzeitig hat er aber von diesem Gesellen<br />
viel gelernt.<br />
34
seine Frustrationstoleranz respektive Schmerzgrenze zu hoch ist. Sein „Durchhaltenwollen“,<br />
sein „Konsequentsein“ bringt ihn um viele bessere Möglichkeiten. Andererseits ist es – wie<br />
bei den familiären Konflikten – Peter, der schließlich der Situation (durch Kündigung) ein Ende<br />
setzt.<br />
Anschließend sucht er sich außerhalb des Baubereiches eine neue Stelle. Dabei nutzt er<br />
seinen Bekanntenkreis. So erfährt er von der Firma, in der er jetzt arbeitet, und bewirbt sich<br />
dort. Er ist bereit, als Ungelernter zu arbeiten. Sein Verdienst ist dennoch höher als vorher.<br />
Peter bereitet nun Proben zur Untersuchung vor, eine Tätigkeit, die ihn schon nach etwa<br />
einem Jahr nicht mehr besonders fordert. Aber er ist angesichts des guten Verdienstes und<br />
nicht zuletzt wegen des guten Arbeitsklimas sehr zufrieden und kann sich auch vorstellen,<br />
seine Arbeit dort noch einige Jahre auszuüben.<br />
Im privaten Bereich, in bezug auf soziale Kontakte, hat Peter ebenfalls keine Schwierigkeiten:<br />
Er hat zwei gute Freunde und weitere Bekannte, <strong>mit</strong> denen er alles bereden kann. 16 Nur<br />
<strong>mit</strong> festen Beziehungen läuft es nicht so, wie er es gerne hätte: „... Was so Beziehungen angeht,<br />
ist unsere Familie recht ... beschissen dran. Wobei ich mich auch nicht unbedingt leicht<br />
tu’ <strong>mit</strong> ’ner Beziehung. Ich bin schon relativ lange alleine, hab’ schon ’n paar Stürze hinter<br />
mir und bin verarscht worden. Und ... seit drei, vier Jahren hab’ ich keine Freundin mehr,<br />
hab’ mal zwischendurch was probiert, aber das hat dann auch nicht geklappt. Da ist schon<br />
so ’ne gewisse Angst auch dahinter, einfach es nicht so zu machen wie meine Geschwister<br />
oder wie meine Mutter. Also ich will’s dann schon irgendwie richtig machen. Und, das ist das<br />
einzigst Negative, was ich so sagen muß, was ich so von meinen Schwestern oder meinen<br />
Geschwistern und von meiner Mutter <strong>mit</strong>bekommen hab’ irgendwo, wo ich auch regelrecht<br />
Angst hab’ irgendwie, das falsch zu tun. Aber es wird schon irgendwann die Richtige kommen.“<br />
Peter erlebt schon früh seine Mutter und später seine Geschwister als sehr unglücklich und<br />
problematisch in bezug auf Beziehungen. Er hat große Angst davor, in dieser Hinsicht<br />
ebenfalls zu scheitern. Nach einigen Enttäuschungen läßt er nur ungern jemand Fremdes an<br />
sich heran. Dabei hat er deutliche Probleme, auf Frauen zuzugehen. Dies bezeichnet er als<br />
sein größtes Problem. Insgesamt aber ist er <strong>mit</strong> seinem jetzigen Leben sehr zufrieden und<br />
plant für die nächste Zukunft keine größeren Veränderungen.<br />
Peters Hauptprobleme und Umgangsweisen nach dem Verlassen der Familie lassen<br />
sich wie folgt zusammenfassen:<br />
• Zunächst steht er vor dem Problem, sich in vollkommen anderen Verhältnissen und an<br />
einem anderen Ort einfinden zu müssen. Er hat zu einem recht frühen Zeitpunkt die Ablösung<br />
von der Familie zu bewältigen. Später stellt der Umgang <strong>mit</strong> Konflikten am Ar-<br />
16 Die Kontakte zu seiner Familie (Mutter und Geschwister) sind eher lose. Sie sehen sich zwar regelmäßig zu Feiern und<br />
ähnlichem, jedoch nicht allzu häufig.<br />
35
36<br />
beitsplatz ein wichtiges Handlungsproblem dar. Auch die Ablösung von der „Zweitfamilie“<br />
in der Wohngruppe darf nicht unterschätzt werden.<br />
• Die Eingewöhnung im Heim und die gleichzeitige Ablösung von der Familie bewältigt er<br />
ohne größere Anstrengungen. Sie stellt sich angesichts äußerst günstiger Bedingungen<br />
dort für ihn subjektiv als Gewinn dar. Erst am Ausbildungs- beziehungsweise Arbeitsplatz<br />
ist er auch subjektiv wieder <strong>mit</strong> Handlungsproblemen konfrontiert, als er in der Art und<br />
Haltung eines Kollegen seinen Stiefvater wiedererkennt. Zunächst denkt er an Flucht (�<br />
Abbrechen der Ausbildung), beißt aber letztendlich die Zähne zusammen und zieht, was<br />
er angefangen hat, durch. Auch später zeigt Peter, der am Arbeitsplatz keineswegs besonders<br />
angenehme Bedingungen vorfindet, ein hohes Beharrungsvermögen. Er paßt<br />
sich, solange nichts Schlimmes passiert, der jeweiligen Situation an. „Aushalten“, so lange<br />
es irgendwie geht, erscheint als dominantes Handlungsmuster. Ist das Maß aber voll<br />
und erfolgt ein Bruch, so tut Peter dies in voller Überzeugung, das Richtige zu tun, und<br />
ohne späteres Bedauern beziehungsweise ohne Zweifel, das Richtige getan zu haben.<br />
• Er findet wohl Kontakt und schließt Freundschaften. Seine (Partner-)Beziehungen schlagen<br />
aber meist nach kurzer Zeit fehl, so daß sich seine kindlichen Verluste und das Gefühl,<br />
verraten zu sein, weiter potenzieren. Entsprechend steigt seine Angst vor festen<br />
Bindungen und erneuten Verlusten.<br />
3. Fallbewertung<br />
Peter ist im Alter von fünfzehn Jahren durch den Auszug aus der Familie der Armut entronnen.<br />
Nach dem Verlassen des Heims gelingt es ihm, durch Ausbildung und kontinuierliche<br />
Berufstätigkeit seine Existenz jenseits der Armutsschwelle zu sichern.<br />
Der Weg heraus aus der „Multiproblemfamilie“ in die „Normalität“ des eigenständigen und<br />
erwerbstätigen Erwachsenen ist Peter in erster Linie durch eigenes aktives Handeln gelungen.<br />
Seine bisherigen Lebensregeln könnten lauten: „aushalten, so lange es irgendwie geht“,<br />
aber im Notfall den Bruch wagen und „für sich selbst verantwortlich sein“ beziehungsweise<br />
„für sich selbst sorgen“.<br />
Das Jugendamt spielt am entscheidenden Punkt in seinem Leben, der definitiven Krise <strong>mit</strong><br />
dem Stiefvater, eine wichtige, wenn auch nachgeordnete Rolle. Die Unterbringung außerhalb<br />
der Familie erfolgt rasch und unter Berücksichtigung der Wünsche Peters. Inwiefern Peter<br />
schon im Vorfeld Unterstützung erhielt, bleibt unklar.<br />
Im weiteren Verlauf, insbesondere bei der anschließenden Krisenbewältigung, beim Übergang<br />
in den Beruf und in die endgültige Selbständigkeit, ist seine Wohngruppe sehr wichtig.<br />
Dort findet er die Sicherheit und Geborgenheit, die ihm lange Zeit in der Kindheit und frühen<br />
Jugend gefehlt haben. Nicht zuletzt findet er dort wichtige Freunde und zuverlässige unterstützende<br />
Bezugspersonen sowie bessere materielle Rahmenbedingungen vor.
Ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Bewältigung seiner problembelasteten späteren<br />
Kindheit und frühen Jugend dürfte die in seinen ersten Lebensjahren stabile und „ungestörte“<br />
Bindung zu seiner Mutter und seinem leiblichen Vater gewesen sein. Der Mutter ist es<br />
scheinbar gelungen, zu ihrem Jüngsten eine gute emotionale Bindung aufzubauen, und auch<br />
der Vater stand als feste Bezugsperson zur Verfügung.<br />
Als weitere Ressource können Peters gute kognitiven Fähigkeiten betrachtet werden, die es<br />
ermöglichen, daß er die Schule nicht als weitere „Zumutung“ erleben muß.<br />
Peters Position in der Geschwisterreihe, die dazu führt, daß er lange Zeit von den ärgsten<br />
Angriffen verschont bleibt, spielt für seine weitere Lebensgeschichte sicher eine förderliche<br />
Rolle.<br />
Es ist davon auszugehen, daß Peter auch auf Dauer sein Leben gut im Griff haben wird,<br />
schließlich hat er die schwierigsten Jahre im Übergang zum Erwachsenensein gut bewältigt.<br />
Ein Abgleiten unter die Armutsschwelle ist erst einmal nicht zu erwarten. Angesichts Peters<br />
eher gering ausgeprägten beruflichen Ambitionen ist jedoch kein weiterer sozialer Aufstieg<br />
zu erwarten, der ihm noch mehr (materielle) Sicherheit bringen würde.<br />
Die von ihm als sein größtes Problem formulierten Schwierigkeiten bei der Partnersuche erscheinen<br />
für Außenstehende auf den ersten Blick „normal“ und wenig bedenklich. Nichtsdestotrotz<br />
sind sie angesichts der Verluste, Enttäuschungen und Brüche in Peters Kindheit<br />
und Jugend als problematischer einzuschätzen als bei anderen Gleichaltrigen in einer ähnlichen<br />
Situation. Hier scheint er am deutlichsten langfristige Folgen oder „Schädigungen“ bewältigen<br />
zu müssen.<br />
Tab. 2: Zusammenfassende Übersicht (Peter)<br />
1. Besondere Bewältigungsaufgaben, Ressourcen und Coping in Kindheit und Jugend (bis 15. Lebensjahr)<br />
Bewältigungsaufgaben<br />
(Belastungen und Probleme)<br />
• Trennung vom leiblichen Vater<br />
• Gewalterfahrung, zunehmende<br />
innerfamiliale Konflikte<br />
• Trennung von den Halbgeschwistern<br />
• Materielle Beschränkungen<br />
• Kontaktprobleme<br />
Ressourcen/positive Einflüsse Copingstrategie<br />
• Sichere Bindung zur Mutter<br />
• Bindung an leiblichen Vater in<br />
den ersten Lebensjahren<br />
• Jüngstes Kind = größerer Schutz<br />
vor Angriffen des Stiefvaters<br />
durch die Mutter<br />
• Gute kognitive Ressourcen<br />
• Gute soziale Integration<br />
• Schule als Schonraum<br />
• Jugendamt als Hilfeinstitution<br />
bekannt und genutzt<br />
• Materielle Bedingungen in der<br />
Umgebung zum Teil ähnlich<br />
• Sich anpassen<br />
• Für sich selbst sorgen<br />
• Durchhalten, konsequent sein<br />
• Aggressionen direkt zurückspiegeln<br />
• Im Notfall auch Bruch in Kauf<br />
nehmen<br />
37
2. Besondere Bewältigungsaufgaben, Ressourcen und Coping in der späteren Jugendzeit<br />
Bewältigungsaufgaben<br />
(Belastungen und Probleme)<br />
• Trennung von der Mutter/Familie<br />
• Einfinden in neue Umgebung<br />
und Lebenssituation<br />
• Konflikte <strong>mit</strong> Kollegen während<br />
der Ausbildung<br />
38<br />
Ressourcen/positive Einflüsse Copingstrategie<br />
• Schnelle Hilfe durch das Jugendamt<br />
• (Teil-)Autonomie bei der Wahl<br />
der Wohngruppe<br />
• Gutes Klima im Heim/in der<br />
Wohngruppe<br />
• Verbesserte materielle Lebensbedingungen<br />
• Für sich selbst sorgen<br />
• Angefangenes konsequent<br />
durchziehen<br />
• Gefällten Entscheidungen nicht<br />
nachtrauern<br />
• Konflikte erst einmal aushalten,<br />
erst wenn es nicht mehr geht,<br />
Veränderung suchen<br />
• Pragmatische Lebenshaltung<br />
und eher kurzfristige Lebensplanung
6 Zum allgemeinen Verständnis:<br />
Konzepte und Definitionen zum Aufwachsen in Armut 17<br />
Armut ist ein wichtiger Belastungsfaktor nicht nur für Erwachsene, sondern genauso für Kinder<br />
und Jugendliche. Armut bedeutet mehr als ein Mangel an materiellen Ressourcen. Arme<br />
Menschen sind zumeist in mehreren Lebensbereichen benachteiligt, zum Teil sogar ausgegrenzt.<br />
Armut ist als ein mehrdimensionales Problem zu begreifen. Kinder und Jugendliche,<br />
die in einer armen Familie aufwachsen, sind nicht nur in bezug auf die materielle Teilhabe<br />
beeinträchtigt, sondern oft auch in ihren kulturellen, sozialen und gesundheitlichen<br />
Ressourcen benachteiligt (vgl. zur Mehrdimensionalität von Armut und zum Armutskonzept<br />
der AWO-ISS-Studie <strong>Hock</strong>/<strong>Holz</strong>/Wüstendörfer 2000a und b sowie Kapitel 6.1).<br />
Durch die Mehrdimensionalität des Phänomens Armut stehen davon betroffene Kinder und<br />
Jugendliche vor dem Problem, ihre Sozialisation unter (deutlich) erschwerten Bedingungen<br />
bewältigen zu müssen. Die allgemeinen Entwicklungsaufgaben in der Kinder- und Jugendphase<br />
sind unter diesen Voraussetzungen schwerer zu bewerkstelligen. Nicht zuletzt sinken<br />
unter Armutsbedingungen die schulischen und beruflichen Integrations- und Karrierechancen<br />
der Betroffenen. Die Fortsetzung der in der Kindheit und/oder Jugend erlebten Armut in der<br />
nächsten Generation, die Vererbung von Armut, liegt nahe.<br />
Genauso ist heute aufgrund von Untersuchungen (zu Erwachsenen in Armut) bekannt, daß<br />
Armut häufig kein dauerhafter Zustand ist, sondern überwunden werden kann. Armutsverläufe<br />
sind offen – wie die dynamische Armutsforschung nachweist (vgl. Leibfried u. a. 1995<br />
und Kapitel 6.3). Alle Wege und Verläufe sind prinzipiell denkbar, der häufig zitierte „Teufelskreis<br />
der Armut“ trifft nur auf einen Teil der Armutspopulation zu. Die Lebenslagen der betroffenen<br />
Menschen sind sehr verschieden, entsprechend unterscheiden sich ihre Chancen,<br />
die Armut zu überwinden.<br />
Auch das Aufwachsen unter Armutsbedingungen produziert keine einheitlichen Lebenslagen<br />
(vgl. unter anderem <strong>Hock</strong>/<strong>Holz</strong>/Wüstendörfer 2000a und b). Die Bandbreite der empirisch<br />
vorfindbaren Lebenslagen von Kindern ist vielmehr groß: Während ein Teil der armen Kinder<br />
im relativen Wohlergehen lebt, sind andere in mehreren Dimensionen benachteiligt. Ein Teil<br />
der von Armut betroffenen Minderjährigen scheint <strong>mit</strong> Blick auf ihre Lebenschancen kaum<br />
eingeschränkt, während andere schon im frühen Kindesalter starke Auffälligkeiten und Benachteiligungen<br />
zeigen, die ein autonomes Leben frei von Armut im Erwachsenenalter wenig<br />
wahrscheinlich werden lassen. Während ein Teil der armen Kinder und Jugendlichen aus<br />
sogenannten Multiproblemfamilien kommt und da<strong>mit</strong> sehr ungünstige Sozialisationsbedingungen<br />
vorfindet, leben andere ein zwar materiell eingeschränktes, aber ansonsten relativ<br />
unbelastetes Leben. Diese Bandbreite wird bei den in diesem Band dargestellten Fallbeispielen<br />
erneut deutlich.<br />
17 = Textauszug 5. Zwischenbericht, Kapitel 2.<br />
39
Im weiteren konzentrieren sich die Ausführungen im Teil I zunächst auf Jugendliche, die im<br />
Übergang von der Schule in den Beruf scheitern. Es wird der Frage nachgegangen, ob und<br />
inwiefern Armut – neben anderen Benachteiligungen – dabei eine Rolle spielt. Es geraten<br />
also zunächst arme Jugendliche in den Blick, bei denen sich zumindest potentiell die familiäre<br />
Armutssituation in der eigenen Biographie fortsetzt. Es geht folglich um einen von mehreren<br />
möglichen Verläufen: die Verstetigung von Armut oder den „Teufelskreis der Armut“.<br />
In Teil II werden anhand einzelner Fallbeispiele, die auf Interviews <strong>mit</strong> Betroffenen basieren,<br />
Wege aus der Armut dargestellt. Die porträtierten einstmals armen Jugendlichen haben<br />
trotz zum Teil sehr ungünstiger Lebens- und Entwicklungsbedingungen ihren Weg gemacht<br />
und den Übergang von der Schule in den Beruf gut bewältigt. Insofern können sie aus<br />
der gesellschaftlichen Normalitätsperspektive ohne weiteres als „erfolgreich“ bezeichnet<br />
werden. Sie stellen da<strong>mit</strong> die Kontrastgruppe zu der zuvor betrachteten Gruppe der an diesem<br />
Übergang Gescheiterten dar. Die Beispiele zeigen, daß eine „erfolgreiche“ Armutsbewältigung<br />
unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Die Analyse dieser Voraussetzungen<br />
soll Ansatzpunkte für verbesserte gesellschaftliche Hilfen und Unterstützungen von armen<br />
Kindern und ihrer Familien liefern.<br />
Als Einführung und erste theoretische Auseinandersetzung <strong>mit</strong> dem Vorhaben, Armut von<br />
Jugendlichen aus zwei Perspektiven zu betrachten, werden zunächst die für die Untersuchung<br />
relevanten drei zentralen Begrifflichkeiten beziehungsweise Konzepte erläutert. Diese<br />
sind „Armut“ (vgl. Kapitel 6.1), „Bewältigung/Coping“ (vgl. Kapitel 6.2) und „Armutskarriere“<br />
beziehungsweise „Erfolg“ (vgl. Kapitel 6.3). Wichtig ist, sich dabei stets die Besonderheit der<br />
Begriffe in bezug auf die Lebensphasen Kindheit und Jugend zu vergegenwärtigen.<br />
6.1 Armut als multidimensionale Benachteiligung (Armutskonzept)<br />
Armut wird im Rahmen der AWO-ISS-Studie nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Unterausstattung<br />
<strong>mit</strong> materiellen Ressourcen – gemessen am Haushaltseinkommen – betrachtet,<br />
sondern auch als Problemlage, die <strong>mit</strong> Einschränkungen in vielen Lebensbereichen einhergeht.<br />
Sowohl temporäre wie auch kontinuierliche Armut während der Kindheit und Jugend<br />
haben in der Regel Auswirkungen auf die Lebenslagen und Lebenschancen der hiervon betroffenen<br />
Heranwachsenden.<br />
Abbildung 6 zeigt, wie vielfältig die Einflußfaktoren sind, die letztendlich bestimmen, was<br />
unter Armutsbedingungen beim Kind oder Jugendlichen ankommt. Je nach gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen (1) , je nach Problemlagen und Ressourcen im Haushalt beziehungsweise<br />
auf seiten der Eltern (2) und nicht zuletzt je nach Umfang, Gestalt und Qualität<br />
des privaten (3) und professionellen Hilfesystems (4) differiert unter gleichen oder ähnlichen<br />
materiellen Lebensbedingungen die tatsächliche Lebenssituation des Kindes.<br />
40
Die tendenzielle strukturelle Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen aus Familien <strong>mit</strong><br />
geringen materiellen Ressourcen wirkt sich also je nach „Lagerung“ der genannten Einflußfaktoren<br />
unterschiedlich aus.<br />
Abb. 6: Einflußfaktoren auf die Lebenssituation von (armen) Kindern und<br />
Jugendlichen<br />
Art und Ausmaß der<br />
materiellen Versorgung<br />
T Positive/negative Einflüsse<br />
des privaten Umfeldes<br />
sowie private Hilfe<br />
Q Gesellschaftliche Rahmenbedingungen<br />
(Arbeitsmarkt, Verteilung der gesellschaftlichen Ressourcen...)<br />
R Lebenssituation in der Familie<br />
(materielle und nichtmaterielle Probleme und Ressourcen der Eltern,<br />
Wertorientierungen, Erziehungsvorstellungen und -verhalten...)<br />
Art und Umfang<br />
der Zuwendung<br />
Erscheinungsformen von Armut bei<br />
Kindern und Jugendlichen<br />
Art und Umfang der Hilfestellungen,<br />
Anregung...<br />
S Institutionelle Rahmenbedingungen<br />
(Gesetze, Gestaltung der Hilfsangebote...)<br />
und professionelle Hilfe/Hilfsangebote<br />
Bedeutsam ist, wie sich die vier obigen Einflußfaktoren auf die Lebenssituation der Kinder<br />
und Jugendlichen auswirken:<br />
41
• Die materielle Lebenslage des Kindes/Jugendlichen: Inwieweit stehen dem Heranwachsenden<br />
selbst ausreichend materielle Ressourcen zur Verfügung? Ist die Basisversorgung<br />
(Nahrung, Kleidung, Wohnung) gewährleistet? Ist eine adäquate Teilhabe an altersgemäßen<br />
Aktivitäten möglich?<br />
• Die gesundheitliche Lage des Kindes/Jugendlichen: Ist die physische und psychische<br />
Gesundheit gewährleistet, oder liegen im weiteren Sinne armutsbedingte Beeinträchtigungen<br />
vor?<br />
• Die kulturelle Lage des Kindes/Jugendlichen: Ist es dem Kind/Jugendlichen möglich,<br />
kulturelle Kompetenzen zu erwerben, die ihm eine Teilhabe an gesellschaftlich üblichen<br />
Aktivitäten sichern? Kann das Kind/der Jugendliche seine Bildungschancen adäquat verwirklichen?<br />
• Die soziale Lage des Kindes/Jugendlichen: Ist das Kind respektive der Jugendliche in<br />
sein soziales Umfeld integriert? Welcher Art sind die sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen,<br />
aber auch zu Erwachsenen? Liegen im weiteren Sinne armutsbedingte Einschränkungen<br />
<strong>mit</strong> Blick auf die sozialen Netzwerke vor?<br />
Die aufgeführten Fragen ermöglichen es, die jeweilige Lebenslage des Kindes/Jugendlichen,<br />
seine materiellen, kulturellen, sozialen und gesundheitlichen Ressourcen in ihren wichtigsten<br />
Teildimensionen zu bestimmen. Da<strong>mit</strong> läßt sich letztlich auch beantworten, ob und inwieweit<br />
das Aufwachsen unter Armutsbedingungen die Entwicklungs-, Integrations- und Karrierechancen<br />
beeinträchtigt.<br />
Im folgenden Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung <strong>mit</strong> den Fragen, inwieweit<br />
• das (arme) Kind respektive der (arme) Jugendliche im Prozeß der Sozialisation <strong>mit</strong> den<br />
hier angesprochenen Einschränkungen, aber auch Ressourcen umgehen kann,<br />
• Entwicklungen und „Karrieren“ über Bewältigungshaltungen und Bewältigungshandlungen<br />
(= Coping) der Heranwachsenden <strong>mit</strong>bestimmt werden können.<br />
6.2 Sozialisation und Bewältigung/Coping (Copingkonzept)<br />
Die zentralen Ziele der Sozialisation in Kindheit und Jugend sind die Entwicklung der eigenen<br />
Persönlichkeit (� Individuierung) und die soziale Entwicklung und das Hineinwachsen in<br />
die Gesellschaft (� Integration). Auf dem Weg zum Erwachsenenleben, zur Autonomie,<br />
müssen Jugendliche ihre innere und äußere Realität bewältigen lernen. Der ganz normale<br />
Prozeß des Aufwachsens, der Sozialisationsprozeß, beinhaltet die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben<br />
18 , die von jedem Menschen gelöst werden müssen (vgl. unter anderem<br />
18 Dazu zählen beispielsweise Akzeptanz des eigenen Körpers, die Geschlechtsrolle einnehmen, „reifere“ Beziehungen <strong>mit</strong><br />
Gleichaltrigen eingehen, Ablösung von Eltern und anderen Autoritätspersonen, Qualifikationen für das spätere Berufsleben<br />
42
van der Linden 1995). Kinder und besonders Jugendliche werden in diesem Prozeß als „produktiv<br />
realitätsverarbeitende Subjekte“, als „Konstrukteure ihrer eigenen Lebenswelt“ verstanden<br />
(vgl. Hurrelmann 1994, 72).<br />
Jenseits oder zusätzlich zu den „normalen“ Entwicklungsaufgaben müssen Kinder und Jugendliche<br />
immer wieder <strong>mit</strong> außergewöhnlichen Veränderungen, Vorfällen und Erschütterungen<br />
umgehen, die nicht jede Person betreffen. Diese Erschütterungen können durch einschneidende<br />
oder dramatische Lebensereignisse ausgelöst werden (zum Beispiel Trennung,<br />
Tod), aber auch von gesellschaftlichen oder kulturellen Veränderungen (zum Beispiel „Wende“,<br />
Kulturwechsel bei Migration) herrühren. Sowohl die normalen Entwicklungsaufgaben als<br />
auch die extern ausgelösten Ereignisse führen zu Übergangssituationen, die ein Umgehen<br />
da<strong>mit</strong> (� Coping) erzwingen (vgl. Klaasen/van der Linden 1992).<br />
Armutsauslöser und Armutsursachen (zum Beispiel Trennung der Eltern), die Armut selbst<br />
(zum Beispiel irgendwo nicht <strong>mit</strong>machen können) sowie Armutsfolgen (zum Beispiel ausgelacht/ausgegrenzt<br />
werden) führen zu Erschütterungen und da<strong>mit</strong> erst einmal zu außergewöhnlichen<br />
Belastungen der davon betroffenen Kinder und Jugendlichen, die sie dann neben<br />
ihren normalen Entwicklungsaufgaben zusätzlich bewältigen müssen. Den Copingstrategien,<br />
den Haltungen und Handlungen von armen Kindern und Jugendlichen, kommt auch deshalb<br />
eine außerordentlich große Bedeutung zu, weil sich soziale Hilfestellungen an diesen orientieren<br />
beziehungsweise diese berücksichtigen müssen.<br />
Die im Kontext dieser Untersuchung wichtigen Fragen lauten: Wie bewältigen arme Kinder<br />
und Jugendliche die normalen Entwicklungsaufgaben respektive Lebensanforderungen?<br />
Welche besonderen Belastungen und da<strong>mit</strong> Anforderungen stellen sich ihnen auf diesem<br />
Weg? Und: Wie gehen sie <strong>mit</strong> diesen außergewöhnlichen Belastungen um?<br />
Nur wenige AutorInnen beschäftigten sich bislang systematisch <strong>mit</strong> diesen Fragen. Hinweise<br />
zu Problemen und zur Problembearbeitung von armen Kindern und Jugendlichen finden sich<br />
bei Dangschat (1996, 169-171) und Bieligk (1996, 106-125). Zur Beantwortung der Fragen,<br />
denen in Teil II anhand einzelner Fallbeispiele nachgegangen wird, wird nachfolgend das<br />
Grundgerüst eines eigenen theoretischen Konstrukts entwickelt, das es zukünftig in anderen<br />
Untersuchungen zu überprüfen und vor allem zu differenzieren gilt. An dieser Stelle und im<br />
Rahmen der Teilstudie „Arme Jugendliche“ innerhalb der gesamten AWO-ISS-Studie können<br />
nur erste Gedanken dazu entwickelt und ausgeführt werden. Die Darstellung erfolgt deshalb<br />
auch in Formen von Exkursen.<br />
Exkurs 1 enthält ein allgemeines Modell der Problembewältigung, das die verschiedenen<br />
Phasen des Problembewältigungsprozesses darstellt und wichtige Einflußfaktoren für Einschätzung<br />
und Coping benennt. Dieses Modell diente als implizites Auswertungsraster bei<br />
der Analyse der biographischen Interviews, ohne daß darauf bei den Darstellungen im einzelnen<br />
Bezug genommen wird. Exkurs 2 beschäftigt sich <strong>mit</strong> verschiedenen Copingformen.<br />
erwerben, sozial verantwortungsvolles Verhalten entwickeln, eigenständige internalisierte Wertestruktur entfalten, stabiles<br />
Selbstkonzept herausbilden (vgl. unter anderem Ferchoff/Neubauer 1997, 117/118).<br />
43
Exkurs 1<br />
Abb. 7: Problembewältigung („Coping“) – Ein Prozeß-Modell (in Anlehnung an Ulich u. a. 1985 und<br />
Klaasen/van der Linden 1992)<br />
44<br />
Potentiell krisenhaftes Ereignis/<br />
potentiell belastende Situation<br />
Einschätzung der<br />
Belastung/Bedrohung<br />
Einschätzung der Bewältigungsmöglichkeiten<br />
Coping – Form der Bewältigung<br />
aktional intrapsychisch<br />
(g) (h)<br />
Gesellschaftliche<br />
Rahmenbedingungen (a)<br />
Individuelle Situation (b)<br />
Subjektive Ziele (c)<br />
Personale Ressourcen (d)<br />
Soziale Ressourcen (e)<br />
Soziokulturelle Einflüsse (f)<br />
Erleben als Erfolg/Mißerfolg<br />
Handeln/Haltung in späteren<br />
Belastungssituationen
Das Modell (vgl. Abbildung 7) sieht das Coping, die Formen der Bewältigung, als Prozeß an.<br />
Am „Anfang“ steht ein potentiell krisenhaftes Ereignis oder eine potentiell belastende Situation<br />
(zum Beispiel Arbeitslosigkeit des Vaters). Diese(s) muß von den davon betroffenen Personen<br />
irgendwie ver- beziehungsweise bearbeitet werden (= vorläufiges „Ende“ des Prozesses).<br />
Die Form der Bearbeitung beziehungsweise des Copings ist abhängig davon, wie bedrohlich<br />
beziehungsweise belastend die Situation eingeschätzt wird und wie – nicht zuletzt<br />
aufgrund vorangegangener Erfahrungen – die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten eingeschätzt<br />
werden (= Zwischenschritte). Auf diese Einschätzungen und das Coping selber haben<br />
neben den früheren Erfahrungen des Erfolgs/Mißerfolgs (a) die konkreten gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen, (b) die je konkrete individuelle Situation, (c) die subjektiven Ziele,<br />
(d) die personalen Ressourcen, (e) die sozialen Ressourcen und nicht zuletzt (f) soziokulturelle<br />
Faktoren einen Einfluß (= Einflußfaktoren).<br />
Im Zusammenhang <strong>mit</strong> den (Fall-)Analysen (vgl. Teil II) werden die genannten Einflußfaktoren<br />
folgendermaßen in Fragen umgesetzt:<br />
(a) Gesellschaftliche Rahmenbedingungen<br />
Welche allgemeinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind für das Kind oder den<br />
Jugendlichen zum Zeitpunkt des Auftretens des (potentiell) belastenden Ereignisses relevant?<br />
� Zum Beispiel: Ausmaß der Jugendarbeitslosigkeit, ausländerrechtliche Regelungen,<br />
institutionelle Vorgaben zum Schulbesuch.<br />
(b) Individuelle Situation<br />
Wie sieht die „objektive“ Situation des Kindes oder des Jugendlichen zum Zeitpunkt des<br />
Auftretens des (potentiell) belastenden Ereignisses aus? � Unter anderem: Alter, familiäre<br />
Situation, finanzielle Situation, schulische/berufliche Situation, Netzwerk.<br />
(c) Subjektive Ziele<br />
Wie sehen die explizit beziehungsweise implizit formulierten Ziele (so vorhanden) des<br />
Kindes oder des Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt aus? � Zum Beispiel denkbar: Abgrenzung<br />
von den Eltern respektive Lebensweise der Eltern; schulisches/berufliches<br />
Vorankommen; Partnerschaft.<br />
(d) Personale Ressourcen<br />
Über welche personalen Ressourcen verfügt das Kind oder der Jugendliche zu diesem<br />
Zeitpunkt? Wie sieht sein Selbstkonzept (Selbstbewußtsein, Selbstwirksamkeit, Ich-Kontrolle)<br />
aus? Wie seine Kontrollüberzeugung (intern/extern)? Wie ist sein Wohlbefinden?<br />
(e) Soziale Ressourcen<br />
Wie sieht die mögliche soziale Unterstützung aus?<br />
• Umfang? � Netzwerk? (Anzahl, Nähe der Interaktionspartner, Dauer der Beziehungen,<br />
Kontakthäufigkeit)<br />
• Qualität? � Einschränkungen und Ressourcen der Partner? � Art der Unterstützung?<br />
• „Paßt“ die Unterstützung?<br />
45
(f) Soziokulturelle Einflüsse<br />
Welche Werte und Normen beeinflussen das Denken und Handeln des Kindes beziehungsweise<br />
Jugendlichen? Welche Praktiken und Wissenssysteme stehen ihm/ihr aufgrund<br />
ihrer bisherigen Erfahrungen zur Verfügung?<br />
(g) und (h) Aktionale und intrapsychische Copingformen<br />
Wie ist die Copingstrategie? (vgl. auch Exkurs 2)<br />
Exkurs 2<br />
Coping kann in vielerlei Form stattfinden. In der Literatur, die sich <strong>mit</strong> Coping oder Bewältigung<br />
beschäftigt (vgl. unter anderem Trautmann-Sponsel 1988, Lazarus/Folkman 1984,<br />
Thomae 1984, Richter 1999, Klaasen/van der Linden 1992, Ulich 1985), finden sich vielfältige<br />
Kategorisierungen oder Kategorisierungsversuche zu Copingformen. Die grundsätzlichste<br />
Unterscheidung ist wohl die zwischen aktionalem Coping (� Bewältigungshandeln) und<br />
dem intrapsychischen Coping (� Bewältigungshaltung).<br />
Tabelle 3 gibt einen Überblick über mögliche Copingformen, wie sie von verschiedenen<br />
AutorInnen anhand theoretischer und empirischer Studien erarbeitet wurden. Es wird versucht,<br />
in einer Übersicht die verschiedenen Begrifflichkeiten, die nicht zuletzt einen sehr unterschiedlichen<br />
Abstraktionsgrad haben, einander zuzuordnen und vor allem auf die beiden<br />
schon in Exkurs 1 genannten grundlegenden Kategorien des „aktionalen“ und des „intrapsychischen“<br />
Copings zu beziehen. Bei der Analyse und Darstellung der Fallbeispiele in Teil II<br />
wird insbesondere auf die weniger abstrakten Begrifflichkeiten von Thomae, Richter und<br />
Klaasen/van der Linden Bezug genommen.<br />
6.3 Armutskarrieren von Kindern und Jugendlichen – Was ist „erfolgreiche“<br />
Bewältigung?<br />
Die in den vorhergehenden Kapiteln vorgestellten Konzepte – das multidimensionale Armutskonzept<br />
und das Copingkonzept – legen es nahe, daß Armut in der Kindheit und/oder Jugend<br />
nicht zu eindeutigen Wegen in das Erwachsensein und da<strong>mit</strong> in die Autonomie führt:<br />
Zu vielgestaltig sind die Einflußfaktoren, die die Lebenssituation des Minderjährigen in Armut<br />
bestimmen (vgl. Abbildung 6); zu variationsreich sind die bei der Problemwahrnehmung und<br />
Problembewältigung wichtigen Variablen (vgl. Abbildung 7).<br />
46
Arme Kinder und Jugendliche sind wie alle anderen Heranwachsenden – selbst unter<br />
größten Einschränkungen – nicht nur passive Opfer ihrer Situation, sondern immer auch<br />
aktiv Handelnde. Je nach Konstellation und Vorgeschichte gehen sie <strong>mit</strong> den gleichen Problemen<br />
(zum Beispiel beengte Wohnverhältnissen, familiale Konflikte) jeweils unterschiedlich<br />
um. Des weiteren kämpfen sie oft <strong>mit</strong> ganz unterschiedlichen Armutsfolgen oder Problemen.<br />
Das heißt in der Konsequenz, daß familiäre Armut letztlich zu ganz unterschiedlichen Lebensläufen<br />
19 führt: Am einen Ende stehen Lebensläufe, bei denen sich <strong>mit</strong> Blick auf die Kinder<br />
die familiäre Armut verstetigt oder wiederholt (� Verlaufstyp „Vererbung von Armut“).<br />
Am anderen Ende finden sich Wege, die gemessen an gesellschaftlichen Normalitätsstandards<br />
als „erfolgreich“ bezeichnet werden können, also ein sozialer Aufstieg erfolgt (� Verlaufstyp<br />
„Ausstieg aus der Armut “).<br />
Entsprechend steht in Teil I des Berichts der Verlaufstyp „Vererbung von Armut“ im Mittelpunkt.<br />
Indem das Scheitern an der sogenannten ersten Schwelle (Übergang Schule – Beruf/<br />
Ausbildung) betrachtet wird, richtet sich der Blick auf arme und benachteiligte Jugendliche,<br />
denen an der Schwelle zum Erwachsensein eine „Abstiegskarriere“ droht. Es werden dort –<br />
soweit dies aufgrund vorliegender Daten und Veröffentlichungen möglich war – Faktoren<br />
benannt, die das Scheitern begünstigen. Außerdem werden Maßnahmen dargestellt, die den<br />
Betroffenen helfen sollen, diesen Weg wieder zu verlassen. Durch eigene Erhebungen wird<br />
schließlich in Teil II der Verlaufstyp „Ausstieg aus der Armut“ beleuchtet, der soziale Aufstieg<br />
und die „erfolgreiche“ Armutsbewältigung. Die Analyse von Einzelfällen dieses Verlaufstypus<br />
soll vor allem Hinweise auf förderliche Faktoren geben. Die Rolle von (professionellen) Hilfestellungen<br />
auf dem Weg der „erfolgreichen“ Armutsbewältigung wird untersucht, nicht zuletzt<br />
um zur Weiterentwicklung des Hilfesystems beizutragen.<br />
Zunächst aber gilt es, sich <strong>mit</strong> der Frage auseinanderzusetzen, wann von „Erfolg“ im Sinne<br />
einer „Aufstiegskarriere“ gesprochen werden sollte und kann. In Abbildung 8 sind die verschiedenen<br />
möglichen Wege graphisch dargestellt.<br />
Abb. 8:Mögliche Lebensverläufe und Karrieren unter Armutsbedingungen<br />
Ausgangssituation<br />
in der<br />
Familie:<br />
(familiäre)<br />
Armut<br />
19 Wird von der prinzipiellen Offenheit der Wege und Karrieren (auch unter Armutsbedingungen) ausgegangen – wie es das<br />
ISS-Projektteam tut –, dann wird allgemein von einem „kontingenten Karrierekonzept“ gesprochen. In der Armutsforschung<br />
empirisch angewandt wurde es in erster Linie von Monika Ludwig, die die Wege/Karrieren von erwachsenen SozialhilfebezieherInnen<br />
analysiert hat (vgl. zusammenfassend Leibfried u. a. 1995, 185-201).<br />
48<br />
(1) „Erfolgreiche Biographie“<br />
(2) „Biographischer Erfolg“/<br />
„Biographie als Leistung“<br />
(3) Verstetigung der Armutssituation<br />
(4) Weiterer sozialer Abstieg<br />
„Erfolg“/<br />
Aufstieg<br />
„Vererbung“/<br />
Verstetigung von<br />
Armut
Biographien beziehungsweise Lebenswege und Karrieren können – in Anlehnung an Wohlrab-Sahr<br />
(1995) – aus zwei Perspektiven betrachtet werden: (a) einer Außenperspektive, die<br />
an normativen, interindividuell gültigen Kriterien orientiert ist, und (b) einer Innenperspektive,<br />
die sich an individuellen biographischen Kriterien orientiert.<br />
Zu (a): Aus der Außenperspektive ist eine menschliche Biographie dann „erfolgreich“, wenn<br />
die gesellschaftlichen Standard-Karriereetappen erreicht und fristgerecht (das heißt <strong>mit</strong> dem<br />
entsprechenden Timing) durchlaufen werden, beispielsweise wenn ein adäquater schulischer<br />
und beruflicher Abschluß im Rahmen der üblichen „Zeitfristen“ eines Landes erreicht wird.<br />
Besondere individuelle Erschwernisse auf dem Weg werden für die Bewertung des Erfolgs<br />
nicht berücksichtigt. Liegt im Sinne dieser Außenperspektive Erfolg vor, so wird im weiteren<br />
von einer „erfolgreichen Biographie“ gesprochen (vgl. Abbildung 8 (1)).<br />
Zu (b): Aus der Innenperspektive hingegen können auch Wege beziehungsweise Karrieren<br />
als „erfolgreich“ bewertet werden, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen. „Erfolg“<br />
wird dann <strong>mit</strong> Blick auf die konkrete individuelle Biographie bestimmt: Erscheint der zurückliegende<br />
Weg als ganz persönliche „Leistung“, als gelungene Bewältigung (besonderer) biographischer<br />
Anforderungen, dann wird im folgenden von einem „biographischen Erfolg“<br />
gesprochen. Dies geschieht auch dann, wenn <strong>mit</strong> Blick auf die gesellschaftlichen Normalvorstellungen<br />
nur Teilziele erreicht sind (vgl. Abbildung 8 (2)). In diesen Fällen weist der Weg<br />
zwar nach oben (� Aufstiegskarriere), erscheint aber als weniger steil.<br />
Als „nicht erfolgreiche Biographien“ werden Wege betrachtet, die aus der Außen- und<br />
Innenperspektive (<strong>mit</strong> dem Blick auf die individuelle Biographie) keinen Hinweis auf eine<br />
Aufwärtstendenz aufweisen (vgl. Abbildung 8 (3) und (4)) oder die <strong>mit</strong> Blick auf die Ausgangssituation<br />
im Elternhaus eine Verstetigung („Vererbung“) der Armut beziehungsweise<br />
Problemlage nahelegen.<br />
Für die Zuordnung zu zwei Verlaufstypen und den darin genannten vier Karrieretypen ist<br />
zunächst einmal nicht entscheidend, wie die aktuelle materielle Lage aussieht. So kann jemand<br />
durchaus zu den „erfolgreichen“ Typen (1) oder (2) gehören und noch (!) in prekären<br />
materiellen Verhältnissen leben. Insbesondere im jungen Erwachsenenalter gehören – unter<br />
anderem ausbildungsbedingt – „Armutsphasen“ nicht selten zur gesellschaftlichen Normalität.<br />
Entscheidend ist, daß <strong>mit</strong>telfristig ein autonomes Leben oberhalb der Armutsgrenze<br />
wahrscheinlich erscheint.<br />
49