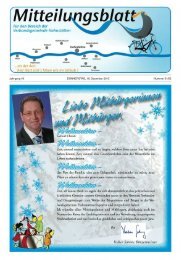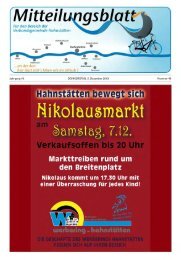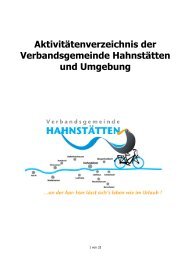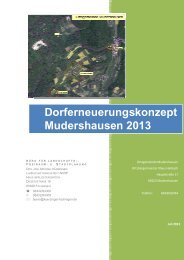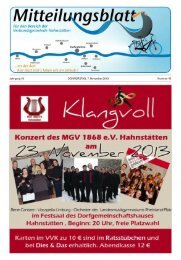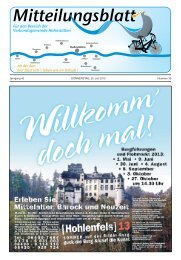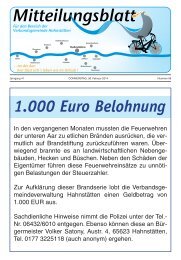Rundgang durch Oberneisen - VG Hahnstätten
Rundgang durch Oberneisen - VG Hahnstätten
Rundgang durch Oberneisen - VG Hahnstätten
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Rundgang</strong> <strong>durch</strong><br />
<strong>Oberneisen</strong><br />
1
1. Allgemeines<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
2. Ruine der Burg <strong>Oberneisen</strong> (Burgmauer)<br />
3. Evangelische Rundkirche <strong>Oberneisen</strong><br />
4. Bergbau<br />
5. Kaltenbach, Herbach und Welsbach<br />
6. Mühlen<br />
7. Turnhalle<br />
8. Baden<br />
9. Eisenbahn<br />
10. Feuerschutz<br />
11. Wasser<br />
12. Schule<br />
13. Aartalradweg<br />
14. Wandern<br />
15. Aarhöhenweg<br />
2
(1) <strong>Oberneisen</strong><br />
Der Ort wurde offenbar bereits 790 erwähnt (Nasonia), als Kaiser Karl der<br />
Große dortige Güter an die Abtei Prüm vergibt. Kaiser Otto I. schenkte dem<br />
Mainzer Kloster St. Alban 958 Grund und Boden in <strong>Oberneisen</strong> (Nasina).<br />
Bereits um das Jahr 800 gab es hier eine nicht unbeachtliche Ansiedlung und<br />
eine Mühle. Waldbesitz hat die Gemeinde erst seit 1812 <strong>durch</strong> die Teilung des<br />
Fuchsenhöhler Märkerwaldes. Um 1840 wird <strong>Oberneisen</strong> im wesentlichen so<br />
beschrieben, wie wir es heute kennen. Damals gab es u.a. einen Geisenhof.<br />
Leute die sich keine Kuh sondern nur eine Ziege leisten konnten, wohnten hier.<br />
(2) Ruine der Burg zu <strong>Oberneisen</strong><br />
Rechts neben der wunderschönen Rundkirche befindet sich die Westwand einer<br />
um 1288 erwähnten Burg, als Markolf von Neisen das an Stelle eines älteren<br />
Hofes am Fuße des Berges neu erbaute befestigte Haus zu Lehen erhielt.<br />
Heute steht nur noch eine vier Stockwerk hohe, ca. 20 m lange und über einen<br />
Meter dicke Längsmauer. Die Ruine lässt auf eine mächtige Burganlage<br />
schließen. An der Wetterseite der Burg stand das Junkerhaus, das zur Burg<br />
gehörte und noch höher stand. Hier saßen die Wächter, denn von hier aus hatte<br />
man eine weite Sicht in das obere und untere Aartal, nach dem Einrich, Taunus<br />
und Westerwald.<br />
Das Dorf Nasina oder Nesina, das an einer Durchgangsstraße lag, wurde im<br />
Dreißigjährigen Krieg vollständig zerstört.<br />
(3) Evangelische Kirche <strong>Oberneisen</strong>, Kirchberg<br />
Eine Kirche gab es bereits 881 und als diese baufällig war, wurde sie 958 der<br />
Abtei St.Alban in Mainz geschenkt und von deren Abt wieder hergestellt. Um<br />
diesen Kirchenbau gibt es wenig Wissen, da die Kirchenakten beim Brande<br />
eines Klosters des St.Alban Stifts in Mainz Opfer der Flammen wurden.<br />
1525 wurde der Chor der Kirche von Grund auf neu gebaut. Größere<br />
Renovierungsarbeiten gab es 1733. Der Bauzustand wurde seit 1780 immer<br />
wieder beklagt. 1812 wurde der Kirchenbau dann bis auf dem Turm niedergelegt<br />
und mit den Vorarbeiten für den Bau der neuen Kirche begonnen.<br />
Die jetzige Rundkirche wurde von 1816 - 1819 vom Herzoglich-Nassauischen<br />
Hofbaudirektor Friedrich Ludwig Schrumpf unter Einbeziehung eines<br />
romanischen Turmes erbaut. Schrumpf hat mit der ev. Kirche einen reinen<br />
Zentralbau geschaffen, zugleich eines der besten Werke des klassizistischen<br />
Kirchenbaus. Der aus einem regelmäßigen Zehneck bestehende Baukörper ist<br />
außen an den Ecken <strong>durch</strong> Pilaster verstärkt, hat <strong>durch</strong>gehende Bogenfenster, an<br />
der Westseite eine offene Vorhalle mit vier toskanischen Säulen und<br />
3
Dreiecksgiebeln, hinter dem der geschickt in den Bau integrierte romanische<br />
Turm aufragt. Der Mittelteil des Innenraumes wird von einer Holzkuppel mit<br />
gemalten Rippen und Oberlicht überdeckt. Kannelierte dorische Steinsäulen<br />
trennen den niedrigen, flachgedeckten Umgang ab, über dem Emporen liegen. In<br />
der vom Gestühl freigehaltenen Mitte steht der Altar. Schrumpf (aus Herzogtum<br />
Nassau 1806-1866 S. 319). Schrumpf war auch Baumeister des Jagdschlosses<br />
Platte, Wiesbaden.<br />
Die Gemeinden Lohrheim, Netzbach und <strong>Oberneisen</strong> finanzierten den Neubau.<br />
Bei der Einweihung am 27. Okt. 1819 gab es unter großer Beteiligung der<br />
Bevölkerung einen feierlichen Umzug vom Pfarrhaus zur Kirche.<br />
Nördlich der Alpen gibt es einige Rundkirchen. <strong>Oberneisen</strong> scheint jedoch die<br />
einzige zu sein, deren Altar in der Mitte des Raumes steht.<br />
Der Glockenturm der Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Zu der<br />
Säulenhalle am Eingangsportal führt eine breite Freitreppe. In der Säulenhalle<br />
befindet sich ein rundbogiges Kreuzgewölbe ohne Rippen. Der Turm birgt eine<br />
Uhr, deren großer Zeiger 1 m lang ist und 3 Glocken (Glaube, Liebe, Hoffnung<br />
genannt), die nach dem Kriege zu Bockenem im Harz gegossen wurden. Das<br />
Innere der Kirche hat 10 hohe, dicke, gekehlte Säulen. In der Mitte der Kirche<br />
steht der runde Altar mit einer Marmorplatte von 1,75 m Durchmesser, die bei<br />
der letzten Renovierung eigens aus einem französischen Marmorbruch<br />
angeliefert wurde.<br />
Besichtigungen sind nach Absprache mit Frau Friedrichs, Schöne Aussicht 14,<br />
65558 <strong>Oberneisen</strong>, Tel.: 06430/7469, möglich.<br />
(4) Bergbau<br />
1648 taucht der Flurname „In der Eysengrub“ auf, was auf die Nutzung von<br />
Eisensteinvorkommen schließen lässt. Eine weitere Erwähnung erfolgt 1779.<br />
Um 1870 ist von mehreren Eisensteingruben die Rede.<br />
Grube Lichfeld, Grube Schmerzensreich, Grube Rothenberg. Die letzte wird<br />
1905 einschl. sämtlicher Immobilien von der Phönix AG an den Kaufmann<br />
Louis Haas zu Magdeburg verkauft. 1913 taucht in den Akten die Phönix AG<br />
wieder auf und 1926 ist es die Sieg-Lahn-Bergbau-Gesellschaft mbH in<br />
Weilburg. 1914 waren 52 Männer in der Grube beschäftigt, wovon einige<br />
täglich den Weg von Schönborn zur Grube hin und zurück gegangen sind.<br />
Die 1862 konsolidierte Grube Rothenberg förderte hochwertigen Roteisenstein,<br />
stark manganhaltigen Brauneisenstein und Phosphorit. Die wunderschönen Rhodochrosit-Stufen<br />
(Manganspat oder Himbeerspat) aus dieser Grube sind in<br />
vielen bedeutenden Sammlungen zu sehen und werden heute noch von Mineraliensammlern<br />
teuer bezahlt.<br />
4
Die Grebenstrasse war der Haupttransportweg der Grube Rothenberg. Bis 1907<br />
wurde das Erz mit einer Drahtseilbahn zum Bahnhof befördert. 1968 findet man<br />
auf einem Grundstück „Schöne Aussicht“ noch tiefgehende Fundamente der<br />
Mittelstation einer ehemaligen Seilbahn.<br />
1895 gab es einen Antrag zur Aufstellung eines Dampfkessels <strong>durch</strong> die<br />
Phosphorit-Aufbereitungsanstalt in Weilburg. Phosphorit wurde und wird als<br />
Düngemittel verwendet.<br />
Steinbrüche gab es an der Lay (oberhalb Wirthmühle – Kalkstein) und an der<br />
Rabenlay (Porphyr). Von diesem Steinbruch ist nur noch am Ende der<br />
Herbachstrasse, von wo aus sich eine Mulde bis über die Höhe des<br />
Aussichtstempelchens zieht, vom aufmerksamen Besucher etwas zu sehen.<br />
Beim Kalkwerk Schaefer befanden sich zwei weitere Steinbrüche. Neben den<br />
Steinen benötigten die Bürger jedoch auch geeigneten Kies zum Bauen. Zu<br />
diesem Zweck unterhielten noch 1932 die beiden Landwirte Wilhem Hasselbach<br />
und Karl Wilhelm Heimann II oben auf dem Enchesberg eine Kiesgrube.<br />
Neben dem Eisensteinabbau in grauer Vorzeit ist der bedeutendste Bodenschatz<br />
im Aartal der „Kalkstein“. 1492 wird in Limburger Bauakten festgehalten, dass<br />
in <strong>Hahnstätten</strong> schon vor Jahrhunderten Kalk gebrannt wurde. Große Felsen<br />
ragten an der Aarstraße zwischen Diez und <strong>Hahnstätten</strong> empor (die Lay). 1860<br />
errichtete Johann Schaefer eine Ziegelhütte und eine bescheidene Kalkbrennerei.<br />
Nach Ausbau der Eisenbahnstrecken im Aar- und Lahntal (1864, 1870) konnte<br />
ein größerer Abnehmermarkt erschlossen werden Das kleine Kalkwerk in<br />
<strong>Hahnstätten</strong> (liegt auch teilweise auf <strong>Oberneisen</strong>er und Lohrheimer Gemarkung)<br />
wuchs im Laufe der Jahrzehnte zu einem Großbetrieb seiner Branche heran.<br />
Der Kalk wird in den Steinbrüchen schichtweise terrassenförmig auf Sohlen<br />
abgebaut. Was früher schwerste Handarbeit war, wurde in den letzten<br />
Jahrzehnten <strong>durch</strong> Mechanisierung und Automatisierung den modernen<br />
Arbeitsbedingungen angepasst.<br />
Auf Grund des hohen Reinheitsgrades findet der Kalk im besonderen<br />
Verwendung in der chemischen, kosmetischen und pharmazeutischen Industrie,<br />
in der Stahl-, Kunststoff- und Papierindustrie, im Bereich des Baugewerbes und<br />
des Umweltschutzes (Abwasser).<br />
1916 wird in <strong>Oberneisen</strong> eine Kaolinschlemmerei errichtet. Ein Abwiege- und<br />
Versandgebäude kommt 1918 hinzu. 1920 und 1922 wird die Trocknungsanlage<br />
erweitert. Eine Lagerhalle wird 1929 unmittelbar am Bahnkörper errichtet.<br />
Der Transport des Rohmaterials aus der Grube in Lohrheim zur<br />
Verarbeitungsanlage in <strong>Oberneisen</strong> erfolgte anfangs mit Pferden.<br />
Das Kaolin wurde in der Schlämmerei aus dem Rohmaterial herausgewaschen.<br />
Der Betrieb in <strong>Oberneisen</strong> ist den Bürgern unter „Otto Schmidt G.m.b.H.<br />
5
<strong>Oberneisen</strong>“ ein Begriff. Zuletzt wurde er von Dr. Walter Wirth bis zur Aufgabe<br />
um die Jahrhundertwende 2000 geführt.<br />
Die Firm Erbslöh aus Geisenheim betreibt in Lohrheim gleichfalls Kaolinabbau<br />
und errichtete 1921 auch eine Lagerhalle mit Gleisanschluss in <strong>Oberneisen</strong>. Der<br />
Abbaubetrieb in Lohrheim ist noch aktiv. Der Transport erfolgt heute mit<br />
Lkw’s. Die Lagerhalle befindet sich noch rechts am Ortseingang bei den<br />
Gleisen, von der B 54 kommend.<br />
(5) Kaltenbach, Herbach und Welsbach<br />
Der Kaltenbach entspringt etwa 1 km südöstlich von Kaltenholzhausen im<br />
Wald. Er fließt <strong>durch</strong> das Dorf in Richtung Westen. Nach ca. 3 km erreicht er<br />
Netzbach und nach etwa noch mal so langer Strecke mündet er in <strong>Oberneisen</strong> in<br />
die Aar.<br />
Das Kaltenbachtal zwischen Netzbach und <strong>Oberneisen</strong> ist eines der<br />
romantischsten Täler in der Gegend. Seit 2003 verläuft hier ein Teilstück des<br />
„Aar-Höhenweges“, der die Aar von der Quelle in Taunusstein-Orlen bis zur<br />
Mündung in Diez in die Lahn begleitet.<br />
Von Mensfelden her plätschert der Herbach am Nordrand des Dorfes entlang.<br />
Von Lohrheim kommt der Welsbach, der noch vor der Aarbrücke in die Aar<br />
mündet.<br />
(6) Mühlen<br />
Neben der bereits 790 erwähnten Mühle (Mühlweg) wird „obig <strong>Oberneisen</strong>“<br />
eine neue Mühle erbaut, die 1611 als einzige Mühle erwähnt wird. Später trägt<br />
sie den Namen Wirthmühle, erhielt um 1710 eine Ölmühle und einen zweiten<br />
Gang. Es muss sich hier um die zuletzt getrennt arbeitenden Mühlen der<br />
Familien Kauffeld und Baseler gehandelt haben. Die Gebäude sind heute noch<br />
vorhanden.<br />
Im Dorf gab es noch eine Ölmühle, die im 17. Jahrhundert nachgewiesen wurde<br />
und heute nicht mehr vorhanden ist. In der „Herbach“, auf dem Weg nach<br />
Mensfelden steht die „Herbächer Mill“. Sie wurde gegen den Willen der<br />
Gemeinde <strong>Oberneisen</strong> gebaut. Die Gemeinde hatte eine Bittschrift an den<br />
Grafen Johann von Nassau gegen den Bau der Mühle eingereicht, weil Sie den<br />
Platz in der Herbach als Weide für das Vieh behalten wollte. Außerdem wurde<br />
befürchtet, dass der Müller, sein Gesinde und das Vieh Schaden an den<br />
6
Wingerten anrichten würden. Und für die Winterzeit wurde das Verbrennen der<br />
Pfähle aus den Wingerten befürchtet. Der Amtmann und Keller zu Diez erklärte<br />
jedoch die Einwände für nicht stichhaltig. Worauf dem Stefan Mohren 1572 das<br />
Bauen der Mühle gestattet wurde.<br />
Die Mühle von 1572 gab es 1592 nicht mehr. Seit 1696 war jedoch in der<br />
Herbach dann wieder eine Mühle aktiv. Heute sind auf dem Anwesen zur<br />
Freude der Radfahrer und Spaziergänger Esel, Hühner, Gänse und Tauben zu<br />
sehen. Die heutigen Bewohner der Mühle wollen <strong>durch</strong> Züchtungen die<br />
französische Eselrasse Poitou erhalten. Informationen gibt’s bei der<br />
Interessengemeinschaft der Esel- und Mulifreunde in Deutschland e.V.<br />
Steinweg 12 , 65520 Bad Camberg und unter www.esel.info<br />
Die heute in der Herbach stehende Scheune der Mühle stand früher an einem<br />
anderen Ort und wurde aus Kirberg nach <strong>Oberneisen</strong> umgesiedelt.<br />
Etwas weiter in <strong>Hahnstätten</strong> gab es dann noch eine Ölmühle. Der letzte<br />
Gebäudeteil wird im Jahre 2005 abgebrochen.<br />
(7) Turnhalle<br />
Wenn man von Lohrheim die erste Brücke über die Aar passiert hat, findet man<br />
rechts die Turnhalle. Früher stand hier wahrscheinlich das erste Schulhaus der<br />
Gemeinde. Die Versammlungen der Turner fanden früher im „Gasthaus<br />
Thielmann“ in der Hauptstraße statt.(heute nicht mehr als Gasthaus genutzt).<br />
Nach 1933 gab es dann in der Turnhalle einen geeigneten Versammlungsraum.<br />
Die Turnübungen fanden früher im Freien, auf einem kleinen Platz nahe der<br />
Burgmauer statt. Ab 1925 konnte dieser Platz wegen der Gefahr herabfallender<br />
Steine nicht mehr genutzt werden und die Turner übten auf einem Platz am Ende<br />
der Herbachstrasse. 1933 wurde ein Grundstück mit einer nichtvollendeten Halle<br />
in der Bahnhofstraße erworben, und mit viel Eigenleistung, Unterstützung <strong>durch</strong><br />
die Gemeinde, Kirchengemeinde, den Kreis, Bezirksregierung und dem<br />
Landessportbund, die Turnhalle erstellt. Sie ist heute noch Zentrum für Sport<br />
und Kultur für die Gemeindemitglieder<br />
(8) Baden<br />
Als es noch keine Schwimmbäder gab, nutzten die Menschen das Wasser der<br />
Aar zum baden. So wurde auf Betreiben des engagierten Lehrers Gustav Müller<br />
bei Straßenbaumaßnahmen im Jahre1924 ein Anmarschweg zum Badeplatz an<br />
der Aar aufgemessen. Ob er gebaut wurde, hat der Chronist nicht erwähnt.<br />
7
(9) Eisenbahn<br />
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war die Eisenbahn nicht nur das wichtigste<br />
Verkehrsmittel für die Bürger aus <strong>Oberneisen</strong>, sondern auch für die Netzbacher,<br />
Lohrheimer und auch für Heringer Bürger. Auch aus dem südlichen Teil<br />
Niederneisens kamen die Bahnreisenden zum Bahnhof <strong>Oberneisen</strong>, da er näher<br />
gelegen war, wie der Bahnhof Flacht. Die Bahn transportierte u.a.<br />
landwirtschaftliche Produkte, Holz, Kohlen und Briketts. Der Bahnhof<br />
<strong>Oberneisen</strong> erscheint 1874 im Brandkataster. 1923 kam die Bahnstrecke Diez-<br />
Wiesbaden für kürzere Zeit unter die Verwaltung der französischen<br />
Besatzungsmacht. Nach dem zweiten Weltkrieg verlor die Bahn <strong>durch</strong> das Auto<br />
an Bedeutung. Am 26.09.1983 wurde der Personenverkehr und alsbald der<br />
gesamte Bahnverkehr auf der Strecke Diez - Bad Schwalbach eingestellt.<br />
(10) Feuerschutz<br />
Das Löschwasser wurde früher aus dem Kaltenbach, der noch nicht überall im<br />
Dorf verrohrt war und aus Brunnen entnommen. In 1891 errichtet man beim<br />
Anwesen Himberger (später Fuchs) einen Brandweiher. Später wurde auf die<br />
unterirdischen Wasserleitungen Hydranten aufgesetzt, so dass oberirdische<br />
Zapfstellen entstanden. Diese sind mit der Zeit aus dem Ortsbild verschwunden.<br />
Heute benutzt die Feuerwehr Standrohre, die auf oberirdische Zapfstellen<br />
aufgeschraubt werden.<br />
Unter den früheren Feuerlöschgeräten gab es eine Feuerspritze. Diese war eine<br />
von der Hand zu bedienende Saug- und Druckpumpe mit zwei Kesseln und<br />
einem Windkessel dazwischen. Mehrere Männer konnten an beiden Enden<br />
gleichzeitig pumpen. Sie war auf ein einfaches Fahrgestell montiert und konnte<br />
kurze Wegstrecken geschoben und gezogen werden. Untergebracht war sie im<br />
Spritzenhaus unterhalb der Burgmauer. Dieser „Oldtimer“ wurde erst 1955, als<br />
längst eine Motorspritze zur Verfügung stand, verkauft.<br />
1970 wird ein Tragkraftspritzenfahrzeug gekauft und die Freiwillige Feuerwehr<br />
<strong>Oberneisen</strong> besteht nicht mehr nur aus Männern sondern wird seit 1980<br />
tatkräftig von Frauen unterstützt. Die Feuerlöschgeräte sind nun in dem 1967<br />
erbauten Feuerwehrhaus, Schöne Aussicht, untergebracht.<br />
(11) Wasser<br />
Unser wichtigstes Lebensmittel, das Wasser, fließt heute wie selbstverständlich<br />
aus der Leitung. In <strong>Oberneisen</strong> gab es einen 1634 erwähnten Sauerborn, der<br />
wohl die Trinkwasserversorgung des Dorfes sicherstellte. Er befand sich unweit<br />
der Aar, das Wasser sprudelte aus einem Kalkfelsen. Zu Beginn des 19.<br />
8
Jahrhunderts wird die Quelle sogar in einem Atemzug mit dem Fachinger<br />
Brunnen erwähnt. Heute existiert die Quelle nicht mehr.<br />
(12) Schule<br />
1581 wurde der Unterricht wohl im Pfarrhaus erteilt. Ein Schulhaus wurde 1632<br />
errichtet, das bis 1839/40 als solches genutzt wurde. 1839 wurde von den<br />
Gemeinden <strong>Oberneisen</strong> und Netzbach am Weg nach Netzbach der neue<br />
Schulbau errichtet. Als sich Netzbach zum Bau einer eigenen Schule entschloss,<br />
wurde der gemeinsame Schulverband 1868 aufgelöst. Als auch dieses Schulhaus<br />
zu klein war, konnten die Kinder ab 1908 die neue Schule in der Bahnhofstraße<br />
(heute Wohnhaus) besuchen.<br />
(13) Aartalradweg<br />
Er beginnt in Diez und verläuft flach und familienfreundlich bis Aarbergen-<br />
Michelbach.<br />
Zwischen Michelbach und der Abfahrt Laufenselden (vor Hohenstein) kann nur<br />
die B54 benutzt werden, dann verläuft der Radweg nach der Einfahrt<br />
Laufenselden stark ansteigend über Burg Hohenstein. Später wird es dann<br />
wieder flacher.<br />
(14) Wandern<br />
Die waldreiche Umgebung lädt zum Wandern ein. <strong>Oberneisen</strong> und Umgebung<br />
ist auch ein guter Standort für Wanderungen an der Lahn (West und Ost),<br />
Europäischer Fernwanderweg 1 Flensburg-Genua, Aar-Höhenweg,<br />
Jammertalweg, Teile der „Hessenstraße“, Wanderweg „Hohlenfels-Taunus“<br />
(Hasselbach), Loreley-Aar-Radweg, Aartal-Rad (Wander)Weg.<br />
Geführte Wanderungen finden in der Regel am 1. Mittwoch im Monat 14 Uhr<br />
statt. Bekanntmachung erfolgt im Mitteilungsblatt und in der Presse.<br />
(15) Aarhöhenweg<br />
Der Aarhöhenweg führt Sie auf einer Länge von 63 km von der Aar-Quelle bei<br />
Taunusstein-Orlen zur Mündung nach Diez. Der Weg hat einen<br />
Höhenunterschied von 355 m und teils längere Streckenabschnitte im<br />
Waldbereich. Wanderkarte TS-Mitte ISBN-Nr. 3894463082 wird zur Übersicht<br />
empfohlen. Flyer gibt es bei der Verbandsgemeinde <strong>Hahnstätten</strong>.<br />
9
Da der Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht unproblematisch ist,<br />
kommt evtl. die Beförderung für einen Teil der Strecke mit einem Taxi infrage.<br />
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣<br />
Diese kleine Schrift wurde mit freundlicher Genehmigung der Ortsgemeinde<br />
<strong>Oberneisen</strong> <strong>durch</strong> Überlassung der Chronik „Oberneiser Dorfgeschichte“<br />
geschrieben, die liebevoll von Willi Knapp aus Altendiez im Mai 1998<br />
zusammengestellt wurde.<br />
Bärbel Völker, Febr. 2006<br />
Verbandsgemeindeverwaltung <strong>Hahnstätten</strong>, Austr. 4, 65623 <strong>Hahnstätten</strong><br />
Tel.: 06430/9114115<br />
E-mail: baerbel.voelker@vg-hahnstaetten.de<br />
10