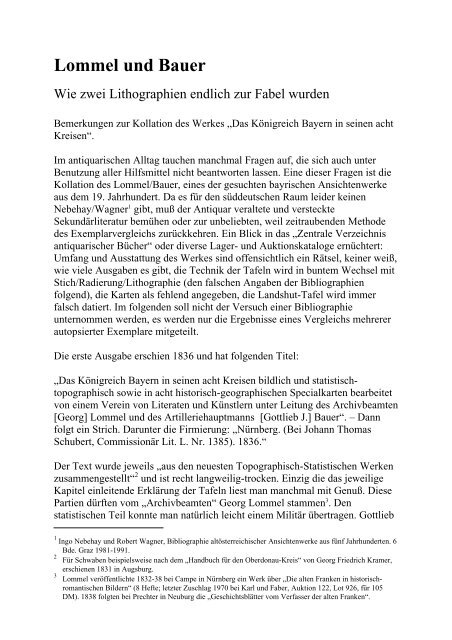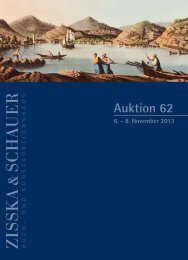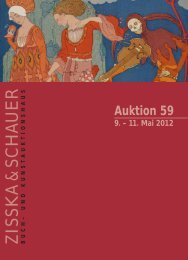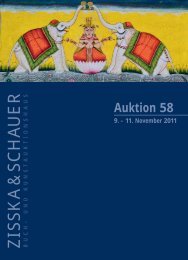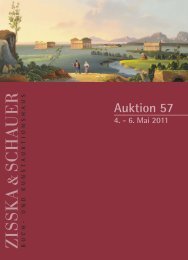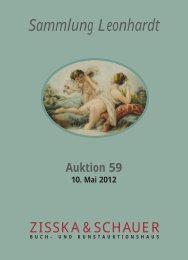Lommel und Bauer
Lommel und Bauer
Lommel und Bauer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Lommel</strong> <strong>und</strong> <strong>Bauer</strong><br />
Wie zwei Lithographien endlich zur Fabel wurden<br />
Bemerkungen zur Kollation des Werkes „Das Königreich Bayern in seinen acht<br />
Kreisen“.<br />
Im antiquarischen Alltag tauchen manchmal Fragen auf, die sich auch unter<br />
Benutzung aller Hilfsmittel nicht beantworten lassen. Eine dieser Fragen ist die<br />
Kollation des <strong>Lommel</strong>/<strong>Bauer</strong>, eines der gesuchten bayrischen Ansichtenwerke<br />
aus dem 19. Jahrh<strong>und</strong>ert. Da es für den süddeutschen Raum leider keinen<br />
Nebehay/Wagner 1 gibt, muß der Antiquar veraltete <strong>und</strong> versteckte<br />
Sek<strong>und</strong>ärliteratur bemühen oder zur unbeliebten, weil zeitraubenden Methode<br />
des Exemplarvergleichs zurückkehren. Ein Blick in das „Zentrale Verzeichnis<br />
antiquarischer Bücher“ oder diverse Lager- <strong>und</strong> Auktionskataloge ernüchtert:<br />
Umfang <strong>und</strong> Ausstattung des Werkes sind offensichtlich ein Rätsel, keiner weiß,<br />
wie viele Ausgaben es gibt, die Technik der Tafeln wird in buntem Wechsel mit<br />
Stich/Radierung/Lithographie (den falschen Angaben der Bibliographien<br />
folgend), die Karten als fehlend angegeben, die Landshut-Tafel wird immer<br />
falsch datiert. Im folgenden soll nicht der Versuch einer Bibliographie<br />
unternommen werden, es werden nur die Ergebnisse eines Vergleichs mehrerer<br />
autopsierter Exemplare mitgeteilt.<br />
Die erste Ausgabe erschien 1836 <strong>und</strong> hat folgenden Titel:<br />
„Das Königreich Bayern in seinen acht Kreisen bildlich <strong>und</strong> statistischtopographisch<br />
sowie in acht historisch-geographischen Specialkarten bearbeitet<br />
von einem Verein von Literaten <strong>und</strong> Künstlern unter Leitung des Archivbeamten<br />
[Georg] <strong>Lommel</strong> <strong>und</strong> des Artilleriehauptmanns [Gottlieb J.] <strong>Bauer</strong>“. – Dann<br />
folgt ein Strich. Darunter die Firmierung: „Nürnberg. (Bei Johann Thomas<br />
Schubert, Commissionär Lit. L. Nr. 1385). 1836.“<br />
Der Text wurde jeweils „aus den neuesten Topographisch-Statistischen Werken<br />
zusammengestellt“ 2 <strong>und</strong> ist recht langweilig-trocken. Einzig die das jeweilige<br />
Kapitel einleitende Erklärung der Tafeln liest man manchmal mit Genuß. Diese<br />
Partien dürften vom „Archivbeamten“ Georg <strong>Lommel</strong> stammen 3 . Den<br />
statistischen Teil konnte man natürlich leicht einem Militär übertragen. Gottlieb<br />
1<br />
Ingo Nebehay <strong>und</strong> Robert Wagner, Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrh<strong>und</strong>erten. 6<br />
Bde. Graz 1981-1991.<br />
2<br />
Für Schwaben beispielsweise nach dem „Handbuch für den Oberdonau-Kreis“ von Georg Friedrich Kramer,<br />
erschienen 1831 in Augsburg.<br />
3<br />
<strong>Lommel</strong> veröffentlichte 1832-38 bei Campe in Nürnberg ein Werk über „Die alten Franken in historischromantischen<br />
Bildern“ (8 Hefte; letzter Zuschlag 1970 bei Karl <strong>und</strong> Faber, Auktion 122, Lot 926, für 105<br />
DM). 1838 folgten bei Prechter in Neuburg die „Geschichtsblätter vom Verfasser der alten Franken“.
J. <strong>Bauer</strong> (über ihn ist nichts zu ermitteln, die Vornamen laut KVK) schrieb die<br />
Angaben denn auch brav aus den vorhandenen Topographien ab. Die Texte sind<br />
zweispaltig gesetzt, jede Kreisbeschreibung umfaßt nur wenige, stets neu<br />
paginierte Seiten. Einzelne Kreisbeschreibungen finden sich in textlich leicht<br />
abweichenden Varianten (am besten kenntlich an der Bogennorm, meist „2.<br />
Aufl.“, genaueres siehe unten). Deshalb tauchen öfter Exemplare mit dem Titel<br />
der ersten Ausgabe auf, aber mit bereits überarbeiteten Texten.<br />
Von dieser ersten Ausgabe gibt es eine Titelvariante, die bisweilen im<br />
Auktionshandel angeboten wird. Der Titel beginnt vollkommen gleichlautend<br />
<strong>und</strong> weicht erst bei der Verfasserangabe ab „[.... ] Specialkarten bearbeitet von<br />
Johann Thomas Schubert <strong>und</strong> einem Verein von Literaten <strong>und</strong> Künstlern unter<br />
Leitung des Archivbeamten <strong>Lommel</strong> <strong>und</strong> des Artilleriehauptmanns <strong>Bauer</strong>“. Die<br />
Firmierung ist dann wieder identisch. Der Verleger mutiert also zum Autor,<br />
<strong>Lommel</strong> <strong>und</strong> <strong>Bauer</strong> werden zu Zuarbeitern. Diese Variante ist laut KVK in<br />
keiner öffentlichen Bibliothek vorhanden, sie läßt sich aber im Auktionshandel<br />
dreimal nachweisen 4 .<br />
Schubert verschwindet dann von der Bildfläche, aber ein Jahr später erscheint<br />
eine zweite Ausgabe mit dem alten Haupt-, doch weitgehend abweichendem<br />
Untertitel.<br />
„Das Königreich Bayern in seinen acht Kreisen bildlich <strong>und</strong> statistischtopographisch<br />
dargestellt, sowie mit acht historisch-geographischen<br />
Specialcharten nach den neuesten Hülfsquellen bearbeitet von einem Vereine<br />
Literaten <strong>und</strong> Künstler.“ Darunter das bayrische Wappen in relativ feinem<br />
Holzschnitt, <strong>und</strong> nach einem Strich die Firmierung „Nürnberg, Friedrich<br />
Napoleon Campe, 1837“. 5<br />
Das Werk hat also seine Autoren verloren, übriggeblieben ist nur noch „Verein<br />
von Literaten <strong>und</strong> Künstlern“, gleichgeblieben ist aber die Ausstattung. Alle drei<br />
Ausgaben haben einen kolorierten Titel <strong>und</strong> 8 kolorierte Kupfertafeln . Alle 8<br />
Tafeln waren vermutlich von Johann Friedrich Carl Kreul gezeichnet worden.<br />
4 Erstmals 1977 in der Auktion 20 von Hartung & Karl (Lot 949; Zuschlag 4600 DM). Der Text dieser Variante<br />
umfaßt laut Katalog 100 nicht durchnumerierte Seiten. Genauere Angaben enthalten die Beschreibungen der<br />
letzten beiden Auktionsexemplare (beide bei Tenner im Jahr 1980, Auktion 130, Nummern 3376 <strong>und</strong> 3377,<br />
Zuschläge 6200 <strong>und</strong> 7400 DM) jeweils 10, 7, 9, 10 Seiten, 9 Blätter, 12 Seiten, 11 Blätter, 9 Seiten. Der Text<br />
dieser beiden Exemplare der Titel-Variante ist also bei 6 Kreisen mit der Erstausgabe identisch, der<br />
Rezatkreis hat aber 9 Blätter (wie im Exemplar Hartung Auktion 104, Nummer 1209). Der Untermainkreis<br />
schon in zweiter Auflage (siehe unten). Unterschlagen haben die Katalogbearbeiter offensichtlich den<br />
typographischen Titel <strong>und</strong> die „Erklärung des Titelkupfers“. Diese finden sich im Exemplar der Auktion 47<br />
von Zisska & Kistner 2006: Kollation dort: Isarkreis 9 S., Oberdonaukreis 10 S., Unterdonaukreis 7 S.,<br />
Rezatkreis 8 Bl., Regenkreis 9 S., Obermainkreis 12 S., Untermainkreis 8 Bl., Rheinkreis 9 S.<br />
5 Exemplare dieser Ausgabe sind laut KVK nicht nachweisbar, die einzigen beiden bekannten Auktions-<br />
Exemplare sind ohne Textkollation beschrieben in den Katalogen der Auktion Karl <strong>und</strong> Faber 112 im Jahr<br />
1968 (Lot 702, mit nur 4 Tafeln, Zuschlag 680 DM) <strong>und</strong> Hartung & Karl 122 im Jahr 1970 (Lot 927,<br />
Zuschlag 650 DM). Beide Exemplare waren ohne Karten.<br />
2
Dieser wirkte in Nürnberg als Porträt- <strong>und</strong> Genremaler (zu ihm siehe Nagler<br />
VIII, 77 <strong>und</strong> Thieme-Becker XXI, 515). Mit dem Stich wurden mehr oder<br />
weniger bekannte Künstler betraut (siehe unten). Die Trachten wurden meist<br />
nicht neu gezeichnet, sondern es wurden vorhandene Tafelwerke geplündert, vor<br />
allem Lipowskys „Sammlung der National-Costüme des Königreichs Bayern“<br />
(München 1832). Die Tafeln aller bekannten Exemplare sind koloriert, eine<br />
unkolorierte Variante ist bislang nicht aufgetaucht.<br />
Friedrich Napoleon Campe war der Sohn des bekannten Nürnberger<br />
Bilderbogen-Verlegers Friedrich Campe <strong>und</strong> der Neffe des Heine-Verlegers<br />
Julius Campe in Hamburg. 1833 gründete er zusammen mit Carl Heideloff in<br />
Paris einen Verlag für den Vertrieb „revolutionärer Schriften“ (so wurde seine<br />
Verlagsproduktion von den Zensurbehörden bezeichnet) 6 . 1834 verbot Preußen<br />
sämtliche bisher erschienenen <strong>und</strong> künftig erscheinenden Schriften des Verlags,<br />
der dann 1837 in Konkurs ging. Campe kehrte nach Nürnberg zurück <strong>und</strong> trat in<br />
den Verlag seines Vaters ein 7 . Mit seinem Auftreten wird die Frage nach den auf<br />
den jeweiligen Titeln versprochenen Karten virulent. Campe hatte zunächst aber<br />
ein ganz anderes Problem zu lösen. Schubert die Rechte abzukaufen dürfte<br />
einfacher gewesen sein, als mit den Folgen eines politischen Donnerschlags<br />
zurechtzukommen. Die bayrische Regierung hatte nämlich inzwischen eine neue<br />
Kreiseinteilung verfügt, die am 28. November 1837 in Kraft trat. Diese brachte<br />
territoriale Verschiebungen <strong>und</strong> gleichzeitig eine Veränderung aller<br />
Kreisbezeichnungen. Campe hätte also den Text neu setzen <strong>und</strong> die Tafeln mit<br />
neuen Beschriftungen versehen lassen müssen. Ist dies geschehen? Sind Text<br />
<strong>und</strong> Tafeln den neuen Kreiseinteilungen angepaßt? Leider nur unvollständig.<br />
Campe fand eine Sparlösung: er ließ die alten Texte unverändert <strong>und</strong> druckte nur<br />
ein Einlegeblatt, das in einem autopsierten Exemplar nach der „Erklärung des<br />
Titelkupfers“ eingeb<strong>und</strong>en ist: „Berichtigung zu dem National-Werk Das<br />
Königreich Bayern in seinen acht Kreisen“. Auf dem Blatt finden sich die neuen<br />
Kreisbezeichnungen mit Angabe aller territorialen Veränderungen. Diese konnte<br />
der Käufer natürlich in den Text eintragen, damit hätte er den territorialen<br />
Umfang zumindest richtiggestellt. Auf keinen Fall mehr zu berichtigen waren<br />
natürlich die statistischen Angaben in den Texten zu den einzelnen Kreisen;<br />
Angaben über Bevölkerung, Gewerbe <strong>und</strong> Handel waren nunmehr falsch <strong>und</strong><br />
blieben es auch. Man darf sich hierbei durch die Angabe „2. Aufl.“ in der<br />
Bogennorm mancher Texte nicht täuschen lassen. Alle territorialen <strong>und</strong><br />
statistischen Angaben beziehen sich immer auf die alte Kreiseinteilung.<br />
6 Zur Geschichte des Verlages vgl. H. H. Houben, Verbotene Literatur, Bd. II, S.270-77.<br />
7 Zum Verlag Campe in Nürnberg vgl. Kapp/Goldfriedrich IV, 161-65 <strong>und</strong> die Monographie von Elisabeth<br />
Reynst: Friedrich Campe <strong>und</strong> sein Bilderbogen-Verlag zu Nürnberg 1962. – Der Vater Friedrich Campe sollte<br />
an seinem Erstgeborenen wenig Freude haben. Napoleon Campe neigte nach Art der Söhne reich gewordener<br />
Väter zum Geldausgeben im großen Stil, betrieb aber in der vermutlich 1842 (das genaue Datum ist nicht<br />
bekannt) auf seinen Namen konzessionierten Kunsthandlung den Verlag vor allem lithographierter<br />
Bilderbögen weiter, erwarb 1852 noch die vormals Bäumlersche reale Buchhandelsgerechtigkeit von dem<br />
Maschinenfabriksbesitzer Theodor Cramer-Klett, ging aber schon 1853 in Konkurs <strong>und</strong> starb zwei Jahre<br />
später.<br />
3
Campe vertrieb also seine zweite Ausgabe ungeniert mit dem unveränderten<br />
Text der ersten Ausgabe (bzw. den entsprechenden Varianten). Aber wie<br />
bewältigte er die Umbenennung der Kreise bei den Kupfertafeln? Und wie<br />
reagierte er auf die Verlegung des Regierungssitzes für den Unterdonaukreis<br />
(das heutige Niederbayern) von Passau nach Landshut? Hier war ja eine neue<br />
Darstellung nötig. Vergleicht man die alte Passau-Darstellung mit der neuen<br />
Landshut-Ansicht, stellt man verblüfft fest, daß sie sich im Rahmen <strong>und</strong> bei der<br />
Figurenstaffage aufs Haar gleichen (auch das Monogramm im Sockel ist<br />
dasselbe. Einzig die Stadtansicht im Hintergr<strong>und</strong> wurde ausgetauscht. Bei den<br />
übrigen Tafeln waren nur die Bezeichnungen zu ändern. Im Prinzip war das<br />
recht einfach. Die alten Bezeichnungen mußten ausgeschliffen <strong>und</strong> neu<br />
gestochen werden. Das fällt dem Betrachter der Tafeln heute kaum auf<br />
(allenfalls die meist etwas grobe Fraktur stört leicht). Alle diese Veränderungen<br />
wurden mit Sicherheit schon vor 1844 vorgenommen (das oben beschriebene,<br />
mit einem Besitzeintrag von 1844 versehene Exemplar beweist dies), aber ob<br />
alle Exemplare der Campe-Ausgabe von 1837 schon mit den neuen Tafeln<br />
ausgestattet wurden, ist zweifelhaft. Denn es war ja ein kommerzielles Problem<br />
zu lösen: Wohin mit den Beständen der alten, nunmehr falsch betitelten<br />
Kupfertafeln? Diese hatten sehr viel Geld gekostet, <strong>und</strong> deshalb ist zu vermuten,<br />
daß Campe Teile seiner zweiten Auflage mit den alten Tafeln ausstattete. Daher<br />
finden sich auf Auktionen immer (soweit man dies aus den Beschreibungen<br />
rekonstruieren kann) Mischexemplare. Die häufigste Kombination sieht<br />
folgendermaßen aus: Titel der ersten Auflage, Texte gemischt aus erster <strong>und</strong><br />
zweiter Auflage (Rezatkreis mit 8 oder 9 Blättern), die Tafeln meist mit den<br />
neuen Kreisbezeichnungen.<br />
Der ursprüngliche Text- <strong>und</strong> Tafelbestand bietet also wenig Schwierigkeiten.<br />
Das eigentliche Problem liegt bei den Karten. Diese wurden auf dem Titel<br />
versprochen, konnten aber offenbar beim Erscheinen des Werkes nicht<br />
ausgeliefert werden. Das läßt sich nicht beweisen, aber erschließen: das<br />
Dedikationsexemplar für Herzog Wilhelm in Bayern hat keine, die Exemplare<br />
der Sammlungen Lipperheide (757) <strong>und</strong> Pfister (II, 2935) haben keine, dasjenige<br />
in der „Bibliotheca bavarica“ von Lentner (11273) ist ohne Karten, ebenfalls alle<br />
im Auktionshandel aufgetauchten (manche wurden allerdings von beunruhigten<br />
Antiquaren „getrüffelt“). Warum ist das so? Nun, der „Commissionär“ Johann<br />
Thomas Schubert scheint ein kleines Licht gewesen zu sein, andere Bücher aus<br />
seinem „Verlag“ sind nicht bekannt. Biographisch ist über ihn nichts zu<br />
ermitteln. Und die Karten dürften teurer gewesen sein als die Tafeln.<br />
8 Sie finden sich in einer Mappe der Bayerischen Staatsbibliothek (Mapp. XI, 62 q 1-6). Alle datiert 1837, nur<br />
der Rezatkreis 1836. Sechs zwischen 1836 <strong>und</strong> 1837 datierte Karten tauchten 2002 in der Auktion 104 bei<br />
Hartung <strong>und</strong> Hartung auf (ohne Isar- <strong>und</strong> Obermainkreis; geschätzt 300 €, zugeschlagen für 320 €); das<br />
würde bedeuten, daß alle 8 Karten existieren; im Auktionskatalog finden sich aber keine Angaben über<br />
Verleger <strong>und</strong> Stecher, so daß eine zweifelsfreie Zuordnung nicht möglich ist.<br />
4
Als mit Sicherheit zum Werk gehörig lassen sich bis jetzt nur 6 Karten<br />
nachweisen 8 (genaue Beschreibung siehe unten), alle zwischen 1836 <strong>und</strong> 1837<br />
datiert, also noch bevor der Verlag an Campe überging. Bezeichnet sind diese<br />
Karten mit dem Kreisnamen, dann folgt bei allen folgende Angabe: Beilage zu<br />
dem Nationalwerk „Bayerns VIII Kreise“. Darunter jeweils der Erscheinungsort<br />
Nürnberg <strong>und</strong> dann das Jahr. Im Erscheinungsjahr des Werkes waren<br />
offensichtlich erst zwei Karten fertig, die zum Rezatkreis <strong>und</strong> zum<br />
Untermainkreis. Nur diese tragen das Datum 1836, die vier anderen bekannten<br />
Karten sind 1837 datiert. Einen kompletten Kartensatz konnte also der Käufer<br />
der ersten Ausgabe überhaupt nicht erwerben. Und vermutlich gilt das auch für<br />
die Erwerber der zweiten Ausgabe bei Campe. Denn es gibt aus dem Jahr 1837<br />
keine Karten mit Campes Verlagsangabe. Solche sind erst 1838 nachweisbar.<br />
Und diese Karten weisen dann eine weitere folgenschwere Änderung auf: die<br />
Angabe „Beilage zu dem Nationalwerk ...“ entfällt ersatzlos. Campe wollte also<br />
die Bindung der Karten an ein inzwischen veraltetes Buch lösen <strong>und</strong> die<br />
Kreiskarten auch einzeln verkaufen.<br />
Schubert- wie Campe-Karten waren jeweils grenzkoloriert. Vergleicht man die<br />
1836 <strong>und</strong> 1837 datierten Exemplare, stellt man fest, daß die Farben<br />
unterschiedlich sind. Diese Änderung der Grenzkolorierung erfolgte nicht aus<br />
ästhetischen Gründen. Durch die Gebietsverschiebungen mußten natürlich auch<br />
die Grenzen neu eingezeichnet werden. Welche Gebiete neu hinzugekommen,<br />
welche abgetrennt worden waren, konnte man aber leicht mit einem Blick<br />
erfassen, denn auf dem Einlegeblatt der Campe-Ausgabe findet sich unten eine<br />
„Erklärung der Farben zur Berichtigung der neuen Kreis-Gränzen auf den<br />
Special-Charten“. In zwei Spalten sind die neuen Kreisbezeichnungen<br />
aufgelistet, dahinter hätte sich natürlich eine Farbprobe finden müssen, im<br />
autopsierten Exemplar unterblieb dies aber.<br />
Wie sind alle diese Bef<strong>und</strong>e zu deuten? Die wahrscheinlichste Erklärung ist<br />
folgende: Schubert konnte die versprochenen Karten nur teilweise liefern, <strong>und</strong><br />
erst mit dem Übergang der Verlagsrechte an Campe änderte sich die Situation.<br />
Die einzelnen Karten aber durch die verräterische Formulierung in der<br />
Kartusche als Teil eines geographischen Werkes zu bezeichnen, wäre<br />
ökonomisch unklug gewesen. Also tilgte Campe den Beilagen-Vermerk <strong>und</strong><br />
vertrieb die Karten sowohl einzeln, dann als Kartensatz <strong>und</strong> schließlich als<br />
Beilage zum „<strong>Lommel</strong>/<strong>Bauer</strong>“. Und der Käufer konnte entscheiden, ob er das<br />
Werk mit oder ohne Karten haben wollte.<br />
Werden also heute <strong>Lommel</strong>/<strong>Bauer</strong>s mit Karten angeboten, sind das mit an<br />
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Exemplare, die nicht zeitgenössisch<br />
zusammengestellt <strong>und</strong> aufgeb<strong>und</strong>en wurden. Alle acht Karten, jeweils datiert<br />
„1838“, finden sich beispielsweise im Exemplar Auktion Zisska & Kistner 44<br />
5
im Jahr 2004, Lot 2166, in das sie mit Sicherheit aber nicht hineingehören, weil<br />
der Text aller acht Teile in erster Ausgabe vorliegt (<strong>und</strong> überdies ganz andere<br />
Wasserränder als die Karten aufweist). Ebenfalls alle acht Karten, nun aber<br />
datiert 1839, finden sich im autopsierten Exemplar der Campe-Ausgabe von<br />
1837. Dieses Exemplar hat einen 1844 datierten Besitzvermerk (siehe oben),<br />
offensichtlich wurden die Karten in diesem Jahr mit dem Text <strong>und</strong> den Tafeln<br />
„verheiratet“.<br />
Epilog: Das Werk war 1857 noch lieferbar, der Verlag war aber inzwischen<br />
nach Campes Konkurs an Lotzbeck übergegangen. Die acht Tafeln kosteten<br />
zusammen 2 2/3 Reichstaler, einzeln jeweils 1/3 Reichstaler, die acht Karten 4<br />
Reichstaler 9 . Natürlich bekam man auch einen Text dazu, <strong>und</strong> zwar einen, der<br />
den neuesten Entwicklungen angepaßt war, denn die Titel warben schon mit der<br />
Beschreibung der neuerbauten Eisenbahnstrecken. Die Texte waren einzeln zu<br />
beziehen, <strong>und</strong> nun war für jeden Teil sogar ein Autor angegeben. Oberbayern<br />
<strong>und</strong> die Pfalz beschrieb A. Hanser, Niederbayern A. Schumacher, ein J.<br />
Schumacher die Oberpfalz <strong>und</strong> C. F. Hammer das gesamte Franken. Jeder Teil<br />
kostete einen halben Reichstaler. Die Tafeln trugen sicherlich die neuen<br />
Kreisbezeichnungen.<br />
Das Werk ist nicht selten, auch wenn der Raritäts-Hinweis in keiner<br />
Katalogbeschreibung fehlt. Der Antiquar Lentner hatte 1912 die Erstausgabe im<br />
Angebot (11273) <strong>und</strong> pries sie wie folgt an: „Sehr selten; war nicht im<br />
Buchhandel“. Außerdem hatte er „einzelne Blätter zum Kompletieren auf<br />
Lager“. Ob das Werk wirklich nicht durch den Buchhandel vertrieben wurde,<br />
läßt sich nicht mehr verifizieren; dafür spräche die Tatsache, daß es nicht im<br />
„Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums“ verzeichnet ist,<br />
dagegen die Aufnahme in Engelmanns „Bibliotheca geographica“ (mit<br />
Preisangabe).<br />
9 Angaben nach Engelmann, Bibliotheca geographica, 310.<br />
6
Kollation<br />
Der gestochene Titel ist unten links monogrammiert „H E“ mit Hausmarke<br />
(Herz mit Kreuz).<br />
Oben in der Mitte der goldstrahlende, von den Genien des Ruhmes <strong>und</strong> der Ehre gehaltene<br />
Titel auf der bayrischen Wappendecke. Im Zentrum die Bavaria, gekrönt mit Lorbeer <strong>und</strong><br />
schwerer Krone. Szepter <strong>und</strong> Schwert ruhen im Schoß, in der Linken die Aegide mit dem<br />
Ludwigs-Monogramm, indessen die Rechte das Füllhorn des Friedens auf die dankbaren<br />
Untertanen schüttet. Ihr zur Rechten die oberen Stände (Gelehrte, Künstler, Krieger, Händler),<br />
auf den anderen Seiten die Masse des Volkes, beginnend mit den verschwisterten<br />
Repräsentanten des Ackerbaus <strong>und</strong> der Viehzucht. Über Spinnerei <strong>und</strong> Leinwandbereitung<br />
geht es zu den höheren Gewerben, deren höchste, „Rothgießer, Steinmetz <strong>und</strong> Mechaniker“<br />
(heutzutage würde man sagen Kunsthandwerker) den Übergang zur Kunst <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
darstellen <strong>und</strong> so den Kreis schließen.<br />
Im Hintergr<strong>und</strong> die Walhalla <strong>und</strong> eine Ansicht von Nürnberg, „als schönes Doppelbild von<br />
Alt <strong>und</strong> Neu“. Das ganze ist eingebettet in einen Rahmen: unten das neue Wappen des<br />
Königreichs, flankiert von mittelalterlichen Waffenstücken, auf den anderen drei Seiten<br />
jeweils das Wappen <strong>und</strong> eine allegorische Darstellung der acht Kreise. Den Schlußstein des<br />
Rahmen bilden die Attribute der Kunst, in der Mitte das Monogramm König Ludwigs.<br />
Nach dem typographischen Titel folgt 1 Blatt: „Erklärung des Titelkupfers“,<br />
dann<br />
Teil 1 (als solcher nicht bezeichnet, die Reihenfolge der Kreise variiert in<br />
den bekannten Exemplaren)<br />
„Bildliche Darstellung des Isarkreises“. - 10 Seiten. – Der Text bleibt in der<br />
zweiten Auflage gleich, die Bogennorm lautet ab S. 7 „Isarkreis 2te Aufl.“<br />
Die Tafel hat folgenden Titel<br />
„HAUPT-U-KREIS-STADT MÜNCHEN / ISAR-KREIS“<br />
Durch ein Portal mit korinthischen Säulen sieht man die Stadt vom Gasteig aus. Links im<br />
Vordergr<strong>und</strong> eine junge Bäuerin aus der Umgebung, gegenüber zur Rechten eine Münchner<br />
Bürgerstocher mit goldener Riegelhaube <strong>und</strong> silberverkettetem Mieder. In der Mitte ein<br />
Bursche aus der Tegernseer Gegend mit einem Mädchen aus Schliersee.<br />
Von dieser Tafel gibt es Abzüge, die rechts unten ein Monogramm „FW 82“ tragen. Damit ist<br />
der Stecher leicht zu ermitteln. Es handelt sich um Friedrich Würthle (das Blatt mit dem<br />
Monogramm ist abgebildet bei Georg Jakob Wolf, Die Münchnerin, nach S. 8). Friedrich<br />
Würthle (1820-1902) stammte aus Konstanz (die Angaben bei Thieme-Becker <strong>und</strong> Pfister<br />
sind entsprechend zu berichtigen), kam 1841 nach München <strong>und</strong> siedelte 1860 nach Salzburg<br />
über, wo er sich als Landschafts-Photograph betätigte. Er arbeitete für die bekannten<br />
7
Münchner Veduten-Verleger <strong>und</strong> ist vor allem als Stahlstecher bekannt. Hat er nun die alte<br />
Tafel nur überarbeitet oder neu gestochen? Keine Antwort auf diese Frage findet man im<br />
Katalog Maillinger II, 385. Dort wird die Tafel nur richtig Würthle zugewiesen, die Technik<br />
nicht erwähnt. Die zweite Auskunft wird erteilt im Aufsatz „Wenig bekannte Münchner<br />
Maler <strong>und</strong> Graphiker des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts. 25 Kurzbiographien“ von Karl Birkmeyer,<br />
erschienen im 93. Band des „Oberbayerischen Archivs“ im Jahr 1971. Birkmeyer<br />
apostrophiert Würthle als „vielseitigen, talentierten <strong>und</strong> fleißigen Künstler“ (138) <strong>und</strong> hebt<br />
unter seinen Arbeiten vor allem diese „meisterliche Kopie“ heraus, bezeichnet sie allerdings<br />
als Lithographie: „Er hat diese Lithographie im Jahr 1882 so vorzüglich ausgeführt, daß sie<br />
dem Original-Kupferstich nicht nachsteht.“ Ein Vergleich beider Varianten ergibt aber<br />
zweifelsfrei, daß auch die Würthle-Tafel gestochen ist, <strong>und</strong> zwar hat Würthle die Tafel<br />
vermutlich nicht neu-, sondern nur aufgestochen. Indiz dafür sind die beiden Plattenbrüche<br />
unten, die sich schon auf allen bekannten frühen Abzügen finden. Selbst ein sklavisch<br />
getreuer Kopist hätte diese aber nicht übernommen, konnte er doch nicht sicher sein, ob seine<br />
Vorlage einer der ersten Abzüge war.<br />
Im zweiten Zustand ist der Kopf gleich, aber unten heißt es „KR.<br />
OBERBAYERN“<br />
Die Karte (48 x 59 cm 10 ) bezeichnet „Der Isarkreis“, datiert 1837 <strong>und</strong> ohne<br />
Stecherangabe. Die 1838 datierte Karte (50 x 57 cm) bezeichnet „Der Kreis<br />
Oberbayern“ <strong>und</strong> ohne Stecherangabe; die 1839 datierte neu gestochen <strong>und</strong> in<br />
kleinerem Format (46,5 x 58,5), aber mit derselben Bezeichnung <strong>und</strong> ebenfalls<br />
ohne Stecherangabe.<br />
Teil 2<br />
„Bildliche Darstellung des Unterdonaukreises“. - 7 Seiten.<br />
Die Passau-Tafel hat folgenden Titel<br />
„Kreisstadt / Passau Unt: / Donau- / Kreis“, monogrammiert links unten im<br />
Sockel „CR“<br />
Durch das von einem romanischen Tympanon bekrönte Portal von St. Peter aus der alten<br />
Kreishauptstadt Straubing blickt man auf die neue Kreishauptstadt Passau mit dem<br />
Zusammenfluß von Donau <strong>und</strong> Inn, rechts die Feste Oberhaus. Im Vordergr<strong>und</strong> rechts ein<br />
alter <strong>Bauer</strong> aus einem Dorf bei Griesbach im Rottal, dahinter Eheleute aus Passau, links eine<br />
Bäuerin mit ihrem Sohn aus Wegscheid, zwischen den beiden ein Mädchen in Rottaler Tracht.<br />
In der Mitte eine Passauer Witwe mit ihrem Kind.<br />
10 Die Größenangaben erfolgen nach eigenen Messungen, nach den Angaben der BSB bzw. aus<br />
Auktionskatalogen. Daher differieren die Maße teilweise beträchtlich. Bei Abweichungen von wenigen<br />
Millimetern bis hin zu 2 cm kann man davon ausgehen, daß die Größe der Druckplatte gleich ist.<br />
8
Im zweiten Zustand ist der Text unverändert, aber in einer anderen Type,<br />
außerdem steht die zweite Zeile in Versalien: „DONAU / KREIS. – Das<br />
Monogramm im Sockel ist verschw<strong>und</strong>en.<br />
Die Landshut-Tafel hat folgenden Titel<br />
„Kreisstadt Landshut. Kreis / Nieder – Bayern“, monogrammiert unten im<br />
Sockel „CR“ 11<br />
Rahmen <strong>und</strong> Figurenstaffage sind vollkommen identisch mit der Passau-Tafel, nur die<br />
Stadtansicht wurde ausgetauscht. Im Zentrum St. Martin, rechts auf der Höhe die Trausnitz.<br />
Die Karte (60 x 51 cm) bezeichnet „Der Unterdonaukreis“, datiert 1837 <strong>und</strong> mit<br />
Stecherangabe C. Seihm. In der zweiten Auflage neu gestochen (58 x 65 cm)<br />
<strong>und</strong> bezeichnet „Der Kreis Niederbayern“, nun ohne Stecherangabe. – 1838 <strong>und</strong><br />
1839 identisch.<br />
Teil 3<br />
„Bildliche Darstellung des Regenkreises“. - 9 Seiten.<br />
Die Tafel hat folgenden Titel<br />
„Regen / Kreis / Kreisstadt / Regensburg“, monogrammiert links unten sehr<br />
verschachtelt „WALTER sc[ulpsit]“, datiert rechts unten „Nbg. 1835“, auf der<br />
Tasche der linken Bäuerin das Monogramm „MAR“<br />
Als Rahmen wurde das Portal des Schottenklosters St. Jakob in Regensburg gewählt. Vor<br />
einer bemerkenswert schmalen Stadtansicht fünf Figuren. „Die vorderste Gruppe bildet eine<br />
Hochzeitparthie von Landleuten aus Mintraching – Bräutigam, Braut <strong>und</strong> Kranzjungfrau. Die<br />
in der Richtung von Regensburg nach Landshut <strong>und</strong> Straubing hin vorfindliche gewöhnliche<br />
Gai- (Gau) Tracht benannte, an Goldstickerei, silbernen Ketten <strong>und</strong> Knöpfen, Sammt <strong>und</strong><br />
Bändern reiche Kleidung zeugt von dem Wohlstand ihrer Träger ... Von den beiden Frauen im<br />
Mittelgr<strong>und</strong> weißt die rückwärtsstehende dieselbe Landestracht mit einigen Abweichungen<br />
<strong>und</strong> einer besonders auffallenden Kopfzierde, die nur von reichen Bäuerinnen bei<br />
außerordentlichen Gelegenheiten getragen, dermalen ziemlich im Abnehmen ist. Die<br />
Nebenstehende prangt in der gewöhnlichen Abensberger Sonntagstracht.“<br />
Zum 1798 geborenen Zeichner <strong>und</strong> Kupferstecher Johann Philipp Walther vergleiche Nagler<br />
XXIII, 481.<br />
Im zweiten Zustand lautet der Titel wie folgt<br />
11 In einem autopsierten Exemplar ist die Landshut-Tafel eingeb<strong>und</strong>en, im Text heißt es aber unverändert<br />
„Kreishauptort Passau“<br />
9
„Kreis Oberpfalz / <strong>und</strong> Regensburg. / Kreisstadt / Regensburg“<br />
Die Karte (48 x 51 cm) bezeichnet „Der Regenkreis“, datiert 1837 <strong>und</strong> ohne<br />
Stecherangabe. – In der zweiten Auflage neu gestochen (60 x 49 cm) <strong>und</strong><br />
bezeichnet „Der Kreis Oberpfalz <strong>und</strong> Regensburg“, aber ebenfalls ohne<br />
Stecherangabe. – 1838 <strong>und</strong> 1839 identisch.<br />
Teil 4<br />
„Bildliche Darstellung des Oberdonaukreises“. - 10 Seiten. – Der Umfang bleibt<br />
in der zweiten Auflage gleich, der Text wurde aber mit geringfügigen<br />
Abweichungen neu gesetzt. – Bogennorm: „Oberdonaukreis. 2. Aufl.“<br />
Die Tafel hat folgenden Titel<br />
„KREISSTADT AUGSBURG / OBER DONAU-KREIS“, monogrammiert<br />
links unten sehr verschachtelt<br />
„WALTER sc[ulpsit]“<br />
Unter einem römischen Triumphbogen-Portal steht links im Vordergr<strong>und</strong> eine Augsburger<br />
Bürgersfrau mit Goldhaube „im Antlitz nicht ohne Spuren transalpinischer<br />
Physiognomiemischung“, rechts eine Gruppe von <strong>Bauer</strong>n: „Er aus Aichach, Sie aus der<br />
Gegend von Landsberg gebürtig – verläugnen in Gesichtsbildung <strong>und</strong> Tracht ihre bojoarische<br />
Abkunft nicht; namentlich den Altwittelsbacher charakterisirt das derbe, tiefergefärbte Antlitz<br />
<strong>und</strong> das dunkle Haupthaar; wogegen das ruhende Mädchen, welches die Landkleidung des<br />
Gögginger Gerichtsbezirkes trägt, seinen blonden Haaren <strong>und</strong> seinem gemüthvollen,<br />
fre<strong>und</strong>lich-ruhigen Gesichtsausdruck nach, dem teutschen Volksstamm der Schwaben<br />
anzugehören scheint.“ Im Mittelgr<strong>und</strong> ein Kemptner Landmädchen.<br />
Diese Tafel wird verzeichnet bei Schefold, Alte Ansichten aus Bayerisch Schwaben, Nummer<br />
40579 (Sammlung Seitz). Beschrieben als Lithographie <strong>und</strong> angeblich gezeichnet von<br />
Friedrich Würthle. Laut fre<strong>und</strong>licher Auskunft von Herrn Seitz (<strong>und</strong> vorgenommener<br />
Autopsie) beruht diese Angabe auf einem Irrtum Schefolds, der die Angaben über das Blatt<br />
von der Seitzschen Karteikarte kritiklos übernahm. Wie die falsche Angabe auf die<br />
Karteikarte geriet, ist Seitz nicht mehr erinnerlich.<br />
Im zweiten Zustand<br />
KREISSTADT AUGSBURG / KREIS SCHWABEN UND NEUBURG“<br />
Die Karte 1838 (70 x 52 cm) bezeichnet „Der Kreis Schwaben <strong>und</strong> Neuburg“,<br />
unten mit Angabe „Gest. von Christ. Grünwald in Nbg“<br />
10
Über Christoph Grünwald ist so gut wie nichts bekannt. Tooley, Dictionary of Mapmakers,<br />
268 verzeichnet nur eine 1846 gestochene „Eisenbahnkarte für Deutschland“.<br />
Karte 1839: identisch, aber unten mit leicht abweichender Angabe: „Gest. von<br />
Christ. Grünewald sen. in Nbg.“<br />
Teil 5<br />
„Bildliche Darstellung des Rezatkreises“. – 8 Blätter. – Es gibt auch eine<br />
Variante mit 9 Blättern (Hartung & Hartung Auktion 104, Lot 1209).<br />
In der zweiten Auflage: 14 S. Bogennorm „Rezatkreis. 2. Aufl.“<br />
Die Tafel hat folgenden Titel<br />
„Kreisstadt Ansbach“ / Rezat= / Kreis“, unten bezeichnet „Druck von Carl<br />
Mayer Nürnberg“<br />
Im Vordergr<strong>und</strong> rechts ein <strong>Bauer</strong>npaar aus dem Knoblauchsland, links eine im städtischen<br />
Dienst stehende Magd, im Hintergr<strong>und</strong> ein <strong>Bauer</strong> aus der Ansbacher Gegend. Als Rahmen<br />
wurde das im Couronnement mit reichem Maßwerk durchbrochene Nordportal von St. Sebald<br />
in Nürnberg gewählt. Dieses ist mit „höchster Treue <strong>und</strong> Sorgfalt dargestellt“. Der Künstler<br />
hat allerdings „sinnreiche Verzierungen“ hinzugefügt. An den Seiten stehen auf Postamenten<br />
plastische Figuren: links Hans Sachs, rechts Albrecht Dürer.<br />
Im zweiten Zustand<br />
„Kreisstadt Ansbach Kr: Mittel-Franken“<br />
Die Karte (47 x 51 cm) bezeichnet „Der Rezatkreis“, datiert 1836“ <strong>und</strong> mit<br />
Stecherangabe A. M. Hammer. Die Variante nach der neuen Kreiseinteilung ist<br />
datiert 1837 <strong>und</strong> bezeichnet die Grenzverschiebungen durch verschiedene<br />
Farben (siehe das Exemplar der BSB). – Die zweite Auflage (50 x 46 cm) mit<br />
dem Titel „Der Kreis Mittelfranken. Nürnberg bei Fr. Napoleon Campe 1838<br />
(bzw. 1839)“, unten mit Angabe „Stich beendet von A. M. Hammer“. - Da<br />
Eichstätt durch die neue Kreiseinteilung nun zu Mittelfranken gekommen war,<br />
wurde das Gebiet in die vorhandene Platte hinzugestochen (deutlich sichtbar<br />
durch den fetteren Strich). – 1838 <strong>und</strong> 1839 identisch.<br />
Teil 6<br />
„Bildliche Darstellung des Obermainkreises. – 12 Seiten (die letzten beiden<br />
kompreß gesetzt). In der zweiten Auflage bis Seite 4 satzidentisch, Seiten 5-6<br />
11
neu gesetzt, dann wieder satzidentisch. – Bogennorm: „Obermainkreis. 2te<br />
Aufl.“<br />
Die Tafel hat folgenden Titel<br />
„Kreisstadt / Baireuth / Ober-Mainkreis“, unten links „Wagner sc.“, unten<br />
rechts „Kreul del.“<br />
Im zweiten Zustand<br />
„Kreisstadt / Baireuth / Kreis Oberfranken“<br />
Bamberg, die alte Kreishauptstadt des Obermainkreises, liefert das Tor <strong>und</strong> gewährt den<br />
Durchblick auf die neue Hauptstadt Bayreuth. Die Architekturumrahmung zeigt vereinfacht<br />
das Gewände des Fürstenportals des Bamberger Domes, das hier nur aus zwei Propheten <strong>und</strong><br />
Apostelsäulen auf beiden Seiten besteht. Am Scheitel des Bogens befindet sich das Wappen<br />
des Kreises. Unter dem Bogen bietet im Vordergr<strong>und</strong> links eine Gärtnerin in Alltagstracht aus<br />
der Gegend von Muggendorf einem <strong>Bauer</strong>npaar in Festtagstracht aus dem Hummelgau Obst<br />
an (Vorlage dafür ist Lipowskys „Sammlung der National-Costüme des Königreichs Bayern“,<br />
München 1832, Heft 9, Blatt 34). Im Hintergr<strong>und</strong> rechts stehen drei Mädchen aus Redwitz<br />
<strong>und</strong> Bamberg in Sonntagstracht, eines mit der Bamberger Flügelhaube. Über den Personen<br />
wird der Blick auf die nunmehrige Kreishauptstadt Bayreuth von Westen freigegeben. Am<br />
Horizont erscheinen die Berge des Frankenwaldes <strong>und</strong> des Fichtelgebirges (Beschreibung<br />
nach Müllner, Unterfränkische Trachtengraphik, Nummer 46).<br />
Zur Kreisbezeichnung: Der 1808 eingerichtete Mainkreis mit der Hauptstadt Bamberg ging<br />
vor allem im Westen über das ursprüngliche Hochstiftsgebiet hinaus. Als der Kreis 1810 um<br />
das Gebiet des ehemaligen Fürstentums Bayreuth erweitert wurde, verlegte man die<br />
Kreishauptstadt von Bamberg nach Bayreuth. 1817 benannte man den Mainkreis – zur<br />
besseren Unterscheidung vom Untermainkreis – in Obermainkreis um. Das Kreisgebiet wurde<br />
im Süden durch die Landgerichte Forchheim, Gräfenberg <strong>und</strong> Höchstadt an der Aisch<br />
vergrößert. Die letzte Kreiseinteilung von 1837 orientierte sich wieder an historischen<br />
Vorbildern <strong>und</strong> Namen. Aus dem Obermainkreis wurde nun Oberfranken (vergleiche die<br />
Darstellung im Ausstellungskatalog „Bamberg wird bayerisch“ Nummer 252, die Tafel dort<br />
beschrieben unter Nummer 253 <strong>und</strong> auf Seite 483 ganzseitig farbig abgebildet).<br />
Die Karte (53 x 60 cm) bezeichnet „Der Obermainkreis“, datiert 1837 <strong>und</strong> mit<br />
Stecherangabe „G. Egloff sc.“ - In der zweiten Auflage (52 x 59 cm) bezeichnet<br />
„Der Kreis Oberfranken“ <strong>und</strong> mit derselben Stecherangabe. - 1838 <strong>und</strong> 1839<br />
identisch (die Karte 1839 bei „Cartographia Bavaria“ 10.15).<br />
Teil 7<br />
12
„Bildliche Darstellung des Untermainkreises“. – 8 Blätter. – Es gibt auch eine<br />
Variante mit 11 Blättern (autopsiert). – Bogennorm in beiden Varianten<br />
identisch.<br />
Die Tafel hat folgenden Titel<br />
„Kreisstadt / Würzburg / Unter-Mainkreis“<br />
Im zweiten Zustand<br />
„Kreisstadt / Würzburg / Kreis Unterfranken <strong>und</strong> Aschaffenburg“<br />
Durch ein romanisches Portal (Vorbild war das der Pfarrkirche St. Andreas von Karlstadt)<br />
wird der Blick auf die Stadt Würzburg vom Steinberg aus gesehen freigegeben. „Absichtlich<br />
ist nach Anleitung der besten Muster gerade diese Darstellung gewählt worden, damit die<br />
zwar angenehme, aber doch etwas versteckte Lage der Stadt angedeutet <strong>und</strong> zugleich ein nicht<br />
unbedeutender Theil der Umgegend mit aufgenommen werden konnte, was auf den<br />
gewöhnlichen Darstellungen vermißt wird, welche die auffallendste Weglassung ganzer<br />
Stadttheile durch eine unwahre Sichtbarmachung unbedeutender Mainstrecken zu ersetzen<br />
suchen“ (Einleitung). Vorbild dafür war das Stadtbild, das Friedrich Geißler nach einer<br />
Zeichnung von Ignaz Wächtler bereits um 1830 als Mittelkartusche eines Sammelbildes<br />
geschaffen hatte (abgebildet in „Gesamtansichten <strong>und</strong> Pläne der Stadt Würzburg“ Nummer<br />
75; die beiden <strong>Lommel</strong>-Blätter beschrieben unter Nummer 93a). - Rechts ein Paar mit<br />
Trachten des Schweinfurter Gaues (die Bäuerin aus Geldersheim, aber durch einen<br />
Kopierfehler ist das hörnerartige Tuch falsch geb<strong>und</strong>en). Links ein Winzerpaar im<br />
Arbeitsgewand der Karlstädter Gegend (der Mann aus der Gegend von Karlstadt mit blauen<br />
langen Hosen, die sich zu der Zeit auch bei der Landbevölkerung durchzusetzen begannen).<br />
Nachdem 1814 das Großherzogtum Würzburg <strong>und</strong> das Fürstentum Aschaffenburg dem<br />
bayerischen Staat einverleibt worden waren, hieß der neue Bezirk „Untermainkreis“; erst ab<br />
1838 nannte man ihn „Kreis Unterfranken <strong>und</strong> Aschaffenburg“.<br />
Die Karte (52 x 59 cm) bezeichnet „Der Untermainkreis“, datiert 1836 <strong>und</strong> mit<br />
Stecherangabe „G. Egloff sc.“. - 1838 (bzw. 1839) unter dem Titel „Der Kreis<br />
Unterfranken <strong>und</strong> Aschaffenburg. Nürnberg bei Fr. Napoleon Campe“ neu<br />
aufgelegt (aber nur in der Grenzkolorierung geändert).<br />
Teil 8<br />
„Bildliche Darstellung des Rheinkreises“. – 9 Seiten.<br />
Die Tafel hat folgenden Titel<br />
„Kreisstadt / Speyer. / RHEIN-KREIS“, unten links monogrammiert „J. P.<br />
Walther sc. Vlg. 1834“ (Müllner, Unterfränkische Trachtengraphik, liest falsch<br />
„Nbg. 1831“)<br />
13
Im zweiten Zustand ist der Kopf oben gleich, aber unten heißt es „KREIS<br />
PFALZ“<br />
Durch ein romanisches Portal blickt man auf den Dom zu Speyer. Auf dem Rhein zieht ein<br />
Raddampfer vorbei, im Vordergr<strong>und</strong> links ein Mädchen aus Heiligenstein, das Weintrauben<br />
verkauft, rechts eine <strong>Bauer</strong>nfamilie aus Bergzabern. „Das Gesamtbild ist vom Künstler<br />
fre<strong>und</strong>lich <strong>und</strong> leicht gehalten, entsprechend dem Naturverhältnis, dem blauen Himmel über<br />
der blühenden Landschaft, dem erleuchteten, feurigen Sinn ihrer Einwohner.“<br />
Karte 1838: (46 x 51 cm), bezeichnet „Der Kreis Pfalz“, unten mit<br />
Stecherangabe „Gestochen von Christoph Grünwald, sen. in Nürnberg“.<br />
Karte 1839: (36 x 52,5), bezeichnet „Der Kreis Pfalz“, unten mit Stecherangabe<br />
„Gestochen von Christoph Grünewald, sen. in Nürnberg“.<br />
14