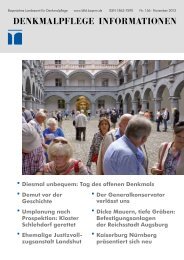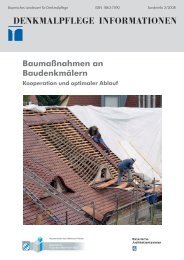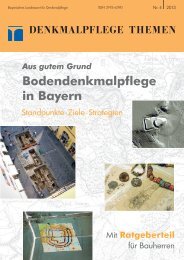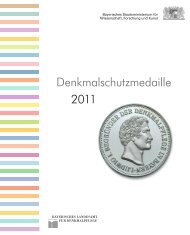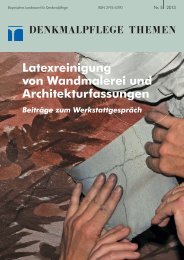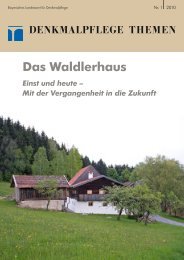Info 150 Layout.indd - Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege ...
Info 150 Layout.indd - Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege ...
Info 150 Layout.indd - Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Musterkonservierung und Ausführung<br />
Mit einem zeitlichen Vorlauf von einem Jahr vor Beginn der<br />
Maßnahme formulierte das BLfD ein Verfahren <strong>für</strong> die Fassungsfestigung<br />
an der Kassettendecke und erprobte es an den<br />
beiden ausgebauten Platten. Nach der Musterkonservierung<br />
sollten die Kassettenfelder wieder eingebaut und ein Jahr<br />
lang den widrigen Klimabedingungen ausgesetzt werden.<br />
Für die Auswahl von Festigungsmittel und die Applikationsweise<br />
waren mehrere Kriterien zu berücksichtigen: Das<br />
Material musste der Feuchtigkeitsbelastung und den Temperaturschwankungen<br />
an der Decke widerstehen sowie<br />
möglichst alterungsbeständig sein. Farbton und Glanzgrad<br />
der Malschicht sollten sich möglichst wenig verändern. Das<br />
Einbringen des Festigungsmittels musste wegen der empfindlichen<br />
Malschicht berührungslos erfolgen, am bestendurch<br />
Sprühauftrag. Da ein Ausbau der Platten nicht möglich<br />
ist, musste das Verfahren <strong>für</strong> eine Bearbeitung vor Ort,<br />
größtenteils über Kopf, geeignet sein.<br />
Nach einiger Recherche und verschiedenen Vorversuchen<br />
stellte sich Kunstharzlösung als das am besten geeignete<br />
Material dar. Gewählt wurde ein Acrylat, das sich in einem<br />
langsam trocknenden, geruchsarmen Lösemittel verarbeiten<br />
lässt.<br />
Zweck der Versuche war, durch Steuerung der Sprüh- und<br />
Anlegetechnik eine Bindemittelanreicherung hauptsächlich<br />
unter der Malschicht zu bekommen – hier musste die Haftung<br />
wiederhergestellt werden. Auf der Schollenoberseite<br />
sollte sich so wenig Bindemittel wie möglich absetzen, dem<br />
Grundsatz folgend, nur so viel wie nötig und so wenig wie<br />
möglich an Fremdsubstanz einzubringen. Durch relativ starke<br />
Baudenkmäler – eine nachwachsende Ressource?!<br />
Zur Baukultur der Nachkriegszeit<br />
Nachkriegsarchitektur zwischen Italien und Dänemark<br />
Zur Belebung der touristischen Infrastruktur wurde in der<br />
norditalienischen Provinz Treviso eine „Architekturstraße“<br />
abgesteckt und die Routen in mehrsprachigen Broschüren<br />
ausführlich beschrieben und illustriert. Gleichrangig mit<br />
kulturhistorisch bedeutenden Stadtensembles, mittelalterlichen<br />
Burgen, klassizistischen Kirchenbauten oder palladianischen<br />
Villen werden darin auch architektonische<br />
Reiseziele vorgeschlagen, die (erst) in den 1960er und 1970er<br />
Jahren entstanden sind. Dabei handelt es sich etwa um eine<br />
ursprünglich <strong>für</strong> ein Elektrounternehmen konzipierte Fabrikanlage<br />
des Architekten und Industriedesigners Marco<br />
Zanuso in Casella d’Asolo (errichtet 1963–67) und um das<br />
unter der Regie des in Architektenkreisen legendären Carlo<br />
Scarpa inszenierte betonbarocke Grabmal der Familie Brion<br />
in San Vito d’Altivole (1969–78).<br />
In Dänemark werden die in die Jahre gekommenen Bauten<br />
von Arne Jacobsen, die zum Inbegriff der Architektur des 20.<br />
Jahrhunderts zählen, regelmäßig mit beeindruckender Sensibilität<br />
behandelt. Beispielsweise erfuhr die 1957 als früher<br />
Pavillontyp fertiggestellte Munkegaard-Schule in Gentofte<br />
Denkmalforschung<br />
Verdünnungdünnflüssigeingestellt,durchAusnutzungder<br />
Kapillarwirkung, durch die der größte Teil der Lösung unter<br />
die Malschichtschollen gesaugt wird, sowie mit ausreichender<br />
Wartezeit zwischen dem Besprühen und dem Andrücken<br />
der lockeren Malschicht konnte dieses Ziel erreicht werden.<br />
Die beiden restaurierten Testplatten wurden im Frühjahr<br />
2009 wieder eingesetzt. Nachdem das Festigungsverfahren<br />
auch vor Ort erfolgreich erprobt und den Gegebenheiten<br />
angepasst worden war, konnten die Erkenntnisse als Grundlage<br />
<strong>für</strong> das Leistungsverzeichnis dienen. Mittlerweile sind<br />
zweiDrittelderDeckenflächebearbeitet.DasVerfahrenließsich<br />
vollkommen zufriedenstellend realisieren und führt zu<br />
einer überzeugenden Stabilisierung der fragilen Malschicht.<br />
Umso erfreulicher ist die geglückte Konservierung der Fassung<br />
vor dem Hintergrund von Überlegungen, die zu Beginn<br />
der Gesamtinstandsetzung formuliert worden waren. Da<br />
man nicht wusste, ob das Schadensbild überhaupt restaurierbar<br />
war, hatte man bereits Kalkulationen <strong>für</strong> ein Abräumen<br />
und Neufassen der Kassettenfelder angestellt.<br />
Natürlich wird auch die gefestigte Fassung weiterhin den<br />
besonderen klimatischen Bedingungen in der Walhalla<br />
ausgesetzt sein, sie ist aber soweit stabilisiert, dass sich<br />
der Schadensfortschritt hinreichend verlangsamt. Die Entscheidung,<br />
keine Retuschen auszuführen und auch Bereiche<br />
mit großen Malschichtverlusten zu belassen, wurde nach<br />
reiflicherErörterungunterallenBeteiligtengetroffen.Sieist<br />
Bestandteil des <strong>für</strong> die Gesamtinstandsetzung gewählten<br />
Weges, eine reine Konservierung auszuführen und den<br />
Bestand so zu akzeptieren wie er ist.<br />
Jens Wagner<br />
bei Kopenhagen, seit 1995 als Kulturdenkmal ausgewiesen,<br />
vor wenigen Jahren eine Erweiterung. Der ursprüngliche<br />
Bestand wurde dabei nahezu konfliktfrei respektiert, undauch<br />
die Instandsetzung des Bestandes beschränkte sich<br />
auf die notwendigsten Erneuerungen. Auch hier galt es,<br />
die energetischen Bedingungen zu verbessern, gleichwohl<br />
wurden die ohnehin kleinflächigen massiven Fassadenbereiche<br />
eben nicht mit Wärmedämmungen verpackt. Die<br />
im Gegenzug ausgetauschten großflächigen Verglasungenzeigen<br />
weiterhin die ursprünglichen Fensterkonstruktionen<br />
bis hin zu den wiederverwendeten Glasleisten.<br />
Natürlich ist nicht alles denkmalpflegerisches Gold, was<br />
(möglichst nicht) glänzt, aber eine gewisse Selbstverständlichkeit<br />
im Umgang mit Bauten der zweiten Hälfte des 20.<br />
Jahrhunderts kann man z. B. unseren italienischen oder<br />
dänischen Nachbarn zugestehen: Eine Selbstverständlichkeit,<br />
die zwischen Ost- bzw. Nordsee und Alpen bisweilen<br />
ganz und gar nicht vorhanden ist! Allgemein betrachtet ist<br />
hier seit Jahren ein nicht unerheblicher Schwund an Baukultur<br />
der Nachkriegszeit zu beobachten. Auch ohne Zugewinn<br />
von Nutzflächen werden ökonomisch „abgeschriebene“<br />
47