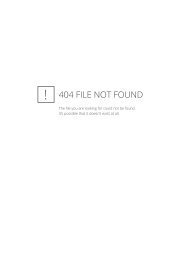Rahel Rosa Neubauer - Collegium Carolinum
Rahel Rosa Neubauer - Collegium Carolinum
Rahel Rosa Neubauer - Collegium Carolinum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
RAHEL ROSA NEUBAUER: DISSERTATIONSPROJEKT 1<br />
<strong>Rahel</strong> <strong>Rosa</strong> <strong>Neubauer</strong><br />
Die Sozialisation der Autorin Irma (Miriam) Singer<br />
im Umfeld der Prager KulturzionistInnen<br />
als Entstehungshintergrund ihrer jüdischen Märchen<br />
Dissertationsprojekt an der Universität Wien<br />
(Betreuer: Univ. Doz. Mag. Dr. Ernst Seibert, Institut für Germanistik, Abteilung<br />
für Kinder- und Jugendliteraturforschung)<br />
Irma/Miriam Singer (Tochovice 1898-1989 Deganya)<br />
Das Leben und Schaffen der Schriftstellerin, Lyrikerin, Journalistin, Übersetzerin, Chaluza<br />
und Kibbuz-Kindergärtnerin Irma Singer aus Prag, die 1920 gemeinsam mit Hugo<br />
Bergmann nach Palästina emigrierte, ist in der Geschichtsforschung wie auch in der Literaturwissenschaft<br />
bis heute völlig unbekannt geblieben. Und das, obwohl ihr Leben und<br />
Werk in vielerlei Hinsicht hochinteressante Aspekte zur deutsch-jüdischen Literatur, zum<br />
deutschsprachigen Judentum in Prag, zur Situation der deutschsprachigen Juden in Palästina<br />
und nicht zuletzt zur gesellschaftlichen Entwicklung des „Vorzeigekibbuz“ Deganya<br />
liefert.<br />
Sie nahm zwei Jahre lang mit Franz Kafka und Felix Weltsch bei Jiřί Langer, einem Verwandten<br />
Max Brods, Privatunterricht in Hebräisch, gehörte zum Kreis um Max Brod und<br />
die Familie Hugo Bergmann, nahm an Diskussionen mit Martin Buber teil und führte A.<br />
D. Gordon, mit dem sie später ebenso wie mit der israelischen Dichterin Rachel in derselben<br />
Unterkunft im Kibbuz Deganya lebte, durch Prag. Briefe von ihr an andere Wandrerinnen<br />
des „Jüdischen Wanderbundes Blau-Weiß“ wurden von Siegfried Bernfeld in einer<br />
seiner Zeitschriften für die jüdische Jugend abgedruckt; ihre 1918 erstmals publizierte<br />
Sammlung jüdischer Märchen stellte für Schalom Ben Chorin einen wesentlichen Anstoß<br />
für das „Entdecken“ seiner jüdischen Identität dar. Ihre Reportagen für diverse europäische<br />
und israelische Periodika sowie ihre Gedichte liefern einen einzigartigen Eindruck<br />
vom Leben in Deganya, dem ersten Kibbuz Erez Israels, wo sie mit ihrem Mann, dem<br />
Chaluz Ja’akov Berkovič, beinahe siebzig Jahre lang lebte und arbeitete. Sie führte als<br />
deutschsprachige Chaluza Albert Einstein und T. G. Masaryk durch den Kibbuz, lernte<br />
Lord Balfour und Max Warburg kennen. Ihre in Europa bis heute vollkommen unbekannten<br />
Veröffentlichungen stellen einen wesentlichen Beitrag zur Kibbuzliteratur dar.<br />
Nur vereinzelt wurden im Laufe der vergangenen zehn Jahre Teile ihres literarischen<br />
Schaffens rezipiert. Ihr Bericht über den Hebräisch-Unterricht mit Franz Kafka war und ist<br />
für die Kafka-Forschung von großem Interesse; für die Golem-Forschung ist von Bedeutung,<br />
dass sie 1918, drei Jahre nach Erscheinen des Romans Gustav Meyrinks, die erste<br />
Bearbeitung des Golem-Stoffes in der Gattung Märchen lieferte.<br />
Im Rahmen der Projekt-Vorarbeiten konnte nun der Nachlass der Autorin aufgefunden<br />
werden, der die Grundlage für eine umfassende biobibliographische Darstellung liefert.<br />
Stand der Forschung zur jüdischen Kinder- und Jugendliteratur<br />
Von der noch jungen Forschung zur jüdischen Kinder- und Jugendliteratur wurde in den<br />
vergangenen fünfzehn Jahren die Bedeutung des kinderliterarischen Werkes Irma bzw.<br />
später Miriam Singers erkannt und gewürdigt. Ihre Märchensammlung Das verschlossene<br />
Buch von 1918 1 , zu deren Publikation sie niemand Geringerer als Max Brod ermutigte, der<br />
1 Singer, Irma: Das verschlossene Buch. Jüdische Märchen [Nachwort von Max Brod], 1. Ausg. illustr. v.<br />
12. Münchner Bohemisten-Treffen, 7. März 2008 — Exposé Nr. 25
<strong>Rahel</strong> <strong>Rosa</strong> <strong>Neubauer</strong> 2<br />
auch den Kontakt zum Wiener Verlag R. Löwit herstellte, stellt ein herausragendes Beispiel<br />
jüdischer Kunstmärchen im 20. Jahrhundert dar und gilt als eines der Werke, die die<br />
Gattung der zionistischen Kinderliteratur überhaupt erst begründeten. Ihr Kinderroman<br />
Benni fliegt ins Gelobte Land von 1936 2 ist das erste in Österreich-Ungarn erschienene<br />
Werk dieser Gattung und zählt zu einem der bedeutendsten Romane zionistischer Kinderliteratur.<br />
Die vom Keren Kaijemet Lejisrael in der Reihe „Heimat. Palästina-Bibliothek für Kinder“<br />
beim jungen Tel Aviver Omanuth-Verlag herausgegebene Erzählung Die Sage von Dilb 3<br />
ist eines der ersten Kinderbücher im deutschsprachigen Raum, in der die „blaue Büchse“<br />
des Jüdischen Nationalfonds als Motiv vorkommt (warum das Exemplar der Deutschen<br />
Bücherei Leipzig den Stempel „Geheim“ erhielt, wird noch zu eruieren sein). Völlig unbeachtet<br />
jedoch und im europäischen Bibliothekenverbund nicht vorhanden blieb bisher<br />
allerdings Kelle und Schwert. Aus den Heldentagen von Dagania 4 , das einen Beitrag zum<br />
Einsatz für friedliches Miteinander zwischen den jüdischen Siedlern und den palästinensischen<br />
Bewohnern des Landes darstellte.<br />
Noch vollkommen unbekannt ist der europäischen Forschung zur jüdischen Kinderliteratur<br />
bislang der zweite, außerordentlich bedeutende Teil des (kinder-)literarischen Schaffens<br />
Irma (nunmehr Miriam) Singers. In sämtlichen bisherigen Bibliographien fehlen ihre<br />
zahlreichen Werke, die nach 1936 erschienen. Nach der Ermordung ihres Wiener Verlegers<br />
durch die Nationalsozialisten wurden ihre Werke nie wieder im deutschsprachigen<br />
Originaltext, sondern nurmehr in hebräischer und zum Teil in französischer und italienischer<br />
Übersetzung publiziert. Es ist dringend an der Zeit, die in der einschlägigen Forschung<br />
bis heute immer wieder kolportierten fälschlichen bio- und bibliographischen Daten<br />
zu korrigieren und zu ergänzen.<br />
Israelisches Archivmaterial und Quellenrecherche<br />
Während einiger Forschungsaufenthalte in Israel konnte der literarische Nachlass Irma<br />
Singers in diversen israelischen Archiven aufgefunden und gesichtet werden. Mittels dieser<br />
Archivalien sowie ausführlicher Gespräche mit ihrem jüngsten Sohn kann erstmals die<br />
Biographie Irma Singers nachgezeichnet sowie eine vollständige Bibliographie ihrer Publikationen<br />
erstellt werden. Das aufgefundene Archivmaterial belegt eine aktive und engagierte<br />
Tätigkeit der jungen Autorin im Umfeld der Prager KulturzionistInnen. Sie war seit<br />
1916 Mitglied des Prager „Jüdischen Wanderbundes Blau-Weiß“ und stand damit in engem<br />
Kontakt zum Jüdischen Turnverein „Makkabi“, zum „Verein jüdischer Hochschüler<br />
Bar-Kochba“ sowie zum „Klub jüdischer Frauen und Mädchen“ und gehörte seit 1918<br />
zum engeren Kreis der Familie Hugo Bergmann, mit der sie Anfang 1920 gemeinsam<br />
nach Palästina auswanderte und bei der sie das erste halbe Jahr in Jerusalem lebte. Im<br />
Rahmen intensiver Quellenrecherche vor allem der Prager „Selbstwehr“, der „Blau-Weiß-<br />
Blätter“ und der „Jüdischen Turnzeitung“ konnten zu allen der genannten Prager Vereine<br />
bislang unbekannte Informationen eruiert und neue Erkenntnisse gewonnen werden.<br />
Interdisziplinäre Methodik<br />
Bei diesem Dissertationsprojekt werden Methoden der Geschichts-, insbesondere der Exil-<br />
Agathe Löwe, Wien/Berlin: Löwit 1918; 2. Ausg. illustr. v. Jakob Löw, Wien/Berlin: 1920; 3. Ausg. illustr.<br />
v. Kosel-Gibson, Wien/Leipzig: Löwit 1925.<br />
2<br />
Singer, Mirjam: Benni fliegt ins Gelobte Land. Ein Buch für jüdische Kinder, illustr. v. Franz Reisz,<br />
Wien/Jerusalem: Löwit 1936.<br />
3<br />
Singer, Irma: Die Sage von Dilb, illustr. v. G. [Grete] Wolf Krakauer, hg. v. KKL Jerusalem u. „Omanuth“,<br />
Tel Aviv, Copyright 1935 [Bd.1 der Reihe Heimat. Palästina-Bibliothek für Kinder].<br />
4<br />
Singer, Irma: Kelle und Schwert. Aus den Heldentagen von Dagania, illustr. v. Otte [Otto] Wallisch hg. v.<br />
KKL Jerusalem u. „Omanuth“, Tel Aviv, Copyright [Bd. 3 der Reihe Heimat. Palästina-Bibliothek für<br />
Kinder].
RAHEL ROSA NEUBAUER: DISSERTATIONSPROJEKT<br />
und Biographieforschung, der Germanistik sowie der Komparatistik, vor allem der „Vergleichenden<br />
Sozialgeschichte der Literaturen“, kombiniert. Es sollen die sozialhistorischen,<br />
gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Autorin, die in einer<br />
Zeit der aufgrund des zunehmenden Antisemitismus sich zunehmend ändernden Lebensbedingungen<br />
zu publizieren begann, untersucht werden. Es ist Ziel des Projekts, die Kinderliteratur<br />
Irma Singers in ihrem kulturellen Kontext und als Form ihrer Auseinandersetzung<br />
mit der Frage nach Identität und einer erfüllenden Lebensform zu erfassen. Die Bedeutung<br />
ihrer Kinderbücher als zeitgeschichtliche Dokumente soll herausgearbeitet werden<br />
– sie sollten Mut und Selbstbewusstsein der jüdischen Kinder stärken, ihnen Perspektiven<br />
geben und mit der Vorstellung Erez Israels konkrete Alternativen zum Alltag in Europa,<br />
wo sie als Juden stets Fremde blieben, aufzeigen.<br />
Aber nicht nur das literarische Werk Irma Singers ist hochinteressant und Ausdruck einer<br />
bedeutenden kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Bewegung des deutschsprachigen<br />
Judentums – auch ihr Prager Freundeskreis und die Institutionen, denen sie angehörte,<br />
das soziale Umfeld, in dem sie bis zu ihrer Auswanderung 1920 aktiv und äußerst<br />
engagiert wirkte, ist von außerordentlichem Interesse sowohl für die Literaturwissenschaft<br />
als auch für die Geschichtsforschung. So war sie seit ihrer frühen Jugend Wandrerin des<br />
Prager „Jüdischen Wanderbundes Blau-Weiß“, engagierte sich in dessen sozialen und kulturellen<br />
Einrichtungen, vor allem im Rahmen der galizischen Flüchtlingshilfe, und publizierte<br />
in der Monatsschrift „Blau-Weiß-Blätter“. Damit gehörte sie zu den sogenannten<br />
Prager KulturzionistInnen und stand in engem Kontakt mit den Mitgliedern und Aktivitäten<br />
des „Jüdischen Turnvereins Makkabi“, des „Klubs jüdischer Hochschüler Bar Kochba“<br />
und des „Klubs jüdischer Frauen und Mädchen“ bzw. des „Mädchenklubs“. In diesem<br />
Zusammenhang wird zudem ein ganz neuer „Prager Kreis“ offenbar, bestehend aus aktiven<br />
und engagierten jüdischen Mädchen und Frauen.<br />
Der Beitrag der Prager KulturzionistInnen zur Schaffung jüdischer Kinderliteratur<br />
Auch zu diesem Aspekt konnten im Zuge des Dissertationsprojekts ganz neue Erkenntnisse<br />
gewonnen werden. Weder der Vorreiterrolle Prags in der jüdischen Jugendschriftendebatte<br />
noch dem Mitwirken Max Brods und Hugo Bergmanns in Salman Schockens Berliner<br />
Kulturausschuss wurden bisher eigene Studien gewidmet.<br />
„Kulturarbeit“ war für alle zionistischen Organisationen Prags ein wichtiges Anliegen.<br />
Die bedeutendste Institution des „Kulturzionismus“, der „Verein für jüdische Hochschüler<br />
Bar Kochba“ war sich bereits früh bewusst, dass die „Beschaffung von Materialien zur<br />
jüdischen Jugenderziehung“ 5 der nationaljüdischen Bewegung ein großes Anliegen sein<br />
musste. Im August 1913 forderte der Bundesbruder Hugo Herrmann in der von den „Barkochbanern“<br />
herausgegebenen und für die Zielsetzung des Kulturzionismus programmatischen<br />
Schrift „Vom Judentum“, „eine Sammlung von Märchen“ sowie „Sagen, Erzählungen,<br />
Romane und Novellen als eine jüdische Jugend-Bücherei [zu] schaffen“ 6 . Einige Monate<br />
später hielt der langjährige Obmann Hugo Bergmann ein „Kulturreferat“ auf dem<br />
böhmischen Distriktstag der Zionistischen Organisation, in dem er erneut ganz konkret<br />
forderte, „der jüdischen Mutter sagen [zu] können, welche Märchen sie ihren Kindern erzählen,<br />
welche Bilderbücher sie ihnen zeigen kann“ 7 . Um eine Sichtung und Zusammenstellung<br />
geeigneter jüdischer Kinderliteratur durchführen zu können, forderte er die Einrichtung<br />
eines zionistischen Kulturrates unter der Leitung einer Kulturkommission als<br />
5<br />
Bericht der 39. Ordentlichen Semestral-Generalversammlung des Bar Kochba unter dem Obmann Robert<br />
Weltsch, Selbstwehr, Jg. 6, Nr. 10, 8.3.1912, S. 3f.<br />
6<br />
Herrmann, Hugo: Erziehung im Judentum, in: Vom Judentum. Ein Sammelbuch, hg. v. Verein jüdischer<br />
Hochschüler Bar Kochba, Leipzig: Kurt Wolff Verlag 1913, S. 186-191, hier S. 188f.<br />
7<br />
Bergmann, Hugo: Die zionistische Kulturarbeit in Böhmen, in: Selbstwehr, 7. Jg., Nr. 49 (5.12.1913), S.<br />
2f., hier S. 3.<br />
3
<strong>Rahel</strong> <strong>Rosa</strong> <strong>Neubauer</strong> 4<br />
Arbeitskommission. In die Kulturkommission wurden führende Bar-Kochba-Mitglieder<br />
gewählt, in den Kulturrat u.a. der Herausgeber der Zeitschrift „Jung Juda“ für jüdische<br />
Kinder und Jugendliche, Filipp Lebenhart.<br />
Im Dezember hielt auf dem Delegiertentag der Zionistischen Vereinigung für Deutschland<br />
Salman Schocken, der spätere Verleger des gleichnamigen jüdischen Verlages, ein „Kulturreferat“,<br />
in dem er die Einrichtung eines „Hauptausschusses für Kultur-Arbeiten“ forderte,<br />
der die Finanzierung von „geistigen Arbeitern“ im Bereich Wissenschaft und Literatur<br />
sicherstellen und deren Forschungen initiieren und fördern sollte. Eine von Schockens<br />
diesbezüglichen Forderungen lautete, „Bücher für den Gebrauch unserer Jugend herauszugeben“.<br />
8 Mitglieder dieses Kulturausschusses wurden neben den Deutschen Schocken,<br />
Buber, Blumenfeld und Calvary auch die Prager Hugo Bergmann und Max Brod.<br />
Im Juni 1917 wurde von diesem Berlin-Prager Kulturausschuss ein „Preisausschreiben für<br />
jüdische Jugenderzählungen“ mit den Preisrichtern Buber, Calvary und Brod veranstaltet,<br />
die in der Folge in der vom Ausschuss gegründeten Reihe „Jüdische Jugendbücher“ veröffentlicht<br />
wurden.<br />
Auch die enge Zusammenarbeit der Prager KulturzionistInnen sowohl mit dem Wiener<br />
Pädagogen Siegfried Bernfeld als auch mit dem Verleger des Wiener Löwit-Verlages sowie<br />
die jüdische Jugendzeitschrift „Jerubbaal“ als Gemeinschaftswerk Prager und Wiener<br />
ZionistInnen stellen ganz neue Forschungsergebnisse dar.<br />
Gründung des Prager „Jüdischen Wanderbundes Blau-Weiß“<br />
Im Zuge der Recherchen für das Dissertationsprojekt konnte die Gründung des Blau-Weiß<br />
Prag (ebenso wie Blau-Weiß Wien eine Ortsgruppe des Österreichischen Bundes) aufgearbeitet<br />
werden. Diese wird weder in Hackeschmidts Studie zum deutschen Blau-Weiß 9<br />
noch in Meier-Cronemeyers ausführlicher Studie zur jüdischen Jugendbewegung 10 behandelt.<br />
Auch die jüngste detailreiche Studie Kateřina Čapkovás zu Prager zionistischen Vereinigungen<br />
11 streift diese nur, da sie sich auf die Zwischenkriegszeit konzentriert. Ebenso<br />
liegt nach derzeitigem Wissensstand auch in Israel keine diesbezügliche Studie vor. Der<br />
jüngste einschlägige Aufsatz „The Beginnings of ,Blau-Weiss’ in Bohemia“ von Richard<br />
Karpe 12 kann ebenfalls durch das neue Datenmaterial ergänzt werden.<br />
Zudem ergaben sich bislang nicht bekannte Aspekte wie das Engagement des Mitbegründers<br />
des Wiener Blau-Weiß, Sigmund Freuds Sohn Ernst Freud, sowie die Unterstützung<br />
durch Sigmund Freund und Felix Salten und die des Prager Blau-Weiß durch Berta Fanta<br />
und den Vater Max Brods.<br />
Der Prager „Klub jüdischer Frauen und Mädchen“<br />
Zu dem kulturzionistischen Umfeld, von dem Irma Singer geprägt wurde, gehörte neben<br />
dem Prager „Blau-Weiß“ und dem „Klub jüdischer Hochschüler ,Bar-Kochba’“ auch der<br />
„Klub jüdischer Frauen und Mädchen“, der von Else Bergmann, der Tochter Berta Fantas,<br />
geb. Sohr, und Frau Hugo Bergmanns, gegründet wurde. Die Vorsitzenden dieser zionisti-<br />
8<br />
Schocken, Salman: Referat über „Organisation und Inhalt der zionistischen Arbeit in Deutschland“, in:<br />
Jüdische Rundschau, Nr. 1, 5.1.1917, S. 2-4.<br />
9<br />
Hackeschmidt, Jörg: Von Kurt Blumenfeld zu Norbert Elias. Die Erfindung einer jüdischen Nation, Hamburg:<br />
Europäische Verlagsanstalt 1997.<br />
10<br />
Meier-Cronemeyer, Hermann: Jüdische Jugendbewegung, in: Germania Judaica. Kölner Bibliothek zur<br />
Geschichte des deutschen Judentums, N.F. 27/28, Jg. 8, H. 1/2, 1969, S. 1-56 u. N.F. 29/30, Jg. 8, H. 3/4,<br />
1969, S. 57-122.<br />
11<br />
Čapková, Kateřina: Specific Features of Zionism in the Czech Lands in the Interwar Period, in: Judaica<br />
Bohemiae 38 (2002), Prag: Židovské Muzeum v Praze 2003, S. 106-159.<br />
12<br />
Karpe, Richard: „The Beginnings of ,Blau-Weiss’ in Bohemia“, in: Rhapsody to Tchelet Lavan in<br />
Czechoslovakia, Israel: Association for the History of Tchelet Lavan - El Al in Czechoslovakia 1996, S.<br />
16-20.
RAHEL ROSA NEUBAUER: DISSERTATIONSPROJEKT<br />
schen Vereinigung waren u.a. Lise Weltsch (die Schwester von Robert Weltsch) und die<br />
Lyrikerin Trude Thieberger, besser bekannt unter dem Namen Gertrude Urzidil (Schwester<br />
von Nelly Thieberger, die, was in der Forschung meist meist nur am Rande erwähnt<br />
wird, während des Ersten Weltkrieges die Leitung der zionistischen Wochenschrift<br />
„Selbstwehr“ innehatte.<br />
Der Klub organisierte regelmäßig literarische Vortragsabende, an denen „das junge literarische<br />
Prag“ vorgestellt wurde, in deren Rahmen beispielsweise kurz zuvor oder noch gar<br />
nicht publizierte Texte des damals noch unbekannten Franz Kafka oder von Max Brod<br />
vorgetragen wurden und auf diese Weise junge Schriftsteller ein Forum bekamen.<br />
Mittels intensiver Quellenrecherche der „Selbstwehr“ wurde erstmals in der Forschung die<br />
Gründungsgeschichte dieses Vereins sowie dessen außerordentliche Bedeutung als literarisches<br />
Forum vor allem für die jungen AutorInnen des Prager Kreises aufgearbeitet. Die<br />
Bestände des Prager Periodikums weisen im deutschsprachigen Raum zumeist gravierende<br />
Lücken vor allem der entscheidenden Jahrgänge 1911-1915 auf; im Zuge der Projektvorarbeiten<br />
konnten glücklicherweise im Magazin der Österreichischen Nationalbibliothek<br />
die auf Mikrofilm ebenfalls fehlenden Jahrgänge in Druckform aufgefunden und wieder<br />
zugänglich gemacht werden.<br />
Auf diese Weise kann das Gründungsdatum, das von Irma Pollak in ihrem grundlegenden<br />
Aufsatz „The Zionist Women’s Movement“ 13 falsch kolportiert und seither in der einschlägigen<br />
Forschungsliteratur übernommen wurde, korrigiert und die Tätigkeit dieses<br />
Vereins umfassend dargelegt werden.<br />
Die tschechisch-deutsche Sprachproblematik der jüdischen Autorin<br />
2006 erschien in der Reihe „Veröffentlichungen des <strong>Collegium</strong> <strong>Carolinum</strong>“ der Band „Juden<br />
zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten 1800-<br />
1945“ 14 . Auch zu diesem Aspekt liefert der in Israel aufgefundene literarische Nachlass<br />
der Autorin anschauliches biographisches Material. Tschechischsprachig aufgewachsen,<br />
besuchte Irma Singer in Prag deutsche Schulen und bediente sich des Deutschen in der<br />
Folge als Schriftsprache, empfand dies allerdings als schwierigen „Dualismus“, den sie<br />
später in Palästina bzw. Israel wiederholt sah, als sie sich nunmehr des Hebräischen als<br />
mündliche Sprache bediente und weiterhin auf Deutsch schrieb.<br />
Folgeprojekt in Planung<br />
Im Rahmen eines weiteren, in Planung befindlichen Forschungsprojekts soll das Leben<br />
und Wirken der Prager Autorin in Israel nachgezeichnet werden. Im Rahmen dieses Folgeprojekts<br />
wären sollen folgende Themenschwerpunkte mitberücksichtigt werden:<br />
100 Jahre Deganya (2010)<br />
Als Korrespondentin diverser europäischer Periodika lieferte Irma/Miriam Singer zahlreiche<br />
Reportagen über Alltag und Entwicklung des Kibbuzlebens in Palästina/Israel. Als<br />
Erzieherin plante sie gemeinsam mit dem Architekten Leopold Kracauer den Neubau des<br />
13 Polak [recte Pollak], Irma: The Zionist Women’s Movement, in: The Jews of Czechoslovakia. Historical<br />
Studies and Surveys, Bd. 2, N.Y. 1971, S. 137-147.<br />
14 Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800-1945,<br />
hg. v. Marek Nekula u. Walter Koschmal, München 2006 [Veröffentlichungen des <strong>Collegium</strong> <strong>Carolinum</strong>,<br />
Bd. 104].<br />
5
<strong>Rahel</strong> <strong>Rosa</strong> <strong>Neubauer</strong> 6<br />
Kibbuz-Kindergartens, der als typisches Beispiel der Architektur Kracauers in Israel gilt.<br />
Ihre Erzählungen „Geschichten um Deganya“, die 1952 in hebräischer Übersetzung in Tel<br />
Aviv als Kinderbuch erschienen, wurden gemeinsam mit denen des Kibbuzbegründers<br />
Joseph Baratz in der Schweiz als Zeitzeugenberichte veröffentlicht. 15 Der hundertste Geburtstag<br />
des ersten Kibbuz Israels stellt einen idealen Anlass für eine entsprechende Publikation/Ausstellung/Tagung/Erstveröffentlichung<br />
von „Geschichten um Deganya“ dar.<br />
Über Kooperationsvorschläge bzw. mögliche Einbindungen in andere Projekte wäre ich<br />
sehr dankbar.<br />
Publikation der Werke Miriam Singers nach 1938<br />
Wie bereits dargelegt, wurden nach der Ermordung des Wiener Verlegers Irma/Miriam<br />
Singers durch die Nationalsozialisten ihre Werke nie wieder im deutschsprachigen Originaltext<br />
publiziert und blieben nicht nur der deutschsprachigen Öffentlichkeit, sondern<br />
auch der Forschung bislang vollkommen unbekannt. Die im Nachlass befindlichen<br />
deutschsprachigen Originaltyposkripte sollen im Rahmen einer neuen Reihe mit dem Arbeitstitel<br />
„Kinderbücher als Zeitdokumente“ erstmals veröffentlicht werden.<br />
Nachlassbearbeitung<br />
Der in diversen israelischen Archiven befindliche literarische Nachlass der Prager sowie<br />
israelischen Autorin Irma/Miriam Singer sollte zudem bearbeitet und erschlossen werden.<br />
Für diesbezügliche Tips und Anregungen, vor allem auch Möglichkeiten finanzieller Unterstützung<br />
derartiger Nachlassbearbeitungen wäre ich außerordentlich dankbar.<br />
„Dorten und Gugelhupf“ – Prag in Palästina<br />
1920 emigrierte eine Gruppe von PragerInnen nach Palästina, die in der Folge den Kibbuz<br />
Bet Alpha (Chefziba) mit begründeten, unter ihnen Frieda Löwy, Blau-Weiß-Führerin und<br />
Mitglied des Klubs jüdischer Frauen und Mädchen, und A. Raphael Salus, 1922 eingewandert<br />
und einer der Gründungsmitglieder von Chefziba (ob dieser mit Ella Salus, Mitglied<br />
des Klubs jüdischer Frauen und Mädchen, verwandt war, konnte bisher noch nicht<br />
eruiert werden).<br />
Anfang 1921 berichtet Hugo Bergmann an Robert Weltsch, dass in Jaffa „jetzt eine ganze<br />
tschechoslowakische Kolonie entstanden“ sei, wo man „ganz wie in Prage“ lebe: „es ist<br />
etwas ungemein Wohltuendes hier zu sein, diese gemütliche, vom Elternhaus gewohnte<br />
angenehm philiströse Umgebung mit Dorten und Gugelhupf und all den guten Sachen,<br />
welche meine Mutter so gut zu machen versteht und die es für uns in Jerusalem nicht mehr<br />
gibt.“ Bergmann nahm in Tel Aviv an einer „Sitzung der ,tschechoslowakischen Einwanderer’“<br />
teil, wo man „die Vereinigung der Einwanderer aus der Tschechoslowakei“ beschloss,<br />
die „Nachrichten über die Lage der Dinge nach der Tschechoslowakei vermitteln<br />
und die vielen Anfragen wegen Möglichkeit von Einwanderung, Kapitalsanlage etc. beantworten<br />
soll, gleichzeitig die bestehenden Bande unter uns pflegen, eventuell dem Einzelnen<br />
im Notfall beistehen soll“. 16 Seine Frau Else Bergmann besuchte mehrmals Irma<br />
Singer in Deganya, um das Arbeiten in Palästina zu erlernen.<br />
Es wäre also von größtem Interesse, auch diesem Netzwerk von Prager Einwanderern in<br />
Palästina gezielte Forschungen zu widmen.<br />
15 Histoire de Degania par Miriam Singer, traduites et adaptées par Rose-H. Vaucher, in : Vaucher, Paul:<br />
Degania. L’aventure du premier kibboutz, préface de Philippe Zeissig, Neuchatel 1965, S. 91-203.<br />
16 Bergman, Schmuel Hugo: Tagebücher und Briefe, Bd. 1, Königstein/Ts. 1985, S. 151.