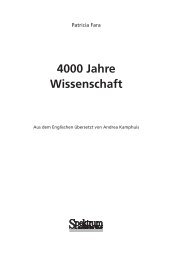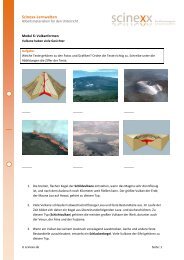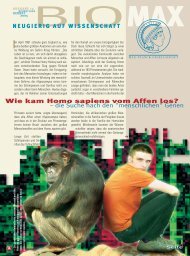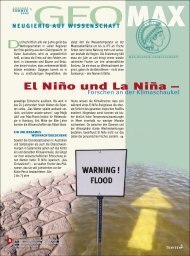Leseprobe aus "Astronomie" - Scinexx
Leseprobe aus "Astronomie" - Scinexx
Leseprobe aus "Astronomie" - Scinexx
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2<br />
38 2 Gravitation und Planetenbewegung<br />
Wegbereiter der modernen Astronomie<br />
Im 16. und 17. Jahrhundert erfuhr die Astronomie enorme Fortschritte und geradezu Umwälzungen,<br />
die sich <strong>aus</strong> den neuen Erkenntnissen ergaben. Die Bewegungen der Himmelskörper konnten<br />
jetzt nämlich durch das Wirken der Gravitationskraft erklärt werden, und die Erde verlor endgültig<br />
ihre besondere Stellung als Zentrum des Kosmos. Die maßgebenden Theorien wurden von<br />
glänzenden Denkern aufgestellt; sie widerlegten das heliozentrische Modell des Sonnensystems<br />
und klärten die Bedeutung der Schwerkraft.<br />
(E. Lessing/<br />
Art Resource)<br />
Nikol<strong>aus</strong> Kopernikus<br />
(1473–1543)<br />
Kopernikus wurde als jüngstes von vier<br />
Kindern einer deutschen Familie in<br />
Thorn an der Weichsel geboren, das zwei<br />
Jahrzehnte zuvor an Polen gefallen war.<br />
Er studierte in Krakau Mathematik und<br />
Astronomie sowie in Bologna und Padua<br />
Medizin und Rechtswissenschaften. Er<br />
konzipierte eine heliozentrische Theorie<br />
des seinerzeit bekannten Universums<br />
und veröffentlichte 1543, kurz vor seinem Tode, sein Hauptwerk<br />
De Revolutionibus Orbium Coelestium (Über die Kreisbewegungen<br />
der Himmelssphären). Seine revolutionäre Theorie<br />
hatte allerdings noch den Nachteil, dass die Umlaufbahnen<br />
der Planeten um die Sonne als Kreise angenommen wurden.<br />
Dies wurde später von Johannes Kepler korrigiert.<br />
(Gemälde von Jean-<br />
Leon Huens, mit<br />
freundlicher<br />
Genehmigung der<br />
National Geographic<br />
Society)<br />
Tycho Brahe (1546–1601) und<br />
Johannes Kepler (1571–1630)<br />
Tycho Brahe (in diesem Porträt Keplers<br />
im Hintergrund dargestellt) wurde als<br />
Sohn einer adligen Familie in der dänischen<br />
Stadt Knudstrup geboren, die<br />
heute zu Schweden gehört. Im Alter von<br />
20 Jahren verlor er bei einem Duell einen<br />
Teil seiner Nase und trug seitdem<br />
eine Prothese bzw. Maske <strong>aus</strong> Metall.<br />
Im Jahre 1576 gewährte ihm der dänische<br />
König Frederik II. die Mittel für den<br />
Bau einer Sternwarte. Brahe nannte sie<br />
Uraniborg (nach Urania, der griechischen<br />
Muse der Astronomie). Brahe<br />
lehnte sowohl die heliozentrische Theo-<br />
rie des Kopernikus als auch die geozentrische Theorie des<br />
Ptolemäus <strong>aus</strong> dem 2. Jahrhundert n. Chr. ab. Er kombinierte<br />
beide Ansätze miteinander und hielt die Erde für ruhend, die<br />
von Sonne und Mond umlaufen wird, während sich alle anderen<br />
Planeten um die Sonne drehen.<br />
Der nahe Stuttgart geborene Johannes Kepler studierte<br />
drei Jahre lang in Deutschland Mathematik, Philosophie und<br />
Theologie. Im Jahre 1596 publizierte er mathematische Formeln<br />
zum Berechnen der Umlaufbahnen der Planeten. Obwohl<br />
diese Theorie unzutreffend war, erregten sein Mut und<br />
seine Originalität die Aufmerksamkeit von Tycho Brahe, dessen<br />
Mitarbeiter Kepler im Jahre 1600 wurde. Dieser leitete<br />
später seine drei Gesetze <strong>aus</strong> den Ergebnissen von Brahes<br />
Beobachtungen ab.<br />
Galileo Galilei (1564–1642)<br />
Galilei, der in Pisa geboren wurde, studierte<br />
hier Medizin und Philosophie.<br />
Bald wandte er sich aber der Mathematik<br />
und der Physik zu. Er erhielt an der<br />
Universität Padua den Lehrstuhl für Mathematik<br />
und kehrte später in gleicher<br />
Funktion an die Universität Pisa zurück.<br />
Hier stellte er sein berühmtes Fallge-<br />
(Art Resource)<br />
setz auf, nach dem alle Objekte mit der<br />
gleichen Beschleunigung zur Erde fallen,<br />
gleichgültig wie schwer sie sind. Im Jahre 1609 verbesserte<br />
er die Konstruktion des Teleskops. Hiermit gelangen<br />
ihm zahlreiche bahnbrechende Entdeckungen, die den von<br />
der römisch-katholischen Kirche als einzig wahr anerkannten<br />
Lehren des Aristoteles widersprachen. Seine Arbeiten zur<br />
Astronomie sowie zu den Begriffen Bewegung, Beschleunigung<br />
und Scherkraft fasste er 1632 in seinem Werk Dialogo<br />
sopra le due massimi systemi (Dialog über die zwei hauptsächlichsten<br />
Weltsysteme) zusammen.<br />
(National Portrait<br />
Gallery, London)<br />
Isaac Newton (1643–1727)<br />
Newton beschäftige sich gern mit der<br />
Konstruktion mechanischer Vorrichtungen<br />
wie beispielsweise Sonnenuhren<br />
oder Windmühlenmodellen; er konzipierte<br />
auch eine Wasseruhr und eine<br />
mechanische Kutsche. Sein Studium in<br />
London und Cambridge schloss er<br />
1665 ab. Als Professor für Mathematik<br />
in Cambridge entwickelte er danach<br />
(unabhängig vom Gottfried Wilhelm<br />
Leibniz) die Infinitesimalrechnung. Bei<br />
seinen Experimenten zur Optik konstruierte Newton ein<br />
Spiegelteleskop und entdeckte, dass weißes Licht eine Mischung<br />
von Licht aller Farben ist. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse<br />
über Kräfte allgemein und über die Gravitationskraft<br />
im Besonderen publizierte er 1687 in dem umfangreichen<br />
Werk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Mathematische<br />
Prinzipien der Naturlehre). Im Jahre 1704 legte<br />
Newton seine zweite große Abhandlung Opticks (Optik) vor,<br />
in der er seine Experimente und Theorien über Licht und Farben<br />
beschrieb. Newton starb 1727 und wurde in der Westminster<br />
Abbey beigesetzt – eine Ehre, die zuvor noch keinem<br />
Wissenschaftler zuteil geworden war.