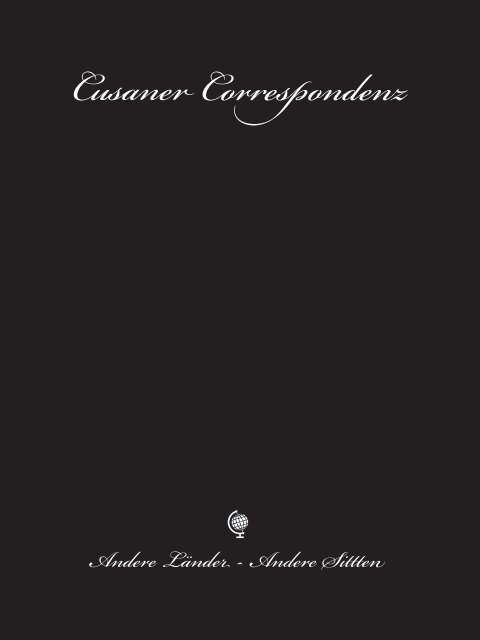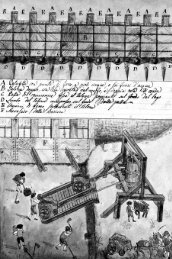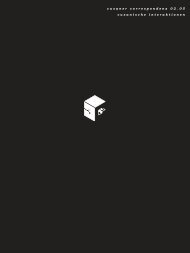cc 02_2010 - Cusanus.net
cc 02_2010 - Cusanus.net
cc 02_2010 - Cusanus.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Cusaner<br />
Correspondenz<br />
Andere Länder - Andere Sittten
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Aus der Reda<strong>cc</strong>tion<br />
04 Reda<strong>cc</strong>tionelles<br />
05 Editorial<br />
Thema<br />
06 Einführung<br />
08 Impuls | Das Fremde und das Eigene<br />
10 Interview | Muhammad Yunus<br />
14 Aufsatz | Moskito<strong>net</strong>ze zum Fischen?<br />
16 Cusana Columna | ¡Ay, qué calor!<br />
17 Künstlerische Arbeit<br />
23 Nachgedacht<br />
24 Kulturtipps | Fremd gelesen<br />
26 Pinnwand<br />
27 Künstlerische Arbeit | Treibgut<br />
Himmlisches<br />
28 Aufsatz | Ein Bett voller Flöhe<br />
32 Reisetipps | Andere Kirchen<br />
34 Impuls | Kaderschmiede?<br />
Focusanus<br />
36 Aus der Geschäftsstelle | Referentin<br />
38 Von der Basis | Klimaschutz-Bündnis<br />
40 Studentenfutter | Indien verstehen<br />
44 Studentenfutter | Über 2.000 Meter<br />
Ausbli<strong>cc</strong><br />
46 Herbstausgabe<br />
47 Impressum<br />
03
Reda<strong>cc</strong>tionelles<br />
DIE AUSLANDSCCORRESPONDENTEN<br />
Hannah Hufnagel (KI)<br />
feiert Mittsommer auf<br />
Åland, ganz traditionell!<br />
15:25 Uhr<br />
Christian Gogolin (D)<br />
hat den vietnamesischen<br />
Höllenritt überlebt.<br />
7:12 Uhr<br />
Laura Pennington (WÜ) nimmt<br />
den Aasee unter die Lupe.<br />
12:34 Uhr<br />
Alex Gebarowski (HH)<br />
sucht Arielle vor<br />
Korsika. 17.49 Uhr<br />
Philipp Schönecker (HD) kämpfte sich durch den<br />
bolivianischen Chaco zu uns ins Team. 10:51 Uhr<br />
Julia Schulz (HI) besucht den Hamburger Bürgermeister. 20:03 Uhr<br />
Andere Länder - Andere Sitten<br />
Die Welt ist schwarz-weiß. Es gibt Schurkenstaaten und die Achse des Guten. Dazwischen<br />
gibt es – nichts, keine Abstufungen, keine Zwischentöne. Der Eine steckt die Andere in<br />
Schubladen, um das eigene Weltbild zu sortieren. Schwarz und weiß, das ist einfach und<br />
klar. Graustufen machen es nur kompliziert.<br />
Schwarz und Weiß gehören in dieser Ausgabe zusammen: “Black and white, unite, unite!”*<br />
Und dazwischen liegt das goldene Mittelmaß, die Neutralität: Grau. Dunkelgrau, Mittelgrau,<br />
Hellgrau: Unser Themenblock mit euren Erfahrungen in anderen Ländern und deren<br />
Sitten, himmlische Erlebnisse und Ideen zwischen Himmel und Erde sowie abschließend<br />
der Focusanus.<br />
Die Welt ist voller Vielfalt, Nuancen und Unterschiede. Also nichts wie raus in die Fremde,<br />
empfiehlt Christian Kölzer in seiner Einführung. Kerstin Humberg macht es vor: Für ihre<br />
Doktorarbeit recherchierte sie fünf Monate lang in Bangladesh und interviewt in dieser<br />
Ausgabe Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus. Dabei gilt es, im Austausch mit<br />
dem „Anderen“ den eigenen kulturellen Rucksack einfach mal abzusetzen, auch wenn es<br />
schwer fällt – wie Cecilia Colloseus resümiert.<br />
Über andere Länder und andere Sitten erfahren wir auch in den folgenden Teilen, zum<br />
Beispiel von ökumenischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Ostseeraum, von ungewöhnlichen<br />
Sakralbauten aus aller Welt oder von den Eindrücken der letzten Auslandsakademie<br />
in Indien.<br />
Im Focusanus stellen wir euch außerdem eine weitere Referentin und verschiedene cusanische<br />
Aktivitäten vor. Unter Himmlisches regt Michael Fipper zu einer Diskussion über<br />
die cusanische Verantwortung in der katholischen Kirche an.<br />
Eine anregende Reise durch das Heft wünscht Euch<br />
Eure Reda<strong>cc</strong>tion<br />
*(Wolf Biermann, Ballade vom Briefträger William L. Moore)<br />
04<br />
05<br />
Editorial
Einführung<br />
Raus aus dem heimischen Goldfischglas!<br />
Dr. Christian Kölzer<br />
„Warum wollen Sie denn ins Ausland?<br />
Bleiben Sie lieber hier, und machen Sie ein gutes Examen<br />
– nach dem Ausland fragt später bei der Einstellung<br />
kein Mensch mehr.“ Der Rat des stellvertretenden<br />
Schulleiters, den er uns Anglistikstudierenden<br />
am Ende unseres Schulpraktikums an einem mittelhessischen<br />
Gymnasium glaubte mit auf den Weg geben zu<br />
müssen, konnte kaum deutlicher sein. Und auch kaum<br />
ignoranter. Ich bin froh, dass ich ihm nicht gefolgt bin.<br />
Und ich bin froh, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit<br />
im <strong>Cusanus</strong>werk immer wieder beobachten kann,<br />
wie auch andere ‚Unfolgsame‘ den Erfahrungsschatz<br />
des Auslandsaufenthaltes bergen wollen, weil sie das<br />
schnellst beste Inlandsstudium eben nicht als größten<br />
Reichtum betrachten, den die Studienzeit bereit hält.<br />
Warum wollen Sie denn ins Ausland?<br />
— Weil dort Erfahrungen warten, die im eigenen Land<br />
nicht zu machen sind. Das sich an das Zurücklassen<br />
des vertrauten Lebensumfeldes anschließende Neusortieren<br />
aller Aspekte des täglichen Lebens und der<br />
zwischenmenschlichen Beziehungen bedarf mitunter<br />
einer großen Kraftanstrengung, birgt aber noch weitaus<br />
mehr vielfältige Chancen des persönlichen Neu-<br />
anfangs, der Selbstgestaltung, der Entfaltung, welche<br />
im Goldfischglas der heimischen Vertrautheit bislang<br />
gehemmt waren. Auch wenn die Auslandserfahrungen<br />
immer individuelle Sonderwege sind, so stimmen viele<br />
Jahres- und Auslandsberichte darin überein, dass die<br />
Zeit im Ausland auch ein Reifeprozess war, der mit all<br />
den mit ihm verbundenen Hoch- und Tiefpunkten als<br />
wichtiger Schritt auf dem Weg zum persönlichen Profil<br />
verbucht werden kann.<br />
Warum wollen Sie denn ins Ausland?<br />
— Weil das direkte Erleben einer anderen Kultur in<br />
keiner Weise mit ihrem rein theoretischen Studium<br />
aufgewogen werden kann. Indien — das Ziel der letzten<br />
Auslandsakademie — ist mehr als die Summe der<br />
mit diesem Land verbundenen Begriffe, ist mehr als<br />
‚exotisch‘ und ‚Schwellenland‘, mehr als ‚Kastenwesen‘<br />
und ‚Call Center‘. Im heißschwülen Staub des Marktverkehrs<br />
im Karol Bagh Nordwestdelhis zu stehen und<br />
sich den Eindrücken hinzugeben, die die Sinne förmlich<br />
bestürmen, belagern und letztlich erobern, bedeutet<br />
nicht, Indien zu verstehen. Aber ebenso wenig bedeutet<br />
die Lektüre von wissenschaftlichen Texten über die<br />
Geschichte, die Gesellschaftsstruktur und die religiöse<br />
Tradition Indiens, dieses Land zu begreifen. Erst die Verbindung<br />
von Hintergrundwissen und direktem Erleben<br />
kann die Annäherung an ein Verständnis ermöglichen.<br />
Und was für Indien gilt, so die geteilte Erfahrung vieler<br />
Reisender, gilt ebenso auch für das direkte Nachbarland,<br />
das vor Ort auch weitaus anders, fremder, alternativenreicher<br />
ist, als es aus der Ferne scheinen mag.<br />
Warum wollen Sie denn ins Ausland?<br />
— Weil dort Kompetenzen erworben werden können,<br />
die in der heutigen globalen und multikulturell aufgestellten<br />
Gesellschaft eben doch gefragt sind. Wer sich<br />
und seine Kultur der Fremde aussetzt, sieht sich in<br />
vielen Situationen herausgefordert, das eigene Selbstverständliche<br />
mit dem Selbstverständlichen des Anderen<br />
zu verhandeln. Vom Alltäglich-Banalen zu existentiellen<br />
Fragen wird somit vieles aufs Neue bewusst<br />
und besinnt, in manchen Fällen gar bezaubert. Das<br />
Verhandlungsgeschick, das hier notwendig ist, um den<br />
vielbesungenen Kulturschock zu einem Kulturimpuls zu<br />
machen, die Selbständigkeit, mit der die vielen kleinen<br />
und großen Aufgaben der Lebensorganisation im Ausland<br />
zu meistern sind, und die Fähigkeit, einen tolerantleichtfüßigen<br />
Umgang mit weiterhin fremd bleibenden<br />
06 07<br />
Einführung<br />
Kulturaspekten zu unterscheiden von einem selbstbewussten<br />
Entgegenstehen an solchen Stellen, wo kulturübergreifende<br />
Werte entwürdigt werden — diese<br />
Kompetenzen, die im homogenen Umfeld der eigenen<br />
Kultur selten trainiert werden können, müssen als unverzichtbare<br />
Fähigkeiten für alle verstanden werden,<br />
die, an welcher Stelle auch immer, zentrale Positionen<br />
in Gesellschaft, Wissenschaft, Politik oder Wirtschaft<br />
anstreben. Die Biographieförderung des <strong>Cusanus</strong>werks<br />
möchte mit der in diesem Rahmen möglichen<br />
Unterstützung von Auslandsaufenthalten die Stipendiatinnen<br />
und Stipendiaten in die Lage versetzen, eben diese<br />
Erfahrungen und Kompetenzen zu erwerben und auf<br />
diese einzigartige Weise persönlich wachsen zu können.<br />
Warum wollen Sie denn ins Ausland?<br />
— Vor dem Hintergrund meiner eigenen Auslandserfahrungen,<br />
die ich zu den prägendsten und bereicherndsten<br />
in meinem Leben zähle, möchte ich nun<br />
dem stellvertretenden Schulleiter von damals antworten,<br />
indem ich ihm in der Sprache der Kultur, die ich<br />
in meiner Auslandszeit kennenlernen durfte, erwidere:<br />
„There’s more to life than this.“ (Björk)
Impuls Impuls<br />
Das Fremde und das Eigene<br />
Ein kleiner kulturanthropologischer Denkanstoß<br />
Cecilia Colloseus<br />
Wenn wir eine Reise antreten, nehmen wir üblicherweise<br />
eine ganze Menge Gepäck mit. Man weiß ja nie,<br />
was man so alles braucht, und in so einen Koffer geht<br />
ja auch einiges hinein. Das größte und unhandlichste<br />
Gepäckstück jedoch nehmen wir meist völlig unfreiwillig<br />
mit und merken im schlimmsten Falle gar nicht, wie<br />
schwer wir manchmal daran zu tragen haben: unser<br />
„kultureller Rucksack“ vollgepackt mit alltäglichen Gewohnheiten,<br />
Werten, Weltbildern und Überzeugungen.<br />
Im Grunde tragen wir ihn überall und jederzeit mit uns<br />
herum, ihn abzulegen ist nahezu unmöglich. Sind wir<br />
zuhause fällt er uns gar nicht auf, da ja jeder um uns<br />
herum den gleichen Rucksack mit dem gleichen Inhalt<br />
trägt. Dies kommt uns in jedem Falle zugute. Denn<br />
müssten wir immer wieder neu ausloten, wie unsere<br />
Mitmenschen ticken, welche Normen gelten etc., wären<br />
unsere ohnehin schon stark geforderten Sinne wohl<br />
restlos überfordert. Gewohntes, Vertrautes, Konsensfähiges,<br />
ja auch Triviales und Bagatellisiertes ist also<br />
dazu da, uns das (Zusammen-)Leben zu erleichtern,<br />
weshalb es auch durch Enkulturation und Sozialisation<br />
immer weiter tradiert wird. Wenn wir jedoch in ein anderes<br />
Land, in eine andere Kultur eintreten, wird der<br />
Rucksack plötzlich sehr präsent: Hier ist aus unserer<br />
Perspektive nichts gewohnt, vertraut oder konsensfähig<br />
und selbst im Trivialen und Bagatellisierten dieser<br />
Kultur sehen wir etwas Besonderes und Exotisches.<br />
REAKTIONEN AUF „DAS FREMDE“: ZWISCHEN<br />
ALLOPHILIE UND XENOPHOBIE<br />
Das Spektrum der Reaktionen auf eine solche Konfrontation<br />
reicht dann von der Liebe für alles Fremde<br />
(Allophilie) über den Fremdenhass (Xenophobie) bis<br />
hin zur Ablehnung der eigenen Kultur (Homöophobie)<br />
oder ihrer übersteigerten Verehrung (Chauvinismus).<br />
Gemeinsam ist allen diesen Abgrenzungs- bzw. Selbstfindungskonzepten<br />
die Definition des Eigenen über das<br />
Fremde und umgekehrt. Am verbreitetsten ist hier<br />
nach wie vor eine ethnozentristische und chronozentristische<br />
Sicht auf das Fremde, die noch nicht einmal<br />
abwertend gemeint sein muss. Wie oft hört man Touristen<br />
angesichts ungewohnter Lebensverhältnisse<br />
sagen: „Ach Gott! Die leben ja hier wie vor hundert<br />
Jahren!“ Der eigene Lebensstandard, die eigene Kultur<br />
wird zum erstrebenswerten Maßstab erhoben und<br />
alles Darunterliegende bemitleidet. Auch im Vergleich<br />
der Wertesysteme tritt eine solche Überheblichkeit<br />
noch oft an den Tag.<br />
ES GILT, DEN EIGENEN „KULTURELLEN RUCKSACK“<br />
ZEITWEISE ABZUSETZEN<br />
So werden auf Mythen basierende Tabus oder ein ehrfürchtiger<br />
Umgang mit Sakralem als unaufgeklärt belächelt<br />
und man klopft sich stolz auf die westliche erhabene<br />
Schulter. Die Dichotomie „Zivilisierte“ und „Wilde“<br />
rückt somit, ohne dass man es merkt, erschreckend<br />
nah. An dieser Stelle gilt es einzulenken, innezuhalten<br />
und das Unhinterfragte, das uns das Leben erleichtern<br />
soll, möglicherweise doch zu hinterfragen. Wenn<br />
wir nämlich den kulturellen Rucksack doch einmal für<br />
kurze Zeit absetzen und sozusagen als Ethnographen<br />
mit Außenperspektive in der eigenen, vertrauten Kultur<br />
unterwegs sind, uns mit ihrem komplexen Ganzen,<br />
in dem alles miteinander in Beziehung steht und jedes<br />
Teil über sich auf das Ganze hinausweist, auseinandersetzen<br />
und nichts als selbstverständlich und trivial<br />
hinnehmen, erschließen sich uns Möglichkeiten, das<br />
„Eigene“ und das „Fremde“ ganz neu zu definieren.<br />
Möglicherweise finden wir Verhaltensweisen, die wir<br />
in der fremden Kultur belächelt haben, in der eigenen<br />
wieder, bloß an einer ganz anderen Stelle. Oder wir finden<br />
es plötzlich merkwürdig, was bei uns alles so normal<br />
und selbstverständlich ist. Es kann mitunter sehr<br />
unterhaltsam sein, das Vertraute so zu betrachten,<br />
als wäre es etwas völlig Neues, man sieht sich selbst<br />
und seine Mitmenschen in einem ganz anderen Licht<br />
und seinen Horizont erweitert man<br />
damit allemal. Probiert es einfach<br />
selber mal aus! In einer postmodernen<br />
Welt, die auf Konzepte<br />
der Globalisierung und<br />
Hybridisierung setzt, sind das<br />
„Eigene“ und das „Fremde“ an<br />
sich keine trennscharfen Kategorien<br />
mehr. Dennoch gibt es<br />
eine bunte Vielfalt an kulturellen<br />
Eigenheiten, die es zu entdecken<br />
gilt und die uns immer wieder<br />
zum Staunen bringen kann.<br />
Gerade hierfür ist es wichtig,<br />
sein kulturelles Gepäck einmal<br />
auszumisten, es jedoch<br />
ebenso wie das Fremde anzunehmen<br />
als das, was es<br />
ist, und an<br />
einem ernsthaften interkulturellen<br />
Dialog zu arbeiten.<br />
Die Konfrontation<br />
mit dem Fremden öff<strong>net</strong> uns<br />
ganz neue Welten – sogar<br />
unsere eigene Alltagswelt.<br />
Der Andersdenkende ist kein<br />
Idiot, er hat sich eben eine andere<br />
Wirklichkeit konstruiert.<br />
Paul Watzlawick<br />
08 09
Interview Interview<br />
Profit für die Armen<br />
Interview mit Nobelpreisträger<br />
Prof. Muhammad Yunus<br />
Kerstin Humberg<br />
Professor Yunus lehrt Ökonomie an der Chittagong Universität in Bangladesch und ist Gründer der Grameen<br />
Bank, die Mikrokredite an Arme vergibt. Für sein Engagement erhielt er im Jahr 2006 den Friedensnobelpreis.<br />
Kerstin Humberg arbeitet im Rahmen ihrer Doktorarbeit zum Thema „Poverty Reduction through Social Business<br />
– Lessons learnt from Bangladesh“ mit dem Yunus Centre in Dhaka zusammen und war fünf Monate vor<br />
Ort.<br />
Herr Yunus, Ihre Vision, Armut mit Hilfe von Social<br />
Business ins Museum der menschlichen Geschichte zu<br />
verbannen, hat ihren Reiz. Andererseits erscheint das<br />
Ziel unmöglich. Welche Reaktionen erhalten Sie, wenn<br />
Sie für Ihren neuartigen Unternehmenstypus werben?<br />
Im Allgemeinen ist die Reaktion sehr positiv — in der<br />
Wirtschaft genauso wie in der Wissenschaft. Zurzeit<br />
entstehen viele neue Institutionen, die das Thema Social<br />
Business weiter vorantreiben. Zum Beispiel das<br />
Institute of Social Business an der California State University<br />
oder das Grameen Creative Lab in Wiesbaden.<br />
Kürzlich habe ich mich mit Vertretern der Glasgow Caledonian<br />
University getroffen. Auch sie wollen die Auseinandersetzung<br />
mit Social Business unter ihren Studenten<br />
und in der Wirtschaft Großbritanniens fördern.<br />
Ob in den USA, Europa oder Japan – bislang habe ich<br />
sehr positive Rückmeldungen bekommen.<br />
Auch beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos?<br />
So ist es. Im Januar hatten wir in Davos eine eigene<br />
Einheit zum Thema Social Business — mit dem Ergebnis,<br />
dass es von nun an jedes Jahr eine solche Session<br />
geben wird. Das ist großartig! Diese Treffen werden<br />
Menschen zusammenbringen, die sich für Social Business<br />
engagieren, Menschen, die erstmals mit diesem<br />
Ansatz in Berührung kommen, und solche, die dem Ansatz<br />
skeptisch gegenüber stehen.<br />
Was sagen Ihre Kritiker dazu?<br />
Auf der negativen Seite hören wir eigentlich nichts<br />
Neues — außer dem alten Argument. Dass Social Business<br />
in der Wirtschaft vermutlich wenig Anklang fin-<br />
den wird, da die Leute letztlich Geld verdienen wollen.<br />
„Wer interessiert sich schon für Geschäfte, in denen<br />
Geld keine Rolle spielt?“, heißt es dann.<br />
Wie gehen Sie damit um?<br />
Ich antworte, dass eine solche Auffassung aus genau<br />
jener Welt kommt, die nur eine Art von Unternehmen<br />
kennt: gewinnorientierte Unternehmen. Etwas anderes<br />
gibt es in dieser Weltanschauung nicht. Doch wenn Social<br />
Business erst einmal existiert, werden wir sehen,<br />
ob sich Menschen dafür engagieren oder nicht.<br />
Wie sieht der Praxistest aus?<br />
Tatsächlich sind bereits mehrere Social Businesses<br />
im Einsatz. Eins davon ist Grameen Danone Food Ltd.,<br />
ein Unternehmen, das wir 2006 gegründet haben, um<br />
die Mangelernährung unter armen Kindern in Bangladesch<br />
zu bekämpfen. Dieses Gemeinschaftsunternehmen<br />
produziert einen mit wichtigen Mineralstoffen angereicherten<br />
Joghurt zu einem Preis von 6 Takas, den<br />
sich selbst die Ärmsten leisten können. Ein anderes<br />
Beispiel ist Grameen Veolia Water Ltd., ein Gemeinschaftsunternehmen,<br />
das armen Landbewohnern Zugang<br />
zu sauberem Trinkwasser verschaffen möchte.<br />
Was steht als nächstes auf Ihrer Agenda?<br />
Weitere Social Businesses sind in der Pipeline. Zum<br />
Beispiel Grameen Employment Service, eine Arbeitsagentur,<br />
die Leute aus Bangladesch für den ausländischen<br />
Arbeitsmarkt trainieren und entsprechende<br />
Jobs vermitteln will. Wir wollen diesen Menschen ein<br />
anständiges Leben ermöglichen, frei vom Missbrauch<br />
durch andere, die nur Geld an ihnen verdienen wollen.<br />
Was schätzen die Befürworter an Social Business?<br />
Die Tatsache, dass der Ansatz einen neuen Spielraum<br />
schafft. Niemand zwingt sie dazu. Social Business ist<br />
eine neue Option. Für Stiftungen zum Beispiel. Anstatt<br />
das Geld für wohltätige Zwecke zu spenden, könnten<br />
Stiftungen in Zukunft in ein Social Business investieren.<br />
Spenden haben nur ein Leben, während sich ein Social<br />
Business auf Dauer finanziell selbst tragen kann. Wenn<br />
das Geschäftsmodell funktioniert, wird das investierte<br />
Kapital immer wieder zurückfließen und deutlich mehr<br />
Menschen zugute kommen. Aus meiner Sicht ist das<br />
ein deutlich effektiverer Einsatz von Mitteln, von der<br />
auch die bilaterale und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit<br />
profitieren könnte.<br />
Für wohltätige Organisationen mag das stimmen. Aber<br />
warum sollten sich Unternehmen, die sich im freien<br />
Wettbewerb behaupten müssen, mit Social Business<br />
auseinandersetzen?<br />
Geld, das für Maßnahmen im Bereich Corporate Social<br />
Responsibility vorgesehen ist, aber letztlich für PR-<br />
Zwecke eingesetzt wird, könnte stattdessen in eine<br />
Social-Business-Investition umgemünzt werden. Das<br />
Kerngeschäft würde keinen Schaden nehmen. Gleichzeitig<br />
ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten, die<br />
vorhandenen Mittel besser einzusetzen.<br />
Wie klappt die Zusammenarbeit mit multinationalen<br />
Unternehmen?<br />
Vertreter aus der traditionellen Geschäftswelt empfinden<br />
eine große Freude an dieser Arbeit. Der komplette<br />
Denkprozess macht eine gewaltige Veränderung<br />
durch. Wir beschäftigen uns mit Fragen, mit denen wir<br />
uns nie zuvor auseinandergesetzt haben – und das mit<br />
Begeisterung. Ohne Druck. Niemand zwingt uns. Sogar<br />
Mitarbeiter, die nicht direkt involviert sind, waren Feuer<br />
und Flamme. Gemeinsam entwickeln wir winzige Prototypen<br />
— und wenn wir nachweisen können, dass diese<br />
Prototypen funktionieren, haben wir damit im Prinzip<br />
einen Samen entwickelt. Der Rest ist eine Frage der<br />
Multiplikation.<br />
Wie im Falle der Grameen Bank?<br />
In diesem Zusammenhang sind Mikrokredite ein gutes<br />
Beispiel. Mikrokredite sind in einem Dorf entstanden.<br />
Sobald es dort funktionierte, war der Samen entwickelt<br />
— und nachdem wir mit der Replikation begonnen<br />
haben, kann nun jeder dieses Geschäftsmodell<br />
replizieren. Inzwischen sind Mikrokredite ein globales<br />
Phänomen. Eines Tages wird sich wahrscheinlich auch<br />
die Grameen Danone Food Ltd. zu einem globalen Phänomen<br />
entwickeln, weil wir alle wissen, was zu tun ist.<br />
Die Idee wird zur Standardlösung, mit der wir Mangelernährung<br />
beheben können. Das ist der Clou: Im Social<br />
Business gibt es keine Patente.<br />
Mit Patent meinen Sie das Schutzrecht auf eine Erfindung?<br />
Ja, doch im Social Business machen wir unsere Erfahrungen<br />
öffentlich. Wir veröffentlichen unser Wissen, damit sich<br />
jeder einbringen und helfen kann. Die Entwicklung von<br />
„Samen“ ist das Allerwichtigste. Sobald wir einen „Samen“<br />
entwickelt haben, kann die Idee weitere Früchte tragen.<br />
10 11
Interview Interview<br />
Was für Wachstumsbeschwerden zeigen sich im Fall<br />
der Grameen Danone Food Ltd.?<br />
Von Beschwerden kann keine Rede sein. Wir haben<br />
Spaß dabei, weil wir etwas Neuartiges ausprobieren.<br />
Eine kleine Fabrik, ein kleines Vorhaben. Die Investition<br />
war nicht größer als eine halbe Millionen Dollar. Eine<br />
wirklich kleine Summe, die wir riskieren, um eine Lösung<br />
für das Problem Mangelernährung zu finden.<br />
Wie hat sich die Wirtschafts- und Finanzkrise bislang<br />
auf Ihre Social Business-Aktivitäten ausgewirkt?<br />
Bislang sind die Auswirkungen positiv, weil sich bei den<br />
Menschen ein Gefühl einstellt, dass gewinnorientierte<br />
Unternehmen allein nicht die Lösung für unsere globalen<br />
Herausforderungen sind. Das Vertrauen, das die<br />
Menschen in die Marktmechanismen hatten — in den<br />
freien Markt mit der Maximierung von Gewinnen hat<br />
Schaden genommen. Es hat nicht funktioniert. Wenn<br />
wir in dieser Situation, in der viele Menschen voller<br />
Zweifel und frustriert sind, von Social Business sprechen,<br />
macht dieser Ansatz für viele plötzlich Sinn. „Ja,<br />
warum nicht? Warum müssen wir immer dem Geld<br />
hinterher rennen? Warum probieren wir nicht einfach,<br />
ein neues Gleichgewicht zu finden? Wir können uns im<br />
profitorientierten Bereich der Wirtschaft anstrengen<br />
— und unsere Talente und Kreativität gleichzeitig im<br />
Social Business nutzen, um die Probleme dieser Welt<br />
zu lösen“.<br />
Die Krise als Chance?<br />
Die Finanzkrise hat ein sehr günstiges Umfeld geschaffen,<br />
in dem die Menschen bereit sind zuzuhören. Solange<br />
die Wirtschaft boomt, weiteres Wachstum gesichert<br />
ist und keine Risiken bestehen, sagen die Leute:<br />
„Komm schon, es läuft doch. Funke uns nicht dazwischen.<br />
Lass es laufen“. Doch heute befinden wir uns in<br />
einem anderen Kontext.<br />
Was passiert vor Ort? Wenn der Milchpreis steigt,<br />
können Sie den Joghurtpreis nicht einfach erhöhen —<br />
das könnten sich Ihre armen Kunden nicht leisten. Das<br />
wäre das Ende der Wachstumsstory.<br />
Entweder steigt der Milchpreis oder — wenn der Ölpreis<br />
anzieht, steigt der Strompreis. Die Temperatur<br />
fällt, die Leute essen keinen Joghurt mehr… Das sind<br />
reale Situationen, die nicht alles in Frage stellen, uns<br />
aber zwingen, unsere Kreativität einzusetzen. Als der<br />
Milchpreis gestiegen ist, haben wir uns gefragt, wie wir<br />
den Milchanteil reduzieren können. Wie wäre es zum<br />
Beispiel mit einem Joghurtdrink, der mehr Wasser enthält?<br />
Dabei noch schmeckt, gesund ist und den Preis<br />
niedrig hält. Es gibt viele Möglichkeiten, die Armen mit<br />
gesunder Nahrung zu versorgen. Vielleicht ändert sich<br />
das Vehikel, aber die Mission bleibt dieselbe. Wir sind<br />
keine Joghurtverkäufer – wir versuchen nur ein Vehikel<br />
für Nahrung zu finden. In einer Form, die Kinder lieben.<br />
Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, müssen<br />
wir eben andere Mechanismen finden.<br />
Könnte es sein, dass es Ihren Partnerunternehmen<br />
gar nicht um Social Business geht, sondern darum, einen<br />
Wachstumsmarkt zu erschließen?<br />
Vielleicht ist das ihre Strategie. Meine Strategie ist es,<br />
diese Unternehmen für Social Business zu gewinnen.<br />
Manche Leute sagen: „Hey, Danone benutzt Dich!“ Und<br />
ich antworte: „Ich dachte, ich benutze Danone“. Wahrscheinlich<br />
benutzen wir uns gegenseitig. In jedem Fall<br />
wird dieser Prozess Danone verändern. Social Business<br />
verändert jeden. Angenommen, Danone hatte ein<br />
Geschäft im Sinn, die Intention, einen neuen Markt zu<br />
erschließen und langfristig vielleicht sogar finanzielle<br />
Rendite zu erwirtschaften. In der Zwischenzeit hat sich<br />
die Sichtweise vermutlich verändert: „Vielleicht ist Social<br />
Business eine gute Idee, weil es die Denkweise so<br />
vieler Menschen in unserem Unternehmen verändert<br />
hat“. Die anfängliche und spätere Sichtweise sind nicht<br />
unbedingt identisch.<br />
Sie planen weitere Gemeinschaftsunternehmen. Was<br />
sind die größten Hindernisse dabei?<br />
Letztlich geht es darum, die Menschen mit dem Konzept<br />
vertraut zu machen. Jetzt, nachdem BASF den<br />
ersten Schritt in Deutschland gemacht hat, werden<br />
andere deutsche Unternehmen sagen: „Sind die verrückt?<br />
Warum macht BASF Geschäfte in Bangladesch<br />
und nennt es Social Business? Andere Unternehmen<br />
bekommen Interesse und werden Gefallen an dieser<br />
Idee finden, weil sie günstig ist: Warum machen wir so<br />
etwas nicht? Für einen Dollar investiertes Kapital bekommen<br />
wir eine Publicity im Wert von einer Millionen<br />
Dollar. Lasst uns diese Publicity nutzen!“<br />
Das allein ist aber noch keine soziale Mission.<br />
Nein, aber wir sollten die Unternehmen aus der Geschäftsecke<br />
kommen lassen. In der Zwischenzeit werden<br />
viele neue Dinge geschehen. Die Denkweise der jun-<br />
gen Leute in den Schulen wird sich verändern: „Wenn<br />
ich groß bin, werde ich ein Social Business betreiben.<br />
Ich weiß schon, was für ein Social Business ich machen<br />
möchte!“ Wir sollten Schritt für Schritt weitermachen.<br />
Soll auch das Danone-Modell ausgeweitet werden?<br />
Natürlich. Geplant sind insgesamt 50 Werke, so dass<br />
wir das ganze Land abdecken können. Davon sind wir<br />
nicht abgerückt – und in der Zwischenzeit sind sogar<br />
neue Initiativen zur Sprache gekommen. Wir schaffen<br />
einen Social Business Fonds, um überall auf der Welt<br />
weitere Social Business Aktivitäten zu finanzieren.<br />
In gewinnorientierten Unternehmen lassen sich die<br />
Ergebnisse relativ einfach an Zahlen messen. Woran<br />
aber machen Sie den Erfolg Ihrer Social Businesses<br />
fest?<br />
Wer die sozialen Ergebnisse nicht misst, betreibt kein<br />
Social Business. Wer Geld verdienen will, meldet: Dies<br />
ist der Nettogewinn. Der Bruttoverdienst beträgt so<br />
und so viel, der Gewinn vor Steuern ist… Dann weiß<br />
jeder, ob das Unternehmen erfolgreich ist oder nicht.<br />
Aber wie beurteilen wir den Geschaftsführer in einem<br />
Social Business? Grameen Danone hat das Ziel, Mangelernährung<br />
zu beseitigen. Inwieweit erreichen wir das<br />
Ziel? Wir müssen die Kinder testen, um nachzuweisen,<br />
dass sich ihre Gesundheit tatsächlich verbessert. Allerdings<br />
müssen wir dafür eine Faustregel entwickeln.<br />
Eine aufwendige Untersuchung, die jedes Detail analysiert,<br />
können wir uns nicht leisten. Schließlich können<br />
wir nicht mehr Geld für die Evaluierung der Effekte ausgeben<br />
als für das Unternehmen insgesamt.<br />
Die ersten Social Business – Praxisbeispiele versuchen<br />
Mangelernährung zu beheben oder die Armen in<br />
Entwicklungsländern mit sauberem Trinkwasser oder<br />
Informationstechnologie zu versorgen. Welche Möglichkeiten<br />
sehen Sie darüber hinaus?<br />
Armutsbekämpfung ist nur ein Bereich von Social Business.<br />
Letztlich adressiert Social Business all jene Herausforderungen,<br />
die gewinnorientierte Unternehmen<br />
nicht bewältigen können. Ein Social Business, von dem<br />
die Umwelt profitiert, kommt letztlich allen Menschen<br />
zu Gute. Ob Reiche, Arme oder Mittelschicht – Social<br />
Business ist für jeden da. Ob Gesundheit, Ernährung,<br />
Wasser, Hygiene – Social Business sollte sich idealer<br />
Weise allen gesellschaftlichen Herausforderungen annehmen,<br />
die bislang unbewältigt geblieben sind.<br />
Was ist mit dem Schutz von Menschenrechten?<br />
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber irgendein<br />
schlauer Kopf wird herausfinden, wie sich der Schutz<br />
von Menschenrechten in ein Social Business übertragen<br />
lässt. Nicht, dass damit alle Probleme gelöst wären,<br />
aber so, dass es hilft. Jemand könnte ein Versicherungsunternehmen<br />
für Menschenrechte gründen:<br />
Wer eine kleine Gebühr bezahlt, wird beschützt. So wie<br />
wir uns gegen Krankheiten absichern, könnten wir versuchen,<br />
uns auch gegen Menschenrechtsverletzungen<br />
zu versichern.<br />
Wie reagieren die Menschen in Bangladesch auf Ihre<br />
Aktivitäten?<br />
In Bangladesch schenkt uns kaum jemand wirklich Beachtung.<br />
Warum nicht?<br />
Das ist keine Überraschung, denn im Grunde denken<br />
die Leute, dass das Wissen bislang meist aus dem<br />
Westen gekommen ist. Die Leute achten nicht auf jemanden,<br />
der nebenan verrückte Dinge tut.<br />
12 13
Aufsatz Aufsatz<br />
Moskito<strong>net</strong>ze zum Fischen?<br />
Social Business geht anders<br />
Kerstin Humberg<br />
Noch steht der Begriff „Social Business“ in keinem Wirtschaftslexikon<br />
— und Gnade dem, der dieses amorphe<br />
Etwas definieren soll. Wer bestimmt eigentlich, was in<br />
der Wirtschaft sozial ist? „Sozial ist, was Arbeit schafft“,<br />
propagiert Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Friedensnobelpreisträger<br />
Muhammad Yunus pocht auf die<br />
Gemeinnützigkeit und sagt: „Social Business? It‘s not for<br />
me. It‘s for others!“ Und was sagt der Papst? Der Papst<br />
glaubt (laut Enzyklika „Caritas in Veritate“), dass die<br />
Wirtschaft zutiefst menschlich sei und daher nach „moralischen<br />
Gesichtspunkten“ organisiert werden müsse.<br />
Klingt einleuchtend, aber wer garantiert uns die Moral?<br />
Auch wenn „Social Business“ in Deutschland oft mit<br />
Yunus‘ Vision vom sozial motivierten Unternehmen (das<br />
profitabel wirtschaftet, aber keine Dividenden ausschüttet)<br />
in Verbindung gebracht wird, ist der Begriff kei-<br />
neswegs geschützt, sondern interpretationsbedürftig.<br />
Was ich persönlich als sozial empfinde, müssen Menschen<br />
in einem Land wie Bangladesch, wo ich gerade zu<br />
diesem Thema forsche, noch längst nicht sozial finden.<br />
Was als sozial gilt, ist normen- und kontextabhängig.<br />
Genaugenommen ist auch der Wirtschaftsprofessor<br />
Yunus flexibel in seiner Definition von Social Business.<br />
Während er auf der einen Seite Dividendenverzicht<br />
fordert, erlaubt er mit Blick auf seine „Grameen Bank“<br />
eine grundsätzliche Ausnahme: Wenn sich Unternehmen<br />
im Besitz von Armen befinden, sind Profitorientierung<br />
und Dividenden seiner Ansicht nach in Ordnung.<br />
Auch sein neuestes Social Business-Engagement sorgt<br />
in der Wissenschaft für begriffliche Konfusion: Gemeinsam<br />
mit der Hamburger Versandhandelsgruppe OTTO<br />
will Yunus ein Textilunternehmen in Bangladesch er-<br />
richten. Die „Zukunftsfabrik“ soll die Textilien ebenso<br />
nachhaltig wie ethisch korrekt produzieren und Löhne<br />
entsprechend dem lokalen Mindestlohnniveau von<br />
19 bis 65 Euro im Monat zahlen. „Die Grameen Otto<br />
Textile Company wird zeigen, dass es durchaus möglich<br />
ist, ökologische und soziale Kriterien mit ökonomischen<br />
Zielen in Einklang zu bringen“, so Michael Otto.<br />
Anders als die bisherigen Social Business Joint Ventures,<br />
die Yunus mit Unternehmen wie Danone, Veolia,<br />
Intel oder BASF zur Versorgung der lokalen Bevölkerung<br />
mit Nährstoffen, Trinkwasser oder technischen<br />
Diensten gegründet hat, wird die Grameen Otto Textile<br />
Company keine Produkte oder Dienstleistungen für die<br />
Armen anbieten. Stattdessen soll die Schaffung von bis<br />
zu 700 Arbeitsplätzen zur Armutsbekämpfung beitragen.<br />
Hört, hört — das klingt nach Kanzlerin. Zwar soll<br />
die neue Otto-Tochter Yunus‘ Kriterien (soziales Ziel,<br />
profitables Geschäftsmodell, keine Dividenden für Otto<br />
und die Grameen Bank) erfüllen, doch lässt dieser neue<br />
„Grameen Social Business“-Typus die Grenzen zum<br />
klassischen Fair Trade-Modell verschwimmen.<br />
FAIR TRADE 2.0?<br />
Für die Praxis ist diese Frage zweitrangig. Was zählt,<br />
ist das Ergebnis. Gutes tun und damit neue Märkte<br />
erschließen? Warum nicht. In der marktbasierten Armutsbekämpfung<br />
liegt die Zukunft — und klar kann die<br />
Entwicklungszusammenarbeit vom Kapital, dem wirtschaftlichen<br />
Sachverstand und der technischen Expertise<br />
multinationaler Unternehmen profitieren. Allerdings<br />
sind Billigvarianten westlicher Produkte (wie der<br />
geplante 1-Euro Schuh von Adidas) allein noch keine Lösung.<br />
Wer extreme Armut bekämpfen will, muss auch<br />
die Produktivkräfte der Armen freisetzen. Zum Beispiel<br />
durch die Einführung technischer Innovationen, wie es<br />
Grameen Phone mit einem pfiffigen Geschäftsmodell,<br />
den Village Phone Ladies und der Einführung von Mobiltelefonen<br />
im ländlichen Bangladesch gelungen ist.<br />
Wer konsumieren soll, braucht Geld, ein einigermaßen<br />
gesichertes Einkommen. Nicht ohne Grund nutzen<br />
Menschen, die hungern, subventionierte Moskito<strong>net</strong>ze<br />
lieber zum Fischfang.<br />
WIRTSCHAFT FÜR DEN MENSCHEN<br />
Und was ist die Moral von der Geschicht‘? Yunus‘ „Social<br />
Business“-Ansatz ist vor allem ein Plädoyer für die effiziente<br />
und effektive Nutzung philanthropischer Ressourcen.<br />
Ein Beitrag zur (auch wirtschaftlich nachhaltigen)<br />
Lösung gesellschaftlicher Probleme durch unternehmerisches<br />
Denken und Handeln. Sei es durch multinationale<br />
Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen.<br />
Letztlich geht es um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle,<br />
die einen Mehrwert für diejenigen schaffen,<br />
die bislang von den Märkten ausgeschlossen sind.<br />
Auch wenn sich an der Frage der Dividenden die Geister<br />
in der Social Business-Szene scheiden, geht diese<br />
Debatte aus Praxissicht am Ziel vorbei. Schließlich<br />
sind Unternehmen, die auf Dividenden verzichten,<br />
nicht automatisch sozialer als profitorientierte Unternehmen.<br />
Gute Intentionen produzieren noch lange<br />
keine positiven Ergebnisse. Ob ein Business tatsächlich<br />
sozial ist, sollte deshalb auch weniger an der Mission<br />
oder Dividendenpolitik, sondern an den realen<br />
Effekten gemessen werden. Wie viele Leben hat ein<br />
Business nachhaltig verbessert oder (noch besser)<br />
gerettet?<br />
Man verdirbt einen Jüngling am sichersten, wenn man ihn verleitet, den<br />
Gleichdenkenden höher zu achten, als den Andersdenkenden.<br />
Friedrich Nietzsche<br />
14 15
Cusana Columna<br />
„¡Ay, qué calor!“<br />
Von English tea, Vin Rouge und Abendbrot<br />
Maria Magdalena Schäfer<br />
Ein Sprung über den Ärmelkanal und wir befinden uns<br />
in… richtig, in England! Nicht nur die Uhren ticken dort<br />
anders, sondern auch die Essgewohnheiten unterscheiden<br />
sich doch hier und da deutlich von dem, was<br />
man vielleicht von zu Hause so gewohnt ist. Die Liebhaber<br />
des „Deutschen Brots“ werden wohl erstmal in<br />
den sauren Apfel beißen müssen… hier gibt’s ab jetzt<br />
jeden morgen Toast. Für diejenigen, die gerne Tee trinken<br />
ist es jedoch hingegen wohl wie im Schlaraffenland:<br />
Bei jeder <strong>net</strong>ten Gelegenheit — sei es, bevor man aus<br />
dem Haus geht, von der Arbeit kommt oder kurzfristig<br />
die Nachbarin zu Besuch kommt — lautet die Standardfrage:<br />
„Would you like a cup of tea?“ „Oh yes, please!“<br />
„With one or two sugar?!“ Und das natürlich in der Intonation<br />
der englischen Sprache — herrlich!<br />
WIE EIN AUSSERIRDISCHER<br />
Zurück durch den Eurotunnel — in der Hoffnung, dass<br />
der Eurostar nicht mal wieder stecken bleibt — landen<br />
wir bei unseren lieben Nachbarn des Savoir-vivre. Hier<br />
ist es absolut ratsam, Stenographie perfekt zu beherrschen,<br />
besonders für den Uni-Alltag. Denn das, was der<br />
Professor sagt, wird nun mal mitgeschrieben oder besser<br />
gesagt, wortwörtlich aufgezeich<strong>net</strong>. Mitdenken oder<br />
sogar kritisch hinterfragen, geschweige denn eine Diskussion<br />
mit dem Professor und den Kommilitonen anzufangen,<br />
sollte man sich gut überlegen. Es könnte sein,<br />
dass man sich wie ein Außerirdischer vorkommt, der das<br />
französische System wohl noch nicht verstanden hat.<br />
Was wir noch probieren sollten, bevor es uns weiter<br />
nach Spanien zieht, ist ein frisches Baguette direkt von<br />
der Boulangerie um die Ecke. Dazu noch ein Stück Camembert<br />
und ein schöner Vin Rouge…<br />
LIEBER MORGEN ALS HEUTE<br />
In Spanien angekommen, sollten wir uns darauf einstellen,<br />
dass wir zu Verabredungen prinzipiell nicht<br />
pünktlich zu kommen brauchen. Eine viertel Stunde<br />
früher oder später, was macht das schon, Hauptsache<br />
man kommt nicht in Stress. Ein wichtiges Wort in<br />
diesem Zusammenhang ist „mañana“ (morgen). Egal,<br />
ob man sich immatrikulieren will, den Mietvertrag unterschreibt<br />
oder einen Handwerker rufen muss, so ist<br />
die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man ein gelassenes<br />
Gegenüber vor sich hat, das lieber morgen<br />
als noch heute vorbeikommt. Und falls nicht morgen,<br />
dann halt übermorgen usw. — auf jeden Fall „mañana“.<br />
Im Sommer hört man auf den Plätzen und in den Gassen<br />
überwiegend den Ausruf: „¡Ay, qué calor!“ (..was für<br />
eine Hitze!)<br />
Nachdem man wahrscheinlich überlegt, ob<br />
man die Siesta nicht vielleicht doch noch verlängern<br />
sollte…17 Uhr ist ja vielleicht wirklich etwas<br />
„früh“, um die Geschäfte wieder aufzumachen.<br />
Und um sämtlichen Ausrufen noch mehr Deutlichkeit<br />
zu verleihen, setzen die Spanier das Ausrufungszeichen<br />
auch besser gleich schon am Anfang.<br />
Zurück in Deutschland freuen wir uns auf ein leckeres<br />
Abendbrot, zu dem wir noch einige Freunde eingeladen<br />
haben, die wie verabredet um Punkt 20 Uhr auf der<br />
Matte stehen.<br />
Als deutscher Tourist im Ausland<br />
steht man vor der Frage,<br />
ob man sich anständig benehmen<br />
muss, oder ob schon deutsche<br />
Touristen dagewesen sind.<br />
Kurt Tucholsky<br />
Künstlerische Arbeit<br />
Alex Gebarowski | Spanien<br />
16 17
Künstlerische Arbeit<br />
Philipp Schönecker | Peru<br />
Künstlerische Arbeit<br />
Christian Gogolin | Kambodscha<br />
18 19
Künstlerische Arbeit Künstlerische Arbeit<br />
Christian Gogolin | Vietnam<br />
Philipp Schönecker | Bolivien<br />
20 21
Künstlerische Arbeit Nachgedacht<br />
Hannah Hufnagel | Schweden<br />
Dazwischen zu Hause<br />
Das Motto „Andere Länder, Andere Sitten“ ist eine mir ziemlich geläufige Aussage.<br />
In meiner Familie treffen drei „Länder“ aufeinander. Ich bin in Deutschland geboren<br />
und mit drei Sprachen aufgewachsen, da mein Vater Kroate ist und meine Mutter<br />
aus Polen kommt. Obwohl die kulturellen Unterschiede zwischen Polen, Kroatien und<br />
Deutschland nicht so groß sind wie z.B. zwischen Deutschland und einem afrikanischen<br />
oder asiatischen Land, kann man doch von „anderen Sitten“ reden. Ich bin mit<br />
den Unterschieden und dem ständigen Vergleich, wie etwas in Deutschland und Kroatien<br />
bzw. Polen ist, aufgewachsen. Diese Gegebenheiten empfinde ich aber als große<br />
Bereicherung, da dadurch mein Blick und mein Verständnis für die noch so geringen<br />
Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen geschärft wurden.<br />
Obwohl dieses „Sich-dazwischen-befinden“ meistens von Vorteil ist, bringt es aber<br />
auch Schwierigkeiten mit sich. Oft werde ich gefragt, als was ich mich nun fühle, als<br />
Deutsche, Kroatin oder Polin. Meine Antwort darauf lautet, dass ich mich als eine<br />
„Mischung“ fühle. Für viele Freunde, Bekannte und auch die Familie ist das nicht<br />
nachvollziehbar. Man muss sich ja schließlich zu einer Nationalität zugehörig fühlen.<br />
Einige Bekannte, die ebenfalls im Einfluss mehrer Kulturen aufgewachsen sind,<br />
erzählen mir, dass sie manchmal das Gefühl der Zerrissenheit empfinden. Zugegeben,<br />
in manchen Augenblicken geht es mir genauso, besonders dann, wenn mir die häufige<br />
Frage gestellt wird, wo ich am liebsten leben würde: in Deutschland, Kroatien oder Polen.<br />
Aber wenn ich in einem Land bin, habe ich Sehnsucht nach den anderen und umgekehrt.<br />
Es ist wie eine nicht zu Ende gehende Reise, die mich ständig dazu antreibt,<br />
meine drei Heimatländer und deren Menschen immer wieder neu kennen zu lernen<br />
und mich gleichzeitig auch auf mir noch fremde Kulturen neugierig macht.<br />
Magdalena Rusan<br />
22 23
Kulturtipps Kulturtipps<br />
Fremd gelesen<br />
zusammengestellt von Slavka Rude-Porubska<br />
Gregor Thum: Die fremde Stadt. Breslau<br />
1945. Siedler Verlag, 2003.<br />
Breslau hat im Laufe seiner Geschichte<br />
viele Herrscher gesehen. Aber nur<br />
1945 folgte auf die Verschiebung der<br />
Staatsgrenzen ein vollständiger Bevölkerungsaustausch.<br />
Die Deutschen wurden<br />
aus Breslau vertrieben und durch<br />
Polen ersetzt, von denen viele ihrerseits<br />
Vertriebene aus dem an die Sowjetunion<br />
gefallenen Ostpolen waren. Für die<br />
meisten Ansiedler blieb Breslau lange<br />
eine fremde Stadt, die, so die verbreitete<br />
Furcht, früher oder später wieder<br />
an die Deutschen fallen würde. Noch<br />
bis in die fünfziger Jahre war die beim<br />
Kampf um die „Festung“ Breslau in den<br />
letzten Kriegsmonaten zerstörte Stadt<br />
eine Trümmerwüste. Doch im diplomatischen<br />
Ringen um die Oder-Neiße-<br />
Grenze war Breslau von so herausragender<br />
politischer Bedeutung, dass der<br />
polnische Staat und seine Gesellschaft<br />
in gemeinsamer Anstrengung darangingen,<br />
Breslau wieder aufzubauen und<br />
zu einer glänzenden Metropole zu machen.<br />
Der Autor schildert, wie sich der<br />
Bruch von 1945 aus der Perspektive<br />
Breslaus ausnahm, wie man aus einer<br />
deutschen eine polnische Stadt zu machen<br />
versuchte und wie sich dies im<br />
Stadtbild niedergeschlagen hat.<br />
Peter Stamm: In fremden Gärten. Erzählungen.<br />
Arche Verlag, 2003.<br />
Die Helden in Peter Stamms neuem Erzählband<br />
kommen aus den unterschiedlichsten<br />
Orten. Sie leben zu zweit, allein,<br />
haben eine Familie und Kinder - oder<br />
auch nicht. Manche sind jung, andere<br />
alt. Alle sind sie irgendwohin unterwegs,<br />
alle scheinen sie auf etwas zu warten.<br />
Auf einen Zug oder auf ein Schiff, auf<br />
eine Geste der Liebe oder einfach auf<br />
das Ende, wie die kranken Reisenden<br />
auf dem Weg nach Lourdes.<br />
Beqe Cufaj: Der Glanz der Fremde. .<br />
Zsolnay Verlag, 2005.<br />
Zwei Leben, eine Kindheit: Ricky und<br />
Arben wachsen in der mehrheitlich von<br />
Albanern bewohnten Provinz Kosovo<br />
auf. Die Lethargie des Lebens im Abseits<br />
spüren sie mehr, als daß sie davon<br />
wissen. Und auch wenn sie kaum<br />
etwas gemeinsam haben, verbindet<br />
sie ein Wunsch: eine bessere Zukunft.<br />
Auf unterschiedlichen Wegen gelangen<br />
schließlich beide nach Deutschland,<br />
wo sie einander treffen. Vom Glanz<br />
ist jedoch nur die Fremde übriggeblieben.<br />
Beqe Cufaj erzählt die Geschichte<br />
dieses seltsamen Paares, das auf tragikomische<br />
Weise versucht, die Träume<br />
nicht aus den Augen zu verlieren.<br />
Die Welt ist ein Buch.<br />
Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.<br />
Augustinus<br />
Daniel Cil Brecher: Fremd in Zion. Deutsche<br />
Verlags-Anstalt, 2005.<br />
Daniel Brecher, geboren 1951, wuchs<br />
als Sohn einer im Zweiten Weltkrieg<br />
verfolgten jüdischen Familie in Düsseldorf<br />
auf. Hin- und hergerissen zwischen<br />
dem Diasporaleben im Land der Täter<br />
und dem Ruf der Zionisten, entscheidet<br />
er sich für ein Leben in Israel. Die<br />
Realitäten des jungen Staates — das<br />
Beharren auf seinem ausschließlich<br />
jüdischen Charakter, die alltägliche<br />
Diskriminierung der arabischen Bevölkerung,<br />
der ständige Kriegszustand<br />
— desillusionieren ihn bald. Als Historiker<br />
in der Armee beginnt Brecher<br />
sich kritisch mit der Geschichte Israels<br />
auseinanderzusetzen. Deutlich spürt er<br />
den Konformitätsdruck, der die Gesellschaft<br />
prägt. Schließlich verlässt er das<br />
Land. Um seine Zukunft zu sichern, so<br />
Daniel Brechers Ausblick, muss Israel<br />
den Zionismus überwinden und sich<br />
grundlegend erneuern.<br />
Necla Kelek: Die fremde Braut. Kiepenheuer<br />
& Witsch, 2005.<br />
Zeynep ist 28 Jahre alt, Mutter von<br />
drei Kindern und lebt seit zwölf Jahren<br />
in Hamburg. Sie versorgt den Haushalt<br />
ihrer Großfamilie und spricht kein<br />
Wort Deutsch. Die Wohnung verlässt<br />
sie nur zum Koranunterricht. Sie ist<br />
eine ‚Import-Gelin‘, eine Importbraut,<br />
eine moderne Sklavin. Tausende junger<br />
türkischer Frauen werden jedes Jahr<br />
durch arrangierte Ehen nach Deutschland<br />
gebracht. Die demokratischen<br />
Grundrechte gelten für sie nicht, und<br />
niemand interessiert sich für ihr Schicksal.<br />
Die türkisch-muslimische Gemeinde<br />
redet von kulturellen Traditionen, beruft<br />
sich auf Glaubensfreiheit und grenzt<br />
sich von der deutschen Gesellschaft ab.<br />
Und findet dafür Verständnis bei den<br />
liberalen Deutschen, die eher bereit<br />
sind, ihre Verfassung zu ignorieren als<br />
sich den Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit<br />
machen zu lassen. Necla Kelek,<br />
Türkin mit deutschem Pass, deckt die<br />
Ursachen dieses Skandals auf.<br />
Sabine Ipsen-Peitzmeier, Markus Kaiser<br />
(Hg.): Zuhause fremd. transcript, 2006.<br />
Seit Beginn der 1990er Jahre, als der<br />
Zuzug von Spätaussiedlern aus der<br />
ehemaligen UdSSR seinen Höhepunkt<br />
erreichte, wächst in Deutschland das<br />
wissenschaftliche Interesse an den<br />
Russlanddeutschen, an ihrer Geschichte,<br />
ihrer Migration sowie ihrer Situation<br />
in der deutschen Gesellschaft. Auch die<br />
Beiträge dieses Bandes widmen sich<br />
diesen Themen. Was sie jedoch über<br />
ihren aktuellen Bezug hinaus auszeich<strong>net</strong>,<br />
ist die deutsch-russische Zusammensetzung<br />
der Autoren, die sich den<br />
Gegenstand aus ihrer jeweils eigenen<br />
Perspektive aneignen und dabei ein vielschichtiges<br />
Bild zeichnen.<br />
24 25
Pinnwand<br />
„Die spinnen, die Anderen...?”<br />
Manchmal bestätigen sich Klischees auch: in Tansania traf<br />
ich auf einen ganz anderen Umgang mit Zeit, der mich als<br />
getriebenen Europäer zu Geduld und Entspannung herausgefordert<br />
hat. So war für die Einheimischen die Verspätung<br />
einer Fähre auf dem Tanganjika-See von über 30 Stunden<br />
ganz selbstverständlich... Irgendwie kommt man schon an!<br />
Ich steige in den Fahrstuhl. Außer mir fährt noch eine weitere<br />
Person in den achten Stock. Die Person steigt aus - und sagt<br />
„Danke“. Vor meinem verwirrten Gesicht schließt sich die Fahrstuhltür.<br />
Warum Danke; noch dazu von einer mir fremden Person<br />
in einer mir nicht geläufigen Sprache? Danke, dass wir es bis hier<br />
her geschafft haben, der Fahrstuhl nicht stecken blieb, kein Feuer<br />
ausbrach?<br />
Alltägliches aus Polen (Sara Esther)<br />
Brasilianische Ästhetik:<br />
neonfarbige, im Dunkeln<br />
leuchtende Plastikrosenkränze.<br />
Bolivianische Erfrischungsgetränke:<br />
vergorener, von den<br />
Frauen des Dorfes vorgekauter<br />
Maisbreisaft (Chicha) –<br />
na dann Prost!<br />
(Philipp)<br />
„Treffen um 19h30?“ - „Ja, ok. Das ist gut,<br />
dann fahren wir alle zusammen los.“ Tja,<br />
schade. Um 20h15 ist immer noch keiner da.<br />
An französische Terminabsprachen muss man<br />
sich erstmal gewöhnen.<br />
Vive la France. (Almuth Sürmann)<br />
Essengehen in den USA: Die Gabel noch im Mund<br />
wird man gefragt, ob man die Reste mitnehmen<br />
möchte. Oder es kann einem passieren, dass man<br />
schon beim Servieren zum baldigen Zahlen aufgefordert<br />
wird. Ein unhöflicher Rausschmiss? Keineswegs,<br />
denn je häufiger man in den USA essen geht,<br />
desto mehr weiß man diesen schnellen Service zu<br />
schätzen. Time is money.<br />
(Judith Suttrup)<br />
Einem Nordrhein-Westfalen sagt man:<br />
„Ich komme aus Bayern.“ Einem Italiener<br />
stellt man sich als Deutscher vor.<br />
Einem<br />
Asiaten gegenüber fühlt man sich dann<br />
als Europäer. Heißt das: Je weiter man<br />
weg ist, desto größer wird die Heimat?<br />
(Cathrin Bengesser)<br />
jeder mensch ist anders<br />
sagt man so und lacht<br />
über den geschmack des<br />
anderen<br />
einzig artig ist der mensch<br />
hab ich gelernt<br />
mit unveräußerlichen rechten<br />
ein anderer mensch<br />
fragt mich am bahnhof nach kleingeld<br />
andererseits.<br />
Aus meinem kanadischem Tagebuch: In<br />
einem Club taucht aus dem Nichts ein<br />
Typ hinter mir auf und schreit: „Bück dich!“<br />
Andere Länder- andere Tanzsitten.<br />
Treibgut<br />
Sie treiben durchs Dasein,<br />
im Alltag verloren,<br />
entfremdet sich Selbst.<br />
Dem Leben gestohlen,<br />
dem Willen entwunden,<br />
dem Schicksal geschenkt.<br />
Die Leere der Blicke,<br />
im Albtraum gefroren,<br />
die Maske des Nichts.<br />
Laura Pennington<br />
Künstlerische Arbeit<br />
26 27
Aufsatz Aufsatz<br />
Ein Bett voller Flöhe<br />
Lebendige Ökumene im Ostseeraum<br />
Hannah Hufnagel<br />
Neun Länder grenzen an die Ostsee, drei christliche Konfessionen prägen die Kultur und ein Eiserner Vorhang<br />
trennte Ost von West. Und dennoch haben die Menschen im Ostseeraum mehr gemeinsam, als sie trennt. Das<br />
baltic intercultural and ecumenical <strong>net</strong>work (bien) regt zum Austausch zwischen jungen Christen an und überspringt<br />
die Grenzen von Sprache, Konfession und Kultur.<br />
Orthodoxe Gesänge wehen durch die warme Sommerluft. Es<br />
wird langsam dunkel. Die ersten Sterne leuchten blass am<br />
graublauen Julihimmel. Vor wenigen Minuten ist die Sonne<br />
im Meer versunken. Die alte Klosterruine St. Klemens wird<br />
heute Abend von zweihundert Kerzen erhellt. Große Schatten<br />
tanzen unruhig an den groben Kalksteinmauern. Von außen<br />
mag es ein gespenstischer Anblick sein. Innerhalb der<br />
Mauern fühlen wir uns sicher und geborgen. Die orthodoxen<br />
Melodien können bald alle mitsingen und wer noch unsicher<br />
ist, hält sich an seinem Liederheft fest.<br />
Mächtige Steinbögen umspannen die Grundmauern der Ruine<br />
und geben den Blick auf den Himmel frei. Wir sehen sonst<br />
nichts von der Außenwelt und haben nur einander. Beinahe<br />
zweihundert junge Menschen in leichten, bunten Sommerkleidern<br />
stehen gen Osten gewandt. Jeder von uns hält eine<br />
Kerze in den Händen. Wir beschließen den Tag mit einem<br />
orthodoxen Abendgebet. Das mittelalterliche Kloster ist eine<br />
besonders eindrucksvolle Kulisse. Als zum Ende des Gebets<br />
der Mond hinter den Rosenranken aufgeht, da ahnen wir,<br />
dass wir diesen Abend so schnell nicht vergessen werden.<br />
Es war der 31. Juli 20<strong>02</strong>, der dritte Tag des bienfestivals in<br />
Visby auf der Insel Gotland. Mitten in der Ostsee treffen sich<br />
196 junge Menschen aus den umliegenden Ländern, um die<br />
Gemeinsamkeiten unseres christlichen Glaubens kennen zu<br />
lernen. Wir haben viel gemeinsam, das spüren wir bald. Es<br />
spielt eigentlich gar keine so große Rolle, welche Sprache<br />
wir sprechen oder welcher Konfession wir angehören. Die<br />
Fragen an unseren Glauben und die Erwartungen an unsere<br />
Zukunft sind die gleichen. Und trotzdem ist da die Geschichte,<br />
die uns trennt. Wir finden, dass es an der Zeit ist, diese<br />
Grenzen gemeinsam zu überwinden.<br />
Bien, das baltic intercultural and ecumenical <strong>net</strong>work, ist<br />
eine junge Initiative. Sie entstand im Jahr 2000 auf Initiative<br />
evangelisch-lutherischer Jugendpastoren. Zehn Jahre<br />
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs schien der Ostseeraum<br />
noch immer zweigeteilt in Ost und West. Die jungen<br />
Menschen diesseits der imaginären Grenze wussten nicht<br />
viel von dem Leben jenseits und drüben kannte man niemanden<br />
von hier. Der christliche Glaube war eine Basis, auf<br />
der sich aufbauen ließ, und so trafen sich im Sommer 2001<br />
die ersten 80 Neugierigen in Riga. Schnell waren Pläne geschmiedet<br />
und ein Kontakt<strong>net</strong>z geknüpft. Die Initiative wuchs<br />
zu einem richtigen Netzwerk, mit dem Ziel, den Austausch<br />
zwischen jungen Christen im Ostseeraum anzuregen.<br />
Bien geht dabei bewusst über Ländergrenzen hinweg, überwindet<br />
Sprachbarrieren und öff<strong>net</strong> Türen in den Mauern der<br />
Konfessionen.<br />
DAS VATER UNSER GLEICHZEITIG IN NEUN<br />
VERSCHIEDENEN SPRACHEN ZU BETEN, VERBINDET<br />
Gelebte Ökumene ist in Deutschland zur Selbstverständlichkeit<br />
geworden, dabei sind wir mit etwa gleich vielen<br />
Katholiken und Protestanten eine Ausnahme. Deutsche<br />
bien-Teilnehmer sind oft überrascht, wenn sie im Gespräch<br />
feststellen, dass in den anderen Ostseeanrainerstaaten die<br />
Ökumene längst nicht so lebendig ist. Das kann wie etwa<br />
in Skandinavien auch daran liegen, dass es dort kaum Katholiken<br />
gibt und nicht jede lutherische Gemeinde eine katholische<br />
Partnergemeinde haben kann. Manchmal können<br />
sich katholische Gemeinden vor Anfragen kaum retten.<br />
Manchmal steht der Ökumene aber auch die nationale Kirchenleitung<br />
im Weg. Doch die Stärke unseres Netzwerkes<br />
ist unsere Unabhängigkeit. Bien ist ein loses Bündnis und keine<br />
feste Institution mit etablierten Strukturen. Streitereien<br />
um die Frauenordination in der lutherischen Kirche mögen<br />
zwar zu Verstimmungen zwischen der Schwedischen und<br />
der Lettischen Kirchenspitze führen, aber das beeinträchtigt<br />
unsere Arbeit an der Basis nicht. Wir machen trotzdem<br />
weiter. Oder gerade deshalb.<br />
Allerdings ist bien auch immer nur so aktiv, wie seine Mitglieder,<br />
also die jungen Menschen und ihre Heimatgemeinden.<br />
Das zentrale bien-Büro wechselt nämlich jährlich Ort<br />
und Mitarbeiterstab und wird von einer lokalen Kirchengemeinde<br />
geführt. Jede Gemeinde hat ihre Kapazitäten und<br />
jedes Team seine Ideen, doch es gibt so etwas wie einen<br />
Konsens und den unverwechselbaren bien spirit, der unser<br />
Netzwerk zusammenhält. Und so haben wir bisher in jedem<br />
Jahr gemeinsam ein internationales Festival feiern können,<br />
eine Mischung aus Happening und Besinnung.<br />
Visby 20<strong>02</strong> war das zweite bienfestival und das erste, an<br />
dem ich teilnahm. Getreu dem Festivalmotto „On the move“<br />
(Lukas 24) haben sich die knapp 200 jungen Christen auf<br />
den Weg gemacht, um fünf Tage lang gemeinsam zu singen<br />
und zu beten, zu diskutieren und zu feiern. Ich erinnere<br />
mich noch sehr genau an meine ersten Erfahrungen in der<br />
internationalen Ökumene, zum Beispiel an die Neugier einer<br />
Protestantin, was junge Katholiken eigentlich vom Papst hal-<br />
ten, oder die Überraschung eines Katholiken, dass die orthodoxen<br />
Frauen während des Gebets ihren Kopf bedecken. Die<br />
zufälligen Gespräche bei den Mahlzeiten und die intensiven<br />
Diskussionen in den einzelnen Workshops sind bereichernd<br />
und anregend. Einen stärkeren Eindruck hinterlassen jedoch<br />
jedes Jahr die Gebete und Gottesdienste einerseits und die<br />
gemeinsamen Aktivitäten und Ausflüge andererseits. Es<br />
ist sehr beeindruckend, die verschiedenen Konfessionen in<br />
einem Morgen- und einem Abendgebet zu erleben, das die<br />
Teilnehmer nach ihrer Tradition selbst gestaltet haben. Nur<br />
einmal, nämlich für den Gottesdienst, teilen wir uns nach<br />
Konfessionen auf und feiern Eucharistie und Abendmahl<br />
getrennt. Aber auch das ist eine Bereicherung, denn jede<br />
Nation bringt sich auf ihre Weise in den Gottesdienst ein. Es<br />
versteht sich von selbst, dass wir Lieder in allen neun Sprachen<br />
des Ostseeraums singen, doch wenn wir dann das<br />
Vater Unser sprechen und jeder in seiner Muttersprache<br />
betet, ist das für mich heute wie vor sieben Jahren in Visby<br />
ein besonders verbindender Moment.<br />
MIT DER EVANGELISCHEN LITURGIE VERTRAUT,<br />
IN DER KATHOLISCHEN MESSE ZU HAUSE<br />
Jedes Festival hat seine besondere Note, die das Vorbereitungsteam<br />
nicht nur durch das Motto, sondern auch durch<br />
Workshops und Visits festlegt. Während der fünf Tage wird<br />
nämlich auch der Austragungsort zum Thema. Unterschiedliche<br />
Ausflüge führen uns auf den Spuren einer Sozialpädagogin<br />
in das besetzte Kopenhagener Stadtviertel Christiania<br />
oder unter der Leitung eines pensionierten Pastors in eine<br />
russisch-lutherischen Kirche, die in der kommunistischen<br />
Ära als Schwimmhalle genutzt wurde. Wir gehen in der St.<br />
Petersburger Station von Radio Maria auf Sendung, besuchen<br />
die Hamburger Seemannsmission und tanken in einem<br />
Exerzitienhaus des Bistums Uppsala Kraft. Der Blick hinter<br />
28 29
Aufsatz Aufsatz<br />
die makellose, touristische Großstadtfassade ist Programm.<br />
Wir wollen verstehen, wie es sich so lebt in Kopenhagen oder<br />
Hamburg und mit welchen Herausforderungen die Christen<br />
in Uppsala oder St. Petersburg zu kämpfen haben.<br />
FÜNF TAGE LEBEN WIE EIN RUSSISCHES WAISENKIND<br />
Das Festival in Visby war in mancher Hinsicht das beste<br />
bienfestival. Die mittelalterliche Hansestadt mit den beeindruckenden<br />
Kirchenruinen, den romantischen Sonnenuntergängen<br />
am Strand, dem pulsierenden Leben und den vielen<br />
verträumten Rosengässchen bot eine malerische Kulisse.<br />
Sicher sind meine Eindrücke auch deshalb so bunt und vielfältig,<br />
weil es mein erster Kontakt mit diesem besonderen<br />
Netzwerk war — und weil ich in Visby meinen Mann kennen<br />
gelernt habe. Die Hafenstadt war für ein bienfestival einfach<br />
perfekt: Was liegt näher, als sich mit einem Ostsee<strong>net</strong>zwerk<br />
auch tatsächlich mitten im Meer zu treffen? Auf den Spuren<br />
der Hanse kamen wir fast alle mit dem Schiff zu der geschichtsträchtigen<br />
Ostseeinsel. Wenn auch nicht alle ganz<br />
so stilecht wie die Nordelbische Jugend, die auf zwei Galeassen<br />
gen Visby segelte und während des Festivals im Hafen<br />
ankerte. Der Gedanke des verbindenden Meeres und des<br />
Schiffs als altem christlichen Symbol setzte sich im letzten<br />
Jahr fort: Eine internationale Besatzung segelte zum bienfestival<br />
nach Turku an der finnischen Küste. In diesem Jahr<br />
geht die Reise nach Klaipeda in Litauen. Ich wurde sofort<br />
vom bien spirit angesteckt. Die Schwedische Kirche faszinierte<br />
mich in Visby ganz besonders. Deshalb entschied<br />
ich mich nach dem Abitur für ein Freiwilliges Soziales Jahr<br />
in Schweden. Als Katholikin ging ich bewusst in den protestantischen<br />
Norden und in eine evangelische Gemeinde.<br />
In Uppsala führte ich das bien-Büro und koordinierte das<br />
Festival 2005. Ein ganzes Jahr lebte ich in einer evangelischen<br />
Gemeinde und lernte die ureigenen Traditionen<br />
der schwedisch-lutherischen Kirche kennen<br />
und schätzen. Manchmal kam mir die Liturgie<br />
sehr vertraut und katholisch vor und dennoch<br />
gab es Momente, in denen ich mich nur in<br />
der Katholischen Messe zu Hause fühlte<br />
— eine Erfahrung, die ich ohne bien nie<br />
gemacht hätte.<br />
Doch so sehr Visby 20<strong>02</strong> meinen<br />
persönlichen Geschmack<br />
getroffen hat und so sehr ich<br />
meine eigenen Ideen in Uppsala<br />
2005 einbringen konnte — ein<br />
in jeder Hinsicht besonderes<br />
Festival fand 2004 in St. Petersburg statt. Seit dem 1. Mai<br />
desselben Jahres wurde die Europäische Union um die Ostseeanrainer<br />
Polen, Estland, Lettland und Litauen erweitert.<br />
Russland ist somit das einzige Land in der Ostseeregion, das<br />
nicht zur EU gehört, und Kaliningrad eine Enklave inmitten<br />
des europäischen Staatenbündnisses. Die Sonderstellung<br />
des Landes spürten wir schon bei der Einreise: Endlose<br />
Passkontrollen und Gepäckdurchsuchungen empfingen uns<br />
an der finnisch-russischen Grenze. Unsere internationale<br />
Reisegruppe erregte Aufsehen. Unsere Aufmerksamkeit<br />
wurde schnell von dem schockierenden Gegensatz zwischen<br />
Arm und Reich gefesselt. Die Bilder von schäbigen<br />
Holzbaracken, die windschief an der überwachungskamerabewehrten<br />
Mauer einer Luxusvilla lehnten sind uns noch<br />
immer im Gedächtnis. Täglich wechselten wir in St. Petersburg<br />
von imponierenden Prachtboulevards zu erschreckend<br />
verkommenen Hinterhöfen. Diese Lebenswirklichkeit hatte<br />
sich niemand aus Westeuropa vorstellen können.<br />
Wir wohnten während der fünf Tage in einem russischen<br />
Waisenhaus. Für den Sommer war das Heim für die Kinder<br />
geschlossen und für unterschiedliche Gruppen geöff<strong>net</strong>.<br />
Wir teilten uns das große Gelände mit einer Gruppe<br />
tschetschenischer Kinder. Die Unterkunft entsprach weder<br />
irgendeinem westeuropäischen Standard noch unseren<br />
bescheidenen Erwartungen, obwohl wir bei den vorangegangenen<br />
Festivals in einfachen Turnhallen und schlichten<br />
Klassenzimmern untergebracht waren. Die Zimmer des<br />
Waisenhauses waren in einem katastrophalen Zustand, von<br />
den Sanitäreinrichtungen ganz zu schweigen. Aber es beschwerte<br />
sich niemand über Ungeziefer im Bett und keiner<br />
klagte über fehlende Toilettentüren. Wir waren ja nur fünf<br />
Tage hier, das ist nichts im Vergleich zu einer ganzen Kindheit<br />
in einem Bett voller Flöhe. Es gab nur kaltes Wasser und<br />
auch das reichte nicht immer für eine Dusche: Für die kleinen<br />
Tschetschenen war fließendes Wasser der pure Luxus und<br />
sie spielten minutenlang unter dem eisigen Wasserstrahl.<br />
Uns haben die Tage in St. Petersburg tief beeindruckt. Der<br />
Blick auf das ungeschönte Bild der Metropole hat uns die<br />
russische Lebenswelt ein Stückchen näher gebracht. Und<br />
es sind genau diese Eindrücke, die wir auch bei den künftigen<br />
Festivals nicht missen wollen. Deshalb kommen jeden<br />
Sommer bis zu zweihundert junge Christen zusammen. Alle<br />
wollen sie jenseits der eigenen Konfession Kontakte knüpfen<br />
und etwas von dem Leben auf der anderen Seite des Meeres<br />
erfahren. Bei mir und meinem Mann war es nicht anders.<br />
Dass wir uns dann ausgerech<strong>net</strong> in einander verliebten, die<br />
wir beide in Hamburg aufgewachsen sind, war so nicht geplant.<br />
Zumindest aber stammen wir aus unterschiedlichen<br />
Konfessionen und leben nun auch den ökumenischen Alltag<br />
in unserer Familie und nicht nur zwischen Nordkap und Mecklenburger<br />
Seenplatte. Bien lebt von den persönlichen Kontakten<br />
und internationalen Freundschaften.<br />
Denn wer an jenem Sommerabend in der alten Klosterruine<br />
die Erfahrung gemacht hat, dass Orthodoxe, Katholiken<br />
und Protestanten einen gemeinsamen Glauben haben und<br />
man eben diesem Glauben auf ganz unterschiedliche Weise<br />
gemeinsam Ausdruck verleihen kann, der lässt sich von<br />
seinem Engagement für die Ökumene nicht mehr so schnell<br />
abbringen.<br />
Wenn Gott sich in einem Hotel eintragen müsste,, er wüsste wahrscheinlich<br />
gar nicht, was er unter „Konfession“ schreiben sollte.<br />
Hans-Dieter Hüsch<br />
30 31
Reisetipps<br />
Andere Länder - Andere Kirchen<br />
Religiöse Bauten weltweit<br />
Hannah Hufnagel und Philipp Schönecker<br />
Die LIBERTY LADY bekennt sich zum Christentum: Statt Leuchte streckt<br />
die Kopie der Freiheitsstatue ein goldenes Kreuz in den Himmel und hält<br />
die zehn Gebote im Arm. Die gut 21 Meter hohe Statue ist das Wahrzeichen<br />
der größten Baptistengemeinde in Memphis.<br />
Schluss mit Totenstille! Der Friedhof VILLA DE GUADALUPE an der mexikanischen<br />
Basilika der Jungfrau von Guadelupe, einem der bekanntesten<br />
Marienheiligtümer der Welt, verwandelt sich an Allerheiligen zu einer<br />
bunten Feiermeile: Familien picknicken auf den Gräbern ihrer Angehörigen,<br />
ausgestattet mit Zuckertotenköpfen und makabren Girlanden. Bis<br />
in die Nacht wird wild gefeiert.<br />
Lust auf einen Ausflug ins Heilige Land zu Zeiten Jesu? Der Bibelpark<br />
in Buenos Aires macht’s möglich: In TIERRA SANTA wird die<br />
Auferstehung des Heilands alle halbe Stunde inszeniert, Martin Luther<br />
und Mutter Theresa sind auch mit von der Partie.<br />
…der hat auf keinen Sand gebaut: 90 Meter unter der Erde liegt die<br />
Untergrundkirche im schwedischen KRISTINEBERG, mitten in einer<br />
Metallgrube, in der noch immer Silber und Gold abgebaut werden.<br />
Die Repression des Sowjetregimes gegenüber den Religionen<br />
machte auch auf vor deren Sakralbauten nicht Halt. Die deutsche<br />
Gemeinde in St. Petersburg wurde in ein öffentliches Schwimmbad<br />
umgewandelt. Heute ist SANKT PETRI wieder ein Gotteshaus, die<br />
Spuren des Umbaus sind noch immer deutlich zu erkennen.<br />
Männer unter sich: In der autonomen Mönchsrepublik auf dem<br />
heiligen Berg ATHOS in Griechenland leben über 2.200 orthodoxe<br />
Klosterbrüder. Frauen ist der Zutritt verboten, weibliche Haustiere<br />
eingeschlossen. Ausgenommen sind lediglich Hennen, deren frischer<br />
Eidotter für die Ikonenmalerei benötigt wird.<br />
In Mali steht das größte Sakralgebäude aus Lehmziegeln: Die mittelalterliche<br />
Moschee von DJENNÉ wird jedes Jahr nach Ende der Regenzeit<br />
gemeinschaftlich von den Einwohnern der Stadt repariert.<br />
Einst war sie eines der wichtigsten islamischen Zentren und gilt<br />
bis heute als Höhepunkt der sudanesisch-sahelischen Architektur.<br />
Die größte Kirche der Welt steht in Rom? Falsch: Die Petersdomkopie<br />
an der Elfenbeinküste ist wenige Quadratmeter größer als<br />
das Original. Präsident Félix Houphouët-Boigny gab 1983 den Auftrag<br />
für das Mammutprojekt Basilika NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX.<br />
Zu Besuch beim Wüstenscheich: Eine der modernsten Moscheen<br />
ist die SCHAH-FAISAL-MOSCHEE in Islamadad. Die Nationalmoschee<br />
von Pakistan ist mit der quadratischen Gebetshalle einem<br />
traditionellen Beduinenzelt nachempfunden.<br />
Die älteste noch erhaltene Kirche liegt im israelischen MEGIDDO<br />
unterhalb eines modernen Gefängnisses. Das Gotteshaus stammt<br />
aus dem ersten christlichen Jahrhundert.<br />
Unter Ratten: Im indischen KARNI-MATA-TEMPEL werden über<br />
20.000 Ratten als Reinkarnation der Göttin Durga verehrt. Die<br />
barfüßigen Gläubigen essen und trinken aus den Opferschalen der<br />
Nagetiere. Eine über den Fuß huschende Ratte bringt Glück.<br />
Der größte Tempelkomplex der Welt liegt in Kambodscha. In ANG-<br />
32 33<br />
Reisetipps<br />
KOR WAT wurden auf einer Gesamtfläche von mehr als 200 km2<br />
bisher über 1.000 große und kleine Heiligtümer unterschiedlicher<br />
Größe entdeckt.<br />
Ein boomendes Geschäft sind die Tempel der japanischen Wasserkinder,<br />
wie der JOSUT-KANNON-TEMPEL in Tokio. Aus Angst vor<br />
der Rache ihrer abgetriebenen Kinder verehren die Mütter dort<br />
kleine Buddha-Skulpturen in Babyoutfits. Für den Service müssen<br />
sie zahlen.<br />
Den Jesus vom Zuckerberg kennt jeder, aber die MARIENSKULP-<br />
TUR auf den Philippinen soll mit 1<strong>02</strong> noch einmal zwei Meter größer<br />
und damit die höchste Statue der Welt werden.<br />
Typisch Touri: Der ULURU im australischen Outback ist für die Aboriginals<br />
heilig und spielt eine zentrale Rolle im indigenen Mythos des<br />
Landes. Dass jährlich tausende Touristen den Berg erklimmen, ist<br />
Teil der respektlosen Vermarktung des Wahrzeichens.
Impuls Impuls<br />
„Seid ihr nur die Kaderschmiede des Establishments?“<br />
Eine Frage an die cusanische Öffentlichkeit von Michael Fipper<br />
Unlängst folgte ich dem Gespräch zweier pensionierter Schuldirektoren, die zeitlebens in der katholischen Kirche<br />
verwurzelt waren. Obwohl beide jenseits der 70, waren sie doch voller Leidenschaft:<br />
„Wir haben in unserer Kirche eine Vorrevolutionsstimmung wie im Herbst 1989“, meinte der eine. „Selbst treue<br />
und engagierte Katholiken begehren auf. Da kocht viel mehr unter der Oberfläche, als die Schlagzeilen in den Medien<br />
widerspiegeln.“<br />
„Diese Vorrevolutionsstimmung spüre ich auch“, entgeg<strong>net</strong>e sein Gegenüber, „aber ich fürchte, es ist nicht wie<br />
1989, sondern eher wie im März 1848: Jeder weiß, dass es mit ‚Hochwürden’ und ‚Euer Exzellenz’ auf Dauer nicht<br />
weiter geht. Aber was es letztlich heißt, ‚das Reich unter demokratischer Führung zu vereinen’, ist leider unklar.<br />
„Du hast recht“, pflichtete der erste bei. „Viele Diskussionen drehen sich um die alten Kamellen: Frauenpriestertum,<br />
Zölibat, Homosexualität, fehlender Respekt vor dem Engagement der Laien. Jetzt kommt noch das Thema<br />
Kindesmissbrauch hinzu. Das sind aber im Grunde nur die Auslöser der Unzufriedenheit. Das ist nicht der Kern<br />
der Sache.“<br />
Der zweite sprang auf den Gedanken auf: „Genau: So wie der Auslöser des Arbeiteraufstands vom 17. Juni 1953<br />
die Erhöhung der Arbeitsnormen gewesen sein mag — im Kern geht es um ganz andere Fragen. Wenn wir nicht<br />
enden wollen wie die Bewegungen von 1848 und 1953, dann brauchen wir eine gemeinsame Vision unter den<br />
Gläubigen, wie wir unsere Kirche eigentlich organisiert sehen wollen.“<br />
Und plötzlich wurde ich in das Gespräch hineingezogen:<br />
„Du bist doch Cusaner. Gibt es unter den Cusanern eigentlich Leute, die alternative Visionen zu den bestehenden<br />
kirchlichen Machtstrukturen und Hierarchien entwickeln? Oder seid Ihr am Ende nur die Kaderschmiede des Establishments?“<br />
Ich zögerte.<br />
„Ihr müsst ja nicht gleich die ganze Organisation infrage stellen, aber als kirchliche Elite werdet ihr derartig zentrale<br />
Fragen doch nicht einfach ausblenden: Was heißt eigentlich Demokratie in der Kirche? Nach welchen Regeln werden<br />
Kirchenobere berufen und abberufen? Womit rechtfertigen sie ihre Macht? In weltlichen Regierungen ist die<br />
Zeit der Herren ‚von Gottes Gnaden’ ja nun vorbei: Wie wird die Kirche aussehen, wenn sie eines Tages nicht nur<br />
Galilei akzeptiert, sondern sich auch mit Kant, Descartes und schließlich Rousseau auseinandersetzt?“<br />
Ich muss zugeben, dass ich von dieser Wendung des Gespräches ein wenig überfordert war. Aber Fragen, gerade<br />
auch kritische Fragen, verdienen es beantwortet zu werden. Und so gebe ich die Frage der beiden alten Herren zur<br />
Diskussion an die Cusanische Öffentlichkeit weiter.<br />
Ist es nicht sonderbar, dass die Menschen so gerne für die Religion<br />
fechten und so ungerne nach ihren Vorschriften leben?<br />
Georg Christoph Lichtenberg<br />
34 35
Aus der Geschäftsstelle<br />
„Worst case: Ein Tag im Büro“<br />
Name: Dr. Ingrid Reul<br />
Alter: Da möchte ich mit einem Zitat von August Strindberg antworten:<br />
„Wenn Sie mich fragen, wie alt ich bin, so weiß ich es nicht. Es kommt darauf an,<br />
mit wem ich spreche.“<br />
Studienfächer: Germanistik, Geschichte, Theater-, Film und Fernsehwissenschaft<br />
Abschluss: Magister | Promotion in Germanistik<br />
Wohnort: Hürth — ganz nah bei Köln<br />
Aufgabenbereich: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement, Vertrauensdo-<br />
zenten, Hochschulgruppen, Fachschaftsarbeit, Auswahl- und Bildungsarbeit<br />
Kontakt: ingrid.reul@cusanuswerk.de, <strong>02</strong>28 98384-35<br />
Wie sieht ein typischer Arbeitstag im <strong>Cusanus</strong>werk aus, das<br />
heißt gibt es ihn überhaupt?<br />
Da die Arbeit im <strong>Cusanus</strong>werk sehr abwechslungsreich ist,<br />
sind für einen typischen Arbeitstag die verschiedensten Szenarien<br />
denkbar: ein Tag auf einer Ferienakademie, ein Tag auf<br />
einer Kolloquienreise, ein Tag während einer Auswahlsitzung<br />
oder – worst case – ein Tag im Büro.<br />
Dieser beginnt mit einem ersten Blick auf die Mails, die seit<br />
gestern abend eingetroffen sind; es wird wohl das Beste sein,<br />
sie gleich zu beantworten. Heute möchte ich am Konzept für<br />
die nächste Ferienakademie arbeiten. Ich lege schon mal die<br />
Unterlagen bereit – doch halt: Da klingelt das Telefon. Ein<br />
freundlicher Journalist möchte wissen, wie sich das <strong>Cusanus</strong>werk<br />
zur aktuellen Debatte über Bildungsgerechtigkeit verhält.<br />
Nachdem das geklärt ist, gehe ich kurz in die Küche und mache<br />
mir ein Kännchen Tee. Zurück im Büro, schlage ich die Unterlagen<br />
auf, die ich für die Akademievorbereitung zurechtgelegt<br />
hatte. Eine meiner Kolleginnen kommt herein und plündert<br />
meine — zugegebenermaßen ziemlich großen — Schokoladenvorräte.<br />
Dabei diskutieren wir kurz die Tagesordnungspunkte<br />
der morgigen Hauskonferenz.<br />
Ich muss heute auch unbedingt noch die Bewerberakten zur<br />
Vorbereitung der Kolloquien lesen, die übermorgen beginnen.<br />
Oh, und schnell mal die Homepage aktualisieren – schon wieder<br />
hat eine Cusanerin einen Preis für ihre Dissertation bekommen.<br />
Ganz dringend muss auch die Pressemitteilung zur<br />
nächsten Künstler-Ausstellung verschickt werden. Vorher<br />
sollte ich mich aber noch um die Druckfahnen für den Jahresbericht<br />
und das Programmheft kümmern. Langsam wird<br />
es Zeit für die Mittagspause im Kreis der Kolleginnen und Kollegen.<br />
Wieder am Arbeitsplatz, schreibe ich eine Idee auf, die<br />
mir zur Ferienakademie gekommen ist. Da eilt mein Kollege<br />
herein und bringt mir eine Kiste mit Vorauswahl-Akten — bitte<br />
bald lesen! Was sagen die Mails? Die Universität München<br />
plant einen Informationstag zur Studienfinanzierung; da frage<br />
ich doch gleich mal die Gruppensprecher, ob sie uns dort vertreten<br />
können. Und wir brauchen einen neuen Vertrauensdozenten<br />
— wer käme denn da in Frage? Das Tagungshaus für<br />
die nächste Akademie ruft an und fragt, ob die Teilnehmer<br />
auch in Viererzimmern übernachten können. Nein, auf keinen<br />
Fall! Unbedingt sollte ich heute noch den Eröffnungsreferenten<br />
für die Graduiertentagung anrufen, um die Inhalte seines Vortrags<br />
mit ihm abzustimmen. Was? Schon 18 Uhr? Er ist nicht<br />
mehr im Büro? Na ja, dann versuche ich es morgen wieder.<br />
Ja, so ungefähr läuft es bei mir. Das klingt alles etwas hektisch,<br />
ist aber niemals langweilig. Das wichtigste sind aber die Beratungsgespräche<br />
mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten; sie<br />
liegen mir besonders am Herzen — und dafür ist auf jeden Fall<br />
immer Zeit!<br />
Beschreiben Sie im Unterschied dazu doch mal einen typischen<br />
Urlaubstag.<br />
Mein Urlaubstag findet idealerweise an einem Phantasie-Ort<br />
statt, der die Vorzüge verschiedener Adressen miteinander<br />
vereint. Ich darf Sie also einladen, mir zu folgen: Florenz liegt<br />
am Mittelmeer, ist dicht besiedelt mit Wiener Kaffeehäusern,<br />
englischer Teekultur und italienischer Renaissance. Die Lufttemperatur<br />
liegt bei 26 Grad, die Wassertemperatur auch.<br />
Der Tag beginnt, nachdem ich lange geschlafen habe, mit<br />
einem ausführlichen Frühstück. Dann starte ich in Richtung<br />
Kultur: Kirchen, Museen, Ausgrabungen, Galerien — kurz: Alles,<br />
was mein Phantasie-Ort seit der Antike hervorgebracht<br />
hat, wird besucht. Nach einer Mittagspause an einem ruhigen<br />
Ort geht es an den Strand; dort stürze ich mich in die Wellen,<br />
bevor ich eines der 35 Bücher lese, die mein Gepäck immer<br />
etwas unhandlich werden lassen.<br />
Danach gibt es Tee und — ganz wichtig — Törtchen. So gestärkt,<br />
kann ich einen Stadtspaziergang machen, etwas shoppen<br />
(ein kurz vor dem Urlaub ausgezahlter Lottogewinn wäre<br />
nicht schlecht) und dann ein ausgiebiges Abendessen auf einer<br />
schattigen Terrasse anschließen. (Wenn ich mir dieses Programm<br />
so ansehe, scheint mir, dass mein Urlaubstag deutlich<br />
mehr Stunden haben müsste als mein Arbeitstag…)<br />
Welchen Titel trägt Ihre Traum-Ferienakademie und wie stellen<br />
Sie sich die zwölf Tage vor?<br />
Meine Traum-Ferienakademie geht aus von einem literarischen<br />
Thema, das in Bezug steht zu wissenschaftlichen Entwicklungen<br />
seiner Zeit; unter historischen Gesichtspunkten also so etwas<br />
wie Literatur und Psychoanalyse oder Literatur und Technik,<br />
aber auch im Blick auf gegenwärtige Entwicklungen lassen<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
sich natürlich entsprechende Wechselwirkungen finden: Wie<br />
werden die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung, wie die<br />
Probleme der Bioethik literarisch rezipiert? Welche Bezüge<br />
gibt es zur bildenden Kunst? Dass das Ganze auch interdisziplinär<br />
funktioniert, ergibt sich daraus dann ganz von selbst. Die<br />
12 Tage verbringen wir mit vielen Autorenlesungen, mit Theaterbesuchen,<br />
Literaturverfilmungen und Schreib-Workshops.<br />
Diese Ausgabe der CC widmet sich dem Thema „Andere Länder<br />
— Andere Sitten“. Welche (Un-)Sitten sind Ihnen bisher in<br />
der großen, weiten Welt begeg<strong>net</strong>?<br />
Mark Twain hat geschrieben, Menschen, die viel gereist seien,<br />
erkenne man an ihrem unzufriedenen Gesichtsausdruck. Ob<br />
sich die Unzufriedenheit aus den Reiseeindrücken ergibt oder<br />
ob sie mit der Enttäuschung zu tun hat, immer wieder in den<br />
Alltag zurückkehren zu müssen, läßt er allerdings offen. Aber<br />
im Ernst: Richtig schlimm sind lärmende Touristen, die glauben,<br />
ihnen gehöre die Welt. Ansonsten habe ich an vielen Orten<br />
große Gastfreundschaft erlebt, die sich in den verschiedensten<br />
originellen Sitten widerspiegelt. (Zum Beispiel ist es in<br />
Georgien üblich, bei jedem Trinkspruch, der am Tisch vorgetragen<br />
wird, das Wodka- oder Weinglas vollständig zu leeren. Und<br />
es gibt viele Trinksprüche im Laufe eines Abends…) Eine Unsitte,<br />
die leider immer noch als Touristenmag<strong>net</strong> funktioniert, ist<br />
meiner Ansicht nach der Stierkampf in Spanien. Ein Land, das<br />
über eine so reiche kulturelle Tradition verfügt, sollte dieses<br />
Spektakel längst abgeschafft haben.<br />
36 37
Von der Basis<br />
Ein christliches Bündnis für den Klimaschutz<br />
Markus Schmidt, Christian Weiß und Sarah Winands<br />
Mit einem Positionspapier zur UN-Klimakonferenz in<br />
Kopenhagen versuchte sich die Initiative 2°C in die<br />
Debatte über Klima- und Umweltschutz einzubringen.<br />
Aus explizit christlicher Sicht formulierten die (alt-)<br />
cusanischen Mitglieder der Initiative konkrete Forderungen<br />
an die Politik, um damit Denkanstöße für die<br />
Entscheidungsträger zu geben.<br />
Der Klimawandel ist eine Herausforderung für die<br />
gesamte Menschheit, der wir nur durch Engagement<br />
auf verschiedensten Ebenen begegnen können.<br />
Diese Auffassung teilend, machte sich die Initiative<br />
2 °C im Oktober 2009 an die Arbeit, sich darüber<br />
Gedanken zu machen, welche Konsequenzen und<br />
Forderungen sich aus dem christlichen Weltbild für<br />
den Klimaschutz ergeben. Diese Überlegungen wurden<br />
dann unter dem Titel „Für einen globalen Bund<br />
in Solidarität und Nachhaltigkeit“ als Positionspapier<br />
formuliert.<br />
Als Christen tragen wir Verantwortung für Gottes<br />
Schöpfung. Herrschaft geht in unserem Verständnis<br />
einher mit dem Auftrag, die Erde als Lebensraum aller<br />
Geschöpfe zu pflegen. Auf heutige Herausforderungen<br />
übertragen bedeutet dies die Verpflichtung,<br />
ein stabiles Klima und die Erhaltung der biologischen<br />
Vielfalt und der Ökosystemfunktionen zu gewährleisten.<br />
Zu einem behutsamen und nachhaltigen Umgang<br />
mit der Umwelt sind wir auch den zukünftigen<br />
Generationen gegenüber verpflichtet. Deren Interessen<br />
müssen bedacht und durch nachhaltiges Handeln<br />
berücksichtigt werden. Vor allem beim Klimapro-<br />
blem mit seiner globalen und langfristigen Dimension<br />
müssen die Kirchen Fürsprecher für diejenigen sein,<br />
die keine Stimme und keinen Einfluss haben. Im Fokus<br />
christlichen Handelns muss die Solidarität mit den<br />
Benachteiligten stehen (vgl. z. B. Mt 25,40). Für sie<br />
muss lautstark und offensiv Partei ergriffen werden.<br />
Wenn wir nichts gegen den Klimawandel unternehmen,<br />
riskieren wir eine humanitäre, ökologische und<br />
ökonomische Katastrophe, deren Ausmaß ihresgleichen<br />
sucht. Dabei ist eine klimaverträgliche Welt<br />
auch mit einem angemessenen Wohlstand möglich,<br />
wenn wir nur die richtigen politischen Weichen stellen.<br />
Wie eine solche Weichenstellung für die Bewahrung<br />
der Erde konkret aussehen kann, beschreibt das<br />
Papier detailliert:<br />
Unter anderem wird eine global wirksame Obergrenze<br />
für CO2-Emissionen im Einklang mit dem 2-Grad-Ziel,<br />
welches natürlich nur ein Mindestziel ist, verlangt und<br />
die Aufteilung dieses CO2-Budgets zugunsten der Entwicklungsländer<br />
gefordert. Diese werden zwar massiv<br />
von den Folgen des Klimawandels betroffen sein,<br />
haben aber kaum zu dessen Verursachung beigetragen.<br />
Weitere Forderungen sind unter anderem Nachbesserungen<br />
beim europäischen Emissionshandel,<br />
eine Verbraucher- und Informationspolitik für transparente<br />
Energiekosten sowie mehr Forschungs- und<br />
Förderprogramme für klimafreundliche Technologien.<br />
Auch wird die Bundesregierung dazu aufgerufen, am<br />
Atomausstieg festzuhalten sowie das Angebot im<br />
öffentlichen Personenverkehr auszubauen. Ein wichtiges<br />
Anliegen der Initiative 2°C war es natürlich auch,<br />
dass ihre Überlegungen und Ansichten in die Öffentlichkeit<br />
getragen und publik gemacht werden. Mit einer<br />
Online-Petition konnte die Initiative 2°C insgesamt<br />
fast 1000 Unterschriften als Unterstützer für ihr<br />
Positionspapier sammeln. Vom Bauhelfer über den<br />
Pfarrer bis hin zur Universitätsprofessorin fand das<br />
Papier in breiten gesellschaftlichen Schichten und<br />
unterschiedlichen politischen Kreisen guten Anklang.<br />
Auch viele Prominente aus Politik und Gesellschaft,<br />
wie etwa der Vize-Präsident des Deutschen Bundestags<br />
Dr. Wolfgang Thierse oder der bekannte Sozialethiker<br />
Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach SJ, setzten<br />
ihre Unterschrift gerne auf die Unterstützerliste. Die<br />
Berichterstattung in den Medien beschränkte sich<br />
aufgrund der großen Anzahl von gesellschaftlichen<br />
Gruppen, die sich zur Klimakonferenz in Kopenhagen<br />
äußerten, auf vereinzelte Pressemitteilungen hauptsächlich<br />
im Inter<strong>net</strong>. Andererseits konnten gute Kontakte<br />
zu verschiedenen und großen Verbänden und<br />
Gruppierungen, wie dem Landeskomitee der Katholiken<br />
in Bayern oder Netzwerk Afrika Deutschland,<br />
geknüpft werden, die auch in Zukunft an einer Zusammenarbeit<br />
zu klimapolitischen Fragen interessiert<br />
sind. Ein besonderer Erfolg ist sicherlich die Einladung<br />
einiger Mitglieder der Initiative ins Bundeskanzleramt<br />
wenige Tage vor den abschließen Verhandlungen in<br />
Kopenhagen. Dort diskutierten sie das Positionspapier<br />
und die darin empfohlenen Maßnahmen gegen<br />
den Klimawandel mit Berthold Goeke, dem Leiter des<br />
Umweltreferates im Bundeskanzleramt. Außerdem<br />
wurde ihm das Papier mit besten Empfehlungen als<br />
Reiselektüre für die Bundeskanzlerin übergeben.<br />
38 39<br />
Von der Basis<br />
Große Hoffnungen wurden wenige Tage später von<br />
vielen Menschen weltweit in die Verhandlungen in Kopenhagen<br />
gesetzt. Doch leider wurden diese in fast<br />
jeder Hinsicht jäh enttäuscht. Der berühmte Satz von<br />
Bertolt Brecht „Wer kämpft, kann verlieren; wer nicht<br />
kämpft, hat schon verloren“ wird zwar viel zu oft zitiert,<br />
aber nur selten passt er so gut wie beim Klimaschutz:<br />
Wenn wir nicht alle — und alle bedeutet hier konsequent<br />
gedacht letztlich die gesamte Menschheit — an<br />
einem Strang ziehen und jeder auch persönlich dazu<br />
bereit ist, seinen eigenen Teil zum Klimaschutz beizutragen,<br />
verspielen wir endgültig die (höchstwahrscheinlich)<br />
noch vorhandene Chance, unsere Erde für<br />
möglichst viele Menschen heute und insbesondere<br />
für zukünftige Generationen in einem lebenswerten<br />
Zustand zu erhalten. Insbesondere wir als Christen<br />
und Christinnen müssen diese Herausforderung annehmen,<br />
und so unsere Verantwortung für die Erhaltung<br />
der Schöpfung sichtbar werden lassen.<br />
Das gesamte Positionspapier sowie ein Hintergrundpapier<br />
ist nach wie vor auf den Inter<strong>net</strong>seiten der Initiative<br />
2°C unter www.cusanus.<strong>net</strong> abrufbar.
Von Studentenfutter<br />
der Basis<br />
Indien verstehen<br />
Auslandsakademie in der Retrospektive – ein Versuch<br />
Simone Hiller und Giulia Mennillo<br />
Nachhaltig prägend war sie, diese Ferienakademie.<br />
Gewiss. Darüber bestand unter den<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereits bei der<br />
Abschlussrunde vor Ort Einigkeit. Wir hatten an einer<br />
Exkursion im Wortsinne teilgenommen: Indien war ein<br />
„Herauslaufen aus dem Gewohnten“ in vielerlei Hinsicht.<br />
Dass diese Erfahrung irreversible Spuren hinterlassen<br />
hatte — keine Frage. Was im Einzelnen und vor allem<br />
im Zusammenhang zu dieser unmittelbaren Intuition<br />
geführt haben mag, war noch eindrucksschwanger im<br />
Sitzkreis auf dem überklimatisierten Hotelfußboden<br />
reflektierend jedoch schwer zu greifen. Nicht ganz zwei<br />
Wochen und nur zwei Orte hatten — gespeist bis in<br />
die letzten Stunden vor der Abreise — ein Mosaik von<br />
Eindrücken, Reflexionen, Erfahrungen und nicht zuletzt<br />
Fragen ausgelegt, das vorerst trotz der erahnten<br />
Existenzialität provisorisch blieb. Offen auch die<br />
Frage, wie sich das Gesammelte und diese spontane<br />
erste Reflexion im realen Alltags-Dasein eines jeden<br />
niederschlagen würden. Und auch drei Monate nach der<br />
Rückkehr vom indischen Subkontinent dürften noch viele<br />
Fragen dieser Art unbeantwortet sein und es wäre mehr<br />
als voreilig, Gegenteiliges zu behaupten. Gleichermaßen<br />
soll der Umstand, dass die Teilnehmenden womöglich<br />
— und hoffentlich — niemals vollständig mit dieser Reise<br />
abschließen werden, keinem Versuch entgegenstehen,<br />
dieses Erlebnis zumindest in Ausschnitten im Lichte<br />
einer mittelfristigen Retrospektive zu betrachten und<br />
den CC-Leserkreis an dieser Reflexion teilhaben zu<br />
lassen.<br />
FÜR „UNS“ UNVORSTELLBARE RELIGIÖSE UND<br />
SPIRITUELLE PLURALITÄT<br />
Zwei inhaltliche Schwerpunkte bestimmten die Akademie:<br />
zum einen die gesellschaftliche Situation der Dalits<br />
(auch unter der umgangssprachlichen Bezeichnung<br />
die „Kastenlosen“ oder die „Unberührbaren“ bekannt),<br />
zum anderen der interreligiöse Dialog im Rahmen<br />
einer für okzidentale Verhältnisse (vielleicht noch) nicht<br />
vorstellbaren religiösen und spirituellen Pluralität. Die<br />
beiden thematischen Stränge erwiesen sich schnell<br />
als Klammer, die das vielseitige Programm zwischen<br />
Taj Mahal, wissenschaftlichen Vorträgen, Besuch<br />
von Forschungsinstituten, Ausflug auf das Land,<br />
Gottesdiensten und Basarbesuchen gewissermaßen<br />
Studentenfutter<br />
zusammenhielt. Sie waren ein roter Faden durch<br />
die Akademie sowohl im Hinblick auf Begegnungen,<br />
Vorträge und Besuche als auch hinsichtlich der<br />
beiden geographischen Stationen unserer Reise, der<br />
Hauptstadt Neu Delhi im Norden mit deren Umland<br />
und der Hauptstadt des Bundesstaates Tamil Nadu<br />
namens „Chennai“ (früher Madras) mit ihrem ländlichen<br />
Hinterland.<br />
SÄKULARISIERUNG: ZWANGSLÄUFIGE FOLGE DES<br />
WIRTSCHAFTSWACHSTUMS?<br />
Indien, ein Land an der Schwelle zwischen Tradition und<br />
Moderne, so lautete der Titel der Auslandsakademie –<br />
ein Land inmitten von gelebter Herkunft und Zukunft, wo<br />
Tradition und Moderne keine Gegensätze sind und sich<br />
aus unserer Perspektive manchmal doch fundamental<br />
widersprechen, lässt sich nach der Reise differenzierter<br />
formulieren. Egal ob zwischen den engen Gassen Alt-<br />
Delhis, mitten auf den Straßen der etwas „kleineren“<br />
Stadt Chennai in Südindien (im Vergleich zu den ca. 18,5<br />
Millionen Einwohnern in Delhi und Umland „nur“ ca. 8<br />
Millionen Einwohner) oder in den Diskussionsrunden mit<br />
hochrangigen Referenten aus Wissenschaft und Politik:<br />
Wir mussten feststellen, dass wir zum Verstehen<br />
der Wendepunktsituation dieser hochkomplexen<br />
aufstrebenden Atommacht erst einen common<br />
sense, ein Gefühl, dafür entwickeln müssen, welche<br />
Überzeugungen und Muster fest verwurzelt im Habitus<br />
und in der Mentalität der Menschen verankert sind. Es<br />
ist der Versuch, ein wertfreies Verständnis von Tradition<br />
als Ausgangspunkt zu entwickeln – weder verurteilt als<br />
überkommen Althergebrachtes noch glorifiziert als<br />
bewährt Überliefertes. Nur unter dieser Prämisse mag<br />
es überhaupt möglich sein, vom Status Quo Indiens aus<br />
die Einflüsse der Moderne herauszukristallisieren und<br />
deren Wechselwirkungen mit diesem multiethnischen<br />
Land zu erahnen und in Ansätzen nachzuvollziehen. Bei<br />
diesem aufgrund der begrenzten Zeit kurzen, aber dafür<br />
umso intensiveren Lernprozess half streckenweise<br />
ein Vergleich mit unserer westlichen Entwicklung, die<br />
durchaus Parallelen zur indischen aufweist. In anderen<br />
Fällen scheiterte unsere europäische Perspektive; zum<br />
Beispiel, wenn einsichtig wird, dass der erste Schritt<br />
zur Modernisierung eines fernab liegenden „tribal<br />
village“ nicht Brunnenbau und Elektrifizierung sind,<br />
40 41
Studentenfutter<br />
sondern die Ganztageskinderbetreuung. Andererseits<br />
machten wir auch grundlegende Unterschiede in der<br />
Auswirkung bestimmter ökonomischer Entwicklungen<br />
aus; beispielsweise den in Indien nicht funktionierenden<br />
Automatismus, dass ein höheres Wirtschaftswachstum<br />
gleichzeitig zu höherem Wohlstand, einem besseren<br />
Lebensstandard und einer gleichmäßigeren Verteilung<br />
der Einkommen führt. Sicherlich — Indien befindet<br />
sich als Schwellenland noch im Anfangsstadium; die<br />
allseits sichtbare Armut war dennoch erschreckend<br />
und befremdend. Andererseits wurden wir von den<br />
renommierten Forscherinnen am „Center for Womens’<br />
Development Studies“ in Delhi mit Begriffen wie „jobless<br />
growth“ und „glass ceiling“ konfrontiert; ihre Forschung<br />
beschäftigt sich neben tödlichen „Haushaltsunfällen“<br />
von Frauen (eine noch immer vorkommende Form, sich<br />
seiner Ehefrau zu entledigen) und der weiblichen nicht<br />
offiziell anerkannten Schwerstarbeit in Familie, Haushalt,<br />
aber auch Straßenbau, zudem mit dem weiterhin<br />
sinkenden Frauenanteil in der Bevölkerung gerade in der<br />
entstehenden Mittelschicht und allem Wachstum zum<br />
Trotz. Und hinter und in alldem: die von uns verkürzt als<br />
Kastensystem wahrgenommene Gesellschaftsordnung,<br />
die noch immer ausschlaggebend für eine Heirat und<br />
allzu oft für den sozialen Status ist. Man erkennt rasch,<br />
eine rein isolierte Betrachtung der verschiedenen<br />
Themenkomplexe ist kaum möglich, auch weil Anspruch<br />
und Wirklichkeit gerade beim Kastenwesen eklatant<br />
auseinanderklaffen. Verfassungsrechtlich abgeschafft,<br />
scheint gerade das Kastenbewusstsein durch Gesetze,<br />
die dazu dienen, die Benachteiligung aufgrund von<br />
Kastenzugehörigkeit zu verbieten, wieder geschärft zu<br />
werden. Plötzlich kämpfen Angehörige niedriger Kasten<br />
ebenfalls darum als „scheduled cast“ gelistet zu werden,<br />
um von den damit verbundenen Vorteilen zu profitieren.<br />
Gleichzeitig behält die Kastenzugehörigkeit trotz ihrer<br />
vehementen und teilweise erfolgreichen Leugnung — von<br />
der UN wird sie nicht automatisch als Diskriminierung<br />
angesehen, weil es nicht um Geschlecht, Religion oder<br />
Ethnie geht und die Verfassung sie verbietet — in Indien<br />
eine alle Lebensbereiche betreffende Gültigkeit. Während<br />
der Akademie konnten wir im direkten Austausch mit<br />
Dalit-Vertretern erfahren, wie unvergleichlich dieses<br />
System mit seinen stabilitätsorientierten Elementen<br />
jedem Individuum in der Gesellschaft seinen festen Platz<br />
zuweist und jedwede Art der tatsächlichen sozialen<br />
Mobilität verbietet. Bildung, hierzulande als das Werkzeug<br />
schlechthin für festes Einkommen und Wohlstand<br />
gepriesen, kann den angeborenen Status innerhalb des<br />
Kastensystems in Indien bislang nur in beispielhaften<br />
Einzelfällen wett machen.<br />
Das Gespräch<br />
mit dem Bischof der<br />
Diözese Chingleput<br />
konnte uns zudem<br />
vor Augen führen, wie<br />
Kastenzuordnungen selbst vor konfessionellen und<br />
religionsspezifischen Grenzen keinen Halt machen, auch<br />
nicht vor den hierarchischen Strukturen der katholischen<br />
Kirche: Ganz nach dem Motto „Kaste sticht Amt“ gibt<br />
es Fälle, in denen katholische Priester den aus einer<br />
Dalit-Familie stammenden Bischof nicht als Leiter der<br />
Diözese anerkennen. Die Annahme, beim Kastensystem<br />
handle es sich um ein dem Hinduismus zuzurechnendes<br />
religiöses System, muss auch anhand anderer Beispiele<br />
hinterfragt werden. Die religiöse Verquickung im Alltag<br />
der Bürger dieser<br />
sich selbst als säkular<br />
verstehenden größten<br />
Demokratie der Welt<br />
mutet fremd an: Die<br />
bereits erwähnte indische<br />
Mittelschicht,<br />
jenes Produkt des<br />
wirtschaftlichen Aufschwungs,<br />
gibt sich<br />
durch die erarbeitete<br />
und neu gewonnene<br />
Kaufkraft keineswegs<br />
säkularer, ganz im<br />
Gegenteil von religiösem<br />
Vakuum kann<br />
nicht die Rede sein,<br />
wenn der sich nun<br />
allmählich einstellende<br />
Wohlstand nicht zu-<br />
Studentenfutter<br />
letzt auch der Göttin des Reichtums, Lakshmi, der Gattin<br />
des Vishnu, gedankt wird. Öffentlicher Anspruch und<br />
private Wirklichkeit gehen augenscheinlich diametral<br />
auseinander. Nach diesen vereinzelten Reflexionen,<br />
die selbstverständlich nur ansatzweise wiedergeben können,<br />
welche Denkanstöße eine solche Bildungsreise auszulösen<br />
vermag, sei angemerkt, dass diese Auslandsakademie<br />
— wir wagen im Namen aller zu sprechen — für uns alle<br />
eine einzigartige und in dieser Form für uns bislang nicht<br />
dagewesene Möglichkeit war, Indien hautnah mit Geist<br />
und allen Sinnen zu erleben, für die wir allen Beteiligten<br />
— allen voran der professionellen wie aufopfernden<br />
Begleitung von Dr.<br />
Kölzer und Pater Dr.<br />
Markus Lubor —<br />
nochmals herzlich<br />
Theodor Fontane<br />
danken möchten.<br />
Hoffentlich werden<br />
noch viele Fortsetzungen folgen, die „barfüßige<br />
Großmacht“ und andere herausfordernde Länder zu<br />
ergründen — wohlwissend, dass andere Länder wie<br />
andere Sitten nie vollkommen zu erfassen sein werden.<br />
Im Rahmen der cusanischen Ferienakademie dieses so<br />
andere Land zu bereisen, war eine einmalige Möglichkeit<br />
von zweiwöchiger Dauer; das „Andere“ zu reflektieren,<br />
ist nun wohl die lebenslange Aufgabe, das Eigene und<br />
das Fremde sowie das Eigene im Fremden fruchtbar<br />
miteinander in Verbindung zu bringen.<br />
Bloßes Ignorieren ist noch keine Toleranz<br />
42 43
Studentenfutter Studentenfutter<br />
Über 2000 Meter ist man immer per DU!<br />
Ergebnisse einer Feldforschung der Fachschaft Expedition<br />
Peter Kneip, Stefan Zinsmeister und Christoph Lindner<br />
ANDERE LÄNDER, ANDERE GETRÄNKE<br />
„Ein Ferner kann kalben und wenn dir das Wasser ausgeht,<br />
kannst Gletschermilch trinken“. Auf diese Weise wurden die<br />
Expeditionsmitglieder von Dr. Ludwig Braun begrüßt. Aber<br />
um eines gleich klar zu stellen, oberhalb von „2.000 Meter<br />
ü.N.N. ist man immer per Du“, wie Ludwig uns aufklärte. Die<br />
Einweisungen in die besonderen Formen der Bergsprache Tirols<br />
begleitete die Fachschaft Expedition auf ihrer gesamten<br />
Forschungsreise vom 7. - 11. Juli <strong>2010</strong>. Kalbt ein Gletscher,<br />
so kann man sich das getreu des semasiologischen Gehaltes<br />
des Wortes kalben bildlich vorstellen, und wer je ein Kuh kalben<br />
gesehen hat, der weiß wovon die Rede ist. Und auch das<br />
Kompositum Gletschermilch erweckt Bilder einer sahnigfrischen<br />
Flüssigkeit, doch erzeugt durch die Gesteinsanteile,<br />
die das Gletscherwasser mit sich den Berg herunterbringt,<br />
gleicht der Geschmack in keiner Weise einer frischen Alpenmilch.<br />
Es verhält sich eher so, dass die Gletschermilch auf der<br />
Zunge nach und nach zerbröselt und zwischen den Zähnen<br />
knirscht. Trotzdem nahmen einige Teilnehmer einen großen<br />
Schluck aus Ludwigs geschnitztem Becher.<br />
ANDERE TÄLER, ANDERE SITTEN<br />
Dass nicht nur in anderen Ländern andere Sitten herrschen,<br />
sondern bereits in anderen Tälern, lässt sich in Obergurgl und<br />
Vent beobachten. Ursprünglich sind das zwei unscheinbare<br />
Bergdörfer, die je durch ein außergewöhnliches Ereignis in die<br />
Weltöffentlichkeit katapultiert wurden. So weiß der Obmann<br />
des Tourismusverbandes von Obergurgl zu berichten: „Der<br />
bekannte Schweizer Physiker und Erfinder Auguste Pi<strong>cc</strong>ard<br />
musste am 27. Mai 1931 mit seinem Stratosphärenballon<br />
auf dem Gurgler Ferner notlanden. Das bis dato verträumte<br />
Dorf Obergurgl sollte an jenen Tag mit einem Schlag geweckt<br />
werden.“ Nicht nur wurde Obergurgl geweckt, sondern aus<br />
dem verschlafenen 14-Höfe-Nest schossen die Pensionen<br />
wie Pilze aus dem Boden. Aus diesem Übernachtungsgeflecht<br />
ragen heute einige überdimensionierte, ja aufgedunsene „Alpenhütten“<br />
hervor — Hotelanlagen mit allem Komfort. Aber<br />
Obergurgl lässt auch nicht jedermann rein! Man ist vor allem<br />
der Ort der Engländer: „20 Prozent der Übernachtungsgäste<br />
stammen aus England“ und auf Nachfrage wurde ergänzt:<br />
„50-55 Prozent der Gäste kommen aus Deutschland“ mit<br />
dem im für den 400 Seelen Ort überdimensionierten Gemeinderaum<br />
verhallenden Nebensatz „Die heißen wir natürlich<br />
auch gerne willkommen“. Mit ganz anderem Stimmvolumen<br />
berichtete man stolz: „Aber von Osteuropa sind wir verschont<br />
geblieben. Es gibt hier fast keine Russen.“ Da bleibt für den<br />
Obmann des Tourismusverbandes nur zu hoffen, dass im<br />
von Obergurgl sehsüchtig erwarteten Ufo, um wieder wie zu<br />
Pi<strong>cc</strong>ards Zeiten in die Presse zu kommen, kein Russe sitzt.<br />
Doch schon hier lassen sich ethnogeographische Unterschiede<br />
ablesen. Obergurgl wurde durch einen Ausländer<br />
berühmt gemacht, Vent dagegen durch einen Ureinwohner.<br />
Es war im Jahre 1991, als „Der Mann im Eis“ von der Familie<br />
Simon, die sich eigentlich nur erleichtern wollte, am<br />
Tisenjoch gefunden wurde, ehe er vom Bergführer und Tourismusobmann<br />
Louis Pirpamer, den wir auf unserer Expedition<br />
trafen, ausgegraben wurde. Es begann eine Erfolgsgeschichte<br />
für das kleine Örtchen — auch Vent wurde über<br />
Nacht berühmt. Seither hofft Vent wahrscheinlich darauf,<br />
dass eine 75.000 Jahre alte Mumie im Gletschereis gefunden<br />
wird, deren DNA zu 100 Prozent mit Louis Pirpamer<br />
übereinstimmt, getreu seinem Motto: „Vent bleibt Vent“.<br />
Welches Weltereignis die Dörfer demnächst heimsuchen<br />
wird, kann mit Sicherheit nur einer beantworten — der Messner!<br />
Reinhold ist natürlich ein Bergkumpel vom Pirpamer Louis,<br />
der ihn wie seine Westentasche kennt. Der Reinhold konnte<br />
das Alter des Ötzi, als er noch frisch im Schnee lag, freilich auf<br />
dem ersten Blick exakt datieren: „500 Jahre!“. Die 300-400<br />
Jahre vom Louis waren ihm zu pauschal. Wie wir inzwischen<br />
wissen, trennen den Schätzungen von Reinhold und Louis und<br />
das tatsächlichen Alter von Ötzi gerade mal eine Potenz!<br />
ANDERE LÄNDER, ANDERE VERANTWORTUNG<br />
Während einer anderen Etappe unserer Expedition durften<br />
wir nach dem Bezwingen einer schotterigen Bergstraße in<br />
2.000m ü.N.N. nicht nur erleben, wie sehr die erste Reihe in<br />
den Kleinbussen begehrt war, sondern auch selbst unseren<br />
Beitrag zum Schutzwald leisten. Insgesamt wurden in Zusammenarbeit<br />
mit der Gruppe Forst des Landes Tirol 200 Lärchen<br />
und Fichten gepflanzt. Nun ist das Stubaital künftig noch<br />
besser vor Lawinen und Hangrutschen geschützt. Ein <strong>net</strong>ter<br />
Nebeneffekt, auch für uns hier in Deutschland, ist der dabei<br />
neu gewonnene CO2-Speicher „Baum“. Dies schien uns bis<br />
dato auch einleuchtend und vernünftig, bis die Frage kam, wo<br />
die ganzen Viecher denn nun grasen, wenn ihre Weideflächen<br />
zu Wald werden. Ganz einfach, erklärte uns der Dieter, alias<br />
Dr. Stöhr vom Forstamt. Zum Ausgleich für die verlorenen<br />
Weideflächen würden den Stubaier Kühen schon mal Sojapellets<br />
serviert. Der Soja wiederum keime gerne auf den gerodeten<br />
Flächen des brasilianischen Regenwaldes. Aber auch<br />
diese Auswirkung des Carbon Capture and Storage „Made in<br />
Austria“ wird man eines Tages gelöst haben, vielleicht wenn<br />
wir in 50 Jahren ins Stubaital zurückkehren, um unseren<br />
cusanischen Schutzwald zu besuchen, denn viel schneller<br />
wächst dort nichts.<br />
ANDERE TAGUNGSFORMEN, BLEIBENDE EINDRÜCKE<br />
Will man ein Resümee zur ersten Fachschaftstagung im<br />
Expeditionsformat ziehen, so müsste man tief durchatmen<br />
und zu einem langen Absatz ansetzen: über den beeindruckenden<br />
Natur- und Kulturraum Alpen, das Forschen mit<br />
allen Sinnen im Geiste des doppelten Humboldts und die<br />
cusanische Gemeinschaft auf 2.000 m bis 3.000 m ü.N.N.<br />
An Stelle eines solchen Absatzes empfehlen wir jedoch lieber<br />
drei Dinge. Zunächst ein Klick auf www.glaziologie.de,<br />
wo der rauschende Vernagtferner bei seiner Diät zu sehen<br />
ist. Dann greife man zum Telefon und wähle die 089/37<br />
914058, um dem Gletscher beim Schwitzen und ins Talrauschen<br />
zu lauschen. Und zu guter Letzt nutze man die<br />
vielen Möglichkeiten, die das <strong>Cusanus</strong>werk uns bietet, und<br />
entfessle den eigenen Entdeckergeist — eine wissenschaftlich<br />
wie persönlich bereicherte Rückkehr ist garantiert.<br />
So bedanken wir uns ganz herzlich beim <strong>Cusanus</strong>werk für die<br />
Gelegenheit zu dieser Expedition und verbleiben bis zum nächsten<br />
Mal mit einem schallenden „Mach den Humboldt!“<br />
44 45
Herbstausgabe<br />
Die Utopie der Gerechtigkeit<br />
„Das Leben ist ungerecht, aber denke daran: nicht immer zu deinen Ungunsten.“<br />
John F. Kennedy<br />
Demnach ist Gerechtigkeit also nur etwas für hoffnungslose Idealisten?<br />
In der nächsten Ausgabe möchten wir die verschiedenen Aspekte des Themas beleuchten. Fragen der<br />
Bildungsgerechtigkeit sind dabei ebenso aktuell wie der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit.<br />
Allenthalben werden mehr Hochschulabsolventen gefordert, die von der bildungsbasierten deutschen<br />
Wirtschaft dringend benötigt werden. Gleichzeitig ist zu fragen: Wer schafft es an die Universitäten und<br />
Fachhochschulen? Wer bekommt ein Stipendium? In Deutschland spielt dabei die soziale Herkunft eine<br />
im internationalen Vergleich beschämend große Rolle: Bayerische Akademikerkinder haben eine sechsmal<br />
höhere Chance eine Gymnasialempfehlung zu bekommen als die Arbeiterkinder im Freistaat. Ist das<br />
Bildungsgerechtigkeit?<br />
Nicht nur in Deutschland herrscht die Wahrnehmung vor, dass die Schere zwischen Arm und Reich<br />
zunehmend auseinanderklafft, erhitzen sich bei millionenschweren Managerboni in Zeiten der Krise die<br />
Gemüter. Während der Staat die großen Banken rettet, wird bei Hartz IV-Empfängern gespart. Ist das<br />
soziale Gerechtigkeit?<br />
Doch davon nicht genug: Auch beim Thema Gleichberechtigung der Geschlechter gibt es noch Defizite.<br />
Immer noch verdienen Frauen für gleiche Arbeit oft weniger als ihre männlichen Kollegen – nur Folge<br />
ihres mangelnden Verhandlungsgeschicks? Brauchen wir eine Frauenquote für die Chefetage wie etwa<br />
in Norwegen?<br />
Und was ist mit der Generationengerechtigkeit (Rentenpolitik)? Internationaler Gerechtigkeit (Verteilung<br />
und Verbrach der Ressourcen)? Gerechtigkeit in der Rechtsprechung (Gleichheit vor dem Gesetz)? Ja,<br />
gibt es den Gerechten Krieg?<br />
Und schließlich die Frage: Inwieweit tragen wir als privilegierte Stipendiaten, Begünstigte der Technologiehochburg<br />
Deutschland, wohlhabende Europäer und überzeugte Christen für die Verwirklichung der<br />
Utopie bei? Was tun wir für die Annäherung an den idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem<br />
es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verteilung<br />
von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder Gruppen gibt, den man Gerechtigkeit<br />
nennt?<br />
Schickt uns eure Antworten!<br />
Eure Reda<strong>cc</strong>tion<br />
Impressum<br />
REDAKTION UND GESTALTUNG<br />
Alex Gebarowski, Christian Gogolin,<br />
Hannah Hufnagel, Laura Pennington,<br />
Philipp Schönecker, Julia Schulz<br />
KONTAKT<br />
<strong>cc</strong>_redaktion@yahoogroups.de<br />
Hannah Hufnagel<br />
Herrengraben 56<br />
20459 Hamburg<br />
BILDNACHWEIS<br />
Kerstin Humberg S. 10,13-14<br />
Hannah Hufnagel S. 28-31<br />
NASA S. 32-33<br />
Hannah Hufnagel S. 34-35<br />
ESA S. 38-39<br />
Giulia Menillo S. 40,42-43<br />
Peter Kneip S. 45<br />
ANSPRECHPARTNERIN GESCHÄFTSSTELLE<br />
Dr. Ingrid Reul<br />
ingrid.reul@cusanuswerk.de<br />
Baumschulallee 5<br />
53115 Bonn<br />
www.cusanuswerk.de<br />
REDAKTIONSSCHLUSS<br />
18. Juli <strong>2010</strong><br />
ISSN 1862-9911<br />
46<br />
46 47
Herbstausgabe <strong>2010</strong>