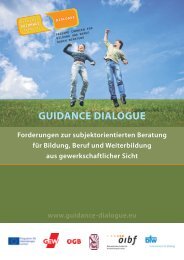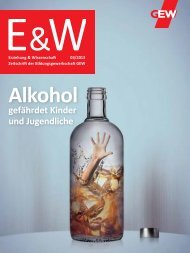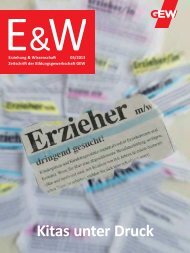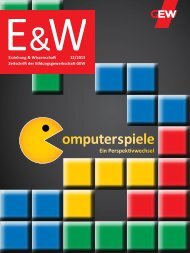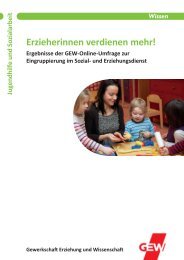E&W Mai 2006 - GEW
E&W Mai 2006 - GEW
E&W Mai 2006 - GEW
- TAGS
- www.gew.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
darauf eine eindeutige, aber nicht<br />
unbedingt befriedigende Antwort:<br />
Er setzt „fast ausschließlich<br />
auf das Steuerrecht“, wie der Verband<br />
alleinerziehender Mütter<br />
und Väter (VAMV) moniert. Zwar<br />
erhalten Eltern ein Kindergeld von<br />
154 Euro im Monat (ab dem vierten<br />
Kind 179 Euro). Doch wahlweise<br />
können sie einen steuerlichen<br />
Freibetrag von 3648 Euro<br />
jährlich nutzen, was sich etwa<br />
ab einem Jahreseinkommen von<br />
60 000 Euro günstiger auswirkt als<br />
das Kindergeld. Was dem Bürger<br />
mehr bringt, prüft das Finanzamt<br />
im Einzelfall von sich aus. Doch<br />
fest steht, dass ausgerechnet Spitzenverdiener<br />
am stärksten entlastet<br />
werden. Mindestens 40 Prozent<br />
der Paarfamilien und 80 Prozent<br />
der Ein-Elternfamilien haben<br />
VAMV-Schätzungen zufolge von<br />
den geplanten steuerlichen Entlastungen<br />
der neuen Bundesregierung<br />
so gut wie nichts, weil sie lediglich<br />
Kindergeld erhalten.<br />
Um diesen Widersinn weiß auch<br />
die seit acht Jahren regierende<br />
SPD, doch sie fühlt sich durch das<br />
Bundesverfassungsgericht gebunden.<br />
Dies verlange, reiche Eltern<br />
nicht mit armen Eltern zu vergleichen,<br />
sondern mit reichen Kinderlosen.<br />
Das verstehen die Verfassungsrichter<br />
unter „horizontaler<br />
Steuergerechtigkeit“, (die laut<br />
Grundgesetz zur „vertikalen Gerechtigkeit“<br />
zwischen Arm und<br />
Reich hinzutreten müsse). Demnach<br />
darf der Staat das Existenzminimum<br />
eines Kindes nicht besteuern,<br />
egal ob es bei der alleinerziehenden<br />
Verkäuferin aufwächst<br />
oder in der Millionärsfamilie. Die<br />
Logik steuerlicher Freibeträge<br />
bringt es mit sich, dass sich über eine<br />
Spitzenentlastung freuen kann,<br />
wer den Spitzensteuersatz zahlt.<br />
Ursprünglich wollte die damalige<br />
rot-grüne Koalition die Vorgaben<br />
aus Karlsruhe mit einer Reform<br />
umsetzen, die allen Eltern die gleichen<br />
finanziellen Vorteile gebracht<br />
hätte. Doch diese wäre so<br />
teuer gekommen, dass der Finanzminister<br />
sein Veto einlegte.<br />
An leeren Kassen aber sollte eine<br />
sozial gerechte Familienpolitik<br />
nicht scheitern. Laut Kieler Institut<br />
für Weltwirtschaft (IfW) unterstützte<br />
der Staat im vergangenen<br />
Jahr Familien mit insgesamt 250<br />
Milliarden Euro – das sind fast elf<br />
Prozent des Bruttoinlandsproduk-<br />
FAMILIENPOLITIK<br />
tes (BIP). Darin eingerechnet ist allerdings<br />
alles, was Familien zugute<br />
kommt – beispielsweise auch öffentliche<br />
Ausgaben für Schulen.<br />
Fast 100 Familienleistungen haben<br />
die Forscher gezählt, die selbstverständlich<br />
zu einem bedeutenden<br />
Teil nach dem Prinzip „linke Tasche,<br />
rechte Tasche“ von Eltern<br />
über Steuern und Abgaben bezahlt<br />
werden. Um diesen Dschungel<br />
zu lichten, schlägt das IfW vor,<br />
die Förderung zu bündeln.<br />
Familienkasse<br />
Diese Idee trägt der Verband der<br />
Alleinerziehenden mit und wirbt<br />
für eine Familienkasse. Die <strong>GEW</strong><br />
tritt dafür ebenfalls ein. Unter deren<br />
Dach könnte der Staat die vielen<br />
Einzelinstrumente zusammenführen.<br />
Und er könnte sie genauer<br />
auf die ausrichten, die es am nötigsten<br />
haben. Dafür fordert der<br />
VAMV eine zweite grundlegende<br />
Reform: eine Grundsicherung für<br />
alle Kinder. 450 Euro solle der<br />
Staat im Monat pro Kind an die<br />
Erziehungsberechtigten zahlen,<br />
unabhängig von deren Einkommen.<br />
Zusätzlich schlägt der Verband<br />
ein Elterngeld vor, das ein<br />
Jahr lang die Aufwendungen und<br />
den Einkommensverzicht der Erziehenden<br />
abgelten solle. Dieses<br />
müsse mindestens 520 Euro für<br />
Nicht-Erwerbstätige betragen und<br />
früher Berufstätigen einen Teil des<br />
Lohnes ersetzen. Finanzieren ließe<br />
sich dieser Radikalumbau laut<br />
VAMV durch eine dreiprozentige<br />
Steuer auf alle Einkünfte und einen<br />
Verzicht auf bisherige Familienleistungen,<br />
an deren Stelle die<br />
Grundsicherung träte. Die steuerlichen<br />
Freibeträge würden nicht<br />
länger benötigt, wenn eine Grundsicherung<br />
das Existenzminimum<br />
abdecke.<br />
Einen weitreichenden Neuanfang<br />
dürfte die große Koalition wohl<br />
kaum wagen. Immerhin will sie<br />
die Familienförderung von ihren<br />
Sparmaßnahmen ausnehmen.<br />
Schon im nächsten Jahr soll das<br />
schwarz-rote Elterngeld starten.<br />
Das sorgt zwar nicht für einen sozialen<br />
Ausgleich, weil es gut verdienende<br />
Paare begünstigt. Aber es<br />
steht zumindest für ein modernes<br />
Familien- und Geschlechterbild.<br />
Auch das ist ein legitimes Ziel<br />
von Familienpolitik: qualifizierte<br />
Frauen in ihrem Kinderwunsch zu<br />
unterstützen. Markus Sievers<br />
E&W 5/<strong>2006</strong> 15