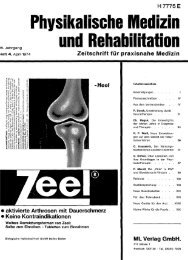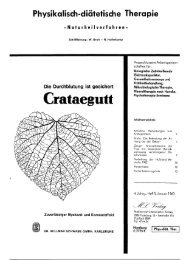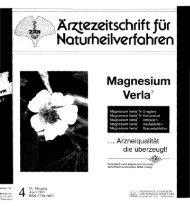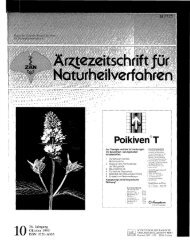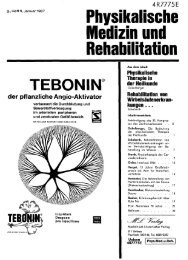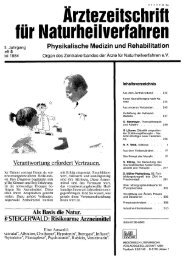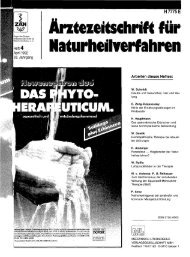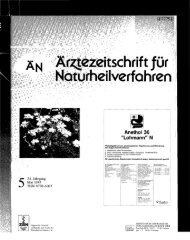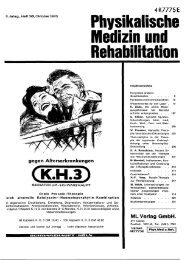ZAEN-Magazin 03-2012 - Zentralverband der Ärzte für ...
ZAEN-Magazin 03-2012 - Zentralverband der Ärzte für ...
ZAEN-Magazin 03-2012 - Zentralverband der Ärzte für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zaenmagazin<br />
ker – und ein Summenindikator <strong>für</strong> eine eventuelle Krankheitsgefährdung.<br />
Die Urin-pH-Messung kann und soll we<strong>der</strong> die Biolektronik<br />
VINCENT noch die Bestimmung <strong>der</strong> Pufferkapazität nach JÖRGEN-<br />
SEN etc. ersetzen. Gegenüber <strong>der</strong> Methode SANDER hat sie aber<br />
eindeutige Vorzüge, u. A. wegen des verschwindend geringen<br />
Aufwandes.<br />
Eine bioelektronische Methode <strong>der</strong> Aziditätsbestimmung<br />
finden Sie im Deco<strong>der</strong>-Dermograph. Er hat zudem den Vorteil,<br />
dass sich aufgrund <strong>der</strong> Lokalisation <strong>der</strong> Aziditätszeichen im Diagramm<br />
feststellen lässt, ob eine Übersäuerung schwerpunktmäßig<br />
ernährungs-stoffwechselbedingt o<strong>der</strong> respiratorisch-bewegungsmangelbedingt<br />
ist.<br />
Die Säureausscheidung im Urin verläuft beim Gesunden in<br />
Form einer doppelgipfligen Kurve, bei <strong>der</strong> die Nachmittagswerte<br />
in den alkalischen Bereich steigen. Die Messungen sollten über<br />
14 Tage bei jedem Wasserlassen erfolgen, damit sich das individuelle<br />
Profil abzeichnet.<br />
In <strong>der</strong> zweiten Phase sollten die Probanden die Kurve durch<br />
Notizen zu Tagesereignissen wie Ernährungsmodifikationen,<br />
Ereignissen im privaten und/o<strong>der</strong> Arbeitsbereich, interkurrenten<br />
Krankheiten etc. ergänzen. Für Fortgeschrittene empfehlen sich<br />
Notizen zur Befindlichkeit.<br />
Eine Patientin war regelmäßig am Wochenende ‚sauer’, so<br />
dass die Vermutung nahe lag, dass ‚hausgemachte’ Probleme<br />
vorlagen. Ihre Säurekurve besserte sich, als sie am Wochenende<br />
häusliche Aufgaben delegierte und zur Jazzgymnastik ging.<br />
Ein Patient kam am Sonntag-Montag nicht in den Neutralbereich,<br />
so dass Antizipation auf die Arbeitssituation als Ursachen<br />
wahrscheinlich war. Seine Befunde besserten sich mit <strong>der</strong><br />
Einübung von Autogenem Training und nach einem Coaching<br />
in Hinblick auf die Beziehung zu seinem Chef.<br />
Im dritten Durchgang können Sie die Probanden allmählich zur<br />
Achtsamkeit hinführen, indem Sie – wie oben bei <strong>der</strong> Gewichtskontrolle<br />
– eine Doppelkurve zeichnen lassen, in <strong>der</strong> die objektiv<br />
gemessenen Werte mit <strong>der</strong> subjektiven Schätzung korreliert<br />
werden.<br />
Praxis / Serie<br />
Das Prinzip des salutogenetischen Vorgehens …<br />
Unabhängig von <strong>der</strong> zugrunde liegenden Krankheit und dem<br />
Krankheitsstadium wird aus <strong>der</strong> Fülle <strong>der</strong> Befindlichkeitsstörungen<br />
und <strong>der</strong> Befunde ein Leitsymptom ausgewählt. Das<br />
macht die Krankheit <strong>für</strong> die Betreffenden handhabbar und<br />
befreit sie von dem Gefühl des Ausgeliefertseins, gibt ihnen<br />
eine Perspektive – selbst wenn diese zunächst nur bis zum<br />
nächsten Tag reicht.<br />
Stagnation und Verschlechterung sind nicht lästige Zeichen<br />
von Wi<strong>der</strong>ständen o<strong>der</strong> gar von Unbehandelbarkeit, son<strong>der</strong>n<br />
sie enthalten wichtige Informationen über noch auszuräumende<br />
Gesundheitshin<strong>der</strong>nisse. Sie sind bedeutsam.<br />
Positive Verän<strong>der</strong>ungen – so klein sie sein mögen – werden<br />
als Verstärker eingesetzt.<br />
Das Prinzip <strong>der</strong> kleinen Schritte als ein wesentliches Element<br />
des therapeutischen Erfolgs ist eins <strong>der</strong> nächsten Themen!<br />
Erst im dritten Schritt wird darauf hin gearbeitet, Zusammenhänge<br />
verständlich zu machen – seien es Zusammenhänge<br />
zwischen Verän<strong>der</strong>ungen des Leitsymptoms und Ereignissen<br />
im Leben <strong>der</strong> PatientInnen und ihren Erlebnissen,<br />
seien es Zusammenhänge zwischen dem Leitsymptom und<br />
<strong>der</strong> zugrunde liegenden Krankheit.<br />
… und sein Rückkopplungskreis<br />
Der adaptive Zirkel <strong>der</strong> Salutogenese besteht aus drei Phasen<br />
(Abb. 4b): Dem Einstieg über ein Leitsymptom und dessen Verän<strong>der</strong>ung<br />
(rot) folgt das Begreifen <strong>der</strong> Bedeutung des Symptoms<br />
und seiner drei möglichen Zustände: Stillstand, Verschlechterung<br />
o<strong>der</strong> Verbesserung (blau). Dadurch wird eine Dynamisierung eines<br />
bis dahin als unverän<strong>der</strong>lich angesehenen Krankheitszustandes<br />
erreicht. Zum Schluss folgt das rationale Durcharbeiten und<br />
Verstehen <strong>der</strong> jeweiligen Möglichkeiten (violett) als Ausgangspunkt<br />
<strong>für</strong> den weiteren Umgang damit (wie<strong>der</strong> rot).<br />
Pathogenetische und salutogenetische Orientierungen führen<br />
zu einem unterschiedlichen Verständnis von Prävention und<br />
Prophylaxe.<br />
Erstere eliminiert o<strong>der</strong> bekämpft Ursachen und Auslöser von<br />
Krankheiten. Wenn das nicht gelingt, empfiehlt sie Karenz<br />
Abb. 4a: ÄrztInnen als Begleiter Abb. 4b: Die salutogenetische Trias<br />
8 3/<strong>2012</strong>