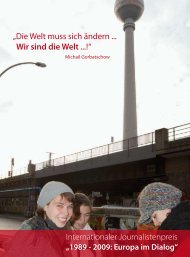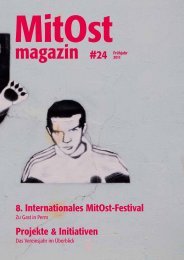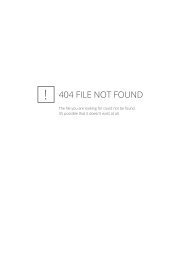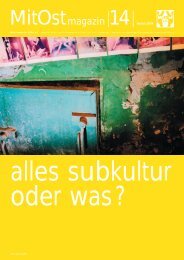PDF - MitOst e.V.
PDF - MitOst e.V.
PDF - MitOst e.V.
- TAGS
- mitost
- mitost.org
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>MitOst</strong><br />
Magazin für Mitglieder, Freunde und Förderer<br />
Essay: Wie beschreibt man ein Land? (Seite 6)<br />
Über die Arbeit von <strong>MitOst</strong> e.V. im Jahr 2021(Seite 16)<br />
Interview: Greencard in Deutschland (Seite 20)<br />
Sonderseiten: 5 Jahre <strong>MitOst</strong> (Seiten 22–29)<br />
Suche nach dem „Unnormalen“: Novi Sad (Seite 33)<br />
Mitteilungen des <strong>MitOst</strong> e.V. – Verein für Sprach- und Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001
EDITORIAL<br />
Liebe <strong>MitOst</strong>-Mitglieder,<br />
liebe Freunde und Förderer,<br />
www.mitost.de Inhalt<br />
Annette Kraus<br />
Gereon Schuch<br />
Waldemar Czachur<br />
Nina Wendt<br />
Alexandra Zander<br />
es freut uns sehr, dass wir zum fünfjährigen Jubiläum unseres <strong>MitOst</strong>-Vereins diese<br />
neu gestaltete Sonderausgabe des <strong>MitOst</strong>-Magazins vorstellen können. Wir waren<br />
der Ansicht, dass ein solcher Geburtstag durchaus Anlass sein sollte, auf die Arbeit<br />
und das Erreichte der vergangenen fünf Jahre zurückzublicken.<br />
Aus diesem Grund enthält diese Jubiläumsausgabe nicht nur Beiträge über die<br />
aktuellen <strong>MitOst</strong>-Projekte des Jahres 2001, sondern auch eine rückblickende<br />
Zusammenfassung der bisherigen Vereinsarbeit. Hierzu werden einige Ausschnitte<br />
aus den bisher erschienenen sieben <strong>MitOst</strong>-Magazinen vorgestellt. Zudem findet sich<br />
noch allerlei Interessantes zur Entwicklung des Vereins seit seiner Gründung 1996.<br />
Wir möchten damit einen Einblick in das geben, was <strong>MitOst</strong> in den vergangenen<br />
fünf Jahren erreicht und bewirkt hat. Betrachtet man insbesondere die Projekte, die<br />
in dieser Zeit von den unterschiedlichsten Projektgruppen mit den verschiedensten<br />
Teilnehmern in vielen Ländern Ost-, Mittel- und Südosteuropas durchgeführt wurden,<br />
so sind das ganz sicher fünf erfolgreiche Jahre gewesen !<br />
Viel Spaß beim Lesen wünschen<br />
der Vorstand<br />
Annette Kraus, Gereon Schuch<br />
Waldemar Czachur, Nina Wendt,<br />
Alexandra Zander<br />
November 2001<br />
und das Redaktionsteam<br />
Robert Sobotta, Susanne Töpfer<br />
Impressum<br />
Inhalt<br />
<strong>MitOst</strong>-Magazin<br />
Heft Nr.8 | November 2001<br />
Herausgeber:<br />
<strong>MitOst</strong> e.V.<br />
Verein für Sprach- und Kulturaustausch in Mittel-,<br />
Ost- und Südosteuropa, gegründet von ehemaligen<br />
Stipendiaten der Robert Bosch Stiftung<br />
www.mitost.de<br />
Verantwortlich:<br />
Annette Kraus<br />
Pücklerstraße 51<br />
D-10997 Berlin<br />
Tel./Fax +49-(0)30-695 345 11<br />
vorstand.mitost@gmx.net<br />
Projektleitung, Redaktion:<br />
Robert m. Sobotta<br />
robertsobotta@excite.com<br />
Lektorat:<br />
Alexandra Zander, Dorothea Leonhardt, Nina Wendt<br />
Titelfoto:<br />
„Bahnsteig in Europa…“, 2001, Robert m. Sobotta<br />
Fotos S. 17, 34, 36: „Menschen in Osteuropa“,<br />
© Steffen Giersch, Dresden<br />
Gestaltung:<br />
Susanne Töpfer, Grafik-Design, Dresden<br />
Tel: +49-(0)351-310 22 60<br />
sus.t@t-online.de<br />
Preis:<br />
Unentgeltlich für Mitglieder<br />
Spenden von Freunden und Förderern willkommen<br />
Auflage:<br />
2.500 Exemplare<br />
Wir danken der Robert Bosch Stiftung für die<br />
Unterstützung<br />
INHALT<br />
Grußworte - H. Maier: Wie schnell die Zeit vergeht 4<br />
- J. Rogall: <strong>MitOst</strong> aus der Sicht der Robert Bosch Stiftung 5<br />
Essay - Wie beschreibt man ein Land?<br />
Eine neue Perspektive für die Landeskunde 6<br />
Projekte 2001 - Lese- und Begegnungsreise mit der Lyrikerin Zehra Çirak<br />
und dem Objektkünstler Jürgen Walter im Baltikum<br />
- „Wir sind jung - Junge machen Zukunft“: Seminar in<br />
8<br />
Chelm/Polen<br />
- Deutschunterricht und Theater: Workshop in<br />
14<br />
Sudak, Krim/Ukraine 15<br />
- Studienfahrt Rheinland 18<br />
- Menschenbild: 2. <strong>MitOst</strong>-Forum Philosophie in Slubice/Polen 30<br />
- Studienreise Novi Sad/Jugoslawien 33<br />
Deutschland-Russland - Über eine größer werdende Distanz: Schüler von der mittleren<br />
Wolga über deutsch-russische Beziehungen 12<br />
- Interview: Greencard in Deutschland 20<br />
Zukunft des Vereins - Über die Arbeit von <strong>MitOst</strong> e.V. im Jahr 2021 16<br />
5 Jahre <strong>MitOst</strong> - 5 Jahre Kultur und Begegnung in Mittel-, Ost- und<br />
Südosteuropa 22<br />
- Überblick: 41 Projekte in 5 Jahren 23<br />
- Gründungsmythos: Glückwünsche zum Kindergeburtstag 24<br />
- Das Beste aus 5 Jahren <strong>MitOst</strong>-Magazin 26<br />
- Zahlen und Fakten 29/39<br />
Theodor-Heuss-Kolleg - Das Theodor-Heuss-Kolleg: Wer, wenn nicht Du? 34<br />
- „Ich schenke Dir mein Lächeln“: Ein Projekt des Theodor-<br />
Heuss-Kollegs für Litauen 35<br />
- „die spinne“: Das neue Online-Magazin 35<br />
Umfrage - Warum bist Du/sind Sie <strong>MitOst</strong>-Mitglied? 36<br />
Buch-Tipps - Wladimir Kaminer: „Russendisko“ 37<br />
- Friedrich Gorenstein: „Malen wie die Vögel singen“ 37<br />
- Thomas Brussig: „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ 38<br />
Dank - Dank für die Unterstützung des Vereins 39<br />
Dichtung - Lyrik von Wjatscheslaw Kuprijanow 40<br />
Anmerkung: Einige Texte sind in der originalen Orthographie von Autoren aus<br />
Ländern in Mittel-Ost-Europa wiedergegeben. Eingesandte Artikel in alter<br />
Rechtschreibung wurden bewusst nicht redigiert. Die Redaktion bemühte sich um<br />
die neue Rechtschreibung.
4<br />
GRUSSWORT<br />
Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Maier<br />
<strong>MitOst</strong>-Mitglied<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Wie rasch die Zeit vergeht:<br />
Nun ist <strong>MitOst</strong> auch schon fünf Jahre alt! Kein<br />
Jubiläum gewiß, kein „großer Geburtstag“ –<br />
aber doch ein Zeichen, dass sich etwas<br />
bewährt und gefestigt hat und weiterentwickelt.<br />
<strong>MitOst</strong> ist aus dem Lektorenprogramm der Robert Bosch Stiftung<br />
für Mittel- und Osteuropa hervorgewachsen, aus einer Initiative von<br />
jungen Ehemaligen, die als Deutschlektoren nach 1990 ins freie,<br />
aber verarmte, an nicht wenigen Stellen sogar chaotische Osteuropa<br />
gingen, um Erfahrungen zu sammeln und zu helfen. Der unge-<br />
wohnte, manchmal jähe Austausch mit einer bis dahin verschlosse-<br />
nen Welt hinterließ einen Impuls: es muß weitergehen „mit Ost“,<br />
mit dem östlichen Teil Europas; die reichen (und befriedeten) West-<br />
europäer dürfen den östlichen Teil des Kontinents nicht allein las-<br />
sen. Es gilt miteinander zu sprechen, sich kennenzulernen, sich bes-<br />
ser zu verstehen, ein Stück Gemeinsamkeit aufzubauen; und wer<br />
könnte das besser als die Jungen?<br />
Ich wünsche <strong>MitOst</strong> auch in den kommenden Jahren Unterneh-<br />
mungsgeist, ein wenig Abenteuerlust, dankbare Rückschau auf<br />
Geleistetes und viel Neugier auf neue Taten!<br />
München, den 20. 07. 2001<br />
<strong>MitOst</strong> aus der Sicht der Robert Bosch Stiftung<br />
Dr. phil. habil. Joachim Rogall<br />
GRUSSWORT<br />
Als ich im Frühjahr 1996 im Referat für Völkerverständigung der Robert Bosch Stiftung die Zuständigkeit für die Förderung in<br />
Mittel- und Osteuropa übernahm, bestand das „Tutorenprogramm zur Förderung der deutschen Sprache und Landeskunde<br />
an Hochschulen in Mittel- und Osteuropa“ bereits seit drei Jahren. Um die Erfahrungen der bisherigen Teilnehmer für die<br />
Weiterentwicklung zu nutzen, wurde für 1996 ein Bilanztreffen der ersten drei Jahrgänge angesetzt. Mit Sabine Krüger, der<br />
für das Programm zuständigen Mitarbeiterin, wurde überlegt, ob analog zum Stiftungsprogramm für amerikanischen<br />
Führungsnachwuchs (Fellowship-Programm) die Gründung einer Alumni-Organisation angeregt werden könnte. In den USA<br />
sind Ehemaligenvereinigungen keine Seltenheit, jede Universität und jedes Stipendienprogramm, das auf sich hält, pflegt<br />
Kontakte mit den Alumni. In Deutschland dagegen gab es nur wenige Vorbilder für ein entsprechendes Netzwerk.<br />
Das Bilanztreffen fand im Oktober 1996 statt, ein Großteil<br />
der Ehemaligen war gekommen, es gab vielfältige Anregungen<br />
(u.a. zur Umbenennung in Lektorenprogramm), und die von Sabine<br />
Krüger behutsam eingebrachte Idee einer Ehemaligenvereinigung<br />
wurde positiv aufgenommen. Sicherlich spielte es eine große Rolle,<br />
daß Sabine Krüger als „Lektorenmutter“ ein besonderer Glücksfall<br />
war und durch ihre starke Integrationsfähigkeit schon während des<br />
Stipendienjahres ein Gemeinschaftsgefühl unter den Lektoren geschaffen<br />
hatte. Daß sich eine Reihe von Ehemaligen bereit fanden,<br />
einen richtigen Verein zu gründen und Ämter in dem neugegründeten<br />
„<strong>MitOst</strong>-Verein“ zu übernehmen, war durchaus ungewöhnlich.<br />
Aus Sicht der Stiftung war dies ein mehrfacher Erfolg. Zum einen<br />
war der Samen, den die Stiftung mit der Verleihung der Stipendien<br />
gestreut hatte, offensichtlich aufgegangen und begann, Früchte zu<br />
tragen. Bei den Ehemaligen entwickelte sich ein dauerhaftes<br />
Interesse an Mittel- und Osteuropa (MOE). Da <strong>MitOst</strong> ausschließlich<br />
ehrenamtlich arbeitete, war der Verein auch ein schönes Beispiel für<br />
das von der Stiftung geförderte ehrenamtliche Engagement. Und<br />
schließlich ermöglichte der <strong>MitOst</strong>-Verein es der Stiftung, den Kontakt<br />
zu den Ehemaligen zu halten und durch sie weitere Projekte in<br />
MOE zu fördern, ein Netzwerk aufzubauen, wie es in dieser Form<br />
keine andere Stiftung besaß.<br />
Die Aktivitäten von <strong>MitOst</strong> waren von Beginn an sehr beachtlich.<br />
Gleich im ersten Jahr beantragte der Vorstand bei der Stiftung die<br />
Unterstützung zahlreicher Projekte. Der Anteil der Stiftungsförderung<br />
am Gesamtbudget von <strong>MitOst</strong> sank von anfänglich 80 Prozent kontinuierlich<br />
bis auf etwas über 50 Prozent. Gleichzeitig wurde der<br />
Verein durch das Einwerben von Drittmitteln „professioneller“ und<br />
baute Kontakte in andere Bereiche auf. Zu den Mitgliedern gehörten<br />
neben dem harten Kern der „Boschewiken“ bald auch ehemalige<br />
DAAD- und IfA-Mitarbeiter sowie Studenten und Partner von <strong>MitOst</strong><br />
aus den MOE-Ländern, darunter auch einige ehemalige Teilnehmer<br />
des Tutorenprogramms zur Förderung der amerikanischen, französischen,<br />
polnischen und tschechischen Sprache und Landeskunde<br />
an Hochschulen in Deutschland, dem Komplementärprogramm zu<br />
den MOE-Lektoren.<br />
Die <strong>MitOst</strong>-Aktivitäten ergänzten die Stiftungsprogramme in MOE in<br />
idealer Weise. Hinzu kam, daß sie durch ihre Einbeziehung der aktiven<br />
Lektoren deren Arbeit in MOE positiv beeinflußten. Es war nicht<br />
zuletzt diese gemeinsame Projektarbeit, welche das Lektorenprogramm<br />
in seiner Weiterentwicklung entscheidend geprägt hat. Die<br />
Stiftung versucht heute alle Lektoren zu entsprechenden Initiativen<br />
zu ermuntern und kann auf <strong>MitOst</strong> als geeigneten Partner verweisen.<br />
Eine Qualitätssteigerung bei der Bewerberauswahl wurde durch die<br />
Beteiligung von <strong>MitOst</strong> im Auswahlgremium erreicht.<br />
Der erhoffte „positive Seilschaftseffekt“ bei der beruflichen<br />
Weiterentwicklung der Stipendiaten stellte sich naturgemäß nicht<br />
sofort und nicht in der erwünschten Größenordnung ein, da nur<br />
wenige Ehemalige in ihrer Anschlussbeschäftigung rasch in<br />
Personalverantwortung kamen und auch in der Stiftung nur wenige<br />
Plätze für Praktika oder Festanstellungen zur Verfügung standen. Das<br />
2001 fertiggestellte Verzeichnis der Ehemaligen zeigt aber eindrucksvoll,<br />
welches Potential mit hoher MOE-Kompetenz hier bei<br />
den ehemaligen Lektoren vorhanden ist.<br />
Sicherlich werden manche neue Lektoren bei ihrem beruflichen<br />
Anschluß nach dem Lektorat von den Kontakten der Ehemaligen<br />
profitieren.<br />
Hervorzuheben ist, daß aus <strong>MitOst</strong>-Aktivitäten, nämlich den Kreisau-<br />
Seminaren für Studenten aus MOE, ein neues Stiftungsprogramm<br />
entwickelt werden konnte: das Theodor-Heuss-Kolleg. Die Entwicklung<br />
des Programms wurde innerhalb eines halben Jahres von<br />
<strong>MitOst</strong>-Mitgliedern zusammen mit der Stiftung durchgeführt. Die<br />
Erfahrungen von <strong>MitOst</strong> konnten hier in besonderer Weise genutzt<br />
werden, um den Entstehungsprozeß eines neuen Stiftungsprogramms<br />
zu beschleunigen.<br />
So stellt sich aus Sicht der Robert Bosch Stiftung die fünfjährige<br />
Geschichte des <strong>MitOst</strong>-Vereins als eindeutige Erfolgsgeschichte dar.<br />
Den runden Geburtstag nehme ich zum Anlaß, den <strong>MitOst</strong>-<br />
Mitgliedern meine Hochachtung für Ihre Arbeit auszusprechen, für<br />
die gute Zusammenarbeit zu danken und der Hoffnung Ausdruck zu<br />
geben, daß sich diese gute Zusammenarbeit auch in den kommenden<br />
Jahren fortsetzen möge.<br />
Ad multos annos, <strong>MitOst</strong>!<br />
Joachim Rogall (Stuttgart, Sommer 2001)<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
5
6<br />
ESSAY<br />
Prof. Dr. Hansjörg Küster,<br />
(Hannover/Deutschland)<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Wie beschreibt man ein Land?<br />
Eine neue Perspektive für die Landeskunde<br />
Foto: Robert m. Sobotta<br />
Blick aus dem Bus<br />
Studienreise Novi Sad/Jugoslawien<br />
(siehe S. 33), Ausflug „Fruska Góra“,<br />
12. Mai 2001<br />
Wer eine Sprache lernt, möchte sich nicht nur in einem anderen Land verständigen<br />
können; er sucht auch Informationen über Land und Leute, Kultur und Sitten. In diesem<br />
Bewusstsein sind die Texte in den Sprachlehrbüchern geschrieben, sogar diejenigen<br />
für die Anfänger: Sie spielen, mehr oder weniger stark angefüllt mit<br />
Klischeevorstellungen, im "Land der Sprache".<br />
Zu einem Sprachenstudium an den Universitäten gehören landeskundliche Lehrveranstaltungen<br />
Dort wird das Wissen vermittelt, das als Hintergrundinformation an Schüler weitergegeben werden kann.<br />
Man lernt nicht nur Englisch oder Polnisch, sondern man will auch etwas über England oder Polen wissen, wenn man<br />
sich mit der Sprache beschäftigt, und zwar auf jeder Ebene des Sprachenlernens.<br />
Landeskundliche Lehrveranstaltungen werden meistens von Dozenten geleitet, die selbst auch die Sprache des<br />
Landes studiert haben und die zum Studium gehörenden landeskundlichen Lehrveranstaltungen gehört haben. Die<br />
Landeskunde Polens wird von einem Polonisten dargestellt, die deutsche Landeskunde von einem Germanisten, die<br />
französische von einem Romanisten. Der Polonist ist also nicht nur der Experte für die Sprache, sondern auch derjenige,<br />
der in das Land Polen einführt, und der Germanist tritt als Botschafter auf, der darstellt, was Deutschland ist. In<br />
der fachlichen Tradition haben dabei einige Aspekte in der Landeskunde besondere Bedeutung erhalten, vor allem die<br />
Kultur des Landes (womit nach älterer Diktion vor allem die "Sitten des Landes" gemeint sind), die Geschichte, Politik<br />
und das tägliche Leben. Geographische Fakten ergänzen das Lehrgebäude; dabei werden aber allenfalls die Gebirge,<br />
Flüsse, Meere usw. schematisch aufgezählt und statistische Angaben vermittelt, also Fläche des Landes, seine<br />
Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte usw.<br />
Die Natur des Landes, seine dadurch bestimmte besondere Eigenheit oder Identität und, wenn man so will,<br />
der Genius loci, der die Sitten des Landes determinierte, kommen eher seltener zur Sprache. Viele Philologen interessieren<br />
sich dafür, aber es ist kaum möglich, sich die notwendigen Daten zur Landesnatur aus dem weit verstreuten<br />
geographischen, geologischen, meereskundlichen und biologischen Schrifttum zusammenzusuchen; die notwendigen<br />
Zusammenhänge zwischen einzelnen Phänomenen werden von den beschreibenden Naturwissenschaftlern zu selten<br />
dargestellt, wenn sie denn überhaupt schon erkannt sind.<br />
Naturräumliche Grundlagen bestimmen das Leben der Menschen, die in einem Land leben, in besonderer Weise. Sie<br />
gehören daher zu den besonders wichtigen Inhalten einer Landeskunde, werden aber häufig zu wenig beachtet, wenn<br />
sich Philologen damit befassen. Natürlich könnten sich auch beispielsweise Geographen mit Landeskunde beschäftigen,<br />
von denen dann aber möglicherweise die kulturellen Inhalte des Fachgebietes vernachlässigt werden.<br />
Für den Charakter eines Landes ist es zum Beispiel entscheidend, ob dort vor allem Laub- oder Nadelbäume vorkommen.<br />
Sie schaffen unterschiedliche Bedingungen für das Leben von Menschen, und die Wälder, die aus bestimmten<br />
Bäumen bestehen, lassen sich in völlig verschiedener Weise nutzen. Besonders viel Gerbstoff enthalten die<br />
Eichen, deren Holz daher zum Bau von Häusern und Schiffsrümpfen besonders begehrt ist; aus diesem Holz kann<br />
man auch Gerberlohe zum Haltbarmachen von Leder gewinnen. Für die Gewinnung von Terpentin und Pech muss<br />
man Kiefernstämme anritzen. Beim Verbrennen von Buchenholzkohle entstehen besonders hohe Temperaturen,<br />
warum man gerade dieses Brennmaterial bevorzugt verwendet, wenn Erz oder Glas geschmolzen und Kalk gebrannt<br />
werden soll. Nadelholz hat ein geringes spezifisches Gewicht und lässt sich daher besonders gut flößen: Kriegsschiffe<br />
mit Masten aus Nadelholz sind leichter als diejenigen, die ausschließlich aus dem schwereren Eichenholz gebaut sind.<br />
Wald ist nicht gleich Wald, er wirkt unterschiedlich auf die Menschen, die in ihm wohnen, und er lässt sich in unterschiedlicher<br />
Weise nutzen.<br />
Entsprechend ist Fluss nicht gleich Fluss: Der eine hat ein großes Gefälle, daher eine starke Strömung und eine tiefe<br />
Fahrrinne, der andere fließt träge daher und ist nur flach, tritt er aber über die Ufer, dauert es sehr lange, bis das<br />
Wasser wieder abgelaufen ist, und seine Eisdecke hält lange.<br />
Meer ist nicht gleich Meer: Das eine hat Salzwasser, so dass sich Salz gewinnen lässt und Fische des Salzwassers darin<br />
vorkommen, das andere enthält Süßwasser mit einer anderen Fauna, in dem einen Meer gibt es Ebbe und Flut, in<br />
dem anderen nicht, das eine Meer ist lange zugefroren, das andere nicht. Völlig verschieden sind die Charaktere der<br />
Gebirge: Das eine besteht aus Sandstein, das andere aus Kalk, so dass jeweils andere Rohstoffe und unterschiedliche<br />
Baumaterialien zur Verfügung stehen, das eine hat schroffe Felsen, das andere schwach geneigte Hänge mit weiten<br />
Hochflächen.<br />
Es gibt Gebiete, in denen das Gras das ganze Jahr über wächst, so dass das Vieh stets Nahrung findet. Anderswo muss<br />
Gras oder Laub geschnitten und getrocknet werden, damit es Heu als Winterfutter gibt. Oder die Hirten müssen mit<br />
ihren Herden im Lauf des Jahres in immer wieder andere Weidegründe ziehen: Dies ist die Ursache für Transhumanz,<br />
das regelmäßige Aufsuchen von zum Teil weit auseinander liegenden Sommer- und Winterweiden.<br />
Diese Charakteristika eines Landes sind grundlegend für seine wirtschaftliche Stellung, und es ist klar, dass auch die<br />
Mythen, Märchen und Geschichten, die innerhalb eines Sprachraumes erzählt werden, von diesen Charakteristika der<br />
Natur bestimmt sind. Von Wölfen und Störchen kann nur dort die Rede sein, wo es diese Tiere gibt. Nur dort erzählt<br />
man sich eine Sage über den Untergang von Siedlungen im Meer, wo der Meeresspiegel tatsächlich anstieg, beispielsweise<br />
an der südlichen Ostseeküste oder am Schwarzen Meer. Die Roggenmuhme kann nur dort ein Kleinkinderschreck<br />
sein, wo Roggen angebaut wird.<br />
Man kann die Mythen, die immer wieder zum Stoff der Literatur wurden, selbstverständlich erzählen, ohne ihren möglichen<br />
Ursprung erklären zu können: Die Geschichte von der Loreley ist schön, aber es wäre gerade in der heutigen<br />
Zeit wichtig, darauf hinzuweisen, dass in der Nähe dieses so genannten Felsens der Rhein enge Biegungen hat und<br />
über Klippen strömte, die erst vor Jahrzehnten beseitigt wurden: Im Mittelalter war die Vorbeifahrt an der Loreley<br />
besonders gefährlich.<br />
Wir brauchen eine bessere Aufbereitung naturwissenschaftlicher Grundlagen zur Landeskunde<br />
Wir brauchen aber auch Experten, die nicht nur in Sprache, Kultur und Geschichte eines Landes, sondern<br />
auch in seine Natur einführen. Sie sollen das Charakteristische der Karpaten erklären können wie den borealen<br />
Nadelwald, die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee und warum der Don so still ist.<br />
Wer sich mit Landeskunde befasst, das Gebiet lehrt und lernt, sollte sich auf alle diese Erfordernisse einstellen können.<br />
Das Fachgebiet braucht eine Erweiterung und eine neue Perspektive aus den beschreibenden Naturwissenschaften,<br />
aus Geologie, Geographie, Klimatologie, Biologie und Ökologie, damit umfassend über ein Land und seine Kultur<br />
unterrichtet wird.<br />
Hierfür müsste ein neues Curriculum entwickelt werden, vielleicht an einer Universität, vielleicht aber auch im Rahmen<br />
eines außeruniversitären Seminarprogrammes, das man unter das elementare Thema stellen könnte: „Wie beschreibt<br />
man ein Land?" Dieses Thema sollte auch in speziellen Lehrbüchern behandelt werden. Ein normaler Reiseführer<br />
reicht dafür nicht aus; es muss uns darum gehen, klarzustellen, was Polen, Estland, Österreich oder Rumänien umfassend<br />
auszeichnet, bevor – sieht man einmal von ein wenig Folklore ab – deren landschaftliche und kulturelle<br />
Identitäten in einem einheitlichen Europa aufgehen, dabei aber auch unerkannt nivelliert werden und untergehen können.<br />
Ein geeintes Europa soll ein Europa der Regionen sein. Dieser Wunsch kann nur in Erfüllung gehen, wenn wir<br />
das Charakteristische jeder Region kennen und wenn jede europäische Kultur bei der Integration Europas ihren<br />
erkennbaren Anteil hat. Dazu kann eine neue Form von Landeskunde einen wichtigen Beitrag leisten.<br />
ESSAY<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001 7
8<br />
PROJEKTE 2001<br />
Lese- und Begegnungsreise mit der Lyrikerin<br />
Zehra Çirak und dem Objektkünstler Jürgen Walter<br />
in Litauen und Lettland<br />
02. – 08. Mai 2001<br />
Landung mit Hindernissen<br />
Ein stechender Schmerz – das war wohl das Erste, was Zehra Çirak empfand, als sie an einem Mainachmittag in<br />
Vilnius/Litauen aus dem Flugzeug stieg. Ein Backenzahn war ihr eine Woche vor ihrer Abreise gezogen worden, nun<br />
schmerzten die Lücke und der Nachbarzahn und machten das Reisen zum Wagnis. Zehra stand etwas blass neben<br />
ihrem Mann Jürgen Walter, als ich die beiden am Flughafen in Empfang nahm, aber sie schien fest entschlossen, „die<br />
Zähne zusammenzubeißen“ und sich die mit Spannung erwartete Baltikumreise (das Ehepaar besuchte Litauen und<br />
Lettland zum ersten Mal, war zuvor nur bis Warschau gekommen) nicht verderben zu lassen. „Jetzt schauen wir uns<br />
erst einmal um!“ – entschied sie noch, und los ging es durch die schöne Vilniusser Altstadt im Abendlicht. Beeindruckt<br />
war die 1961 in Istanbul geborene, in Karlsruhe aufgewachsene und heute mit ihrem deutschen Mann in Berlin lebende<br />
Lyrikerin, die gerade im Februar in München für ihr Werk mit dem diesjährigen Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet<br />
worden war, vor allem von dem „multikulturellen“ Flair der litauischen Hauptstadt mit dem südlichen<br />
Barock-Ambiente und den vielen verschiedenen Kirchen und Glaubensrichtungen, die hier dicht beeinander existieren.<br />
Als Experten für das „Leben zwischen den Kulturen“ hielt es das Künstlerpaar für angebracht, sicherheitshalber an<br />
allen heiligen Stätten für schnelle Heilung des Zahnes und Linderung der Schmerzen zu bitten, sowohl bei der<br />
„Schwarzen Madonna“ im Tor der Morgenröte, als auch in der russisch-orthodoxen Heiliggeistkirche, beim litauischen<br />
Nationalheiligen Kasimir und sogar in einer alten griechisch-orthodoxen Kirche. Unerschrocken genossen die beiden<br />
anschließend die litauische Küche, wogegen allerdings Çiraks wunde Zahnlücke heftig protestierte.<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Myriam Geiser, (Kaunus/Litauen) Fotos: Archiv Myriam Geiser<br />
Abschiedsbild vor der Galerie<br />
(Mitte: Stephanie Grimm,<br />
Myriam Geiser)<br />
Start in Kaunas<br />
Kaunas war die erste Station der Tournee. Hier sollte die audiovisuelle Performance mit dem<br />
Titel „Höhenflug“ zum ersten Mal aufgeführt werden. Die Veranstaltung am 3. Mai bildete zugleich<br />
den Auftakt der Kaunasser Kulturtage „Kultur im Mai aus Deutschland und der Schweiz“<br />
mit festlichem Rahmen in M. Zilinskas Kunstgalerie. Der Tag begann allerdings zunächst mit<br />
einer Tour durch litauische Zahnkliniken. Erst nachdem Antiobiotika und Schmerzmittel verschrieben<br />
und die Lage von einem energischen Zahnchirurgen notdürftig für stabil erklärt worden<br />
war, konnten sich die beiden Künstler auf ihren Auftritt vorbereiten. Nach Ansprachen von<br />
Vertretern der verschiedenen Kulturmittlerorganisationen, der Veranstalter und des Bürgermeisters<br />
der Stadt Kaunas, und nach einem Abstecher der Gäste zum kalten Büfett wurde es ernst:<br />
Über 150 neugierige Zuschauer versammelten sich im verdunkelten Saal und warteten<br />
gespannt, was sich hinter ihren Köpfen ereignen und vor ihnen auf der Leinwand sichtbar werden<br />
würde. An der Rückwand des Saales saß Zehra Çirak mit ihren Texten, vor ihr die<br />
Musikanlage, neben ihr die litauische Übersetzerin Kristina Sprindzinnaite. Hinter einem eigens<br />
dafür konstruierten Gestell mit einem Spezial – Diaprojektor stand Jürgen Walter, bereit, auf<br />
das Startknöpfchen zu drücken. Und dann hieß es nur noch: „Guten Flug!“.<br />
Interkulturelles Experiment<br />
Wie’s aussieht, sind alle zufrieden<br />
PROJEKTE 2001<br />
Zehra Çirak, Jürgen Walter in<br />
Kaunas/Litauen in M. Zilinskas<br />
Kunstgalerie<br />
Die Performance von Çirak und Walter ist das Ergebnis einer ungewöhnlichen Lebens- und<br />
Künstlergemeinschaft. Zu Bildern von Plastiken des Objektkünstlers Jürgen Walter, die auf die Leinwand<br />
projiziert werden, liest Zehra Çirak ihre Gedichte. Dazwischen erklingen Geräusche und Musik. Alles<br />
zusammen handelt vom universellen Traum des Menschen vom Fliegen – ein uraltes Thema, das die beiden<br />
Künstler in ihren Werken immer wieder aufs Neue variieren.<br />
Dieses künstlerische Konzept hatte uns Veranstalter auch zu dem Experiment ermutigt, auf diese Weise das<br />
litauische und lettische Publikum mit den Phänomenen „multikulturelle Gesellschaft“ und „interkulturelle“<br />
Gegenwartsliteratur in Deutschland zu konfrontieren. Es sollte keine klassische Lesereise eines Vertreters<br />
der aktuellen sogenannten Migrantenliteratur mit anschließender Diskussion der Texte und ihrer Inhalte<br />
werden, sondern eine Begegnung mit einem real existierenden deutsch-türkischen Künstlerpaar, das die<br />
unterschiedlichen kulturellen Hintergründe in sein Schaffen integriert und zu einer gemeinsamen<br />
Formensprache vereinigt. Das Motiv der „Sehnsucht nach dem Fliegen“ bildet dabei einen allgemeinmenschlichen<br />
Bezugspunkt, der für Zuhörer/Zuschauer jeder Herkunft leicht zugänglich ist. Die Aspekte<br />
Migration und Kulturenkontakt werden durch die Biographie der Autorin und durch die Lebensgemeinschaft<br />
der beiden Künstler anschaulich. Und mit der aktuellen Chamisso-Preisträgerin konnten wir nicht<br />
zuletzt auch eine der wichtigsten Gegenwartslyrikerinnen deutscher Sprache als Gast präsentieren.<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
9
10<br />
PROJEKTE 2001<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Fluggäste<br />
Abschiedsfoto vor dem Hotel „Prusija“ – nun geht die Fahrt<br />
weiter im Auto des Mitarbeiters der Deutschen Botschaft,<br />
Carsten Schneider (re.), nach Liepaja und Daugavpils in Lettland<br />
Um einem möglichst breiten Publikum die Performance auch sprachlich zugänglich zu<br />
machen, wurden sowohl in Litauen als auch in Lettland eine Auswahl der Gedichte übersetzt<br />
und während der Veranstaltung eingesprochen. Dies ergab dann auch jeweils einen ganz eigenen<br />
klanglichen Reiz, und es war vor allem für Zehra Çirak selbst eine aparte Erfahrung, ihre<br />
eigenen Werke in der fremden Sprache erklingen zu hören.<br />
Wesentlich für die Veranstaltung in Kaunas wie auch für die weiteren drei anschließenden<br />
Auftritte im Baltikum war das (mit Hilfe der Übersetzer geführte) Gespräch mit dem Publikum<br />
nach der Performance. Hier ließen sich Zehra Çirak und Jürgen Walter sogar gerne zu ihrem<br />
Zusammenleben und- arbeiten befragen. Offen und witzig berichteten beide über ihre gemeinsame<br />
Geschichte und den künstlerischen Prozess. Da kam es dann zu so entwaffnend<br />
evidenten Aussagen wie: „Wie kamen Sie auf die Idee, als Lyrikerin und Bildhauer zusammen<br />
zu arbeiten? – Weil wir uns lieben!“ Oder: „Unsere Ehe hat wie jede andere auch Phasen, in<br />
denen man sich gut verträgt und andere, in denen man sich lieber aus dem Weg gehen möchte.<br />
Wenn wir uns nicht vertragen, gehen wir auf Tournee!“ In Kaunas und auch in Klaipeda<br />
waren für interessierte Teilnehmer im Vorfeld der Veranstaltungen Vorbereitungsseminare<br />
zum Thema Migrantenliteratur und zu Person und Werk Zehra Çiraks angeboten worden, in<br />
Klaipeda geleitet von meinem Kollegen Heiko Stern, in Kaunas von mir selbst. In Lettland hatten<br />
die am Projekt beteiligten DAAD-Lektoren Markus Lux und Gotthard List mit ihren<br />
StudentInnen an den Übersetzungen der Gedichte gearbeitet. Auf diese Weise war ein Teil des<br />
Publikums bereits besonders gut mit dem Thema bzw. dem Werk vertraut und konnte auch<br />
gezielte Fragen stellen. Und den beiden Künstlern machte das Gespräch mit ihren Zuschauern<br />
sichtlich Spaß. Im Rückblick nannten sie als größtes Erlebnis ihren Auftritt in Liepaja, wo ein<br />
Großteil des Publikums aus Kindern bestand – die Neugier,<br />
Ernsthaftigkeit und Begeisterung, mit der sich die jungen<br />
Zuschauer auf die doch nicht ganz leicht rezipierbaren<br />
Texte und Bilder einließen, beeindruckte vor allem Jürgen<br />
Walter, der sich bisher noch selten mit Zuschauern dieser<br />
Altersgruppe konfrontiert sah.<br />
Zunächst heißt es: „Das Büfett<br />
ist eröffnet!“<br />
Leibesübungen<br />
So heißt der aktuelle Gedichtband von Zehra Çirak, und dieser Titel lässt sich ebenfalls gut als Motto für ihre Tournee<br />
durch die litauische und lettische „Provinz“ verwenden. Vier Auftritte in fünf Tagen, dazwischen gab es einen „freien Tag“<br />
mit Besichtigungsprogramm in Riga, um den Gästen die heimliche Hauptstadt des Baltikums nicht vorzuenthalten. Die<br />
Veranstaltungen hatten wir allerdings bewusst alle in den zweiten und dritten Städten der beiden Länder stattfinden<br />
lassen, die bei durchziehenden internationalen Künstlern sonst so gerne übersprungen werden. Uns war es wichtig,<br />
dass gerade hier, in unseren jeweiligen „Einsatzorten“, für das interessierte Publikum ein deutsches Kulturprogramm<br />
der besonderen Art angeboten wird. Und die Künstler waren damit auf Anhieb einverstanden. Die einzelnen Stationen<br />
der Tour boten dann jeweils auch ganz unterschiedliche Erfahrungen und Eindrücke. Nach dem „offiziellen“ Auftakt in<br />
Kaunas mit festlichem Rahmen und geladenen Gästen in der modernen Zilinskas - Kunstgalerie erwartete Çirak und<br />
Walter in Klaipeda ein eher gemütliches Ambiente im Simon-Dach-Haus, dem litauisch-deutschen Kulturzentrum, mit<br />
einem kleinen, aber gut vorbereiteten und gesprächsfreudigen Publikum. Die Auftritte in Lettland hatten auch ihren<br />
ganz eigenen exotischen Charakter: In Liepaja fand die Performance in einer surrealen Umgebung im ehemaligen<br />
Kriegshafen statt, wo sich ein alternatives Kulturzentrum etabliert hat, das v.a. mit Kindern arbeitet. Und in Daugavpils,<br />
der letzten Station der Reise, lag die Besonderheit darin, dass, angesichts der dort ansässigen starken russischen Minderheit,<br />
während der Performance Übersetzungen einzelner Gedichte sowohl in lettischer als auch in russischer<br />
Sprache eingelesen wurden. Zur Veranstaltung an der dortigen Pädagogischen Universität am Vormittag waren immerhin<br />
etwa 70 Zuschauer erschienen. Und auch hier regten die Texte und Bilder zu interessanten Fragen und<br />
Gesprächen an. Auf der Rückfahrt von Daugavpils nach Vilnius durch eine wunderbare Frühlingslandschaft mit knallgelben<br />
Löwenzahnwiesen unter blauem Himmel machten wir noch einen kleinen Abstecher zum geographischen<br />
Zentrum Europas, das französische Geographen nördlich der litauischen Hauptstadt verortet haben. Ein symbolischer<br />
Abschluss dieser interkulturellen Lese- und Begegnungsreise, deren Koordinaten im weitesten Sinne von Istanbul über<br />
Berlin bis Riga reichen. Mit vielen neuen Bildern im Kopf und einer Sammlung von Gedichtübersetzungen in drei<br />
neuen Sprachen im Gepäck traten Zehra Çirak und Jürgen Walter ihren Rückflug an. Und das Zahnweh war zuletzt fast<br />
ganz vergessen.<br />
Die „Höhenflug“-Reiseroute im Überblick:<br />
2. Mai Ankunft in Vilnius<br />
3. Mai Auftritt in Kaunas, M. Zilinskas - Kunstgalerie<br />
4. Mai Auftritt in Klaipeda, Simon-Dach-Haus<br />
5. Mai Auftritt in Liepaja, Kulturzentrum „K@2“<br />
6. Mai Freier Tag in Riga<br />
7. Mai Auftritt in Daugavpils, Pädagogische Universität<br />
8. Mai Abflug Vilnius<br />
Veröffentlichungen von Zehra Çirak:<br />
„Vogel auf dem Rücken eines Elefanten“, Gedichte.<br />
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1991.<br />
„Fremde Flügel auf eigener Schulter“, Gedichte.<br />
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1994.<br />
„Leibesübungen“, Gedichte.<br />
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2000.<br />
Eine Auswahl der Objekte Jürgen Walters sind auf der Website<br />
www.juergen-walter.com zu finden.<br />
PROJEKTE 2001<br />
Der Sturm aufs kalte Büfett im Foyer der Galerie<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
11
DEUTSCH-RUSSISCHE BEZIEHUNGEN<br />
Sonja Lührmann<br />
Über eine größer werdende Distanz:<br />
Schüler von der mittleren Wolga über deutsch-russische<br />
Beziehungen<br />
12 <strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Fotos: Sonja Lührmann<br />
(ehemalige Lektorin in Joschkar-Ola/Russische Föderation)<br />
„Die Leute in Deutschland sind kulturell offener als in Russland. Das liegt daran, dass die Leute<br />
in Deutschland sehr viel reisen. [...] Und diese Liebe zur Reise bei Deutschland und Deutschen<br />
imponiert mir sehr. Leider habe ich jetzt keine Möglichkeit zu reisen, aber ich träume in der<br />
Zukunft mit meiner Familie viel zu reisen. Wir Russen sind offen, gutherzig, gastfreundlich.“<br />
Natalja Eremina, Joschkar-Ola<br />
Die Spitzenpreisträger mit ihren Arbeiten<br />
(v. li.: Eine Schülerin der Klasse 9A, Gymnasium Kosmodemjansk;<br />
Aleksej Wanjukow, Jekaterina Iljina, beide 3. Schule Kosmodemjansk;<br />
Irina Seliwanowa, 23. Schule Joschkar-Ola; Tatjana Widjagina,<br />
Mittelschule Mari-Turek)<br />
Was wissen Schüler in der russischen Provinz, für die eine<br />
Reise nach Deutschland – heute vielleicht noch mehr als zu den<br />
Zeiten von UdSSR und DDR – meist im Reich der Träume liegt, über<br />
Deutschland und die Deutschen? Ist Fremdsprachenunterricht für<br />
sie nur sinnlose Quälerei, oder hat die Beschäftigung mit Sprache<br />
und Kultur eines anderen Landes Relevanz für ihr Leben? Um diesen<br />
Fragen nachzugehen und gleichzeitig ein kleines Beispiel dafür<br />
zu geben, wie lohnend es sein kann, Deutsch zu lernen, haben<br />
meine Kollegin Olga Maikowa, Lehrkraft für Deutsch und Betreuerin<br />
des Lehrmittelzentrums des Goethe-Instituts an der Marischen<br />
Staatlichen Universität, Joschkar-Ola, und ich im Frühling 2001<br />
einen Wettbewerb für deutschlernende Schüler der Republik Mari El<br />
veranstaltet. In der Ausschreibung regten wir die Schülerinnen und<br />
Schüler der 9. bis 11. Klasse an, sich von dem etwas pompösen<br />
Thema „Deutschland-Russland: Beziehungen gestern, heute, morgen“<br />
nicht einschüchtern zu lassen und Arbeiten in einem selbstgewählten<br />
Medium einzureichen.<br />
Weil selbst die deutsche Reiselust nur selten jemanden nach<br />
Joschkar-Ola führt, hier zunächst ein Text von Ksenija Bachmaer<br />
aus dem Dorf Wisimjari über die Republik Mari El, eines<br />
der Subjekte der Russischen Föderation:<br />
„Die Republik Mari El liegt fast im Zentrum Europas, an<br />
den malerischen Ufern des großen russischen Flusses – der Wolga.<br />
Sie ist klein, aber fein. Das Territorium der Republik beträgt von<br />
Norden nach Süden – 150 km, von Westen nach Osten – 275 km<br />
[...] Die Hauptstadt der Republik heißt Joschkar-Ola. Sie liegt an der<br />
kleinen Kokschaga.“ Wem jetzt immer noch nicht klar ist, wo das<br />
Zentrum Europas ist, der schaue im Atlas etwa 800 km östlich von<br />
Moskau nach. Joschkar-Ola (ca. 250 000 Einwohner) liegt 150 km<br />
nordwestlich von Kasan, der Hauptstadt von Tatarstan.<br />
Ksenijas Arbeit gehört zu der Gruppe von Beiträgen, die<br />
den eigenen Heimatort für Deutsche vorstellen. Zu diesem Thema<br />
wurden Aufsätze, Briefe, Bilderalben, und Ausstellungswände mit<br />
Bildern und Texten angefertigt. Abstraktere Themen wählten die<br />
Schüler der 3. Schule aus Kosmodemjansk, einer Kleinstadt an der<br />
Wolga, die Aufsätze über Goethe und Puschkin, den Rhein und die<br />
Wolga oder deutsche und russische Kultur im Allgemeinen verfassten.<br />
Zum Thema „Die Gemeinschaft der russischen und deutschen<br />
Kulturen“ fielen Ekaterina Iljina Katharina die Große und in Russland<br />
populäre deutsche Gruppen wie die Scorpions, Ramstein und<br />
Modern Talking ein, abschließend bemerkte sie: „In der letzten Zeit<br />
verbreiten sich Verbindungen zwischen unseren Staaten, dazu trägt<br />
unser neuer Präsident Wladimir Putin, der viele Jahre in der DDR<br />
gelebt hat, bei.“<br />
Aleksej Wanjukow - übrigens der einzige männliche Teilnehmer mit<br />
Einzelbeitrag – zeigte in seiner Arbeit über „Das Alte und das Neue<br />
in den Verhältnissen zwischen Russland und Deutschland“ die erfrischende<br />
Bereitschaft, auch negative Aspekte der deutsch-russischen<br />
Beziehungen anzusprechen: „Es gibt aber auf unserer Erde eine<br />
Generation, deren Väter und Grossväter auf den Schlachtfeldern<br />
zusammengekommen sind. Es waren Stalingrad und Leningrad... Es<br />
war der Plan ‘Ost’. Es gab Konzentrationslager und Einäscherungsöfen...<br />
Ich glaube, dass das nicht zu vergessen ist. Man kann aber<br />
nicht damit leben, nur diesen Seelenschmerz im Gedächtnis halten.“<br />
Über die heutige Zeit schreibt er: „Für viele Deutsche<br />
assoziiert sich das heutige Russland mit solchen Begriffen wie<br />
‘Alkoholismus’, ‘Armut’, ‘Korruption’, ‘Mafia’. Im Fernsehen wird unser<br />
Land negativ gezeigt. Ich meine, dass wir auch schuld daran sind.<br />
Man muss aber wissen, dass der Weg zur neuen Gesellschaft lang<br />
und schwer ist.“<br />
Neben einer allgemeinen Tendenz zur Beschönigung trat ein Problem<br />
des Fremdsprachenunterrichts in Russland sehr klar hervor:<br />
Nur sehr wenige Schulen, zumindest in der Provinz, befähigen ihre<br />
Schüler zum selbstständigen Formulieren von Texten in der<br />
Fremdsprache. Die meisten Arbeiten bestanden aus liebevoll abgeschriebenen<br />
und illustrierten, in einigen Fällen immerhin individuell<br />
etwas abgewandelten Lehrbuch- oder Zeitschrifttexten. In Mari El<br />
scheinen nur die Lehrerinnen der schon erwähnten 3. Schule in Kosmodemjansk<br />
und der 18. Schule in Joschkar-Ola (eine Privatschule<br />
mit einer Art Waldorf-Pädagogik) mit ihren Schülern eigenständige<br />
Textproduktion zu üben. Um die Schüler anderer Schulen nicht zu<br />
benachteiligen, vergaben wir immerhin 40% der erreichbaren<br />
Punkte für die äußere Gestaltung der Arbeit und berücksichtigten<br />
sprachliche Fehler überhaupt nicht. Dennoch bewerteten wir gerade<br />
solche Arbeiten hoch, für die es keine möglichen Quellen zum<br />
Abschreiben gab, wie z.B. Tatjana Widjaginas Beschreibung einer<br />
Reise an ihre Schule in Mari-Turek, einem Dorf im Osten der<br />
Republik, die zwar nicht ganz wahrheitsgetreu, dafür aber bestimmt<br />
von ihr (sicher mit Hilfe der Lehrerin) selbst verfasst war.<br />
DEUTSCH-RUSSISCHE BEZIEHUNGEN<br />
Die Preisträger und ihre Lehrerinnen<br />
(In der Mitte sitzend, v.li.: Sonja Lührmann, Bosch-Lektorin; Soja<br />
Georgiewna, Leiterin des Lehrstuhls für Fremdsprachen; Olga Maikowa,<br />
Betreuerin des Lehrmittelzentrums des Goethe-Instituts)<br />
Ein spezifisches Problem des Deutschunterrichts spricht<br />
eine 9. Klasse der 20. Schule aus Joschkar-Ola an, die ein Video<br />
über Deutsch an ihrer Schule drehte: Früher war Deutsch die verbreitetste<br />
Fremdsprache an den Schulen der Republik, heute wird<br />
es mehr und mehr von Englisch verdrängt. Englisch gilt als die<br />
Sprache, die man in der Geschäftswelt braucht, und Deutschlehrer<br />
klagen, dass ihnen nur noch die schlechten Schüler zugeteilt werden.<br />
Eine zweite Fremdsprache bieten nicht alle Schulen an und<br />
wenn, dann nur mit einer Stunde pro Woche. Während die Schulen<br />
versuchen, sich daraufhin umzuorientieren, ihre Schüler für die<br />
internationale Wirtschaft und das Internet fit zu machen, gilt Deutsch<br />
eher als Kultursprache, die wenig praktischen Nutzen hat. Auch unseren<br />
Wettbewerbsteilnehmern fielen überwiegend Verbindungen aus<br />
Kultur und Geschichte ein, aber niemand von ihnen bezeichnete die<br />
Auseinandersetzung damit als nutzlosen Luxus. Was die Bereicherung<br />
der eigenen Kreativität durch das Erlernen einer Fremdsprache bringen<br />
kann, zeigt sich am besten in Snezhana Malinowas Übersetzungen<br />
von Gedichten von Goethe, Grillparzer und Moritz Hartmann ins<br />
Russische.<br />
Dass wenigstens bei diesem Wettbewerb geistiges<br />
Interesse und materieller Nutzen sich nicht ausschließen, konnten<br />
wir mit den von der Robert Bosch Stiftung und dem Goethe-Institut<br />
gestifteten Preisen unter Beweis stellen: Die etwas enttäuschende,<br />
aber für das erste Mal und die kurze Ausschreibungszeit (Anfang<br />
März bis Mitte Mai) nicht allzu schlechte Zahl von insgesamt 29 Einzel-<br />
und Gruppenbeiträgen machte es möglich, dass alle Teilnehmer<br />
ein Buch, eine Zeitschrift, eine CD oder zumindest eine Tasche und<br />
einen Kugelschreiber erhielten. An die institutionellen Kontakte, die<br />
das Interesse an der deutschen Sprache wieder wecken könnten, erinnert<br />
Aleksej: „Wir müssen auch wiedergewinnen, was wir früher gehabt<br />
haben: Kunstfestivale, Versammlungen der Freundschaft und<br />
der Kultur, die Entwicklung des Tourismus.“<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
13
1<br />
2<br />
14<br />
PROJEKTE 2001<br />
„Wir sind jung – Junge machen Zukunft“<br />
Seminar: Chelm (Polen), 01. – 06. Mai 2001<br />
Text 1: Olga Bolochowa, Studentin aus Witebsk, Belarus<br />
Text 2: Zoriana Zombra, Studentin aus Lwiw, Ukraine<br />
Eifrige Beratung am Grünen Tisch<br />
Ausflug nach Majdanek/Lublin, 04. Mai 2001<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Fotos: Ellen Gaus<br />
Das Ziel des Seminars „Wir sind jung“ waren Diskussionen zu den aktuellen Themen: Jungen<br />
und Mädchen, Drogen, Freundschaft oder Liebe. Ich finde das prima. Das wertvollste Gut dieser<br />
Initiative sind neue Möglichkeiten für internationale Kontakte und neue „Brücken der Freundschaft“<br />
und das Verständnis zwischen den Ländern und Menschen.<br />
Die AIDS- Vorlesung prägte sich mir besonders ein. Denn dieses Problem geht jeden von uns<br />
an. Diese Krankheit macht nicht an der Grenze halt. Man soll das besprechen und Schlussfolgerungen<br />
ziehen.<br />
Am schönsten, am besten gefielen mir persönlich die Spiele.<br />
Es war so komisch, aber auch nützlich.<br />
Im Leben jedes Menschen sind bestimmte Daten, Ereignisse und Tage, an die er sich sehr<br />
lange Zeit erinnert, und die Erinnerungen darüber erregen bei ihm ein angenehmes Lächeln<br />
auf dem Gesicht. Zu solchen Ereignissen in meinem Leben gehört mein Aufenthalt im Mai<br />
dieses Jahr auf dem Seminar in Chelm. Das polnische Land sammelte ukrainische, belorussische,<br />
polnische Jugend unter der Leitung der deutschen Kollegen. Das Wichtigste ist, dass es<br />
keinen Unterschied im Umgang, in den Meinungen, in den Aktionen<br />
gab, doch es ist bekannt, dass die jungen Menschen, leben sie in<br />
Amerika oder in Europa, gemeinsam der Wunsch vereint, den anderen<br />
kennenzulernen, die Zeit zusammen zu verbringen, etwas Neues<br />
zusammen zu erkennen.<br />
Was mir am meisten während dieses Seminars gefiel?<br />
Alles! Du kannst es nicht glauben, aber so ist die Wahrheit. Ehrlich<br />
gesagt, hatte ich am Anfang ein wenig Angst, aber das Interesse<br />
hat sie bezwungen. Und schon der erste Tag hat bewiesen, dass<br />
es wirklich lustig und interessant wird. „Scharfe" Diskussionen und<br />
wohlwollender Streit zwischen Jungen und Mädchen gaben süße<br />
Rosinen in unseren Umgang. Wie kann man die Befragung der Jugend in der Stadt vergessen?<br />
Wer hat gesagt, dass die Menschen Komplexe haben? In unserem Lexikon gibt es kein solches<br />
Wort! Aber wie kann man sich ein Seminar ohne Erholung vorstellen? Bei uns war sie einfach<br />
super!!! Die Lieder mit Gitarre und nicht nur in deutscher Sprache, lustige Spiele, Discos,<br />
Spaziergänge durch die Stadt und der Ausflug nach Lublin: wunderschön!<br />
Zwar schließt man in solchen Reisen am meisten Freundschaft. Nein, wir kennen einander<br />
nicht drei Tage, wir sind schon hundert Jahre bekannt und wir werden niemals unsere<br />
Freundschaft verlieren, nicht wahr? Dank solcher Begegnungen erkennen wir die Welt und die<br />
Welt erkennt die Ukraine. Ich sage: bis zu neuen Begegnungen, meine neuen deutschen,<br />
belorussischen, polnischen und ukrainischen Freunde! Auf Wiedersehen...<br />
Deutschunterricht und Theater<br />
Ein Theaterworkshop mit 42 ukrainischen Germanistikstudenten<br />
Sudak/Krim (Ukraine), 16. – 27. Juli 2001<br />
Text : Ellen Gaus, (Bockenem/Deutschland) und<br />
Lenore Becks, (Stuttgart/Deutschland)<br />
Im Sommer war es mal wieder soweit. Die dritte und vorläufig letzte Begegnung des<br />
Projekts „Deutschunterricht und Theater“ stand an. Nach den erfolgreichen Treffen<br />
in Kiew (Mai 1999) sowie in Frankfurt/Main und Marburg (März 2000) sollte es<br />
erneut die Ukraine sein.<br />
Elf Tage Theater pur. Das war eine ziemlich intensive Begegnung der sieben Theatergruppen<br />
aus den Universitäten/Pädagogischen Hochschulen Kiew, Dnepropetrowsk, Rivne, Lviv, Nishyn,<br />
Donezk und Gorlivka. Jeden Morgen nach dem Frühstück ging’s los mit dem gemeinsamen<br />
„Theater“ – Warming up und danach folgte der Theaterunterricht in drei Gruppen mit den<br />
Profis Silvia Pahl, Klaus Wilmanns vom Theater 3 Hasen oben aus Deutschland sowie<br />
Mykola & Vita Shakaraban, Kiew. F.A.U.S.T. stand auf dem Plan. Aber nicht der alte Goethe<br />
sollte es sein, sondern „Furiose Abenteuer und sonderbare Träume“ von Paul Maar und<br />
Christian Schidlowsky. Anhand dieses Stückes sollten den Teilnehmern exemplarisch<br />
Grundlagen eines lebendigen Theaterspiels vermittelt werden. Nach der Mittagpause war noch<br />
Zeit für ein erfrischendes Bad im Schwarzen Meer und dann war<br />
„Spracharbeit“ (Phonetik mit Gisela, Wortschatz mit Leo und<br />
Hintergrundinfo zum Stück mit Ellen) angesagt. Abends hatten die einzelnen<br />
Gruppen schließlich Gelegenheit, ihre eigene „mitgebrachte“<br />
Theaterarbeit zu präsentieren. Ein Ausflug mit dem Schiff nach Jalta sowie<br />
die Besichtigung der genuesischen Festung, in deren Schatten wir zwei<br />
Wochen lebten, rundeten das Ganze ab. Ein Highlight war die Aufführung<br />
des „Theater 3 Hasen oben“: „Da gibt es nichts zu kichern“ nach Daniil<br />
Charms.<br />
Am letzten Abend führten die drei „neuen“ Theatergruppen ihre erarbeiteten<br />
Szenen aus F.A.U.S.T. auf. Klaus und seine Gruppe zeigten in ihrer<br />
Inszenierung, wie man Musik und Geräusche effektiv einsetzen kann, Silvia<br />
legte sehr viel Wert auf die „Körperarbeit“ und Mykolas Gruppe arbeitete mit selbstgefertigten<br />
Gipsmasken. Die drei Gruppen wurden so aufgeteilt, dass in jeder Gruppe zwei Vertreter einer<br />
Uni waren. Auf diese Weise konnten sich die Teilnehmer untereinander besser kennen lernen,<br />
und jede Theatergruppe hat insgesamt die drei verschiedenen Arbeitsmethoden mitbekommen.<br />
Für die Zukunft haben die Teilnehmer schon viele neue Theater-Ideen, deren Umsetzung<br />
bestimmt nicht lange auf sich warten lässt. Auf jeden Fall haben die Studis jede Menge Spass<br />
gehabt, neue Eindrücke und sehr viele gute Tipps und Tricks für ihre Theaterarbeit und ihr<br />
Studium bekommen, so dass sie im folgenden Studienjahr frischen Wind in ihre Theaterarbeit<br />
und ihre Uni bringen können.<br />
Fotos: Ellen Gaus<br />
PROJEKTE 2001<br />
Das Team: (v.li.) V. Shakaraban (Nascentis<br />
Theater, Kiew), L. Becks, Gisela Gibtner<br />
(Goethe-Institut, Kiew), E. Gaus, M. Shakaraban<br />
(Nascentis Theater; Kiew), S. Pahl, K. Wilmanns<br />
Warming up am mittleren Morgen<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
15
16<br />
ZUKUNFT DES VEREINS<br />
Robert m. Sobotta<br />
Über die Arbeit von <strong>MitOst</strong> e.V.<br />
im Jahr 2021<br />
<strong>MitOst</strong> No. 8 | November 2001<br />
Foto: Steffen Giersch, Dresden<br />
(1998-2000 Lektor in Polen, jetzt Dresden/Deutschland)<br />
Zum 25jährigen Vereinsjubiläum 2021 hat<br />
sich <strong>MitOst</strong> e.V. erfreulich entwickelt. Wie<br />
Senior President Wladimir-Dieter Mitosta<br />
auf der jährlichen ZK-Versammlung in<br />
London feststellte, stieg die Mitgliederzahl<br />
auf genau 183.483 Personen in mittlerweile<br />
über 100 Ländern. Dies garantiert eine<br />
kontinuierliche Arbeit auf vielen Ebenen.<br />
Inzwischen sind nicht nur Hunderte weltweite<br />
Projekte mit einem Volumen von<br />
mehr als 2 Mrd. Euro Teil der Vereinsarbeit;<br />
auch die interne Strukturanpassung an das<br />
mehrere Generationen umfassende Spektrum<br />
der Mitglieder ist eine Herausforderung<br />
für die Gremien der Organisation.<br />
Bereits 380 Auszeichnungen für mehr als 20jährige Mitgliedschaften wurden vergeben.<br />
Viele aktive Gründungsmitglieder der frühen Jahre unseres Vereins haben inzwischen das<br />
Rentenalter erreicht. Das Vereinsvermögen ist durch Erbschaften wesentlich gestärkt worden.<br />
Der Vorstand will auf einer baldigen Sitzung die Einrichtung weltweiter Sanatorien und Altersheime<br />
unter der Marke <strong>MitOst</strong> e.V. anstoßen; auf der Hauptversammlung wurde eine entsprechende<br />
Initiative positiv beschieden. Zusätzlich zu den bestehenden Regionalzeitschriften<br />
<strong>MitOst</strong>West, <strong>MitOst</strong>Ost, <strong>MitOst</strong>Süd und <strong>MitOst</strong>Nord soll, zunächst mit globalem Verteiler an<br />
Mitglieder der Geburtsjahrgänge vor 1970, ein Fachmagazin für die Bedürfnisse der älteren<br />
Mitglieder konzipiert werden. Zu diesen Bemühungen zählt auch die Verstärkung der Kreuzfahrtensparte<br />
in der <strong>MitOst</strong>Reisen GmbH.<br />
Projektentwurf für die<br />
Hauptverwaltung des <strong>MitOst</strong> e.V.<br />
wahlweise in Ulan Bator/Mongolei<br />
oder Lagos/Nigeria, Realisierung<br />
geplant ab 2024<br />
<strong>MitOst</strong><br />
Natürlich ist zu erwähnen, dass gleichzeitig eine Verjüngung des Vereins stattfindet; inzwischen<br />
besteht die Familienmitgliedschaft, die Mitgliedern Reisen in der <strong>MitOst</strong>-Welt durch viele Vorteile<br />
wesentlich vereinfacht. Der erste <strong>MitOst</strong>-Urenkel eines Gründungsmitglieds wurde 2021 geboren. In das<br />
Sortiment der <strong>MitOst</strong>-Kinderausstattung gehört inzwischen eine vielfältige Kinderabteilung. Einer der<br />
beliebtesten Artikel aus diesem Bereich ist der Schnuller mit dem typischen <strong>MitOst</strong>-Logo.<br />
Sämtliche Publikationen des <strong>MitOst</strong> e.V. erscheinen inzwischen in den 28 Sprachen<br />
der Länder mit jeweils mehr als 250 Mitgliedern. Die zunehmende Internationalität des Vereins<br />
lässt die Zeiten vergessen, in denen die Russische Föderation das östlichste Zielgebiet der<br />
Vereinsarbeit war. Längst haben sich die Projekte weiter nach Osten ausgedehnt und Alaska<br />
erreicht sowie davon ausgehend den ganzen amerikanischen Doppelkontinent und schließlich,<br />
weiter nach Osten vordringend, Afrika erschlossen. Neu ist die derzeitige Integration der westlichsten<br />
Länder Europas, Island und Portugal, in das <strong>MitOst</strong>-Netzwerk. Durch die fortschreitende<br />
Expansion nach Osten sind inzwischen im Zirkelschluß die traditionellen westlichen Länder<br />
der <strong>MitOst</strong>-Organisation (Tschechien, Deutschland, Österreich) an ihren Westgrenzen erreicht.<br />
Es gab bereits mehrere Eingaben zur Änderung des Namens unserer Organisation in MitWelt<br />
e.V.; Traditionalisten wehren sich dagegen.<br />
Die Beteiligungen des <strong>MitOst</strong> e.V. haben sich im vergangenen Jahr entsprechend der langjährigen<br />
Tendenz entwickelt: der Bereich Print und Medien des <strong>MitOst</strong> e.V., welcher 2015 die<br />
Mehrheit an der Springer AG, Hamburg, übernommen hat, geht seinerseits eine Partnerschaft<br />
mit der weltweit im Online-Dienst dominanten Nachrichtenagentur TASS-CNN Moskau, ein.<br />
Damit soll insbesondere die Mitgliederakquise in den noch gering repräsentierten, potenziell<br />
für <strong>MitOst</strong> enorm ergiebigen Ländern Indonesien, China, Tibet und Indien optimiert werden.<br />
Gerade in den ehemaligen Entwicklungsländern ist die mediale Kommunikation essenziell für<br />
die <strong>MitOst</strong>-Arbeit. Nur auf diese Weise, so Vorstandsmitglied Human Resources, Sofija del Este,<br />
kann bis 2035 das Ziel von 500.000 Mitgliedern erreicht werden. Im Kontext der Expansion<br />
ist das zehnjährige Jubiläum der erfolgreichen Integration der ehemaligen Robert Bosch Stiftung<br />
GmbH in die Strukturen des Vereins zu verzeichnen.<br />
Die Mitgliederquoten schwanken länderspezifisch zwischen 0,0 und 0,2% der Gesamtbevölkerung<br />
in Uruguay: Republica Oriental [= östlich] del Uruguay. In diesem Land ist schon in der<br />
offiziellen Bezeichnung eine Affinität zu den Vereinszielen erkennbar. Deutliche Zuwächse für<br />
<strong>MitOst</strong> e.V. gab es im vergangenen Jahr vor allem an der Ostküste Afrikas (100% Zuwachs in<br />
Madagaskar, auf 14 Mitglieder). Entsprechend der bisherigen Entwicklung, wird die Eröffnung<br />
eines Regionalbüros auch auf dem fünften Kontinent, Australien, notwendig. Damit wäre<br />
<strong>MitOst</strong> auch organisatorisch weltweit vertreten.<br />
Diese Entwicklungen bringen natürlich auch Probleme mit sich. Seit der Mitgliederversammlung<br />
2004 in Athen fanden die nur noch vierjährlichen Plenarveranstaltungen jeweils in den aktuellen<br />
Olympiastädten statt. Nur in diesen Städten kann <strong>MitOst</strong> e.V. während der mehrwöchigen<br />
Veranstaltungen auf die für bis zu 100.000 Teilnehmer erforderliche Infrastruktur zurückgreifen.<br />
ZUKUNFT DES VEREINS<br />
Langjährige Altmitglieder nach der<br />
Auszeichnung „20 Jahre <strong>MitOst</strong>-Mitglied“<br />
Dennoch ist der Vorstand zuversichtlich,<br />
dass der Verein auch in Zukunft seine<br />
Arbeit in erfolgreicher Weise fortsetzen<br />
kann. Weil <strong>MitOst</strong> e.V. inzwischen ein<br />
weltweit bekannter und aktiver Kulturverein<br />
ist, strebt der Vorstand für die<br />
Zukunft einen Beobachterstatus in der<br />
UNO sowie die Kooperation mit weiteren<br />
Organisationen an.<br />
<strong>MitOst</strong> No. 8 | November 2001<br />
17
18<br />
PROJEKTE 2001<br />
Gereon Schuch<br />
…auf Schloß Stolzenfels<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Studienfahrt Rheinland<br />
Stationen deutscher und europäischer Kultur<br />
und Geschichte<br />
Eine Bildungs- und Begegnungsfahrt: 22. – 29. April 2001<br />
Fotos: Gereon Schuch<br />
(1998 - 2000 Lektor in Pécs/Ungarn, jetzt Koblenz/Deutschland)<br />
“Studienfahrt Rheinland – Stationen deutscher und europäischer Kultur und Geschichte.” Unter<br />
diesem Motto starteten Ende April 2001 insgesamt 11 Studierende aus Jugoslawien,<br />
Alle Wege führen nach Europa!?<br />
Rumänien, der Slowakei, Ungarn, der Ukraine und Weißrussland ihre einwöchige Erkundung<br />
bedeutender Orte der deutschen und europäischen Vergangenheit und Gegenwart.<br />
Bewerben konnten sich Studierende aus den oben genannten Ländern mit einem freien Essay<br />
zu der Karikatur „Alle Wege führen nach Europa !?“. Zahlreich meldeten sich Interessierte bei<br />
uns, wir erhielten eine große Menge spannender Essays. Leider konnten wir nur eine recht<br />
kleine Anzahl von Teilnehmern einladen, so dass wir mit unserer Jury aus jedem Land zwei<br />
Studierende auswählen mußten. Stellvertretend für die Vielzahl guter Beiträge sei hier nur ein<br />
Ausschnitt vorgestellt:<br />
„...Wenn die Menschen hier vom Beitritt zur EU hören, fallen Ihnen immer nur die wirtschaftlichen<br />
Vor- und Nachteile ein, aber es geht nicht nur darum. Ich bin der Meinung, dass der<br />
Schlüssel des Tores, das nach Europa führt, in den Händen der Jugend liegt. Die Jugend Ost-<br />
Europas muss über das Wissen verfügen, das den Beitritt ermöglicht. Jedes Land hat<br />
Traditionen, Kulturschätze und Bräuche, die Europa kennenlernen sollte, zumindest so, dass<br />
man einige Besonderheiten eines jeden Landes kennt. Wenn wir einander kennen, können wir<br />
leichter zusammenarbeiten.<br />
Ob viele Wege nach Europa führen, das glaube ich nicht. Sicher gibt es viele Wege, aber nur<br />
manche von ihnen sind die richtigen. Der richtige Weg ist der Weg der Interkulturalität und der<br />
Freiheit. Wir dürfen unsere Kultur und Freiheit auf dem nach Europa führenden Weg nicht verlassen.<br />
Meiner Meinung nach können wir unser Ziel nur dann erreichen, wenn wir den<br />
Schülern und Studenten unseres Landes ermöglichen, nach Westeuropa zu fahren und dort<br />
viele Erfahrungen zu machen. Sie lernen die Bräuche, die Kultur des Gastlandes kennen,<br />
wobei sie wiederum den Gastgebern ihre Traditionen und Kulturschätze zeigen. Ich halte es<br />
für wichtig, dass die westeuropäischen Studenten die osteuropäischen Kulturen und Denkungsarten<br />
kennenlernen, denn wir können nur auf diese Weise zusammenfinden. Wenn wir uns<br />
kennengelernt haben und unsere Erfahrungen ausgetauscht haben, gibt es keine Grenzen<br />
mehr. Dieser Weg führt nach Europa...“<br />
(Fekete Krisztián, Györ/Ungarn)<br />
Im Rahmen dieses <strong>MitOst</strong>-Projekts sollte den Studierenden, die alle noch keine längeren<br />
Aufenthalte in Deutschland erlebt hatten, zum einen die Möglichkeit gegeben werden,<br />
politische und historische Strukturen in Deutschland näher kennenzulernen, zum anderen stand<br />
aber auch der Austausch unter den teilnehmenden sieben Nationalitäten und die Begegnung mit<br />
Studierenden aus Deutschland im Mittelpunkt.<br />
Eine Etappe der Reise war somit die “Europastadt Frankfurt”, die “City of the Euro”,<br />
wo ein Besuch der Europäischen Zentralbank besonders die Ökonomiestudenten begeisterte.<br />
Goethe, Gotik und Geld liegen in dieser Stadt sehr nahe beieinander – aber es wurde auch<br />
deutlich, daß gerade eine solche Stadt nicht frei von sozialen Gegensätzen und Konflikten ist.<br />
Danach ging es in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz, wo neben einer<br />
Gesprächsrunde mit einem echten Landespolitiker im Plenarsaal des Landtags auch die<br />
Gespräche in den Mainzer Weinstuben einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.<br />
Natürlich wurde auch der “Man of the Millennium”, Johannes Gutenberg, nicht vergessen.<br />
Die Strecke zwischen Bingen und Koblenz war dann eher für die Romantiker, wenngleich<br />
der Blick auf geschwungene Weinberge, verwunschene Burgen und mittelalterliche<br />
Festungen durch das weniger romantische Regenwetter etwas geschmälert wurde. Bonn<br />
wiederum als Ex-Bundeshauptstadt machte vor allem durch das ehemalige Regierungsviertel<br />
und das didaktisch hervorragende “Haus der Geschichte” den wechselvollen Verlauf der deutschen<br />
Vergangenheit(en) deutlich. Und schließlich bot Köln sowohl mit seinem Dom als auch<br />
mit dem Schokoladenmuseum einen eindrucksvollen Abschluß der Bereisung von<br />
Gegenwartskultur und lebendiger Geschichte.<br />
Für alle Teilnehmer, für die Studierenden aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie für die drei<br />
OrganisatorInnen des Projekts, war sicher eines der eindrucksvollsten Erlebnisse, dass wir, aus<br />
völlig verschiedenen Hintergründen kommend, gemeinsam etwas kennengelernt und uns dabei<br />
kennengelernt haben!! Während der Fahrt wurde von allen Teilnehmern abwechselnd ein „Reisetagebuch“<br />
geführt; auch hieraus sei ein Ausschnitt vorgestellt:<br />
PROJEKTE 2001<br />
…und es wurde viel fotografiert<br />
…zwei Ungarn und zwei<br />
Kurfürsten zu Mainz am Rhein<br />
Montag, 23.04.2001<br />
...Gestern blieben wir sehr lange aus, weil wir in Frankfurt einen Kneipenrundgang gemacht haben. Heute<br />
konnten wir deshalb kaum aufstehen. Nach dem Frühstück haben wir die EZB besucht und dort haben wir den interessantesten<br />
Vortrag des Tages gehört. Wir sind ein wenig der Geschichte der EU näher gekommen und haben auch<br />
über das Eurosystem und über die Münzen und Geldscheine einige Informationen bekommen. Später haben wir die<br />
Frankfurter Börse besucht und dort haben wir größten Teils visuelle Eindrücke gesammelt. Wir konnten von oben die<br />
Beamten beobachten und wir haben den Eindruck gehabt als wären sie kleine Fische im Aquarium. Der Vortrag an<br />
der Börse war sehr trocken. Vor unseren Augen liefen nur Zahlen und Abkürzungen, aber trotzdem haben wir uns<br />
gefreut, daß wir auch in die Welt der Börse eingeführt wurden....<br />
Danach haben wir das Kolping Hotel verlassen und wir sind nach Mainz gefahren. Am Abend pflegten wir<br />
die Kneipenkultur weiter. Beim Kerzenlicht in der gemütlichen Studentenkneipe haben wir festgestellt, daß wir zu richtigen<br />
Bierexperten geworden sind. In der Kneipe hatten wir eine sehr nette und lustige Gesellschaft. Wir haben viele<br />
schöne deutsche Jungen kennengelernt.<br />
Wir finden es sehr interessant, daß wir aus verschiedenen Ländern gekommen sind und verschiedene Sprachen sprechen.<br />
Wir fühlen uns manchmal so, als wären wir in die Zeit der Babel-Geschichte zurückversetzt. Vor dem Einsturz<br />
hat uns eine Brücke gerettet, und zwar die deutsche Sprache, die wir alle beherrschen...<br />
(Judit Deli, Novi Sad / Jugoslawien und Laura Pünkösti, Brasov / Rumänien)<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
19
20<br />
INTERVIEW<br />
Sergej kommt wie immer<br />
superpünktlich, aber er ist<br />
verkatert. Er hat eine<br />
Cousine in der Nähe von<br />
München ausfindig<br />
gemacht und am Sonntag<br />
dieses Wiedersehen mit<br />
ihr und ihrem Mann<br />
ordentlich begossen.<br />
Soviel zum Thema<br />
Vorurteile.<br />
Dorothea Leonhardt<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Greencard in Deutschland<br />
Ein Interview mit Sergej Rybinskij<br />
Fotos: Dorothea Leonhardt<br />
(München/Deutschland)<br />
Sergej wurde am 1. Mai 1974 in der Nähe von Krasnojarsk in Sibirien<br />
geboren. Er hat dort Elektrotechnik studiert und dann seine Doktorarbeit<br />
in Moskau geschrieben. In dieser Zeit hat er zeitweise bei der<br />
Deutschen Telekom in Moskau gearbeitet. Im Januar 2001 bekam er<br />
aufgrund seiner Fachpublikationen ein Jobangebot von Sony in München.<br />
Seit Juni lebt er als „Greencard-Russe“ hier und spricht, da Sony erst<br />
mal Englischkurse für wichtiger hält, immer noch kein Deutsch.<br />
Welche Formalitäten sind zum Erhalt einer Greencard nötig ?<br />
Oh, das war alles sehr einfach. Ich bin mit dem Arbeitsvertrag von Sony zur Deutschen Botschaft gegangen<br />
und habe das Visum für 5 Jahre bekommen.<br />
Es gab also keine Schwierigkeiten ?<br />
Die einzige größere Schwierigkeit tauchte erst auf, als ich hier ankam, nämlich die katastrophale<br />
Wohnungsnot in München. Gott sei dank hat Sony einen Makler bezahlt, aber es war trotzdem schwierig<br />
genug, etwas zu finden.<br />
Sergej, gab es einen bestimmten Grund, warum Du in Deutschland arbeiten wolltest ?<br />
Nein, ich wollte gerne im Ausland arbeiten, aber nicht unbedingt in Deutschland, ich wäre auch in die USA<br />
gegangen, wenn ich ein Angebot bekommen hätte.<br />
Warum wolltest Du im Ausland arbeiten ?<br />
Nun, zum einen ist es interessant und erweitert den Horizont, gerade Deutschland hat den Ruf, ein<br />
ruhiges und angenehmes Land zu sein. Zum anderen ist es ganz einfach eine wirtschaftliche Überlegung.<br />
Auch wenn die Situation in Russland besser wird, ist es immer noch sehr schwierig, eine gut bezahlte und<br />
interessante Arbeit zu finden.<br />
Wir sitzen in einem Lokal, das sehr gerne auch von Homosexuellen besucht wird. Um uns herum gruppieren sich<br />
einige homosexuelle Pärchen. Es entspinnt sich zunächst eine ausgiebige Diskussion zu diesem Thema. Sergej meint<br />
zwar, nichts gegen Schwule zu haben, findet aber die Art der Öffentlichkeit in Deutschland doch befremdlich. Wir<br />
sprechen ausgiebig über die verschiedenen Kulturen, kommen aber zu keinem rechten Schluss, außer dass sich unsere<br />
Kulturen da doch unterscheiden.<br />
Du hast vorhin gesagt, dass Du hier erst einmal einen Kulturschock bekommen hast, der bis heute andauert.<br />
Worin äußert sich das ?<br />
Das ist sehr schwer zu sagen, vieles ist einfach nicht so, wie ich es gewohnt bin. Mir fällt folgendes Beispiel<br />
ein: als ich ankam, war ich total erstaunt, wie clean der Flughafen ist. Die Förderbänder der Gepäckausgabe<br />
funktionieren einwandfrei und die Sachen fallen nicht herunter. Als ich nach dem Interview zurück nach<br />
Moskau kam, hatte ich den umgekehrten Schock, Scheremetjewo ist dreckig und bei der Gepäckausgabe<br />
fallen die Koffer ständig vom Band in den Dreck.<br />
Das ist aber nur ein Beispiel, es ist einfach alles anders. Aber ich würde auch nicht von Schock sprechen.<br />
Ich werde mich sicher auch daran gewöhnen, dass der Bus pünktlich kommt.<br />
Ich habe aber auch das Problem, dass ich noch kein Deutsch kann und keinen richtigen Kontakt zu den<br />
Leuten habe, am Leben nicht richtig teilnehmen kann.<br />
Ich glaube, dass der Kulturschock auch vom Kulturniveau und der intellektuellen Fähigkeit eines Menschen<br />
abhängt. Intellektuelle können sich leichter in eine andere Kultur hineindenken. Wichtig ist auch die Kommunikationsfähigkeit.<br />
Wodurch unterscheidet sich München von Moskau ?<br />
Eigentlich in allem, fangen wir doch damit an, worin sie sich ähnlich sind. Ähmm…<br />
Wir überlegen lange, uns fällt aber nichts so recht ein, bis wir drauf kommen: beide sind schrecklich teuer und wenn<br />
man neu zuzieht, ist es mehr oder weniger unmöglich, eine Wohnung zu finden.<br />
Es war aber klug, hier die IT-Branche anzusiedeln. Hier ist es teuer und fast alles, das ich verdiene, gebe ich<br />
auch wieder hier aus und führe es so der deutschen Wirtschaft zu. Wäre hier alles billig, würde ich viel<br />
sparen und nach 5 Jahren ein Haus in Russland kaufen.<br />
Welche Unterschiede bei den Menschen bemerkst Du ?<br />
Dazu kann ich aufgrund der Sprachbarriere wenig sagen. Es fällt auf, dass die Leute hier sehr ruhig sind,<br />
recht selbstsicher. Das Leben geht seinen Gang, fast niemand macht sich Sorgen um den nächsten Tag.<br />
Wie findest Du die Mädels hier ?<br />
Sie kommen mir sehr viel feministischer vor als in Russland. Die Frauen hier wissen, dass sie genau so viel<br />
verdienen wie die Männer und auf eigenen Beinen stehen können. Russische Frauen wirken viel weniger unabhängig<br />
und schwächer. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Grund ist, warum deutsche Männer gerne<br />
russische Frauen heiraten.<br />
Du hast eine Freundin in Moskau, bald willst Du heiraten. Warum ?<br />
Ganz einfach: Ich liebe meine Freundin. Man muß im Leben das machen, was man in diesem Augenblick<br />
machen muß. Ich liebe meine Freundin und die finanzielle Situation erlaubt es uns, zu heiraten. Es gibt im<br />
Augenblick keinen Grund, diesen Schritt nicht zu tun.<br />
Stichwort Alkohol.<br />
Alkohol ist ein Problem für russische Männer, besonders, wenn sie allein sind. In Russland gibt es auch das<br />
Problem, dass die Männer nicht das können, was sie meinen, können zu müssen, z.B. die Familien ordentlich<br />
versorgen. Dann ertränken sie ihre Probleme. Oder sie haben mit 30 alles erreicht, was sie wollten: Arbeit,<br />
Frau, Kind. Sie setzten die Ansprüche an sich zu niedrig und sie trinken quasi aus Langeweile. Es ist ein<br />
nationales Problem.<br />
Provozierende Frage: Du hast mir auf dem Weg hierher auch voller Stolz erzählt, dass Du eine ganze Flasche<br />
Wodka trinken kannst.<br />
Ich bin darauf nicht stolz. Ich wäre froh, wenn ich nicht so viel trinken könnte. Es ist eigentlich nicht so toll.<br />
Stichwort Ausländerfeindlichkeit.<br />
Ich merke davon gar nichts. Es liegt sicher auch daran, dass ich ganz „normal“ aussehe. Aber ich empfinde<br />
Deutschland sehr freundlich und einladend zu Ausländern.<br />
Wie unterscheidet sich die Arbeitswelt ?<br />
Sony ist ein japanisches Unternehmen und ich arbeite in einem internationalen Team, in dem weniger als die<br />
Hälfte Deutsche sind. Ich weiß also nicht, inwieweit sich diese Erfahrung auf andere Unternehmen übertragen<br />
läßt. Ich muß sagen, dass bei Sony sehr viel gearbeitet und wenig privat geredet oder gemacht wird. Ich<br />
habe das Gefühl, die Leute wollen der Firma etwas geben, etwas beisteuern.<br />
Die Arbeitsprozesse sind sehr gut geplant und eingeteilt, und es werden oft Statusabfragen gemacht.<br />
In Russland ist es oft so, dass der Chef sagt, das und das muß bis nächste Woche gemacht werden, dann<br />
hängen sich alle rein und das Projekt wird unter großen Mühen mit Ach und Krach fertig. Danach schauen<br />
wieder alle vier Wochen Löcher in die Luft.<br />
Letzte Frage: Würdest Du anderen Leuten raten, auch nach München zum Arbeiten zu kommen?<br />
Ja klar, auf alle Fälle.<br />
INTERVIEW<br />
Hintergrund:<br />
Ziel der im März 2000 von<br />
der Bundesregierung gestarteten<br />
„Greencard-<br />
Initiative“ ist es, ohne<br />
große Formalitätenaufwand<br />
ausländische IT (Informationstechnologie)<br />
–<br />
Spezialisten für die<br />
deutsche Wirtschaft zu<br />
gewinnnen. Die ausländischen<br />
Spezialisten können<br />
für maximal fünf Jahre<br />
in Deutschland arbeiten.<br />
Bislang haben 8.556 IT-<br />
Spezialisten aus aller Welt<br />
die deutsche Greencard<br />
beantragt und in deutschen<br />
Unternehmen Arbeit gefunden.<br />
(Stand 22. Juli 2001)<br />
Bayern steht in der Verteilung<br />
der Greencard an<br />
absoluter Spitze. Es wird<br />
gefolgt von Hessen und<br />
Baden-Württemberg.<br />
Schlußlicht sind die Länder<br />
Sachsen-Anhalt und<br />
Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Indien steht an erster<br />
Stelle der Herkunftsländer<br />
der Greencardinhaber. Es<br />
wird gefolgt von Russland<br />
(wobei hier auch<br />
Weißrussland und die<br />
Ukraine miteingerechnet<br />
werden), Rumänien,<br />
Tschechische/Slowakische<br />
Republik, ehem.<br />
Jugoslawien und Ungarn.<br />
Weitere Informationen<br />
finden Sie unter:<br />
www.bundesregierung.de<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
21
22<br />
5 JAHRE MITOST<br />
Ein Jahr oder länger an einer Hochschule<br />
in einem Land Mittelost- oder Südosteuropas:<br />
Das ist eine prägende Erfahrung, die für viele<br />
in den Entschluß mündet, Begonnenes<br />
weiterzuführen und neue Ideen umzusetzen.<br />
5 Jahre <strong>MitOst</strong> e.V. –<br />
5 Jahre Kultur und Begegnung in Mittel-, Ost- und Südosteuropa<br />
Annette Kraus<br />
Die Robert Bosch<br />
Stiftung hat<br />
dieses große<br />
Potenzial erkannt<br />
und fördert den<br />
Verein seit seiner<br />
Gründung<br />
großzügig und<br />
unbürokratisch.<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
1. Vorsitzende <strong>MitOst</strong> e.V. (Berlin/Deutschland)<br />
Am 1. Dezember 1996 gründeten in Stuttgart ehemalige Lektoren, die als Stipendiaten der Robert Bosch Stiftung an<br />
einer Hochschule Mittel- oder Osteuropas tätig gewesen waren, <strong>MitOst</strong> e.V. als Verein für Sprach – und Kulturaustausch<br />
mit mittel- und osteuropäischen Ländern. Es folgte unmittelbar die Einrichtung der Homepage, 1997 fanden die ersten<br />
Projekte statt und 1998 erschien das erste Magazin.<br />
Seitdem hat <strong>MitOst</strong> in ehrenamtlicher Arbeit eine Fülle von Projekten durchgeführt, konnte insgesamt beinahe vierhundert<br />
Mitglieder aus allen Ländern gewinnen, in denen Aktivitäten stattfinden, und sich insgesamt als Veranstalter und<br />
Partner einen Namen machen. Inzwischen heißt der Verein „<strong>MitOst</strong> e.V. – Verein für Sprach- und Kulturaustausch in Mittel-,<br />
Ost- und Südosteuropa“ – und diesen Namen nehmen wir ernst.<br />
In ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit haben die von <strong>MitOst</strong> durchgeführten Projekte durchaus gemeinsame<br />
Nenner: Sie sind ein Beitrag zum Kulturdialog und zur politischen Bildung, sie schaffen Raum für Begegnung<br />
und Austausch, sie qualifizieren und ermutigen junge Menschen, ihre kulturellen oder gesellschaftspolitischen Visionen<br />
zu verwirklichen, und sie schaffen Netzwerke, die in ihrer Komplexität und ihrem Wirkungskreis inzwischen beachtlich<br />
sind: Jedes Projekt schafft seine eigenen Ehemaligen, die wiederum häufig aktive Mitglieder des Vereins werden und<br />
neue Projektideen einbringen.<br />
Hier schließt sich ein weiteres Kernanliegen des Vereins an: Neben der Durchführung von Projekten versteht er sich als<br />
Ehemaligen-Verein des Lektorenprogramms der Robert Bosch Stiftung. Die Vereinsaktivitäten bringen die Alumni immer<br />
wieder zusammen. Insbesondere die Mitgliederreisen und die jährliche Mitgliederversammlung sind Foren, bei denen<br />
sich alte Bekannte wiederbegegnen und neue Kontakte entstehen.<br />
Unsere Ziele sind nicht immer einfach zu erreichen: Die Mitgliedschaft lebt verstreut, bei der Durchführung der Projekte<br />
tauchen Hindernisse auf und die Temperamente der einzelnen Beteiligten sind oftmals unterschiedlich. In fünf Jahren erfolgreicher<br />
Vereinsarbeit konnten wir diese Mühen immer wieder aufs Neue überwinden. Die Schlüssel zu diesem Erfolg<br />
sind Engagement, Begeisterung und Spaß an Begegnung und Austausch in und mit Mittel-, Ost- und Südosteuropa.<br />
5 Jahre Projektarbeit<br />
das bedeutet insgesamt 41 Projekte:<br />
Theater<br />
Lesereisen<br />
Mitgliederreisen<br />
Studienreisen<br />
Seminare und Workshops<br />
Ausstellungen<br />
Publikationen<br />
Mitgliederversammlung<br />
5 JAHRE MITOST/FAKTEN<br />
Zusammenstellung: Heike Roll, Nina Wendt, Alexandra Zander<br />
- Festival deutschsprachiger Theatergruppen aus Mittelosteuropa in Lublin, Polen (1997)<br />
und Bratislava, Slowakische Republik (1998)<br />
- Reise des Theaters „Blaue Maus“ in die Tschechische Repubik, die Slowakische Republik und<br />
nach Ungarn (1998)<br />
- „Hotel Europa“ - Teilnahme am Theaterfestival UNIDRAM in Potsdam (1999)<br />
- Deutschunterricht und Theater mit Teilnehmern aus der Ukraine (1999-2001)<br />
- Forumtheater in Bratislava, Slowakische Republik (2000)<br />
- des Autors Christian Liedtke („Heinrich Heine zum 200. Geburtstag“) in die Tschechische<br />
Republik und in die Slowakische Republik (1998)<br />
- der Autorin Emine Sevgi Özdamar durch Polen (2000)<br />
- der Autorin Zehra Çirak und des Bildhauers Jürgen Walter durch Litauen und<br />
Lettland (2001)<br />
- der Autorin Tina Stroheker und der Übersetzerin Anna Wziatek nach Polen (2001)<br />
- auf die Kurische Nehrung (1997)<br />
- nach Galizien und in die Bukowina (1998)<br />
- in die Südbukowina (1999)<br />
- nach Siebenbürgen (2000)<br />
- von Studenten aus MOE-Ländern nach München und Süddeutschland (1998-2000)<br />
- einer Gruppe von Germanistikstudenten aus Novi Sad nach Halle, Dresden und<br />
Berlin (2000)<br />
- und der Gegenbesuch in Novi Sad und Belgrad, Jugoslawien (2001)<br />
- ins Rheinland (2001)<br />
- Studentisches Seminar in Kreisau, Polen (1997-2000)<br />
- Studentisches Seminar für deutsch-tschechische Geschichte – „Begegnung in<br />
Brünn“, Brünn, Tschechische Republik (1999)<br />
- CIRKUL – Internationale Sommerakademie des Kulturni Cirkus (1999-2001)<br />
- „Wer, wenn nicht wir ...“ – Workshop zur interkulturellen Kommunikation,<br />
Poltawa, Ukraine (2000)<br />
- <strong>MitOst</strong> Forum Philosophie, Slubice, Polen und Frankfurt/O., Deutschland (2000-2001)<br />
- Studentisches Seminar „Junge machen Zukunft. Wir sind jung!“ in Chelm, Polen (2001)<br />
- Wanderausstellung „Farben der Roma-Kinder“ (1999-2001)<br />
- Vor Ihnen liegt die 8. Ausgabe des <strong>MitOst</strong>-Magazins<br />
- 5 Jahre www.mitost.de<br />
- Zur Zeit erscheint die erste Ausgabe der „<strong>MitOst</strong>-Editionen“<br />
- Es erschien eine Auswertung der Methoden des Kreisau-Seminars<br />
- Berlin, Deutschland, 1997<br />
- Budapest, Ungarn, 1998<br />
- Prag, Tschechische Republik, 1999<br />
- Krakau, Polen, 2000<br />
- Kosice, Slowakische Republik, 2001<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
23
24<br />
5 JAHRE MITOST<br />
Markus Hipp<br />
Fünf Jahre <strong>MitOst</strong> –<br />
Glückwünsche zum Kindergeburtstag<br />
Der Gründungsmythos<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Bilanztreffen Stuttgart 1996, vorne rechts: Frau Irmgard Bosch, Kuratorin der Robert Bosch Stiftung<br />
Fotos: Archiv Markus Hipp<br />
(1996 -1998 1. Vorsitzender <strong>MitOst</strong> e.V., seit 1999 bei der Robert Bosch Stiftung, Stuttgart/Deutschland)<br />
„Jubiläum“ klingt ein wenig nach alt, etabliert und hochoffiziell. Auch gibt es bestimmt Leute, die Tiefsinniges über<br />
Sinn und Unsinn fünfjähriger Gedenkfeiern sagen könnten. Sowohl dem staubansetzenden Unterton als auch der – in<br />
Vereinen vielgeliebten – Grundsatzdebatte möchte ich (wieder einmal) eher pragmatisch dadurch entkommen, daß ich<br />
<strong>MitOst</strong> heute „nur“ zum fünften „Kindergeburtstag“ gratuliere – zu nicht mehr, aber auch nicht zu weniger! Wie aber<br />
bereitet man einen Kindergeburtstag vor? Man sortiert und klebt z.B. die jüngsten Fotos ins Kinderalbum und blättert<br />
bei der Gelegenheit gerne wieder einmal zurück, ganz zurück – ein paar ältere „Bilder“:<br />
Verliebt...<br />
Energische Tutorinnen und Tutoren (damals noch, heute längst selbstbewußt<br />
Lektoren), irgendwo in Mittel- oder Osteuropa, allein im Einsatz<br />
oder in kleinen Gruppen bei Regionaltreffen, meist in Eiseskälte<br />
mit roten Nasen und Zipfelmützen, aber – auf (fast) allen Fotos – glücklich,<br />
lachend, begeistert. „MOE“, das Kürzel der Geliebten, wird zum Kosenamen,<br />
zum Inbegriff einer intensiven Affäre, in der leidenschaftlich<br />
gefeiert und heftig gestritten wird, einer Affäre jedenfalls, die tiefe<br />
Spuren hinterläßt! Aber wird die Beziehung halten, wenn in den aufgewühlten<br />
MOE-Seelen wieder der deutsche Alltag Einzug hält?<br />
Verlobt ...<br />
Mit der Idee, „etwas zurückzugeben von den schönen Begegnungen<br />
und Erfahrungen in Mittel- und Osteuropa“ – so eine häufige Formulierung<br />
dieser Tage – gehen beim ersten Bilanztreffen der Boschtutoren<br />
im September 1996 in Stuttgart einige schwanger, aber „ein<br />
bißchen schwanger gibt es nicht“. Die Robert Bosch Stiftung, die sich<br />
mit unehelichen Zuständen schwer tut, drängt vorsorglich und programmväterlich<br />
zur Entscheidung: Wie wär‘s denn mit einem richtigen<br />
Ehemaligenverein? Zweifel und Zuspruch halten sich die Waage, aber<br />
am Ende vereinbart ein knappes Dutzend ein baldiges Wiedersehen.<br />
...und eine typische Traufe<br />
(neudeutsch für Trauung und Taufe in einem)<br />
Am 1. Dezember 1996, nachmittags, ein klassisches „Start-up-Gründer-Familienfoto“<br />
(das weiß man aber immer erst später, aus der<br />
Werbung): nicht in der klassischen Garage, aber doch vereint um<br />
den großen Eßtisch von Sabine Krüger – also dort, wo ohnehin schon<br />
seit Wochen und Monaten die Fäden derer zusammenlaufen, die<br />
sich nun endlich trauen wollen, dieser Welt einen weiteren Verein<br />
zu schenken: aus Dresden Uta Schoppe und Birgit Schatt, aus<br />
Hamburg Imke Hoffmann, Karen Oßmann und Kathrin Liedtke,<br />
aus Dortmund Darius Polok, aus Freiburg Martin Faber und aus<br />
München Nina Müller und Markus Hipp. Die Papierstapel wild übereinander,<br />
obligatorisch auch die Pizza, bekanntlich ein modernes<br />
Synonym für Kreativität. Die Abstände zwischen den Wehen werden<br />
kürzer, die Herztöne guter Ideen und Konzepte immer deutlicher,<br />
aber am späten Nachmittag geht es plötzlich nicht mehr weiter, und<br />
vor allem: das Kind hat ja noch gar keinen Namen. „Boschfrösche“<br />
– das kann’s ja wohl noch nicht sein? Ein Ortswechsel soll helfen –<br />
raus aus Stuttgart, hoch auf die Schwäbische Alb, Weite, Inspiration,<br />
frische Luft: Melchingen! Im Hinterzimmer des Theaters Lindenhof,<br />
nach wortverspielt anregendem Kabarett und einigen wehenfördernden<br />
Biohämmern aus Hopfen und Malz setzen urplötzlich die<br />
Presswehen ein, kritzelt der Wehenschreiber auf einen alten Bierdeckel:<br />
Mittel- und Osteuropa ... Mittel- und Ost ... MittelOst ... „Mit-<br />
Oscht“! schreit ein nicht nur von Heimatluft berauschter Schwabe<br />
unvermittelt in den qualmerfüllten Raum. Die sprachlich versierteren<br />
Norddeutscheren erkennen auf Anhieb, dass der zufälligen geographischen<br />
Wortschöpfung eine geradezu genialisch tiefe präpositive<br />
Bedeutung innewohnt: <strong>MitOst</strong> – das steht nicht nur für die alte<br />
Geliebte „MOE“, sondern vor allem für: Mit dem Osten! In postnataler,<br />
glücklicher Erschöpfung wird noch am selben Abend per<br />
Fingerzeig ein erster Elternbeirat, vulgo „Vorstand“ gewählt, die<br />
Gültigkeit solcher Wahl ob der nicht zu leugnenden Wirkung besagter<br />
Medikamente jedoch sofort von einem Mitglied angezweifelt,<br />
woran man erkennt: Jetzt sind wir ein richtiger Verein! Und was für<br />
einer: „für Sprach- und Kulturaustausch mit Mittel- und Osteuropa“!<br />
Hört, hört – die haben sich was vorgenommen. Mehr als ein bloßer<br />
Ehemaligenverein für nostalgisches Sprücheklopfen muß es schon<br />
sein. Frei, offen und international will man sein und bleiben, aber<br />
auch dankbar, deshalb weit mehr als nur eine Reminiszenz:<br />
„Gegründet von Stipendiaten der Robert Bosch Stiftung“. (Für die<br />
Juristen unter den späteren Historikern: Die Wahl wurde am nächsten<br />
Tag im nüchternen Stuttgart ordnungsgemäß wiederholt und die<br />
Satzung anschließend so feierlich wie möglich von allen Taufpaten<br />
unterzeichnet. Der Rest war – fast – reine Formallogik der deutschen<br />
Vereinsgründungstat).<br />
Keine ruhige Minute ...<br />
Der Fortgang der Geschichte ist schnell erzählt, er überraschte uns<br />
alle: Kaum war die Geburtsanzeige raus, wuchs <strong>MitOst</strong> durchschnittlich<br />
jeden dritten Tag um ein neues Mitglied. Wie ein Fisch im<br />
Wasser lernte der Verein in seinen wunderschön bunten Projekten<br />
in Windeseile spielerisch Tasten, Krabbeln, Laufen, und sein Gesicht<br />
bekam immer deutlichere Konturen. Noch bevor er richtig reden<br />
konnte und sich im <strong>MitOst</strong>-Magazin und Faltblatt klassisch zu artiku-<br />
Sabine Krüger und Markus Hipp,<br />
Regionaltreffen in<br />
Olomouc/Tschechische Republik, 1995<br />
5 JAHRE MITOST<br />
lieren lernte, plapperte er seine kindlichen Entdeckungen in die<br />
www.mitost.de Welt hinaus und fand fortan viele interessierte<br />
Zuhörer. Die „<strong>MitOst</strong>-Kreisau-Seminare“ wurden zu einem echten<br />
Geheimtipp für aufgeweckte Studenten in MOE, so fruchtbar, dass<br />
sie inzwischen Theodor Heuss in Form eines quicklebendigen<br />
Kollegs zu einem erstaunlichen Comeback verhalfen, den Verein<br />
aber auch erstmals vor die schwierige Frage nach dem Umgang mit<br />
dem eigenen Erfolg stellte. Aus noch familiären Wiedersehensfesten<br />
in Dresden und Berlin wurden schnell faszinierende internationale<br />
Treffen in Budapest, Prag und Krakau, die mehr zum Kennenlernen<br />
neuer Gesichter und Geschichten denn zum bloßen Wiedersehen<br />
einluden. Kurz und gut: <strong>MitOst</strong> hielt alle schwer auf Trab und<br />
manchmal kamen wir ihm fast nicht mehr hinterher. An seinem<br />
fünften Geburtstag sind wir deshalb zunächst einfach einmal froh,<br />
dass er bis heute all seine abenteuerlichen Exkursionen ohne größere<br />
Blessuren und Knochenbrüche überstanden hat. Schön ist auch, dass<br />
ihn seine ersten Spielgefährten niemals eifersüchtig für sich allein<br />
reklamierten und er so Jahr für Jahr neue Freunde fand und die alten<br />
nicht verlor.<br />
Geburtstagswünsche<br />
Was wünscht man also einem so lebhaften, phantasievollen und<br />
sommersprossigen Fünfjährigen zum Geburtstag? Weiterhin viel<br />
begeisterndes, kindliches Lachen, das auf andere überspringt. Dazu<br />
ein selbstbewußt unbekümmertes Gemüt, das zwar die Vorsicht,<br />
nicht aber die gefährliche Angst vor der eigenen Courage kennt. Und<br />
wenn <strong>MitOst</strong> nun bald – es läßt sich kaum vermeiden – in die<br />
Schule kommt? Dann soll er um alles in der Welt kein langweiliger,<br />
vereinsmeiernder Streber werden, der seine Mitschüler mit frühreifen<br />
Grundsatzreferaten nervt, sondern einfach „nur“ das aufgeweckte<br />
offene und neugierige Bürschchen bleiben, das schnell lernt und<br />
sich auf neue Situationen pragmatisch einstellt – und dabei doch<br />
seinen Standpunkt nicht verliert! Nur wer sich ändert, bleibt sich<br />
treu. In diesem Sinne – weiter so, <strong>MitOst</strong>!<br />
PS: Sabine, Uta, Birgit, Heike und all die anderen Gründerinnen<br />
sehen das natürlich ganz anders: Für sie ist <strong>MitOst</strong> ein Mädchen –<br />
überstimmt!<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
25
26<br />
5 JAHRE MITOST<br />
Auf diesen Seiten geben wir zur Erinnerung<br />
an die bisherige Arbeit und an das, was<br />
<strong>MitOst</strong> auszeichnet, jeweils gekürzte Artikel<br />
aus den alten Heften des Magazins wieder.<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
(Zusammenstellung: Robert m. Sobotta)<br />
Heft 1, S. 12, März 1998, Markus Hipp (1994-1996 Lektor in der Tschechischen<br />
Republik, jetzt Stuttgart/Deutschland)<br />
Bilder einer Süddeutschlandreise: Von München nach Melchingen<br />
So oder ähnlich beginnt jedes <strong>MitOst</strong>-Projekt:<br />
„... nach einer langen Nacht in vollen Zügen und Bussen, übernächtigt, verschwitzt, verfroren./Treffpunkt<br />
„Internationale Presse“ [oder allgemein: „Treffpunkt <strong>MitOst</strong>“, Anm. d. Red.]: 27 Menschen<br />
aus vier Ländern, die sich noch nie gesehen haben, beginnen sich zu finden. Sprachen<br />
verbinden – also zuerst einmal: Slowakisch zu Slowakisch, Polnisch zu Polnisch, Ungarisch zu<br />
Ungarisch, mluvÌs cesky? Ano! Das Oktoberfest hat gerade begonnen. Alle Gäste werden privat<br />
untergebracht. <strong>MitOst</strong>, der noch etwas rätselhafte Gastgeber, bekommt Gesichter und<br />
Namen: Susanne, Nina, Heike, Eva, Veronika, Anika, Wolfgang, Markus. Nochmals ankommen:<br />
duschen, essen, Schlaf nachholen.“<br />
Heft 1, S. 4, März 1998, Jolanta, Anna, Paulina (Polen), Liga, Laura<br />
(Lettland), Olga (Weißrussland)<br />
<strong>MitOst</strong>: Brücke zwischen Ost und West: Studentisches Seminar Kreisau 1997<br />
Typische Worte zum ersten der für <strong>MitOst</strong> typischen Kreisau-Seminare:<br />
„... Die Seminarteilnehmer wurden in die Zeitungsarbeit an Universitäten und Hochschulen<br />
eingeführt./Die Idee zu diesem Seminar kam von den vier Mitgliedern des Vereins, die für die<br />
Durchführung des Seminars zuständig waren./Alle Vier sind ehemalige Stipendiaten der Robert<br />
Bosch Stiftung. Eine weitere Gemeinsamkeit der Vier ist das Interesse an Kultur und an Kontakten<br />
mit Mittelosteuropa. Den Verein haben sie gegründet, um die Arbeit, die sie im Ausland<br />
begonnen haben, fortzusetzen./Alle <strong>MitOst</strong>-Mitglieder treffen sich einmal im Jahr zu einer Vollversammlung.<br />
Die Kommunikation in der Zwischenzeit erfordert viel Geduld, Zeit und Geld.<br />
Alle sind jedoch optimistisch. Sie stehen erst am Anfang ihrer Arbeit. „Der Verein hat immer<br />
noch zu wenige Mitglieder aus dem Osten“, sagt Darius.“<br />
Heft 1, S. 17, März 1998, Susanne Lükö, Anna Szeplaki (Györ/Ungarn)<br />
<strong>MitOst</strong> oder MitWest?<br />
„MITWEST (Deutsch) = MIT VESZT (Ungarisch: Was verliert er?)<br />
Zum Beispiel: „MitWest er?“ = Was verliert er?<br />
Antwort: Die Angst vor der deutschen Sprache.“<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
Heft 3, S. 19, März 1999, Wassili Kischkurno (Minsk/Weißrussland)<br />
Wer, wenn nicht wir?<br />
Zum Kreisau-Seminar 1998 aus der Sicht eines fleissigen Teilnehmers:<br />
„Demokratie... was ist das? Demokratie im Staat, an der Uni? Gibt es so etwas in der Gesellschaft,<br />
oder ist es nur ein Idyll, eine Utopie? Wen oder was können wir als demokratisch bezeichnen?<br />
Gibt es Grenzen der Freiheit, der Demokratie? Allen diesen Fragen war die Werkstatt<br />
„Demokratie und Mitgestaltung an der Hochschule“ des Zweiten Internationalen Studentischen<br />
<strong>MitOst</strong>-Seminars „Hochschule der Zukunft“ in Kreisau gewidmet. Demokratie muß man lernen.<br />
Was und wie können wir Studenten selbst unternehmen, damit der Grad an Demokratisierung<br />
höher wird?<br />
Diese Frage war Thema der Arbeit der Werkstatt. Wenn wir etwas auf dem Gebiet der Ausbildung<br />
verändern, können diese Veränderungen Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft<br />
haben.<br />
Wir fahren mit großer Hoffnung nach Hause, denn wir haben versucht, unsere Lösungen praktisch umzusetzen.<br />
Auch wenn die staatlichen Strukturen undemokratisch sind, können die wirklichen<br />
Veränderungen nur aus der Mitte der Gesellschaft und vor allem von jungen Leuten kommen.“<br />
5 JAHRE MITOST<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />
Heft 3, S. 11, März 1999, Stefan Romer (1997-1999 Lektor in Polen,<br />
jetzt Schwerin/Deutschland)<br />
Mein kleines Stück Polen<br />
Was jeder Gast in MOE erlebt...<br />
„Solche Besuche waren gewöhnlich sehr angenehm. Das Frühstück ging fließend in das zweite<br />
Frühstück über, welches nach einer Stunde dem Mittagessen Platz machte. Die Zeitspanne<br />
zwischen Mittag und Abendbrot wurde mit Kaffee und Kuchen überbrückt. Zum Schluß traten<br />
wir dann, bepackt mit Tüten voller Eier, Äpfel, Kartoffeln und gerupfter Hühner den Rückweg an.“<br />
Heft 2, S. 30, September 1998, Almut Hille (1996-1998 Lektorin in der<br />
Slowakischen Republik, jetzt Berlin/Deutschland)<br />
Die Farben der Roma-Kinder<br />
„Eines der Projekte, die <strong>MitOst</strong> im Jahr 1999 verwirklichen möchte, ist eine Ausstellungsreise<br />
durch Deutschland mit Zeichnungen von Roma-Kindern aus der Slowakei. Die Kinder leben in<br />
Jarovnice, einem kleinen Dorf in der Ostslowakei, unter schwierigen sozialen Bedingungen.<br />
Seit 1992 gibt es in Jarovnice zwei Grundschulen: eine für die „weißen“ slowakischen Kinder<br />
und eine für die Roma. Der engagierte Direktor versucht, das Ausbildungsprogramm auf die<br />
Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder auszurichten.<br />
Am liebsten mögen die Kinder jedoch den Kunstunterricht bei Jan Sajko. Er ist ein einfühlsamer,<br />
enthusiastischer Lehrer, der ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Phantasie und Kreativität in Bilder<br />
umzusetzen. Die Ergebnisse sind faszinierend und haben internationale Anerkennung gefunden.<br />
Die vom Bildungsministerium der Slowakei zur Verfügung gestellten Mittel werden immer weiter<br />
gekürzt. Für die Umsetzung ihrer Ausbildungsziele ist die Schule deshalb auf private<br />
Spenden und Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Mit dem Ausstellungsprojekt könnte <strong>MitOst</strong><br />
nach zwei Seiten wirksam werden: einerseits Unterstützung für die Schule suchen und vielleicht<br />
einigen Kindern aus Jarovnice die Möglichkeit einer Reise geben, indem sie zur<br />
Präsentation ihrer Arbeit eingeladen werden.<br />
Es wäre denkbar, die Zeichnungen der Kinder direkt mit Fotos der Roma-Siedlung in Jarovnice<br />
zu kontrastieren. In ihr leben, streng getrennt vom Rest des Dorfes, über 2500 Menschen in<br />
selbstgebauten Hütten ohne Wasser, Kanalisationsanschluß und Strom. Für die Kinder gibt es<br />
kaum eine Chance zu entrinnen.“<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
27
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
28<br />
5 JAHRE MITOST<br />
Donaubrücke in Novi Sad<br />
nach 1999<br />
Foto: Susanne Töpfer<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Heft 5, S. 7, März 2000, Frank Weiße (Mitbegründer Kulturní Cirkus)<br />
Kulturní Cirkus<br />
„Vom 30. Juli bis 08.August 1999 fand in Mikulov (Tschechien), an der Grenze zu Österreich<br />
gelegen, die Erste Internationale Sommerakademie „Mikulove 1999“ statt. Organisiert wurde<br />
das Ganze vom eingetragenen Verein „Kulturni Cirkus“, der Mitglied im <strong>MitOst</strong> e.V. ist und<br />
seinen Sitz in Brünn (Tschechien) hat. Lektoren aus Tschechien, Deutschland und Österreich<br />
leiteten folgende Workshops: Fotografie, Keramik, Glasmalerei, Malerei, Grafik, Tanz, Musizieren,<br />
Raumgestaltung, Glasgestaltung, Intuitives Schreiben und Illustration.<br />
Klaus Tilzer behielt die volle Durchsicht mit seiner Glasgestaltung, wobei er nur Abfälle benutzte.<br />
Sehnsüchtig wartete er also auf jede geleerte Flasche, um sie zerschneiden oder wenigstens<br />
ein bisschen verknoten zu können. Glasbruch sei für ihn kein Problem, wobei das beste Glas<br />
ein Glas tschechisches Bier sei, lobte er, sich seiner Einsicht fügend.<br />
Eine Sonnenuntergangsperformance auf einem Gipfel in Mikulov war ein weiterer Höhepunkt.<br />
Es wurde auch das Weben eines Grasteppichs inszeniert, auf dem dann die Kursteilnehmer<br />
davonschweben konnten.“<br />
Heft 5, S. 20f, März 2000, Agata Mierzwa (Krakau/Polen) übersetzt<br />
von Heinz Pascher (ehemals Lektor in Polen)<br />
Aufbruch nach Wien – und umgekehrt ?<br />
„Vom 16. bis 21.Oktober 1999 war eine Gruppe von zehn Soziologiestudenten der Jagiellonen<br />
Universität Krakau in Wien. Geplant waren Treffen mit Wiener Studenten, der Besuch von sozialwissenschaftlichen<br />
Forschungseinrichtungen sowie von Vorträgen zu Themen der Europäischen<br />
Integration.<br />
Trotz des sehr anstrengenden Programms während unserer Reise hatten wir ausreichend Zeit,<br />
um Wien mit seinen Sehenswürdigkeiten, seiner Architektur und seinen Ausstellungen kennen<br />
zu lernen – und tauchten allabendlich in das bunte Nachtleben ein.<br />
Wir hatten jedoch den Eindruck, dass unsere Anwesenheit in Wien keinerlei Interesse bei den<br />
dortigen Studenten geweckt hat. Es war kaum jemand daran interessiert, an dem von der Universität<br />
Wien finanzierten Gegenbesuch in Krakau teilzunehmen. Prof. Kovacs meinte, der Osten<br />
mit seiner historischen Last und seiner ökonomischen Instabilität sei für die meisten nicht attraktiv.“<br />
Heft 6, S. 31f, Oktober 2000, Hans-Joachim Hahn (1998-1999 Lektor in<br />
Polen, jetzt Berlin/Deutschland)<br />
<strong>MitOst</strong>-Studienreise nach Deutschland für Studenten aus Novi Sad, Jugoslawien<br />
Eine ganz „normale“ Studienreise:<br />
„Es war klar, dass der „zivile“ Kontakt zwischen Serbien und Deutschland nicht abbrechen dürfe.<br />
Wie haben Germanistikstudenten und -studentinnen diesen militärischen Konflikt erlebt, bei<br />
dem das Land, dessen Sprache und Kultur sie erlernen, im Bündnis mit anderen Staaten ihren<br />
Wohn- und Studienort bombardierte? Wie wäre es für sie, genau dorthin eine Reise zu unternehmen?<br />
So wurde aus dem Projekt eine äußerlich „normale“ Studienreise unter ungewöhnlichen<br />
Umständen... Die Reise insgesamt schien uns ein schöner Erfolg geworden zu sein.“<br />
Heft 5, S. 27, März 2000, Birgit Schatt (1995-1996 Lektorin in Litauen,<br />
jetzt Dortmund/Deutschland)<br />
Prag im November – Bilanz und Ausblick<br />
„Mitgliederversammlung 1999 des <strong>MitOst</strong> e.V. in Prag: Es hat sich gezeigt, dass auch bewährte<br />
Strukturen und Verfahrensweisen mit der Vergrößerung des Vereins überdacht werden müssen.<br />
Wie kann bei steigender Mitgliederzahl die Effektivität der Zusammenarbeit gewährleistet werden?“<br />
Heft 6, Seite 18ff, Oktober 2000 Frauke Preibisch (1998-1999 Lektorin<br />
in der Tschechischen Republik, jetzt Siegen/Deutschland)<br />
Mitgliederreise Siebenbürgen, Juni 2000<br />
„Der Bus zerreißt die Stille der Hitze, die sich beinahe schwer über die Wiesen und Dörfer legt.“<br />
<strong>MitOst</strong> ist angekommen. (Anm. d. Red.).<br />
<strong>MitOst</strong> Mitglieder leben in…<br />
Zusammenstellung:<br />
Heike Roll, Nina Wendt, Alexandra Zander<br />
Wissenswertes über den Vorstand<br />
treuestes Vorstandsmitglied war<br />
Birgit Schatt mit einer Amtszeit von<br />
4 Jahren<br />
von 15 Vorstandsmitgliedern in 5<br />
Jahren waren 10 Frauen und 5 Männer<br />
die weitesten Wege nahm Olga Mikesova<br />
(Horni Plana/Tschech. Rep.) auf sich<br />
während ihrer Amtszeit bekamen 3 Vorstandsfrauen<br />
ein Baby<br />
wir schauen zurück auf 4 Jahre gelungene<br />
deutsch-deutsche Vorstandsarbeit<br />
fit for Vorstand: Marathonsitzungen,<br />
Matratzenlager, gemeinsamer<br />
Mittagschlaf...<br />
Land 1999 2000 2001<br />
Belgien 1 1<br />
Bosnien-Herzegowina 1 2<br />
Bulgarien 6 8 9<br />
Deutschland 147 176 211<br />
Estland 3 3 4<br />
Großbritannien 1 1 1<br />
Italien 1 1 1<br />
Jugoslawien 2<br />
Kroatien 1 1<br />
Lettland 5 5 7<br />
Litauen 5 4 10<br />
Österreich 3 3 4<br />
Polen 15 20 31<br />
Rumänien 1 1 3<br />
Russland 4 4<br />
Schweiz 1<br />
Slowakische Republik 13 19 17<br />
Tschechische Republik 19 22 24<br />
Ukraine 7 11 18<br />
Ungarn 19 21 19<br />
USA 1 1 1<br />
Weißrussland 4 6 20<br />
Institutionen 2 2 2<br />
Mitglieder insgesamt: 252 311 393<br />
Von Aachen bis Zvolen<br />
Die Gründung des Vereins "<strong>MitOst</strong>" fand am 1.12.1996 in der Gaststätte "Gib acht",<br />
Rotebühlstraße, Stuttgart (Deutschland), statt. Damals waren es 9 Mitglieder.....<br />
Jahr Mitgliederzahl<br />
1996 9<br />
1997 ca. 100<br />
1998 ca. 200<br />
1999 252<br />
2000 311<br />
2001 393<br />
2001<br />
Frauen 243<br />
Männer 148<br />
Eine Mitgliedschaft als Institutionen haben:<br />
Kulturní Cirkus, Brno; Tschechisches Honorargeneralkonsulat, Hamburg<br />
Von den heute 393 Mitgliedern sind 124 ehemalige Lektoren der Robert Bosch Stiftung<br />
Nicht nur von Aachen bis Zvolen…<br />
Kalmer Piskoop, Tallinn<br />
N<br />
John Fanning, San Francisco W O 3 Mitglieder in Woronesch<br />
S<br />
6 Mitglieder in Sofia<br />
5 JAHRE MITOST/ZAHLEN UND FAKTEN<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001 29
30<br />
PROJEKTE 2001<br />
Veränderungen des Menschenbilds an der Schwelle zum 21. Jahrhundert<br />
2. <strong>MitOst</strong>-Forum Philosophie, Slubice/Polen, 21. – 23. September 2001<br />
Zusammenstellung<br />
Markus Sedlaczek (1996-1997 Lektor in der Tschechischen Republik, jetzt München/Deutschland)<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Dr. Stefan Münker mit einigen Teilnehmern des Forums<br />
vor dem Eingang zur Europa-Universität Viadrina<br />
Fotos: Olga Shparaga, Robertas Lukonas, Markus Sedlaczek<br />
Bereits zum zweiten Mal konnte das <strong>MitOst</strong>-Forum Philosophie stattfinden. Vom 21. 9. - 23. 9. 2001 trafen<br />
sich 16 Teilnehmer aus fünf Ländern an der Oder, um über ein Thema zu sprechen, das ebenso umfang-<br />
reich wie aktuell ist. Impulse für die gemeinsame Diskussion in den Seminarsitzungen, die wie voriges<br />
Jahr im Collegium Polonicum im polnischen Slubice stattfanden, lieferten Referate zweier junger<br />
Geisteswissenschaftlerinnen, die eingeladen waren, aus ihrer Sicht und der Perspektive ihrer For-<br />
schungsarbeit bestimmte Aspekte zu beleuchten und ihre Thesen vor internationaler Zuhörerschaft zur<br />
Diskussion zu stellen.<br />
v.li. Markus Sedlaczek, Olga Shparaga, Dr. Stefan Münker und<br />
Vilija Sipaite während der öffentlichen Abschlußveranstaltung<br />
PROJEKTE 2001<br />
Olga Shparaga, Philosophiedozentin aus Minsk (Weißrussland), sprach dabei zum Thema: „Plurale Welt, offene<br />
Identität und der Andere: eine phänomenologische Perspektive auf das Menschenbild an der Schwelle zum 21.<br />
Jahrhundert“. Anhand ausgewählter Schlüsselstellen aus Werken von Edmund Husserl, Jean-Paul Sartre, Maurice<br />
Merleau-Ponty und Emmanuel Lévinas, aber auch unter Bezugnahme auf neuere Erscheinungen in Literatur und Film,<br />
führte sie ein Plädoyer für eine „plurale Welt“ und eine „offene Identität“, die nicht zuletzt auch einer Ideologiekritik<br />
Wege weisen können. In der Diskussion kamen dann recht bald auch die jüngsten Ereignisse zur Sprache, indem die<br />
Frage nach dem Anderen konkret mit der Reflexion über die Terroranschläge vom 11. September verbunden wurde.<br />
Vilija Sipaite, Germanistikdozentin aus Kaunas (Litauen), sprach über „Mythos und Realität. Virtualität der Demokratie<br />
oder des Individuellen? Zum Problem der Ethik im 21. Jahrhundert“. Ausgehend von Peter Sloterdijks Rede<br />
„Regeln für den Menschenpark“ (1999) und der im Anschluß<br />
daran entstandenen Debatte untersuchte sie die<br />
Modellierung von Aussagen. Sie benannte vier „Erzählungen“<br />
in Sloterdijks Text und wies darauf hin, daß viele Mißverständnisse<br />
der Debatte darauf zurückzuführen seien, dass<br />
viele Rezipienten den besonderen Aussagecharakter übersehen<br />
und die Rede als Objektsprache verstanden hätten.<br />
Inhaltlich an den besprochenen Sloterdijk-Text anschliessend,<br />
gab es am Samstagnachmittag dann eine allgemeine<br />
Diskussion aktueller Positionen und Probleme der<br />
Gentechnik bzw. Genethik. Das Gespräch konzentrierte<br />
sich dabei unter anderem auf derzeit aktuelle Probleme<br />
der Embryonenforschung, die Begriffe „Leben“ und<br />
„Person“ sowie die grundsätzliche Frage nach den Grenzen,<br />
die wir Menschen entweder anerkennen oder uns<br />
setzen sollten.<br />
Vilija Sipaite während ihres Referats im Seminar<br />
Den Abschluß bildete am Sonntagvormittag eine öffentliche Veranstaltung im Senatssaal der Europa-Universität<br />
Viadrina in Frankfurt/Oder. Dr. Stefan Münker, promovierter Philosoph aus Berlin, Autor zahlreicher Texte zur Medientheorie<br />
und Gegenwartsphilosophie sowie Kulturredakteur beim ZDF, hielt dabei den Gastvortrag zum Thema „Die<br />
Wirklichkeit aus der Perspektive ihrer digitalen Produzierbarkeit“. Eine seiner Hauptthesen lautete, dass wir es beim<br />
Phänomen der virtuellen Realität keineswegs mit einer zweitrangigen oder nur „scheinbaren“ Realität zu tun haben,<br />
sondern mit einer spezifischen Form einer ästhetischen Weise der Welterzeugung. Was speziell Implikationen für<br />
das Menschenbild betrifft, wies er vor allem auf einen von ihm so genannten „immateriellen Fehlschluß“ hin, demgegenüber<br />
er die Leiblichkeit unserer Erfahrungen auch virtueller Realitäten betonte. An den Vortrag schloß sich eine<br />
Diskussion zwischen dem Redner, den beiden Referentinnen des Seminars sowie den übrigen Teilnehmern an, in<br />
deren Verlauf die Möglichkeiten und Grenzen des Internets diskutiert wurden. S. Münker wies dabei darauf hin, daß das<br />
Szenario in der öffentlichen Debatte oft zu bunt und optimistisch oder im Gegenteil allzu schreckenerregend ausgemalt<br />
wird und bejahte die aufgeworfene These, daß Cyberspace und Internet insofern zu keinem vollkommenen<br />
Wandel des Menschenbilds geführt haben. Im Gegensatz dazu waren die Möglichkeiten einer klaren ethischen Bewertung<br />
der Chancen und Gefahren der neuesten Gentechnologien als brisantes, wenn nicht gar unlösbares Problem<br />
offen geblieben. Was konkrete Forschungen betrifft, überwog bei den Teilnehmern aber eindeutig Skepsis.<br />
Diskussionsbeitrag von Maria Shaton (Maria Shaton, Wirtschafts-Studentin, Weißrussland) „Wieso können die<br />
Menschen die Frage nach dem Leben der anderen Menschen so ruhig entscheiden – ich meine nicht nur das, was<br />
Terroristen tun, auch Gerichte sind nicht immer objektiv, es werden manchmal auch unschuldige Menschen verurteilt.<br />
Vielleicht sprechen wir zu abstrakt. Dostojewski hat gesagt: Die Freude der ganzen Welt ist nicht die Träne eines einzigen<br />
Kindes wert.“<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
31
32<br />
PROJEKTE 2001<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Bitte zuhören!<br />
Vilija Sipaite<br />
während ihres Referats<br />
im Seminar<br />
(2.v.re.: A. Homp)<br />
Thesen der Teilnehmer aus den Bewerbungsessays<br />
„Ich will an einem Einzelfall zeigen, wie philosophische Schlüsse nicht direkt zur unmittelbaren Lösung, sondern zur<br />
Erhellung der Problemstellung beitragen können - und das ist ja doch etwas, was die Praxis betrifft. (. . .) Ich bin<br />
davon überzeugt, daß das Problem der Abtreibung ein semantisches Problem in sich birgt. Wenn wir darüber streiten,<br />
ob Abtreibung Mord ist, streiten wir uns eigentlich um die Bedeutung des Wortes ‚Leben’. (. . .) Der<br />
Lebensbegriff gehört zu unseren Hilfsmitteln, mit denen wir unsere Welt strukturieren und sie uns so verständlicher<br />
machen. (. . .) Ziel meines Essays war zu zeigen, daß die negative oder positive Antwort auf die Frage ‚Ist Abtreibung<br />
Mord?’ davon abhängt, ob wir die Bedeutung des Ausdrucks ‚Leben’ so weit fassen, daß diese auch den Prozeß der<br />
Entwicklung des nichtgeborenen Kindes einbezieht bzw. welche Teile dieser Entwicklung wir als Leben bezeichnen<br />
und welche nicht mehr.“ (Pavel Zahrádka, 24, Philosophie-Student, Tschechische Republik)<br />
„Zweifellos hat uns der Einsatz der Technik einen hohen Lebensstandard gebracht, für den wir aber manchen<br />
Nachteil in Kauf nehmen müssen. Im Gegensatz zur Technik haben sich nämlich Moral, Verantwortungsbewußtsein<br />
und Ethik kaum weiterentwickelt. (. . .) Heutzutage fallen der technisierten Welt voller Hektik und Streß viele<br />
Menschen zum Opfer, die einfach das verrückte Tempo, den ständigen Stress und die Überanstrengung des modernen<br />
Lebens nicht aushalten. Das ist nämlich eines der wichtigsten Probleme der modernen Menschheit, das es früher<br />
nicht gegeben hat.“ (Natalia Lebed, 19, Design-Studentin, Weißrussland)<br />
„Vom Menschen der heutigen Tage können wir als von einem ‚kritischen Menschen’ sprechen. ‚Kritisch’ wird in diesem<br />
Falle in zwei Bedeutungen verstanden. (. . .) Beide Bedeutungen implizieren eine wesentliche Verunsicherung des<br />
Menschen in der Welt. Dieser reagiert darauf im Prinzip auf zwei Weisen: entweder umgibt er sich mit materiellen<br />
Gütern (im Unterschied zu den 50er oder 60er Jahren aber nicht mehr der Familie, sondern nunmehr des Individuums<br />
wegen), oder er beschäftigt seine Sinne in einem Maße, daß er zur Reflexion über sich selbst kaum Zeit<br />
findet. (. . .) Und was sagt der Staat dazu? Als Gemeinschaft der Politiker und Manager kann er nichts anderes tun,<br />
als noch mehr Wohlstand und noch mehr Spaß anzubieten. Analog dazu ist die europäische Integration zu betrachten:<br />
Werden nur die ökonomischen Interessen Europa verbinden, dann ist kaum etwas anderes zu erwarten als die ‚Verwandlung’<br />
des Europäers in einen homo oeconomicus.“ (Michal Jamny, 23, Philosophie-Student, Tschechische Republik)<br />
„Der Mensch bleibt derselbe - mit seinen eigenen Ängsten, Wünschen, Ambitionen usw. Aber die Umgebung des<br />
Menschen ändert sich immer, die Möglichkeiten werden mehr (. . .) Es ist klar, daß die philosophische Aufgabe in diesem<br />
Falle darin besteht, diese Tendenzen zu beobachten und klare Prognosen auszuarbeiten. Wir brauchen dem Fortschritt<br />
nicht zu widerstehen. Aber es ist notwendig, nicht nur die Menschen auf neue Technologien vorzubereiten, sondern<br />
auch mögliche Wege des Umgangs mit den neu entstehenden Dingen zu zeigen, den neuen Typ der Situation<br />
zu begreifen und in keine blinde Abhängigkeit zu geraten.“ (Peter Osadtschij, 21, Philosophie-Student, Weißrussland)<br />
„Der Mensch in der heutigen Welt oder die heutige Welt im Menschen? Wie stark veränderte sich die Beziehung<br />
‚Mensch - Welt’ in den letzten 50 Millionen Jahren? (. . .) Meiner Meinung nach verändert sich die Bewertung des<br />
Zusammenhangs ‚Mensch - Welt’ jeden Tag. Es ist heute schwierig, den Menschen der Natur entgegenzusetzen.<br />
Vielmehr bedeutet die Natur heute - die moderne Welt. Und diese moderne Welt befindet sich im Inneren des<br />
Menschen, gestaltet ihn und hat ohne ihn keine Existenz.“ (Maria Shaton, 21, Wirtschafts-Studentin, Weißrussland)<br />
„Schon Nietzsche hat bemerkt: der Mensch ist jener, der sich selbst überspringen möchte. Erfahrungstier, soziales<br />
Wesen, Vernunfttier - egal, an welche Definition man denkt, es ist immer ein Ungenügen vorhanden. Der Mensch ist<br />
etwas, was verständlich ist, und noch etwas, was darüber hinausgeht. Dies Etwas macht den Menschen zum Menschen.<br />
(. . .) Der Mensch ist immer Übermensch, weil der Mensch nie mit einem von uns wirklich zusammenfällt. Wir haben<br />
Vieles erfunden, um diesen Zwiespalt zu verbergen – Religion, Moral, Institutionen, die uns lehren, was wir tun sollen,<br />
damit wir mit dem Menschenbild zusammenfallen (Kant).“ (Olga Pilate, 24, Philosophie-Studentin, Lettland)<br />
Arndt Lorenz<br />
Suche nach dem „Unnormalen“<br />
06. – 16. Mai 2001 Studienreise Novi Sad/Jugoslawien<br />
Fotos: Susanne Töpfer<br />
Dresden/Deutschland<br />
PROJEKTE 2001<br />
"In Serbien ist alles in Ordnung!" Dieser Wunsch begegnet dem Ankommenden auf Schritt und Tritt.<br />
Novi Sad empfängt seine Gäste mit sauberen Straßen, großen, farbigen Werbetafeln. Flippige junge<br />
Leute gehen spazieren oder sitzen in den vielen Cafés und coolen Bars. Keine altersschwachen<br />
Busse mit Papp-Fensterscheiben, keine Bettler in den Fußgängerzonen.<br />
Novi Sad, 09.05.2001, an der Donau, M. Christalle, A. Lorenz (li.hi.), K. Mauersberger,<br />
E. Kowollik, D. Tomic (Gastgeber), J. Kühn, R. Sobotta, U. Zenner und A. Müller<br />
Novi Sad, 09.05.2001, Büro Otpor (Widerstand), A. Augustin<br />
und R. Sobotta<br />
Lange Gespräche mit den Vojvodinern. Vergebliche Suche in ihren Antworten nach dem erwarteten<br />
"Unnormalen". Sie hassen Milosevic und hätten ihm am liebsten in Jugoslawien den Prozess gemacht. Er ist an<br />
allem, aber auch allem schuld! Die Bombenangriffe der NATO werden ohne Groll, aber mit trauriger Stimme für<br />
schlechtes Wetter und ungewöhnlichen Zeckenbefall verantwortlich gemacht. Versuch der Novi Sader, damit<br />
Situationen zu erklären, durch die sie traumatisiert wurden und die sie nicht verstehen können.<br />
Direkt neben dem Wohngebiet, in dem tausende Menschen leben, der Anblick einer ehemals riesigen<br />
Hängebrücke: auseinandergefetzter Beton, dicke Heizungsrohre ragen zum Himmel, verdrehte Geländer, ins Donauwasser<br />
gefallene Fahrbahnen, aus den Angeln gehobene Fundamente. "In Serbien ist alles in Ordnung!" - am<br />
Strand neben dem zerstörten Bauwerk liegen Liebespaare, Kinder machen die ersten Schwimmversuche.<br />
Ein Militärschiff fährt vorbei. Wer und wo sind die Angehörigen des Novi Sader Militär- Korps? Diese Soldaten waren<br />
1991 verantwortlich für die Massaker im nur 80 Kilometer entfernten Vukovar. Kein Wort davon in den Gesprächen, stattdessen<br />
wird das friedliche Zusammenleben in der Vojvodina angepriesen.<br />
Langsam haben die jungen Studenten die Nase voll von den zermürbenden Polit- Diskussionen. Nach vorn schauen,<br />
Studium, später Arbeit, zur Disko gehen, vielleicht Reisen ins Ausland und das endlich wieder ohne lästiges Visum.<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
33
34<br />
THEODOR-HEUSS-KOLLEG<br />
Infos unter:<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Darius Polok<br />
www.theodor-heuss-kolleg.de<br />
Theodor-Heuss-Kolleg in Aktion?<br />
Wer, wenn nicht Du?<br />
Chancen für engagierte junge Menschen<br />
Foto: Steffen Giersch, Dresden<br />
Koordinator Theodor-Heuss-Kolleg (Berlin/Deutschland)<br />
Sind Dir gute Fragen manchmal wichtiger als fertige Antworten?<br />
Nimmst Du Dinge, mit denen Du unzufrieden bist, gleichgültig hin,<br />
oder willst Du Initiative ergreifen und Dein persönliches Lebensumfeld<br />
verantwortlich mitgestalten?<br />
Möchtest Du Dich in Schule, Universität oder Deinem Heimatort<br />
gemeinsam mit anderen engagieren und brauchst Du dazu Unterstützung,<br />
Kontakte und Wissen?<br />
Dann ist das Theodor-Heuss-Kolleg für Dich eine Chance, Ideen und Ziele mit anderen jungen<br />
Menschen aus Deutschland und Mittel- und Osteuropa zu verwirklichen. Im Theodor-Heuss-<br />
Kolleg wirst Du über einen längeren Zeitraum begleitet und gefördert.<br />
Die Sommerseminare sind nur der Anfang. Hier erwerben die Kollegiaten in Rollenspielen und<br />
praxisnahen Übungen praktisches Wissen über Demokratie und Medien. Sie üben auch die Durchführung<br />
von Projekten: von der ersten Idee bis hin zur Klärung technischer Details, wie der<br />
Erstellung von Zeit- und Finanzplänen oder der Formulierung von Projektanträgen. Danach<br />
kehren die Teilnehmer heim und arbeiten weiter selbstständig an den entwickelten Projekten.<br />
Sie werden dabei von Mentoren unterstützt und tauschen sich im Herbst bei einem der regionalen<br />
Fortbildungsseminare des Kollegs aus. Im Frühsommer des kommenden Jahres treffen sich alle<br />
Kollegiaten noch einmal, „um die Projektarbeit zu resümieren und sie der Öffentlichkeit vorzustellen“,<br />
sagt Darius Polok, einer der Koordinatoren des Theodor-Heuss-Kollegs.<br />
Auf den Seminaren wird das Wissen um demokratische Verfahren und Prozesse vermittelt. Die<br />
Verhandlungsführung in einer interkulturellen Situation wird zum Beispiel in einem Rollenspiel<br />
geübt, bei dem die in zwei Gruppen aufgeteilten Studenten die Rollen von Kommunalvertretern<br />
aus zwei Orten übernehmen. Ihre Aufgabe besteht darin, einen möglichst erfolgreichen<br />
Abschluß für den geplanten Bau einer Brücke zu erzielen, die über den Grenzfluß die<br />
beiden Orte Links- und Rechtsstadt miteinander verbinden soll.<br />
„Diese spielerischen Übungen helfen nicht nur dabei, uns gegenseitig besser kennenzulernen,<br />
sie vermitteln auch kostbare praktische Kompetenzen. Mit Sicherheit werde ich sie in der Zukunft<br />
nutzen können. Vielleicht sogar schon recht bald, denn gemeinsam mit Teilnehmerinnen<br />
aus Polen, Russland und Ungarn planen wir ein internationales studentisches Seminar, das sich<br />
mit dem Thema „Identität“ beschäftigen wird“, meint Elene Agladse, eine Jurastudentin aus<br />
Tbilissi/Georgien, die sich an ihrer Heimatuniversität in der studentischen Selbstverwaltung<br />
engagiert.<br />
„Ich schenke Dir mein Lächeln“<br />
Ein Projekt von Teilnehmerinnen des Theodor-Heuss-Kollegs<br />
Zwei von neun<br />
Plakatmotiven<br />
THEODOR-HEUSS-KOLLEG<br />
Zwei Beobachtungen des litauischen Alltags stehen am Anfang der Projektidee der beiden<br />
Heuss-Kollegiatinnen Jurgita Aniunaite und Margarita Vogelyte aus Litauen: Die Menschen in<br />
öffentlichen Verkehrsmitteln schauen trübe und unfreundlich vor sich hin. Über das Leben der Kinder<br />
in litauischen Heimen weiß niemand recht Bescheid. Aus dieser Beobachtung wurde beim<br />
Kollegseminar im März ein Projekt mit Zeit- und Kostenplan entwickelt und schon im April<br />
begannen die beiden Studentinnen mit der Durchführung. Zunächst wurden über das Bildungsministerium<br />
über 100 Bildungseinrichtungen in Litauen angeschrieben. Bis Ende April<br />
gab es bereits über 150 Einsendungen aus Heimen des ganzen Landes.<br />
„Die Bilder von Kindern und Jugendlichen bedeckten zuerst den ganzen Boden unserer<br />
Wohnung. Später wurden in einer Nachtaktion die Fenster im Foyer der Vytautas Magnus Universität<br />
voll mit den verschiedensten Lächeln beklebt und sogar um Mitternacht von den ersten<br />
Zuschauern bewertet. Die Bilder wurden im Rahmen der Deutschen Kulturtage in Kaunas<br />
neben einer Ausstellung von Günther Grass der Öffentlichkeit präsentiert“, berichtet Jurgita.<br />
Während ein Großteil der Bilder anschließend im Pädagogischen Museum in Kaunas ausgestellt<br />
wird, wurden ausgewählte Arbeiten für den Druck bearbeitet. Inzwischen erhielten die<br />
Heuss-Kollegiatinnen die Zusage der Litauischen Staatsbahn, im Herbst die Plakate in den<br />
Zügen aushängen zu dürfen. Auch einige Krankenhäuser in Vilnius und Kaunas haben bereits<br />
ihr Interesse an den Plakaten signalisiert. So werden die Plakate der Kinder aus den Heimen<br />
in den kommenden Monaten Tausenden Litauern ein Lächeln schenken und die graue<br />
Alltagswirklichkeit in Litauen etwas bunter gestalten. Durch diese öffentlichkeitswirksame<br />
Aktion sollen auch Spenden für die beteiligten Kinderheime gesammelt werden. D. Polok<br />
Tjumen und Mannheim, Tartu und Odessa – jetzt neu vernetzt auf<br />
www.spinne-magazin.de<br />
Das deutschsprachige Online-<br />
Magazin „die spinne“ erscheint<br />
jeden Monat und bietet<br />
Informationen und Geschichten rund<br />
um Mittelosteuropa. Die schon<br />
länger existierende Idee für das<br />
Magazin wurde im Märzseminar des<br />
Theodor-Heuss-Kollegs von<br />
Studenten aufgegriffen und während<br />
der Sommermonate konkretisiert.<br />
Wir hoffen, dass „die spinne“ ein<br />
reizvolles Angebot für Euch, Eure<br />
Arbeit, Euer Studium darstellt und<br />
ihr als Leser, Autoren oder Werber<br />
aktiv werdet!<br />
Fotos: Theodor-Heuss-Kolleg<br />
Jurgita Aniunaite Margarita Vogelyte<br />
Mal wieder einen Wajda gesehen? In der Donau geangelt? Weißrussisch gewählt?<br />
Dann solltet Ihr Eure Beobachtungen und Meinungen an „die spinne“ schicken!<br />
Ab sofort könnt Ihr mitplanen, mitschreiben, mitfotografieren ... und natürlich auch lesen, was<br />
andere woanders denken und tun.<br />
Für die monatlichen Ausgaben brauchen wir noch:<br />
- Texte zu den jeweiligen Schwerpunktthemen<br />
- Rezensionen<br />
- Länderreportagen<br />
- Interviews<br />
- Fiktionales<br />
Redaktionsschluss ist jeweils der 20. des Vormonats. Bitte schickt bereits existierende Texte<br />
oder noch neu zu schaffende Werke an<br />
spinne@theodor-heuss-kolleg.de<br />
Dorthin gehen bitte auch alle Eure Vorschläge und Fragen an die Redaktion:<br />
Petra Puhova (SK), Maxim Pimanyonok (BY), Angela Hohlfeldt (D), Heike Fahrun (D)<br />
Spinnt los! Das Redaktions-Team<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
35
UMFRAGE<br />
?<br />
Warum<br />
bist Du/sind Sie <strong>MitOst</strong>-Mitglied ?<br />
Foto: Steffen Giersch, Dresden<br />
Kalmer Piskoop Tallinn, Estland<br />
?<br />
?<br />
Nils-Eyk Zimmermann Berlin, Deutschland<br />
weil mitost meinem typ entspricht (modern, postmateriell und auf<br />
der suche nach der identitaet)<br />
weil es mitost nicht überall zu kaufen gibt<br />
Viktoriya Kovalyshyna Luzk, Ukraine<br />
Für mich ist wichtig, dass ich die deutsche Sprache praktizieren und<br />
andere, die vielleicht aus verschiedenen Kulturen kommen, kennenlernen<br />
kann. Wenn ich ein Mitglied von <strong>MitOst</strong> bin, kann ich<br />
mich besser über unterschiedliche Veranstaltungen erkundigen und<br />
vielleicht über die Organisation auch jemanden nützlich sein. Es<br />
besteht auch Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen, falls mir<br />
etwas einfällt, was meiner Meinung nach unbedingt so zu realisieren<br />
wäre. Und ich kann es auch nicht ohne erwähnen lassen, dass<br />
die meisten Kosten für die Teilnahme an den Veranstaltungen<br />
<strong>MitOst</strong> übernimmt - so kann ich mehr Europa sehen.<br />
Meine Teilnahme am <strong>MitOst</strong> Verein ist Weg der Zusammenarbeit,<br />
Zukunftsgrundlage der europäischen Staaten und der Ukraine im<br />
einzelnen. Probleme in jedem europäischen Staat sind Stimulus zur<br />
Entwicklung dieser Staaten und Unterpfand ihres Erfolges.<br />
Austausch zwischen Ländern gibt die Möglichkeit zur schnellen Lösung<br />
von Problemen und ist Triebkraft unseres gemeinsamen Fortschritts,<br />
des einzelnen Menschen, der Gesellschaft und des Staates.<br />
Meine Teilnahme besteht im schnellen und zugänglichen Informationsaustausch<br />
zwischen den Menschen und Organisationen, die zusammenarbeiten<br />
wollen und zwischen denen nur die sprachliche<br />
Barriere entsteht. Die Barriere, die leicht überwunden sein kann.<br />
Kay Hempel Dresden, Deutschland<br />
Weil ich OHNE OST nicht sein kann.<br />
Alles ist einfach, nicht wahr?<br />
Sabine Krüger und Jörg Rauch Stuttgart, Deutschland<br />
Viktoria Bondarenko Donezk, Ukraine<br />
...weil das gemeinsame Lachen verbindet.<br />
Seitdem ich mich mit der Philosophie befasse, hege ich den Traum, ...entdecke Dein Land durch Kontakt mit dem Fremden.<br />
einmal meine Gesinnungsgenossen zu finden. Dieses Jahr ist mein ...weil es auch kulinarisch noch so viel zu entdecken gibt.<br />
Traum zur Erfüllung gekommen: ich bin zum Mitglied des <strong>MitOst</strong>-<br />
Vereins geworden. Die Mitgliedschaft in der Organisation bietet mir<br />
...weil es schon genug Vorurteile auf der Welt gibt.<br />
die Möglichkeit, viele interessante Menschen – junge, verwegene, Kirill Plotnikov Woronesch, Russland<br />
nach Wahrheit strebende Interessenten und gelehrte, weise Fachleute,<br />
Professoren auf dem Gebiet der Philosophie kennenzulernen.<br />
Was bleibt mit uns das ganze Leben lang? Geld? Arbeit? Würde ich<br />
nicht sagen. Was denn? Freunde und noch mal – Freunde!!!<br />
Verschiedene Kulturen treffen sich im Rahmen dieser Organisation,<br />
Matthias Zillich<br />
und sie schaffen zusammen... Keinen Kampf gegen einander, kei-<br />
Warum ich Mitglied bei <strong>MitOst</strong> bin? Das würde ich selber gerne wisnen Terror... und das ist wichtig zur Zeit, unglaublich wichtig!!! Wir<br />
sen. Das hat sich so ergeben. Wenn man erst mal Lektor bei Bosch sind alle Freunde... und keine Feinde! Das ist, was uns dieser Verein<br />
ist, dann kommt man an <strong>MitOst</strong> kaum vorbei. Es wäre gut mit Ähn- gibt... Meine besten Freunde habe ich in Bratislava am Festival des<br />
lichgesinnten Kontakt zu haben und vielleicht etwas Gemeinsames Deutschen Theaters und auf der Mitgliederversammlung in Krakau<br />
zu entwickeln – ist wohl in erster Linie mein Gedanke dabei. kennengelernt. DAS ist meine Antwort, warum ich Mit-Ostler bin!<br />
Heike Fahrun Berlin, Deutschland<br />
Petja Stefanova Veliko Tarnovo, Bulgarien<br />
Kennst Du nicht diese Drückermethoden, bei denen man nach dem <strong>MitOst</strong> Mitglied bin ich weil <strong>MitOst</strong> vereinigt, weil ich dadurch Leute<br />
Einflößen von zwei Flaschen reinsten polnischen (!) Wodkas und mit ähnlichen Interessen treffen kann, weil ich die Welt besser ken-<br />
unter Vorspiegelung irgendeines mittelosteuropäischen (ein Wort,<br />
das einem in diesem Zustand nur noch schwer über die Lippen<br />
nenlernen kann. Es macht mir Spaß, international beteiligt zu sein.<br />
geht) Brauches ein rötlich-graues Faltblatt unterschreibt (und auch<br />
das nur, um endlich schlafen gehen zu können)?<br />
36 <strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001 ?<br />
(e-mail-Umfrage, August 2001, R. Sobotta und S. Töpfer)<br />
Der „normale Wahnsinn“ unserer<br />
Welt: Russendisko<br />
Wladimir Kaminer „Russendisko“,<br />
Goldmann Verlag, München, 9. Auflage, 2000<br />
Dorothea Leonhardt, (München/Deutschland)<br />
Eigentlich ist dieses Magazin ja eher als Forum für weniger bekannte<br />
Künstler gedacht, aber das Buch „Russendisko“ von Wladimir Kaminer<br />
paßt gut zum Thema (siehe Seite 20-21, Greencard in Deutschland).<br />
Wladimir Kaminer ist zwar weder Greencard-Russe noch IT-<br />
Spezialist, aber er ist ein Russe, der in Deutschland lebt, und er hat<br />
seine Eindrücke als Ausländer im allgemeinen, und als Russe im besonderen<br />
in Essays witzig, satirisch, manchmal auch melancholisch,<br />
immer genau beobachtend, zum Ausdruck gebracht.<br />
Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Nach einer<br />
Ausbildung als Toningenieur studierte er Dramaturgie am Moskauer<br />
Theaterinstitut. Seit 1990 lebt er mit seiner Frau und zwei Kindern<br />
in Berlin. Kaminer ist als freier Autor und „Multikultischaffender“<br />
mittlerweile auch über Berlin hinaus bekannt. Er schreibt für taz und<br />
FAZ, hat eine wöchentliche Sendung „Wladimirs Welt“ beim SFB4<br />
und organisiert im Kaffee Burger Veranstaltungen wie seine mittlerweile<br />
berüchtigte „Russendisko“. Bei dieser Veranstaltung legt er<br />
solange russische Musik auf, bis alle weinen und/oder völlig besoffen<br />
sind. Sehenswert ist die Seite: www.russendisko.de. Die Erzählsammlung<br />
„Russendisko“ ist sein erstes Buch.<br />
Nun aber zum Buch: In „Russendisko“ beschreibt Wladimir Kaminer<br />
wie er, seine Frau Olga, seine Eltern und seine Freunde sich in der<br />
westlichen Welt und Berlin zurechtfinden. Er beschreibt den ganz<br />
„normalen Wahnsinn“ unserer Welt aus der Sicht eines Beobachters<br />
von Außen, mit dem Blick von einem, dem diese Welt fremd ist, die<br />
doch seine eigene ist. Niemals jedoch blickt er dabei von oben<br />
herab. Er zeichnet stets ein liebevolles, einfühlsames Porträt seiner<br />
Alltagsprotagonisten, auch ist seine Ironie niemals böse oder gar verletzend,<br />
sondern stets mit einem Augenzwinkern. So schildert er z.B.<br />
wie sein Vater, die Herausforderungen des Moskauer Alltags vermissend,<br />
beschließt, den Führerschein zu machen und dabei drei<br />
Fahrlehrer „aufarbeitet“, oder wie er seinen Berater vom Arbeitsamt<br />
abends in der Schwulenszene trifft und die nette, pummelige Anlageberaterin<br />
der Sparkasse als Tänzerin in einem Audioballett.<br />
Meist schafft er mit wenigen kurzen Sätzen, eine Charakteristik und<br />
eine ganze Stimmung wieder zu geben, wenn er z.B. eine deutsche<br />
Amtsstube beschreibt: „Seine Krawatte paßte farblich perfekt zu<br />
den Farben der Tapete im Büro. Er klang sehr überzeugend und<br />
verdarb mir für den Rest des Tages gründlich die Laune“.<br />
Wenn man sich wie ich jahrelang bemüht hat, eine fremde Sprache<br />
so perfekt zu lernen, um als Übersetzer sein Dasein zu bestreiten, muß<br />
man - nicht ohne Neid - anerkennen, daß es eine Meisterleistung<br />
ist, in einer fremden Spache zu brillieren wie Wladimir Kaminer.<br />
Susanne Kitlinski, (Lektorin und Regionalkoordinatorin<br />
in Witebsk/Weißrussland)<br />
BUCH-TIPP<br />
Ein Ort, an dem man malt wie die<br />
Vögel singen<br />
Friedrich Gorenstein „Malen wie die Vögel singen“<br />
Ein Chagall-Roman. Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin, 1998<br />
Hört man den Namen Witebsk, denkt man vielleicht zuerst an einen<br />
Rechtschreibfehler eines Russen, der Deutsch lernt, sollte es nicht<br />
besser Bizeps heißen? In einem alten russischen Reiseführer bezeichnet<br />
man Witebsk als die Geburts- und Wirkungsstätte Marc Chagalls.<br />
Heute erinnern immerhin noch ein Denkmal, das Geburtshaus und ein<br />
kleines Museum an ihn. Der ukrainische Schriftsteller Friedrich Gorenstein<br />
hat Chagalls Koordinaten genommen und einen Roman daraus<br />
gemacht. Fast ein ganzes Jahrhundert hat es gedauert, Chagalls Leben,<br />
und immer waren der Teufel und das Glück anwesend, laut<br />
Gorenstein. Kein Wunder, denn Chagall wurde in einem brennenden<br />
Haus geboren und war durch den jüdischen Glauben nicht nur<br />
einmal dem Tode ausgesetzt. Das Glück aber schien sein Schicksal<br />
zu sein, denn irgendwie schaffte er es immer wieder, weiterzukommen,<br />
auch wenn er sich nie richtig wohl gefühlt hatte an einem Ort.<br />
Vielleicht waren es gerade seine Bilder und die Wahrnehmung seiner<br />
Umwelt, die ihm Kraft gaben, weiterzumachen. Von Witebsk aus ging<br />
er nach St. Petersburg und später nach Paris. Doch Witebsk und seine<br />
zurückgelassene Familie gingen ihm nicht aus dem Kopf. Vom Heimweh<br />
getrieben, nach kurzem Zwischenstopp in Deutschland, kehrte<br />
er wieder nach Witebsk zurück. Aber auch hier fand Chagall keine<br />
Ruhe, fühlte sich unverstanden und fremd. Zuerst wurde er als Kommissar<br />
für künstlerische Angelegenheiten gefeiert und leitete als Direktor<br />
die Kunstakademie, doch der Kommunismus überrollte ihn, brauchte<br />
seine Kunst nicht mehr. Er wurde wieder fallen gelassen und flüchtete<br />
mit seiner Familie nach Frankreich, wo er auch seinen Lebensabend<br />
verbrachte.<br />
Der leichte, direkte Erzählton und die fast naive Darstellung der Figuren,<br />
gemischt mit Ironie und zeithistorischen Ereignissen, ergeben<br />
einen lebendigen Roman, der viele einzelne Momentaufnahmen<br />
aus dem Leben Chagalls vereinigt. Gorenstein lässt die Figuren<br />
immer selber sprechen, aber die grotesken und prophetischen Hinweise,<br />
wie zum Beispiel die Gastgeschenke in Auschwitz, wo der<br />
Antisemitismus tobt, oder das Gespräch mit einem deutschen<br />
Soldaten, lassen den Leser stolpern und<br />
verdeutlichen die Tragik und die Wunderwelt<br />
von Chagall. Dabei werden Zeitgenossen<br />
wie Degas, Trotzki und Malewitsch<br />
geschickt in die Romanhandlung<br />
eingebunden, und es stellt sich immer<br />
wieder die Frage, ob das wohl wirklich<br />
so war. Alles bleibt so schillernd wie<br />
Chagalls Bilder.<br />
Chagalldenkmal in Witebsk<br />
Foto: S. Kitlinski<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
37
38<br />
BUCH-TIPP<br />
Von deutschen Klassikern und polnischem Lesestoff<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
Thomas Brussig „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“<br />
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/Main, 2001<br />
Heike Fahrun (1998-2000 Lektorin in Polen, jetzt Berlin/Deutschland)<br />
„Was die Polen lesen“ wird uns z.B. regelmäßig-unregelmäßig in<br />
„DIE ZEIT“ präsentiert. Aber was davon ist auf Deutsch geschrieben?<br />
Auch in Polen ist es nicht anders als auf dem deutschen Büchermarkt:<br />
gekauft wird vor allem Ratgeber-Literatur, die einem nach der<br />
Lektüre Erfolg, Geld oder Liebe verspricht. Und wenn es um die Belletristik<br />
des großen westlichen Nachbarn geht, herrscht in der Nobelpreisträger-Nation<br />
im Allgemeinen gähnende Solidität: „Deutsche<br />
Literatur, das sind bei uns verstaubte Exemplare, die in einem vergessenen<br />
Winkel der Bibliotheken stehen [...] In den Buchhandlungen<br />
erscheinen sporadisch Neuausgaben deutscher Klassiker, an<br />
der Spitze „unser“ Grass, aber Tatsache ist, dass die deutsche<br />
Literatur während der letzten Jahre kein Leckerbissen für unsere<br />
Verleger war.“ – so klagen zumindest zwei Warschauer Germanistik-<br />
Studentinnen in einem Leserbrief an die „Gazeta Wyborcza“.<br />
Nun haben wir alle nichts gegen unseren Nobelpreisträger, aber<br />
betrachtet man, was in polnischen Buchhandlungen an deutschsprachiger<br />
Literatur vorhanden ist, dann muss man den beiden<br />
Studentinnen vorsichtig Recht geben: die deutsche Serie der<br />
Wydawnictwo Literackie z.B. (www.wl.net.pl) wartet auf mit Kleist,<br />
Canetti, Döblin u.a.; ETA Hoffmann ist ebenso wie Franz Kafka jederzeit<br />
lieferbar. Auch wenn man sich die Liste der durch Inter Nationes<br />
geförderten Übersetzungen der letzten Jahre ansieht, trifft der<br />
„Klassiker-Vorwurf“ zu: da stehen „unser“ Grass und Ernst Jünger<br />
neben Goethes „Wanderjahren“ und Gedichten von Eduard Mörike.<br />
Zu den wenigen Ausnahmen zählen die Walser-Töchter Alissa und<br />
Theresia, Alt-Raver Rainald Goetz und der unvermeidliche Bernhard<br />
Schlink mit seinem „Vorleser“ – und auch die „Hotzenplotz“-Bücher<br />
von Ottfried Preußler scheinen im Rahmen des Kulturaustausches<br />
eine Übersetzung wert.<br />
Aber zumindest in einer Hinsicht können unsere Studentinnen, die<br />
gern auch SchriftstellerInnen wie Karin Duve, Thomas Brussig, Jenny<br />
Erpenbeck und Benjamin Lebert im polnischen Literaturwissen verankern<br />
würden, getröstet werden: Brussigs „Am kürzeren Ende der<br />
Sonnenallee“ soll im Januar 2002 auf Polnisch erscheinen. Nachdem<br />
die Verfilmung von Leander Haußmann schon im November 2000<br />
in den polnischen Kinos lief, nimmt sich Wydawnictwo Czarne<br />
(www.czarne.com.pl) nun der Romanvorlage an. Der kleine Verlag,<br />
der vor allem polnische Schriftsteller herausgibt, wird von Monika<br />
Sznajderman geleitet. Sie ist verheiratet mit Andrzej Stasiuk, einem<br />
der erfolgreichsten polnischen Gegenwartsautoren, der auch für<br />
Teile des Verlagsprogramms verantwortlich ist. Da Stasiuk auf der<br />
Frankfurter Buchmesse im letzten Jahr aus seinem Desinteresse an<br />
deutscher bzw. westlicher Literatur kein Geheimnis machte – der<br />
größte Teil der ausländischen Autoren bei Czarne kommt aus den<br />
süd-/östlichen Nachbarländern, die einzige weitere deutschsprachi-<br />
ge Schriftstellerin dort ist nicht zufällig die Rumäniendeutsche Herta<br />
Müller, muss wohl einiges für Thomas Brussig gesprochen haben.<br />
Schon 1998 konnte man in einer Ausgabe des polnischen Magazins<br />
„Literatura na swiecie“ Auszüge aus Brussigs Roman „Helden wie<br />
wir“ lesen, mit dem der ostdeutsche Autor 1995 berühmt wurde.<br />
Erst vier Jahre später folgte dann, quasi im Kombipack mit der<br />
Verfilmung, „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“. Warum also das<br />
begeisterte „tak, Aleja, tak“, wie es in einer Mail der Czarne-<br />
Verlegerin an die Übersetzerin Alicja Rosenau heißt, warum nicht die<br />
Geschichte von Klaus Uhltzscht, der durch seinen Penis die Berliner<br />
Mauer zum Einsturz brachte?<br />
Schon Alicja, die nach dem Kinobesuch auf eigene Faust mit der<br />
Übersetzung begann, fand in „Sonnenallee“ beschrieben, was sie<br />
auch als Polin nachvollziehen konnte – in einem unfreien politischen<br />
System trotz allem gut leben zu können. Brussigs Roman<br />
schildere viele „Sehnsüchte, die jetzt nicht mehr existieren“ würden,<br />
weil sie erfüllbar geworden seien. Für Czarne war dies angeblich der<br />
Grund, „Sonnenallee“ dem zu sehr von DDR-internen Dingen dominierten<br />
„Helden wie wir“ vorzuziehen. Das dort im Vordergrund stehende<br />
Stasi- und Mitläufertum habe in Polen nicht die selbe Bedeutung<br />
gehabt und wäre daher auch im Nachhinein nicht von<br />
Interesse. Wenn in „Sonnenallee“ dagegen der lange und mühsame<br />
Versuch beschrieben wird, in den Besitz des 72er-Stones-<br />
Albums „Exile on Main Street“ zu kommen, dann ähnelt dies auch<br />
Andrzej Stasiuks eigenen Erfahrungen, wie er sie in seiner Autobiographie<br />
„Jak zostalem pisarzem“ (Wie ich Schriftsteller wurde) darstellt.<br />
In einer Gesellschaft, die eigentlich alles versuchte, um ihre<br />
Mitglieder unter Kontrolle zu halten, kann Stasiuk sagen: „Ich war frei<br />
und hatte keinen Hunger“. Wie in einem revolutionären Traum.<br />
Gesellschaft scheint hier nur eine Folie zu sein, vor der sich die eigenen<br />
Wünsche und der eigene Freiheitsdrang entfalten (können sollen).<br />
Und mögen die Zeiten unschön und der Ort so verrückt sein<br />
wie das kurze Ende der Sonnenallee, wichtig und berichtenswert<br />
sind die subjektiven Erinnerungen – an die erste Liebe, den ultimativen<br />
Song oder die Entdeckung des eigenen Talents. Das Revolutionäre,<br />
der (pubertäre) Protest folgt keiner politischen, „sondern<br />
vielmehr einer ästhetischen Moral“ – so eine polnische Rezension<br />
zum Film „Sonnenallee“. Man darf annehmen: Es geht um die<br />
Authentizität des eigenen Lebens, die auch vor dem Hintergrund<br />
einer grauen (oder inzwischen zu bunten?) Welt gewahrt werden<br />
will und die in Polen so gefragt ist wie anderswo. Brussigs Held<br />
Micha beschreibt dies in einem Paradox: „Es war von vorn bis hinten<br />
zum Kotzen, aber wir haben uns prächtig amüsiert.“ Gibt es also<br />
doch ein wahres Leben im falschen?<br />
Projektmittel<br />
Projektvolumen 1997-2001 890.000 DM<br />
Anteil Robert Bosch Stiftung GmbH 523.000 DM 59 %<br />
Eigenleistung <strong>MitOst</strong> und Drittmittel 367.000 DM 41 %<br />
Für die finanzielle und ideelle Unterstützung<br />
möchten wir uns bedanken bei:<br />
Robert Bosch Stiftung GmbH (Stuttgart/Deutschland)<br />
Körber Stiftung (Hamburg/Deutschland)<br />
ZAHLEN UND FAKTEN/DANK<br />
Die für 2001 verwendeten Zahlen beruhen auf dem Kosten- und Finanzierungsplan und sind<br />
daher nicht endgültig.<br />
Goethe-Institute an verschiedenen Standorten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa<br />
Stiftung für West-Östliche Begegnungen (Berlin/Deutschland)<br />
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds (Prag/Tschechische Republik)<br />
Centrum für angewandte Politikforschung (München/Deutschland)<br />
Freudenberg Stiftung GmbH (Weinheim/Deutschland)<br />
Stiftung für Bildung und Behindertenförderung GmbH (Stuttgart/Deutschland)<br />
Österreichisches Ost- und Südosteuropainstitut<br />
Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland in Mittel-, Ost- und Südosteuropa<br />
Internationale Jugendbegegnungsstätte Kreisau (Krzyzowa/Polen)<br />
Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD (Bonn/Deutschland)<br />
Kulturamt Oldenburg (Deutschland)<br />
Rotary Club<br />
BMW (Deutschland)<br />
Slowak International Tabak (Slowakische Republik)<br />
Europäische Universität Viadrina (Frankfurt/Oder / Deutschland)<br />
Collegium Polonicum Slubice (Slubice/Polen)<br />
Stadt Namest’ nad Oslavou (Tschechische Republik)<br />
Universität Regensburg, Institut für Germanistik (Deutschland)<br />
Verein zur Förderung regional kultureller Vielfalt (Hollabrunn/Österreich)<br />
Außenministerium der Tschechischen Republik (Prag/Tschechische Republik)<br />
Land Hessen (Deutschland)<br />
Freundeskreis Alte Brücke Novi Sad (Berlin/Deutschland)<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen, Institut für Neuere Deutsche Literatur (Deutschland)<br />
Litblockin Verlag (Fernwald/Deutschland)<br />
Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obcych w Chelmie, NKJO (Chelm/Polen)<br />
Direktorium für Entwicklungszusammenarbeit des Schweizer Außenministeriums, DEZA<br />
(Schweiz)<br />
…und bei vielen weiteren Förderern von <strong>MitOst</strong>-Projekten<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 8 | November 2001<br />
39
Wjatscheslaw Kuprijanow<br />
wurde 1939 in Novosibirsk geboren. Er arbeitete zunächst als Bauarbeiter und studierte dann<br />
Mathematik und Germanistik. Er lebt als Lyriker, Schriftsteller, Übersetzer und Literaturwissenschaftler<br />
in Moskau. Er übersetzte unter anderem Werke von Hölderlin, Novalis, Rilke, Brecht<br />
und Jandl. Seit 1986 unternimmt Kuprijanow regelmäßig Lesereisen in die Bundesrepublik. Es<br />
sind mehrere Gedichtbände, Romane und Erzählungen auf Deutsch erschienen.<br />
Dorothea Leonhardt<br />
bald beginnt das leben<br />
bald beginnt das leben<br />
mit zwei (du kannst schon reden<br />
nur das hören stört) mit sieben<br />
(du kannst schon lesen<br />
nur das reden stört) mit 17<br />
(du kannst schon lieben<br />
nur das lesen stört) mit 33<br />
(du kannst schon denken<br />
nur das schreiben stört) mit 41<br />
mit 50 mit 65 mit 100 (es gibt<br />
noch das leben nach dem leben)<br />
bald beginnt das leben<br />
in rußland (in amerika<br />
hat es schon begonnen)<br />
in lettland (im abendland<br />
ist es schon untergegangen)<br />
im gelobten im schlaraffenland<br />
bald beginnt es (der krieg<br />
hat schon begonnen) nach dem<br />
30jährigen 100jährigen<br />
6-tage-krieg nach dem großen<br />
vaterländischen bosnischen<br />
nach dem ersten dem dritten<br />
weltkrieg nach dem kalten<br />
sternschildbürgerkrieg<br />
nach dem frieden abkommen<br />
umbruch umzug frühling sieg<br />
herbst winter unter dem guten<br />
zaren präsidenten generalsekretär<br />
es beginnt im<br />
altertum jugendstil mittelalter<br />
in der eisenzeit eiszeit zeit x<br />
in dem x. dem xx. dem xxx.<br />
jahrhundert unserer zeit im jahr<br />
1849 1861 1917 1945 1953 1991<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2996<br />
1996<br />
Die Gedichte wurden von Wjatscheslaw Kuprijanow und Rudolf Stirn ins Deutsche übertragen.<br />
Aus: Wjatscheslaw Kuprijanow: Eisenzeitlupe - Gedichte; Alkyon Verlag, D-71554 Weissach i.T., 1996.<br />
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Alkyon Verlages.<br />
Weitere Gedicht- und Prosabände von Wjatscheslaw Kuprijanow sind beim Alkyon Verlag erschienen.<br />
stilleben<br />
augapfel<br />
glühbirne<br />
und eine träne<br />
dazwischen<br />
Eine Täuschung<br />
Der Dichter, der hellsehende,<br />
bespricht mit den Blindgewordenen<br />
die Aussichten einer Zukunft<br />
der allwissende<br />
fragt die Unverständigen<br />
über das Unerhörte aus<br />
und all das<br />
äußert er lautstark<br />
um es vor den Tauben<br />
auf ewig<br />
zu verbergen<br />
X X X<br />
mit verwirrung<br />
habe ich gelesen<br />
alle rätselhaften völker der geschichte<br />
sind längst ausgestorben<br />
geblieben sind nur<br />
ganz gewöhnliche<br />
nicht ungewöhnlich<br />
daß dieses rätsel der geschichte<br />
ohne lösung bleibt<br />
Rußlands Traum<br />
Rußland schlummert in kühlem Tau<br />
und träumt<br />
es wäre Amerika –<br />
seine Schwätzer – Kongreßmitglieder<br />
seine Faulenzer – Arbeitslose<br />
seine Raufbolde – Gangster<br />
seine Trinker – Drogenabhängige<br />
seine Schwarzhändler – Manager<br />
seine Russen – Neger<br />
Ausflüge zum Mond sind die Regel<br />
Rußland wird wach in kaltem Schweiß<br />
als wäre alles ganz unverändert<br />
Schwätzer die Schwätzer<br />
Faulenzer die Faulenzer<br />
Raufbolde die Raufbolde<br />
Schwarzhändler die Schwarzhändler<br />
Russen die Russen<br />
Man muß nur richtig landen<br />
Und Rußland schlummert wieder ein<br />
und träumt die russische Idee –<br />
daß sich Amerika im Traum<br />
als Rußland sieht