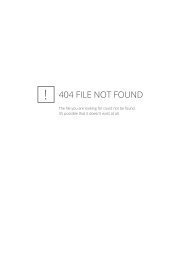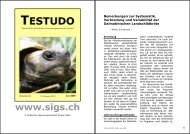Methoden der Beobachtung und Bestandserfassung ... - VipersGarden
Methoden der Beobachtung und Bestandserfassung ... - VipersGarden
Methoden der Beobachtung und Bestandserfassung ... - VipersGarden
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Methodische Gr<strong>und</strong>lagen für Schutzmaßnahmen von Moorfröschen (Rana arvalis) 435<br />
Braunfrösche ansprechen, denn in diesem Stadium sehen sich Gras- <strong>und</strong> Moorfrosch<br />
äußerst ähnlich (gleiches gilt für Moor- <strong>und</strong> Springfrosch). Nur mit viel Erfahrung<br />
<strong>und</strong> einer 10-fach vergrößernden Handlupe kann man einen Teil <strong>der</strong> Jungtiere von<br />
Moor- <strong>und</strong> Grasfrosch auf Gr<strong>und</strong> des Aussehens <strong>und</strong> <strong>der</strong> Länge des inneren Fersenhöckers<br />
(Callus internus) unterscheiden. Bezüglich weiterer möglicher Unterscheidungsmerkmale<br />
frisch metamorphosierter Braunfrösche sei auf FOG (2008) verwiesen.<br />
Herbstbeobachtungen<br />
Viele Amphibienschützer sind im Frühjahr <strong>und</strong> Sommer unterwegs. Dass aber auch<br />
<strong>der</strong> Herbst viele <strong>Beobachtung</strong>en, manchmal bessere als im Sommer, ermöglicht, ist<br />
noch immer nicht genügend bekannt. Eine Reihe Amphibienarten, so auch <strong>der</strong> Moorfrosch,<br />
vollziehen im September Herbstwan<strong>der</strong>ungen, die zumeist in Richtung Laichgewässer<br />
führen (vgl. GLANDT 1986). Ein nicht geringer Teil <strong>der</strong> Tiere einer Moorfrosch-Population<br />
dringt dabei bis zum Laichgewässer vor (HARTUNG & GLANDT<br />
2008). Dann findet man vor allem halbwüchsige <strong>und</strong> adulte Tiere, <strong>der</strong>en Unterscheidung<br />
von den an<strong>der</strong>en mitteleuropäischen Braunfröschen meist keine Probleme bereitet.<br />
Die älteren Tiere sind allerdings recht flink, <strong>und</strong> man muss schnell sein, um sie mit<br />
<strong>der</strong> Hand zu fangen. Es ist immer wie<strong>der</strong> bemerkenswert, wie schnell Moorfrösche in<br />
dichter bodennaher Vegetation verschwinden können, nach meinem Eindruck viel<br />
schneller als Grasfrösche. Dabei dürfte ihnen ihre geringere Körpergröße <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
spitzere Kopf sehr zu Gute kommen.<br />
Schätzung <strong>der</strong> Populationsgröße<br />
Wenn man eine Aussage zur Größenordnung des Bestandes einer Moorfrosch-<br />
Laichgemeinschaft machen will, wie sie für faunistische Kartierungen <strong>und</strong> Naturschutzzwecke<br />
in <strong>der</strong> Regel ausreichend ist, bietet sich am ehesten die Zählung o<strong>der</strong><br />
Schätzung <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> auffälligen, faustgroßen Laichballen an. Nur in kleinen Beständen<br />
ist ein Abzählen <strong>der</strong> Laichballen möglich. Schon einige Hun<strong>der</strong>t Laichballen,<br />
die meist in Ansammlungen abgelegt werden, lassen sich nur noch schätzen. Hierzu<br />
wählt man sich je Laichballen-Ansammlung einen kleinen Ausschnitt (ich wähle ca. 30<br />
x 30 cm) <strong>und</strong> zählt möglichst genau die hierin befindlichen Laichballen aus, sodann<br />
wird auf die gesamte Laichballen-Fläche hochgerechnet. Wie immer bei solchen<br />
Schätzungen braucht man etwas Übung. Eine zweite Person, die unabhängig von<br />
einem selbst nochmals zählt <strong>und</strong> hochrechnet <strong>und</strong> mit <strong>der</strong> man sich anschließend<br />
abgleicht, kann deshalb in <strong>der</strong> Anfangsphase eines Erfassungsprojektes hilfreich sein.<br />
Zwei Annahmen sind notwendig, um über die Zahl <strong>der</strong> Laichballen die Bestandsgröße<br />
abschätzen zu können. Die erste Annahme ist, dass je adultem Weibchen <strong>und</strong><br />
Saison ein Laichballen abgelegt wird. Die Angaben in <strong>der</strong> Literatur hierzu sind nicht<br />
einheitlich. Manche Autoren geben 1–2 Ballen je Weibchen, an<strong>der</strong>e einen Ballen (im<br />
Einzelnen siehe GLANDT 2006). Letzteres scheint aber die Regel. Deshalb <strong>und</strong> aus<br />
praktischen Gründen empfehle ich, einen Ballen je Weibchen anzunehmen, jedenfalls<br />
solange, bis eindeutige <strong>und</strong> bessere Daten als die bisherigen vorliegen.