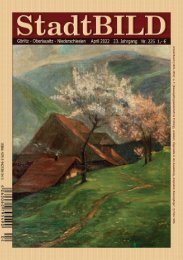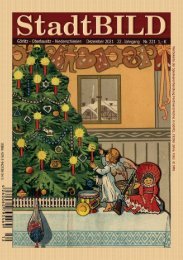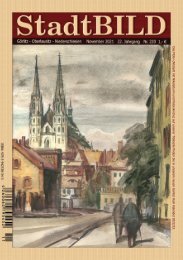06_StadtBILD_Juni 2022
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Görlitz, Figurenschmuck an einem Hauseingang (Foto: Adobe Stock.de)
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
Vorwort<br />
Sie halten heute die druckfrische <strong>Juni</strong>ausgabe unseres<br />
beliebten <strong>StadtBILD</strong>-Magazins in den Händen.<br />
Nach 3 Monaten Krieg im Osten Europas spüren wir<br />
täglich die Auswirkungen in Verknappung und Verteuerung<br />
vieler Waren des täglichen Bedarfs. Auch<br />
das Druckpapier wurde von dieser Entwicklung<br />
nicht verschont, so dass wir jetzt schon nicht mehr<br />
kostendeckend für den symbolischen einen Euro<br />
drucken können. Dennoch bemühen wir uns, Ihnen<br />
weiterhin jeden Monat eine Ausgabe mit historischen,<br />
aber auch aktuellen Themen zukommen zu<br />
lassen. Ausgerechnet in unserer unruhigen Zeit wurde<br />
jetzt in der Stiftskirche „St. Wenzelslaus“ im Görlitzer<br />
Vorort Jauernick eine seit fast 100 Jahren geplante<br />
zweite Glocke angebracht. Mit ihrem Geläut trägt<br />
sie ihre Botschaft ICH RUFE ZU FRIEDEN ÜBER ALLE<br />
GRENZEN HINWEG weit ins Görlitzer Land hinein.<br />
Diesem Ruf verpflichtet sein wird auch der Lausitz<br />
Kirchentag vom 24.-26. <strong>Juni</strong> <strong>2022</strong> in Görlitz. Hierüber<br />
berichten wir in vorliegender Ausgabe genauso wie<br />
über die 60.000 kostbaren Schätze des Graphischen<br />
Kabinetts im Görlitzer Kulturhistorischen Museum,<br />
deren älteste Graphiken aus der Dürer-Zeit stammen.<br />
Dieses Graphische Kabinett gibt einen fast<br />
lückenlosen Einblick in die Kunstgeschichte bis zur<br />
Gegenwart, so dass sich jederzeit ein Besuch lohnt!<br />
Genau vor 475 Jahren traf ein Ereignis aus den Religionskriegen<br />
die Görlitzer und ihren Rat besonders<br />
hart, und zwar handelt es sich um den bekannten<br />
Pöhnfall, über den unsere Leser hier mehr erfahren.<br />
Ein etwas anderer Beitrag bringt Ihnen die Anfänge<br />
und Geschichte der Zeidelwirtschaft in der Görlitzer<br />
Heide nah. Sie haben noch nie vom Zeidelwesen gehört?<br />
Dann sollten sie diesen informativen Beitrag<br />
auf jeden Fall lesen!<br />
Etwas kulinarischer ist der Artikel über die einst bekannte<br />
Görlitzer Konditorenfamilie aus der Schützenstraße.<br />
Die Straßenbahn ist heute aus dem Görlitzer Stadtbild<br />
nicht wegzudenken. Nicht wenige Görlitzer<br />
hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Die Vergangenheit<br />
kann dafür Vorbild sein – mittlerweile<br />
fahren seit 140 Jahren Straßenbahnen durch Görlitz.<br />
Die Geschichte der Straßenbahn in der Neißestadt<br />
begann genau am 25. Mai 1882 mit der Pferdebahnlinie.<br />
Weitere Linien kamen in den folgenden Jahren<br />
hinzu. 1897 wurde das Streckennetz auf Meterspur<br />
umgebaut und elektrifiziert. Die erste städtische<br />
Pferdeomnibuslinie wurde am 5. Mai 1892 eröffnet.<br />
1901 wird auf der Zittauer Straße das neue Depot<br />
der elektrischen Görlitzer Straßenbahn eingeweiht.<br />
Heute haben hier die Görlitzer Verkehrsbetriebe<br />
(GVB) ihr Wagendepot inkl. historische Triebwagen<br />
und eine Pferdebahn. Aus Anlaß des Jubiläums<br />
„140 Jahre Straßenbahn in Görlitz“ laden die GVB<br />
zu Sonderfahrten und Führungen am 25. <strong>Juni</strong> von<br />
11.00-17.00 Uhr auf dem Betriebshof, Zittauer Straße<br />
durch das Betriebsgelände ein. Es gibt in diesem Jahr<br />
damit gute Gründe, mit einem Tag der offenen Tür<br />
an diese Görlitzer Verkehrsgeschichte zu erinnern.<br />
Aktueller hingegen ist der Beitrag über das wegen<br />
der Pandemie auf den 18. <strong>Juni</strong> <strong>2022</strong> verschobene<br />
Kneipenmusikevent „Görlitz Rockt“, welches wieder<br />
viele Görlitzer und Besucher zu den Kneipen locken<br />
wird, da das Event erstmals unter freiem Himmel vor<br />
den Lokalen ausgetragen werden wird.<br />
Wir wünschen Ihnen viel Spannung beim Lesen und<br />
viel Freude beim Besuchen der angekündigten Veranstaltungen<br />
im Monat <strong>Juni</strong>.<br />
Ihre <strong>StadtBILD</strong>-Redaktion<br />
anzeige<br />
Einleitung<br />
3
Meisterwerke auf Papier. Das Görlitzer Graphische Kabinett<br />
auf Papier<br />
Wussten Sie schon, dass das Graphische<br />
Kabinett mit seinem Gesamtbestand von<br />
rund 60.000 Werken zu den bedeutendsten<br />
öffentlichen Grafiksammlungen im Osten<br />
Deutschlands zählt? Beheimatet ist es in<br />
den Sammlungen des Kulturhistorischen<br />
Museums Görlitz.<br />
Die Geschichte des Kabinetts reicht rund<br />
300 Jahre zurück. Als der aus Schweidnitz<br />
(Świdnica) stammende Johann Gottlieb Milich<br />
1726 dem Görlitzer Rat seine Bibliothek<br />
schenkte, gehörten dazu auch zahlreiche<br />
Kupferstiche. Weitere kamen im Lauf des 18.<br />
Jahrhunderts durch Schenkungen von Görlitzer<br />
Bürgern hinzu. Parallel baute auch die<br />
1779 in Görlitz gegründete Oberlausitzische<br />
Gesellschaft der Wissenschaften eine Grafiksammlung<br />
auf. Beide Bestände wurden<br />
1932 zum heutigen Graphischen Kabinett<br />
vereinigt. Einige Handzeichnungen und<br />
Druckgrafiken gingen am Ende des Zweiten<br />
Weltkriegs durch Auslagerungen verloren.<br />
Sie befinden sich heute unter anderem in<br />
der Sammlung der Polnischen Akademie<br />
der Wissenschaften in Krakau (Kraków). In<br />
den Jahren der DDR wuchs der Bestand<br />
durch Schenkungen, Ankäufe und die Übernahme<br />
von Künstlernachlässen weiter an.<br />
Auch heute wird das Graphische Kabinett<br />
jährlich um zahlreiche Werke ergänzt.<br />
Die Sammlungsbestände sind sehr vielfältig.<br />
Sie umfassen Handzeichnungen und<br />
Druckgrafiken der verschiedensten Techniken<br />
vom ausgehenden 15. Jahrhundert bis<br />
zur Gegenwart. Dabei gehören nicht nur<br />
Werke von Künstlern aus Görlitz und der<br />
Oberlausitz, sondern auch aus den historischen<br />
Nachbarregionen Sachsen, Schlesien<br />
und Böhmen zum Spektrum. Folgende<br />
Schwerpunkte zeichnen den Bestand aus:<br />
Druckgrafik der Dürer-Zeit<br />
Zu den ältesten und wertvollsten Beständen<br />
des Graphischen Kabinetts gehören die<br />
Druckgrafiken der Dürer-Zeit. Dabei handelt<br />
es sich um Holzschnitte und Kupferstiche<br />
von Albrecht Dürer, Lucas Cranach d. Ä.,<br />
Martin Schongauer, Sebald Beham und anderen<br />
namhaften Künstlern des ausgehenden<br />
15. und frühen 16. Jahrhunderts. Besondere<br />
Bedeutung besitzen Dürers Drucke der<br />
Kleinen Holzschnitt-Passion aus den Jahren<br />
anzeige<br />
4<br />
Geschichte
Meisterwerke auf Papier. Das Görlitzer Graphische Kabinett<br />
auf Papier<br />
Albrecht Dürer, Der ungläubige Thomas<br />
(aus der Kleinen Holzschnitt-Passion),<br />
1509/10, Holzschnitt (Foto: Görlitzer Sammlungen)<br />
Lucas Cranach d. Ä., Ecce homo, 1509, Holzschnitt<br />
(Foto: Görlitzer Sammlungen)<br />
1509/10. Aus der Wittenberger Werkstatt<br />
Lucas Cranachs d. Ä. sind unter anderem<br />
Holzschnittillustrationen zur Heiligen Schrift<br />
vorhanden. Die Wirkung solcher Druckgrafiken<br />
in Görlitz belegen die Holzschnitte von<br />
Georg Scharffenberg, der seit den 1560er<br />
Jahren in der Neißestadt tätig war.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
5
Meisterwerke auf Papier. Das Görlitzer Graphische Kabinett<br />
auf Papier<br />
Johann Alexander Thiele, Flusslandschaft mit Brücke, 1751, Feder und Pinsel in Braun<br />
(Foto: Görlitzer Sammlungen)<br />
Landschaftszeichnungen der Klassik und Romantik<br />
Im 18. und 19. Jahrhundert spielte die<br />
Landschaftszeichnung eine besondere<br />
Rolle. Das lässt sich anhand der Werke im<br />
Graphischen Kabinett umfassend darstellen.<br />
Führend auf diesem Gebiet waren<br />
Künstler aus Sachsen, insbesondere aus<br />
Dresden und Leipzig. Zu ihnen gehörte der<br />
anzeige<br />
6<br />
Geschichte
Meisterwerke auf Papier. Das Görlitzer Graphische Kabinett<br />
auf Papier<br />
Christoph Nathe, Blick über die Neiße auf die Görlitzer Peterskirche, 1785, Pinsel in Wasserfarben<br />
(Foto: Görlitzer Sammlungen)<br />
kurfürstlich sächsische Hofmaler Johann<br />
Alexander Thiele, von dem sich zahlreiche<br />
Zeichnungen im Graphischen Kabinett befinden.<br />
Im ausgehenden 18. Jahrhundert<br />
war der aus der Oberlausitz stammende<br />
Christoph Nathe ein wichtiger Protagonist<br />
der Zeichenkunst. Seine Ansichten<br />
aus Görlitz und Umgebung, aber auch aus<br />
dem Riesengebirge und den Schweizer<br />
Alpen waren Vorläufer für die Zeichen-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
7
Meisterwerke auf Papier. Das Görlitzer Graphische Kabinett<br />
auf Papier<br />
Adrian Ludwig Richter, Rast im Gebirge, um 1830, Pinsel in Wasserfarben (Foto: Görlitzer Sammlungen)<br />
kunst der Romantik. Das Graphische Kabinett<br />
bewahrt mit rund 400 Zeichnungen<br />
den weltweit größten Einzelbestand<br />
seiner Werke. Auch die Zeichenkunst der<br />
Romantik ist durch erstrangige Arbeiten<br />
im Kabinett präsent. Dazu zählen Werke<br />
von Julius Schnorr von Carolsfeld, Moritz<br />
von Schwind oder Adrian Ludwig Richter.<br />
Sehr umfangreich ist auch die Gruppe der<br />
Zeichnungen des aus Lodenau stammenden<br />
Adolf Gottlob Zimmermann, der zum<br />
Kreis der Nazarener, einer romantischreligiösen<br />
Kunstrichtung des 19. Jahrhunderts,<br />
gehörte.<br />
Handzeichnungen und Druckgrafiken der<br />
Moderne<br />
Die grafischen Künste erlebten im Zeitalter<br />
der Moderne erneut eine große Blüte.<br />
Im Graphischen Kabinett wird dies durch<br />
Werke aus den verschiedenen modernen<br />
Stilrichtungen – dem Impressionismus,<br />
dem Expressionismus oder auch<br />
der Neuen Sachlichkeit – belegt. Der Fokus<br />
liegt hier vor allem auf Künstlerinnen<br />
und Künstlern aus Görlitz, aber auch aus<br />
Dresden und Breslau (Wrocław). Zu den<br />
wesentlichen Beispielen expressionistischer<br />
Zeichenkunst gehören die Pastelle<br />
des Görlitzers Fritz Neumann-Hegenberg.<br />
Die Neue Sachlichkeit repräsentieren Werke<br />
von Arno Henschel und Willi Schulz<br />
aus den 1920er bis 1950er Jahren. Eine<br />
besondere Gruppe bildet der moderne<br />
Kupferstich, der maßgeblich vom Görlitzer<br />
Johannes Wüsten in den ausgehenden<br />
1920er Jahren geprägt wurde. Wüstens<br />
druckgrafisches Werk ist in Gänze im Kabinett<br />
vorhanden.<br />
8<br />
Geschichte
Meisterwerke auf Papier. Das Görlitzer Graphische Kabinett<br />
auf Papier<br />
Fritz Neumann-Hegenberg, Schlummerndes Dorf, um 1920, Tempera (Foto: Görlitzer Sammlungen)<br />
Druckgrafiken aus der DDR<br />
In der DDR wurde den grafischen Künsten<br />
eine große Bedeutung zugemessen. An allen<br />
Kunsthochschulen erfolgte ein Unterricht<br />
in druckgrafischen Techniken, aber<br />
auch im Rahmen zahlreicher Mal- und<br />
Zeichenzirkel fand eine intensive Beschäftigung<br />
mit ihnen statt. Das spiegelt sich<br />
auch in den umfangreichen Beständen<br />
des Graphischen Kabinetts zur Druckgrafik<br />
aus der DDR wider. Insbesondere Dresde-<br />
anzeige<br />
10<br />
Geschichte
Meisterwerke auf Papier. Das Görlitzer Graphische Kabinett<br />
auf Papier<br />
Wilhelm Rudolph, Pferd vor Ruinen, um 1949, Holzschnitt (Foto: Görlitzer Sammlungen)<br />
ner Künstler, die im Umfeld der dortigen<br />
Kunsthochschule tätig waren, sind mit<br />
Werken vertreten, wie z. B. Wilhelm Rudolph,<br />
Hans und Lea Grundig oder auch der<br />
aus Görlitz stammende Stefan Plenkers. In<br />
jüngster Zeit konnte diese Bestandsgruppe<br />
durch Schenkungen um zahlreiche<br />
Werke von Künstlern wie Dieter Goltzsche,<br />
Horst Weber oder Armin Schulze erweitert<br />
werden.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
11
Meisterwerke auf Papier. Das Görlitzer Graphische Kabinett<br />
auf Papier<br />
Johann Gottfried Schultz, Klebeband mit Kupferstichen, angelegt um 1800 (Foto: Görlitzer Sammlungen)<br />
Grafikbände<br />
Neben zahlreichen Einzelblättern gehören<br />
auch mehrere hundert Grafikbände zum<br />
Graphischen Kabinett. Einen besonderen<br />
Schatz bilden dabei die sogenannten<br />
Klebebände. Bei ihnen handelt es sich um<br />
eine alte Form des Sammelns, bei dem die<br />
Blätter nicht einzeln, sondern in Büchern<br />
eingeklebt zusammengetragen wurden.<br />
Während in anderen Kupferstichkabinetten<br />
Klebebände im 20. Jahrhundert oft<br />
anzeige<br />
12<br />
Geschichte
Meisterwerke auf Papier. Das Görlitzer Graphische Kabinett<br />
auf Papier<br />
wieder aufgelöst wurden, erfolgte dies in<br />
Görlitz glücklicherweise nicht. Dadurch<br />
blieben z. B. die rund 40 Klebebände, die<br />
der Oberlausitzer Johann Gottfried Schultz<br />
um 1800 zusammenstellte, bis heute in ihrer<br />
ursprünglichen Form erhalten. Auch<br />
die Bände des Görlitzer Mathematikers<br />
und Zeichners Daniel Petzold aus der Mitte<br />
des 18. Jahrhunderts sind bis heute erhalten.<br />
Gegenwärtig zeigt das Graphische Kabinett<br />
noch bis zum 16. Oktober <strong>2022</strong><br />
japanische Farbholzschnitte des 19. Jahrhunderts,<br />
darunter Meisterwerke des bekannten<br />
Malers und Grafikers Katsushika<br />
Hokusai.<br />
Kai Wenzel<br />
Da Kunstwerke auf Papier sehr lichtempfindlich<br />
sind, können sie immer nur für kurze<br />
Zeit ausgestellt werden. Das Graphische<br />
Kabinett verfügt über einen eigenen Ausstellungsraum<br />
im Barockhaus Neißstraße<br />
30. Hier werden unter wechselnden Themen<br />
Einblicke in die Sammlungsbestände<br />
gegeben. Darüber hinaus ist es möglich,<br />
sich nach Voranmeldung Grafiken während<br />
der Öffnungszeiten des Museums<br />
vorlegen zu lassen. Eine umfangreiche<br />
Publikation unter dem Titel „Meisterwerke<br />
auf Papier. Das Graphische Kabinett zu<br />
Görlitz“ gibt zudem einen Überblick über<br />
die Sammlung und ist in unserem Museumsshop<br />
erhältlich.<br />
anzeige<br />
Geschichte 13
Sachsens größtes Kneipenfestival<br />
Görlitz Rockt!<br />
Color The Sky bringen mit ihrem handgemachten Acoustic-Rock tanzbare Lagerfeuerstimmung auf die<br />
großen Bühnen dieser Welt! (Foto: incaming media GmbH)<br />
Es gibt es wieder. Nach zwei Jahren erzwungener<br />
Pause findet das Görlitzer Kneipenmusikfestival<br />
endlich wieder statt. Auf Grund der<br />
noch im Frühjahr unklaren epidemischen<br />
Lage wurde sicherheitshalber die beliebte<br />
Musiknacht in den Frühsommer verlegt. Das<br />
bedeutet natürlich etliche Umplanungen.<br />
So wurde das Kneipenmusikfestival auf den<br />
18. <strong>Juni</strong> <strong>2022</strong> verlegt.<br />
Da die abendlichen Temperaturen Mitte <strong>Juni</strong><br />
bereits sommerliche Werte haben können,<br />
haben wir uns entschlossen, das Kneipenmusikfestival<br />
als Open-Air-Veranstaltung vor<br />
den Gaststätten auszurichten. Falls Petrus<br />
ein paar Regenschauer schicken sollte, wird<br />
das der Stimmung keinen Abbruch tun, wir<br />
haben entsprechende Pavillons vor den Lokalen<br />
aufgebaut.<br />
anzeige<br />
14<br />
Ausblick
Görlitz Rockt!<br />
Rockt!<br />
Das Festival beginnt mit dem Eröffnungskonzert<br />
der beliebten Görlitzer Band „Color<br />
The Sky“ im Gleis 1 im Görlitzer Bahnhof bereits<br />
17.17 Uhr. Ab 18.00 Uhr beginnen dann<br />
über 20 Bands und Künstler in und vor den<br />
verschiedenen Lokations zu spielen.<br />
Das Programm ist erneut vielfältig. So reicht<br />
die Palette der angebotenen Musikrichtungen<br />
wieder vom Alternativ-, Klassik- und<br />
Punkrock hin zu Blues und Rockabilly. Die<br />
Freunde von Pop und Schlager kommen vor<br />
dem Citycenter auf ihre Kosten. Von lateinamerikanischen<br />
Rhythmen, internationalem<br />
Pop, fröhlichem Reggae, krachendem<br />
Beat, groovendem Soul und treibendem<br />
Rock'n'Roll bis hin zu den besten Partykrachern<br />
der letzten 30 Jahre ist für fast jeden<br />
Musikgeschmack etwas dabei. Dementsprechend<br />
vielfältig sind auch die Künstler, die<br />
am 18. <strong>Juni</strong> <strong>2022</strong> auftreten.<br />
So reicht das Angebot vom Solokünstler bis<br />
zur größeren Musikband, von lokalen Musikern<br />
bis zu überregionalen Künstlern und<br />
von melodischen Stimmen bis hin zu harten<br />
Rockern.<br />
So abwechslungsreich wie die Akteure wird<br />
auch das gebotene Musikprogramm.<br />
Eine Stadt, eine Nacht und überall Livemusik<br />
– ein unschlagbares Konzept, das am 18. <strong>Juni</strong><br />
<strong>2022</strong> Liebhaber handgemachter Livemusik<br />
auf die Beine bringt. Das Festival erstreckt<br />
sich in diesem Jahr vom Görlitzer Bahnhof<br />
bis zur Vierradenmühle an der polnischen<br />
Grenze, und dabei kann man bequem zwischen<br />
den einzelnen Locations flanieren und<br />
die Schönheit der Europastadt genießen.<br />
Dadurch wird wieder ein lebhaftes Treiben<br />
in die beschauliche Altstadt einziehen, welche<br />
zusätzlich noch durch etliche gleichzeitig<br />
stattfindende Hochzeitsfeiern belebt wird.<br />
Das Festival ist in diesem Jahr aber mehr als<br />
nur ein lieb gewonnenes Musikfestival. Es ist<br />
auch die gefeierte Rückkehr in ein Nachtleben,<br />
wie man es von früher kannte, als Corona<br />
nur eine Biermarke war. Die Maskenpflicht<br />
ist gefallen, und auch sonst gibt es keine Corona-Einschränkungen<br />
mehr. Ganz nach dem<br />
Motto: „Reclaiming Freedom - das Leben hat<br />
uns wieder“! Und entsprechend motiviert<br />
sind die Veranstalter an die Organisation herangegangen.<br />
„Wir wollen den Corona-Stress<br />
hinter uns lassen und eine gute Zeit haben“,<br />
erklärt Andreas Ch. de Morales Roque, vom<br />
Organisationsteam „Görlitz Rockt“.<br />
anzeige<br />
Ausblick<br />
15
Sachsens größtes Kneipenfestival<br />
Görlitz Rockt!<br />
Vor dem Nachtschmied spielen die Görlitzer Altrocker „Zenker & Co“. (Foto: incaming media GmbH)<br />
In der Krebsgasse neben dem Café Oriental<br />
wird die Bühne für die Newcomer Lea &<br />
Kevin und die junge Görlitzer Band „Demianiplatz<br />
3“ zum Sprungbrett für hoffentlich<br />
weitere Auftritte.<br />
Auf dem Untermarkt sorgen „Mr. Creamy“<br />
und „Rooftop Radio“ für durchgängige Partystimmung,<br />
während auf dem Obermarkt<br />
vor dem Nachtschmied die Altrocker „Zenker<br />
& Co“ wieder mit bekannten Songs für Fröhlichkeit<br />
sorgen. In der Neißstraße sorgen die<br />
Musiker von „Instinkt“ im Barbecue wieder<br />
für gute Laune. Im Vogtshof des Studierendenclub<br />
Maus rockt Toni mit seinen Musikern<br />
der Band „Ramroad“. Wir wollen hier<br />
nicht alle Lokalitäten aufzählen. Entdecken<br />
Sie am besten selbst mit dem ausführlichen<br />
Programmheft in der Hand, welches es zu je-<br />
anzeige<br />
16<br />
Ausblick
Görlitz Rockt!<br />
Rockt!<br />
Mr. Creamy: Mit den Rockklassikern der 80er, 90er und 2000er sorgt die Oberlausitzer Coverband für ausgelassene<br />
Stimmung und lässt die wilden Zeiten noch einmal aufleben. (Foto: incaming media GmbH)<br />
dem Eintrittsbändchen gratis dazu gibt, die<br />
einzelnen Lokale mit ihren vielseitigen Angeboten.<br />
Und so funktioniert das Kneipenfestival:<br />
Die Besucher können im Vorverkauf bei<br />
www.eventbrite.de sowie bei den bekannten<br />
Vorverkaufsstellen und in den jeweiligen<br />
Kneipen im Vorverkauf für 12,00 Euro zzgl.<br />
Gebühren Einlaßbändchen und Programmheft<br />
erwerben!<br />
An der Abendkasse kostet der Einlass 15,00<br />
Euro. Mit den Einlaßbändchen kann man<br />
in allen teilnehmenden Lokalen die unterschiedlichen<br />
Liveauftritte genießen.<br />
Kommen Sie mit Ihrer Familie und Freunden<br />
zu dem einmaligen Event und genießen<br />
Sie einen wundervollen Abend bei<br />
„Görlitz Rockt“!<br />
Bertram Oertel<br />
anzeige<br />
Ausblick<br />
17
Die Geschichte der Konditorfamilie Frenzel<br />
Hochzeitsfoto von Willy Frenzel und Jenny Donner.<br />
Mit der Industrialisierung Mitte des 19.<br />
Jahrhunderts – vorangetrieben durch den<br />
Anschluss an das preußische und sächsische<br />
Eisenbahnnetz – wurde in Görlitz die<br />
mittelalterliche Stadtanlage nach Süden<br />
und Westen hin durch gründerzeitliche<br />
Wohn- und Villenviertel erweitert.<br />
anzeige<br />
18<br />
Geschichte
Die Geschichte der Konditorfamilie Frenzel<br />
Und im Jahre 1919 beginnt mit dem Bestehen<br />
der Meisterprüfung für das Handwerk<br />
der Konditoren die Geschichte der Konditorfamilie<br />
Frenzel.<br />
In Chemnitz startete Willy Frenzel seine<br />
berufliche Laufbahn zunächst als Konditorgehilfe<br />
in der Zeit 14. Oktober 1914<br />
bis 25. Mai 1915 bei der Konditorei und<br />
Kaffeestube „Emil Freund & Nachfolger“.<br />
Der damalige Inhaber Carl Jentzsch führte<br />
das kleine Geschäft nach und nach zu einem<br />
erstklassigen und renommierten gastronomischen<br />
Unternehmen, das er 1929<br />
in EFREUNA, Konditorei- und Kaffeehaus<br />
(ca. 400 Sitzplätze) umbenannte und das<br />
heute noch ein beliebter Ort für Kaffeekränzchen<br />
in Chemnitz ist.<br />
Zeugnis des Konditorgehilfen Willy Frenzel.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
19
Die Geschichte der Konditorfamilie Frenzel<br />
Im Mai 1915 folgte für Willy Frenzel die Einberufung<br />
zum Militär, er diente während<br />
des 1. Weltkriegs in Rumänien.<br />
Mit dem Ende des 1. Weltkriegs kehrte er<br />
1918 nach Chemnitz zurück, wo er im Dezember<br />
1919 die Meisterprüfung für das<br />
Handwerk der Konditoren ablegte. Während<br />
dieser Zeit in Chemnitz lernte er auch<br />
Frau Jenny Donner aus Mühlau kennen<br />
und lieben, die er dann später heiratete.<br />
Ca. 1921 erwarb der Konditormeister Willy<br />
Frenzel ein Haus in der Görlitzer Schützenstraße<br />
(ca. 1910 erbaut) und übernahm<br />
das Café C. Leifer im Erdgeschoß.<br />
20<br />
Geschichte
Die Geschichte der Konditorfamilie Frenzel<br />
Das Bild (unten rechts Seite 20) zeigt das<br />
Haus in der Schützenstraße eingerüstet –<br />
Datum und Grund der Baumaßnahme sind<br />
unbekannt, nach Fertigstellung zeigte sich<br />
die Fassade vereinfacht – Zierrat und Putz<br />
wurde teilweise entfernt – hinzugekommen<br />
ist der Schriftzug „Konditorei Frenzel“<br />
(Bild oben).<br />
Die Konditorei befand sich auf der rechten<br />
Seite des Gebäudes.<br />
Das Bild oben rechts zeigt den Verkaufsraum,<br />
Frau Jenny Frenzel mit zwei Mitarbeiterinnen,<br />
und rechts oben an der Wand<br />
hängt der Meisterbrief von Willy Frenzel.<br />
Geschichte<br />
21
Die Geschichte der Konditorfamilie Frenzel<br />
Auf dem Bild ist vor der Eingangstüre stehend<br />
die langjährige Mitarbeiterin Fräulein<br />
Pfriem zu sehen, sie bestand darauf<br />
mit „Fräulein“ angesprochen zu werden.<br />
Das Ehepaar Frenzel wohnte im 1. Obergeschoß<br />
rechts, direkt über der Konditorei.<br />
Hermann und Dietrich Donner (oben rechtes<br />
Bild) bei einem ihrer zahlreichen Besuche<br />
in Görlitz auf dem Dachgarten des<br />
Hauses Schützenstraße im Jahre 1944.<br />
Dietrich Donner (rechtes Bild) als „Konditor“<br />
im Innenhof des Hauses Schützenstraße<br />
in Görlitz.<br />
22<br />
Geschichte
Die Geschichte der Konditorfamilie Frenzel<br />
Diese Aufnahme stammt ebenfalls aus dem<br />
Jahre 1944 und zeigt Konditormeister Willy<br />
Frenzel inmitten seines Teams im Hof des<br />
Hauses Schützenstraße. Rechts neben Willy<br />
Frenzel mit der Bäckermütze Günter Krause,<br />
der in den 1960iger Jahren seine Meisterprüfung<br />
ablegte und ebenfalls in der Schützenstraße<br />
wohnte. Links vorne Fräulein Pfriem<br />
und in der Mitte der junge Dietrich Donner.<br />
1950 – Wolfram Donner umgeben von jungen<br />
Damen auf dem Schaufenstersims des<br />
Uhrmachermeisters Erich Schaaf in der Görlitzer<br />
Schützenstraße.<br />
Geschichte<br />
23
Die Geschichte der Konditorfamilie Frenzel<br />
Der junge Wolfram Donner genießt am<br />
Abend nach dem Essen ein gutes Eis (ca.<br />
1955).<br />
Konditormeister Willy Frenzel vor seinem Laden<br />
in der Görlitzer Schützenstraße (1957).<br />
Willy Frenzel auf dem Dachgarten seines<br />
Hauses Schützenstraße in Görlitz. Hier verbrachte<br />
er mit seiner Familie viele schöne<br />
Stunden während der warmen Jahreszeit<br />
(unten Ehepaar Frenzel 1963).<br />
24<br />
Geschichte
Die Geschichte der Konditorfamilie Frenzel<br />
Das Ehepaar Frenzel 1967 vor dem Haus<br />
Schützenstraße in Görlitz mit Frau Monika<br />
Donner und Tochter Ulrike. Im Hintergrund<br />
ist der Laden des Uhrmachers Erich Schaaf<br />
zu erkennen.<br />
Konditormeister Willy Frenzel ist Anfang<br />
der 1960iger Jahre in den Ruhestand gegangen,<br />
und hat die Konditorei und das<br />
Kaffee an den Konditormeister Weustenfeld<br />
verpachtet. Danach hatte er mehr Zeit,<br />
um sich um seine Familie zu kümmern<br />
– auf dem Bild unten begießt er 1967 die<br />
junge Kathrin Donner auf dem Dachgarten<br />
seines Hauses Schützenstraße in Görlitz,<br />
auf daß sie schneller wachsen möge.<br />
Geschichte<br />
25
Die Geschichte der Konditorfamilie Frenzel<br />
Familienfoto im <strong>Juni</strong> 1975, anläßlich des 80. Geburtstages von Konditormeister Willy Frenzel i.R. auf dem Dachgarten<br />
des Hauses Schützenstraße in Görlitz.<br />
Willy Frenzels Ehe blieb kinderlos, und von<br />
den potentiellen Erben wollte keiner das<br />
Haus mit Grundstück übernehmen, da zu<br />
Zeiten der DDR der Erhalt eines solchen<br />
Gebäudes von Einzelpersonen kaum zu<br />
stemmen war. Er verpachtete seine Konditorei<br />
und das Kaffee noch an zwei weitere<br />
Konditormeister – Rothenburger und<br />
Handke, bis er sich im <strong>Juni</strong> 1978 dazu entschloss,<br />
per Verzichtserklärung sein Haus<br />
in der Schützenstraße der Stadt Görlitz zu<br />
vermachen.<br />
Das Haus in der Schützenstraße in Görlitz<br />
wurde bis 2020 mehr oder weniger sich<br />
selbst überlassen, so dass der Zerfall seinen<br />
Lauf nahm. Nun aber sieht es so aus,<br />
als würde es einen Investor geben, der<br />
dieses Gebäude zu neuem Leben und alter<br />
Schönheit erweckt.<br />
Vielen Dank an Herrn Antonio Rankel<br />
(www.phototoniart.de) und an Herrn W.<br />
Donner für den Beitrag und die zur Verfügung<br />
gestellten Fotos!<br />
Willy Frenzel erlitt im Oktober 1987 einen<br />
Schlaganfall, an dem er am 03.11.1987 verstarb.<br />
26<br />
Geschichte
475 Jahre Pönfall<br />
Jahre Pönfall<br />
Vorgeschichte<br />
Um das Jahr 1500 stand die königlich böhmische<br />
Stadt Görlitz im Zenit ihrer wirtschaftlichen<br />
Blüte wie auch ihrer machtvollen<br />
politischen Selbstständigkeit. Sonderlich<br />
das kräftig ausgebildete Exportgewerbe der<br />
Tuchmacherei, der Fernhandel sowie eine<br />
damit verbundene überaus kluge Diplomatie<br />
gegenüber den meist schwach agierenden<br />
Landesherren waren dafür die wesentlichen<br />
Voraussetzungen gewesen. Wohl<br />
niemand in Görlitz und den anderen ebenfalls<br />
durchaus prosperierenden Städten des<br />
Bundes hätte sich vorstellen können, dass<br />
nur ein halbes Jahrhundert später die Früchte<br />
der Mühen von Generationen nahezu völlig<br />
vernichtet werden würden. Europa geriet<br />
ab Beginn des 16. Jahrhunderts in komplexe<br />
Wandlungsprozesse, die den heutigen<br />
durchaus ähneln. Die Reformation wirkte<br />
dabei als bedeutsamer Katalysator zur Ausprägung<br />
und Lösung schon länger schwelender<br />
Konflikte. Dies betraf nun auch und<br />
besonders das kleine Markgraftum Oberlausitz,<br />
Nebenland der böhmischen Krone, ein<br />
Territorium mit nur rudimentär ausgeprägter<br />
Zentralstaatlichkeit, aber mit bedeutenden<br />
partikularen Herrschaftsstrukturen. So<br />
bedingte die damalige Schwäche der Landesherrschaft,<br />
dass anders als üblich die Inhaber<br />
von Grundherrschaft, also die Räte der<br />
Sechsstädte, der Adel und die Klöster über<br />
die Konfession ihrer Untertanen entschieden.<br />
Mehrheitlich wurde das Land evangelisch.<br />
Als der böhmische König Ferdinand<br />
I. im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts<br />
an politischem Handlungsspielraum etwa<br />
durch einen Friedensvertrag mit den Osmanen<br />
und mit der Stabilisierung der Zentralstaatlichkeit<br />
in seinen Kernländern gewann,<br />
geriet auch die Lösung der bestehenden<br />
Konflikte mit den Kronnebenländern, so<br />
auch mit den Ständen der Oberlausitz (Adel<br />
und Städte) in dessen Blickfeld. Dabei ging<br />
es besonders um die Zentralisierung des<br />
Gerichts-, Steuer- und Militärwesens, den<br />
Abbau von Privilegien, dessen Ausbau frühmoderner<br />
Staatlichkeit und natürlich ebenso<br />
um die Konfessionsfrage. Zugleich strebte<br />
wesentlich der oberlausitzer Adel nach einer<br />
Lösung der Streitigkeiten mit den dominant<br />
auftretenden Sechsstädten, die ihm jedoch<br />
nur mit Hilfe des Landesherrn möglich erschien.<br />
Dazu zählte u.a. dessen Forderung,<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
27
475 Jahre Pönfall –<br />
Jahre Pönfall<br />
dass die landesherrlichen Steuern der Stadtund<br />
Bürgerdörfer mit zur Quote des Adels<br />
zugerechnet werden sollten. Man forderte<br />
zwei Stimmen für den Adel auf den Landtagen,<br />
die Abschaffung der Gerichtskompetenzen<br />
der Städte auf den Dörfern adliger<br />
Grundherren wie auch erweiterte Marktund<br />
Braurechte. All diese Konflikte eskalierten<br />
dann in Folge des Schmalkaldischen<br />
Krieges, den die Katholische Liga Kaiser Karls<br />
V. und treu an dessen Seite Ferdinand I. gegen<br />
den protestantischen Schmalkaldischen<br />
Bund unter Kurfürst Johann Friedrich von<br />
Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen<br />
1546 führte. Die Stände der Oberlausitz gerieten<br />
angesichts der Geld- und Truppenforderungen<br />
König Ferdinands I. in einen<br />
schweren Gewissenskonflikt. De jure war<br />
man dem Landesherrn zu Gehorsam und<br />
Hilfe verpflichtet, praktisch sollte man sich<br />
mit den protestantischen Glaubensbrüdern<br />
in blutigen Schlachten schlagen. Wie immer<br />
suchte man daher die geforderten Leistungen<br />
zu mindern, man korrespondierte und<br />
verhandelte hinhaltend. Dazu kam, dass<br />
der sächsische Kurfürst versuchte, die Oberlausitzer<br />
in diesem Religionskrieg auf seine<br />
Seite zu ziehen. In Böhmen verweigerte die<br />
starke Ständeopposition ihrem König Truppen<br />
für den Feldzug außerhalb der Heimat.<br />
Die gegen Ferdinand revoltierenden Böhmen<br />
suchten nun auch die Unterstützung<br />
der Nebenländer der Krone. Eine fatale Situation<br />
entstand. Anfang des Jahres 1547 erklärte<br />
sich, den Zorn des Landesherrn fürch-<br />
anzeige<br />
28<br />
Geschichte
Ende der Blütezeit des Sechsstädtebundes und der Stadt Görlitz.<br />
475 Jahre Pönfall<br />
tend, die oberlausitzische Ritterschaft bereit,<br />
1000 Reiter und die Städte, 500 Mann für<br />
zwei Monate zu stellen. Die Kriegsereignisse<br />
und das Agieren Ferdinands sollten nun<br />
aber dramatische Folgen für die Sechsstädte<br />
zeitigen. Zugleich geriet man mit dem Adel<br />
und seinem absolut feindlichen Anführer<br />
Dr. Ullrich von Nostiz aus verschiedenen<br />
Ursachen immer mehr in Streit. Den Grund<br />
für die Bestrafungsaktion Ferdinands lieferte<br />
der eigentlich vertragsgemäße Abzug des<br />
sechsstädtischen Truppenkontingents kurz<br />
vor der Entscheidungsschlacht bei Mühlberg<br />
am 24. April 1547. Das Schreiben Ferdinands<br />
mit Forderung um Verlängerung der<br />
Waffenhilfe wurde erst am Vortage (!) verfasst<br />
und erreichte die Städte erst nach der<br />
vernichtenden Niederlage des Schmalkaldischen<br />
Bundes. Es folgte ein blutiges und<br />
drastisches Strafgericht Ferdinands gegen<br />
die böhmische Ständeopposition, das deren<br />
Vertretern alle Privilegien und den Besitz<br />
entzog. Voller Schrecken verfolgte man hier<br />
die böhmischen Ereignisse und hoffte auf<br />
die königliche Gnade. Dann am 9. August<br />
erhielten die Görlitzer das wohl furchterregendste<br />
Schreiben der bisherigen Stadtgeschichte.<br />
König Ferdinand I. lud den gesamten<br />
Rat und 10 Personen aus dem Gremium<br />
der Geschworenen für den 1. September auf<br />
die Prager Burg vor. Sie sollten sich dort wegen<br />
Ungehorsam, Widersetzlichkeit und Rebellion<br />
verantworten.<br />
(Fortsetzung folgt)<br />
Siegfried Hoche, Ratsarchivar<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
29
„Von Wegen“<br />
Wegen<br />
Unter dem Motto „VON WEGEN“ laden vom<br />
24. bis 26. <strong>Juni</strong> <strong>2022</strong> fünf Kirchenkreise aus<br />
zwei Landeskirchen gemeinsam zum LAU-<br />
SITZ KIRCHENTAG nach Görlitz ein. Das Begegnungswochenende<br />
in der Lausitz feiert<br />
Gemeinschaft über Kirchgemeindegrenzen<br />
hinweg und gibt ein buntes Glaubenszeugnis<br />
in die Region. Seien Sie dabei und werden<br />
Sie ein Teil dieses Festes!<br />
Neben jeder Menge Musik können Sie sich<br />
auf Open-Air Gottesdienste, ein bunt gemischtes<br />
Programm in thematischen Zentren,<br />
Tagzeitgebete und spirituelle Momente,<br />
den Markt der Möglichkeiten und jede<br />
Menge gute Gespräche und nette Begegnungen<br />
freuen.<br />
Erleben Sie die Konzerte des erzgebirgischen<br />
Sängers Samuel Rösch und der a capella<br />
Band „Alte Bekannte“ oder lauschen<br />
Sie Johann Knöfels Cantus Choralis 1575.<br />
Die Ökumenischen Chortage „Atem, los!"<br />
mit dem Landesposaunentag in der EKBO<br />
sind in den LAUSITZ KIRCHENTAG eingebunden.<br />
Hunderte von Bläserinnen und<br />
Bläsern bringen die Stadt zum Klingen. Ein<br />
Freitag, 20.00 Uhr, Obermarkt: Sänger Samuel<br />
Rösch (2018 gewann er die Gesangs-Castingshow<br />
„The Voice of Germany“ und ist seitdem mit<br />
deutschsprachigem Pop unterwegs) © Julia Tuncel<br />
Kindermusical zur Emmausgeschichte wurde<br />
eigens für den Kirchentag komponiert<br />
und erlebt seine Uraufführung.<br />
Pilgern Sie zum Heiligen Grab in Görlitz<br />
oder beteiligen Sie sich an lebhaften Diskussionen<br />
über (lokal)politische, kirchliche<br />
anzeige<br />
32<br />
Ausblick
Herzliche Einladung zum Lausitz Kirchentag<br />
Von Wegen<br />
und wirtschaftliche Themen auf dem Roten<br />
Sofa. Der LAUSITZ KIRCHENTAG lädt unter<br />
anderem ein zum Austausch über Diakonie,<br />
Kirche und Gesellschaft, Ökumene, sozialen<br />
Frieden, Jugend und Bildung.<br />
Mit dabei sind die Ministerpräsidenten Michael<br />
Kretschmer und Dr. Dietmar Woidke,<br />
Samstag, 17.30 Uhr, St. Peter und Paul: „Singt & spielt!“<br />
Sie lieben klassische Musik und wollen einen echten<br />
Ohrenschmaus erleben? Den gibt es beim Festkonzert<br />
des Landesposaunentages und des<br />
Ökumenischen Chortages der EKBO<br />
Samstag, 16.00 Uhr, Bühne Obermarkt: „Keine Kohle,<br />
aber ne Menge Energie?!“ u.a. mit: Ministerpräsident<br />
Michael Kretschmer und Bischof Dr. Christian Stäblein<br />
die Bischöfe der einladenden Landeskirchen<br />
Dr. Christian Stäblein (EKBO) und Tobias<br />
Bilz (EVLKS), Bischof Wolfgang Ipolt<br />
(Görlitz), Propst Joachim Lenz (Jerusalem),<br />
der Israel-Experte Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Dieter<br />
Vieweger, der Autor Dr. Johannes Stemmler,<br />
anzeige<br />
Ausblick<br />
33
Herzliche Einladung zum Lausitz Kirchentag<br />
Von Wegen<br />
Pastorin und Leiterin Kirche im Dialog Dr.<br />
Emilia Handke, die Grünen-Politikerin Heide<br />
Schinowsky und die Journalistin Christine<br />
Keilholz. Viele weitere Gäste werden den<br />
Austausch zu den Themenschwerpunkten<br />
bereichern.<br />
Das Jugend-Areal lädt zu Workshops, sportlichen<br />
Aktivitäten mit Bubblefußball und<br />
Kletterwand, Chillout-Ecken und guten<br />
Gesprächen ein. Die Theatergruppe ev.<br />
Jugend Oberlausitz plant gerade ein Theaterstück<br />
mit Jugendlichen für Jugendliche.<br />
Für Kinder und deren Familien wird es unter<br />
anderem eine musikalische Familienshow<br />
mit Sebastian Rochlitzer geben. Der<br />
Kinder-und Jugendzirkus Applaudino lädt<br />
zu einem kreativen Mitmach-Programm ein<br />
– jonglieren, Einrad fahren und Akrobatik.<br />
Sonntag, 15.00 Uhr, Stadtpark: „Ich stell die Welt auf<br />
den Kopf“ – eine Familienshow mit Sebastian Rochlitzer<br />
und Handpuppe Ulfie, Kleinkunst-Elementen<br />
und jeder Menge Mitmachliedern. © Sergej Falk<br />
Wenn Sie den LAUSITZ KIRCHENTAG als<br />
Helferin oder Helfer unterstützen wollen,<br />
dann melden Sie sich gerne direkt bei Matthias<br />
Scheufele: m.scheufele@zdw.ekbo.de.<br />
Wir brauchen noch Menschen für Auf- und<br />
Umbauten, Bühnenbetreuung, Besucherlenkung<br />
und am Servicepoint. Nutzen Sie<br />
die Gelegenheit, sich bei einer Großveranstaltung<br />
einzubringen. Ein spannender<br />
Blick hinter die Kulissen ist garantiert!<br />
Planen Sie jetzt Ihr Wochenende in Görlitz.<br />
Wir freuen uns auf Sie!<br />
www.lausitzkirchentag.de<br />
anzeige<br />
Ausblick<br />
35
Die Stiftskirche „St. Wenzeslaus“ in Jauernick erhält eine zweite Glocke<br />
„St. Kirche in Jauernick<br />
Nach Überlieferung des Pfarrers Olerus soll<br />
bereits 967 eine in Holz erbaute Kirche in<br />
Jauernick errichtet worden sein. Der heute<br />
vorhandene Bau geht in seinen Grundmauern<br />
auf das 13. Jahrhundert zurück. Erstmals<br />
erwähnt wurde die Kirche 1242. In diesem<br />
Jahr erwarb das Zisterzienserinnenkloster<br />
St. Marienthal das Dorf und seine Kirche.<br />
In den Jahren 1427 und 1429 wurde das<br />
Gotteshaus durch die Hussiten schwer beschädigt.<br />
Am 8. Oktober 1443 konnte sie<br />
durch Johannes Erler neu geweiht werden.<br />
anzeige<br />
36<br />
Geschichte
Die Stiftskirche „St. Wenzeslaus“ in Jauernick erhält eine zweite Glocke<br />
„St. Turmabnahme am 22. <strong>Juni</strong> 2021<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
37
Die Stiftskirche „St. Wenzeslaus“ in Jauernick erhält eine zweite Glocke<br />
„St. Glocke Petit & Edelbrock 1931<br />
Erler stammte aus der Görlitzer Gegend und<br />
wurde als Minorit 1432 Weihbischof für die<br />
Bistümer Meißen, Breslau und Prag sowie<br />
Titularbischof von Gardar auf Grönland.<br />
Sein Sitz befand sich in Zittau. Ein Teil des<br />
heutigen Kirchbaus, der Altarraum und die<br />
Sakristei dürften aus dieser Zeit stammen,<br />
das Langhaus wurde in den Jahren 1497<br />
bis 1500 errichtet. Ein mittelalterlicher Taufstein<br />
ist aus dem Jahre 1497. Die Vorhalle ist<br />
mit zahlreichen Fresken ausgeschmückt.<br />
Aber auch die Glockengeschichte der Kirche<br />
ist bemerkenswert. Glocken läuteten<br />
bereits 1438 über dem Ort. Die erste große<br />
Glocke trug die lateinische Inschrift: Da<br />
vivis gratiam, Defunctis requiem, Ecclesiae<br />
pacem, Peccatoribus veniam, Omnibus vitam<br />
acternam – verbum caro factum est.<br />
Dazu gab es auf dem schlanken Turm<br />
noch zwei kleinere Glocken mit der Inschrift:<br />
O Rex Gloriae, Veni cum pace. Lucas<br />
M(attheus).<br />
Nach ihrer Form und anderen Merkmalen<br />
wurden diese drei Glocken wahrscheinlich<br />
von dem Meister gegossen, der auch um<br />
diese Zeit die drei Glocken zu Bernstadt<br />
goss. 1615 zersprang die mittlere, wurde<br />
anzeige<br />
38<br />
Geschichte
Die Stiftskirche „St. Wenzeslaus“ in Jauernick erhält eine zweite Glocke<br />
„St. Glockenguss am 11. Februar <strong>2022</strong><br />
in Zittau neu gegossen und ein Jahr später,<br />
am Neujahrstag 1616, wieder auf den Turm<br />
gebracht.<br />
Verziert waren sie mit Reliefbildnissen von<br />
Johannes und Maria neben einem Kruzifix,<br />
dem Wappen des Klosters Marienthal sowie<br />
dem Wappen des Klostervogtes Nikol<br />
von Salza auf Linda und Heidersdorf. Neben<br />
der Inschrift “ Ps. 150: laudate Dominum in<br />
Cymbalis bene sonantibus. Laudate eum im<br />
ymbalis jubilationis“ waren auch die Namen<br />
der Äbtissin Ursula Queitsch, des Sekretärs<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
39
Die Stiftskirche „St. Wenzeslaus“ in Jauernick erhält eine zweite Glocke<br />
„St. Glockenabnahme am 24. Februar <strong>2022</strong> in Gescher<br />
anzeige<br />
40<br />
Geschichte
Die Stiftskirche „St. Wenzeslaus“ in Jauernick erhält eine zweite Glocke<br />
„St. Georg Wagner, der Kirchväter und des Richters<br />
zu lesen.<br />
1867 wurden diese drei Glocken von der<br />
Firma Gruhl in Kleinwelka umgegossen. Die<br />
drei Neuen mit einem Gewicht von 651 kg,<br />
351 kg und 183 kg hatten die Stimmung fis<br />
- a - cis. Die große Glocke trug den Namen<br />
der Äbtissin Gabriela Marschner.<br />
Über den Verbleib dieses Geläutes gibt es<br />
keinen Nachweis. Es ist aber anzunehmen,<br />
dass sie dem 1. Weltkrieg zum Opfer fielen<br />
und der Rüstungsindustrie zugeführt<br />
wurden. 1931 erhielt die Gemeinde neue<br />
Glocken der Firma Petit & Edelbrock aus<br />
Gescher / Westfalen. 1942 mussten Glocken<br />
wiederum vom Turm genommen und abgeliefert<br />
werden. Nur eine 210 kg schwere<br />
Glocke mit dem Durchmesser von 700 mm<br />
ist heute noch erhalten. Der in der Holzkonstruktion<br />
des Dachreiters hängende Klangkörper<br />
mit dem Nominal cis² ist geweiht auf<br />
den Heiligen Josef und trägt die Inschrift:<br />
Sancte Joseph Patrone morientum, ora<br />
pro nobis. Weitere Verzierungen sind ein<br />
Medaillon des Hl. Josef mit Beil und Lilienzweig,<br />
gotische Friese, Blattornamente und<br />
das Gießerzeichen mit der Jahreszahl 1931.<br />
Bei Untersuchungen des Turmes wurden<br />
gravierende Schäden an der Turmkonstruktion<br />
festgestellt, die Standsicherheit<br />
war nicht mehr gegeben. Aus diesem Grunde<br />
wurde im November 2018 das Läuten<br />
eingestellt und die Kirche geschlossen.<br />
Aber erst 2021 konnte mit den Sanierungsarbeiten<br />
am Kirchturm begonnen werden.<br />
Am 22. <strong>Juni</strong> wurde die Turmhaube abgenommen<br />
und neben dem Kirchgebäude<br />
abgestellt. Zahlreiche Vorarbeiten waren<br />
notwendig, um sichere Standflächen für<br />
die Turmhaube und die Baufahrzeuge zu<br />
schaffen. Die in unmittelbarer Nähe sich befindenden<br />
Grabstellen mussten gesichert<br />
werden.<br />
Seit längerer Zeit gab es auch den Wunsch,<br />
das Geläut zu erweitern. Die noch vorhandene<br />
cis²-Glocke war in der Konstruktion<br />
der Turmhaube gelagert, so dass auch die<br />
Belastungen beim Läutevorgang direkt in<br />
die Turmkonstruktion übertragen wurden.<br />
Dass eine zweite Glocke möglich wurde, ist<br />
großzügigen Spendern zu verdanken. Prälat<br />
Birkner, Pfarrer in Jauernick von 1996 bis<br />
2009, ist es zu verdanken, dass der erforderliche<br />
Betrag gespendet wurde.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
41
Die Stiftskirche „St. Wenzeslaus“ in Jauernick erhält eine zweite Glocke<br />
„St. Nach Abstimmungen über die Glockenzier<br />
und die Schriftbilder sowie das Reliefbildnis<br />
der Heiligen Hedwig, Schutzpatronin Schlesiens,<br />
konnte die Glocke mit dem Nominal<br />
e² in Auftrag gegeben werden. Es bot sich<br />
an, diese Glocke in der Glockengießerei Petit<br />
& Edelbrock in Gescher Westfalen gießen<br />
zu lassen. In dieser Gießerei wurde bereits<br />
1931 die noch vorhandene Glocke gefertigt.<br />
Am 10. Februar <strong>2022</strong> machte sich eine kleine<br />
Gruppe aus Jauernick auf den Weg in das<br />
700 km entfernte Gescher, um am 11. Februar<br />
dem Glockenguss beizuwohnen. Prälat<br />
Birkner konnte Prälat Giela vom Bistum<br />
Münster gewinnen, dem Guss beizuwohnen<br />
und den feierlichen Segen für ein gutes<br />
Gelingen der Glocke zu spenden. Zwei<br />
Wochen später, am 24. Februar, war die Abnahme<br />
der Glocke in der Gießerei. Der Guss<br />
war qualitätsmäßig gelungen und auch die<br />
Tonanalyse gab keinen Anlass zu Beanstandungen.<br />
Die 130 kg schwere e²-Glocke mit<br />
einem Durchmesser von 593 mm trägt folgende<br />
Verzierungen und Inschriften:<br />
Auf der Haube die Gussnummer, am Hals<br />
umlaufend ein Fries Tauben mit Ölzweig.<br />
Flanke Avers ein Reliefbildnis der Heiligen<br />
Hedwig, darunter über dem Wolm Inschrift<br />
HL. HEDWIG BITTE FÜR UNS zwischen einem<br />
Lilienfries, dem Gussjahr und Gießerzeichen.<br />
Auf der Flanke Revers der Spruch:<br />
ICH RUFE ZU FRIEDEN ÜBER ALLE GREN-<br />
ZEN HINWEG<br />
Nach Verladen der Glocke im Fahrzeug<br />
konnte die Rückfahrt nach Jauernick angetreten<br />
werden. Bei unserer Ankunft gegen<br />
19.00 Uhr in Jauernick erwartete uns Prälat<br />
Birkner mit folgender Mitteilung zum Friedenswunsch<br />
auf der Glocke: „Ich rufe zu<br />
Frieden über alle Grenzen hinweg“ konnte<br />
für diesen Tag nicht bedeutsamer sein. Am<br />
24. Februar begann der von Russland ausgehende<br />
Krieg in der Ukraine.<br />
Am 27. März <strong>2022</strong> um 14.00 Uhr wurde zur<br />
feierlichen Glockenweihe in die ehrwürdige,<br />
historische Kirche in Jauernick eingeladen.<br />
Zahlreiche Gäste aus dem Ort, aus<br />
Görlitz und eine Jugendgruppe aus Zgorcelec<br />
nahmen an der Glockenweihe durch<br />
Bischof Ipolt teil.<br />
Nach der Segnung und Salbung der Glocke<br />
wurde diese durch einen Ministranten<br />
angeschlagen, so dass alle Besucher den<br />
anzeige<br />
42<br />
Geschichte
Die Stiftskirche „St. Wenzeslaus“ in Jauernick erhält eine zweite Glocke<br />
„St. Glockenweihe durch Bischof Ipolt<br />
Nominalton e² wahrnehmen konnten.<br />
Im Anschluss an die feierliche Segnung<br />
konnten auf dem naheliegenden Hof des<br />
St. Wenzeslaus-Stiftes bei Kaffee und Kuchen<br />
alle Teilnehmer Gedanken, Erinnerungen<br />
und Hoffnungen auf eine friedliche<br />
Zukunft austauschen.<br />
Dipl.-Ing. (FH) Michael Gürlach<br />
Glockensachverständiger Bistum Görlitz<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
43
Das Zeidelwesen in der Görlitzer Heide<br />
Görlitzer Die Bienenwirtschaft ist uralt! Die Germanen<br />
schon bedienten sich zur Herstellung des<br />
bekannten Metgetränkes des Honigs als Zusatzstoff.<br />
Besonders verdient um die Hebung<br />
der Bienenwirtschaft machte sich Kaiser Karl<br />
der Große. Auf seinem Hofe befanden sich<br />
nicht weniger als 67 Bienenstöcke. Er bestimmte,<br />
dass auf seinen Gütern besondere<br />
Zeidler sein sollten. Den Bauern befahl er, der<br />
Kirche einen Honigzins zu entrichten. Eine<br />
besondere Einrichtung zur Gewinnung des<br />
Honigs waren die sogenannten „Zeidelweiden“,<br />
erstmalig 993 in einer Urkunde Ottos III.<br />
erwähnt. Die Blütezeit des<br />
Zeidelwesens fällt in das<br />
14. und 15. Jahrhundert<br />
hinein. Die Methode des<br />
Zeidelns bestand darin,<br />
dass man in Waldungen<br />
für wilde Bienenschwärme<br />
in hohlen Bäumen Wohnungen<br />
– Beuten genannt<br />
– herrichtete. Die Bienen<br />
zogen in diese Beuten und<br />
verblieben darin ohne<br />
besondere Pflege und<br />
Wartung bis zur Zeidelzeit,<br />
nämlich bis zu dem<br />
Zeitpunkt, wo ihnen unter Anwendung von<br />
Rauch die angesammelten Honigvorräte abgenommen<br />
wurden. Die Bäume, in denen<br />
sich solche Beuten befanden, nannte man<br />
Zeidelbäume oder Beutenbäume. Sie mussten<br />
langschaftig, astrein, stark und vollholzig<br />
sein. Bevorzugt wurden Kiefern. An den Bäumen<br />
befanden sich die Zeidelzeichen, das<br />
waren Kreuze, Quadrate, Halbmonde u. a.,<br />
sie durften nicht von fremder Hand entfernt<br />
werden. Die mutwillige Entfernung zog eine<br />
hohe Strafe nach sich. Diese Beutenbäume<br />
mussten an windgeschützten Stellen in ruhigen<br />
Revieren stehen, in deren Nähe sich<br />
Wassergräben, Bäche oder Tümpel befanden.<br />
Zeideln nannte man die Entnahme des<br />
Honigs. Wie das Zeideln, diese Honigentnahme,<br />
vonstatten ging, blieb für jeden Zeidler<br />
sein eigenstes Geheimnis. All jene Bäume,<br />
die für einen solchen Honigbetrieb zugerichtet<br />
waren, fasste man unter dem Begriff<br />
„Zeidelweide“ zusammen. Streitigkeiten unter<br />
den Zeidlern entstanden manchmal über<br />
die Abgrenzung, weil sich mitunter Bienenschwärme<br />
nach dem Zeideln in Nachbargebiete<br />
begaben und sich dort niederließen<br />
und dann von den betreffenden<br />
Zeidlern zurückgeholt<br />
werden sollten.<br />
Bei dieser Gelegenheit<br />
entstanden dann oft bittere<br />
Feindschaften unter<br />
den benachbarten Zeidlern.<br />
Die jeweiligen Landesherren<br />
erließen in der<br />
Folgezeit ein Gesetz, wonach<br />
der Zeidler den Bienenschwarm<br />
so weit verfolgen<br />
konnte, als er das<br />
Zeidelbeil werfen konnte.<br />
Sehr hoch im Schwange<br />
war seinerzeit das Zeidelwesen in der Görlitzer<br />
Heide. Dort bestand sogar eine eigene<br />
Zeidelordnung und eine besondere Zeidelgerichtsbarkeit.<br />
Der berühmteste Zeidler in<br />
der Görlitzer Heide war im Jahr 1486 Nikolaus<br />
Ranfft zu Tommersdorf. Er kaufte eine Zeidelwiese<br />
erblich für 200 Mark. Ihm wurde die<br />
Verpflichtung auferlegt, von jedem Baum,<br />
den er als Beutenbaum anzeichnete, alljährlich<br />
dem betreffenden Förster 2 Groschen zu<br />
zahlen. Die Zeidler der Görlitzer Heide waren<br />
zu einer Zeidelgilde zusammengeschlossen<br />
und standen unter einem sogenannten Zei-<br />
44<br />
Geschichte
Das Zeidelwesen in der Görlitzer Heide<br />
Görlitzer delstarosten. Alljährlich fand in Görlitz eine<br />
Versammlung aller Zeidler statt, auf der die<br />
Zeidelordnung verlesen und Beschwerden<br />
und Klagen vorgebracht wurden. Eine besondere<br />
Befugnis hatten die herrschaftlichen<br />
Zeidelweiden. Sie konnten verkauft werden.<br />
Das Verkaufsrecht hatten die Mitglieder der<br />
Görlitzer Zeidelinnung. Kaufte ein Mitglied<br />
der Zeidelinnung eine solche herrschaftliche<br />
Zeidelweise und starb er ohne Erben, so fiel<br />
die Zeidelweide an die Herrschaft zurück.<br />
Ging einem Zeidler ein Baum in seiner Zeidelweide<br />
ein, so musste dieser Baum durch<br />
einen neuen ersetzt werden. Ließ die betreffende<br />
Herrschaft, der er die Zeidelweide<br />
abgekauft hatte, einen Baum schlagen, so<br />
erhielt der Zeidler daraus die sogenannte<br />
„Klotzbeute“. Er selber war verpflichtet, jährlich<br />
zwei bis drei neue Beuten zu hauen. Da<br />
die Zeidelzeichen mitunter durch Witterungseinflüsse<br />
unkenntlich wurden, musste<br />
er alle zehn Jahre sie neu einhauen. Wurde<br />
ein Baum vom Sturm umgebrochen, dass<br />
dadurch die Zeidlerei hinfällig wurde, so bekam<br />
der Zeidler 2 Groschen Stammgeld. Sehr<br />
streng verboten war das Ersteigen eines Baumes<br />
mit einem Steigeisen. Der Zeidler durfte<br />
nur, wollte er den Stamm erklettern, eine Leiter<br />
oder ein Seil benutzen. Großen Wert legte<br />
man auf die Zugehörigkeit der Zeidler zu der<br />
Zeidlerinnung. War ein Zeidler nicht Mitglied,<br />
so durfte er auf eignem Grund und Boden<br />
seine Beute errichten. Der Zins für eine Zeidelweide<br />
betrug damals 2 bis 4 Reichstaler.<br />
Bekannt war auch die Zeidelweide zu Muskau.<br />
Sie war eine der größten. Die Innung<br />
zählte beispielsweise 1769 schon 170 Personen.<br />
Diese hatten insgesamt 7000 Stöcke, sie<br />
brachten einen Zins von 73 Reichstalern.<br />
Kathrin Drochmann<br />
Impressum:<br />
Herausgeber (V.i.S.d.P.):<br />
<strong>StadtBILD</strong>-Verlag<br />
eine Unternehmung der<br />
incaming media GmbH<br />
vertreten durch den Geschäftsführer<br />
Andreas Ch. de Morales Roque<br />
Mitglied im Deutschen Fachjournalistenverband<br />
Carl-von-Ossietzky-Straße 45 | 02826 Görlitz<br />
Tel. 03581 87 87 87 | Fax: 03581 40 13 41<br />
E-Mail: info@stadtbild-verlag.de<br />
Shop: www.stadtbild-verlag.de<br />
Bankverbindung:<br />
IBAN: DE21 8504 0000 0302 1979 00<br />
BIC: COBADEFFXXX<br />
Geschäftszeiten:<br />
Mo. - Fr. von 9.00 bis 16.00 Uhr<br />
Druck:<br />
Graphische Werkstätten Zittau GmbH<br />
Erscheinungsweise: monatlich<br />
Redaktion & Inserate:<br />
Andreas Ch. de Morales Roque<br />
Kathrin Drochmann<br />
Dipl. - Ing. Eberhard Oertel<br />
Bertram Oertel<br />
Layout:<br />
Kathrin Drochmann<br />
Lektorat:<br />
Wolfgang Reuter, Berlin<br />
Teile der Auflage werden kostenlos verteilt, um<br />
eine größere Verbreitungsdichte zu gewährleisten.<br />
Für eingesandte Texte & Fotos übernimmt der Herausgeber<br />
keine Haftung. Artikel, die namentlich<br />
gekennzeichnet sind, spiegeln nicht die Auffassung<br />
des Herausgebers wider. Anzeigen und redaktionelle<br />
Texte können nur nach schriftlicher Genehmigung<br />
des Herausgebers verwendet werden.<br />
Redaktionsschluss:<br />
Für die nächste Ausgabe (Juli)<br />
ist am 15.<strong>06</strong>.<strong>2022</strong><br />
Geschichte<br />
45
Überbrückungshilfe IV bis <strong>Juni</strong> <strong>2022</strong> verlängert<br />
ETL-Steuerberatung<br />
Zwei Jahre Corona-Pandemie haben die Märkte ordentlich durcheinandergebracht. Damit Unternehmen<br />
die staatlich verordneten Coronamaßnahmen wirtschaftlich überleben können, hat die Regierung<br />
Überbrückungshilfen bereitgestellt.<br />
Am 1. April wurde die Überbrückungshilfe IV (ÜH IV) nochmal um drei Monate verlängert. Damit können<br />
Unternehmen mit der aktuellen Überbrückungshilfe Coronahilfen für den Zeitraum Januar bis <strong>Juni</strong><br />
<strong>2022</strong> beantragen, wenn sie einen coronabedingten Umsatzrückgang haben. Wichtigste Grundlage dieser<br />
Beurteilung sind dabei nicht die Umsatzzahlen im Vergleich zum Referenzmonat des Jahres 2019,<br />
sondern sachliche Fakten, die ihre Ursache in gegenwärtigen oder vergangenen Coronamaßnahmen<br />
haben. Dabei werden wirtschaftliche Faktoren, wie Lieferengpässe oder Schwierigkeiten bei der Rekrutierung<br />
von Arbeitskräften nicht anerkannt. Dies gilt in der Regel selbst dann, wenn die Schwierigkeiten<br />
nachweislich darauf zurückzuführen sind, dass die Pandemie den weltweiten Absatz- und Beschaffungsmarkt<br />
bzw. den Arbeitsmarkt durcheinandergewirbelt hat. Aber auch Umsatzrückgänge, die mit<br />
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg stehen, berechtigen nicht zur Beantragung<br />
von Überbrückungshilfe IV. Dies mag für den einen oder anderen Unternehmer nicht nachvollziehbar<br />
sein, es sind aber die Vorgaben des Bundes als Beihilfegeber, die beachtet und eingehalten werden<br />
müssen. Teilen Sie Ihrem prüfenden Dritten schriftlich mit, welche Gründe für einen coronabedingten<br />
Umsatzrückgang maßgebend sind. Wenn Sie damit Ihren prüfenden Dritten überzeugen können und<br />
mindestens in einem Monat des Förderzeitraums 30 % weniger Umsatz als im Vergleichsmonat haben,<br />
kann ein Antrag gestellt werden.<br />
Antragsfrist endet bereits am 15. <strong>Juni</strong> <strong>2022</strong><br />
Obwohl der Förderzeitraum bis 30. <strong>Juni</strong> <strong>2022</strong> verlängert wurde, endet die Antragsfrist bereits am<br />
15. <strong>Juni</strong> <strong>2022</strong>. Aufgrund europarechtlicher Vorgaben kann diese Frist nicht verlängert werden. Da zudem<br />
alle Anträge auf Überbrückungshilfen bis zum 30. <strong>Juni</strong> <strong>2022</strong> durch die Bewilligungsstellen vorläufig<br />
beschieden sein müssen, sollten Sie bald Ihren Steuerberater mit einem Antragswunsch kontaktieren.<br />
Wirtschaftlich Berechtigte müssen im Transparenzregister eingetragen sein<br />
Im Zusammenhang mit der Antragstellung von Überbrückungshilfen war und ist auch die Offenlegung<br />
der wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister zu bestätigen. Noch war aufgrund einer Übergangsfrist<br />
zur Eintragungspflicht die tatsächliche Eintragung vielfach entbehrlich. Doch nun endet für<br />
Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, UG [haftungsbeschränkt],<br />
Genossenschaft, Europäische Genossenschaft oder Partnerschaft) die Übergangsfrist zum 30.<br />
<strong>Juni</strong> <strong>2022</strong>. Wenn für Ihr Unternehmen eine Eintragungspflicht im Transparenzregister besteht, empfehlen<br />
wir, eine baldige Eintragung vorzunehmen. Spätestens zur Schlussrechnung der Überbrückungshilfen<br />
muss die Eintragung erfolgt sein. Wird im Nachgang festgestellt, dass die im Rahmen des Antrags<br />
erteilte Verpflichtungserklärung verletzt wurde, droht die vollumfängliche Rückzahlung der Überbrückungshilfe.<br />
Schlussrechnungen für alle Überbrückungshilfen bis 31. Dezember <strong>2022</strong><br />
Bis zum 31. Dezember <strong>2022</strong> muss für alle Überbrückungshilfen eine Schlussrechnung über den prüfenden<br />
Dritten eingereicht werden. Dabei werden die Schlussrechnungen für die Überbrückungshilfen<br />
und außerordentlichen Wirtschaftshilfen in zwei Abrechnungspaketen starten. Das Paket I ermöglicht<br />
die Schlussrechnung für die Überbrückungshilfen I bis III und die außerordentlichen Wirtschaftshilfen<br />
(November-/Dezemberhilfe) und umfasst damit die Monate <strong>Juni</strong> 2020 bis <strong>Juni</strong> 2021. Es soll ab Mitte Mai<br />
<strong>2022</strong> den prüfenden Dritten zur Verfügung stehen. In einem zweiten Paket werden dann die Schlussrechnungen<br />
für die Überbrückungshilfen III Plus und IV erfolgen.<br />
Autor: Ulf Hannemann, Freund & Partner GmbH (Stand: 29.04.<strong>2022</strong>)<br />
46<br />
Ratgeber | Anzeige