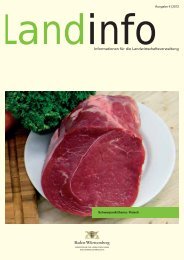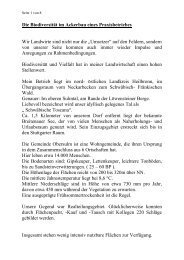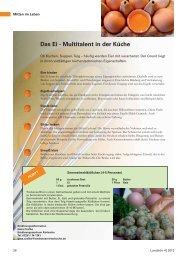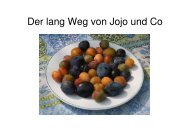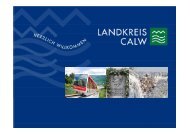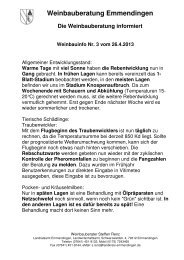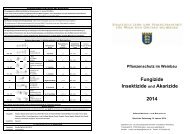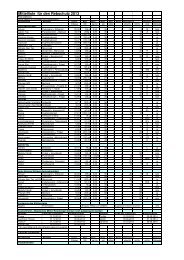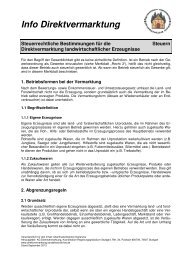Forst-/Rechtliche Aspekte der Waldweide im Südschwarzwald
Forst-/Rechtliche Aspekte der Waldweide im Südschwarzwald
Forst-/Rechtliche Aspekte der Waldweide im Südschwarzwald
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Tagung<br />
<strong>Waldweide</strong> - Tabubruch <strong>im</strong> Wald?<br />
07. Mai 2003,<br />
Feldberg, Naturschutzzentrum <strong>Südschwarzwald</strong><br />
<strong>Forst</strong>-/<strong>Rechtliche</strong> <strong>Aspekte</strong> <strong>der</strong> <strong>Waldweide</strong> <strong>im</strong> <strong>Südschwarzwald</strong><br />
FD Albrecht Verbeek, <strong>Forst</strong>direktion Freiburg<br />
1. Einleitung<br />
Die <strong>Waldweide</strong> mit Rin<strong>der</strong>n, Schafen, Ziegen, Pferden und Schweinen zählt, neben<br />
<strong>der</strong> Jagd, sicher zu den ältesten Formen <strong>der</strong> Waldnutzung in Mitteleuropa. Sie hat<br />
bis ins Spätmittelalter hinein meist in Verbund mit einer oftmals exzessiven<br />
Holznutzung eine großflächige Waldzerstörung verursacht o<strong>der</strong> doch ganz<br />
wesentlich dazu beigetragen. Als entscheidende Faktoren für diese Entwicklung<br />
sind zu nennen<br />
• dauerhafte Auflichtung <strong>der</strong> Bestände, insbeson<strong>der</strong>e durch<br />
Verbiss/Zerstörung <strong>der</strong> Verjüngung, bis hin zu parkartigen Strukturen<br />
• Aushagerung und Verdichtung <strong>der</strong> Böden, (noch deutlich verstärkt durch<br />
die heutzutage wesentlich schwereren Rin<strong>der</strong>rassen als in früheren<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ten üblich), mit entsprechenden, vielfach gravierenden<br />
Erosionsfolgen<br />
Als indirekte Folgen bzw. Eingriffe <strong>der</strong> <strong>Waldweide</strong> sind zu erwähnen<br />
• Streunutzung, Reisighacken, Plaggenwirtschaft, Schorben des<br />
Oberbodens, Schneiteln <strong>der</strong> Laubbäume u.a.m. mit <strong>der</strong> Folge einer totalen<br />
Degradation <strong>der</strong> Waldböden<br />
• <strong>der</strong> Verfall <strong>der</strong> Wäl<strong>der</strong> wurde zusätzlich beschleunigt durch Brennen,<br />
Schwenden, z.T. auch Ringeln <strong>der</strong> Bäume mit dem Ziel <strong>der</strong> Erweiterung/<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Weidefläche <strong>im</strong> Wald o<strong>der</strong> auch zur Lichtstellung <strong>der</strong><br />
Mastbaumarten Buche und Eiche.<br />
Die Folgen dieser Entwicklung sind bekannt: Der Schwarzwald hatte Ende des 18.<br />
Jhdts. lediglich noch eine Bewaldung – soweit man aufgrund <strong>der</strong> Vorratsarmut und<br />
Auflichtung überhaupt noch von Wald sprechen konnte – auf vielleicht 25 – 30 %<br />
<strong>der</strong> Fläche. Heute haben wir <strong>im</strong> Schwarzwald ein mittleres Bewaldungsprozent von<br />
~60 %.<br />
Während die Schweinemast noch als relativ waldverträglich eingestuft werden<br />
kann, ist die Rin<strong>der</strong>beweidung schon wesentlich kritischer zu beurteilen, auch wenn<br />
hierdurch i.d.R. nur ein kleinstandörtlich wechseln<strong>der</strong>, plätzeweise selektiver<br />
Verbiss erfolgt. Deutlich schwerwiegen<strong>der</strong> stellt sich die Vegetationsbelastung<br />
durch Schafe dar, da die Verjüngung insgesamt gefressen wird. Beson<strong>der</strong>s<br />
gefürchtet sind freilich Ziegen, von denen ein Tier pro ha ausreicht, um die<br />
Wie<strong>der</strong>bewaldung einer Freifläche durch totalen Sämlingsverbiss nachhaltig zu<br />
unterbinden. Beson<strong>der</strong>s waldschädlich sind die Ziegen durch ihre Kletterfähigkeit<br />
bzw. durch das Schälen, z.T. durch Hornstöße, auch älterer Bäume. Am Rande sei<br />
angemerkt: Lediglich die Bienenweide ist forstlich irrelevant bzw. unschädlich und<br />
unterliegt daher auch keinen öffentlich-rechtlichen Beschränkungen.<br />
Nach <strong>der</strong> großflächigen Waldverwüstung durch jahrtausendelange lokale<br />
Weidebelastung ist es nicht verwun<strong>der</strong>lich, dass <strong>Forst</strong>verwaltungen bzw. die<br />
Förster mit <strong>der</strong> <strong>Waldweide</strong> quasi ein „Feindbild" verbinden. Die <strong>Waldweide</strong>,<br />
insbeson<strong>der</strong>e die Ziegenweide, wird oft als „Geißel des Waldes" o<strong>der</strong> gar „...<strong>der</strong><br />
Menschheit" bezeichnet. Logischerweise ergab sich daraus schon sehr früh die<br />
(forstpolitische) For<strong>der</strong>ung nach einem Verbot <strong>der</strong> <strong>Waldweide</strong> bzw. einer klaren<br />
Trennung von Wald und Weide, also einer Einschränkung <strong>der</strong> vielfältigen Nutzung<br />
des Waldes durch die Landbevölkerung.
des Waldes durch die Landbevölkerung.<br />
Mit zahlreichen <strong>Forst</strong>ordnungen, speziell <strong>im</strong> 18. Jhdt., versuchte man die<br />
Problematik in den Griff zu bekommen, was aber lange Zeit auch deswegen nicht<br />
gelang, da dies zwar dem Wald zu Gute kam o<strong>der</strong> kommen sollte, aber für die<br />
Menschen <strong>im</strong> ländlichen Raum eine erhebliche Verschlechterung ihrer sozialen Lage<br />
bedeutete. Die Übernutzung <strong>der</strong> Wäl<strong>der</strong> entsprang ja auch einer existenziellen<br />
Notlage <strong>der</strong> bäuerlichen Bevölkerung, die auf einer größtmöglichen Weidefläche<br />
angewiesen war, weshalb entsprechende Verbote vielfach nicht beachtet wurden.<br />
„Waldfrevel" war die Folge, gegen den die Obrigkeit oft mit härtesten Mitteln<br />
vorging. Förster gehörten zu jener Zeit zu den meistgehassten Personen.<br />
Erst mit <strong>der</strong> Ablösung vieler Weideberechtigungen Anfang des 19.Jhdts., vielfach<br />
nach jahrzehntelangen gerichtlichen Auseinan<strong>der</strong>setzungen, konnte eine gewisse<br />
Entlastung herbeigeführt werden. Das geschah oftmals durch Abteilung von<br />
Waldflächen aus dem herrschaftlichen, klösterlichen o<strong>der</strong> kommunalen Besitz und<br />
Aufteilung auf die einzelnen Berechtigten. Schließlich wurde mit dem Bad.<br />
<strong>Forst</strong>gesetz von 1833 eine einheitliche, klare Rechtsgrundlage geschaffen, womit ja<br />
auch in Deutschland <strong>der</strong> Beginn einer mo<strong>der</strong>nen, nachhaltigen und pfleglicheren<br />
<strong>Forst</strong>wirtschaft und Waldbehandlung zeitlich mehr o<strong>der</strong> weniger zusammenfällt.<br />
2. <strong>Forst</strong>rechtliche Behandlung <strong>der</strong> <strong>Waldweide</strong><br />
2.1 Das Bad. <strong>Forst</strong>gesetz von 1833 verbot zwar nicht generell die direkten und<br />
indirekten Eingriffe, die mit <strong>der</strong> <strong>Waldweide</strong> verbunden sind, schränkte sie jedoch<br />
ganz erheblich ein. In § 32 ff., wo es um die Gewinnung <strong>der</strong> <strong>Forst</strong>nebenprodukte<br />
ging, wurde u.a. folgendes geregelt:<br />
• in Hochwaldungen können die Schläge <strong>der</strong> Viehweide nur eröffnet werden,<br />
wenn das junge Gehölz 35 Jahre (Lbh) bzw. 30 Jahre (Ndh) mindestens<br />
erreicht hat<br />
• Viehtrieb nur während <strong>der</strong> Monate Mai bis Oktober<br />
• vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang wird das Weidevieh in<br />
Waldungen nicht geduldet<br />
• das Weiden von Schafen und Geißen in Waldungen findet nicht statt<br />
• die Gewinnung des grünen Laubs von stehenden Bäumen zum Viehfutter<br />
ist untersagt<br />
• das Sammeln des Streulaubs, des Mooses und <strong>der</strong> Nadeln kann nur<br />
stattfinden, wenn in Hochwaldungen ein Alter von 40 J. (Lbh) bzw. von 30<br />
J. (Ndh) erreicht ist<br />
• zu Eckerich und Mast dürfen nur jene Eicheln und Bucheln benutzt<br />
werden, welche für die Besamung <strong>der</strong> Schläge überflüssig sind<br />
• neue <strong>Forst</strong>berechtigungen können nicht mehr entstehen.<br />
Im badischen wie auch württembergischen <strong>Forst</strong>strafgesetz von 1879 wurde das<br />
unbefugte Weiden mit einer z.T empfindlichen Geldstrafe belegt.<br />
2.2 Das Landeswaldgesetz von 1976, das ja die völlig zersplitterte<br />
<strong>Forst</strong>rechtsmaterie in Baden-Württemberg neu ordnete, regelt lediglich in § 83,<br />
Abs. 2, Nr. 16 als allgemeine Ordnungswidrigkeit<br />
• wer <strong>im</strong> Wald unbefugt Vieh treibt, Vieh weidet o<strong>der</strong> weiden lässt.<br />
Ein generelles gesetzliches Verbot <strong>der</strong> <strong>Waldweide</strong> existiert also nicht.<br />
Allerdings greift hier <strong>im</strong> Regelfall § 14 LWaldG mit dem Gebot einer pfleglichen<br />
Bewirtschaftung des Waldes. Dazu gehört insbeson<strong>der</strong>e den Boden und die<br />
Bodenfruchtbarkeit zu erhalten bzw. Nebennutzungen, wozu u.a. die <strong>Waldweide</strong> zu<br />
rechnen ist, nur so auszuüben bzw. ausüben zu lassen, dass die vielfältigen<br />
Funktionen des Waldes nicht beeinträchtigt werden. I.d.R. ist davon auszugehen,<br />
dass die <strong>Waldweide</strong> dieser Vorgabe nicht entspricht bzw. mit einer<br />
ordnungsgemäßen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung nicht zu vereinbaren ist.<br />
Ggf. ist sogar zu prüfen, ob durch die Intensität <strong>der</strong> Beweidung die
Waldeigenschaft verloren geht und eine Umwandlungsgenehmigung nach § 9<br />
LWaldG erfor<strong>der</strong>lich wird.<br />
3. För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Trennung von Wald und Weide<br />
Hinzuweisen ist auch auf die Tatsache, dass bis in das Jahr 1986 die Trennung<br />
von Wald und Weide als „<strong>Forst</strong>liches Vorhaben" wohlgemerkt! aus Mitteln des<br />
„Grünen Plans", später <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung <strong>der</strong><br />
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" finanziell geför<strong>der</strong>t wurde.<br />
För<strong>der</strong>voraussetzung war, dass die Maßnahme <strong>der</strong> Freistellung des Waldes von <strong>der</strong><br />
Viehweide dient. Sie umfasste die Ablösung von Weideberechtigungen o<strong>der</strong> auch<br />
ersatzweise die Anlage o<strong>der</strong> Bereitstellung neuer o<strong>der</strong> bestehen<strong>der</strong> Weideflächen<br />
durch Rodung, Säuberung und Kultivierung von Waldflächen bis hin zu Errichtung<br />
eingezäunter Weiden.<br />
I.ü. hat man sich seitens <strong>der</strong> <strong>Forst</strong>verwaltung gerade <strong>im</strong> Allmendgebiet des<br />
<strong>Südschwarzwald</strong>es verschiedentlich strategisch wie planerisch <strong>der</strong> Problematik<br />
angenommen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die maßgeblich auch von<br />
<strong>Forst</strong>leuten (FP a.D. Lauterwasser als damaliger Leiter des FA Todtnau)<br />
mitverfasste Denkschrift des Landkreises Lörrach von 1969, die sich mit <strong>der</strong><br />
„Erhaltung <strong>der</strong> Landschaft und Verbesserung <strong>der</strong> Lebensbedingungen <strong>im</strong> Wiesental"<br />
auseinan<strong>der</strong>setzte, ebenso an die von <strong>der</strong> <strong>Forst</strong>verwaltung 1976 erarbeitete<br />
Modellplanung Todtnau, wo es speziell um die Neuabgrenzung von Wald und<br />
Weide ging.<br />
4. Beson<strong>der</strong>e forstrechtliche <strong>Aspekte</strong> <strong>der</strong> <strong>Waldweide</strong> <strong>im</strong> <strong>Südschwarzwald</strong><br />
Im Allmendgebiet des <strong>Südschwarzwald</strong>es, hier v.a. <strong>im</strong> Großen Wiesental, stellen<br />
bzw. stellten sich in den vergangenen Jahrzehnten als Folge des erheblichen<br />
Rückgangs <strong>der</strong> Beweidungsintensität beson<strong>der</strong>e Probleme bzgl. <strong>Waldweide</strong>,<br />
Weidewald, Waldeigenschaft von Sukzessionsflächen, Nutzungsrechten am<br />
Weidewald u.a.. Diese Probleme haben z.T. zu sehr unschönen, oft an die Person<br />
<strong>der</strong> Akteure vor Ort gebundenen, jahrelangen Auseinan<strong>der</strong>setzungen zwischen<br />
<strong>Forst</strong>ämtern und Landwirtschaftsämtern bzw. <strong>der</strong> Weideinspektion Schönau, z.T.<br />
auch mit einzelnen Gemeinden geführt. Viele damit zusammenhängende<br />
Rechtsfragen, z.B. inwieweit die Nutzbürgerrechte sich auch auf die neu<br />
entstandenen Weide-/Sukzessionswaldflächen bzgl. <strong>der</strong> Holznutzung erstrecken<br />
bzw. fortbestehen o<strong>der</strong> ob diese Waldzugänge dem Gemeindewald zugeschlagen<br />
werden müssen/können, sind bis heute unbeantwortet geblieben.<br />
Bzgl. <strong>der</strong> forstrechtlichen Problemstellung ergab sich nämlich eine Zäsur einerseits<br />
durch die Aufforstungsbest<strong>im</strong>mungen des Landwirtschafts- und<br />
Landeskulturgesetzes (LLG) von 1972 (Genehmigungspflicht, Pflegepflicht, <strong>der</strong>en<br />
Aussetzen bzw. Überlassen an den natürlichen Bewuchs), an<strong>der</strong>erseits durch die<br />
Walddefinition und die Best<strong>im</strong>mungen über die Umwandlung von Wald gem.<br />
Landeswaldgesetz.<br />
Der Wille des Gesetzgebers geht mit dem LLG sicherlich dahin, durch eine strikte<br />
Einhaltung <strong>der</strong> Pflegepflicht vollendete Tatsachen wie die Entstehung von<br />
Sukzessionswäl<strong>der</strong>n in einem Übergangszeitraum bis zur Freigabe an den<br />
natürlichen Bewuchs zu verhin<strong>der</strong>n. Die Gemeinden, denen nach § 29 LLG die<br />
Überwachung <strong>der</strong> Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht gesetzlich übertragen wurde,<br />
haben in <strong>der</strong> Vergangenheit allerdings keinen beson<strong>der</strong>s strengen Maßstab an ihre<br />
eigenen Pflichten in Bezug auf die gemeindlichen Allmendweideflächen gelegt, so<br />
dass auch nach Inkrafttreten des LLG neue umfangreiche Weidewaldungen<br />
entstanden sind.<br />
Bei den Auseinan<strong>der</strong>setzungen bestanden beide Seiten auf den aus den jeweiligen<br />
Gesetzen sich ergebenden Rechtpositionen: Die Landwirtschaftsverwaltung ließ<br />
unter Berufung auf fehlende Aufforstungsgenehmigungen, Pflegepflicht und<br />
landespflegerische Freihaltung <strong>der</strong> Landschaft bestehenden Weidewald in<br />
unbestockte Weideflächen u.a. mit dem Hinweis zurückversetzen, es handele sich<br />
nicht um wirklichen Wald, <strong>der</strong> <strong>im</strong> „Waldverband" o<strong>der</strong> in einem Waldverzeichnis
gem. § 2 abs. 5 LWaldG geführt werde.<br />
Die <strong>Forst</strong>verwaltung verwies auf die Waldeigenschaft gem. § 2 LWaldG, auf<br />
entsprechende Einschätzungen <strong>der</strong> fraglichen Flächen durch die Finanzverwaltung<br />
als Wald, Holzung, Gehölz mit entsprechendem Eingang ins Liegenschaftskataster,<br />
auf die Tatsache, dass alle <strong>der</strong>artigen Flächen <strong>im</strong> Gemeindebesitz <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong><br />
<strong>Forst</strong>einrichtung erfasst werden müssen bzw. sie protestierte gegen die Rücküberführung<br />
in Weideflächen, weil es sich dabei um ungenehmigte Umwandlungen<br />
handele.<br />
Diese Problematik findet auch ihren Nie<strong>der</strong>schlag in den Rechtsverordnungen für<br />
die NSG „Feldberg" und „Belchen". Innerhalb <strong>der</strong> dort in den Schutzgebiets-Karten<br />
ausgewiesenen gelben Linie dürfen u.a. keine Flächen <strong>der</strong> natürlichen Entwicklung<br />
zu Wald überlassen werden, obwohl zum Zeitpunkt des Erlasses <strong>der</strong> VOen<br />
umfangreiche Flächen sich in diesen Bereichen in z.T. weit fortgeschrittener Wald-<br />
Sukzession befanden bzw. unbestritten als Waldflächen deklariert werden mussten,<br />
abgesehen von <strong>der</strong> Tatsache, dass seit Inkrafttreten <strong>der</strong> Verordnungen sich örtlich<br />
deutliche Weiterentwicklungen in Richtung Wald vollzogen haben.<br />
Seit Mitte <strong>der</strong> 90er Jahre ist auf dieser Front – Gott sei Dank – etwas Ruhe<br />
eingekehrt, man sieht die Dinge auch forstlicherseits etwas gelassener und<br />
praktiziert anstelle fundamentalistischer Positionen ein sehr pragmatisches<br />
Vorgehen. Dazu hat u.a. auch beigetragen, dass sich <strong>der</strong> Herr Ministerialdirektor<br />
<strong>der</strong> Angelegenheit zwe<strong>im</strong>al persönlich vor Ort angenommen hat. Man hat sich<br />
seitdem auf folgendes Vorgehen geeinigt:<br />
• Flächen, die sich noch in regelmäßiger, auch extensiver Pflege befinden,<br />
werden nicht schon durch erstmaliges Auftreten früher Sukzessionsstadien<br />
mit Waldbäumen und –sträuchern zu Wald i.S. von § 2 LWaldG, solange<br />
die klar erkennbare Absicht des Eigentümers o<strong>der</strong> des<br />
Nutzungsberechtigten besteht, diese Flächen freizuhalten und eine<br />
entsprechende Pflege auch tatsächlich stattfindet. Hierfür genügt auch<br />
eine extensive Pflege/Beweidung in ggf. mehr-jährigen<br />
(standortsabhängig bis zu 5jährigen) Intervallen.<br />
• Nach (ggf. geduldeter) Aufgabe solcher Pflegemaßnahmen wird die<br />
Waldeigenschaft jedoch auch durch Sukzession begründet, unabhängig<br />
davon, ob für die Fläche eine Aufforstungsgenehmigung gem. § 25 LLG<br />
vorliegt, die Fläche in einem Aufforstungsgebiet gem. § 25 a LLG liegt,<br />
o<strong>der</strong> die Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht nach § 27 (3) LLG erloschen<br />
ist.<br />
Für die weitere Arbeit vor Ort ergeben sich daraus folgende Konsequenzen:<br />
• Sofern eine als Wald anzusprechende Fläche als Weidefläche benötigt<br />
wird, muss ein Umwandlungsantrag gestellt werden. Die <strong>Forst</strong>verwaltung<br />
wird bei dem <strong>im</strong> <strong>Südschwarzwald</strong> gegebenen Bewaldungsprozent keinen<br />
strengen Maßstab bei <strong>der</strong> Beurteilung anlegen.<br />
• Sofern eine als Wald anzusprechende Fläche naturschutzwichtig ist, sind<br />
die Naturschutzziele in die <strong>Forst</strong>einrichtung einzubringen und umzusetzen.<br />
In diesem Fall ist ggf. auch eine För<strong>der</strong>ung <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> RL Naturnahe<br />
Waldwirtschaft zu prüfen.<br />
• Sofern eine als Wald anzusprechende Fläche aus Sicht des Naturschutzes<br />
offengehalten werden muss, ist hierfür eine Umwandlungsgenehmigung<br />
erfor<strong>der</strong>lich. Die <strong>Forst</strong>verwaltung wird bei <strong>der</strong> Beurteilung des<br />
Umwandlungsantrages <strong>der</strong> hohen Wertigkeit <strong>der</strong> Naturschutzzielsetzung<br />
Rechnung tragen.<br />
• Sukzessionsflächen, die aus landschaftspflegerischer Sicht und aus Sicht<br />
des Naturschutzes nicht als beson<strong>der</strong>s wichtig eingestuft werden, sollen<br />
<strong>der</strong> natürlichen Wie<strong>der</strong>bewaldung überlassen o<strong>der</strong> aufgeforstet werden.<br />
Ich meine, man hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut an diese Marschroute<br />
gehalten. Ich könnte zahlreiche Beispiele nennen, die dies belegen.<br />
5. Schlussbetrachtung
M.E. besteht bei den meisten <strong>Forst</strong>kollegen vor Ort durchaus großes Verständnis<br />
für die Naturschutzbedeutung lichter Weidewäl<strong>der</strong> bzw. halboffener<br />
Weidelandschaften für den Artenschutz, insbeson<strong>der</strong>e für lichtliebende, meist<br />
konkurrenzschwache Pflanzen- und Tierarten, die <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> von uns<br />
praktizierten naturnahen Waldwirtschaft, die meist eine Kl<strong>im</strong>axwald- also<br />
Dunkelwaldwirtschaft ist, zu kurz kommen. Dies ist ja nun heute von verschiedener<br />
Seite eingehend beleuchtet worden. Insofern sind wir für exemplarische<br />
Maßnahmen, die in diese Richtung zielen, durchaus offen, da sie zudem auch Inhalt<br />
einer umfassend verstandenen Multifunktionalen <strong>Forst</strong>wirtschaft sein sollten. Im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Naturschutzkonzeption „Oberer Hotzenwald" o<strong>der</strong> des<br />
Naturschutzgroßprojektes „Feldberg – Belchen – Oberes Wiesental" sind ja<br />
entsprechende Maßnahmen bereits durchgeführt worden bzw. sind Gegenstand <strong>der</strong><br />
Pflege- und Entwicklungspläne o<strong>der</strong> für die Zukunft projektiert. Auch für den mehr<br />
musealen Erhalt von typischen Hutewaldstrukturen wird man einer<br />
Wie<strong>der</strong>aufnahme einer extensiven Beweidung offen gegenüberstehen.<br />
Eine größerflächige Wie<strong>der</strong>aufnahme <strong>der</strong> <strong>Waldweide</strong> kann jedoch aus forstlicher<br />
Sicht nicht in Frage kommen. Die Gründe sind eingehend dargelegt worden. Und<br />
auch ein dargestalter Paradigmenwechsel würde vermutlich noch nicht einmal von<br />
unserem Ministerpräsidenten verlangt werden, <strong>der</strong> ja ansonsten diesbezüglich, wie<br />
die jüngste Vergangenheit zeigt, vor nichts zurückscheut.<br />
Ich glaube auch nicht, dass die flächige Wie<strong>der</strong>aufnahme <strong>der</strong> Beweidung <strong>der</strong><br />
Wäl<strong>der</strong> ein echtes, vorrangig zu betreibendes Ziel <strong>im</strong> <strong>Südschwarzwald</strong> sein kann.<br />
Die <strong>Forst</strong>verwaltung hat kein pr<strong>im</strong>äres Interesse daran, dass angesichts <strong>der</strong> örtlich<br />
schon sehr hohen, z.T. schon zu hohen Bewaldungsverhältnisse weitere<br />
Waldflächen unter ihre Fittiche gelangen. Daher sollte alles daran gesetzt werden,<br />
die überkommene Kulturlandschaft noch in ihrem jetzigen Bestand offen o<strong>der</strong><br />
zumindest halboffen zu halten, auch o<strong>der</strong> gerade durch entsprechende<br />
Weidekonzepte. Der Naturpark <strong>Südschwarzwald</strong> hat dazu in jüngster Zeit erst eine<br />
entsprechende Studie vorgelegt. Dabei werden sich mit Sicherheit genügend<br />
Strukturen ergeben, die den spezifischen Artenschutzanfor<strong>der</strong>ungen gerecht<br />
werden, die man mit <strong>der</strong> <strong>Waldweide</strong> zu erreichen sucht.