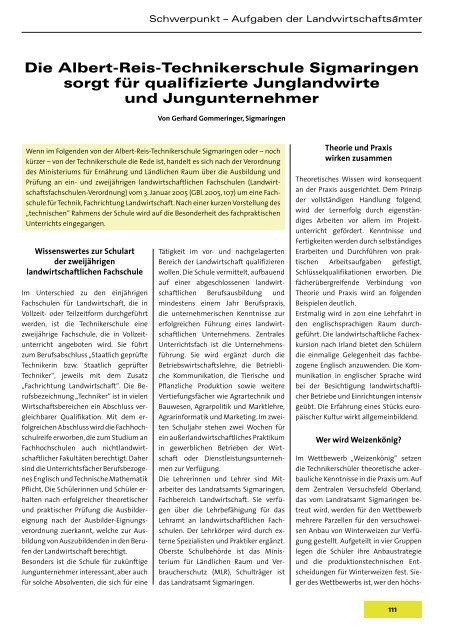Die Albert-Reis-Technikerschule Sigmaringen sorgt für qualifizierte ...
Die Albert-Reis-Technikerschule Sigmaringen sorgt für qualifizierte ...
Die Albert-Reis-Technikerschule Sigmaringen sorgt für qualifizierte ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wissenswertes zur Schulart<br />
der zweijährigen<br />
landwirtschaftlichen Fachschule<br />
Im Unterschied zu den einjährigen<br />
Fachschulen <strong>für</strong> Landwirtschaft, die in<br />
Vollzeit- oder Teilzeitform durchgeführt<br />
werden, ist die <strong>Technikerschule</strong> eine<br />
zweijährige Fachschule, die in Vollzeit -<br />
unterricht angeboten wird. Sie führt<br />
zum Berufsabschluss „Staatlich geprüfte<br />
Technikerin bzw. Staatlich geprüfter<br />
Techniker“, jeweils mit dem Zusatz<br />
„Fachrichtung Landwirtschaft“. <strong>Die</strong> Berufsbezeichnung<br />
„Techniker“ ist in vielen<br />
Wirtschaftsbereichen ein Abschluss vergleichbarer<br />
Qualifikation. Mit dem er -<br />
folgreichen Abschluss wird die Fachhochschulreife<br />
erworben, die zum Studium an<br />
Fachhochschulen auch nichtlandwirtschaftlicher<br />
Fakultäten berechtigt. Daher<br />
sind die Unterrichtsfächer Berufsbezogenes<br />
Englisch und Technische Mathematik<br />
Pflicht. <strong>Die</strong> Schülerinnen und Schüler erhalten<br />
nach erfolgreicher theoretischer<br />
und praktischer Prüfung die Ausbildereignung<br />
nach der Ausbilder-Eignungsverordnung<br />
zuerkannt, welche zur Ausbildung<br />
von Auszubildenden in den Berufen<br />
der Landwirtschaft berechtigt.<br />
Besonders ist die Schule <strong>für</strong> zukünftige<br />
Jungunternehmer interessant, aber auch<br />
<strong>für</strong> solche Absolventen, die sich <strong>für</strong> eine<br />
Schwerpunkt – Aufgaben der Landwirtschaftsämter<br />
<strong>Die</strong> <strong>Albert</strong>-<strong>Reis</strong>-<strong>Technikerschule</strong> <strong>Sigmaringen</strong><br />
<strong>sorgt</strong> <strong>für</strong> <strong>qualifizierte</strong> Junglandwirte<br />
und Jungunternehmer<br />
Von Gerhard Gommeringer, <strong>Sigmaringen</strong><br />
Wenn im Folgenden von der <strong>Albert</strong>-<strong>Reis</strong>-<strong>Technikerschule</strong> <strong>Sigmaringen</strong> oder – noch<br />
kürzer – von der <strong>Technikerschule</strong> die Rede ist, handelt es sich nach der Verordnung<br />
des Ministeriums <strong>für</strong> Er nährung und Ländlichen Raum über die Ausbildung und<br />
Prüfung an ein- und zweijährigen landwirtschaftlichen Fachschulen (Landwirtschaftsfachschulen-Verordnung)<br />
vom 3. Januar 2005 (GBl. 2005, 107) um eine Fachschule<br />
<strong>für</strong> Technik, Fachrichtung Landwirtschaft. Nach einer kurzen Vorstellung des<br />
„technischen“ Rahmens der Schule wird auf die Besonderheit des fachpraktischen<br />
Unterrichts eingegangen.<br />
Tätigkeit im vor- und nachgelagerten<br />
Bereich der Landwirtschaft qualifizieren<br />
wollen. <strong>Die</strong> Schule vermittelt, aufbauend<br />
auf einer abgeschlossenen landwirtschaftlichen<br />
Berufsausbildung und<br />
mindestens einem Jahr Berufspraxis,<br />
die unternehmerischen Kenntnisse zur<br />
erfolgreichen Führung eines landwirtschaftlichen<br />
Unternehmens. Zentrales<br />
Unterrichtsfach ist die Unternehmensführung.<br />
Sie wird ergänzt durch die<br />
Betriebswirtschaftslehre, die Betriebliche<br />
Kommunikation, die Tierische und<br />
Pflanzliche Produktion sowie weitere<br />
Vertiefungsfächer wie Agrartechnik und<br />
Bauwesen, Agrarpolitik und Marktlehre,<br />
Agrarinformatik und Marketing. Im zweiten<br />
Schuljahr stehen zwei Wochen <strong>für</strong><br />
ein außerlandwirtschaftliches Praktikum<br />
in gewerblichen Betrieben der Wirtschaft<br />
oder <strong>Die</strong>nstleistungsunternehmen<br />
zur Verfügung.<br />
<strong>Die</strong> Lehrerinnen und Lehrer sind Mit -<br />
arbeiter des Landratsamts <strong>Sigmaringen</strong>,<br />
Fachbereich Landwirtschaft. Sie verfügen<br />
über die Lehrbefähigung <strong>für</strong> das<br />
Lehramt an landwirtschaftlichen Fachschulen.<br />
Der Lehrkörper wird durch externe<br />
Spezialisten und Praktiker ergänzt.<br />
Oberste Schulbehörde ist das Minis -<br />
terium <strong>für</strong> Ländlichen Raum und Verbraucherschutz<br />
(MLR), Schulträger ist<br />
das Landratsamt <strong>Sigmaringen</strong>.<br />
Theorie und Praxis<br />
wirken zusammen<br />
Theoretisches Wissen wird konsequent<br />
an der Praxis ausgerichtet. Dem Prinzip<br />
der vollständigen Handlung folgend,<br />
wird der Lernerfolg durch eigenstän -<br />
diges Arbeiten vor allem im Projekt -<br />
unterricht gefördert. Kenntnisse und<br />
Fertigkeiten werden durch selbständiges<br />
Erarbeiten und Durchführen von prak -<br />
tischen Arbeitsaufgaben gefestigt,<br />
Schlüsselqualifikationen erworben. <strong>Die</strong><br />
fächerübergreifende Verbindung von<br />
Theorie und Praxis wird an folgenden<br />
Beispielen deutlich.<br />
Erstmalig wird in 2011 eine Lehrfahrt in<br />
den englischsprachigen Raum durch -<br />
geführt. <strong>Die</strong> landwirtschaftliche Fachexkursion<br />
nach Irland bietet den Schülern<br />
die einmalige Gelegenheit das fachbe -<br />
zogene Englisch anzuwenden. <strong>Die</strong> Kommunikation<br />
in englischer Sprache wird<br />
bei der Besichtigung landwirtschaftlicher<br />
Betriebe und Einrichtungen intensiv<br />
geübt. <strong>Die</strong> Erfahrung eines Stücks euro -<br />
päischer Kultur wirkt allgemeinbildend.<br />
Wer wird Weizenkönig?<br />
Im Wettbewerb „Weizenkönig“ setzen<br />
die Technikerschüler theoretische ackerbauliche<br />
Kenntnisse in die Praxis um. Auf<br />
dem Zentralen Versuchsfeld Oberland,<br />
das vom Landratsamt <strong>Sigmaringen</strong> betreut<br />
wird, werden <strong>für</strong> den Wettbewerb<br />
mehrere Parzellen <strong>für</strong> den versuchsweisen<br />
Anbau von Winterweizen zur Verfügung<br />
gestellt. Aufgeteilt in vier Gruppen<br />
legen die Schüler ihre Anbaustrategie<br />
und die produktionstechnischen Entscheidungen<br />
<strong>für</strong> Winterweizen fest. Sieger<br />
des Wettbewerbs ist, wer den höchs -<br />
111
Landkreisnachrichten 50. Jahrgang<br />
ten Gewinn erzielt. Auf dem Versuchsfeldtag<br />
im Juli stellen die Schüler den<br />
Besuchern ihre Winterweizenversuche<br />
vor. <strong>Die</strong> unternehmerische Tätigkeit<br />
endet nicht nach der Ernte des Getreides.<br />
Ihre kaufmännischen Talente können die<br />
Schüler im Planspiel Warenterminbörse<br />
beim virtuellen Verkauf des Weizens<br />
unter Beweis stellen. Dabei ist es Ziel,<br />
einen möglichst hohen Verkaufserlös<br />
nach Abzug der Lager- und Transport -<br />
kosten zu erreichen.<br />
Marketing ist Wettbewerb<br />
Im zweiten Schuljahr werden den<br />
Schülern Grundlagen, Strategien und<br />
Instrumente des Marketings vermittelt.<br />
<strong>Die</strong> Ausrichtung der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe am Markt und am Kunden<br />
setzt ein immer größer werdendes Maß<br />
an Flexibilität und Kreativität des Unternehmers<br />
voraus. Deshalb können die<br />
Technikerschüler in diesem Fach theoretische<br />
Inhalte gepaart mit eigener Phantasie<br />
im Projektunterricht erfahren.<br />
So ist Ziel des Marketing-Wettbewerbs,<br />
neue Ideen zu entwickeln, diese auf ihre<br />
Machbarkeit zu prüfen und auf gelernte<br />
Unterrichtsinhalte anzuwenden. Im Projektunterricht<br />
erstellen die Schüler ein<br />
Marketingkonzept <strong>für</strong> eine selbstgewählte<br />
Geschäftsidee zur Erschließung<br />
neuer Einkommensmöglichkeiten in der<br />
Landwirtschaft. An zwei Schultagen werden<br />
in Gruppen Einkommensalterna -<br />
tiven zur klassischen Landwirtschaft entwickelt<br />
und kalkuliert. Zum Beispiel<br />
wurden folgende originelle Konzepte erarbeitet:<br />
ein Silo-Komplettservice <strong>für</strong><br />
Landwirte, die Herstellung und Vermarktung<br />
von Heimtierfutter, ein Frühstückslieferservice<br />
und ein Offroad-Parcours als<br />
Freizeitbeschäftigung.<br />
Der Weg von der Idee zu einem tragfähigen<br />
Geschäftskonzept setzt Kenntnisse<br />
in Marketing, Unternehmensführung<br />
und Produktionstechnik voraus. Außerdem<br />
sind Erfahrungen in Informatik und<br />
Rhetorik gefordert, um die Ergebnisse<br />
überzeugend zu präsentieren. Den Höhe-<br />
112<br />
Technikerschüler beurteilen einen Grünlandbestand und dokumentieren das Ergebnis als Grundlage<br />
<strong>für</strong> eine gezielte Grünlandverbesserung.<br />
punkt des Wettstreits zwischen den<br />
Schülergruppen bildet die Vorstellung<br />
der Projekte vor einer fachkundigen<br />
Kommission, bestehend aus Praktikern<br />
und Vertretern von Banken. Bei der Bewertung<br />
zählen nicht nur das Fachwissen<br />
und die Schlüssigkeit des Konzepts,<br />
sondern auch die Originalität und der<br />
Einsatz unterschiedlicher Präsentationstechniken.<br />
Als Lohn <strong>für</strong> die Mühen winken<br />
den kreativen Schülern attraktive<br />
Preise.<br />
Schülerunternehmen in<br />
der Unternehmerschule<br />
Über die Direktvermarktung regional<br />
erzeugter landwirtschaftlicher Produkte,<br />
wie zum Beispiel den Verkauf von Weihnachtsbäumen,<br />
erleben sich die Tech -<br />
nikerschüler als eigenständige Unternehmer.<br />
Bei diesen Schülerunternehmen<br />
steht die praktische Umsetzung eines<br />
selbst gestalteten Marketingkonzeptes<br />
im Vordergrund. <strong>Die</strong> Produktbeschaffung,<br />
Preisfindung, die Logistik, die Werbung<br />
und der Verkauf werden gemeinschaftlich<br />
organisiert und durchgeführt.<br />
<strong>Die</strong> Schüler können sich so in ungewohn-<br />
ten Rollen wahrnehmen und neue Erfahrungen<br />
sammeln.<br />
Der landwirtschaftliche Betrieb<br />
als Klassenzimmer<br />
Das Klassenzimmer wird teilweise auf<br />
den elterlichen Betrieb der Technikerschüler<br />
verlegt. Dort wird Theorie in Praxis<br />
umgesetzt. <strong>Die</strong> künftigen Hofnachfolger<br />
stellen ihren Betrieb vor. In drei<br />
Gruppen bearbeiten die Schüler schwerpunktmäßig<br />
Themen des Pflanzenbaus,<br />
der Tierhaltung und der Unternehmensführung.<br />
Spezielle Betriebszweige erhalten<br />
besonderes Augenmerk.<br />
<strong>Die</strong> Schüler beurteilen Pflanzen- und<br />
Grünlandbestände, um sachgerechte<br />
Entscheidungen zur Bestandesführung<br />
mittels produktionstechnischer Maßnahmen<br />
treffen zu können. Futtermittel<br />
werden auf Qualität und Nährstoffe beurteilt<br />
und in einen Zusammenhang mit<br />
der Körperkondition der Nutztiere gebracht.<br />
Auch im Stall wird ein BMI (Body<br />
Mass Index) errechnet, bei Nutztieren<br />
heißt er Body Condition Score (BCS). Verbesserungsvorschläge<br />
zur Fütterung und
Haltung werden erarbeitet und begründet.<br />
<strong>Die</strong> Arbeitsgruppe Unternehmensfüh -<br />
rung schätzt den Gewinn des Betriebes<br />
über Faustzahlen und visuelle Eindrücke.<br />
Alter und Zustand der Gebäude und<br />
Maschinen spielen hierbei eine Rolle.<br />
<strong>Die</strong> realistische Gewinnschätzung der<br />
Schüler erstaunte schon so manchen<br />
Betriebsleiter. Anschließend findet ein<br />
fachübergreifender Austausch der Ergebnisse<br />
statt. <strong>Die</strong> mögliche Weiterentwicklung<br />
des Betriebs wird diskutiert.<br />
<strong>Die</strong> Schüler nehmen bereits hierbei Anre-<br />
Schwerpunkt – Aufgaben der Landwirtschaftsämter<br />
gungen <strong>für</strong> die spätere Technikerarbeit<br />
auf.<br />
<strong>Die</strong> Technikerarbeit<br />
<strong>Die</strong> Anfertigung der schriftlichen Abschlussarbeit<br />
ist ein Schwerpunkt des<br />
letzten Schulhalbjahres. <strong>Die</strong> Technikerarbeit<br />
bietet den Schülern die Gelegenheit,<br />
das elterliche Unternehmen intensiv zu<br />
durchleuchten und Alternativen der betrieblichen<br />
Weiterentwicklung aufzuzeigen.<br />
Nach der umfassenden Analyse des<br />
aktuellen Ist-Betriebes erfolgt dessen be-<br />
triebswirtschaftliche Optimierung. Da -<br />
rüber hinaus werden mögliche Varianten<br />
von Ziel-Betrieben kalkuliert, verglichen<br />
und beurteilt. <strong>Die</strong> zusammenfassende<br />
Beschreibung der Überlegungen endet<br />
teilweise in Werken mit weit über 100<br />
Seiten. <strong>Die</strong> Technikerarbeit diente bereits<br />
manchem Schüler als Masterplan <strong>für</strong> die<br />
spätere Betriebsübernahme.<br />
Gerhard Gommeringer ist Leiter des<br />
Landwirtschaftsamts beim Landratsamt<br />
<strong>Sigmaringen</strong><br />
113