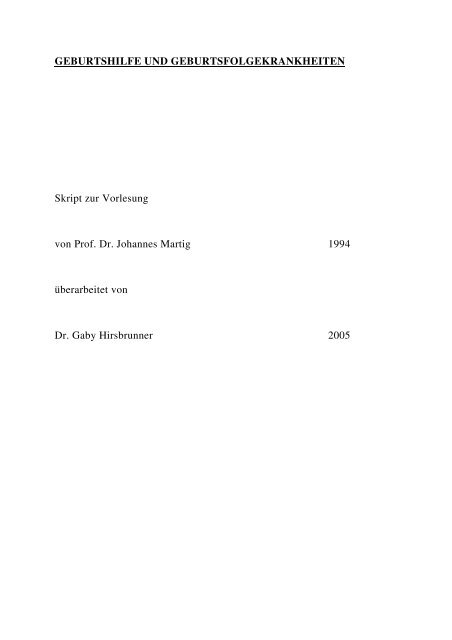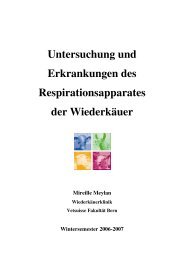GEBURTSHILFE UND GEBURTSFOLGEKRANKHEITEN Skript zur ...
GEBURTSHILFE UND GEBURTSFOLGEKRANKHEITEN Skript zur ...
GEBURTSHILFE UND GEBURTSFOLGEKRANKHEITEN Skript zur ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>GEBURTSHILFE</strong> <strong>UND</strong> <strong>GEBURTSFOLGEKRANKHEITEN</strong><br />
<strong>Skript</strong> <strong>zur</strong> Vorlesung<br />
von Prof. Dr. Johannes Martig 1994<br />
überarbeitet von<br />
Dr. Gaby Hirsbrunner 2005
INHALTSVERZEICHNIS<br />
<strong>GEBURTSHILFE</strong><br />
DIE NORMALE GEBURT 4<br />
Ursachen des Geburtseintritts 4<br />
Geburtswege 5<br />
Leitung der Normalgeburt 7<br />
DIE PATHOLOGISCHE GEBURT 8<br />
Geburtshilfliche Untersuchung 8<br />
Beurteilung und Behandlung der wichtigsten Geburtshindernisse 12<br />
Die Foetotomie 26<br />
Sectio caesarea 34<br />
BETREUUNG DES NEUGEBORENEN UNMITTELBAR NACH DER GEBURT 36<br />
<strong>GEBURTSFOLGEKRANKHEITEN</strong> 39<br />
DAS NORMALE PUERPERIUM 39<br />
DIE ERKRANKUNGEN IM PUERPERIUM 42<br />
Mechanische Beschädigung der weichen Geburtswege 42<br />
Beschädigung des Beckengürtels 47<br />
Beschädigung innerer Organe bei der Geburt 49<br />
Presswehen post partum 50<br />
Inversio et prolapsus uteri 50<br />
Verlagerungen der Harnblase 53<br />
Atonia uteri post partum 54<br />
Retentio placentae 55<br />
Puerperale bakterielle Erkrankungen 59<br />
2
Vorbemerkungen<br />
In diesem <strong>Skript</strong> werden konsequent weibliche Personenbezeichnungen wie "Tierärztin",<br />
"Melkerin" benützt; es sind damit sowohl weibliche wie männliche Personen, die diese<br />
Funktion ausüben, gemeint.<br />
In der Vorlesung werden die Verhältnisse beschrieben, wie sie sich der Tierärztin bei<br />
Ruminanten präsentieren. Das Gesagte ist sinngemäss auf andere Haustierspezies<br />
anwendbar; nur teilweise kommen die besonderen Probleme beim Schwein und Pferd<br />
<strong>zur</strong> Sprache. Im übrigen wird auf die einzelnen Spezialvorlesungen verwiesen.<br />
3
<strong>GEBURTSHILFE</strong> (OBSTETRIK)<br />
DIE NORMALE GEBURT<br />
Die Geburt ist ein normaler, zum physiologischen Reproduktionsgeschehen gehörender<br />
Vorgang, der aber sowohl für das Muttertier wie für den Neonaten einen Stress<br />
bedeutet. Diese Tatsache sollte man bei der Geburtshilfe nie aus den Augen verlieren,<br />
d.h. es sind alle Vorkehrungen zu treffen (oder zu unterlassen), damit der Stress<br />
möglichst gering bleibt.<br />
Ursachen des Geburtseintritts<br />
Noch nicht alle Zusammenhänge sind bekannt. Es bestehen beträchtliche tierartliche<br />
Unterschiede.<br />
Östrogen: während der Trächtigkeit verantwortlich für das Wachstum der<br />
Muskelzellen der Gebärmutter <strong>zur</strong> Anpassung an die zunehmende Grösse des<br />
Foeten. Während der Geburt ist das Östrogen für die Kontraktionsfähigkeit des<br />
Myometriums verantwortlich (vermehrte Ansprechbarkeit auf Oxytocin).<br />
Progesteron: hemmt die Kontraktionsfähigkeit der Muskelzellen. Bildungsort beim<br />
Rind Rind: Corpus luteum graviditatis bis Trächtigkeitstag 180, dann bis<br />
Trächtigkeitstag 250 Foetoplazentäre Einheit, danach wieder Corpus luteum<br />
graviditatis. Ziege, Schwein: Corpus luteum graviditatis. Schaf: ca. ab Tag 60 die<br />
Plazenta.<br />
Anstieg des Östrogengehalts in den letzten Tagen bis Wochen vor der Geburt,<br />
Steigerung der Kontraktionsfähigkeit des Myometriums. Abfall des<br />
Progesterongehalts ein bis drei Tage ante partum. Wegfall der<br />
kontraktionshemmenden Wirkung auf die Myometriumzelle.<br />
Beginnende Hormonproduktion der Nebennierenrinde des Foeten löst die Geburt aus:<br />
Foetale Kortikoide bewirken die Produktion von Prostaglandin (PGF2α): Luteolyse des<br />
Corpus luteum graviditatis (Rind, Ziege). Beim Schaf starker Anstieg der Östrogene,<br />
welche die Progesteronwirkung neutralisieren. Zunehmende Dehnung der Muskelzellen<br />
der Gebärmutter wegen des Grössenwachstums des Foeten gegen Ende der Trächtigkeit.<br />
Nach Überschreiten der Dehnungsfähigkeit kommt es durch intrazelluläre<br />
Prostaglandinbildung zu spontanen Kontraktionen (Vorwehen), welche nach Wegfall<br />
der Progesteronwirkung in eigentliche Wehen übergehen.<br />
Verstärkung der Wehen durch Oxytocinwirkung. Oxytocin wird im Hypothalamus<br />
gebildet und im Hypophysen-Hinterlappen gespeichert. Oxytocin wirkt nur auf das<br />
sensibilisierte Myometrium.<br />
Künstliche Geburtsauslösung<br />
Um den Geburtstermin kann beim Wiederkäuer die Geburt mit hohen Dosen von<br />
Dexamethason (20 mg) oder mit Prostaglandin (PGF2α) oder einer Kombination beider<br />
Wirkstoffe ausgelöst werden.<br />
Indikationen:<br />
- Verhinderung von Schwergeburten bei befürchteten absolut oder relativ zu<br />
grossen Foeten; nach Überschreiten der normalen Trächtigkeitsdauer<br />
- Abbruch einer pathologischen Trächtigkeit<br />
- schwere Erkrankung eines hochträchtigen Muttertieres<br />
4
- biotechnische Indikationen (Synchronisation, Terminierung)<br />
Geburtseintritt: 1-3 Tage nach Injektion<br />
Risiken:<br />
- Geburt unreifer Foeten (vor Auslösen der Geburt Belegdaten überprüfen!)<br />
- gehäufte Fälle von Retentio placentae<br />
Künstliche Auslösung von Aborten: s. Vorlesung Fortpflanzungsstörungen.<br />
Geburtswege<br />
Weiche Geburtswege: Uterus, Zervix, Vagina, Vulva. Bedeutung und Beurteilung: vgl.<br />
geburtshilfliche Untersuchung.<br />
Harte Geburtswege: im Vergleich zu andern Haustieren stellt das Becken beim Rind<br />
häufiger ein Geburtshindernis dar.<br />
Beckenmasse:<br />
- Conjugata vera: mediane Verbindungslinie vom Promontorium des Kreuzbeins<br />
zum kranialen Ende der Beckenfuge<br />
- Pecten-Vertikale (Diameter verticalis): Senkrechte, vom kranialen Ende der<br />
Beckenfuge <strong>zur</strong> Ventralfläche der Wirbelsäule. Für Geburtshilfe sehr wichtig, da<br />
bestimmend für die Erweiterungsfähigkeit des Beckens nach oben. Durch<br />
Lockerung der Verbindung im Ileosakralgelenk (Östrogenwirkung) und Zug an<br />
Schambein durch Kontrakton der Rektusmuskulatur während der Presswehen kann<br />
die Pectenvertikale unter der Geburt vergrössert werden.<br />
- Querdurchmesser des Beckeneingangs:<br />
dorsaler Q.: zwischem lateralem Ende der Kreuzbeinflügel<br />
mittlerer Q.: zwischen Tubercula psoatica<br />
ventraler Q.: zwischen Eminentiae pectineae<br />
Im Gegensatz zu den beiden andern kann der mittlere Querdurchmesser ein<br />
obstetrisches Hindernis sein.<br />
- Querdurchmesser des Beckenausgangs: Verbindung der medialen Ende der<br />
Sitzbeinhöcker: Wirkung als Geburtshindernis möglich.<br />
Führungslinie: Verbindungslinie in der Medianebene aller Punkte, die vom<br />
Beckenboden und Kreuzbein den gleichen Abstand haben. Die Führungslinie ist doppelt<br />
geknickt, was bei der Extraktion zu berücksichtigen ist.<br />
Beim Rind ist Beckenenge ein relativ häufiges Geburtshindernis, vor allem bei<br />
Primiparen. Gründe:<br />
- längsovaler Querschnitt<br />
- Steilstellung der Darmbeinsäule und Länge des Sakrums erlauben nur eine geringe<br />
Erweiterungsfähigkeit in der Vertikalen<br />
- doppelte Knickung der Führungslinie<br />
Kleiner Wiederkäuer: Beckenform für Geburt besser geeignet als beim Rind, fast<br />
kreisförmiger Querschnitt des Beckens; Pectenvertikale kaudal am Kreuzbein.<br />
Beurteilung des Beckens anlässlich der geburtshilflichen Untersuchung. Eine<br />
Ausmessung des Beckens vor dem Belegen oder kurz vor der Geburt <strong>zur</strong> Abschätzung<br />
des Geburtsrisikos ist jedoch nicht möglich.<br />
Geburtsphasen<br />
Vorbereitungsphase, Eröffnungsphase, Austreibungsphase, Nachgeburtsphase.<br />
Zeitliche Überschneidung der einzelnen Vorgänge.<br />
Von aussen nur teilweise erkennbar.<br />
5
Vorbereitungsphase<br />
Verstärkte Durchblutung und Ödematisierung des Gewebes, bedingt durch erhöhten<br />
Östrogengehalt.<br />
Ödem: Euter, Milchspiegel, Unterbauch<br />
Vergrösserung der Schamlippen und Schamspalte<br />
Scheide wird schlaff<br />
Einsinken der Beckenbänder<br />
Auflösung des Schleimpfropfs, sichtbar durch Abgang der Schleimschnur.<br />
Erschlaffung der Gebärmutter: Foet, der zuvor mit den Gliedmassen bis in den<br />
supravaginalen Raum reichte, fällt wieder <strong>zur</strong>ück und nimmt eine leicht seitliche<br />
Stellung ein.<br />
Erweiterung der Zervix um ca. 1/3 von kranial nach kaudal. Einsetzen<br />
der Wehen (vorerst ohne Oxytocinwirkung).<br />
Änderung im Verhalten des Tieres (Nesttrieb). Bei Rind in Anbindehaltung rudimentär.<br />
Einschiessen der Milch.<br />
Eröffnungsstadium<br />
Für weiteren Verlauf der Geburt sehr wichtig. Einsetzen der Wehentätigkeit:<br />
rhythmische Uteruskontraktionen von Hornspitze zum corpus uteri verlaufend.<br />
Allmähliche Zunahme von Frequenz, Dauer und Intensität.<br />
Die den Foet enthaltenden Fruchtblasen werden gegen die erschlaffte und teilweise<br />
geöffnete Zervix gedrängt und weiten diese langsam aber sehr effizient. Im Idealfall<br />
platzen die Fruchtblasen erst, nachdem sie in der Schamspalte sichtbar werden, meistens<br />
die Allantoisblase als erste. Allantoisblase: bläulich, Inhalt harnartig.<br />
Amnionblase: gelb-gräulich, Inhalt schleimig.<br />
Bedeutung des Fruchtwassers: Erhöhung der Gleitfähigkeit des Foeten, Schutz vor der<br />
Austrocknung der Schleimhäute. Frühzeitiger Blasensprung: ungenügende Weitung der<br />
weichen Geburtswege. Austrocknung und Entzündung der Schleimhäute während des<br />
Austreibungsstadiums.<br />
Dauer des Eröffnungsstadiums: 6-16 Stunden. Symptome: Bis zum Sichtbarwerden der<br />
Fruchtblasen oder Abgang des Fruchtwassers wenig deutliche Symptome:<br />
- Unruhe, Inappetenz<br />
- häufiges Aufstehen und Abliegen, ev. Schlagen zum Bauch<br />
- Nachhintenstrecken des Schwanzes.<br />
Austreibungsstadium<br />
Beginn mit dem Ferguson-Reflex: Druck des Foeten auf die Druckrezeptoren in der Zervix<br />
führt <strong>zur</strong> Ausschüttung von Oxytocin. Platzen der Amnionblase unter Einwirkung der<br />
ersten Presswehen. Presswehen = Treibwehen: wenige Sekunden dauernde<br />
Kontraktionen der Rumpf- und Zwerchfellsmuskulatur <strong>zur</strong> Unterstützung der<br />
oxytocingesteuerten Wehen. Reflexbogen: Druckrezeptoren im Scheidengewölbe -<br />
Nervus pudendus - Rückenmark - motorische Innervation der Bauchmuskulatur.<br />
Durch den keilförmig vorangetriebenen Foeten werden die weichen Geburtswege<br />
zusätzlich erweitert. Presswehen sind schmerzhaft und anstrengend. Das Tier liegt ab<br />
und nimmt Halbseiten- oder Seitenlage mit gestreckten Gliedmassen an. Augenrollen,<br />
Maulatmung, Stöhnen, manchmal sogar Brüllen. Atmung oberflächlich und angestrengt.<br />
Wehenpausen von unterschiedlicher Dauer (ev. mehrere Minuten). Bedeutung: Erholung<br />
für Muttertier, verbesserte Durchblutung der Gebärmutter und damit der Plazenta<br />
(Gasaustausch!).<br />
Dauer des Austreibungsstadiums:<br />
6
- Kühe: 1-3 Stunden<br />
- Rinder: 5-6 Stunden<br />
- kleiner Wiederkäuer: eher kürzer als beim Rind<br />
- Pferd: 5-30 min<br />
Engpässe:<br />
- Durchtritt von Kopf mit Vordergliedmassen durch Zervix und Scheide<br />
(endgültige Weitung)<br />
- Eintritt von Brust in den Beckenraum<br />
- Durchtritt von Kopf und Vordergliedmassen durch Scheidenring und Schamspalte,<br />
vor allem bei Primiparen<br />
- Durchtritt von Brust durch Scheide und Schamöffnung<br />
- Durchtritt der Darmbeinhöcker des Kalbes durch Becken.<br />
Für den Durchtritt der Hinterpartie müssen die Kniegelenke gestreckt sein.<br />
Nachgeburtsstadium<br />
Durch die Austreibung der Frucht fällt der Pressreiz weg. Die Kontaktaufnahme mit<br />
dem Neugeborenen stimuliert die Oxytocinfreisetzung und damit die<br />
Nachgeburtswehen, die <strong>zur</strong> Kontraktion der Gebärmutter führen.<br />
Leitung der Normalgeburt<br />
In der Regel überwachen Landwirtinnen oder Melkerinnen die Geburt ihrer Kühe.<br />
Meistens werden Tierärztinnen nur beigezogen, wenn eine Störung im Geburtsablauf<br />
beobachtet oder befürchtet wird.<br />
Vorbereitungen<br />
(gelten sinngemäss auch für die tierärztlich geleitete Geburt)<br />
- Genügend Platz: Die Kuh soll auf der ihr beliebigen Seite liegen können, ohne von<br />
anderen Tieren gestört zu werden. Hinter der Kuh muss genügend Platz für<br />
Zughilfe vorhanden sein.<br />
- Betreuung des Neugeborenen!<br />
- bei Kurzläger: Abdecken des Gitterrostes<br />
- saubere, trockene Einstreu<br />
- warmes Wasser, Seife, mildes Desinfektionsmittel <strong>zur</strong> Reinigung und<br />
Desinfektion der Vulva und Umgebung und zum Waschen von Armen und<br />
Händen der Geburtshelferin vor, während und nach der Geburtshilfe<br />
- saubere (am besten neue) Stricke und starke Rundhölzer, ca. 30 cm lang, oder<br />
spezielle Geburtshilfeketten mit Handgriffen, eingelegt in Desinfektionslösung für<br />
den Fall, dass Zughilfe geleistet werden muss.<br />
- Gleitmittel (falls nichts anderes vorhanden ist, geht auch Salatöl oder Melkfett)<br />
- kaltes Wasser zum Aufwecken des Kalbes; trockenes Stroh zum Abreiben des<br />
Kalbes<br />
Grundprinzipien bei jeder Geburt<br />
Sauberkeit: Geburtshelferin, Kuh, Umgebung<br />
Vermeidung von Verletzungen:<br />
- keine Manipulationen während der Wehen<br />
- generell vorsichtige Untersuchungen und Korrekturen<br />
- kurze Fingernägel; Ringe, Uhren usw. ausziehen<br />
- Verwendung von Gleitmittel<br />
7
Überlegtes Handeln: Kenntnis der Normalverhältnisse, Beizug einer Tierärztin bei<br />
unklaren Befunden, bei der Feststellung eines nicht einfach zu reponierenden<br />
Geburtshindernisses, bei engen Platzverhältnissen.<br />
Wichtig ist die gute Beobachtung der unter der Geburt stehenden Tiere: Überwachung<br />
der Vorbereitungsphase und Abschätzen des vermutlichen Geburtstermins; intensivierte<br />
Überwachung auch während der Nacht bei unmittelbar bevorstehender Geburt, um den<br />
Zeitpunkt des Fruchtwasserabgangs nicht zu verpassen.<br />
Wenn Gliedmassenspitzen und Kopf nicht kurz nach dem Abgang der<br />
Amnionflüssigkeit in der Schamspalte sichtbar werden: innere geburtshilfliche<br />
Untersuchung unter Einhaltung der oben erwähnten Prinzipien <strong>zur</strong> Feststellung, ob<br />
normale Verhältnisse vorliegen.<br />
Bei normalem Fortschreiten der Austreibungsphase (Fortschritt von 1-2 cm pro<br />
Wehenschub) soll keine Zughilfe geleistet werden. Dies gilt insbesondere für<br />
Primipare, bei denen die weichen Geburtswege erst in der Austreibungsphase durch<br />
den Foeten endgültig geweitet werden.<br />
Bei verschleppter Geburt, aber normaler Lage, Stellung und Haltung des Foeten kann<br />
durch leichte Zughilfe an den Gliedmassen die Austreibungsphase verkürzt werden,<br />
sofern die Geburt von selbst soweit gediehen ist, dass die Gliedmassen bis zu den<br />
Fesselköpfen aus der Scheide herausragen. Genaueres <strong>zur</strong> Zughilfe: s. unten.<br />
Es ist darauf zu achten, dass das Kalb in eine möglichst trockene und saubere<br />
Umgebung geboren wird. Trockenreiben des Kalbes und Verbringen an seinen<br />
Standplatz. In der Abkalbeboxe kann man das Kalb bei der Kuh belassen, die es in der<br />
Regel intensiv ableckt. Bei Anbindehaltung besteht Verletzungsgefahr für das Kalb<br />
durch Nebentiere oder das in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkte Muttertier. Wenn<br />
man das Kalb für kurze Zeit nach der Geburt bei der Kuh belässt, ist in der Regel die<br />
Beunruhigung des Muttertieres nach Entfernen des Kalbes grösser, als wenn die Kuh nie<br />
Kontakt hatte mit ihrem Kalb.<br />
Gute Überwachung der Kuh unmittelbar nach der Geburt:<br />
- Allgemeinzustand<br />
- Stehvermögen<br />
- Intensität der Nachwehen (Gefahr von Prolapsus uteri)<br />
- Ausscheidung von frischem oder koaguliertem Blut aus Scheide?<br />
- Abgang der Nachgeburt<br />
DIE PATHOLOGISCHE GEBURT<br />
Tierärztliche Geburtshilfe<br />
Überlegenheit der Tierärztin durch<br />
- genaue Untersuchung, Diagnose, Prognose und Therapie<br />
- manuelle und operative Fähigkeiten<br />
- Möglichkeit, Medikamente einzusetzen<br />
- Erfahrung, da sie viel häufiger mit abnormen Geburten konfrontiert wird als der<br />
Laie<br />
Geburtshilfliche Untersuchung<br />
Die genaue und umfassende Untersuchung ist der Schlüssel zum Erfolg bei der<br />
Geburtshilfe.<br />
8
Anamnese<br />
Alter, Anzahl der Trächtigkeiten, Trächtigkeitsdauer und Verlauf der Trächtigkeit;<br />
Störungen bei früheren Geburten; Verlauf des Vorbereitungs- und Eröffnungsstadiums;<br />
Zeitpunkt des Abgangs von Fruchtwasser, Beschaffenheit der Fruchtwässer; abnormes<br />
Verhalten des Muttertieres?<br />
Vorausgegangene Untersuchungen und Hilfeleistungen anderer Personen (könnten<br />
dadurch bedingt bereits Verletzungen bestehen?)<br />
Kurze Beurteilung des Allgemeinzustandes.<br />
Körperhaltung, Verhalten, Nährzustand.<br />
Körperbau und -entwicklung, besonders von Becken und Euter. Erhebung der Trias, nur<br />
wenn aufgrund der kurzen Allgemeinuntersuchung eine massive Abweichung von der<br />
Norm vermutet wird, z.B. ein Schockzustand, eine fieberhafte Erkrankung oder eine<br />
Hypokalzämie.<br />
Äussere geburtshilfliche Untersuchung<br />
- Leibesumfang: Kann Hinweis geben auf Mehrlingsträchtigkeit, Eihautwassersucht.<br />
Wehentätigkeit<br />
- Ödematisierung von Vulva, Milchspiegel, Euter, Beckenbändern<br />
- Grösse und Verlauf der Schamspalte<br />
- heraushängendes Gewebe oder Abgang von Sekret aus der Schamspalte (Fruchtwasser<br />
und Eihäute: Farbe, Geruch, Beschaffenheit); Blut, Eiter oder nekrotisches Material<br />
(verschleppte Geburten, Frühgeburten, Aborte); Fett oder Bindegewebe, Kot,<br />
Eingeweide, Harnblase (Scheidenverletzungen, Missbildungen von Foeten)<br />
Innere geburtshilfliche Untersuchung<br />
Wenn immer möglich am stehenden Tier: Prüfung der Stehfähigkeit, bessere Übersicht<br />
(normaler Situs), geringere Wehentätigkeit.<br />
Bei festliegenden Tieren: wenn möglich linke Seitenlage mit Beckenhochlagerung.<br />
Kleiner Wiederkäuer: wenn möglich ebenfalls am stehenden Tier. Wenn das Tier<br />
während der Untersuchung immer wieder abliegt: seitliche Lagerung auf Strohballe<br />
oder Schragen. Beim Schaf kann man in der Regel Zervix und Becken mit der Hand<br />
knapp passieren, bei der Ziege nicht immer. Manipulationen bei Schaf und Ziege sehr<br />
vorsichtig durchführen. Cave: Schaf und Ziege sind auch punkto Geburtshilfe nicht<br />
„kleine Rinder“.<br />
Die Geburtshelferin soll saubere Berufskleider tragen, die sie auch vor Durchnässung<br />
(schwallweiser Abgang von Fruchtwasser) schützen. Reinigung und Desinfektion von<br />
Vulva und Umgebung des unter der Geburt stehenden Tieres.<br />
Reinigung der Hände und Arme der Geburtshelferin. Kurze Fingernägel, keine Ringe,<br />
Uhr etc., Einsatz von Gleitmittel.<br />
Da Kühe während geburtshilflicher Untersuchungen und Manipulationen häufig Kot<br />
absetzen, muss die Waschprozedur mehrmals wiederholt werden.<br />
Man beurteilt:<br />
am Muttertier:<br />
- Beschaffenheit der Schleimhaut<br />
- Weite der weichen Geburtswege<br />
- Symmetrie und Weite des Beckens<br />
- Fruchthüllen<br />
am Foeten:<br />
- Lage, Stellung, Haltung<br />
- Anzahl der Foeten<br />
9
- Grösse des Foeten<br />
- Vitalität des Foeten<br />
- Missbildungen<br />
Schleimhaut<br />
Normal: glatt, glitschig, erschlafft ohne Querschnittverengung<br />
Abnorm: rauh, trocken, vermehrt warm, verschwollen; oberfächliche, tiefe oder<br />
perforierende Verletzungen mit Hervorquellen von Gewebe oder Austritt von Blut;<br />
Längs- oder Querfaltenbildung (Torsio uteri)<br />
Weite der weichen Geburtswege<br />
Normal: gleichmässiger, gestreckter Kanal mit verstrichener Zervix<br />
Abnorm: Verengungen in Schamspalte oder Hymenalring nach gestörtem Vorbereitungs-<br />
und/oder Eröffnungsstadium, aber auch bei verfetteten Tieren; besonders häufig bei<br />
Primiparen. Scheidenverengungen infolge Narbenstrikturen nach Schwergeburt bei der<br />
letzten Kalbung oder Prolapsus vaginae. Scheidenspangen, Scheidenzysten, Zervixenge<br />
verschiedenen Grades nach<br />
- gestörter Vorbereitungs- und/oder Eröffnungsphase<br />
- bei verschleppter / übergangener Geburt (teilweise Kontraktion nach vormals<br />
vollständiger Eröffnung)<br />
- infolge Narbenstriktur nach Verletzung bei der vorangegangenen Geburt<br />
Harte Geburtswege<br />
Beurteilung von Form und Grösse des Beckens anhand der genannten Parameter.<br />
Abnorm: Asymmetrien und Kallusbildungen nach Beckenfrakturen; stark hervortretende<br />
Knochenteile: Pecten ossis pubis, Promontorium<br />
Fruchthüllen<br />
Blasensprung erfolgt? Beschaffenheit der Placenta. Menge, Farbe und Geruch des<br />
Fruchtwassers; Beimengung von Haaren, Kot, Blut oder Eiter?<br />
Lage, Stellung und Haltung des Foeten<br />
Lage: Verhältnis der Längsachse des Foeten <strong>zur</strong> Längsachse des Muttertieres. Normal:<br />
Längslage als Vorderendlage (VEL) oder Hinterendlage (HEL). Pathologisch:<br />
Querlagen, Senkrechtlagen<br />
Stellung: Verhältnis vom Rücken des Foeten zum Rücken des Muttertieres. Normal:<br />
obere Stellung: Rücken des Foeten dem Rücken des Muttertieres zugewandt.<br />
Pathologisch: untere Stellung und seitliche Stellungen (z.B.: seitliche Stellung nach<br />
rechts: der Rücken des Kalbes ist der rechten Bauchwand des Muttertieres zugewandt)<br />
Haltung: Verhältnis der beweglichen Teile des Kalbes zu seinem Rumpf. Normal: bei<br />
Vorderendlage Hals und Vordergliedmassen gestreckt. Bei Hinterendlage:<br />
Hintergliedmassen gestreckt. Abnorm: Beugehaltungen von Hals und Gliedmassen aller<br />
Art (s. unten)<br />
Für das Erkennen von Lage, Stellung und Haltung des Foeten muss man in der Lage<br />
sein, seine einzelnen Körperteile eindeutig zu identifizieren. Gliedmassen: Abtasten der<br />
Gliedmassen von den Klauen über das Fesselgelenk zum nächsten Gelenk. Nur anhand<br />
von Carpus bzw. Tarsus lassen sich Vorder- und Hintergliedmassen eindeutig<br />
voneinander unterscheiden. Das schrittweise Vorgehen von distal nach proximal ist<br />
wichtig, damit man nicht etwa das Ellbogengelenk mit einem Sprunggelenk<br />
verwechselt.<br />
Kopf: viele leicht erkennbare Strukturen: Mandibula, Incisivi, ev. Zünglein,<br />
Flotzmaul mit Nasenlöchern, Augenbogen, Augen, ev. Ohren. Becken: erkennbar<br />
10
anhand von Sitzbein- ev. Darmbeinhöckern, Schwanz und Anus. Brustkorb: Rippen,<br />
Dorsalfortsätze und Sternum sind im allgemeinen als solche zu erkennen.<br />
Anzahl der Foeten<br />
Verdacht auf Mehrlingsträchtigkeit:<br />
- bei kleinen Foeten nach normaler Trächtigkeitsdauer<br />
- bei gleichzeitigem Vorfinden von Hintergliedmassen und Vordergliedmassen<br />
und / oder Kopf<br />
- bei Vorfinden von drei oder mehr gleichen Gliedmassen oder zwei Köpfen<br />
Differentialdiagnosen: Missbildungen oder Lageanomalien. Durch genaue<br />
Untersuchung versucht man, die einzelnen Körperteile einander zuzuordnen; Abklären,<br />
ob sich einzelne Foeten aneinander vorbeischieben lassen.<br />
Grösse des Foeten<br />
Beurteilung anhand des Umfangs von Röhrenknochen und Schädel sowie von<br />
Sitzbeinhöckerabstand und Darmbeinhöckerabstand.<br />
Beurteilung der Grösse im Verhältnis <strong>zur</strong> Grösse des Beckens vom Muttertier:<br />
- wieweit ist der Kopf bzw. das Becken ohne äussere Hilfe eingetreten?<br />
- Beurteilung des Platzes zwischen Kopf und Beckeneingang<br />
- tritt bei Vorderendlage der Kopf nach Zug an den Vordergliedmassen in das<br />
Becken ein?<br />
- vorsichtiger Extraktionsversuch<br />
Die Beurteilung der Grösse des Foeten in Relation zum mütterlichen Becken stellt auch<br />
erfahrene Geburtshelferinnen immer wieder vor Probleme. Erschwerend kommt hinzu,<br />
dass man durch Abtasten der erreichbaren Körperteile nur bedingt auf die Masse des<br />
ganzen Foeten schliessen kann. Für den Verlauf der weiteren Geburt ist die richtige<br />
Beurteilung der Grösse des Foeten von entscheidender Bedeutung.<br />
Vitalität des Foeten<br />
Manchmal lässt sich nicht definitiv entscheiden, ob ein Foet <strong>zur</strong> Zeit der Untersuchung<br />
lebt oder nicht. Nur eindeutig positive Zeichen sind beweisend!<br />
Positiv: deutliche Foetale Bewegungen nach Kneifen im Zwischenklauenspalt,<br />
Nasenseptum, Zunge. Übermässig starke Abwehrbewegungen können ein Zeichen von<br />
Agonie sein. Positiver Analreflex, Pulsation der Nabelarterie. Weitere<br />
Beurteilungskriterien: Augenturgor: deutlicher Unterschied des Bulbusdruckes<br />
zwischen lebenden und toten Foeten. Bei längerem leichtem Druck auf die Bulbi lassen<br />
sich manchmal auch Abwehrbewegungen auslösen.<br />
Verdacht auf abgestorbenen Foeten: Wasserabgang mehr als 6 Stunden <strong>zur</strong>ückliegend,<br />
spontaner Haarausfall und leicht ausziehbare Haare, Verschmutzung des Fruchtwassers<br />
mit Kot, teilweise Ablösung der Placenta.<br />
Der Befund, ob der Foet noch lebt oder nicht, kann den Entscheid über das<br />
weitere Vorgehen bei der Geburtshilfe wesentlich beeinflussen.<br />
Geburtshilfliche Nachuntersuchung<br />
Unbedingt notwendig nach jeder tierärztlichen Geburtshilfe. Man<br />
achte auf:<br />
- Übermässige Blutungen<br />
- Verletzungen, Schwellungen, Asymmetrien<br />
- Vorhandensein von weiteren Foeten: bewusst beide Hörner aufsuchen, bei<br />
grossem, ins Abdomen herabhängendem Uterus die Bauchdecken mit einem Brett<br />
anheben lassen<br />
- bei unklaren Befunden: Nachkontrolle nach einigen Stunden<br />
11
Neben der vaginalen und allenfalls auch rektalen Exploration soll man sich auch über<br />
den Allgemeinzustand des Tieres ins Bild setzen.<br />
Nicht völlig erschöpfte Tiere zum Aufstehen antreiben:<br />
- Kontrolle der Stehfähigkeit<br />
- Verringerung der Gefahr eines Prolapsus uteri<br />
- saubere Nachuntersuchung mit normalem Situs der Organe<br />
Beurteilung und Behandlung allfälliger pathologischer Zustände: s.<br />
Nachgeburtserkrankungen<br />
Geburtshilfliche Diagnose<br />
Ergibt sich aus Allgemeinsymptomen und lokalen Befunden an Kuh und Kalb. Prognose<br />
für das Muttertier: Überleben, Wirtschaftlichkeit (Milchleistung der folgenden<br />
Laktation, erneute Konzeption), Fleischverwertung bei Schlachtung.<br />
Prognose für das Kalb: Überleben.<br />
Die Diagnose und die Prognose in Abhängigkeit der verschiedenen in Frage kommenden<br />
Behandlungsmöglichkeiten sollen der Besitzerin in verständlicher Weise erörtert werden. Um<br />
nachträglichen Vorhaltungen vorzubeugen, ist es wichtig, die Besitzerin in die<br />
Entscheidungsfindung über das weitere Vorgehen einzubeziehen. Es hat keinen Sinn, eine<br />
Behandlung (z.B. eine forcierte Extraktion) gegen den Willen der Besitzerin<br />
durchzuführen; umgekehrt soll sich die Tierärztin nicht zu einem Behandlungsversuch,<br />
den sie nicht verantworten kann, überreden lassen.<br />
Beurteilung und Behandlung der wichtigsten Geburtshindernisse<br />
Unterstützende Massnahmen bei der Behebung von Geburtshindernissen<br />
Unterdrückung der Presswehen mit Hilfe einer kleinen Epiduralanästhesie <strong>zur</strong><br />
Verminderung der Gefahr von Verletzungen bei Untersuchungen und Manipulationen.<br />
Nachteil: verminderte Wehentätigkeit bei der Extraktion nach Korrektur des<br />
Geburtshindernis', Gefahr des Verlusts der Stehfähigkeit.<br />
Injektion von Tokolytika <strong>zur</strong> vorübergehenden Ausschaltung der Wehen und<br />
Erschlaffung der Gebärmutter.<br />
- Isoxsuprin (Degraspasmin ® : 200 mg i.m. / i.v. Wirkungseintritt nach 15 min.<br />
Dauer: ca. 2 Stunden. Antagonist: Oxytocin. Nebenwirkungen: Blutdruckabfall,<br />
Steigerung der Herzfrequenz.<br />
- (Clenbuterol (Ventipulmin ® ) würde ebenfalls tokolytisch wirken. Die Wirkung<br />
kann aber mit Oxytocin nicht antagonisiert werden. Zudem hat Clenbuterol 28<br />
Tage Absetzfrist für Fleisch und darf bei milchliefernden Tieren nicht eingesetzt<br />
werden.)<br />
Kleine Epiduralanästhesie: zwischen 1. und 2. Schwanzwirbel 2-4 cm tief einstechen nach<br />
chirurgischer Vorbereitung der Stelle. Depot von 4-6 ml einer 1-2%igen Lidocainlösung ohne<br />
Adrenalin. Das Stehvermögen sollte erhalten bleiben, Scheide und Vorhof sind anästhesiert.<br />
Fruchtwasserersatz: Einpumpen von 5-10 oder mehr Litern einer schleimigen Flüssigkeit<br />
in die Gebärmutter mittels einer Eimerpumpe. Herstellen des Fruchtwasserersatzes<br />
durch Verdünnen von normalem dickflüssigen Gleitmittel mit sauberem lauwarmem<br />
Wasser. Wirkung: bessere Bewegungsfreiheit für Manipulationen in der Gebärmutter,<br />
insbesondere Korrektur von Lage- und Haltungsanomalien sowie bei Foetotomie. Schutz<br />
der Schleimhäute vor Austrocknung, Verbesserung der Gleitfähigkeit des Foeten.<br />
Nachteil bei Einpumpen von Fruchtwasserersatz: Kontaminationsgefahr, insbesondere<br />
wenn nachträglich ein Kaiserschnitt durchgeführt werden muss.<br />
12
1. Missverhältnis zwischen Grösse des Foeten und Weite der harten Geburtswege<br />
Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob das Haupthindernis in den harten oder weichen<br />
Geburtswegen liegt, was nicht immer einfach ist. Die Frage, ob es sich um einen relativ<br />
oder absolut zu grossen Foeten handelt, lässt sich sehr oft, zumindest anlässlich der<br />
geburtshilflichen Untersuchung, nicht eindeutig entscheiden; sie ist aber für das weitere<br />
Vorgehen <strong>zur</strong> Behebung des Geburtshindernisses auch nicht von ausschlaggebender<br />
Bedeutung, ja für dessen Behebung irrelevant.<br />
Absolut zu grosser Foet: übertragene Foeten, grobknochiges Kalb bei an sich normal<br />
gebauter Kuh (Missverhältnis: Muttertier - Vatertier)<br />
Relativ zu grosser Foet: juveniles Becken des Muttertieres (zu frühes Belegen),<br />
angeborene Beckenenge des Muttertieres, Beckenenge infolge Fraktur oder anderer<br />
Schädigung.<br />
Symptome: kein Fortschritt in der Austreibungsphase trotz normaler Wehentätigkeit,<br />
Foet im Becken eingekeilt. Bei Zug an den Gliedmassen wird der Kopf <strong>zur</strong> Seite oder<br />
nach unten abgedrängt. Grobe Gliedmassen, breiter Schädel (absolut zu grosser Foet),<br />
keine Fortschritte bei kunstgerechtem Extraktionsversuch.<br />
Differentialdiagnosen: Ellbogen-Schulterbeugehaltung, Scheidenenge, Zervixenge,<br />
Missbildungen, z.B. Doppellender, Hydrozephalus, Hydrops oder Aszites des<br />
Foeten.<br />
Behebung:<br />
Optionen bei lebendem Foeten:<br />
- verstärkter Zug<br />
- Sectio caesarea<br />
- Schlachtung des Muttertieres und Entwicklung des Kalbes zu Beginn der<br />
Schlachtung („konservativer Kaiserschnitt“) bei züchterisch wertlosem<br />
Muttertier, ungenügender Laktationsbereitschaft, schwerer Gesundheitsstörung)<br />
Optionen bei totem Foeten:<br />
- verstärkter Zug<br />
- Foetotomie<br />
- Sectio caesarea<br />
- Schlachtung des Muttertieres<br />
Prophylaxe: im Rahmen des Zuchtprogramms werden die Einflüsse der Stiere auf die<br />
Häufigkeit von Schwergeburten genau erfasst und den Züchterinnen mitgeteilt. Bei<br />
speziell gefährdeten Muttertieren (vor allem bei Primiparen) besteht die Möglichkeit,<br />
Stiere einzusetzen, welche in der Regel kleine Kälber produzieren. Zudem können<br />
Gebrauchskreuzungen mit Stieren gewisser Mastrassen (z.B. Aberdeen Angus), bei<br />
denen die Kälber generell kleiner sind als bei den Tieren der Si/RH-Rasse,<br />
vorgenommen werden.<br />
Bei Überschreiten der normalen Trächtigkeitsdauer um mehr als eine Woche soll man<br />
die medikamentelle Geburtseinleitung erwägen, selbst wenn die Muttertiere noch nicht<br />
richtig aufgeeutert haben. Voraussetzung ist allerdings, dass das Belegdatum<br />
zweifelsfrei feststeht (Nachkontrolle Besamungskarte!).<br />
Es wird etwa argumentiert, eine Geburtseinleitung sei nicht empfehlenswert, wenn die<br />
Tiere ungenügend auf die Laktation vorbereitet seien. Erfahrungsgemäss eutern die<br />
Kühe während des Vorbereitungsstadiums nach medikamenteller Geburtseinleitung gut<br />
auf; zusätzlich ist zu bedenken, dass eine Schwergeburt bei einem Tier, das gut<br />
aufgeeutert hat, die Laktation ebenfalls gefährden kann.<br />
Der verstärkte Zug (forcierte Extraktion)<br />
13
Es gibt Situationen, bei denen anlässlich der Untersuchung eindeutig klar wird, dass eine<br />
forcierte Extraktion sinnlos ist.<br />
Eine forcierte Extraktion ist dann anzustreben, wenn man die Aussichten für die<br />
Entwicklung eines lebenden Kalbes ohne Schädigung des Muttertieres als hoch<br />
einschätzt.<br />
Bei forcierter Extraktion ist in erster Linie das Kalb und in zweiter Linie das Muttertier<br />
gefährdet.<br />
Die Wünsche und Risikobereitschaft der Tierbesitzerin sind in die Entscheidung<br />
einzubeziehen, dürfen aber nicht zu tierquälerischer Belastung des Muttertieres führen.<br />
Bei Schlachtung von unter der Geburt stehenden Tieren ist die zu erwartende<br />
Verminderung der Fleischqualität (körperliche Anstrengung, Hyperöstrogenismus) zu<br />
bedenken.<br />
Ausführung des verstärkten Zugs: bestmögliche Ausnützung der Platzverhältnisse und<br />
Anwendung von dosierter Zughilfe<br />
- Befestigung von Geburtshilfestricken oder Geburtshilfeketten oberhalb des<br />
Fesselkopfs<br />
- Unterstützung der Wehenkraft durch Zug mit maximal zwei Personen während<br />
den Wehen (kein Zug während den Wehenpausen!)<br />
- Muttertier in Seitenlage <strong>zur</strong> optimalen Ausnützung der Presswehen (Steilstellung<br />
des Beckens)<br />
- Zugrichtung: bis <strong>zur</strong> Entwicklung des Kopfes, bzw. des Beckens (Hinterendlage)<br />
parallel <strong>zur</strong> Wirbelsäule; danach in Richtung Sprunggelenke der Kuh<br />
(Streckung der Kniegelenke des Kalbes in Vorderendlage)<br />
- schonende Erweiterung der weichen Geburtswege durch Massage mit der<br />
zwischen Kopf bzw. Rumpf und Scheidenschleimhaut eingekeilte flachen<br />
Hand (Gleitmittel)<br />
- in gewissen Phasen kann der einseitige Zug an einer Gliedmasse oder alternierende<br />
Zug an den Gliedmassen von Nutzen sein<br />
- bei Festklemmen des Foetalen Beckens im mütterlichen Becken kann in gewissen<br />
Situationen die Rotation des Foeten um seine Längsachse <strong>zur</strong> Überwindung des<br />
Geburtshindernisses beitragen<br />
- wenn zu Beginn der forcierten Extraktion keine Fortschritte erzielt werden, ist<br />
der Versuch abzubrechen; der Entscheid muss gefällt werden, bevor der Kopf,<br />
bzw. das Becken (bei Hinterendlage) die Schamspalte passiert hat<br />
Risiken bei der forcierten Extraktion:<br />
- Verletzungen, Quetschungen, Blutungen verschiedenen Grades der weichen<br />
Geburtswege<br />
- Luxation im Kreuzbein- Darmbeingelenk<br />
- Beckenbrüche<br />
- Gebärmuttervorfall oder Harnblasenvorfall infolge der starken Presswehen nach<br />
der Geburt<br />
- Absterben des Foeten unter der Geburt<br />
- Steckenbleiben des Foeten mit seinem Becken im Becken des Muttertieres<br />
2. Zervixenge<br />
Ursachen:<br />
- Vorbereitungsstadium noch nicht abgeschlossen<br />
- Beginn des Eröffnungsstadiums bei ungenügendem Fortschritt des<br />
Vorbereitungsstadiums: zu frühes Bersten der Fruchtblasen - ungenügende<br />
Öffnung nach Behebung einer Torsio uteri<br />
14
- Narbenstrikturen nach Verletzung in der vorangegangenen Geburt<br />
- Verschleppte / übergangene Geburt<br />
Diagnose:<br />
Abklären des Grades der Zervixenge: von "fast verstrichen" bis fingerdicker Öffnung ist<br />
alles möglich. Fruchtblasen intakt oder geborsten? Foet lebend oder tot? Wenn tot, seit<br />
wann? Zervix derb oder weich, d.h. dehnungsfähig? Differentialdiagnose: Torsio uteri<br />
(anhand der übrigen Befunde in der Regel leicht auszuschliessen).<br />
Weiteres Vorgehen: bei intakten Fruchthüllen abwarten, bei gleichzeitiger<br />
Wehenschwäche ev. Behandlung derselben je nach vermuteter Ursache<br />
(Kalziuminfusion, Oxytocininjektion).<br />
Nach Abgang der Fruchtwasser und noch lebendem Foeten, je nach Ausmass der<br />
Zervixenge:<br />
- bei geringgradiger Einengung des Zervixkanals: Kalb einziehen unter Fixation des<br />
Kopfes mit einer Genickschlinge; durch gleichzeitigen Zug an Gliedmassen und<br />
Kopf und manueller Massage versuchen, die Zervix zu erweitern; ev.<br />
Fruchtwasserersatz<br />
- bei ausgeprägter Zervixenge und nach Versagen des manuellen<br />
Erweiterungsversuchs: Sectio caesarea<br />
- bei Zervixenge und eindeutig totem Foeten kommt zusätzlich, je nach Grad der<br />
Zervixenge, auch eine Foetotomie in Frage; je nach Zustand des Muttertieres und<br />
Zersetzungsgrad des Foeten muss auch eine Schlachtung ins Auge gefasst werden,<br />
wobei zu berücksichtigen ist, dass bei emphysematösen Foeten die<br />
Fleischverwertung in Frage gestellt ist<br />
- bei fast vollständigem Verschluss der Zervix lässt sich häufig nicht entscheiden, ob<br />
die Fruchtwasser abgegangen sind und ob der Foet noch lebt; eine Sectio caesarea<br />
ist in dieser Situation riskant, weil nicht vorauszusehen ist, ob sich nach der<br />
Operation die Zervix soweit öffnet, dass die Nachgeburt abgehen kann<br />
Zervixenge ist eines der häufigsten Geburtshindernisse beim Schaf; sie trifft sehr<br />
oft in Zusammenhang mit Prolapsus vaginae ante partum auf („Ringwomb“).<br />
3. Scheidenenge und Vulvaenge<br />
Ursachen: analog der unter Zervix genannten Gründe; zusätzlich kommt eine<br />
übermässige Verfettung als Ursache in Frage.<br />
Diagnose: verstrichene Zervix, Kalb von normaler Grösse, welches in den<br />
Geburtswegen festgeklemmt ist. Differentialdiagnosen: Zervixenge, Beckenenge<br />
Behebung:<br />
bei noch stehenden Fruchtwässern: Abwarten<br />
bei Primiparen, wenige Stunden nach Wasserabgang und guter Wehentätigkeit:<br />
Abwarten<br />
Extraktion durch schonenden verstärkten Zug unter Einsatz von Fruchtwasserersatz und<br />
ständiger manueller Massage. Bei ausgeprägter Enge und lebensschwachem Foeten:<br />
Sectio caesarea. Episiotomie (Dammschnitt) wird beschrieben, wegen Infektionsgefahr<br />
jedoch sehr selten ausgeführt.<br />
4. Torsio uteri<br />
Drehung der Gebärmutter um ihre Längsachse. Nähere Umschreibung nach Drehrichtung,<br />
Grad und Lokalisation.<br />
Drehrichtung: bezogen auf die Kuh (und damit aus der Sicht der hinter der Kuh<br />
stehenden Geburtshelferin). Torsion nach links = Torsion im Gegenuhrzeigersinn.<br />
Torsion nach rechts = Torsion im Uhrzeigersinn. Grad: von 90 bis > 360° ist alles<br />
möglich.<br />
15
Lokalisation: zervikal-vaginal; präzervikal (= Bereich des corpus uteri); korkzieherartig<br />
von vaginal bis <strong>zur</strong> Hornspitze. Häufigste Form: 3/4 Drehung nach links, zervikalvaginal.<br />
Torsio uteri ist beim Rind ein relativ häufiges Geburtshindernis; beim Schaf kommt sie<br />
selten vor oder wird zumindest selten diagnostiziert.<br />
Ursachen:<br />
Artdisposition des Rindes durch:<br />
- Grösse des Uterus, der nur durch an der Curvatura minor ansetzende Ligamenta<br />
lata uteri fixiert wird<br />
- extreme Asymmetrie der Gebärmutter durch die Einhornträchtigkeit<br />
- maximale Übertragung von Foetalbewegungen auf die Gebärmutter durch die<br />
disseminierte Plazentation<br />
- Bewegungsablauf beim Aufstehen und Abliegen<br />
Begünstigend wirken ferner eine starke Erschlaffung der Bauchdecken bei alten Tieren,<br />
sowie die Einengung der Bewegungsfreiheit bei beengenden Verhältnissen im<br />
Anbindestall.<br />
Auslösender Faktor: heftige Foetale Bewegungen auf äussere Reize oder beim<br />
Einstellen <strong>zur</strong> Geburt von der vorgeburtlich seitlichen oder unteren Stellung in eine<br />
geburtsgerechte obere Stellung. Torsio uteri tritt meistens im Laufe der Vorbereitungs-<br />
oder Eröffnungsphase auf, kann aber auch schon in frühen Trächtigkeitsstadien<br />
vorkommen.<br />
Symptome<br />
Typische Anamnese: normale Geburtsvorbereitungen, die sich nicht weiter entwickeln<br />
oder sogar rückgängig gemacht werden, ev. Trippeln, leichte Kolikerscheinungen,<br />
Inappetenz.<br />
Wehen bei unvollständiger oder vollständiger Geburtsvorbereitung; kein Fortschreiten<br />
der Geburt; ev. Fehlen von Wehen, nach vorübergehend normaler Wehentätigkeit.<br />
Inappetenz, Tachykardie, ev. leichte Tympanie und Kolikerscheinungen (auch bei<br />
Auftreten solcher Symptome in der Hochträchtigkeit an Torsio uteri denken!).<br />
Fruchtwasser meist noch nicht abgegangen.<br />
Vulva manchmal verzogen.<br />
Vagina: spiralige Faltenbildung; die explorierende Hand wird in der Drehrichtung<br />
abgelenkt. Querfalte wegen Einschnürung durch Uterusbänder.<br />
Verengung des Geburtskanals je nach Grad und Hauptlokalisation der Torsion: zervikalvaginal:<br />
Verengung beginnt bereits in der Vagina; bei Drehungen bis 270° kann die<br />
Hand meist die Zervix noch passieren, bei >360° nicht mehr.<br />
Präzervikal: Vagina wenig verdreht, starke Einengung von Zervix; Foet nur knapp<br />
oder überhaupt nicht erreichbar.<br />
Befunde am Foeten (Voraussetzung: ursprünglich obere Stellung):<br />
1/4 Torsion nach links: Rücken nach links<br />
1/4 Torsion nach rechts: Rücken nach rechts<br />
1/2 Torsion nach links und nach rechts: Rücken nach unten<br />
3/4 Torsion nach links: Rücken nach rechts<br />
3/4 Torsion nach rechts: Rücken nach links<br />
vollständige Torsion nach links oder rechts: Rücken nach oben<br />
Mit zunehmendem Drehungsgrad nimmt die Einengung des Geburtskanals zu.<br />
Rektalbefund: ligamenta lata uteri folgen der Drehung und werden angespannt, laufen<br />
einseitig über den Uterus. Mit zunehmender Torsion werden die Bänder ödematös und<br />
gestaut; starke Pulsation und Schwirren der aa.ut.med.<br />
16
Die Anspannung der Gebärmutterbänder führt auch <strong>zur</strong> Querfaltenbildung am Boden der<br />
Vagina. Bei Unklarheit über die Drehrichtung anlässlich der vaginalen Untersuchung<br />
verschafft die rektale Untersuchung meistens Klarheit.<br />
Diagnose<br />
- Äussere klinische Befunde<br />
- Längs- und Querfalten in Vagina bei gleichzeitiger Einengung des Geburtskanals<br />
- Befunde am Foeten<br />
- Befunde an Ligg. lata bei rektaler Untersuchung<br />
Differentialdiagnosen:<br />
- Scheidenenge, Zervixenge<br />
- Stellungsanomalien (bei korkzieherartiger Torsion)<br />
Folgen:<br />
- Zirkulationsstörungen an der Gebärmutter: Ischämie an der Torsionsstelle, Stauung<br />
und Infarzierung der Gebärmutter und ihres Aufhängeapparates durch<br />
Kompression der Venen bei erhaltener Durchgängigkeit der Arterien: Ausschwitzungen,<br />
erhöhte Brüchigkeit des Gewebes.<br />
- ungenügende Versorgung des Foeten mit Sauerstoff und Nährstoffen,<br />
Kreislaufversagen beim Muttertier (Schock)<br />
- gestörtes Vorbereitungsstadium: Zervixenge<br />
Korrektur:<br />
Grundsätzlich kommen in Frage: manuelle Retorsion mit oder ohne Hilfe von aussen,<br />
Wälzen des Muttertiers, Sectio caesarea<br />
Manuelle Retorsion:<br />
Retorsion der Gebärmutter durch Zurückdrehen des mit ihr verlagerten Kalbes am<br />
stehenden Muttertier. Voraussetzung: Kalb muss bei der vaginalen Exploration<br />
erreichbar sein. Intakte Fruchtblasen wenn möglich nicht zum Bersten bringen<br />
- Reposition leichter und gefahrloser für das Muttertier<br />
- nach Reposition muss die Eröffnung der weichen Geburtswege normal<br />
weitergehen können<br />
Epiduralanästhesie kann Retorsion begünstigen.<br />
Bei geringgradiger Torsion Spiralzug: Einziehen des Kalbes mit überkreuzten<br />
Gliedmassen.<br />
Normalerweise wendet man den sogenannten Kamer'schen Griff an, indem man das<br />
Kalb von sich wegstösst, z.B. bei zervikal-vaginaler Torsion 3/4 nach links:<br />
- Geburtshelferin steht mit ihrer linken Seite <strong>zur</strong> Kuh und führt ihren linken Arm ein<br />
- Erfassen eines erreichbaren Körperteils, über welchen eine gute Kraftübertragung<br />
möglich ist. Bei VEL: Kopf, Hals, Schulter; bei HEL: Oberschenkel, Becken<br />
- durch leicht wippende Bewegung Gebärmutter in Schwingung versetzen und dann<br />
mit konzentrierter Kraft das Kalb über die untere Stellung in eine seitlich rechte<br />
Stellung verbringen<br />
- nach Handwechsel: Torsion in gleicher Weise mit rechtem Arm oder mit einer<br />
Hebebewegung mit dem linken Arm zu Ende führen<br />
- keine langen Vorversuche: rasche Ermüdung wegen Strangulation des Armes -<br />
Handwechsel rasch durchführen wegen Gefahr von erneuter Torsion<br />
Unterstützung von aussen:<br />
- die wippenden Bewegungen werden durch zwei Hilfspersonen, einerseits durch<br />
Faustmassage in der rechten Flanke in Retorsionsrichtung und anderseits durch<br />
Anheben des ventralen Abdomens links durch den Rücken der zweiten<br />
Hilfsperson unterstützt<br />
17
- oder durch Anheben des Abdomens und rollenden Bewegungen mittels<br />
eines von zwei Hilfspersonen gehaltenen Bretts<br />
wenn kein guter Haltepunkt am Foet erreichbar ist (vor allem bei HEL), gelingt die<br />
Retorsion ev. mit dem Torsionshaken nach Kalchschmidt:<br />
- Verbinden der beiden Gliedmassen möglichst proximal durch in Achterschlingen<br />
angelegten Geburtsstrick<br />
- Einhängen des Hakens an der Kreuzungsstelle<br />
- Unterstützung der manuellen Retorsion durch eine Hilfsperson, die den in das<br />
Ende des Hakens eingeführten Querstab dreht<br />
- Gefahr: unkontrollierbare Kraftanwendung: Fraktur von Röhrenknochen des<br />
Kalbes, Zervix- oder Scheidenverletzungen<br />
Wälzen:<br />
- bei nicht erreichbarem Foet (präzervikale Torsion, hochgradige zervikalvaginale<br />
Torsion)<br />
- nach Misslingen von manuellen Retorsionsversuchen<br />
- bei festliegendem Muttertier<br />
Prinzip: Muttertier wird um den vom Operateur fixierten Uterus gedreht. Praktische<br />
Durchführung:<br />
- Vorbereiten eines grossen Wälzplatzes (Stroh, Weide); kleine Epiduralanästhesie<br />
- Niederlegen in Seitenlage: Torsio nach links: Ablegen auf linke Seite. Torsio nach<br />
rechts: Ablegen auf rechte Seite. Beine des Muttertieres paarweise<br />
zusammenbinden<br />
- Geburtshelferin führt Arm in die Scheide ein und erfasst den Foeten oder<br />
(falls dieser nicht erreichbar ist) die Zervix<br />
- durch Hilfspersonen wird das Tier über seinen Rücken auf die andere Seite<br />
gewälzt; diese Prozedur muss unter Umständen wiederholt werden<br />
Wenn der Foet von der Vagina her nicht erreichbar ist, kann die Retorsion von aussen<br />
durch Auflegen eines Bretts auf das Abdomen während des Wälzens unterstützt werden<br />
(„Brettwälzmethode“). Dabei muss das Brett (Breite: 30 cm, Länge: 3.5 m) dem<br />
liegenden Tier in die Flanke gelegt werden, so dass es die Kuh um 40-50 cm überragt.<br />
Eine Gehilfin kniet auf dem Brett und die Kuh wird gedreht. Das Brett sollte in der<br />
Flanke liegen und nicht der rippengestützten Seite aufliegen.<br />
Nach Retorsion:<br />
- Geburt kann normal ablaufen<br />
- bei noch nicht gebrochenem Wasser: normale Beendigung des Eröffnungsstadiums<br />
abwarten<br />
- bei gebrochenem Wasser: Foet in die Zervix einziehen, Fortgang des<br />
Austreibungsstadiums überwachen<br />
- Störungen kommen oft vor: nicht beeinflussbare Zervixenge, Wehenschwäche<br />
infolge zirkulationsbedingter Schädigung der Gebärmutterwand, Uterus- und<br />
Zervixverletzungen aus gleichen Gründen<br />
Sectio caesarea:<br />
Wegen der Gefahr der nichtbeeinflussbaren Zervixenge nach Retorsion entschliesst man<br />
sich manchmal direkt, einen Kaiserschnitt zu machen, wenn die manuelle Retorsion<br />
nicht gelingt. Das Operationsrisiko ist aufgrund der zu befürchtenden Schädigung der<br />
Gebärmutterwand in solchen Fällen grösser als bei Kaiserschnitt mit anderen<br />
Indikationen (Einreissen der Gebärmutternaht, Schockgefahr).<br />
18
5. Gestörte Wehentätigkeit<br />
Normal im Austreibungsstadium: total 40-60 Wehen von 15-50 sec Dauer, unterbrochen<br />
von Wehenpausen von 2-3 min Dauer.<br />
Verminderte Tätigkeit (Frequenz oder Intensität) wird als Wehenschwäche bezeichnet.<br />
Ursachen Primäre Wehenschwäche<br />
Probleme bestehen bereits in der Öffnungsphase der Geburt.<br />
Allgemeinerkrankungen (Hypokalzämie, Fettmobilisationssyndrom),<br />
Infektionskrankheiten, Indigestionen, Erschöpfung durch lange Transporte, Kachexie,<br />
andere Störungen.<br />
Störungen an Gebärmutter oder Bauchdecken: Überdehnung der Gebärmutter bei<br />
Eihautwassersucht oder Mehrlingsträchtigkeit. Verwachsungen der Gebärmutter,<br />
Überdehnung der Bauchdecken, Bauchhernien; Schmerz in Bauch- oder Brusthöhle<br />
(Peritonitis usw.)<br />
Für Geburt ungünstige Umgebungsbedingungen: Beeinträchtigung durch Nebentiere,<br />
allgemeine Unruhe und Lärm im Stall. Störungen durch zu häufige Überwachungen und<br />
Kontrollen durch die Tierhalterin oder die Geburtshelferin.<br />
Ursachen sekundäre Wehenschwäche<br />
Nach normaler Öffnungsphase mit guter Wehentätigkeit nehmen Kontraktionen von Uterus<br />
und Bauchmuskulatur ab oder sistieren. Erschöpfung wegen verzögerter Geburt (relativ<br />
oder absolut zu grosser Foet), Enge der weichen Geburtswege, Torsio usw.<br />
Alle Geburtshindernisse, die verhindern, dass der Foet in die Zervix eintreten und somit<br />
reflektorisch die Oxytocinausschüttung anregen kann, führen zwangsweise zu<br />
Wehenschwäche oder Wehenlosigkeit. Reflektorische Unterdrückung der Wehentätigkeit bei<br />
Verletzungen der weichen Geburtswege und ihrer Umgebung im Laufe der Geburt.<br />
Symptome<br />
Nicht immer sind bei primärer Wehenschwäche Symptome des Primärleidens<br />
erkennbar. Man stellt lediglich eine ungenügende Frequenz, Dauer oder Intensität der<br />
Wehen fest.<br />
Therapie<br />
Bei Verdacht auf Hypokalzämie (Somnolenz, kühle Körperoberfläche, Festliegen<br />
oder nur mühsames Aufstehen) ist eine Kalziuminfusion die Therapie der Wahl.<br />
Nach Korrektur von Geburtshindernissen und Einziehen des Foeten in die Zervix<br />
setzen in der Regel die normalen Wehen ein.<br />
Tiere, die sich durch ihre Umgebung gestört fühlen, überlässt man am besten sich selbst<br />
in ruhiger, halbdunkler Umgebung, nachdem man bei einer genauen Untersuchung<br />
festgestellt hat, dass normale Verhältnisse vorliegen; wenn nötig, kann auch in diesem<br />
Fall durch Einziehen des Foeten in die Zervix die Wehentätigkeit angeregt werden.<br />
In allen übrigen Fällen lässt sich die Wehenschwäche durch Behandlung des<br />
Primärleidens kurzfristig nicht beeinflussen. In diesen Fällen ist die Injektion von<br />
Oxytocin angezeigt.<br />
Dosierung:<br />
- Rind und Pferd: 10-30 IE i.m. bzw s.c.<br />
- Schwein: 5-10 IE i.m. bzw. s.c.<br />
- Schaf und Ziege: 1-3 IE i.m.<br />
- Hund: 1-5 IE i.m.<br />
Bei intravenöser Verabreichung benötigt man ungefähr 1/4 der subkutanen Dosis<br />
Wirkungseintritt: nach intramuskulärer und subkutaner Applikation: 10-20 min, bei<br />
intravenöser Injektion sofort. Wiederholungen: nicht vor zwei Stunden.<br />
19
Eine gleichzeitige Injektion von Uterusrelaxantien, welche die adrenergischen<br />
Betarezeptoren stimulieren, z.B. Isoxuprin, wird empfohlen, weil dadurch der<br />
Uterustonus reguliert und die Wehentätigkeit besser koordiniert werden (keine<br />
persönliche Erfahrung).<br />
Eine Anwendung von Oxytocin ist nur angezeigt, wenn man als Ursache der<br />
Wehenschwäche eine Obstruktion der Geburtswege ausschliessen kann (Gefahr von<br />
Uterus-Rupturen) und nach vorgängiger Kontrolle von korrekter Lage, Stellung, Haltung<br />
des Foeten.<br />
6. Unerwünscht starke Wehen<br />
Unerwünscht starke Wehen können bei ungenügender Vorbereitung des Tieres zu<br />
Ablenkung des Kopfes, im Extremfall zu Ruptur der Gebärmutter führen; entsprechende<br />
Probleme trifft man etwa bei der Stute an. Therapie: Epiduralanästhesie, ev.<br />
Uterusrelaxans.<br />
7. Geburtsstörungen durch Eihäute und Nabelstrang<br />
Zu früher Blasensprung ist Ursache von Enge der weichen Geburtswege. In seltenen<br />
Fällen kommt es vor, dass die Amnionhaut nicht spontan reisst. Die Amnionblase soll<br />
nur künstlich eröffnet werden, wenn sich der Foet mit Kopf und Gliedmassen im<br />
Bereich der Schamöffnung befindet.<br />
Bei stark verzögerter Geburt beginnen sich die Eihäute abzulösen, was zum Absterben<br />
des Foeten führen kann.<br />
Bei Vorliegen von Riesenplazentomen und diffuser Plazentation besteht eine erhöhte<br />
Blutungsbereitschaft.<br />
Beim Einstellen für die Geburt kann sich der Foet in der Nabelschnur verstricken. Durch<br />
Strangulation kommt es zum Absterben des Foeten. Eine solche Verstrickung kann aber<br />
auch Ursache eines Geburtshindernisses sein: stockende Geburt trotz normaler Lage,<br />
Stellung und Haltung. Bei genauer Untersuchung kann man den die Austreibung<br />
behindernden Nabelstrang (z.B. zwischen Hals und Vorderbeinen) feststellen und nach<br />
Zurückstossen des Kalbes reponieren.<br />
8. Tote Früchte<br />
Die eindeutige Feststellung, ob ein Foet noch lebt oder nicht, kann schwierig sein.<br />
Nach Eintreten der Totenstarre ist die Reposition von Lage-, Stellungs- und<br />
Haltungsanomalien erschwert oder unmöglich und mit grossen Risiken für das<br />
Muttertier verbunden.<br />
Auch frisch tote Foeten lassen sich schwerer extrahieren als lebende, weil sie sich den<br />
gegebenen Platzverhältnissen nicht durch Eigenbewegungen anpassen.<br />
Emphysematöse Foeten können wegen der gasigen Auftreibung des Körpers häufig nicht<br />
ausgezogen werden; sehr oft lassen sie sich überhaupt nicht bewegen, weil ihnen die<br />
Gebärmutterwand eng anliegt. Dies gilt auch für noch relativ wenig entwickelte Foeten<br />
bei Abort.<br />
Bei Extraktionsversuchen zerreissen manchmal die faulig zersetzten Gliedmassen.<br />
Für die Geburtshelferin besteht Infektionsgefahr (Schutzhandschue tragen).<br />
Therapie:<br />
bei verunmöglichter Haltungskorrektur infolge Totenstarre: Teilfoetotomie.<br />
bei absolut oder relativ zu grossen Foeten: Totalfoetotomie oder Sectio caesarea;<br />
bei emphysematösen Foeten: je nach Zustand und Wert des Muttertieres Totalfoetotomie<br />
(erhöhtes Risiko für Muttertier und Geburtshelferin) oder Notschlachtung des<br />
20
Muttertiers (Fleischverwertung fraglich) oder Sectio caesarea (erhöhtes Operationsrisiko<br />
wegen Vorschädigung der Gebärmutter und Infektionsgefahr).<br />
Operationsrisiko für Geburtshelferin bei Sectio caesarea geringer als bei Foetotomie.<br />
9. Missbildungen als Geburtshindernis<br />
Ursachen: Erbfehler; intrauterine Schädigung<br />
- Hydrozephalus und Enzephalozele<br />
Hydrozephalus: vermehrte Flüssigkeit in den Gehirnventrikeln, Auftreibung des<br />
Schädels, meistens verbunden mit Atrophie des Knochens. Enzephalozele:<br />
vergrösserter, flüssigkeitshaltiger Gehirnventrikel wird durch die Fontanelle<br />
ausgestülpt und ist nur von Haut umgeben. Diagnose: in VEL einfach, häufig<br />
Kopfseitenhaltung; in HEL erst erkennbar, wenn der Kopf nicht ins Becken oder<br />
in die Zervix eintreten kann. Therapie: Spaltung von Haut und dünnem Knochen<br />
mit Fingermesser; Teilfoetotomie durch Tangentialschnitt an der Schädelkalotte<br />
- Anasarka (Wasserkalb, Mondkalb, Speckkalb)<br />
Umfangsvermehrung des Rumpfes durch starke seröse Durchtränkung von<br />
Subkutis und Bindegewebe. Extremitäten sind kleine Stümpfe; Ohren, Augen und<br />
Lippen sind wulstig. Solche Kälber werden häufig nicht ausgetragen. Man findet<br />
sie auch in Zusammenhang mit Eihautwassersucht oder Eihautödem. Manchmal ist<br />
auch das Allgemeinbefinden des Muttertieres beeinträchtigt: Inappetenz,<br />
Milchrückgang, Abmagerung. Diagnose: meist einfach, zumindest<br />
Verdachtsdiagnose. Therapie: Entwicklung durch Extraktion oft nicht möglich<br />
bedingt durch die Grösse des Foeten, Zervixenge, Wehenschwäche, Reissen des<br />
Gewebes bei Zug. Totalfoetotomie. Eine Sectio caesarea kommt aus<br />
wirtschaftlichen und medizinischen Gründen meist nicht in Frage. Wenn<br />
Extraktion und Foetotomie nicht möglich sind: Notschlachtung.<br />
- Aszites des Foeten<br />
Ansammlung von grossen Flüssigkeitsmengen in Bauch- und manchmal auch<br />
Brusthöhle. Je nach Ursache befindet sich die Flüssigkeitsansammlung in der<br />
Harnblase oder im Magen-Darmkanal. Symptome: Foet mit kleinem Kopf und<br />
feinen Gliedmassen tritt nicht in die normal erweiterte Zervix oder ins Becken ein.<br />
Normaler Geburtszeitpunkt oder Abort, manchmal auch in Zusammenhang mit<br />
Eihautwassersucht. Diagnose: bei Foet von normaler Grösse unter Umständen<br />
schwierig, wenn man nicht bis zum Abdomen vordringen kann. Therapie:<br />
Einführen eines Schlundrohrs und Durchstechen der foetalen Magenwand.<br />
Durchtrennen der Bauchdecken mit dem Fingermesser. Teilfoetotomie bis <strong>zur</strong><br />
Eröffnung der Brusthöhle; von dort aus stumpfes Vorgehen.<br />
Nicht jede Missbildung führt zu einem Geburtshindernis. Überzählige Gliedmassen<br />
erschweren die Diagnose und können ein Geburtshindernis darstellen.<br />
- Verkrümmung von Hals und Gliedmassen, Sehnenkontraktur,<br />
Gelenksankylosierung. Diagnose: ergibt sich aus nicht reponierbaren<br />
Haltungsanomalien. Therapie: auch bei kleinen Foeten ist die Extraktion von<br />
Kälbern mit ankylosierten Gliedmassen mit Verletzungsrisiko für das Muttertier<br />
verbunden. Bei Anomalien von Lage, Stellung oder Haltung sollte man sich<br />
deshalb relativ rasch zu einer Teilfoetotomie entschliessen.<br />
- Schizosoma reflexum<br />
Beim Rind im Vergleich zu anderen Haustierspezies häufig. In der embryonalen<br />
Entwicklung verschliessen sich Brust und Bauchdecke nicht in der Mediane; es<br />
kommt <strong>zur</strong> Lordose der Wirbelsäule in der Lendenwirbelgegend und zum<br />
Aufbiegen der seitlichen Brust- und Bauchwand. Die Bauch- und Brustorgane<br />
21
liegen offen da, die starren Gliedmassen und der Kopf sind von der ausgestülpten,<br />
mit Bauch und Brustfell überzogenen Bauch- und Brustwand teilweise verdeckt.<br />
Diagnose: entweder in Scheide, manchmal aus Schamöffnung heraushängende<br />
foetale Eingeweideteile und mit Peritonäum bedeckte Bauchdecken oder vier<br />
einander mit der Dorsalseite zugewandte Gliedmassen. Dazwischen Kopf,<br />
umgeben von peritonäumbedeckter Bauchdecke. Differentialdiagnosen:<br />
Gebärmutterruptur, Zwillingsträchtigkeit, Doppelmissbildungen, Lageanomalien.<br />
Therapie: Spontangeburt soll schon vorgekommen sein. Wenn der offene Bauch<br />
der Geburtsöffnung zugewandt ist: Exenteration der Organe und Schnitt durch<br />
Wirbelsäule an der Stelle ihrer stärksten Biegung; ev. Extraktion mit Krey-<br />
Schöttler-Haken in toto. Wenn Kopf und Gliedmassen der Geburtsöffnung<br />
zugewandt sind: Foetotomie; bei unmöglicher Foetotomie: ev. Sectio caesarea.<br />
- Perosomus elumbis (Elchkalb)<br />
Fehlen von Wirbelkörpern in Lenden-, Kreuz- oder Schwanzwirbelsäule. Hinterteil<br />
unterentwickelt, Ankylosierung der Hintergliedmassen. Foet lebt unter Umständen.<br />
Therapie: Normalextraktion oder Foetotomie, ev. auch Sectio caesarea, je nach Grösse<br />
des Foeten.<br />
- Neubildungen oder Hyperplasie einzelner Organe<br />
Thymushypertrophie beim Kalb; Nierenhypertrophie; Struma congenitale bei der<br />
Ziege. Therapie: wenn Extraktion nicht möglich ist, Teilfoetotomie oder Sectio<br />
caesarea.<br />
- Doppelmissbildungen<br />
Doppelgesicht, Doppelkopf, Brustzwillinge, Brustbauchzwillinge, Kopfbrustzwillinge,<br />
symmetrisch oder asymmetrisch. Solche Missbildungen können lebensfähig sein.<br />
Diagnose: schwierig, wenn Doppelbildung nicht direkt palpierbar.<br />
Differentialdiagnosen: Haltungsanomalien, Zwillingsträchtigkeit. Versuch, die<br />
einzelnen Gliedmassen gegeneinander zu verschieben. Therapie: Foetotomie oder<br />
Sectio caesarea<br />
10. Fehlerhafte Lagen<br />
Normal: Vorderendlage (Kopfendlage) oder Hinterendlage (Beckenendlage).<br />
Hinterendlage kommt bei rund 5% der Geburten vor. Gegenüber der Geburt in<br />
Vorderendlage besteht bezüglich Gefährdung des Muttertieres und Gefährdung des<br />
Foeten ein erhöhtes Risiko: bei Eintritt des foetalen Beckens in das mütterliche Becken<br />
kommt es beim liegenden Tier relativ leicht zum Einklemmen von Eingeweideteilen<br />
(Darm, Blase) zwischen Gebärmutter und Beckenboden, was bei weiterer Extraktion zu<br />
Quetschung oder Ruptur dieser Teile führt. Aus diesem Grund soll man Kälber, die sich<br />
in Hinterendlage präsentieren, immer am stehenden Tier ins Becken einziehen; die<br />
Extraktion am liegenden Tier darf erst erfolgen, wenn das foetale Becken fest im<br />
mütterlichen Becken engagiert ist. Aufstehversuchen von unter Geburt stehenden Tieren<br />
mit Foeten in Hinterendlage ist nachzugeben. Zudem besteht eine erhöhte<br />
Erstickungsgefahr für das Kalb, weil in der zweiten Phase der Extraktion die<br />
Nabelschnur zwischen Brustkasten und Becken eingeklemmt wird. Dadurch kommt es<br />
leicht zu Aspiration von Fruchtwasser, wenn der zweite Teil der Extraktionsphase nicht<br />
zügig vor sich geht.<br />
Lageanomalien entstehen in den meisten Fällen während der Eröffnungsphase, wenn<br />
der Foet an der nicht genügend weiten Becken- oder Zervixöffnung vorbeigeschoben<br />
wird. Fehlerhafte Lagen kommen selten vor, sind aber immer ein schweres Geburtshindernis.<br />
Sehr oft erweist sich der Foet schon bei der ersten Untersuchung als tot.<br />
Grundsätzliches <strong>zur</strong> Lageberichtigung:<br />
22
- nur bei lebendem Foeten ohne Missbildungen versuchen (Verletzungsgefahr)<br />
- Epiduralanästhesie<br />
- Fruchtwasserersatz<br />
- Hilfsmittel: Krücke, Haken<br />
- es gibt keine starren Regeln <strong>zur</strong> Behebung von Lageanomalien; sie müssen von<br />
Fall zu Fall beurteilt werden. Die näherliegende Längslage ist nicht immer die<br />
einfacher herzustellende!<br />
Rückenvertikallage<br />
Beim Rind selten. Das Rückgrat ist der Geburtshelferin zugewandt; Kopf<br />
nach oben oder nach unten. Behebung: Herstellen einer Hinterendlage und<br />
oberer Stellung und anschliessende Korrektur der beidseitigen<br />
Hüftgelenksbeugehaltung. (Ev. Herstellen einer Vorderendlage unterer<br />
Stellung gefolgt von Stellungskorrektur). Foetotomie dürfte schwierig sein,<br />
Sectio caesarea scheint meist möglich.<br />
Bauchvertikallage<br />
Die obere Bauchvertikallage (Kopf nach oben) ist beim Rind die häufigste unter den<br />
Lageanomalien. Diagnose: bei unberührten Fällen leicht, bei schon mit dem Kopf und<br />
Vordergliedmassen ins Becken eingezogenen Foeten schwierig oder unmöglich. Bei<br />
ungenauer Untersuchung ist die Bauchvertikallage leicht mit einer normalen Vorderendlage<br />
und oberer Stellung zu verwechseln. Es besteht dann die Gefahr, dass bei weiteren<br />
Extraktionsversuchen die Gebärmutter durch die sich unter dem Beckenboden<br />
festhakenden Hinterklauen verletzt / perforiert wird. Häufig bestehen zusätzlich noch<br />
Haltungsanomalien. Differentialdiagnosen: Zwillingsgeburt, Schizosoma reflexum<br />
überzählige Gliedmassen. Korrektur: Herstellen einer Hinterendlage unterer Stellung<br />
gefolgt von Stellungskorrektur. Das Herstellen einer Vorderendlage mit oberer Stellung<br />
hat wenig Aussicht auf Erfolg und ist mit grossem Verletzungsrisiko verbunden.<br />
Foetotomie, der Reihe nach:<br />
l. Absetzen der Vordergliedmassen in den Carpi<br />
2. Absetzen von Kopf und Hals<br />
3. Absetzen der Hintergliedmassen in den Kniegelenken<br />
4. Thoraxschnitt<br />
5. Extraktion des Rests<br />
Kaiserschnitt ist sehr schwierig, weil von der Operationswunde aus keine Gliedmassen<br />
erreichbar sind.<br />
Rückenhorizontallage und Bauchhorizontallage: analog Vertikallagen<br />
11. Fehlerhafte Stellungen<br />
Ursachen: Verharren in ursprünglicher intrauteriner Stellung oder unvollständige<br />
Drehung infolge Wehenschwäche, toter Frucht oder vorzeitigem Zug. Nicht selten<br />
kombiniert mit Haltungsanomalien. Diagnose: bei genauer Untersuchung einfach.<br />
Vorderendlage, untere Stellung: Sohlenfläche und Ballen nach oben, Rücken<br />
nach unten, Bauch nach oben.<br />
Hinterendlage, untere Stellung: Sohlenflächen und Ballen nach unten, Rücken nach<br />
unten, Bauch nach oben. Differentialdiagnose: Torsio uteri. Korrektur: bei Extraktion in<br />
unterer Stellung besteht die Gefahr von Verletzungen des Corpus uteri, weil der Kopf<br />
resp. Steiss am Schambein anstossen. Drehung des Foeten um seine Längsachse am<br />
stehenden Tier von Hand wie bei Torsio uteri. Eingekeilte Foeten <strong>zur</strong>ückstossen. Wenn<br />
die Drehung in der einen Richtung nicht gelingt, sollte versucht werden, in die andere<br />
Richtung zu drehen. Auch Spiralzug oder gar Wälzen kommen in Frage. Bei lebenden<br />
Foeten genügt unter Umständen der Druck auf die Bulbi mit Daumen und Zeigfinger<br />
23
während ungefähr 1 min: dadurch werden meistens reflektorische Bewegungen des<br />
Foeten ausgelöst; nicht selten nimmt dann der Foet von selbst oder mit wenig Hilfe die<br />
normale Stellung ein.<br />
12. Fehlerhafte Haltungen<br />
Relativ häufige Geburtshindernisse. Bei Kombination mit Stellungsanomalien wird in<br />
der Regel zuerst die Haltung und dann die Stellung korrigiert.<br />
Fehlerhafte Kopfhaltungen<br />
- Kopfseitenhaltung:<br />
beim Rind relativ häufig. Ursachen: enge Platzverhältnisse (Zervix, Becken), Kopf<br />
kann nicht eintreten und wird bei anhaltender Wehentätigkeit seitlich abgedrängt.<br />
Diagnose: eine oder beide Vordergliedmassen treten ein, Hals mit Breitseite, Teile des<br />
Kopfes (Ohren) sind meistens erreichbar. Bei flüchtiger Untersuchung Verwechslung<br />
mit Hinterendlage unterer Stellung möglich. Prognose: in der Regel gelingt es, beim<br />
lebenden und frisch toten Kalb die Seitenhaltung zu korrigieren. Da Kopfseitenhaltung<br />
sehr oft Ausdruck von engen Platzverhältnissen ist, ist auch nach der Haltungskorrektur<br />
eine normale Extraktion in Frage gestellt. Bei der Korrektur besteht die Gefahr von<br />
Uterusverletzung durch die Incisivi (schützen!). Eine Spontangeburt in Kopf-<br />
Seitenhaltung ist schon vorgekommen, soll aber nicht angestrebt werden. Korrektur:<br />
Kalb <strong>zur</strong>ückschieben unter gleichzeitigem Erfassen des Kopfes am Maul, den Kopf in<br />
die Beckengegend ziehen und damit den Hals strecken. Wenn der Kopf nicht am Maul<br />
erfasst werden kann, versucht man, ihn mit Daumen und Zeigfingern in den<br />
Augenhöhlen oder an der Mandibula zu ergreifen. Nachteil: Incisivi sind ungeschützt.<br />
Weitere Alternativen: Einsetzen von an einem Geburtshilfestrick befestigten<br />
Augenhaken in die Orbitae; Reposition mit vorsichtigem Zug durch eine Hilfsperson<br />
unter gleichzeitiger manueller Kontrolle durch die Geburtshelferin. Bei lebenden<br />
Foeten dürfen nur stumpfe Augenhaken verwendet werden; diese rutschen relativ leicht<br />
ab. Für das weitere Vorgehen ist es ratsam, den Kopf mit einer Genickschlinge zu<br />
fixieren, damit er bei weiteren Extraktionsversuchen nicht wieder seitlich abgleitet. Die<br />
Genickschlinge darf aber nicht als eigentliche Zughilfe verwendet werden. Bei Foet in<br />
Totenstarre: Teilfoetotomie durch Absägen des Halses möglichst rumpfnah. Der<br />
weitere Verlauf des Extraktionsversuchs muss ergeben, ob eine Totalfoetotomie<br />
durchgeführt werden muss. Bei lebendem Foeten und engen Platzverhältnissen oder<br />
nicht reponierbarer Anomalie: Sectio caesarea. Beim kleinen Wiederkäuer ist die<br />
Reposition meistens auch möglich, indem man den ganzen Kopf in die Hand<br />
nimmt.<br />
Pro memoriam: auch bei Haltungs- und Stellungsanomalien gilt: bei störender<br />
Wehentätigkeit Epiduralanästhesie und / oder Uterusrelaxans einsetzen. Bei engen<br />
Platzverhältnissen, insbesondere bei dem Foeten anliegender Gebärmutterwand<br />
reichlich Fruchtwasserersatz verwenden.<br />
- Kopf-Brusthaltung, Genickhaltung, Scheitelhaltung<br />
Ursachen: wie Seitenhaltung; Diagnose: im allgemeinen leicht, ev. Verwechslung<br />
mit Kopfseitenhaltung, besonders bei gleichzeitiger Stellungsanomalie. Prognose:<br />
analog Kopfseitenhaltung; Korrektur: keine Extraktionsversuche ohne Korrektur.<br />
Das vorübergehende Erstellen einer Carpalbeugehaltung kann die Reposition<br />
erleichtern. Hochheben des Kopfes über eine leicht seitliche Haltung bei gleichzeitigem<br />
Zurückstossen des Foeten mit der andern Hand. Ergreifen des Kopfs wie bei<br />
Seitenhaltung. Ev. Reposition nach vorübergehendem Verbringen in eine seitliche<br />
Stellung. Foetotomie oder Sectio caesarea mit gleicher Indikation wie bei<br />
Kopfseitenhaltung.<br />
24
- Kopf-Rückenhaltung<br />
kommt selten vor. Dabei wird der Foet immer tot vorgefunden. Reposition nur<br />
bei frisch totem Foeten versuchen, analog Kopfseitenhaltung. Sonst Teil- oder<br />
Totalfoetotomie, ev. Sectio caesarea.<br />
Fehlerhafte Haltungen der Vordergliedmassen<br />
Normal: gestreckte Haltung. Beim Schwein und Hund ist auch die beidseitige<br />
Schulterbeugehaltung als normal zu betrachten. Haltungsanomalien treten ein- oder<br />
beidseitig auf. Einseitige Anomalien erlauben ein weiteres Eintreten der Frucht und<br />
führen zu deren Einkeilen, so dass sie unter Umständen das grössere Geburtshindernis<br />
darstellen als beidseitige Haltungsanomalien.<br />
- Carpalbeugehaltung, eingetreten oder nicht eingetreten<br />
Korrektur: Klauenspitzen in die Hand nehmen, unter gleichzeitigem Zurückstossen<br />
des Kalbes die Gliedmassen strecken.<br />
- Schulterbeugehaltung (Schulterbeugehaltung kann auch bei Hinterendlage ein<br />
Geburtshindernis darstellen)<br />
Korrektur: Spontangeburten von kleinen Kälbern (z.B. Zwillingskälber) sind<br />
schon vorgekommen. Wenn möglich sollte man jedoch die Reposition versuchen.<br />
Gliedmasse so distal wie möglich ergreifen und unter Zurückstossen des Foeten in<br />
Carpalbeugehaltung verbringen; sobald die Klauen erreichbar werden, nimmt man<br />
sie in die hohle Hand und streckt die Gliedmasse unter Flexion im Fesselgelenk.<br />
Bei beidseitiger Beugehaltung verbringt man zuerst die eine Gliedmasse in<br />
Carpalbeugehaltung, streckt danach die andere vollständig und beendet dann die<br />
Haltungskorrektur an der ersten Gliedmasse.<br />
- Ellbogen-Schulterbeugehaltung<br />
beim Rind relativ häufig vorkommend. Diese Haltungsanomalie kommt zustande, wenn<br />
der Kopf im Verhältnis zu den Gliedmassen zu fest ins Becken vordringt. Durch die<br />
doppelte Abwinkelung im Schulter- und Ellbogengelenk und die damit verbundene<br />
Steilstellung der Scapula wird ein Eintreten des Brustkastens in das Becken<br />
verunmöglicht. Bei Zug an den Vordergliedmassen ohne vorhergehende<br />
Haltungskorrektur wird der Foet noch mehr eingekeilt. Ellbogen-Schulterbeugehaltung<br />
ist als Zeichen von engen Platzverhältnissen zu werten. Korrektur: Anbringen von<br />
Geburtshilfestricken oder Ketten oberhalb des Fesselkopfs. Zurückstossen des<br />
Kopfes unter gleichzeitigem leichtem Zug an der entsprechenden Gliedmasse.<br />
Danach mit der andern Gliedmasse gleich verfahren. Der weitere<br />
Extraktionsversuch wird zeigen, ob Kopf und gestreckte Gliedmassen ins Becken<br />
eintreten können; ev. Genickschlinge, um das Abgleiten des Kopfs <strong>zur</strong> Seite zu<br />
verhindern. Sehr oft lässt sich nach Korrektur einer Ellbogen-<br />
Schulterbeugehaltung die Geburt normal beenden.<br />
- Fuss-Nackenhaltung<br />
kommt selten vor. Gefahr von perforierenden Verletzungen des Scheidendaches,<br />
der Zervix, des Corpus uteri dorsal, wenn sich die Klauen in der Falte zwischen<br />
Zervix und Corpus uteri verfängt. Korrektur: bei lebendem Foeten nach<br />
Zurückstossen des Kalbes relativ einfach. Bei toten Foeten mit Haltungsanomalien<br />
an Vordergliedmassen sollen wegen der erhöhten Verletzungsgefahr keine langen<br />
Repositionsversuche vorgenommen werden; wenn die Reposition nicht einfach<br />
gelingt, muss eine Teilfoetotomie durchgeführt werden. Bei unmöglicher<br />
Haltungskorrektur am lebenden Foeten: Kaiserschnitt.<br />
Fehlerhafte Haltungen der Hintergliedmassen<br />
Normal: gestreckte Haltung. Haltungsanomalien kommen bei Hinterendlage relativ<br />
häufiger vor als bei Vorderendlage. Bei Vorliegen von beidseitigen Haltungsanomalien<br />
25
kommt es manchmal zu verschleppten Geburten, wenn der Abgang des Fruchtwassers<br />
nicht beobachtet wird, weil bei der Austreibungsphase keine foetalen Teile sichtbar<br />
werden.<br />
- Ein- oder beidseitige Sprunggelenksbeugehaltung, eingetreten oder nicht<br />
eingetreten<br />
Diagnose: Sprunghöcker, Schwanz und Beckenteile leicht erkennbar. Korrektur:<br />
Extraktion in Tarsalbeugehaltung ist nicht möglich. Bei lebendem Foeten: Überführen<br />
in gestreckte Haltung unter gleichzeitigem nach vorne Schieben des Foeten. Zur<br />
Vermeidung von Uterusverletzungen werden die Klauenspitzen mit der einen und die<br />
Sprunghöcker mit der anderen Hand abgedeckt. Bei totem Foeten: Absetzen der<br />
Gliedmassen im Tarsus und anschliessend Extraktion oder Totalfoetotomie.<br />
- Ein- oder beidseitige Hüftgelenksbeugehaltung, eingetreten oder nicht eingetreten<br />
(die beidseitige Hüftgelenksbeugehaltung wird etwa fälschlicherweise<br />
als "reine Steisslage" oder "absolute Steisslage" bezeichnet)<br />
Diagnose: nur Becken und Schwanz palpierbar. Korrektur: Extraktion vom Foeten<br />
mit Hüftgelenksbeugehaltung ist bei kleinem Foeten (Zwillings- oder<br />
Mehrlingsträchtigkeit) selten möglich. Korrektur: Verbringen in<br />
Tarsalbeugehaltung, ev. unter Zuhilfenahme eines Stricks, der oberhalb des<br />
Fesselkopfs befestigt und durch den Zwischenklauenspalt geführt wird. Bei<br />
beidseitiger Haltungsanomalie verbringt man eine Gliedmasse in<br />
Tarsalbeugehaltung und korrigiert anschliessend die andere Gliedmasse. Wenn der<br />
Foet tot ist, vor allem wenn er sich schon in Totenstarre befindet, sollte die<br />
Reposition wegen des grossen Verletzungsrisikos (Uterusruptur) für das Muttertier<br />
nicht versucht werden. Foetotomie: Absetzen der Gliedmassen durch Diagonal-<br />
oder Transversalschnitt am Hinterkörper. Bei unmöglicher Reposition und<br />
lebendem Foeten: Kaiserschnitt. Beim kleinen Wiederkäuer kann die Reposition in<br />
gleicher Weise vorgenommen werden, andernfalls ist auch die Extraktion in<br />
beidseitiger Hüftgelenksbeugehaltung möglich.<br />
13. Abnorme Mehrlingsträchtigkeit<br />
Bei Zwillings- und Mehrlingsgeburten trifft man sehr häufig Stellungs- und<br />
Haltungsanomalien einzelner Foeten an; auch Lageanomalien kommen vor. Wenn es<br />
einmal gelungen ist, die einzelnen Gliedmassen und Köpfe richtig zuzuordnen, ist es in<br />
der Regel einfach, die entsprechenden Korrekturen vorzunehmen, da die Foeten klein<br />
sind. Differentialdiagnosen: Bauchquer- und Senkrechtlage, Schizosoma reflexum,<br />
Doppelmissbildungen. Vorgehen: Haltungs- und Stellungskorrektur des besser<br />
erreichbaren Foeten; Extraktion unter Zurückschieben des andern. Nicht in jedem Fall<br />
kann der mehr eingetretene Foet als erster extrahiert werden. Auch bei Zwillingsgeburten<br />
ist eine gründliche Nachkontrolle nötig, weil am überdehnten Uterus ein dritter<br />
Foet besonders leicht übersehen wird.<br />
Die Foetotomie<br />
Seit Aufkommen des Kaiserschnitts hat die Foetotomie stark an Bedeutung verloren.<br />
Heutzutags wird eine Foetotomie nur noch durchgeführt, wenn der Foet mit Sicherheit<br />
tot ist; das Abtöten des Foeten im Mutterleib ist nur vertretbar, wenn man vermuten<br />
muss, dass der Foet mit Kaiserschnitt nicht entwickelt werden kann.<br />
Abtöten des Foeten im Mutterleib: Durchschneiden der Nabelschnur (bei Hinterendlage)<br />
oder Dekapitation (bei Vorderendlage). Indikationen: Teilfoetotomie bei mit Brustkorb<br />
oder Hüfte im Becken stecken gebliebenem Foeten (absolute Indikation); Lage- oder<br />
26
Haltungsanomalien, die manuell oder mit Hilfe von Instrumenten nicht zu berichtigen<br />
sind, besonders auch bei verschleppter Geburt. Missbildungen, vor allem bei<br />
Ankylosierungen, bei der das Operationsrisiko für eine Sectio caesarea sehr gross ist.<br />
Doppelmissbildungen, Schizosoma reflexum, absolut oder relativ zu grosser Foet. Heute<br />
wird häufig auch bei toten Foeten die Sectio caesarea bevorzugt.<br />
Emphysematöser Foet: sowohl Foetotomie wie Sectio caesarea sind vertretbar (s.<br />
oben).<br />
Die Foetotomie ist eine Methode, für die nach wie vor Indikationen bestehen. Es<br />
handelt sich um einen anspruchsvollen chirurgischen Eingriff, an den man sich nur<br />
heranwagen soll, nachdem man sich die entsprechenden theoretischen Kenntnisse<br />
und praktischen Fertigkeiten angeeignet hat.<br />
Instrumentarium<br />
Röhrenfoetotom nach Thygesen (1), bestehend aus zwei miteinander verbundenen<br />
Röhren (A). Am vorderen, dem Kalb anliegenden Ende befindet sich der Foetotomkopf<br />
(B). Die verschiebbare Halteplatte (C) dient <strong>zur</strong> Befestigung der Kälberstricke bzw. der<br />
Ketten.<br />
Drahtsäge (2), Griffe (3), Öhrsonde (4), Schlingenführer (5), Doppelhaken nach Krey-<br />
Schöttler (6). Geburtshilfeketten oder -stricke (sie werden in der folgenden<br />
Beschreibung der Operationstechnik mit "Seil" bezeichnet).<br />
Vorbereitungen<br />
Bereitstellen von:<br />
- Eimer mit warmem Wasser und Seife: Reinigung von Vulva und Umgebung der<br />
Kuh, sowie von Händen und Armen der Geburtshelferin<br />
- Eimer mit Desinfektionslösung <strong>zur</strong> Desinfektion nach dem Waschen und für das<br />
Einlegen der Instrumente<br />
- Eimer mit Fruchtwasserersatz und Eimerpumpe<br />
- Waschungen und Desinfektion müssen während der Operation mehrmals<br />
wiederholt werden; auch das Einpumpen von Fruchtwasserersatz muss mehrmals<br />
wiederholt werden.<br />
Operationsplatz<br />
- genügend Raum hinter der Kuh (Minimum 2 m)<br />
- die Operation wird wenn möglich am stehenden Tier ausgeführt<br />
- bei mangelnder Stehfähigkeit: linke Seitenlage mit Beckenhochlagerung<br />
- Hilfspersonen: mindestens zwei Hilfskräfte, die sich beim Sägen ablösen<br />
können.<br />
Prämedikation<br />
Epiduralanästhesie (bei Operation am liegenden Tier hohe Epiduralanästhesie),<br />
Uterusrelaxans<br />
Operationstechnik<br />
Grundsätze:<br />
- immer nach Plan vorgehen, der vor der Operation festgelegt wurde<br />
- Anwendung von reichlich Fruchtwasserersatz, um Raum zu schaffen<br />
- Schnitte so anbringen, dass möglichst keine scharfkantigen Stümpfe<br />
entstehen<br />
- abgeschnittene Stücke müssen ohne grosse Kraftanwendung extrahiert werden<br />
können; Abdecken von scharfen Teilen mit der Hand<br />
Durchführung von Quer- und Schrägschnitten:<br />
Ende des abzutragenden Teils mit Seil anschlaufen oder mit Doppelhaken, an welchem<br />
ein Seil angeschlauft ist, fixieren. Die Drahtsäge in beide Röhren einziehen, so dass<br />
zwischen den beiden Foetotomköpfen eine Schlaufe entsteht. Das Foetotom einführen,<br />
27
indem man das Seil durch die Sägeschlaufe zieht. Den Foetotomkopf an gewünschter<br />
Stelle auflegen und mit der Hand dort festhalten. Das Seil an der Halteplatte fixieren.<br />
Die Säge vom Foetotomkopf ausgehend in die richtige Lage verbringen und gleichzeitig<br />
straff anziehen lassen. Die Halteplatte so verstellen, dass bei an der richtigen Stelle<br />
liegendem Foetotomkopf das Seil straff angespannt ist. Anbringen der Griffe am Ende<br />
der Drahtsäge. Sägen: zum Ansägen der Haut zuerst mit kurzen, lockeren Sägezügen,<br />
dann mit möglichst langen Zügen, damit die Drahtsäge möglichst gleichmässig<br />
abgenützt wird; dabei muss die Drahtsäge immer straff gespannt sein. Der Operateur<br />
hält das Foetotom mit der einen Hand in der Nähe des Foetotomkopfes, mit der andern<br />
Hand an der Halteplatte. Nach den ersten Sägezügen wird kurz unterbrochen, um den<br />
richtigen Sitz der Säge zu kontrollieren.<br />
Durchführung von Längsschnitten:<br />
Die Drahtsäge mit der Öhrsonde in eine Röhre des Foetotoms einführen, das vordere<br />
Sägeende am Schlingenführer befestigen. Fixation des abzuschneidenden Rumpfes mit<br />
Seilschlinge oder Doppelhaken. Einführen des Schlingenführers entlang der<br />
gewünschten Schnittlinie; Nachziehen der Drahtsäge und Einziehen in die zweite Röhre<br />
des Foetotoms. Befestigung des Seils an der Halteplatte. Verbringen des<br />
Foetotomkopfes und der Säge in die definitive Lage. Anziehen der Drahtsäge und<br />
verschieben der Halteplatte bis das Seil straff gespannt ist. Anbringen der Griffe und<br />
Sägen wie bei Querschnitt.<br />
Reguläre Schnittführungen an der Vordergliedmasse:<br />
Schnitt durch das gestreckte Carpalgelenk: Der Foetotomkopf ist in der Gelenksbeuge.<br />
Schnitt durch das gebeugte Carpalgelenk: Der Foetotomkopf ist auf dem Scheitel des<br />
Gelenks (ev. Vorbereiten wie bei Längsschnitt). Absetzen der gestreckten<br />
Vordergliedmasse an der Schulter mit Schrägschnitt nach vorwärts; Fixation des<br />
Foetotoms schwierig, starke Abnützung des Sägedrahts. Absetzen der Vordergliedmasse<br />
bei Schulterbeugehaltung: dazu muss vorher die andere Gliedmasse im Carpus und der<br />
Hals möglichst rumpfnah durchgesägt werden. Vorbereitung als Längsschnitt, der<br />
Foetotomkopf wird an entgegengesetzter Seite des Halsstumpfes angesetzt.<br />
Reguläre Schnittführungen an der Hintergliedmasse:<br />
Durchsägen des gestreckten Sprunggelenks: Der Foetotomkopf liegt in der<br />
Gelenksbeuge, Schnitt durch proximales Intertarsalgelenk. Durchsägen des gebeugten<br />
Sprunggelenks: Foetotomkopf am unteren Ende des Calcaneus. Absetzen der<br />
Hintergliedmasse bei gestrecktem Hüftgelenk: vgl. Totalfoetotomie bei Hinterendlage.<br />
Absetzen der Hintergliedmasse bei Hüftgelenksbeugehaltung: als Längsschnitt<br />
vorbereiten; Der Foetotomkopf liegt im gegenseitigem Sitzbeinausschnitt.<br />
Reguläre Schnittführungen am Hals:<br />
Möglichst rumpfnahes Absetzen des gestreckten Halses mit Querschnitt. Der<br />
Foetotomkopf wird hinter dem Widerrist fixiert, der Schnitt verläuft (am Kalb) von<br />
cranio-ventral nach caudo-dorsal. Um Raum zu schaffen, müssen zuvor die<br />
Vordergliedmassen in den Carpi durchgesägt werden.<br />
Totalfoetotomie:<br />
Es gibt verschiedene Methoden <strong>zur</strong> Durchführung einer Totalfoetotomie; jede hat ihre<br />
Vor- und Nachteile. Man sollte sich auf eine Methode konzentrieren und diese<br />
möglichst gut beherrschen. Hier wird nur das von der Hannover'schen Klinik<br />
empfohlene Verfahren besprochen.<br />
Totalfoetotomie bei Vorderendlage:<br />
- Durchsägen der beiden Carpi als raumschaffende Operationen (l, 2)<br />
- Absetzen des Halses möglichst rumpfnah (3)<br />
28
- kombinierter Quer- und Längsschnitt zum Absetzen der beiden Vordergliedmassen:<br />
Thorax hinter den Schulterblättern bis <strong>zur</strong> Mitte (Ansägen der Wirbelsäule)<br />
durchsägen (4a); Versetzen des Foetotomkopfs auf den Halsstumpf<br />
Längsschnitt durch Wirbelsäule (4b); Durchsägen der zweiten Thoraxhälfte nach<br />
Zurückversetzen des Foetotomkopfs an die ursprüngliche Stelle (4c)<br />
- Fixation: Seile an Gliedmassenstümpfen<br />
- Eviszeration der Thoraxhöhle<br />
- ein oder mehrere Rumpfquerschnitte (5); die einzelnen Segmente müssen leicht<br />
extrahierbar sein; bei Eröffnung des Abdomens: Eviszeration<br />
- Fixation mit Doppelhaken im Wirbelkanal<br />
- letzter Querschnitt: vor Becken<br />
- Längsteilung des Beckens (6) als Längsschnitt; Foetotomkopf auf seitlicher<br />
Begrenzung des Wirbelsäulenstumpfs, Sägenschlaufe im gegenseitigen<br />
Sitzbeinausschnitt; Extraktion der beiden Gliedmassen<br />
Totalfoetotomie bei Hinterendlage:<br />
- Absetzen der Gliedmassenenden in den Tarsi (1, 2) als raumschaffende<br />
Operationen<br />
- kombinierter Quer- und Längsschnitt mit vorübergehend wechselnder Position<br />
des Foetotomkopfes zum Absetzen der beiden Hintergliedmassen (3a, b, c)<br />
gleich wie beim Absetzen der Vordergliedmassen in Vorderendlage beschrieben<br />
- Eviszeration der Bauchhöhle<br />
- ein oder mehrere Querschnitte durch den Rumpf (4), wie bei Vorderendlage<br />
beschrieben<br />
- bei Eröffnung der Brusthöhle: Eviszeration<br />
- schräge Durchtrennung des Thorax mit Längsschnitt (4); Fixation an<br />
Wirbelsäulenstumpf mit Doppelhaken<br />
- Säge mit Schlingenführer so anlegen, dass eine ganze Vordergliedmasse und der<br />
Hals mit dem entsprechenden Thoraxstück abgesetzt werden können<br />
(Couleurbandschnitt)<br />
- Foetotomkopf zum Einsägen seitlich hinter Schulterblatt, danach neben<br />
Wirbelsäulenstumpf<br />
- Entfernen der beiden Teile nacheinander<br />
Kontrollen und Behandlungen nach Foetotomie<br />
Überprüfung des Allgemeinzustands<br />
Palpation von Scheide, Zervix und Gebärmutter: Untersuchung auf<br />
Zusammenhangstrennungen, Quetschungen, Hämatome, Blutungen. Zurückbleiben von<br />
einzelnen foetalen Teilen; Vorhandensein von weiteren Foeten. Zustand und<br />
Ablösbarkeit der Nachgeburt. Zur besseren Kontrolle legt man alle extrahierten foetalen<br />
Teile in einen Eimer und lässt sie erst nach Abschluss der Operation wegbringen.<br />
Bei günstiger Prognose: lokale und systemische Chemotherapie; intramuskuläre<br />
Verabreichung von Oxytocin (20-30 IE) <strong>zur</strong> Tonisierung der Gebärmutter; weitere<br />
unterstützende Therapie in Abhängigkeit der Befunde.<br />
29
Der Kaiserschnitt (Sectio caesarea)<br />
Indikationen<br />
Absolut oder relativ zu grosser Foet; bei nicht reponierbarer Torsio uteri; nicht<br />
reponierbare Lage-, Stellungs- und Haltungsanomalien; Missbildungen, bei denen man<br />
glaubt mit Foetotomie nicht zum Ziel zu kommen.<br />
Vorbereitungen<br />
Ein Kaiserschnitt kann gut im Stall durchgeführt werden. Operationsplatz: Kuh so<br />
anbinden, dass sie nicht <strong>zur</strong> Seite ausweichen kann; am besten mit rechter Seite <strong>zur</strong><br />
Wand. Auf der Operationsseite braucht man genügend Platz, damit die Operateurin und<br />
ihre Assistentin, sowie die Helferinnen, die das Kalb extrahieren, unbehindert arbeiten<br />
können. Vorübergehend müssen Nachbartiere verstellt werden.<br />
In einiger Entfernung vom zu operierenden Tier muss ein Platz zum Abreiben des<br />
Neugeborenen vorbereitet werden.<br />
Tisch zum Abstellen der Instrumente in der Nähe des zu operierenden Tieres.<br />
Beleuchtung: Handlampe mit Verlängerungskabel und geeigneten Anschlüssen<br />
mitbringen.<br />
Hilfskräfte<br />
Eine Assistentin, die sich wie die Operateurin vorbereitet hat. Sie ist während der<br />
Vorlagerung des Uterus (Herausschneiden des Kalbes und Naht) unentbehrlich.<br />
Allenfalls kann sie durch eine Person ersetzt werden, die unter Kontrolle die Hände<br />
gewaschen hat und sterile Schutzhandschuhe trägt.<br />
Zwei Helferinnen zum Herausziehen des Kalbes; sie sind in dieser Phase unentbehrlich<br />
und können sich sonst bei der Betreuung des Neugeborenen und beim Beleuchten des<br />
Operationsfeldes und anderen Handreichungen nützlich machen.<br />
Alle Hilfskräfte müssen über ihre Aufgabe zum voraus genau orientiert werden.<br />
Anweisungen über die Einhaltung der Asepsis.<br />
Es müssen genügend warmes Wasser, Seife und mehrere Handtücher bereit gestellt<br />
werden.<br />
Operationstechnik<br />
Gebräuchliche Methoden:<br />
- Operation am stehenden Tier, linke Flanke<br />
- Operation am auf der rechten Seite liegenden, ausgebundenen Tier, linke<br />
Flanke<br />
Selten angewandte Methode mit spezieller Indikation:<br />
- Operation in rechter Flanke am wenn möglich stehenden, allenfalls auch liegenden<br />
Tier. Indikation: extreme Rechtslagerung des Foeten; zum Beispiel bei Torsio 3/4<br />
nach rechts in HEL.<br />
Der rechte Flankeneingang wird beim Kaiserschnitt wenn möglich vermieden, weil bei<br />
der Vorlagerung der Gebärmutter die Dünndarmschlingen leicht eingeklemmt werden.<br />
Vorteile bei Operation am stehenden Tier: Organe in normaler Lage, Bauchdecken<br />
entspannt. Uterus leicht aus der Bauchwunde vorzulagern, relativ schonende<br />
Körperhaltung für Operateurin. Nachteile bei Operation am stehenden Tier: Tier liegt<br />
ev. während der Operation ab. Grösseres Risiko <strong>zur</strong> Entstehung von subkutanem<br />
Emphysem post operationem. Vorteile bei Operation am liegenden Tier: Tier ist<br />
zuverlässig immobilisiert. Nachteile bei Operation am liegenden Tier: Uterus manchmal<br />
schwer vorzulagern, grössere Wundspannung bei Bauchdeckennaht, Niederlegen und<br />
Ausbinden des Tieres benötigen zusätzlich Zeit. Starke Beanspruchung des Rückens der<br />
Operateurin.<br />
34
Wenn immer möglich führen wir den Kaiserschnitt am stehenden Tier in der linken<br />
Flanke durch.<br />
Tiere, die schon während der Voruntersuchung oder Vorbereitung immer wieder<br />
abliegen, legen wir <strong>zur</strong> Operation ab.<br />
Prämedikation und Anästhesie<br />
Injektion eines Uterusrelaxans, zum Beispiel Isoxsuprin (20 ml Degraspasmin ® i.m.)<br />
kann das Vorlagern der Gebärmutter erleichtern, ist aber nicht unbedingt erforderlich.<br />
Operation am stehenden Tier: bei anhaltenden Presswehen setzen einer kleinen<br />
Epiduralanästhesie. Zur Anästhesierung der Bauchwand: lokale Infiltrationsanästhesie,<br />
umgekehrter L-Block oder Paravertebralanästhesie, je nach Präferenz der Operateurin.<br />
Grossflächiges Scheren (besser als Rasur) des Operationsfeldes und Vorbereitung nach<br />
allgemeinen chirurgischen Prinzipien.<br />
Vorbereitung der Operateurin und ihrer Assistentin nach Regeln der Asepsis.<br />
Zur Wirbelsäule senkrechter oder leicht schräg von caudo-dorsaler nach cranioventraler<br />
Richtung verlaufender, ca. 40 cm langer Flankenschnitt, ca. handbreit<br />
unterhalb Querfortsätzen der Lendenwirbel und gut handbreit vor dem Hüfthöcker<br />
beginnend (Details zum Flankenschnitt: s. allgemeine Chirurgie).<br />
Vorlagerung der Gebärmutter<br />
Schwierigster Teil der Operation! Die Vorlagerung des Uterus ist wichtig, damit nach<br />
dessen Eröffnung sein Inhalt nicht in die Bauchhöhle oder in die Operationswunde<br />
gelangt. Man erfasst durch die Uteruswand die Gliedmassen in der Hornspitze (bei VEL<br />
die hinteren) und zieht damit den zu eröffnenden Teil in die Flankenwunde.<br />
Bei Vorderendlage:<br />
- Erfassen einer Hintergliedmasse oberhalb des Sprunghöckers mit der linken Hand<br />
und an Klauenspitzen mit der rechten Hand<br />
- Zug und Anheben unter leicht wippenden Bewegungen, bis die Gebärmutter<br />
mit dem ganzen darin enthaltenen Bein des Kalbes aus der Wunde ragt<br />
(Achillessehne im unteren Wundwinkel)<br />
Bei Hinterendlage:<br />
- Erfassen einer Vordergliedmasse am Metakarpus mit der einen Hand und<br />
Umfassen des Kopfes mit der andern<br />
- Zug und Anheben der Gebärmutter, bis sie mit dem, die Klauenspitzen<br />
enthaltenden Teil aus der Wunde hervorragt<br />
Eröffnen der Gebärmutter und Durchtrennen der Eihäute über den Klauenspitzen auf<br />
einer kurzen Strecke mit dem Skalpell; Verlängern des Schnittes unter Kontrolle (cave<br />
Karunkelstiele nicht anschneiden!) mit der Schere auf der ganzen Länge des<br />
vorgelagerten Teils. Aufsuchen der zweiten Gliedmasse. Gliedmassenenden proximal<br />
vom Fesselkopf durch die beiden Hilfspersonen anschlaufen lassen. Langsame<br />
Extraktion des Kalbes nach dorsal und caudal. Beim vorsichtigen Zug am Kalb wird ein<br />
weiterer Teil der Gebärmutter nach extraperitoneal verlagert und kann von der<br />
Operateurin weiter eröffnet werden. Unmittelbar nach Entfernen des Kalbes muss die<br />
Gebärmutter von der Assistentin ausserhalb der Flankenwunde festgehalten werden.<br />
Abschneiden der losen, heraushängenden Eihautteile.<br />
Uterusnaht: entweder als fortlaufende, einstülpende Matratzennaht mit Chromcatgut<br />
USP 3 (Metric 7) oder als fortlaufende einstülpende Lembertnaht mit Plain-Catcut USP<br />
6 (Metric 10) mit versenkten Knoten (Ütrecht-Methode). Bei beiden Methoden wird<br />
lediglich die Serosa und die Muscularis, nicht aber die Mucosa durchstochen. Bei<br />
Zweifel an Dichte oder Festigkeit der Naht wird über die erste eine zweite fortlaufende<br />
Uterusnaht angelegt. Kontrolle der Gebärmutter auf allfällige Verletzungen und<br />
Versorgen in Bauchhöhle. Verschluss der Flankenwunde (s. allgemeine Chirurgie).<br />
35
Nachbehandlung<br />
Versorgung des Uteruslumens mit Antibiotika nach Abgang der Nachgeburt. Zur<br />
Schonung der Uteruswunde keine langdauernden Ablösungsversuche bei Zurückbleiben<br />
der Nachgeburt. Systemische Chemotherapie während 3-5 Tagen. Entfernung der<br />
Hautnähte nach 10 Tagen.<br />
BETREUUNG DES NEUGEBORENEN UNMITTELBAR NACH DER GEBURT<br />
Primäre Gefahr: Depressionszustand des Neugeborenen mit Hypoxie "Asphyxie"<br />
Sekundäre Gefahr: Infektion des schutzlos (ohne maternale Antikörper) geborenen<br />
Kalbes.<br />
Depressionszustand des Neugeborenen mit Hypoxie<br />
Ursache von (zu vielen) Kälberverlusten. Bei jeder Geburt kommt es zu einem<br />
hypoxischen Zustand, der zu einer gemischt-respiratorisch-metabolischen Azidose<br />
führt. Ursachen der Hypoxie: Durchblutungsstörungen der Plazenta durch<br />
Wehentätigkeit führt zu verminderter Sauerstoffzufuhr zum Kalb und zu verminderter<br />
Abgabe von CO2 an das Muttertier: respiratorische Azidose. Reaktion des foetalen<br />
Organismus: Drosselung der Durchblutung bei den in dieser Phase nicht<br />
lebenswichtigen Organen und Körperteilen. Nur Gehirn und Herz sind maximal<br />
durchblutet. Die Umstellung des Stoffwechsels in den schlecht durchbluteten<br />
Körperteilen auf anaerobe Glykolyse führt <strong>zur</strong> Laktatansammlung und somit <strong>zur</strong><br />
metabolischen Azidose. Unmittelbar post partum nimmt wegen der Aufhebung der<br />
"Sparschaltung" die Durchblutung in den Organen zu; es wird vermehrt C02<br />
ausgeschwemmt, wodurch sich die Azidose noch leicht verstärkt.<br />
Verschlimmerung der Azidose bei Geburtskomplikationen:<br />
- Kompression der Nabelschnur bei verzögerter Extraktion, vor allem bei HEL<br />
- beginnende Ablösung der Plazenta bei verschleppten Geburten<br />
- teilweise Strangulation der Nabelschnur, reitende Nabelschnur, eingeklemmter<br />
Brustkasten bei beginnender Lungenatmung<br />
- Fruchtwasseraspiration<br />
- unsachgemässe Geburtshilfe: Nichteinhalten der Wehenpausen<br />
Symptome<br />
Körper bewegungslos, schlaff, Kopf aufgelegt, Koma. Keine oder nur schnappende,<br />
unregelmässige oder röchelnde (Fruchtwasser in Nase, schlaffes Velum palatinum)<br />
Atmung. Herz schlägt noch.<br />
Therapie<br />
1. Befreien der Atemwege<br />
2. Beatmung und Stimulierung des Atemzentrums<br />
3. Pufferinfusion<br />
- ad 1.: Fruchtwasser befinden sich in den Nasenhöhlen, allenfalls im Rachen oder<br />
gar in der Trachea.<br />
o Mit Strohhalm Niessreiz auslösen.<br />
o Durch Massage von aussen Nasenlöcher ausstreifen.<br />
o Maulhöhle von Fruchtwasser befreien (Infektrisiko).<br />
o Aufhängen des Kalbes an Hintergliedmassen (mit Geburtshilfeketten oder<br />
-stricken). Massage von Thorax und Hals, Ausstreifen der Nase, klemmen<br />
ins Nasenseptum<br />
- ad 2.: Reizung des Atemzentrums:<br />
36
o Wecken durch Begiessen mit einem Schwall kalten Wassers<br />
o Abreiben mit trockenem Stroh, (entspricht dem Ablecken durch die<br />
Kuh)<br />
o medikamentell: Respirot ® ein zentrales Analeptikum, welches auf<br />
die Nasen- oder Maulschleimhaut geträufelt und rasch resorbiert<br />
wird.<br />
o Injekton von 2-5 ml Doxapram-V ® (zentrales Analeptikum) i.v., i.m., s.c.<br />
oder Einträufeln in die Maulhöhle. Dieses Medikament hat eine<br />
vorübergehende Swissmedic-Bewilligung!<br />
o Beatmung: manuell durch Massage des Brustkorbes von aussen (wenig<br />
wirksam); Mund zu Nase mit Hals in extremer Streckhaltung, damit die<br />
Luft in die Trachea gelangt; mit Atembeutel und Maske mit Halsstellung<br />
wie oben. Zusätzlich kann aus Druckflasche Sauerstoff zugeführt werden,<br />
entweder über Atembeutel oder durch Einlegen eines Schlauches in die<br />
Nasenöffnung (bei Übersättigung mit Sauerstoff wird das Atemzentrum<br />
gehemmt). Intubation und Beatmung wäre am wirkungsvollsten, ist aus<br />
technischen Gründen in der gegebenen Notfallsituation aber kaum<br />
durchführbar<br />
- ad 3.: Infusion von 200-500 ml Bikarbonatlösung in eine Jugularvene.<br />
Verhinderung von Neugeboreneninfektionen<br />
Frühzeitig, d.h. innerhalb der ersten 6 Lebensstunden reichlich, d.h. bis <strong>zur</strong> Sättigung<br />
Kolostrum verabreichen. Lebensschwache Kälber und solche mit verschwollener(m)<br />
Nase, Maul und Zunge (nach Schwergeburt) können in dieser Phase noch nicht trinken.<br />
Man sollte versuchen, durch vorsichtiges Einflössen in den Mundwinkeln, z.B. mit einer<br />
50 ml-Injektionsspritze, solchen Kälbern einige Deziliter Kolostrum zu verabreichen.<br />
Gefahr von Verschlucken und Aspirationspneumonie. Die vorsichtige Verabreichung<br />
von Kolostrum über eine Schlundsonde oder Nasenschlundsonde ist in diesen Fällen oft<br />
weniger risikoreich.<br />
Sauberkeit und Hygiene in der Umgebung des Kalbes: dafür sorgen, dass das Kalb nicht<br />
in den kotverschmutzten Stallgang oder in die Kotrinne zu liegen kommt. Saubere,<br />
trockene Einstreu am Liegeplatz, Schutz vor Kotverschmutzung durch Nebentiere,<br />
Schutz vor Kälte (Zugluft, schlecht wärmegedämmte Aussenwand), ev. Wärmelampe.<br />
Beurteilung des Nabels<br />
Beim Kalb reisst der Nabel unter der Geburt. Eine Abnabelung ist nicht nötig. Es kommt<br />
vor, dass das Kalb nach spontaner Abnabelung aus einem Nabelgefäss blutet. Solche<br />
Gefässe sind zu ligieren, die Nabelgegend zu desinfizieren. Wegen erhöhter<br />
Omphalitisgefahr ist in solchen Fällen eine systemische Behandlung mit Antibiotika<br />
indiziert. Bei nahe an der Bauchdecke abgerissener Nabelschnur (fehlender Nabelscheide)<br />
ist gleich vorzugehen. Im Normalfall soll der Nabel möglichst nicht berührt<br />
werden. Eine routinemässige Nabeldesinfektion ist nicht zu empfehlen: Gefahr von<br />
zusätzlicher Kontamination bei unsauberem Arbeiten, Gefahr von Reizung des zarten<br />
Gewebes bei Verwendung von aggressiven Desinfektionsmitteln. Bei bestandesweise<br />
gehäuftem Auftreten von Omphalitiden ist allenfalls eine routinemässige<br />
Nabeldesinfektion nach Anleitung der Tierärztin empfehlenswert.<br />
Spezielle Situation beim Fohlen: das Fohlen bleibt nach der Geburt noch längere Zeit an<br />
der Nabelschnur hängen und erhält so das noch in der Plazenta befindliche Blut. Auch<br />
das Fohlen soll nicht künstlich abgenabelt werden. Die Nabelschnur reisst bei den ersten<br />
37
Aufstehversuchen an ihrer Prädilektionsstelle. Die Bestäubung des Nabels mit<br />
Sulfonamidpuder wird beschrieben. Beim Fohlen ist auch darauf zu achten, ob das<br />
Darmpech abgeht.<br />
38
<strong>GEBURTSFOLGEKRANKHEITEN</strong><br />
DAS NORMALE PUERPERIUM<br />
Puerperium = Phase nach der Geburt<br />
Man bezeichnet etwa die erste Phase der Involution zwischen Geburt und<br />
Nachgeburtsabgang als Nachgeburtsstadium und die Phase danach als das eigentliche<br />
Puerperium.<br />
Frühpuerperium: die ersten 9 bis 10 Tage des Puerperiums. Beginn: Geburt; Ende: nach<br />
vollständiger Involution des Geschlechtsapparates, die eine erneute Einnistung eines<br />
befruchteten Eis und das Austragen einer Frucht erlaubt.<br />
Bei Primiparen: abgeschlossen nach ca. 6 Wochen (42 Tage) p.p. Bei Pluriparen: 7<br />
Wochen (50 Tage) p.p.<br />
Angestrebt wird eine neue Trächtigkeit nach einer Zwischenkalbezeit von 60-90 Tagen.<br />
Ziel: pro Kuh und Jahr 1 Kalb.<br />
Puerperale Erkrankungen führen nicht selten zu einer Verlängerung des Puerperiums<br />
und damit der Zwischenkalbezeit; dies ist eine wirtschaftlich bedeutende Seite der<br />
Puerperalerkrankungen.<br />
Abgang der Nachgeburt<br />
Normal: innerhalb von 1/2 bis 8 Stunden post partum<br />
Pathologisch: > 10 Stunden post partum<br />
Gewicht: ca. 1/10 des Foetalgewichts<br />
Der Mechanismus des Nachgeburtabgangs ist nach wie vor nicht vollständig geklärt. Es<br />
handelt sich um zwei, zeitlich nicht getrennt ablaufende Vorgänge: Loslösung und<br />
Ausstossung.<br />
Näheres: siehe bei Besprechung des Nachgeburtverhaltens.<br />
Lochialfluss<br />
Lochien: Flüssigkeit, die zu Beginn des Puerperiums von der Kuh durch die Vulva<br />
ausgeschieden wird. Herkunft: hauptsächlich aus dem Uterus, wenig aus Zervix und<br />
Vagina. Bestandteile: Serum, Schleim, Erythrozyten, Leukozyten, später auch gröbere<br />
Gewebeteile. Es handelt sich im wesentlichen um Abbauprodukte des Endometriums,<br />
insbesondere der Karunkeln. Der Lochialfluss dauert in der Regel 10-14 Tage,<br />
manchmal bis 3 Wochen. Aussehen: zuerst blutig rot gefärbter Schleim; später braun,<br />
dünnflüssig mit groben Flocken und erkennbaren Karunkelteilen; gegen Ende gelbgräulich,<br />
zähschleimig; zum Schluss durchsichtig klar.<br />
Menge: grosse Variation, schlecht abschätzbar; man sieht einzelne Lachen in der<br />
Streue oder auf Kotfladen, vor allem nach längerem Liegen. Zusätzlich verschmiert<br />
der Lochialfluss den Schwanz auf Vulvahöhe.<br />
Weniger wichtig als die Dauer sind Geruch, Farbe und Konsistenz des lochialen<br />
Ausflusses. Normale Lochien sehen nie eitrig aus und stinken auch nicht.<br />
Veränderung am Geschlechtsapparat<br />
Vulva: kurz vor der Geburt stark ödematisiert und geschwollen. Hat schon zwei bis<br />
drei Tage nach normaler Geburt wieder die normale Grösse und Konsistenz.<br />
Vagina: Hyperämie verschwindet rasch. Gute Heiltendenz von oberflächlichen<br />
Wunden. Die Straffung des Gewebes erfolgt über eine längere Periode gemeinsam<br />
mit dem Uterus und dem perivaginalen Gewebe.<br />
39
Zervikalkanal: verschliesst sich relativ rasch nach dem Abgang der Nachgeburt. 12<br />
Stunden danach ist er mit der zugespitzten Hand noch knapp passierbar. Zwei Tage post<br />
partum ist der Zervikalkanal nur noch zwei Finger breit offen; Abnahme des Lumens<br />
vom Orificium externum zum orificium internum hin. Zervix: nach der ersten<br />
Involutionsphase ist die Zervix bei rektaler Palpation mit der Hand halb umfassbar und<br />
hat zuerst eine starre Konsistenz mit Längsfalten wie der Uterus (Durchmesser ca. 10-12<br />
cm). Rückbildung auf die normale Grösse (Durchmesser 3-4 cm) innerhalb von ca. 2-3<br />
Wochen. Die Zervix ist dann wieder mit Daumen und Zeigfinger umfassbar und hat eine<br />
weiche Konsistenz. Aufgrund des Gewichtsverlustes der Gebärmutter wird die Zervix<br />
wieder zunehmend auf dem Beckenboden hin und her verschiebbar. Man achte auf<br />
gleichmässige Dicke von caudal nach cranial und das Grössenverhältnis zum Uterus.<br />
Uterus: während und unmittelbar nach der Geburt verkleinert sich der Uterus unter<br />
gleichzeitiger Zunahme der Wanddicke auf ungefähr die Hälfte seiner Grösse. Diese<br />
Verkleinerung kommt durch Kontraktionen der glatten Muskulatur (Nachwehen) und der<br />
elastischen Fasern des interstitiellen Gewebes zustande. Später: Abbau von<br />
interstitiellem Gewebe und Atrophie der während der Trächtigkeit hypertrophierten<br />
Muskelfasern. Peptonisierung des Gewebes, Verflüssigung, Transsudation und<br />
Resorption. Fettgewebe degeneriert und wird durch Makrophagen über die Lymphe<br />
abtransportiert. Diese Vorgänge sollen durch intermittierende Anämie bei Kontraktionen<br />
und durch Ischämie sowie Wegfall des trophischen Reizes zustande kommen.<br />
Nach Abgang der Nachgeburt werden die Karunkeln wegen mangelnder Durchblutung<br />
(Thrombosierung und Fibrosierung der Gefässe im Karunkelstiel) rasch kleiner; es folgt<br />
eine oberflächliche Degeneration und nekrotischer Zerfall innerhalb von 5 Tagen. Nach<br />
15 Tagen sind .in der Schleimhaut nur noch kleine Erhebungen zu sehen, die<br />
Epithelisierung ist nach ca. 6 Wochen abgeschlossen. Der weitaus grösste Teil des<br />
abgestorbenen Karunkelgewebes wird mit den Lochien ausgeschieden. Die<br />
Abbauvorgänge in der Gebärmutterwand führen zu einem raschen Gewichtsverlust von<br />
60-70% innerhalb der ersten 5 Tage; die weitere Verkleinerung und Gewichtsverminderung<br />
vollzieht sich etwas langsamer. Ungefähr 4 Wochen p.p. erreicht die<br />
Gebärmutter das Endgewicht.<br />
Dank der sofortigen Kontraktion kommt es <strong>zur</strong> massiven Verkleinerung der<br />
Oberfläche und Verminderung des Volumens: kleine, oberflächliche Verletzungen<br />
verschliessen sich spontan; die Infektionsanfälligkeit nimmt ab. .<br />
Auch nach normalem Geburtsverlauf ist der Inhalt von klinisch normalen Uteri 5<br />
Wochen p.p. nur bei ca. 2/3 der Tiere steril; bei den übrigen findet man eine "normale<br />
Uterusflora". Starke bakterielle Besiedelung, auch mit pathogenen Keimen treten nach<br />
gestörtem Geburtsverlauf, nach Nachgeburtsverhaltung und verzögerter<br />
Uterusinvolution in Zusammenhang mit geringer ovarieller Aktivität auf.<br />
Rektale Untersuchung<br />
- kurz nach der Geburt ist der Uterus noch nicht umfassbar; die normale Kontraktion<br />
ist anhand der Längsfaltenbildung und der starren, derben Konsistenz der dicken<br />
Uteruswände erkennbar. Die Gebärmutter lässt sich im Abdomen nur wenig<br />
bewegen.<br />
- Innerhalb von 5-8 Tagen ist der Uterus wieder nach vorne abgrenzbar und<br />
zunehmend beweglich.<br />
- Nach 10-14 Tagen lässt sich die Gebärmutter wieder im Beckenraum versammeln;<br />
ihre Wand wird zunehmend dünner und weicher; bei Einsetzen des ersten Zyklus<br />
ist sie tonisiert oder tonisierbar.<br />
- Nach 3 bis 4 Wochen: normale Grösse (Horndurchmesser 3-5 cm). Es bleibt eine<br />
Asymmetrie (Durchmesser des trächtig gewesenen Hornes grösser).<br />
40
Uterusbänder und Eileiter: verkleinern sich und werden straff gemeinsam mit dem sich<br />
<strong>zur</strong>ückbildenden Uterus. Die arteriae uterinae mediae verlieren ihr Schwirren<br />
unmittelbar nach Abgang des Foeten, ihre verstärkte Pulsation kurz danach. Sie bilden<br />
sich ebenfalls <strong>zur</strong>ück; Asymmetrie auf der Seite des ehemals trächtigen Hornes.<br />
Eierstöcke: Lageveränderungen entsprechend der Verkleinerung der Gebärmutter;<br />
Rückbildung des Corpus luteum graviditatis. Erster Zyklus nach ca. 10-14 Tagen p.p.<br />
Veränderungen am Gesamtorganismus<br />
Die Geburt ist ein normaler natürlicher Vorgang, bedeutet aber immer einen Stress.<br />
Stress der Geburt: Anstrengung bei der Austreibung, Wegfall eines grossen<br />
zirkulatorischen Widerstandes, Wegfall von viel Volumen und Gewicht (total 50-60<br />
kg). Flüssigkeitsverlust: Fruchtwasser (11-20 1), Blut. Teilweise wird der<br />
Flüssigkeitsverlust durch Mobilisierung von Flüssigkeit aus der Bauchhöhle (physiologischer<br />
Aszites der Hochträchtigen) und aus dem ödematisierten Bindegewebe<br />
kompensiert.<br />
Stress der beginnenden Milchleistung: die Umstellung des Euters von der Ruhephase<br />
auf die Laktation stellt eine grosse Stoffwechselbelastung dar. Bereitstellen von<br />
Aufbaustoffen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen, sowie Energie für die<br />
Milchbildung.<br />
Das Aufeutern und die Milchbildung beginnen schon ante partum, mit dem Einschiessen<br />
der Milch wird jedoch der Bedarf rasch stark erhöht. Weitere Probleme ergeben sich<br />
durch die tägliche Zunahme der Milchleistung. Nach Erreichen der maximalen<br />
Tagesleistungen, ca. 2-3 Wochen p.p., kommt es zu einer Dauerbelastung. Diese wirkt<br />
sich umso schwerwiegender aus, wenn die Funktion und Kapazität des<br />
Digestionsapparates den neuen Bedürfnissen nicht gerecht werden kann (Näheres s.<br />
Spezialvorlesungen).<br />
Zirkulationsapparat: die Herzschlagfrequenz ist vor, während und unmittelbar nach der<br />
Geburt erhöht, später Bradykardie.<br />
Körpertemperatur: Anstieg in der letzten Zeit der Trächtigkeit; Abfall kurz ante partum;<br />
im Puerperium normal bis leicht erhöht (bis 39.2° C).<br />
Die Atmung wird nach der Geburt ruhig und tief.<br />
Digestionsapparat: um die Geburt häufig Inappetenz und auch Verminderung der<br />
Pansenmotorik (Intensität und Frequenz der Peristaltikwellen). Normalerweise rasche<br />
Erholung, es besteht aber die Gefahr einer puerperalen Indigestion, die verschiedene<br />
Ursachen und Folgen haben kann (Näheres: siehe Spezialvorlesungen).<br />
Unmittelbar nach der Geburt sind die Tiere in der Regel durstig (Flüssigkeitsverlust).<br />
Bindegewebe: Bauchdecken und Beckenbänder werden in den ersten Wochen post<br />
partum wieder straff; fester Verschluss der Beckensymphyse.<br />
Euter: das schon a.p. entstandene Ödem bildet sich im Verlauf von 2 Wochen p.p.<br />
wieder <strong>zur</strong>ück (Näheres: s. "Erkrankungen des Euters").<br />
Die in den ersten Tagen sezernierte Kolostralmilch unterscheidet sich in ihrem Gehalt<br />
wesentlich von der normalen Milch: relativ hoher Gehalt an Albumin und vor allem<br />
Globulinen bei leicht vermindertem relativen Gehalt an Kasein; höher Salz- und<br />
Vitamingehalt.<br />
Bedeutung des Kolostrums: gut verdauliche, energiereiche Nahrung des Neugeborenen.<br />
Passive Immunisierung dank hohem Gehalt an γ-Globulinen, die in den ersten<br />
Lebensstunden unverändert resorbiert werden.<br />
Veränderungen am Blutbild: Rotes Blutbild: Hämokonzentration um die Geburt, relativ<br />
tiefe Hämatokritwerte im Puerperium. Weisses Blutbild: typisch für Stress:<br />
Leukozytose, Neutrophilie, Eosinopenie und Lymphopenie. Rasche Normalisierung in<br />
den ersten Tagen p.p. Blutchemie: in Zusammenhang mit der beginnenden Laktation<br />
41
kommt es zu einer physiologischen Hypokalzämie, die leicht in den pathologischen<br />
Bereich abrutschen kann (Näheres: s. Kapitel Hypokalzämie).<br />
Pflege der Kuh im Puerperium<br />
Gute Überwachung in den ersten Stunden: Prolapsus uteri; Nachgeburtsabgang;<br />
Erkennen von andern Störungen, z.B. Blutungen.<br />
In den ersten Tagen: Festliegen und andere puerperale Störungen.<br />
Haltung: viel saubere Einstreu; ohne besonderen Anlass keine Untersuchungen und<br />
Behandlungen am Geschlechtsapparat.<br />
Fütterung: gehaltvoll, gut verdaulich, appetitanregend.<br />
Die Fütterung ante und post partum ist für den Verlauf der Laktation und die optimale<br />
Funktion von Verdauung und Stoffwechsel von entscheidender Bedeutung (vgl.<br />
Fütterungslehre).<br />
Melken: in den ersten zwei Tagen nur soviel Milch (bzw. Kolostrum) ausziehen, wie für<br />
die Ernährung des Kalbes benötigt wird; auch in den Tagen danach die Kuh noch nicht<br />
voll ausmelken (Festliegeprophylaxe). Am ödematösen Euter der frisch gekalbten Kuh<br />
ist eine Mastitis oft schlecht zu erkennen: gute Überwachung, Schalmtest (Sekret aller 4<br />
Viertel sollte gleich aussehen).<br />
DIE ERKRANKUNGEN IM PUERPERIUM<br />
Bedeutung: wirtschaftlich steht sehr viel auf dem Spiel!<br />
- durch schwere Erkrankungen im Puerperium kann die Milchleistung während der<br />
ganzen Laktation negativ beeinflusst werden<br />
- bei schwerer Erkrankung des Muttertieres ist die Aufzucht des Neugeborenen<br />
gefährdet<br />
- der Schlachtwert von Kühen im Puerperium ist generell gering (Ödematisierung);<br />
nach puerperalen Erkrankungen noch schlechter<br />
Mechanische Beschädigung der weichen Geburtswege<br />
Mechanische Beschädigungen der weichen Geburtswege führen zu<br />
- oberflächlichen, tiefen oder perforierenden Zusammenhangstrennungen<br />
- Quetschungen und Hämatomen<br />
- Blutungen<br />
Oft bestehen verschiedene der aufgezählten Veränderungen gleichzeitig. Meistens<br />
kommt es in der Folge zu lokalen Entzündungen, sehr oft auch zu Infektionen.<br />
Ursachen: vielfältig, in der Regel für die verschiedenen Abschnitte dieselben.<br />
Vom Foeten bedingt: unnatürlicher Druck oder übermässige Spannung<br />
- bei absolut zu grossem Foeten<br />
- bei Vorliegen einer fehlerhaften Lage, Stellung oder Haltung<br />
- bei toten Foeten, insbesondere in Totenstarre und bei Vorliegen von Ankylosen<br />
- bei emphysematösen Foeten<br />
- bei Missbildungen<br />
Schlag mit Gliedmassen bei heftigen (häufig agonalen) Bewegungen des Foeten.<br />
Vom Muttertier ausgehend: Enge der weichen Geburtswege<br />
- unterentwickelte, juvenile Tiere (zu frühes Belegen)<br />
- verfettete Tiere (vor allem bei Primiparen)<br />
- schlechte Vorbereitung <strong>zur</strong> Geburt (keine oder übermässige Ödematisierung des<br />
Gewebes)<br />
- frühzeitiger Blasensprung<br />
42
- ungenügende Erschlaffung der Zervix zu Beginn der Eröffnungsphase<br />
- Narbenstrikturen (nach Verletzungen bei vorangegangenen Geburten)<br />
- Austrocknung bei verschleppter Geburt<br />
- nach Torsio uteri<br />
- nach Prolapsus vaginae<br />
- Entzündung oder Infektion (Abort)<br />
- Heftige Bewegungen des Muttertieres vor oder während der Geburt<br />
- Niederstürzen usw.<br />
- Übermässig heftige Wehen<br />
Durch die Geburtshelfer (Laien oder Tierärztinnen)<br />
- forcierter Zug trotz ungenügender Platzverhältnisse<br />
- Zug trotz fehlender Wehen oder Zug in den Wehenpausen<br />
- falscher Einsatz von Wehenmitteln<br />
- unsanftes Fällen von unter der Geburt stehenden Tieren<br />
- unsachgemässe Vorbereitung und Untersuchungstechnik (Fingernägel<br />
usw., Handstellung)<br />
- intrauterine Untersuchung oder Manipulation während der Wehen<br />
- unsachgemässe Repositionsversuche bei Lage-, Stellungs- oder Haltungsanomalien:<br />
falsche Technik; fehlende Wehenausschaltung; ungenügende<br />
Platzverhältnisse (fehlender Fruchtwasserersatz)<br />
- Verletzungen mit geburtshilflichen Instrumenten: Fingermesser, Geburtshaken,<br />
Foetotom<br />
- (um sich vor ungerechtfertigten Anschuldigungen zu schützen, soll man schon bei<br />
der geburtshilflichen Untersuchung auf Beschädigungen der weichen Geburtswege<br />
achten)<br />
Allgemeine Kriterien <strong>zur</strong> Beurteilung von Verletzungen:<br />
Tiefe: oberflächlich, tief, perforierend?<br />
- perforierende Verletzungen im retroperitonealen Bereich: Vorfall von Binde- und<br />
Fettgewebe<br />
- perforierende Verletzungen mit Verbindung <strong>zur</strong> Bauchhöhle: Vorfall von<br />
Darmschlingen oder Harnblase<br />
Lage: gut oder schlecht zugänglich?<br />
- Scheidendach, seitlich oder Scheidenboden? Verletzungen am Scheidenboden<br />
führen zu Versacken von Lochien, Harn oder Wundsekret<br />
- Retroperitonealbereich oder an Peritonäum angrenzend?<br />
- Bereich von Urethra und ihrer Mündung?<br />
- Ausdehnung<br />
Blutungen<br />
- Ausmass der Blutung: flächenhaft? arterielle oder venöse Blutung?<br />
- ev. Koagula in Gebärmutter oder Scheide<br />
- ev. Blutung ins Gewebe<br />
Schwellungen<br />
- bereits eingetretene Komplikationen?<br />
- entzündliche Prozesse<br />
- Phlegmonen mit oder ohne Allgemeinstörungen<br />
- Abflussstörungen von Wundsekret (Versackungen)<br />
- Störungen des Lochialflusses<br />
- Störung des Nachgeburtsabgangs<br />
43
Beschädigung von Vulva und Vagina<br />
Quetschungen:<br />
- kommen in Zusammenhang mit Schwergeburten häufig vor (verschiedene<br />
Ursachen, s. oben).<br />
- gute Heiltendenz, Abschwellung im Verlauf von Tagen.<br />
- manchmal in Verbindung mit Drucknekrosen der Schleimhaut: grau-grüne<br />
Verfärbung<br />
- oberflächliche Risse<br />
- gequetschtes Gewebe ist guter Nährboden für Infektionserreger (besonders<br />
gefürchtet sind C. septicum, C. tetani, die durch diese Läsionen eindringen)<br />
- Behinderung von Sekret- und Lochialabfluss, ev. von Abgang der Nachgeburt<br />
Therapie: Entzündungshemmer systemisch, vorzugsweise Flunixin Meglumin<br />
(Finadyne ® )<br />
- bei Gefahr von Infektionen: Antibiotika systemisch<br />
Hämatome:<br />
- können wegen fehlender Tamponade gross werden, vor allem an der Vulva, sinken<br />
ab<br />
- Überwachung des Allgemeinzustandes, innere Verblutung möglich<br />
Therapie: in Scheide keine; bei von aussen sichtbaren ev. Lehm- oder Salbenanstrich.<br />
Eröffnete Hämatome: Hämostase, ev. durch Massenligatur, Wundbehandlung je nach<br />
Allgemeinzustand; systemische Chemotherapie<br />
Zusammenhangstrennungen:<br />
- je tiefer, desto schlimmer; man achte auf Blutungen.<br />
- bei perforierenden Wunden: Vorfall von Fettgewebe, ev. Kot, ev. Harnblase<br />
- Komplikationen: Infektionen und Phlegmone; Taschenbildung mit Sekret- und<br />
Lochialrückstau, gefolgt von Toxämie<br />
- tiefe Nekrose, perivaginaler Abszess, Narbenstrikturen. Nach Abheilung ev.<br />
Konzeptions- bzw. Geburtshindernis<br />
- Dammriss, Mastdarmfistel<br />
Therapie: oberflächliche Zusammenhangstrennungen erfordern keine Behandlung;<br />
tiefe und perforierende: in frischem Zustand: Naht; einige Stunden alte Wunden: gute<br />
Ligatur des vorfallenden Fettgewebes, Resektion distal davon; Naht später, nach<br />
Organisation des Gewebes. Alte Fettgewebsvorfälle: Imponieren als Lipome oder<br />
granulomatöse, gestielte Schwellungen. Sie können in gleicher Weise nach Ligatur oder<br />
mit einem Kettenecraseur abgesetzt werden. Die Wunde verschliesst sich danach<br />
meistens von selbst.<br />
Praktische Durchführung von Scheidennähten:<br />
- kleine Epiduralanästhesie, Tamponade des Rektums (nicht vergessen am Ende<br />
wieder zu entfernen!). Reinigung und Desinfektion von Vulva und Umgebung<br />
- bei Wunden im Bereich des Scheidenbodens: Einführen eines Harnkatheters in die<br />
Urethra<br />
- ev. zwei Hilfsnähte an der Vulva zum Spreizen der Vulvalippen (gehalten von<br />
Hilfspersonen)<br />
- fortlaufende Schneidernaht von cranial nach caudal, lange Fadenenden, (Knoten<br />
ausserhalb der Vulva beginnen, Verschieben nach innen). Grosse, halbkreisförmige<br />
runde Nadel mit geschlossenem Öhr, Nahtmaterial: grober Chrom-Catcut, Dexon<br />
oder Nylon<br />
- da man "blind" nähen muss, ist es ratsam, den Faden mit der Nadel fest zu<br />
verknoten<br />
44
- für Sekretabfluss sorgen, keine Spülungen, systemische Antibiotikabehandlung,<br />
Nachkontrolle<br />
Dammrisse<br />
Damm: lockeres Bindegewebe zwischen Vagina und Rektum. Man unterscheidet:<br />
unvollständiger Dammriss, vollständiger Dammriss, Scheiden-Mastdarmfistel<br />
Verlauf: Spontanheilung selten oder unvollständig; Gefahr von ständiger<br />
Verschmutzung der Vagina mit Kot. Dies führt zu chronischer Vaginitis und<br />
Akonzeption. Ansaugen von Luft: Pneumovagina; Konzeptionshindernis, Unruhe,<br />
Abmagerung.<br />
Therapie:<br />
frische Fälle: sofortige Naht; ältere Fälle (einige Stunden und älter): Abwarten, bis sich<br />
die Ödematisierung und allenfalls die Phlegmone <strong>zur</strong>ückgebildet haben; Naht nach<br />
Auffrischen der Wundränder.<br />
Nahtverfahren:<br />
- kleine Epiduralanästhesie, ev. Sedation nach Fasten, Tamponade des Rektums<br />
- Reinigung von Vulva und Umgebung<br />
- Hilfsnähte zum Spreizen der Vulvalippen<br />
- Wundauffrischung; Mastdarmfisteln sind unter Umständen nur zugänglich, wenn<br />
man sie durch Resektion der noch vorhandenen Gewebsbrücke in einen<br />
vollständigen Dammriss umwandelt<br />
- Naht von cranial nach caudal<br />
- Nahttechnik in Abhängigkeit von der Läsion und dem Zustand des Gewebes<br />
- resorbierbares, atraumatisches Nahtmaterial<br />
- wenn möglich separate einstülpende Naht der Rektumwand<br />
- Naht des Dammgewebes und der Scheidenschleimhaut separat oder in einer Naht,<br />
einzeln oder fortlaufend<br />
- Hautnaht mit nicht resorbierbarem Material<br />
Nachbehandlung: systemische Chemotherapie, bei dicker Kotkonsistenz milde Laxation.<br />
Beschädigungen der Zervix<br />
Oberflächliche Verletzungen werden wegen des raschen Verschlusses des<br />
Zervikalkanals übersehen. Anlässlich von Sterilitätsuntersuchungen stellt man dann<br />
Passagebehinderungen im Zervikalkanal (Verklebungen oder Verwachsungen) oder bei<br />
der rektalen Palpation Verdickungen fest.<br />
Verheerend sind starke Blutungen an der Zervix, weil sie kaum zugänglich und im<br />
derben Gewebe schwer stillbar sind.<br />
Perforierende Verletzungen können weder von der Vagina noch von einer<br />
Flankenwunde aus angegangen werden.<br />
Auch wenn Zervixverletzungen abheilen, können sie ev. eine weitere Trächtigkeit<br />
verunmöglichen (Verschluss der Zervix ungenügend).<br />
Gebärmutterverletzungen<br />
Prädilektonsstellen: Corpus uteri ventral auf Höhe des Schambeinrandes und darunter:<br />
die Muscularis besteht dort nur aus einzelnen Muskelbündeln; zudem ist hier die Wand<br />
besonders exponiert.<br />
Dorsal in der Falte zwischen Zervix und Corpus uteri.<br />
Nur ein Teil der Gebärmutterverletzungen ist bei der vaginalen oder rektalen<br />
Untersuchung zugänglich.<br />
Ursachen: s. allgemeine Ursachen<br />
45
Nicht perforierende Verletzungen<br />
Symptome:<br />
von der Vagina zugängliche Verletzungen:<br />
- aufgeraute Vertiefung in der sonst glatten Mukosa<br />
- ev. spritzende Gefässe oder Sickerblutungen, vor allem im Bereich von<br />
Karunkelstielen<br />
von der Vagina nicht zugängliche Verletzungen:<br />
- keine spezifischen Symptome: Uterusatonie mit leicht- bis mittelgradiger<br />
Allgemeinstörung<br />
- später: Metritis, ev. Perimetritis (s. dort)<br />
Diagnose: bei frischen, von der Vagina zugänglichen Veränderungen manchmal<br />
schwierig, weil man verhindern will, durch intensive manuelle Exploration eine tiefe<br />
Verletzung noch zu perforieren. Bei nicht zugänglichen Verletzungen nur<br />
Verdachtsdiagnose. Prognose quo ad vitam günstig; quo ad conceptionem zweifelhaftgünstig,<br />
je nach Ausdehnung und Tiefe.<br />
Therapie: bei tiefen Verletzungen, besonders bei Blutungen Nahtversuch (Abwägen:<br />
Machbarkeit vs. Gefahr von Verschlimmerungen bei Manipulationen), Tonisierung des<br />
Uterus. Innert Stunden p.p.: 20-30 IE Oxytocin i.m. danach ev. Prostaglandine i.m.;<br />
Antibiotika intrauterin und systemisch<br />
Generelle Bemerkungen zu Chemotherapie bei puerperalen Erkrankungen<br />
Vor jeder Chemotherapie muss man sich über die Prognose im Klaren sein und mit der<br />
Besitzerin darüber reden. Sehr oft ist die Prognose zweifelhaft. Anderseits ist der<br />
Schlachtwert von Tieren mit puerperalen Störungen meistens gering. In vielen Fällen ist<br />
eine massive Chemotherapie für den Erfolg der Behandlung ausschlaggebend.<br />
Die Besitzerin muss sich vor Einleiten einer Chemotherapie entscheiden können, ob<br />
sie die Behandlungskosten und das Risiko eines Totalverlusts (antibiotikahaltiges<br />
Fleisch) in Kauf nehmen will, oder ob sie das Tier lieber schlachten lassen will, um zu<br />
versuchen, das Fleisch zu retten.<br />
Perforierende-Verletzungen<br />
Symptome:<br />
von der Vagina zugängliche Verletzungen: je nach Grösse kleines, übersehbares Loch<br />
oder langer Riss; zusätzlich:<br />
- Serosa mit Fibrinauflagerungen palpierbar<br />
- Peritonäum, Teile von Organen (Pansen, Darmschlingen, palpierbar<br />
- Vorfall von Darmschlingen, Netz in das Uteruslumen<br />
- Plazenta hängt in Bauchhöhle (bei grossen Defekten)<br />
von der Vagina nicht zugängliche:<br />
- Symptome von akuter Peritonitis (s. dort)<br />
- bei Rektalpalpation ev. Auflagerungen auf der Gebärmutter oder Verklebungen<br />
mit Peritonäum oder anderen Organen<br />
- manchmal paralytischer Ileus und leichte Tympanie, ev. Festliegen<br />
Diagnose: klinisch häufig keine eindeutige Diagnose möglich, wenn die Wunde von<br />
vaginal aus nicht palpiert werden kann. Im Zweifelsfall: Bauchhöhlenpunktion oder<br />
sogar Probelaparotomie, -laparoskopie<br />
Differentialdiagnosen: nicht perforierende Verletzung der Gebärmutter,<br />
Darmquetschung oder -ruptur, andere fieberhafte puerperale Erkrankungen,<br />
Hypokalzämie.<br />
46
Prognose: frische Fälle zweifelhaft; übrige ungünstig oder sehr zweifelhaft<br />
Therapie: frische Fälle Nahtversuch von Vagina oder vorzugsweise von<br />
Laparotomiewunde aus. Zusätzliche Gabe von Antibiotika intrauterin und systemisch;<br />
uterustonisierende Medikamente, ev. Blutersatz, ev. Flüssigkeitsersatz.<br />
Beim kleinen Wiederkäuer kommt auch eine Ovario-Hysterektomie in Frage.<br />
Prophylaxe: s. Geburtshilfe; Uterusverletzungen können aber auch bei Spontangeburten<br />
entstehen!<br />
Blutungen p.p.<br />
Symptome: spritzende Blutgefässe oder diffuse Blutung in Wunden der weichen<br />
Geburtswege oder aus teilweise oder vollständig abgerissenen Karunkelstielen. Ausfluss<br />
von frischem Blut oder stark mit frischem Blut vermischten Lochien aus der Vagina.<br />
Ansammlung von Blutkoagula in Scheide oder Uteruslumen. Absetzen von viel<br />
Blutkoagula aus Scheide nach dem Abliegen; bei massiven Blutungen: blasse<br />
Schleimhäute und unpigmentierte Haut (Euter), kühle Körperoberfläche, vor allem an<br />
den Akren, fadenförmiger frequenter Puls, pochender Herzschlag, oberflächliche<br />
Atmung<br />
Diagnose: lokale Befunde (Versuch, die blutende Stelle zu lokalisieren), Anämie,<br />
Blutungsschock.<br />
Differentialdiagnosen: Ansammlung von Blut aus Nabelgefässen, Schock anderer<br />
Ursache<br />
Therapie: Hämostase durch Ligatur von einzelnen Gefässen oder Massenligatur; ev. ist<br />
nur das Abklemmen mit einer Arterienklemme möglich (Arterienklemme einige<br />
Stunden belassen, nachdem sie über langen Nylonfaden an der Aussenhaut angenäht<br />
wurde!).<br />
Auffindbare Sickerblutungen: Betupfen mit stark vasokonstriktivem Medikament (z.B.<br />
aus der Humanmedizin Por-8 ® = Ornipressin); bei unstillbaren Sickerblutungen oder bei<br />
massiven Blutverlusten:.Bluttransfusion mit 3-4 Litern Vollblut oder mehr; ev.<br />
zusätzliche Infusion mit Plasmaexpander und Flüssigkeitsersatz, vorsichtige Gabe Ca ++ -<br />
haltiger Lösungen. Tiere überwachen lassen (plötzliche Verschlechterung des<br />
Allgemeinzustandes möglich)<br />
Beschädigung des Beckengürtels<br />
Es kommen in Frage: Frakturen am Becken oder am Sakrum; Diastase (Luxation) des<br />
Kreuzbein-Darmbeingelenks; Nervenlähmungen<br />
Ursachen: absolut oder relativ zu grosser Foet, vor allem bei zu lange dauernden oder<br />
zu forcierten Extraktionen. Aufstehversuche oder Niederstürzen mit im Becken<br />
eingekeilten Foeten; Niederstürzen von geschwächten Tieren.<br />
Symptome: bei allen Leiden Festliegen mit wenig gestörtem Allgemeinbefinden, ausser<br />
bei starken Schmerzen. Manchmal versuchen solche Tiere aufzustehen oder nehmen gar<br />
vorübergehend eine hundesitzige Haltung ein.<br />
Bei Beckenbruch<br />
- Asymmetrie von aussen oder bei rektaler Palpation; Palpationsschmerz<br />
- zusätzlich Hämatome und Quetschungen an Bruchstelle, ev. erhöhte<br />
Beweglichkeit und Krepitation bei passivem Bewegen.<br />
Bei Diastase<br />
- Dornfortsätze des Sakrums sinken ein<br />
- Promontorium des Kreuzbeins ragt in Beckenhöhle vor; Hämatome (schmerzhaft<br />
gespannte Schwellung bei rektaler Palpation im Bereich der Kreuzbeinflügel)<br />
Nervenlähmungen führen zu Paresen oder Paralysen oder regionalen, meist schwer<br />
nachweisbaren Sensibilitätsausfällen.<br />
47
Sakralnerven<br />
- Lähmung von Harnblase – Überlaufblase, kein Harnabsatz oder Träufeln,<br />
von rektal stark angefüllte Harnblase spürbar<br />
- Rektum: Kotansammlung in der Ampulla recti<br />
- kein oder erschwerter Kotabsatz - herabgesetzter Analreflex<br />
- Schwanzwurzel: Hammelschwanz, Sensibilitätsausfälle perianal und perivaginal<br />
N. obturatorius<br />
- Lähmung der Einwärtszieher der Hintergliedmassen: Vergritten, Froschlage<br />
N. ischiadicus<br />
- Lähmung aller Muskeln distal vom Kniegelenk: Einknicken, Belastung nicht<br />
möglich<br />
N. femoralis<br />
- Lähmung der Extensoren im Kniegelenk: Einknicken im Kniegelenk .<br />
Selten als Geburtsfolge:<br />
N.peronaeus<br />
- Lähmung der Beuger im Tarsalgelenk und der Zehenstrecker: durchgestreckter<br />
Tarsus, Überköten, Belasten auf Fesselkopf, Sensibilitätsausfall dorsal am Fuss<br />
N.tibialis<br />
- Lähmung der Tarsalstrecker und der Zehenbeuger: Einknicken im Tarsus,<br />
Fesselgelenk in Beugehaltung nach vorne, Sensibilitätsausfall plantar am Fuss<br />
Diagnose: genaue klinische Diagnose ist sehr schwer und nur in seltenen Fällen zu<br />
stellen. Sehr oft beschränkt sich beim festliegenden Tier die Diagnose auf "traumatisch<br />
bedingtes Festliegen nach Schwergeburt". Nach mechanischem Aufstellen der Tiere<br />
lässt sich ev. genaueres aussagen: Asymmetrien sind besser erkennbar,<br />
Belastungsausfälle werden sichtbar, Schmerzproben und passive Bewegungen sind<br />
besser ausführbar, rektale Untersuchung ist aufschlussreicher.<br />
Bestimmung der CK-Aktivität zum Ausschluss von Muskelschäden (Cave: steigt bei<br />
längerem Festliegen aber auch an). Kalziumbestimmung im Serum oder Vollblut<br />
(Schnelltest) zum Ausschluss der Hypokalzämie.<br />
Differentialdiagnosen: Hüftgelenksluxation; Fraktur an Gliedmassenknochen;<br />
Muskelzerrungen infolge eines Sturzes bei Aufstehversuchen oder wegen<br />
vorbestehender Schwäche oder Nervenlähmung; hypokalzämisches Festliegen; akute<br />
Klauenrehe; Festliegen anderer Ursachen.<br />
Prognose:<br />
Bei Beckenfraktur je nach Lokalisation Abheilung möglich, jedoch Gefahr von<br />
nachfolgender Schwergeburt.<br />
Bei Diastase im Kreuzbein-Darmbeingelenk: zweifelhaft, Heilung möglich.<br />
Bei Nervenlähmungen: zweifelhaft.<br />
Therapie:<br />
- Medikamentell: Steroide und /oder nicht steroidale Entzündungshemmer<br />
(Phenylbutazon; Flunixin Meglumin; zusätzlich Vitamin B1-Präparate)<br />
Wichtiger sind:<br />
- gute Einstreu und mehrmaliges Wenden pro Tag zum Verhindern von<br />
Dekubitusstellen<br />
- Vergrittgeschirr anlegen<br />
- ab 2., 3. Tag mechanisch Aufstellen (Aufziehbock mit Winden) oder<br />
Improvisationen mit gepolsterten Schenkelfaltenschlingen und Flaschenzug<br />
48
Beschädigung innerer Organe bei der Geburt<br />
Es kommen in Frage: Atonie, Quetschungen, Rupturen der Harnblase;<br />
Urethraquetschungen; Uretherriss; Darmquetschung oder -ruptur<br />
Ursachen: Beschädigung von ins Becken verlagerten Organen oder Teilen davon bei<br />
Geburt in Hinterendlage. Dies geschieht vor allem, wenn der Foet an der liegenden<br />
Mutter ins Becken eingezogen wird oder bei Zug in Wehenpausen (Näheres s.<br />
Geburtshilfe). Ev. auch Schwergeburten in Vorderendlage (Urethraquetschung).<br />
Atonie, Quetschung, Ruptur der Harnblase und Urethraquetschungen<br />
Symptome: werden zu Beginn gerne übersehen, wenn nicht speziell daraufhin<br />
beobachtet wird.<br />
- Passives Abfliessen von Harn, vor allem nach dem Abliegen: Überlaufblase - Harn<br />
kann nicht im Strahl abgesetzt werden<br />
- Pollakisurie<br />
- ev. Blutharnen<br />
- bei rektaler Untersuchung: grosse in die Bauchhöhle herabhängende Blase, ev. nur<br />
als Strang spürbar<br />
- Inappetenz, Milchrückgang, ev. leichte Kolikerscheinungen<br />
- Später: Zystitis (Harnstatus mit Sediment)<br />
- Bei Blasenruptur: Harnträufeln oder kein Harnabsatz; zunehmende Verschlechterung<br />
des Allgemeinzustandes (eine gequetschte Blase kann sekundär<br />
rupturieren)<br />
Diagnose: anhand Anamnese und klinischer Symptome; grosse Harnmengen beim<br />
Kathetrisieren; ev. Harnstoffbestimmung im Serum<br />
bei Zystitis: bakteriologische Harnuntersuchung<br />
Differentialdiagnosen: Harnabflussstörungen infolge Quetschung, Hämatom oder<br />
Phlegmone der Scheide: Kompression auf Urethra oder Verengung des<br />
Scheidenausgangs (Urovagina)<br />
Bei Blutharnen: Beimengung von Lochien zum Harn; puerperale Hämoglobinurie<br />
Bei Zystitis: bakterielle Pyelonephritis infolge Harnstase ante partum<br />
Prognose: je nach Diagnose zweifelhaft<br />
Therapie: häufig genügt einmaliges Kathetrisieren einer zu vollen Blase; nachdem<br />
die damit verbundene Überdehnung der Muscularis überwunden wurde, ist spontanes<br />
Harnabsetzen wieder möglich (gute Beobachtung).<br />
Bei anhaltender Harnabsatzbeschwerde: Einsetzen eines Dauerkatheters (Ballonkatheter)<br />
mit Fixation an Haut neben Vulva. Blasenspülungen mit Betadinelösung 10%;<br />
bei C. renale-Infektion: Penicillin systemisch über 10-14 Tage.<br />
Ruptur des Urethers (sehr selten)<br />
Symptome: sich über mehrere Tage hinziehende und sich verschlimmernde Störung mit<br />
vorerst unspezifischen Symptomen. Bei einseitiger Verletzung keine<br />
Harnabsatzbeschwerden vorhanden. Später: ausgedehnte retroperitoneale, ödematösgespannte<br />
Schwellunq dorsal im Abdomen palpierbar. Harnansammlung in Bauchhöhle<br />
(Punktat, Harnstoffbestinmung)<br />
Prognose: infaust; keine Therapie möglich, meistens Totalverlust wegen Harngeruch<br />
des Fleisches.<br />
Darmquetschung oder -ruptur<br />
Symptome: Darmquetschung: Erscheinungen von Ileus oder Subileus<br />
Darmruptur: akut verlaufende, mit schweren Allgemeinstörungen (Peritonitis, Toxämie),<br />
Festliegen und Ileus einhergehende Erkrankung<br />
(Näheres: s. Vorlesung Digestionskrankheiten)<br />
49
Diagnose: Anamnese, klinisches Bild; rektale Untersuchung: ev. sind gequetschte oder<br />
mit der Bauchwand verklebte Darmteile palpierbar. Bauchhöhlenpunktion. Bei Verdacht<br />
und operablem Zustand des Tieres: Probelaparotomie<br />
Differentialdiagnosen: Uterusruptur; Blasenquetschung oder -ruptur; Schockzustand p.p.<br />
anderer Ursache.<br />
Prognose: Darmquetschung: zweifelhaft; Darmrupturen: ungünstig; sofortige<br />
Notschlachtung!<br />
Therapie: leichte Fälle: Spasmolytika, nichtsteroidale Entzündungshemmer, salinische<br />
Abführmittel; im Zweifelsfall: Probelaparotomie und Darmresektion.<br />
Presswehen post partum<br />
Starke Presswehen unmittelbar nach der Geburt, ev. auch einige Tage darüber hinaus.<br />
Die normalen Nachgeburtswehen werden normalerweise bis zum Abgang der<br />
Nachgeburt von der Bauchpresse unterstützt; bzgl. Frequenz und Intensität<br />
unterscheiden sie sich aber deutlich von den hier zu besprechenden pathologischen<br />
Presswehen p.p.<br />
Ursachen: Verletzungen der weichen Geburtswege, vor allem der Zervix oder des<br />
Rektums; übermässige Erschlaffung der weichen Geburtswege, die schon ante partum<br />
bestanden haben (Prolapsus vaginae a.p.); Hämatome und phlegmonöse Schwellungen<br />
perivaginal oder an den Ligamenta lata uteri; Pneumovagina; Tieflagerung der<br />
Hinterpartie zusätzlich <strong>zur</strong> Erschlaffung der Beckenbänder und des Scheidengewebes;<br />
unsachgemässe Untersuchung oder Behandlung der weichen Geburtswege (grober<br />
Ablösungsversuch von Nachgeburt, reizende Medikamente usw.)<br />
Symptome: aufgekrümmter Rücken, anhaltendes Drängen unterbrochen durch kurze<br />
Pausen, Anus und / oder Vulva leicht ausgestülpt; in den Pausen kommt es zum Ansaugen<br />
von Luft in die Vagina, wodurch der Reiz noch verstärkt wird. Stöhnen, Inappetenz,<br />
Milchrückgang. Später Ermattung, puerperale Infektionen als Komplikation<br />
Diagnose: Abklären der Ursache unter Epiduralanästhesie<br />
Prognose: zweifelhaft; eine lokale Behandlung von Verletzungen führt kurz- und<br />
mittelfristig eher zu einer Verstärkung des Reizes. Ungünstig bei anhaltendem Drängen<br />
ohne ersichtlichen Grund trotz palliativer Massnahmen. Ungünstig bei grossen<br />
Hämatomen in den Gebärmutterbändern.<br />
Therapie: Analgetika, z.B. Metamizol (Novaminsulfon); ev. Sedativa, z.B. Xylazin, ev.<br />
Epiduralanästhesie bis zum Abklingen des Reizes wiederholen; Antiphlogistika<br />
systemisch, je nach Ursache. Herstellen eines Pneumoperitonäums durch Einpumpen von<br />
Luft nach Punktion in der rechten Bauchwand (Sekretsaugpumpe).<br />
Zur Vermeidung eine Prolapsus uteri: Scheidenverschluss (zusätzlicher Reiz?).<br />
Vorfallgeschirr, wirkt vor allem durch Brustzwang. Anlegen eines straff angezogenen<br />
Seils um den Thorax (Brustzwang); Hochlagerung der Hinterpartie bei festliegenden<br />
Tieren!<br />
Inversio et Prolapsus uteri<br />
Inversio uteri: Einstülpung des trächtig gewesenen Hornes kurz nach der Geburt.<br />
Inversio et Prolapsus uteri: Einstülpung des trächtig gewesenen Hornes gefolgt von<br />
Ausstülpung nach aussen durch die noch erschlaffte Zervix.<br />
Ursachen: Uterusatonie (s. dort); fehlender Verschluss infolge Erschlaffung der Zervix<br />
Erschlaffung der Beckenbänder: Verlagerung von Bauchinhalt in Beckenhöhle am<br />
liegenden Tier; Erschlaffung von Vagina und perivaginalem Gewebe. Vorbestehender<br />
Prolapsus vaginae ante partum; Tieflagerung der Hinterpartie.<br />
Auslösende Faktoren<br />
50
- starke Presswehen p.p. (s oben)<br />
- Saugwirkung durch Föten bei Extraktion unter engen, weichen Geburtswegen<br />
- Zugwirkung durch teilweise heraushängende Nachgeburt<br />
Inversio uteri<br />
Beim Rind selten diagnostiziert. Man unterscheidet:<br />
- Inversio innerhalb des Uterus<br />
- Inversio mit teilweisem Durchtritt durch den Zervikalkanal<br />
Symptome: Inappetenz, gestörte Rumination, ungenügende Milchleistung; subfebrile<br />
Körpertemperatur, Tachykardie. Deutlichere Allgemeinstörungen bei Peritonitis oder<br />
Toxämie. Inversio innerhalb des Uterus: bei durchgängiger Zervix ist der umgestülpte<br />
Teil des Gebärmutterhorns ev. zu palpieren, andernfalls ist bei der rektalen<br />
Untersuchung ein Wulst spürbar; ev. fibrinöse Auflagerungen auf der Serosa.<br />
Bei teilweiser Ausstülpung durch die Zervix: Wulst bei der vaginalen Untersuchung<br />
erkennbar. Nach Strangulation: Uterus gestaut, ödematös, ev. nekrotisch.<br />
Prognose: Bei Inversio innerhalb des Uterus Spontanheilung im Rahmen der Involution<br />
möglich. Erhöhte Gefahr von Metritis / Perimetritis, ev. auch Peritonitis und Toxämie.<br />
Prognose: Bei teilweiser Ausstülpung in die Zervix: zweifelhaft.<br />
Therapie: in frischen Fällen und sofern der umgestülpte Teil noch erreichbar ist<br />
manuelle Reversion; Vorsicht bei Verklebungen! Beschrieben wird auch die<br />
Massenligatur von in die Vagina ausgestülpten, prolabierten Teilen, die nicht<br />
reponierbar sind. Chemotherapie: lokal und systemisch<br />
Inversio et Prolapsus uteri<br />
Bei der Ausstülpung der Gebärmutter (häufig nur des trächtig gewesenen Horns) kommt<br />
es <strong>zur</strong> Kompression der Gefässe in den Gebärmutterbändern, die von der Verlagerung<br />
ebenfalls betroffen sind. Folgen:<br />
- Stauung und Ödematisierung der Gebärmutterwand, später Infarzierung und<br />
Nekrose<br />
- Zirkulationsstörungen bis zum Schock infolge Sequestrierung grosser Blutmengen<br />
Symptome: ausgestülpter, mit Mukosa bedeckter Uterus hängt aus der Vulvaöffnung<br />
hervor; Karunkeln sichtbar, meistens haften die Eihäute noch. Grösse, Farbe und<br />
Konsistenz des Organs richten sich nach<br />
- Zeitspanne zwischen Geburt und Prolaps<br />
- Dauer des Prolaps<br />
Bedingt durch die Stauung wird der Uterus dunkelrot bis blau, angeschwollen, teigig<br />
weich; später dunkelblau bis schwarz, brüchig. Vermehrtes Pressen, Tachykardie,<br />
manchmal Festliegen; später Schocksymptome und Anzeichen von Toxämie.<br />
Prognose: ohne Therapie Tod innerhalb von Stunden. Bei rascher Reposition in der<br />
Regel günstig; plötzlicher Tod nach anscheinend normalem Verlauf kommt vor: innere<br />
Blutung; Schock nach Aufhebung der Stauung; Hypothermie.<br />
Gefahr von Rezidiven, besonders bei<br />
- sehr starker Erschlaffung der Gebärmutter<br />
- schlechter Hochlagerung des Beckens<br />
- unvollständiger Reversion<br />
- anhaltend starken Presswehen (s. oben)<br />
Prognose bei Komplikation durch Hypokalzämie: zweifelhaft bis günstig<br />
Prognose bei verschleppten Fällen (Stunden nach Prolaps): zweifelhaft bis ungünstig,<br />
Tod durch Schock oder / und Toxämie<br />
Therapie: Notfall-Massnahmen der Tierhalterin vor Eintreffen der Tierärztin: Schutz des<br />
Uterus vor Verschmutzungen und Verletzungen<br />
- am liegenden Tier: Uterus in sauberes Tuch einwickeln, Schutz vor Nachbartieren<br />
51
- am stehenden Tier: Anheben der Gebärmutter mit sauberem Tuch durch zwei<br />
Personen mit Brett oder etwas Ähnlichem<br />
Nach Ankunft im Stall: ruhiges, rasches, überlegtes Vorgehen; klare Anweisungen<br />
- kurze Untersuchung <strong>zur</strong> Beurteilung des Allgemeinbefindens, ev. Therapie<br />
einleiten: Kalziuminfusion, Schocktherapie<br />
- Untersuchung der Gebärmutter und Entscheid über weiteres Vorgehen: Reposition:<br />
bei einigermassen gutem Allgemeinzustand des Tieres und nicht stark geschädigter<br />
Uteruswand (dies ist unter den bei uns herrschenden Praxisbedingungen der<br />
Normalfall). Notschlachtung: bei schwerem Schockzustand oder anderen schweren<br />
Allgemeinstörungen.<br />
Bei ausgedehnten Zusammenhangstrennungen der Gebärmutter oder wenn wegen<br />
starker Stauung und Brüchigkeit des Gewebes eine Reposition nicht mehr möglich<br />
ist kann grundsätzlich der Uterus amputiert werden. Dies ist aber beim Rind nicht<br />
zu empfehlen, allenfalls beim kleinen Wiederkäuer und Schwein (Überleben der<br />
Jungen).<br />
Reposition am liegenden Tier<br />
- hohe Epiduralanästhesie; Kuh in Hasenlage verbringen und Becken hochlagern<br />
(Strohballen)<br />
- versuchen, die Nachgeburt abzulösen; dies sollte zügig und ohne zu grosse<br />
Blutungen gehen. Belassen der Nachgeburt ist kein entscheidender Nachteil,<br />
Rezidiv- und Infektionsgefahr sind aber erhöht.<br />
- gründliche Reinigung des Uterus und der Umgebung; Spülung mit lauwarmer,<br />
antiseptischer Lösung, z.B. Povidone-Iodlösung (z.Bsp. Betadine ® ) 5-10%<br />
- wenn nötig: Naht von perforierenden oder tiefen Wunden, Serosa auf Serosa,<br />
resorbierbares Nahtmaterial<br />
- ev. Bandagieren von des Uterus von der Hornspitze gegen den Körper mit breiter<br />
Leinenbinde, um die Blutstauung teilweise rückgängig zu machen<br />
- ev. Oxytocin i.m. <strong>zur</strong> Tonisierung der Gebärmutter (Vorteil?)<br />
- hochhebenlassen der Gebärmutter auf Vulvahöhe durch zwei Hilfspersonen, die<br />
sich die Hände geben oder Brett; Reposition der Gebärmutter, beginnend an<br />
Umschlagstelle bis <strong>zur</strong> Zervix, dann vom Zentrum her mit geballten Fäusten, unter<br />
Vermeidung von Verletzungen; nach Durchtritt durch Zervikalkanal vollständige<br />
Behebung der Inversion überprüfen.<br />
Vorteile: gute Ruhigstellung des Tieres und zuverlässige Ausschaltung der Presswehen,<br />
dadurch leichte Reposition.<br />
Nachteile: erhöhte Gefahr von Verlagerung von Harnblase oder Darmschlingen in den<br />
Beckenraum oder ins vorgefallene Organ. Grosser Aufwand an Zeit und Kraft!<br />
Reposition am stehenden Tier<br />
- kleine Epiduralanästhesie<br />
- weitere Schritte bis <strong>zur</strong> eigentlichen Reposition wie bei Arbeit am liegenden Tier,<br />
jedoch muss die Gebärmutter von Hilfspersonen immer leicht angehoben werden<br />
(Rupturgefahr)<br />
- Gebärmutter durch zwei Hilfspersonen mit von Tuch bedecktem Brett auf<br />
Vulvahöhe anheben lassen und dann wie beschrieben reponieren.<br />
Vorteile: normaler Situs der Organe<br />
Nachteile: beim Durchstossen der Gebärmutter durch Zervix beginnen die Tiere<br />
manchmal stark zu pressen und liegen ab, wodurch die Reposition verunmöglicht wird.<br />
Aus diesem Grund ziehen wir die Reposition am liegenden Tier vor.<br />
Nachbehandlung: Versorgung des Gebärmutterlumens mit Antiseptika, z.B. Polyvidon-<br />
Iod (z.Bsp. Vetisept ® -Obletten) oder Antibiotika (Tetrazykline)<br />
52
ei liegenden Tieren: Hochlagerung der Hinterpartie; Scheidenverschluss (Flessa oder<br />
Bühnerband). Es wird beschrieben, mit dem Beginn der Verabreichung von<br />
Chemotherapeutika 12-18 Stunden zuzuwarten (Möglichkeit der Schlachtung bei<br />
Verschlechterung des Allgemeinzustandes). Nach Absprache mit der Besitzerin<br />
empfehlen wir aber eine sofortige lokale und systemische Gabe von Antibiotika oder<br />
Chemotherapeutika.<br />
Komplikationen bei der Reposition:<br />
- Verlagerung von Darmschlingen oder der gefüllten Harnblase mit der Gebärmutter,<br />
letztere kann allenfalls durch die Gebärmutterwand hindurch punktiert werden. Es<br />
besteht die Gefahr, dass diese Organe bei der Reposition zusätzlich beschädigt<br />
werden.<br />
- Hämatome in der Uteruswand oder in den Ligamenta lata uteri: nicht<br />
beeinflussbare Rezidivgefahr.<br />
Für die Behandlung von Rezidiven geht man gleich vor, wie bei der Erstbehandlung.<br />
Zur Verhinderung von weiteren Rezidiven wird empfohlen, ein aufgerolltes Tuch in die<br />
Scheide einzulegen, bevor man den Scheidenverschluss anbringt; auch eine<br />
Tabaksbeutelnaht an der Zervix wurde beschrieben. Beide Massnahmen sind<br />
problematisch, da durch sie der Pressreiz verstärkt wird.<br />
(Amputation: Näheres: s. Spezialliteratur)<br />
Prophylaxe: gefährdete Tiere nicht mehr <strong>zur</strong> Zucht verwenden; Tiere nach Geburt sofort<br />
zum Aufstehen zwingen: Entlastung der Bauchhöhle verminderte Effizienz der<br />
Bauchpresse; Vorfallgeschirr; Epiduralanästhesie und Flessaverschluss oder<br />
Bühnerband; Sedativa und/oder Analgetika (s. auch Kapitel über Presswehen)<br />
Verlagerungen der Harnblase<br />
Verlagerungen der Harnblase sind möglich durch perforierende Scheidenwunden oder<br />
die Harnblase wird durch die Urethramündung ausgestülpt (Inversion und Prolaps).<br />
In beiden Fällen sind Verlagerungen <strong>zur</strong> Zervix hin oder nach aussen möglich.<br />
Verlagerung durch Scheidenwunde<br />
Symptome: Harnabsatzbeschwerden, Harnträufeln oder Harnverhalten. Bei vaginaler<br />
Untersuchung ist die Blase als fluktuierendes Gebilde erkennbar. Ev. Harnabsatz bei<br />
Palpation. Die Blasenwand kann stark verändert sein: entzündliche Reaktionen und<br />
Auflagerungen, Stauung oder Infarzierung; erschwerend kommt die perforierende<br />
Scheidenwunde dazu.<br />
Prognose: in frischen Fällen zweifelhaft bis günstig, Gefahr von Zystitis. In<br />
verschleppten Fällen zweifelhaft. Reposition und Naht sind wegen Verklebungen oder<br />
Verwachsungen der Harnblase im Wundgebiet ev. nicht möglich.<br />
Therapie: kleine Epiduralanästhesie; Entleerung der Harnblase mit Katheter oder durch<br />
Punktion, Reposition der Harnblase und Scheidennaht. Überwachung, da Zystitisgefahr.<br />
Vorfall mit Inversion<br />
Ursachen: analog Prolapsus uteri.<br />
Symptome: je nach Stadium: unmittelbar p.p. faustgrosse, hellrot bis gelbe, schlaffe,<br />
vorgefallene Blase in Scheide oder Vulvaöffnung sichtbar. Harnträufeln aus der<br />
Urethramündung. Häufig werden die Kühe erst einige Tage p.p. vorgestellt: Inappetenz,<br />
ungenügende Milchleistung, subfebrile Körpertemperatur. Die Blase ist dann als<br />
faustgrosses, prall-derbes, dunkelrot bis schwarzes Gebilde mit glasig ödematöser,<br />
weicher Oberfläche palpier- und sichtbar. Harnträufeln aus der Urethramündung.<br />
Diagnose: einfach bei genauer Untersuchung und Interpretation der Befunde.<br />
Differentialdiagnosen: Harnblasenvorfall ohne Inversion; perforierende Scheidenwunde<br />
mit retrovaginalem Fettgewebsvorfall; partielle Retentio secundinarum.<br />
53
Prognose: zweifelhaft bis günstig. Reposition gelingt meistens; Gefahr von Rupturen<br />
bei starker Infarzierung. Rezidiv- und Zystitisgefahr.<br />
Therapie: Reposition am stehenden Tier<br />
- kleine Epiduralanästhesie<br />
- ev. Auflegen von reichlich Zucker zum Entzug von Ödemflüssigkeit<br />
- Bandagierung von Spitze gegen Urethra <strong>zur</strong> Verminderung der Blutstauung, analog<br />
Prolapsus uteri<br />
- manuelle Reposition<br />
- Tabaksbeutelnaht um Urethramündung nach vorherigem Einlegen eines Katheters<br />
in die Urethra. Entfernen nach einigen Tagen<br />
- Blasenspülungen mit milden Desinfektionslösungen, z.B. Povidone-Iodlösung<br />
(Betadine ® ) 5-10%<br />
Amputation der Apex vesicae urinariae wird beschrieben.<br />
Prolapsus ani<br />
Beim Rind kommt es infolge von Schwergeburten etwa zu Quetschungen des Rektums<br />
und nachfolgendem Absetzen von Kot mit Beimengungen von frischem Blut, manchmal<br />
begleitet von Tenesmus. Prolapsus ani kommt als Geburtsfolgestörung beim Rind nur<br />
selten, bei Stute und Mutterschwein etwas häufiger vor.<br />
Therapie: Reposition unter Epiduralanästhesie, ev. Tabaksbeutelnaht.<br />
Entzündungshemmende und schmerzmildernde Therapie.<br />
Atonia uteri<br />
Die primäre Volumenverminderung nach der Geburt durch Kontraktion der glatten<br />
Muskulatur und elastischen Fasern findet nur unvollständig oder überhaupt nicht statt.<br />
Häufig in Verbindung mit Zurückbleiben der Nachgeburt.<br />
Ursachen: Überdehnung der Gebärmutterwand: Mehrlingsgeburten, Eihautwassersucht,<br />
starke Ödematisierung. Schädigung der Gebärmutter: nach Torsio uteri, nach<br />
Schwergeburten und verschleppten Geburten, nach Foetotomie, durch Infektionen<br />
(Aborte).<br />
Gebärparese, Fettmobilisationssyndrom, Toxämie infolge Infektion, z.B. Mastitis<br />
sekundär infolge von Sekretrückstau (Scheidenschwellung) oder Rückfluss von Harn<br />
bei geöffneter Zervix (Urovagina). Mögliche Folgen: die Nachgeburt wird nicht<br />
ausgestossen. Nach Inversio, ev. Inversio et Prolapsus uteri.<br />
Beim Rückstau von Lochien: Besiedelung mit Fäulniserregern oder anderen pathogenen<br />
Keimen: Saprämie, Toxämie (Circulus viciosus), Endometritis.<br />
Symptome: Störung des Allgemeinzustandes je nach Stadium und eingetretenen<br />
Komplikationen.<br />
Vaginale Untersuchung: Zervikalkanal teilweise geöffnet, Zervixöffnung nach cranioventral<br />
verzogen, ev. klarer Zervikalschleim sichtbar. Rektale Untersuchung: der Uterus<br />
ist schlaff, hängt über den Beckenrand in die Bauchhöhle als schlaffer Sack, nach vorne<br />
nicht abgrenzbar. Die Wand ist dünn, ohne Längsfaltenbildung (nicht tonisiert).<br />
Prognose abhängig von der Ursache<br />
- bei Hypokalzämie: ziemlich günstig<br />
- übrige Ursachen: zweifelhaft bis günstig; wenn es gelingt, grössere<br />
Flüssigkeitsmengen aus dem Lumen abzuhebern, tritt meistens eine Tonisierung<br />
ein und die Allgemeinstörungen verschwinden.<br />
Therapie:<br />
54
- Kalziuminfusionen nützen manchmal auch, wenn keine klinischen Anzeichen von<br />
Hypokalzämie sichtbar sind. Dosierung nach Wirkung (Gefahr von Nebenwirkungen<br />
erhöht)<br />
- wiederholte Gabe von Prostaglandinen i.m.<br />
- Abhebern des Gebärmutterinhalts mit relativ weitlumigem, dickwandigem<br />
Schlauch (z.B. Nasenschlundsonde für Fohlen): Einführen des Schlauchs durch die<br />
Zervix unter manueller Kontrolle, den Schlauch mit Desinfektionslösung, z.B.<br />
Povidone-Iodlösung (Betadine ® ) 5-10% füllen und rasch umkippen, so dass das<br />
äussere Ende des Schlauchs tiefer liegt als das innere. Cave Perforationsgefahr<br />
des dünnwandigen Uterus!<br />
- Einlegen von Antibiotikaobletten ins Gebärmutterlumen (s. puerperale<br />
Infektionen); bei Toxämie auch systemische Antibiotika und Flunixin Meglumin<br />
(Finadyne ® )<br />
Retentio placentae<br />
Synonym: Retentio secundinarum<br />
Das Zurückbleiben der Nachgeburt, die Nachgeburtsverhaltung, das<br />
Nachgeburtsverhalten.<br />
Normaler Abgang bei Rind und kleinen Wiederkäuern: 3-8 Stunden p.p.; pathologisch ><br />
10 Stunden p.p.<br />
Normaler Abgang beim Schwein: z.T. während der Austreibungsphase, spätestens bis<br />
4 Stunden nach Abgang des letzten Ferkels.<br />
Normaler Abgang bei der Stute: 1/2 bis 3 Stunden p.p.; pathologisch > 6 Stunden.<br />
Beim Abgang der Nachgeburt spielen zwei, sich zeitlich überschneidende<br />
Mechanismen eine Rolle: Ablösung und Ausstossung. Beide können einzeln oder<br />
gemeinsam gestört sein.<br />
Normaler Ablösungsvorgang beim Rind<br />
Zustand während der Trächtigkeit:<br />
Allantochorium des Foeten haftet mit Zotten, die ihrerseits Verästelungen aufweisen, in<br />
den Krypten der Karunkeln. Histologisch: epithelio-choriale Plazentation. Plazenta<br />
maternalis: Gefässe, Bindegewebe, kubisches Epithel auf Basalmembran. Plazenta<br />
foetalis: Epithel, z.T. aus zweikernigen Riesenzellen bestehend, Bindegewebe, Gefässe.<br />
Die Epithelzellen des mütterlichen und foetalen Gewebes sind an ihrer Kontaktstelle<br />
durch Mikrovilli ineinander verzahnt.<br />
Veränderungen treten kurz vor, während und nach der Geburt auf: Die Karunkeln<br />
werden mit zunehmender Trächtigkeit kollagenisiert; die Gefässwände hyalinisiert; die<br />
Gefässlumina zunehmend obliteriert. Abflachung und Atrophie des mütterlichen<br />
Epithels, vermehrte Fetteinlagerung in Epithelzellen. Vermutlich enzymatische Lösung<br />
der vormals festen Verbindung zwischen den beiden Epithelschichten.<br />
Trophoplastenzellen enthalten zum Teil Einschlusskörper (Blutpigment). Unter der<br />
Geburt Lockerung des Chorionepithels in den maternalen Krypten; durch die Wehen<br />
Abflachung der Plazentome, deren Bindegewebe hormonell aufgelockert wurde.<br />
Verhältnisse unmittelbar nach Abgang der Nachgeburt:<br />
Karunkeln: Krypten teilweise sichtbar, teilweise kollabiert, teilweise Resten von<br />
Chorionzotten enthaltend. Histologisch: kubisch-squamöses Epithel teilweise erhalten,<br />
teilweise nackte Basalmembran.<br />
Kotyledonen: gut erhaltene Zotten; nie haftet mütterliches Gewebe daran. Im<br />
Elektronenmikroskop sind die Mikrovilli als Bürstensaum erkennbar. Karunkeln<br />
Stunden nach Abgang der Nachgeburt: Ablösung der restlichen Epithelzellen von der<br />
Basalmembran. Später: Involution der Krypten, Nekrose und Desquamation der<br />
55
abgerissenen Chorionzotten. Weiterer Abbau der Karunkeln durch zunehmende<br />
Hyalisierung der Gefässe und Fibrosierung des Gewebes von der Peripherie gegen den<br />
Karunkelstiel hin. Der Ablösungsvorgang beginnt somit normalerweise schon ante<br />
partum durch Kollagenisierung des plazentären Bindegewebes verbunden mit<br />
Hyalinisierung der Gefässwände zunehmend von Peripherie gegen Karunkelstiel.<br />
Teilweise Lösung der Zotten aus den Krypten am Rande der Karunkeln.<br />
Zusätzlich wirken hämodynamische und mechanische Vorgänge unterstützend.<br />
Hämodynamisch: Abnahme des Gewebeturgors im foetalen Teil durch Entleerung der<br />
Gefässe nach Ruptur der Nabelschnur. Mechanisch: Kompression und Auffächerung<br />
der Karunkeln in der Eröffnungs- und Austreibungsphase der Geburt und während der<br />
Nachwehen; Zuggewicht der teilweise heraushängenden Eihäute.<br />
Die Steuerung dieser Vorgänge durch das Zusammenspiel verschiedener Hormone<br />
(Östrogen, Progesteron, Prostaglandine, Oxytocin) ist sehr kompliziert und kann auf<br />
verschiedenen Stufen und über verschiedene Mechanismen gestört sein.<br />
Ursachen der Retentio placentae<br />
Normal ablaufender Ablösungsvorgang, gestörte Austreibung: selten<br />
Ursachen:<br />
- Atonie des Uterus (s. vorne)<br />
- zu früher Verschluss des Zervikalkanales<br />
- Hängenbleiben der Nachgeburt an Karunkelstiel<br />
- Scheiden- oder Zervixspangen<br />
Viel häufiger ist der Ablösungsvorgang gestört;.<br />
Histologisch findet man verschiedene Muster an den Plazentomen bei Kühen mit<br />
Ret.plac.:<br />
- Nekrose zwischen Chorionzotten und Kryptenwänden neben gesunden Zotten und<br />
solchen, die schon in Mazeration begriffen sind. Solche Veränderungen findet man<br />
häufig nach Normalgeburten. Allergische Reaktion?<br />
- Plazentome bleiben über Tage nach Abgang des Foeten frisch, d.h. ohne<br />
beginnende Ablösungsvorgänge. Häufig bei Aborten.<br />
- Gefässproliferation von maternaler und / oder foetaler Seite, a.p. entstanden:<br />
selten, ev. Zeichen von Entzündung.<br />
- Blutfülle der foetalen Gefässe, Proliferation des mütterlichen Gewebes: nach<br />
Absterben des Foeten im Mutterleib und nach verschleppten Geburten<br />
- Zottenoedem, 24 Stunden p.p. nach vorerst normalem Beginn des<br />
Ablösungsvorgangs. Zotten sehr brüchig.<br />
- Infektiöse Plazentitis: primär nur bei Aborten (z.B. B. abortus) bei<br />
Normalgeburten nur als sekundäres Phänomen.<br />
Häufig ist im Einzelfall die Ursache der Retentio secundinarum nicht erklärbar.<br />
Verschiedene Faktoren können für das Zurückbleiben der Nachgeburt verantwortlich<br />
sein, wobei auch für die unten genannten Ursachen die Pathogenese im einzelnen unklar<br />
bleibt. Die Frage nach den Ursachen ist vor allem bei bestandesweise gehäuftem<br />
Auftreten von Retentio placentae von Bedeutung. Es können mehrere Faktoren<br />
zusammenspielen. Sowohl für den Einzelfall als teilweise auch bei bestandesweise<br />
gehäuftem Auftreten kommen folgende Ursachen in Frage:<br />
- verkürzte (< 273 Tage) oder verlängerte (> 285 Tage) Trächtigkeitsdauer<br />
(genetische Einflüsse von Muttertier und Stier, Phythohormone?, Lichteinwirkung?,<br />
iatrogene Einflüsse)<br />
- medikamentelle Geburtsinduktion, unabhängig davon, ob mit Kortikoiden<br />
oder Prostaglandinen vorgenommen<br />
- allergische Störungen, z.B. nach Dasselbehandlung<br />
56
- Fütterungsfehler: Energie- und Proteinmangel z.B. bei Unterernährung bei<br />
extensiver Haltung<br />
- Mineralstoffmangel, z.B. Phosphormangel<br />
- Mangel an Spurenelementen und Vitaminen, z.B. Selen / Vit. E.<br />
- Energieüberschuss in der Trockenzeit: Fettmobilisationssyndrom p.p.<br />
- Überdehnung des Uterus: Zwillings- oder Mehrlingsträchtigkeit<br />
Eihautwassersucht (verschiedene Pathogenesen)<br />
- unnatürliche Haltung der Muttertiere, z.B. Trennen der Kälber von Muttertier<br />
beim Hausbüffel<br />
- Erschöpfung der Muttertiere durch lange Transporte<br />
- Schwergeburten (verschiedene Pathogenesen)<br />
- gleichzeitig bestehende, andere Erkrankungen, z.B. Mastitis, Fettmobilisationssyndrom<br />
usw.<br />
Verlauf<br />
Häufig bakterielle Besiedelung innerhalb von 12 Stunden p.p. (teilweise offener<br />
Zervikalkanal, Dochtwirkung der heraushängenden Eihäute, Geburtshilfe).<br />
Demarkation unter Aufbau eines Abwehrwalls mit Einwanderung von Leukozyten:<br />
an Karunkeloberfläche (Höhe der Zottenkuppen): Dauer 3-6 Tage; in Mitte der<br />
Karunkel oder am Karunkelstiel: Dauer 1-2 Wochen.<br />
Nach der Demarkation wird die Plazenta als Ganzes oder in einzelnen Stücken ev. auch<br />
als Lochialflüssigkeit mit einzelnen Gewebsfetzen abgestossen.<br />
Klinische Erscheinungen und Behandlung<br />
Symptome:<br />
nach normaler Zeit ist die Nachgeburt nicht oder nur teilweise abgegangen.<br />
Zersetzungsgrad (Farbe, Reissfestigkeit, Geruch) je nach<br />
- Dauer seit Geburt<br />
- Ursache der Retention<br />
- vorangegangenen Untersuchungen und Manipulationen<br />
- Länge des heraushängenden Stücks (Dochtwirkung)<br />
- Sauberkeit von Kuh und Stall<br />
- Umgebungstemperatur<br />
Innere Untersuchung: die an den Karunkeln haftenden Eihautteile sind leicht zu<br />
erkennen, ebenso die freien Karunkeln anhand ihrer wabenartig-höckerigen Oberfläche.<br />
Immer beide Hornmündungen aufsuchen und Schleimhaut und Wanddicke der<br />
Gebärmutter beurteilen.<br />
Diagnose:<br />
meistens eindeutig; <strong>zur</strong> Diagnose gehört auch eine Aussage über vorhandene<br />
Komplikationen und das allfällige Vorhandensein von zusätzlichen Leiden. Unklar: bei<br />
partieller auf Hornspitze beschränkter Ret.plac. bei Weide- und Laufstallhaltung (ev.<br />
Plazentophagie) bei Aufstallung mit Schwemmentmistung und Gitterrost bei<br />
Verschleppen der Plazenta durch den Hund.<br />
Differentialdiagnose: zweiter oder dritter Foet (vor allem bei Abort und<br />
Eihautwassersucht)<br />
Prognose:<br />
ohne Therapie: zweifelhaft, Selbstheilung möglich<br />
nach Therapie: quo ad vitam günstig (Ausnahmen); quo ad conceptionem: zweifelhaftgünstig,<br />
häufig verlängerte Zwischenkalbezeit<br />
Therapie:<br />
die Ansichten über die Therapie sind weltweit ziemlich unterschiedlich und haben im<br />
Laufe der letzten Jahrzehnte verschiedene Wandlungen durchgemacht. Wir befürworten:<br />
57
- einen Ablösungsversuch innerhalb von 24 Stunden p.p. wenn bis nach 10<br />
Stunden die Nachgeburt nicht spontan abgegangen ist.<br />
- Lokale Behandlung mit Antibiotika; wenn nötig systemische<br />
Antibiotikabehandlung und Therapie der zusätzlichen Leiden.<br />
- Nachbehandlung am übernächsten Tag in allen Fällen, bei denen die Nachgeburt<br />
nur teilweise öder überhaupt nicht gelöst werden konnte. Bei unbefriedigendem<br />
Verlauf: weitere Nachbehandlungen.<br />
- Untersuchung und Behandlung nach Abgang der demarkierten Nachgeburt,<br />
gemäss Meldung der Tierhalterin.<br />
- Für alle Tiere nach Ret.plac.: Kontrolle auf Endometritis und Funktion der<br />
Ovarien 3-4 Wochen p.p.; wenn nötig Behandlung.<br />
Früher Ablösungsversuch:<br />
pro:<br />
- genaue Diagnose (mechanische Ursache, zweiter Foet, Verletzungen der weichen<br />
Geburtswege), solange Zervikalkanal noch passierbar<br />
- Wegschaffen von abgestorbenem Gewebe und Sekreten, welche als Nährboden<br />
und Eintrittspforte (Dochtwirkung) von Infektionen wirken<br />
- Verminderung der Gefahr von Prolapsus uteri<br />
- Beseitigen einer Behinderung für das Muttertier<br />
- Stallhygiene<br />
contra:<br />
- Einschleppen von Infektionen<br />
- Störung der natürlichen Demarkation und lokalen Abwehr<br />
- im frühen Stadium ist unter Umständen nicht das ganze trächtig gewesene<br />
Horn abtastbar<br />
- bei jeder manuellen Abnahme bleiben foetale Teile <strong>zur</strong>ück<br />
Technik bei Ablösungsversuch: Vorbereitung der Kuh und der Tierärztin wie vor<br />
Geburtshilfe. Bei Abwehr, insbesondere starkem Pressen: kleine Epiduralanästhesie.<br />
Lange Handschuhe aus Plastik oder Gummi (Abort). Heraushängende Teile der<br />
Eihäute ohne Zug zu einem Strang drehen (bessere Orientierung im Uterus).<br />
Ablösungsversuch an verschiedenen Karunkeln: Fixation der Karunkel mit Zeig- und<br />
Mittelfinger, Abstreifen der Kotyledo mit dem Daumen. Sämtliche leicht ablösbare<br />
Kotyledonen, wenn möglich alle, ablösen. Häufiges Wechseln der Arme vermeiden.<br />
Nicht ablösbare Eihäute auf Höhe der Vulvaöffnung abschneiden, lokale<br />
Antibiotikabehandlung in Form von Uterusobletten mit breitwirkendem Antibiotikum.<br />
z.B. Tetracycline: l g / Oblette, davon 2-4 Obletten je nach Fall. Alternative:<br />
Polyvinylpyrrolidon-Jod mit 100 mg Jod pro Oblette, davon 2-3 Obletten<br />
Daneben gibt es Obletten, die sich unter Schaumbildung auflösen: bessere Verteilung im<br />
Uteruslumen, leicht tonisierende Wirkung auf Uteruswand.<br />
Nachbehandlung nach 2 Tagen: gleiches Vorgehen wie bei Ablösungsversuch, ohne<br />
lange Manipulationen. Wiederholung der lokalen Antibiotikabehandlung.<br />
Vorteile<br />
- Überprüfen des Behandlungserfolgs<br />
- Überprüfen der Involution und des Allgemeinzustandes des Muttertieres<br />
- Förderung des Sekretabflusses<br />
- Verlängerung der antibiotischen Behandlung<br />
Nachteil: Störung der normalen Demarkation und lokalen Abwehrvorgänge. Behandlung<br />
bei Allgemeinstörungen: vgl. puerperale Infektionen.<br />
Therapie nach Demarkation: meistens ist kurz nach Abgang der demarkierten<br />
Nachgeburtsteile der Zervixkanal so weit offen, dass noch einmal mit Uterusobletten<br />
58
ehandelt werden kann. Andernfalls: Behandlung mit Antibiotika in flüssigem Medium<br />
oder mit milden Desinfektionslösungen. Beurteilung und Behandlung 4 Wochen p.p.:<br />
wenn nötig Uterusbehandlungen mit Antibiotikalösungen oder milden Desinfizientien<br />
bzw. Tonisierung des Uterus mit Prostaglandinen; Anregung der ovariellen Tätigkeit<br />
(vgl. auch Vorlesung Hirsbrunner / <strong>Skript</strong> Küpfer).<br />
Als Ausputztrank wird ein altes Arzneimittel bezeichnet, das als Emulsion abgegeben<br />
wird, und täglich in kleinen Mengen mit dem Futter oder direkt per os verabreicht wird.<br />
Es enthält Pflanzenextrakte wie Terpentinöl, die die Durchblutung der Gebärmutter und<br />
damit die lokale Abwehr fördern, ferner Stoffe wie Oleum sabinae, welchem eine<br />
kontraktionsfördernde Wirkung auf die Uterusmuskulatur zugeschrieben wird (seit jeher<br />
bekannt als Abortivum!). Ihre nützliche Wirkung lässt sich schwer nachweisen, kann<br />
aber auch nicht einfach verneint werden. Ausputztrank wird als unterstützende<br />
Massnahme immer noch häufig angewandt, auch nach normalen Geburten.<br />
Pro memoriam:<br />
bei Aborten ab dem 3. Trächtigkeitsmonat sind die seuchenpolizeilichen Vorschriften<br />
zu beachten: Absonderung, Entnahme von Plazenta- und Blutproben.<br />
Retentio placentae bei der Stute<br />
Bei der Stute muss die Tierärztin schon beigezogen werden, wenn die Nachgeburt<br />
nicht innerhalb von 6 Stunden p.p. abgegangen ist.<br />
Bei Stuten kann es zu schwersten Störungen kommen, wenn nur sehr kleine Reste<br />
der Nachgeburt in der Gebärmutter <strong>zur</strong>ückbleiben. Eine gefürchtete Komplikation<br />
von Ret.plac. ist die Hufrehe. Nach jeder Geburt muss die Nachgeburt ausgelegt<br />
und auf ihre Unversehrtheit und vollständige Ablösung hin untersucht werden.<br />
Beim Zurückbleiben der Nachgeburt versucht man durch Eingeben von grossen Mengen<br />
körperwarmer Desinfektionslösung (z.B. Betadinelösung) zwischen Gebärmutterwand<br />
und Plazenta die Loslösung zu erzwingen, was meistens auch gelingt. Die<br />
Desinfketionslösung gelangt über eine durch die Zervix eingeführte sterile<br />
Schlundsonde in die Gebärmutter und wird anschliessend wieder abgehebert.<br />
Wiederholung der Spülung an den folgenden Tagen. Zusätzlich ev. systemische<br />
Chemotherapie und ergänzende Behandlungen je nach Zustand (siehe Vorlesung Meier).<br />
Puerperale bakterielle Erkrankungen<br />
Die Zusammenhänge zwischen der mangelnden Hygiene während und nach der Geburt<br />
und der Entstehung des sogenannten Kindbettfiebers wurden 1847 vom Wiener<br />
Gynäkologen I. Semmelweis erstmals beschrieben. Seine ohne Wissen von der Existenz<br />
von Bakterien gewonnenen Erkenntnisse setzten sich nur langsam durch, führten an den<br />
Gebärkliniken aber zu einer massiven Reduktion der Todesfälle infolge Kindbettfiebers.<br />
Seit Einführung von Sulfonamiden und Antibiotika kam es noch einmal zu einer<br />
deutlichen Reduktion der puerperalen Infektionen.<br />
Noch heute sind aber Hygiene (Waschen und Desinfektion) und das Vermeiden von<br />
Verletzungen die wichtigsten Massnahmen <strong>zur</strong> Verhinderung von puerperalen<br />
Infektionen. Gründe für hohes Infektrisiko im Puerperium:<br />
- intakte, weiche Geburtswege unmittelbar p.p.: weit offene Zervix, grosse<br />
Oberfläche des Gebärmutterlumens<br />
- Stress der Geburt und der einsetzenden Milchleistung (s. Einleitung) vermindern<br />
die Abwehrkraft<br />
- durch jede geburtshilfliche Untersuchung und Manipulation erhöht sich das<br />
Infektionsrisiko (Mikroverletzungen, Einschleppen von Keimen) auch bei<br />
fachgerechtem Vorgehen erheblich<br />
59
- alle bis jetzt genannten puerperalen Leiden erhöhen das normalerweise schon hohe<br />
Risiko aus einleuchtenden Gründen um ein Mehrfaches<br />
- Die Abwehrkraft des Muttertieres kann zusätzlich durch gleichzeitig bestehende<br />
Stoffwechselstörungen, z.B. Fettmobilisationssyndrom oder Herdinfektionen (z.B.<br />
akute Mastitis) wesentlich beeinträchtigt werden.<br />
Als puerperale bakterielle Infektionen kommen in Frage<br />
- lokal begrenzte Infektionen einzelner Abschnitte der weichen Geburtswege, z.B.<br />
Colpitis<br />
- lokale Infektionen mit Einbezug des Nachbargebietes, z.B. paravaginaler<br />
Abszess<br />
- Fäulnisinfektion: massive Vermehrung von an sich apathogenen oder wenig<br />
pathogenen Keimen in totem Material, z.B. Lochien, mit anschliessender<br />
Resorption dieser Fäulnisprodukte (Saprämie)<br />
- lokale Infektion mit Bakteriämie und Metastasebildung<br />
- lokale Infektion mit Toxämie<br />
- lokale Infektion und Sepsis (selten)<br />
Die verschiedenen Verlaufsformen treten häufig nicht in reiner Ausprägung auf und<br />
sind klinisch manchmal nicht voneinander abzutrennen. Ihr Schweregrad und Verlauf<br />
hängen weitgehend auch ab von der Ätiologie; Art und Virulenz der beteiligten Keime;<br />
Ausmass der vorbestehenden Gewebsschädigung; lokaler und genereller<br />
Abwehrbereitschaft des Muttertiers<br />
Ätiologie:<br />
Das Spektrum der in Frage kommenden Erreger ist angesichts der speziellen Exposition<br />
und Pathogenese sehr breit. Zu rechnen ist vor allem mit folgenden Keimen:<br />
Eitererreger: A.pyogenes, Streptokokken und pathogene Staphylokokken<br />
Nekroseerreger: F. necrophorum, D. nodosus<br />
Coliforme: gefürchtet wegen Toxämien<br />
H. somni: vor allem als Erreger von subakuten und chronischen Endometritiden<br />
C. septicum: Geburtsrauschbrand, heute beim Rind äusserst selten, ev. beim Schaf.<br />
C. tetani: hohe natürliche Resistenz des Rindes gegen Starrkrampf; in Zusammenhang<br />
mit puerperalen Infektionen kann es in äusserst seltenen Fällen auch beim Rind zu<br />
Starrkrampf kommen. Das Schaf ist anfälliger.<br />
Infektiöse Vulvitis, Vestibulitis, Vaginitis (Colpitis)<br />
Symptome: akut Phlegmone<br />
massive, gespannte Schwellung bei vaginaler und rektaler Untersuchung; spürbar<br />
erhöhte Wärme. Schleimhaut blau-rot verfärbt, trocken, ev. mit kleinen Rissen, ev. mit<br />
flächenhaften grau-gelben nekrotischen Belägen (F. necrophorum); eitrig,<br />
übelriechendes Sekret vermischt sich mit Lochien und Harn.<br />
Bei Gasbrand: emphysematöse, knisternde Schwellung (Differentialdiagnose: Ansaugen<br />
von Luft durch Schleimhautverletzungen); Behinderung von Lochialabfluss und<br />
Harnabsatz; Behinderung und Schmerzäusserung beim Absetzen von Kot, Ampulla recti<br />
angefüllt; subfebrile bis hochfieberhafte Körpertemperatur, Pulserhöhung, Inappetenz<br />
und leicht- bis mittelgradige Apathie, aufgekrümmter Rücken und andere Anzeichen von<br />
Schmerz. Ungenügende Milchleistung<br />
subakut bis chronisch: Abszedierung<br />
peri- und paravaginale Abszesse, im Vulvabereich gegen ventral absinkend. Bei rektaler<br />
und vaginaler Untersuchung als prall-derbe, selten deutlich fluktuierende Gebilde.<br />
Manchmal Fistelbildung zum Scheidenlumen hin; Demarkierung von oberflächlichem<br />
60
Scheidengewebe: grosser granulomatöser Defekt. Allgemeinstörungen häufig gering<br />
oder fehlend, jedoch Abmagerung und ungenügende Milchleistung.<br />
Prognose: quo ad vitam bei intensiver Therapie meistens günstig (Ausnahmen:<br />
Geburtsrauschbrand, Starrkrampf) quo ad usum: zweifelhaft. Abmagerung,<br />
ungenügende Leistung während der ganzen Laktation; Peritonitis; ausgedehnte<br />
retroperitoneale Abszesse; chronischer Herdinfekt. quo ad conceptionem: zweifelhaft<br />
bis günstig: Strikturen, Urovagina<br />
Therapie: akutes Stadium systemische Chemotherapie mit Strepto-Penicillin oder<br />
Sulfonamiden oder Tetracyclinen. Entzündungshemmer systemisch: Flunixin<br />
Meglumin; bei metastatisch-toxischen Erscheinungen: steroidale Entzündungshemmer.<br />
Von Lokalbehandlungen in der Scheide ist nichts zu erwarten; Spülungen sind<br />
gefährlich wegen Versacken der Spülflüssigkeit. Äusserlich sichtbare Schwellungen:<br />
Lehmanstrich oder Auftragen von DMSO. Subakut bis chronisch: von der Scheide<br />
oder von aussen zugängliche Abszesse können unter Umständen nach Punktion<br />
gespalten werden. Cave: grosse Scheidengefässe!<br />
Infektiöse Endometritis, Metritis, Peri- und Parametritis, Zervizitis<br />
Die Unterscheidung zwischen Endometritis und Metritis geschieht anhand klinischer<br />
Kriterien und deckt sich nicht mit den pathologisch-anatomischen oder gar<br />
histologischen Befunden.<br />
Symptome und Diagnose:<br />
akute Endometritis: Lochialstauung mit massiver Infektion, meistens in den ersten 10<br />
Tagen p.p. Bei vaginaler und rektaler Untersuchung wie bei Atonia uteri beschrieben.<br />
An der Zervixmündung und in der Scheide häufig kein pathologisches Sekret erkennbar;<br />
ev. Abfluss von wenig Sekret beim Liegen, verschmierter Schwanz. Uterusinhalt:<br />
dunkelrot-braun mit Gewebsfetzen, penetrant, stechend, faulig-süsslicher Geruch.<br />
Mittel- bis hochgradige Allgemeinstörungen als Ausdruck von Toxämie (s. unten)<br />
Subakute Endometritis: verzögerte Uterusinvolution, zu grosser, manchmal leicht<br />
fluktuierender, ev. dünnwandiger Uterus. Häufig vergesellschaftet mit Corpus luteum<br />
(persistierend nach erster Brunst?) an einem der Ovarien, ev. auch mit Follikelzysten<br />
kein oder nur spärlicher Sekretausfluss aus Zervix. Uterusinhalt: rein eitrig oder<br />
schleimig-eitrig: Weissfluss (fluor albus) meistens 3-4 Wochen p.p. Nicht oder nur<br />
leicht gestörtes Allgemeinbefinden.<br />
Metritis: meistens in den ersten 2 Wochen p.p. Uteruswand eher verdickt, starr-rigid<br />
("zu gut tonisiert"), bei rektaler Palpation ev. schmerzhaft. Sekret wie bei akuter oder<br />
subakuter Endometritis; mittel- bis hochgradige Allgemeinstörungen.<br />
Perimetritis: Im Zusammenhang mit Metritis oder perforierenden Uterusverletzungen.<br />
Ausschwitzungen oder fibrinöse Auflagerungen; bei rektaler Untersuchung fühlt sich die<br />
Serosa nicht glatt an. Später: Verklebungen und Verwachsungen des Uterus mit der<br />
Umgebung. Al.lgemeinstörungen, je nach Stadium und Ausmass.<br />
Parametritis: nach Hämatomen in Gebärmutterbändern, nach Ausfluss von infiziertem<br />
Uterusinhalt über Eileiter oder in Zusammenhang mit Perimetritis. Auflagerungen, ev.<br />
knotige Verdickungen im Gebärmutterband, Verklebungen oder Verwachsungen mit<br />
Bursa ovarica und Eierstöcken. Genaue Diagnose ist meistens nicht möglich, häufig<br />
auch Verwachsungen mit der Umgebung. Allgemeinstörungen je nach Art und Ausmass<br />
Zervizitis: Passagebehinderung oder totaler Verschluss (Verklebungen), später<br />
Verwachsungen des Zervikalkanals. Zervix bei rektaler Untersuchung stark vergrössert,<br />
unregelmässiger Durchmesser von kaudal nach kranial, derbe Konsistenz ev.<br />
Verwachsungen bei vaginaler Untersuchung: ev. stark gerötete und vergrösserte Portio<br />
vaginalis cervicis.<br />
61
Prognose: quo ad vitam bei intensiver Therapie meistens günstig; quo ad usum wie bei<br />
Vaginitis usw.; quo ad conceptionem zweifelhaft; immer verlängerte<br />
Zwischenkalbezeit, ev. dauernde Unfruchtbarkeit, vor allem bei subakut-chronischen<br />
Formen. Ungünstig bei beidseitiger Parametritis, bei Zervixverwachsungen.<br />
Therapie: Akute Endometritis: Entleerung des Uterus (Prostaglandine, ev. Abhebern der<br />
infektiösen Lochien; Antibiotika-Obletten, z.T. auch als Schaumobletten; systemische<br />
Chemotherapie; Nachkontrolle und wenn nötig Behandlung nach 2 Tagen. Behandlung<br />
der Toxämie: s. unten<br />
Subakute Endometritis: Entleerung des Uterus und in Gang bringen des ovariellen<br />
Zyklus. Prostaglandine; zusätzlich intrauterine Behandlung mit Antibiotika in flüssigem<br />
Medium (wässerige Lösung, wässerige Suspension, Emulsion oder ölige Lösung)<br />
Metritis, Peri-, Parametritis, Zervizitis im akuten Stadium systemische Chemotherapie;<br />
im subakuten und chronischen Stadium ist keine spezifische Therapie möglich.<br />
Näheres zu diesem Kapitel: s. auch Vorlesung und Unterlagen Gynäkologie<br />
Toxämie<br />
Toxämie ist klinisch von Sepsis nicht abgrenzbar; eine Sepsis scheint aber in<br />
Zusammenhang mit puerperalen Erkrankungen äusserst selten vorzukommen.<br />
Bakterientoxine; Gewebsabbau- und Entzündungsprodukte.<br />
Schädigung der grossen Parenchyme, Myokard, Synovien und Lederhaut. Nicht in<br />
jedem Fall sind alle Zielorgane betroffen oder zumindest nicht im gleichen Ausmass..<br />
Im Extremfall: Schock<br />
Symptome: schwere Form hohes Fieber bis 42°C, manchmal mit Schüttelfrost, kühle<br />
Akren, Puls 100-120/min oder höher, Apathie bis Somnolenz bis zum Koma, manchmal<br />
Festliegen, Versiegen der Milch, eingesunkene Bulbi, Schleimhäute gerötet,<br />
verwaschen-schmutzig, Anorexie, Pansenparese, manchmal Obstipation, manchmal<br />
Diarrhoe (ev. mit Meläna). Manchmal wird das klinische Bild von Symptomen der<br />
akuten Klauenrehe dominiert.<br />
Milde Verlaufsform: mittelgradiges Fieber: 39-40°C, Pulsfrequenz erhöht, verminderte<br />
Milchleistung, mässig-wechselnde Inappetenz, Indigestion, Diarrhoe oder Verstopfung,<br />
metastatisch toxische Synovitis (vorwiegend Tarsi, Fesselgelenke der<br />
Hintergliedmassen, gemeinsame Sehnenscheide der Zehenbeuger vorne und hinten), ev.<br />
nur Ödeme an Gliedmassenenden. Laborbefunde: Hämatologie: ev. Hämokonzentration,<br />
Leukopenie (Neutropenie und Lymphopenie, später relative Neutrophilie und<br />
Linksverschiebung).<br />
Blutchemie: je nach Stadium und Schweregrad: Elektrolytverschiebungen<br />
(Hypokaliämie, Hypokalzämie) Enzymaktivitätserhöhungen (Leber- und<br />
Muskelenzyme).<br />
Diagnose: anhand von klinischen Befunden und Allgemeinsymptomen. Mit einer<br />
gründlichen Allgemeinuntersuchung müssen andere Infektionsherde, vor allem das Euter<br />
als Ursache der Toxämie ausgeschlossen werden.<br />
Differentialdiagnosen: Peritonitis, Gebärparese, Fettmobilisationssyndrom<br />
Prognose: je nach Verlaufsform; quo ad vitam zweifelhaft; quo ad usum zweifelhaft; bei<br />
schweren Parenchymschäden wird unter Umständen die normale Leistungsfähigkeit<br />
nicht wieder erlangt.<br />
Für Klauenrehe: s. dort.<br />
Für metastatisch toxische Synovitis: günstig.<br />
Therapie: wichtigste Massnahme ist die Sanierung des Herdes, in welchem die Toxine<br />
produziert werden: s. oben.<br />
Zusätzlich <strong>zur</strong> systemischen Chemotherapie<br />
62
- Glukokortikoide oder Flunixin Meglumin: antitoxische, entzündungshemmende<br />
Wirkung<br />
- Infusion grosser Mengen von physiologischer Kochsalzlösung und isotonischer<br />
Glukoselösung: 10-20 1 und mehr: Auffüllen der Gefässe, Förderung der Diurese,<br />
Versorgung mit Energie, Leberschutz<br />
- Kalziuminfusion: Substitution, gefässabdichtende (antitoxische) Wirkung<br />
- ev. Vitamin E / Selen: antioxydative Wirkung<br />
- früher wurde in solchen Fällen ein Aderlass durchgeführt<br />
- symptomatisch: Pansensaftübertragungen; ev. Indigestionsinfus; gehaltvolles, gut<br />
strukturiertes, appetitanregendes Futter<br />
- Rehebehandlung: s. dort<br />
- metastatisch toxische Synovitis: Lehmanstrich, ev. Aufpinseln von DMSO<br />
(Kortikoide wirken gut)<br />
Bakteriämie<br />
Infolge chronisch eitriger Infektionen an den weichen Geburtswegen während des<br />
Puerperiums kann es <strong>zur</strong> bakteriämischen Aussaat in verschiedene Organe kommen:<br />
Leberabszess, Thrombus der Vena cava caudalis, Endocarditis valvularis,<br />
Nierenmetastasen<br />
Prophylaxe von puerperalen Infektionen<br />
Allgemeines: s. Einleitung zu diesem Kapitel.<br />
Spezifische Massnahmen: bei bestandesweise gehäuftem Auftreten von<br />
Geburtsrauschbrand oder Tetanus, vorallem in Schafherden: Vakzination. Absonderung<br />
von Tieren mit pathologischem Sekretausfluss.<br />
Nach durchgemachter puerperaler Infektion: gute Reinigung und Desinfektion des<br />
Standplatzes.<br />
Bei gehäuftem Auftreten von bakteriellen Infektionen in einem Bestand: Geburtshygiene<br />
und Pflege der Kuh im Frühpuerperium überprüfen.<br />
63