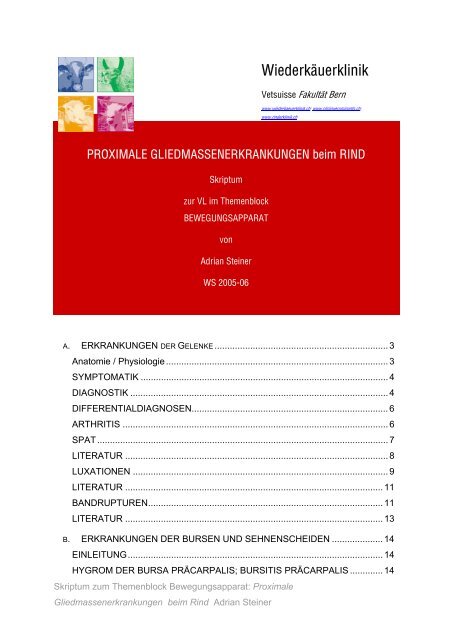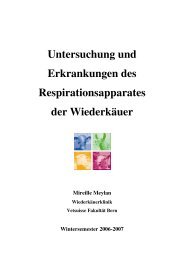Proximale Gliedmassenerkrankungen (pdf, 532KB)
Proximale Gliedmassenerkrankungen (pdf, 532KB)
Proximale Gliedmassenerkrankungen (pdf, 532KB)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wiederkäuerklinik<br />
Vetsuisse Fakultät Bern<br />
www.wiederkaeuerklinik.ch; www.cliniqueruminants.ch;<br />
www.rinderklinik.ch<br />
PROXIMALE GLIEDMASSENERKRANKUNGEN beim RIND<br />
Skriptum<br />
zur VL im Themenblock<br />
BEWEGUNGSAPPARAT<br />
von<br />
Adrian Steiner<br />
WS 2005-06<br />
A. ERKRANKUNGEN DER GELENKE .................................................................... 3<br />
Anatomie / Physiologie ....................................................................................... 3<br />
SYMPTOMATIK ................................................................................................. 4<br />
DIAGNOSTIK ..................................................................................................... 4<br />
DIFFERENTIALDIAGNOSEN............................................................................. 6<br />
ARTHRITIS ........................................................................................................ 6<br />
SPAT .................................................................................................................. 7<br />
LITERATUR ....................................................................................................... 8<br />
LUXATIONEN .................................................................................................... 9<br />
LITERATUR ..................................................................................................... 11<br />
BANDRUPTUREN............................................................................................ 11<br />
LITERATUR ..................................................................................................... 13<br />
B. ERKRANKUNGEN DER BURSEN UND SEHNENSCHEIDEN .................... 14<br />
EINLEITUNG.................................................................................................... 14<br />
HYGROM DER BURSA PRÄCARPALIS; BURSITIS PRÄCARPALIS ............. 14<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner
BURSITIS CALCANEA SEPTICA .................................................................... 15<br />
LITERATUR ..................................................................................................... 16<br />
C. ERKRANKUNGEN DER MUSKELN UND SEHNEN .................................... 17<br />
EINLEITUNG.................................................................................................... 17<br />
RUPTUR DES M. FIBULARIS TERTIUS/ RUPTUR DES M. GASTROCNEMIUS<br />
......................................................................................................................... 17<br />
DURCHTRENNUNG DES FERSENSEHNENSTRANGES .............................. 18<br />
DURCHTRENNUNG DER OBERFLÄCHLICHEN UND/ODER TIEFEN<br />
BEUGESEHNE................................................................................................. 19<br />
LITERATUR ..................................................................................................... 20<br />
D. ANDERE GLIEDMASSENERKRANKUNGEN .............................................. 21<br />
PERITARSITIS................................................................................................. 21<br />
SPASTISCHE PARESE ................................................................................... 21<br />
ANGEBORENE VERKRÜMMUNG DER VORDERGLIEDMASSEN BEIM KALB<br />
......................................................................................................................... 22<br />
LITERATUR ..................................................................................................... 23<br />
E. ABBILDUNGEN ............................................................................................ 24<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
2
A. ERKRANKUNGEN DER GELENKE<br />
ANATOMIE / PHYSIOLOGIE<br />
Ein Gelenk besteht aus:<br />
- mindestens 2 Knochenenden, überzogen von<br />
hyalinem Knorpel; darunter liegt die<br />
subchondrale Knochenplatte.<br />
- Gelenkskapsel bestehend von aussen nach innen aus:<br />
- Bindegewebe, lamina propria, membrana synovialis;<br />
- letztere besteht aus sekretorischen (Typ B) und<br />
phagozytierenden (Typ A) Zellen.<br />
- Ligamenten, welche entweder intrakapsulär (Kollateralbänder) oder<br />
intraartikulär, aber extrasynovial (Kreuzbänder) gelegen sind.<br />
- Stützstrukturen (fakultativ): Menisken<br />
Die Innervation des Gelenkes erfolgt nur bis zum bindegewebigen Anteil der<br />
Gelenkskapsel; d.h. nicht primär die Entzündung, sondern die Dehnung eines<br />
Gelenkes wird als Schmerz empfunden.<br />
Die Nährstoffversorgung des Gelenkes erfolgt indirekt durch Diffusion ausgehend<br />
vom subsynovialen Kapillarbeet. Frei diffundieren können Elektrolyte, Wasser,<br />
Sauerstoff, Kohlendioxid und kleine Proteine: Ultrafiltrat des Plasmas. Sie folgen<br />
einer hydrostatischen und kolloidosmotischen Druckdifferenz. Im Gelenk besteht<br />
normalerweise ein Unterdruck von -2cm bis -6cm Wassersäule. Das Gelenk wird<br />
zudem durch Lymphgefässe drainiert.<br />
Na-Hyaluronat (Hyaluronsäure) wird in den sekretorischen Synovialzellen produziert<br />
und in die Synovia abgegeben; es ist verantwortlich für die Viskosität der Synovia<br />
und ist gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil der Proteoglykanaggregate des<br />
Gelenkknorpels. Proteglykanaggregate sind verantwortlich für die Elastizität des<br />
Gelenkknorpels und bestehen aus Na-Hyaluronat im Zentrum, und rechtwinklig dazu<br />
angegliederten Proteoglykanuntereinheiten, welche wiederum aus je einem<br />
Kernprotein mit daran angegliederten Glykosaminoglykanseitenketten bestehen.<br />
Der hyaline Knorpel besteht aus Wasser (ca. 70%), Kollagenfaser,<br />
Proteoglykanaggregaten und wenigen Chondrozyten. Die Ernährung des hyalinen<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
3
Knorpels erfolgt wie Synovialflüssigkeit und in geringerem Mass ausgehend vom<br />
subchondralen Knochen.<br />
Die Funktion der Gelenke besteht in der Beweglichkeit der Gliedmasse und in der<br />
Dämpfung von longitudinalen Kräften (hyaliner Knorpel und Synovia). Die<br />
elastische Beschaffenheit des hyalinen Knorpels sowie die hohe Viskosität der<br />
Synovia (Lubrifikation) erlauben eine beinahe friktionslose Bewegung.<br />
SYMPTOMATIK<br />
Schwellung (prall, ev. fluktuierend): Erhöhung des Proteingehaltes führt zur<br />
Volumenzunahme durch Diffusion von Wasser ins Gelenk.<br />
Wärme, Rötung<br />
Schmerz: Durch Dehnung der Gelenkskapsel (Palpation und Lahmheit)<br />
Reduzierte Beweglichkeit (siehe Beugeprobe)<br />
Abnorme Beweglichkeit bei Vorliegen von Bandrupturen<br />
Allgemeinsymptome v.a. bei septischer Arthritis: Fieber, Appetitlosigkeit,<br />
Milchrückgang.<br />
Muskelatrophie an der betroffenen Gliedmasse bei chronischem Geschehen (>14<br />
Tage)<br />
Veränderungen der Zusammensetzung der Synovialflüssigkeit<br />
Radiologisch sichtbare Veränderungen im Bereich der subchondralen<br />
Knochenplatte sind frühestens 10 Tage nach Beginn einer Arthritis erkennbar<br />
DIAGNOSTIK<br />
- Gründliche klinische und orthopädische Untersuchung mit Beugeproben<br />
- Gelenkspunktion (Arthrocentese) und nachfolgende Untersuchung der Synovia<br />
- Spezialuntersuchungen wie Ultrasonographie, Radiologie, Arthroskopie<br />
Gelenkspunktion<br />
Anatomie der Punktionsstellen kann dem Lehrbuch "Lameness in Cattle"<br />
entnommen werden. Bei mehrhöhligen Gelenken wie dem Kniegelenk müssen u.U. 2<br />
Punktionen durchgeführt werden. Individuelle anatomische Unterschiede sind zu<br />
beachten.<br />
Technik der Gelenkspunktion: Bei jeder Gelenkspunktion muss eine zwingende<br />
Indikation vorliegen. Die Punktion hat unter absolut sterilen Kautelen zu erfolgen<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
4
(Gefahr der iatrogenen Infektion). Im Bereich einer Phlegmone darf keine Punktion<br />
durchgeführt werden, da die Gefahr der iatrogenen Infektion erhöht ist.<br />
Makroskopische Normalbefunde der Synovia: Menge: In Abhängigkeit vom<br />
Gelenk: Ein bis wenige Milliliter; Viskosität: fadenziehend; Transparenz: klar;<br />
Beimengungen: keine; Farbe: bernsteinfarben; Koagulation: Keine spontane<br />
Koagulation.<br />
Laboruntersuchung der normalen Synovia: Proteingehalt (
Tabelle 2: Charakteristika von normaler und veränderter Synovia<br />
Diagnose Transparenz Leuk/yl % polymorph-<br />
kernige Zellen<br />
normal klar
ARTHRITIS SEPTICA<br />
�Siehe separates Skriptum<br />
SPAT<br />
Es handelt sich dabei per definitionem um eine primär aseptische, degenerative<br />
Arthritis (Osteoarthrose) im Bereich des Tarsometatarsal- und des distalen<br />
Intertarsalgelenkes. In vielen Fällen liegt eine infektiöse Arthritis = septischer Spat =<br />
Spat mit Komplikationen vor, wobei Primär-, Sekundär- und Tertiärinfektionen als<br />
Ursache in Frage kommen.<br />
Ätiopathogenese: Nicht genau bekannt. Als auslösender Faktor kommt eine<br />
Überbeanspruchung der distalen Gelenke des Tarsus mit nachfolgender<br />
Tarsalknochendegeneration in Frage.<br />
Symptomatik: Anamnese nicht pathognostisch. Kühe aller Alterskategorien sind<br />
betroffen. Mittel- bis hochgradige gemischte Lahmheit; Periartikuläre Schwellung mit<br />
Akzentuierung im medio-distalen Gelenksbereich des Tarsus. Flexion und Extension<br />
des betroffenen Sprunggelenks sind schmerzhaft. Häufig liegt eine sekundäre<br />
aseptische Affektion des Talokruralgelenkes vor. Relativ häufig tritt Spat als<br />
Nebenbefund (subklinische Form) auf.<br />
Die Diagnosesicherung erfolgt radiologisch. Häufige Befunde sind: Ankylose,<br />
Sklerosierung, Osteolyse, Weichteilschwellung; inkonstant werden beobachtet:<br />
Periostale Knochenzubildung (Zeichen für Vorliegen von septischem Spat) und<br />
Einschmelzungsherde. Beim aseptischen Spat stehen im akuten Stadium<br />
Weichteilschwellung, Osteolyse und Einschmelzungsherde im Vordergrund. Im<br />
Verlaufe der Abheilung kommt es zur Sklerosierung und schlussendlich zur<br />
Ankylosierung (siehe Definitionen).<br />
Therapie: Leinsamenkataplasmen, systemische Applikation von nicht-steroidalen<br />
Entzündungshemmern, Boxenruhe. Bei Vorliegen einer Infektion: Penicillin (1-2<br />
Wochen). Bei Vorliegen von Einschmelzungsherden: Kürettage und Spülung, oder<br />
Osteostixis (Anbohren der Knochen vom Gelenk her.<br />
Prognose: Zweifelhaft bis günstig bei aseptischem Spat; zweifelhaft bei septischem<br />
Spat und ungünstig bei Sekundärinfektion des Talokruralgelenkes.<br />
Definitionen: Sklerosierung: Verhärtung durch Bindegewebszubildung, welche<br />
verknöchern kann. Ankylose: Versteifung eines Gelenkes bedingt durch einen intra-<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
7
oder periartikulären Erkrankungsprozess. Arthrodese: Operative Versteifung eines<br />
Gelenkes.<br />
LITERATUR<br />
Crabill M, Cohen ND, Martin J. Detection of bacteria in synovial fluid using the<br />
polymerase chain reaction. Vet Surg 1995; 24: 423.<br />
Desrochers A, St-Jean G, Cash WC, et al. Characterization of anatomic<br />
communications between the femoropatellar joint and the lateral and medial<br />
femorotibial joints in cattle using intraarticular latex positive contrast arthrography.<br />
Vet Surg 1995; 24: 425.<br />
Hirsbrunner G, Steiner A. Treatment of infectious arthritis of the radiocarpal joint of<br />
cattle with gentamicin-impregnated collagen sponges. Vet Rec. 1998, 399-402.<br />
Martig J, Ueltschi G, Eberle J, Schneider E. Spat des Rindes. Tierärztl Prax 1977; 5:<br />
303-315.<br />
Rohde C, Anderson DE, St-Jean G et al. Synovial fluid analysis in cattle: A Review of<br />
130 cases. Vet Surg 2000;29:341-346.<br />
Schneider RK, Barmlage LR, Mecklenburg LM, et al. Open drainage, intraarticular<br />
and systemic antibiotics in the treatment of septic arthritis/tenosynovitis in horses.<br />
Equine Vet J 1992; 24: 443-449.<br />
Singh A, Patil DB, Sharifi D, et al. Effect of intraarticular injection of local anesthetics<br />
and local arthrocentesis on bovine synovia. Indian J Anim Sci 1991; 61: 1190-1192.<br />
Steiner A. Arthroscopic lavage and implantation of gentamicin-impregnated collagen<br />
sponges for treatment of chronic septic arthritis in cattle. Lameness Symposium,<br />
Luzern, 1998, Proc. 309-310.<br />
Steiner A, Hirsbrunner G, Miserez R, Tschudi P. Arthroscopic lavage and<br />
implantation of gentamicin impregnated collagen sponges for treatment fo chronic<br />
septic arthritis ihn cattle: 14 cases (1995-1997). VCOT 1999;12:64-69.<br />
VanHuffel X, Steenhaut M, Imschoot J et al. Carpal joint arthordesis as a treatment<br />
for chronic carpitis in calves and cattle. Vet Surg 1989;18:304-311.<br />
Whitehair KJ, Blevins WE, Fessler JF et al. Regional perfusion of the equine carpus<br />
for antibiotic delivery. Vet Surg 1992;21:279-285.<br />
Whitehair KJ, Bowersock TL, Blevins WE et al. Regional limb perfusion for antibiotic<br />
treatment of experimentally induced septic arthritis. Vet Surg 1992;21:367-373.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
8
LUXATIONEN<br />
Luxation: Gegenseite Verschiebung zweier durch ein Gelenk verbundener<br />
Knochenenden, wobei kein Kontakt zueinander mehr besteht. Subluxation: Im<br />
Gegensatz zur Luxation besteht noch partieller Kontakt der Gelenksoberflächen.<br />
Diastase: Auseinanderweichen von Knochen, welche normalerweise bindegewebig<br />
verbunden sind. Gelenksluxationen kommen beim Rind eher selten vor. In der Folge<br />
sind die Gelenke in abnehmender Häufigkeit des Auftretens von Luxationen<br />
aufgelistet: Hüftgelenk, Patellafixation nach dorsal, Iliosakralgelenk, Fesselgelenek,<br />
Carpometacarpalgelenk, Tarsometatarsalgelenk. Luxationen anderer Gelenke<br />
kommen äusserst selten vor.<br />
HÜFTGELENKSLUXATION<br />
Definition: Bei der Hüftgelenksluxation (HGL) handelt es sich um eine Verlagerung<br />
des Femurkopfes in einen Bereich ausserhalb des Acetabulums. Die Verlagerung<br />
kann in folgenden Richtungen (Abb.1) stattfinden: Kraniodorsal > kaudoventral >><br />
kranioventral ~ kaudodorsal. Meist unilateral, bei Tieren aller Alterskategorien<br />
vorkommend.<br />
Ätiopathogenese: Trauma: Bei Kälbern meist Geburtstrauma, bei Rindern Alpunfall<br />
und bei Kühen Ausgleiten vor, während oder nach dem Abkalben (häufig in<br />
Zusammenhang mit Hypokalzämie), oder während der Brunst (Ausgleiten beim<br />
Bespringen und besprungen werden). Trauma führt zum Ausklinken des<br />
Femurkopfes aus dem Acetabulum.<br />
Klinische Befunde: Fehlende Belastung der Gliedmasse und Aussenrotation<br />
derselben, Zehenspitzenstand, passive Beweglichkeit der Gliedmasse erhöht,<br />
hochgradiger Schmerz auslösbar durch passive Bewegung, meistens keine<br />
Krepitation auslösbar, asymmetrischer Beckenbereich, Veränderung der Distanzen<br />
zwischen Tuber coxae, Tuber ischiadicum und Trochanter major (Abb.1).<br />
Diagnosesicherung: Radiologie<br />
Differentialdiagnosen: Frakturen von: Femurkopf, Femurhals, Trochanter major,<br />
Becken im Acetabulumbereich, Paralyse/Parese des N. obturatorius.<br />
Therapie: - Gedeckte Reduktion (Abb. 2): Allgemeinnarkose; seitliche Lagerung<br />
mit der betroffenen Gliedmasse oben; Fixation des Beckens am Tisch mittels eines<br />
Seils; Distraktion der Luxation mittels Flaschenzug in der Richtung einer<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
9
Verbindungslinie zwischen Femurkopf und Acetabulum in Supinationsstellung;<br />
Einklinken der Luxation durch Pronation der Gliedmasse.<br />
- Offene Reduktion: Nur bei Misslingen der gedeckten Reposition oder<br />
bei Rezidivierung: Kraniolateraler Zugang zum betreffenden Hüftgelenk: Toggle-pin<br />
Fixation.<br />
Prognose: Positive prognostische Indikatoren sind: Kraniodorsale Luxation, geringes<br />
Alter, kurze Zeitspanne zwischen Auftreten der Luxation und Reposition (fehlende<br />
oder beginnende Organisation des intraartikulären Hämatoms), Stehfähigkeit des<br />
Tieres vor der Reposition, Fehlen anderer Verletzungen.<br />
Rezidivrate: Bei kraniodorsaler Luxation: ~20%.<br />
PATELLAFIXATION (-LUXATION) NACH DORSAL<br />
Definition: Bei der Patellafixation nach dorsal (PFD) handelt es sich um eine<br />
habituelle (temporäre) oder permanente Fixation der Patella über dem medialen<br />
Rollkamm der Trochlea femoris. Die PFD ist die am häufigsten vorkommende<br />
Luxation der Patella beim Rind. Die PFD kann uni- als auch bilateral vorkommen.<br />
Ätiopathogenese: Ursache und prädisponierende Faktoren sind unbekannt. Beim<br />
Büffel häufiger vorkommend als beim Rind.<br />
Klinische Befunde: Initial: Steifer Gang und intermittierend Hahnentritt,<br />
zwischenzeitlich häufig normaler Gang. Im fortgeschrittenen Stadium: Plötzlich<br />
auftretendes temporäres oder permanentes Verharren der Gliedmasse in maximaler<br />
Extensionsstellung, Nachschleifen der betroffenen Gliedmasse und der Zehenspitze<br />
auf dem Boden. Palpation: Patella sehr weit proximal gelegen, stark gespannte<br />
Patellarbänder.<br />
Diagnosesicherung: Provokation der Fixation durch Zurückrichten des Tieres.<br />
Differentialdiagnosen: Gonitis, HGL, Parese der Hintergliedmasse.<br />
Therapie: Desmotomie des medialen Patellarbandes mittels eines Tenotoms am<br />
stehenden oder besser am liegenden (Platzmangel wegen Euter) Tier (Abb. 3). Bei<br />
Erfolglosigkeit der Desmotomie kann zusätzlich eine Tenotomie der Endsehne des<br />
Musculus vastus medialis durchgeführt werden. Das klinische Resultat der<br />
Tenotomie kann unmittelbar nach der Operation beurteilt werden.<br />
Komplikationen der Desmotomie des medialen Patellarbandes: Selten<br />
auftretend: Phlegmone, Abszessbildung, Eröffnung des Kniegelenkes mit iatrogener<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
10
Gonitis. Leichtgradige Arthrosen des Kniegelenkes sind als langfrisitge<br />
Komplikationen beschrieben.<br />
Prognose: Zweifelhaft bis günstig nach alleiniger Tenotomie des medialen<br />
Kniescheibenbandes und günstig bei gleichzeitiger Durchführung der Tenotomie der<br />
Endsehne des Musculus vastus medialis.<br />
LITERATUR<br />
Baird AN, Angel KL, Moll HD. Upward fixation of the patella in cattle: 38 cases (1984-<br />
1990). JAVMA 1993;202:434-436.<br />
Hanson RR, Peyton LC. Surgical correction of intermittent upward fixation of the<br />
patella in a Brahman cow. Can Vet J 1987;28:675-677.<br />
Larcombe MT, Malmo J. Dislocation of the coxo-femoral joint in dairy cows. Austr Vet<br />
J 1989;66:351-354.<br />
Tulleners EP, Nunamaker DM, Richardson DW. Coxofemoral luxations in cattle: 22<br />
cases (1980-1985). JAVMA 1987;191:569-574.<br />
BANDRUPTUREN<br />
RUPTUR DES KRANIALEN (ANTERIOREN) KREUZBANDES<br />
Vorkommen: Relativ selten vorkommend; in sehr seltenen Fällen sind gleichzeitig<br />
das kaudale Kreuzband und die medialen Kollateralbänder rupturiert. Tritt v.a. bei<br />
schweren Kühen (reduziertes Stehvermögen post partum in Folge von<br />
Hypokalzämie) oder bei Stieren auf. Im folgenden Text wird nur auf die Ruptur des<br />
kranialen Kreuzbandes eingegangen.<br />
Anatomie: Kraniales Kreuzband (lig. decussatum laterale): Origo: Kaudoaxial am<br />
lateralen Rollkamm in der Fossa intercondylica femoris. Insertio: Fossula centralis<br />
tibiae, welche craniomedial der eminentia intercondylaris tibiae gelegen ist.<br />
(Patho)physiologie: Das kraniale Kreuzband stabilisiert zusammen mit dem<br />
kaudalen Kreuzband das Kniegelenk in kraniokaudaler Richtung. Bei Ruptur des<br />
kranialen Kreuzbandes verschiebt sich die Tibia gegenüber den Femurkondylen in<br />
kranialer Richtung und das Gelenk ist instabil = vordere Schublade (Abb. 4).<br />
Aetiopathogenese: Bei Kühen: Akutes Trauma durch Verdrehen der Gliedmasse<br />
oder Ausrutschen des Tieres auf glattem Boden. Bei alten Stieren: Ruptur kann<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
11
sekundär als Folge von degenerativen Gelenkserkrankungen (DJD) und<br />
Meniskusschäden auftreten.<br />
Klinische Befunde: Plötzliches Auftreten einer mittel- bis hochgradigen gemischten<br />
Lahmheit. Schwellung im Bereich des Kniegelenkes sicht- und palpierbar.<br />
Tuberositas tibiae ist im Vergleich zur gesunden kontralateralen Seite vermehrt<br />
prominent respektive nach kranial verschoben. Am Anfang der Belastungsphase der<br />
Gliedmasse kann ein dumpfer Knall hörbar sein. Bei manueller Palpation des<br />
Kniegelenkes während der Bewegung ist die Instabilität spürbar. Vorderes<br />
Schubladenphänomen kann wegen der grossen Muskelmasse nicht immer ausgelöst<br />
werden.<br />
Radiologische Befunde: Bei Belastung der betroffenen Gliedmasse: Verschiebung<br />
der Tibia nach kranial relativ zum Femur. Ev. Avulsionsfrakturen an der<br />
Insertionsstelle des Kreuzbandes sichtbar. In chronischen Fällen, bei Vorliegen einer<br />
DJD sind aktive Mineralisationsprozesse im Bereich der Kreuzbänder, Menisken und<br />
Kollateralbänder sichtbar.<br />
Therapie: Üblicherweise palliativ bis zur Schlachtung: Nur bei hochträchtigen Kühen<br />
bis zum Abkalben ratsam: Schmerzmittel (Phenylbutazon) und Boxenruhe, weiche<br />
Einstreu. Bei sehr wertvollen und leichten Tieren (>200 kg) kann im akuten Fall<br />
(keine Anzeichen von DJD vorhanden) eine chirurgische Stabilisierung mittels<br />
Imbrikation oder Kreuzbandersatz versucht werden. Als Bandersatz wird ein<br />
autologes Transplantat der Gluteobicepsfaszie oder ein Kunststoffband verwendet.<br />
Imbrikation (Abb.5): Raffung des Gelenkes durch Vernähen des lateralen<br />
Kollateralbandes mit dem mittleren geraden Kniescheibenband ---><br />
Gelenksstabilisierung. Kreuzbandersatz (Abb.6): Bei der in der Literatur<br />
beschriebenen Technik wird mittels eines gestielten Transplantates der<br />
Gluteobicepsfaszie das gerissene kraniale Kreuzband "over the top" (siehe<br />
Kleintierchirurgie) ersetzt.<br />
Prognose: Prinzipiell ungünstig; ausser bei leichten Tieren ohne arthrotische<br />
Veränderungen: Zweifelhaft bis ungünstig.<br />
KOLLATERALBANDRUPTUR<br />
Vorkommen: Am häufigsten rupturierte Kollateralbänder sind: Mediale und laterale<br />
Carpometacarpal- und Tarsometatarsalbänder, mediale Bänder des Knies und<br />
laterale Bänder des Fesselgelenkes. Führt zur Subluxation oder Luxation des<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
12
Gelenkes. Ursache: Trauma. Diagnostik: Unphysiologische Beweglichkeit im<br />
Bereich des betroffenen Gelenkes, sowie Schwellung und Druckdolenz im Bereich<br />
des rupturierten Bandes. Diagnosesicherung: Radiologisch darstellbare (Sub)-<br />
Luxation. Therapie: Rekonstruktion mittels autologem Faszientransplantat oder<br />
künstlicher Bandprothese; Arthrodese oder gedeckte Reposition und externe<br />
Gipsfixation als Alternative. Prognose: Abhängig vom Gewicht des Tieres, dem<br />
betroffenen Gelenk und dem Grad der sekundären (bedingt durch Instabilität)<br />
Gelenksschäden von ungünstig bis günstig.<br />
LITERATUR<br />
Crawford WH. Intra-articular replacement of bovine cranial cruciate ligaments with an<br />
autogenous fascial graft. Vet Surg 1990;19:380-388.<br />
Huhn JC, Kneller SK, Nelson DR. Radiographic assessment of cranial cruciate<br />
ligament rupture in the dairy cow. Vet Radiol 1986;27:184-188.<br />
Metzger L, Schawalder P, Geissbühler U, Tontis A, Stich H, Steiner A. Diagnostik<br />
und Therapie der Ruptur beider Kreuzbänder, des medialen Kollateralbandes und<br />
Abriss beider Menisken bei einem Schafbock. SAT 1998;140:273-281.<br />
Moss EW, McCurnin DM, Ferguson TH. Experimental cranial cruciate ligament<br />
replacement in cattle using a patellar ligament graft. Can Vet J 1988;29:157-162.<br />
Nelson DR, Koch DB. Surgical stabilisation of the stifle in cranial cruciate ligament<br />
injury in cattle. Vet Rec 1982;111:259-262.<br />
Schawalder P, Gitterle E. Eigene Methoden zur operativen Rekonstruktion des<br />
vorderen und hinteren Kreuzbandes. Kleintierparxis 1989;34:323-330.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
13
B. ERKRANKUNGEN DER BURSEN UND SEHNENSCHEIDEN<br />
EINLEITUNG<br />
Bursa = Schleimbeutel = Mit Synovialflüssigkeit gefüllter Beutel, welcher<br />
reibungsarmes Gleiten einer Sehne auf einem Knochen respektive der Haut über<br />
einem Gelenk ermöglicht; subkutan gelegene Bursen können erworben sein; unter<br />
Sehnen gelegene Bursen sind angeboren.<br />
Sehnenscheide = Tendovagina = Mit Synovialflüssigkeit gefüllte, eine Sehne<br />
umhüllende Scheide; ermöglicht reibungsarmes Gleiten einer Sehne über einem<br />
Gelenk resp. Knochen.<br />
Diagnostik: Orthopädische Untersuchung, ultrasonographische Untersuchung,<br />
Punktion: Punktat wird gleich wie ein Gelenkspunktat beurteilt. Radiologie nur zum<br />
Ausschluss eines knöchernen Problemes angezeigt.<br />
HYGROM DER BURSA PRÄCARPALIS; BURSITIS PRÄCARPALIS<br />
Definition: Es handelt sich dabei um eine primär nicht infizierte Vergrösserung und<br />
Anfüllung der Bursa präcarpalis. Durch Sekundärinfektion kann sich eine septische<br />
Bursitis entwickeln.<br />
Aetiopathogenese: In der Literatur liegen widersprüchliche Angaben darüber vor, ob<br />
die Bursa präcarpalis angeboren oder erworben ist. Durch einen chronischen Reiz<br />
(wiederholtes Trauma, wie zum Beispiel Anschlagen des Carpus am Krippenrand)<br />
kommt es entweder zur Anbildung und Auffüllung einer erworbenen oder zur<br />
Auffüllung einer angeborenen Bursa. Durch Perforation der prall gefüllten Bursa mit<br />
einem spitzen Gegenstand kann sich eine septische Bursitis entwickeln.<br />
Klinische Befunde: Bursahygrom: Umschriebene, pralle, nicht dolente, leicht<br />
verschiebliche Umfangsvermehrung im Präcarpalbereich; keine Lahmheit oder<br />
leichtgradige Hangbeinlahmheit vorhanden. Septische Bursitis: Alle Anzeichen einer<br />
Entzündung im Bereich einer prallen, umschriebenen, nicht verschieblichen<br />
Umfangsvermehrung im Präcarpalbereich; gemischte Lahmheit verschiedenen<br />
Grades vorhanden. Bei Unsicherheit erfolgt Differenzierung mittels Beurteilung der<br />
Synovialflüssigkeit.<br />
Differentialdiagnosen: Carpitis (Antebrachiocarpalgelenk), Pericarpitis.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
14
Therapie: - Septische Bursitis: Eröffnung mit dem Skalpell an tiefster Stelle<br />
medial und lateral der Medianen ---> Kürettage und Spülung ---> Einlegen von 2<br />
Penrose-Drains ---> Tägliche Spülung bis zur Abheilung. Falls eine Phlegmone<br />
vorliegt: Vor dem Spalten mittels Leinsamenkataplasmen reifen lassen = Behandlung<br />
wie Abszess.<br />
- Bursahygrom: Entweder konservativ: Wiederholte Punktion und Entleerung im<br />
Abstand von 1 Woche und lokale Applikation eines steroidalen<br />
Entzündungshemmers; hoher Schienenverband (Immobilisation) über mehrere<br />
Wochen. Oder chirurgisch durch Bursektomie = Chirurgische Entfernung der Bursa<br />
ohne diese zu eröffnen, danach Immobilisierung für mindestens 2 Wochen mittels<br />
hohem Schienenverband (Abb. 7).<br />
Prognose: Septische Bursitis: Zweifelhaft; Bursahygrom: Sehr zweifelhaft bei<br />
konservativer, günstig bei chirurgischer Behandlung.<br />
Komplikationen: Rezidiv; iatrogene Infektion eines Hygroms nach Punktion und<br />
Steroidapplikation.<br />
BURSITIS CALCANEA SEPTICA<br />
Definition: Es handelt sich dabei um eine infizierte Vergrösserung und Anfüllung<br />
einer oder mehrerer Bursen im Bereich des Tuber calcanei.<br />
Anatomie: Im Bereich des Tuber calcanei befinden sich 3 Schleimbeutel (Abb 8a):<br />
Bursa calcanea subcutanea (angeboren oder erworben), Bursa calcanea<br />
subtendinea supf. (zwischen der oberflächlichen Beugesehne und dem Tuber<br />
calcanei) und Bursa calcanea subtendinea prof. (unter der Achillessehne).<br />
Aetiopathogenese: Die Infektion dieser Burs(a)/en kommt meist primär (Verletzung:<br />
Stich, Schnitt mit der Schaufel...), seltener sekundär (Übergreifen einer Infektion aus<br />
der Umgebung, wie z.B. ausgehend von einer Peritarsitis) zustande.<br />
Klinische Befunde: Mittel- bis hochgradige gemischte Lahmheit; die Lahmheit ist<br />
deutlich weniger ausgeprägt, wenn nur die subkutane Bursa betroffen ist.<br />
Akzentuierte, dolente, manchmal fluktuierende Schwellung im Bereich des Tuber<br />
calcanei.<br />
Diagnosesicherung: Orthopädische Untersuchung; mittels Ultraschall-untersuchung<br />
(Abb. 8b) kann differenziert werden, welche der 3 Bursen betroffen ist. Punktion:<br />
Zytologische Untersuchung des Punktates (Beurteilung: siehe<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
15
Gelenkserkrankungen). Radiologische Untersuchung gibt Auskunft darüber, ob<br />
schon eine Periostitis/Osteitis/Osteomyelitis des tuber calcanei vorliegt.<br />
Differentialdiagnosen: Fraktur des Tuber calcanei, Sehnenruptur im Bereich des<br />
Fersensehnenstrangs, Ruptur der Fersenkappe (Luxation der oberflächlichen<br />
Beugesehne), Peritarsitis, Tendovaginitis der gemeinsamen Sehnenscheide des M.<br />
tibialis caudalis und M. flexor digitalis profundus.<br />
Therapie: Wie Abszess: Hyperämisierung mit Leinsamenkataplasmen; Penicillin (10<br />
Tage); Spalten (medial und lateral je 1 Öffnung machen), Kürettage und Drainage mit<br />
nachfolgend täglicher Spülung bis zur Abheilung. Nur in seltenen Fällen kann mit<br />
einer Abheilung (Resorption) in Folge von Hyperämisierung als alleiniger Behandlung<br />
gerechnet werden.<br />
Prognose: Subkutane Bursa: Zweifelhaft bis günstig; tiefer gelegene Bursen:<br />
Zweifelhaft bis ungünstig bei sehr aufwändiger Behandlung.<br />
LITERATUR<br />
Flury S. Ultrasonographische Darstellung des Tarsus beim Rind. Med. Vet.<br />
Dissertation Bern, 1996.<br />
Kofler J. Neue Möglichkeiten zur Diagnostik der septischen Tendovaginitis der<br />
Fesselbeugesehnenscheide des Rindes mittels Sonographie - Therapie und<br />
Langzeitergebnisse. Dtsch Tierärztl Wschr 1994;101:215-222.<br />
Kofler J. Diagnostic ultrasound in the investigation of septic tendosynovitis of digital<br />
flexor tendon sheath in 33 cattle. Porc. XIX World Buatrics Congress, Edinburgh<br />
1996; Vol 2: 551-553.<br />
Nuss K, Maierl J. Tenosynovitis of the deep flexor tendon sheeth at the bovine<br />
tarsus. Proc. 8 th Annual Scientific Meeting of the ECVS, Brugge (B) 1999; 194-195.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
16
C. ERKRANKUNGEN DER MUSKELN UND SEHNEN<br />
EINLEITUNG<br />
Muskeln heilen innerhalb einiger Wochen durch Einlagerung resp. Überbrückung<br />
des Defektes mit Bindegewebe. Der Heilungsprozess von Sehnengewebe dauert viel<br />
länger (> 6 Monate); es kann nie mit einer restitutio ad integrum gerechnet werden.<br />
RUPTUR DES M. FIBULARIS TERTIUS/ RUPTUR DES M. GASTROCNEMIUS<br />
Anatomie/ Biomechanik: Diese beiden Muskeln sind verantwortlich für den<br />
Spannsägemechanismus im Bereich der Hintergliedmasse. Unter<br />
Spannsägemechanismus versteht man die obligatorische Verspannung von Knie- mit<br />
Tarsalgelenk. Dabei bildet der M. fib. tertius (M. peroneus tertius) die vordere, der M.<br />
gastrocnemius die hintere Verspannung. Physiologischerweise nimmt bei Flexion des<br />
Kniegelenkes auch der Tarsus eine Flexionsstellung ein und vice versa. M. fib.<br />
tertius: Origo: Epicondylus lateralis femoris; insertio: <strong>Proximale</strong>r Metatarsus. M.<br />
gastrocnemius: Origo: Distaler Femur; Insertio: Tuber calcanei.<br />
Ruptur des M. fibularis tertius: Meist befindet sich die Ruptur im Bereich des<br />
Muskelbauches. Befunde bei der Untersuchung im Schritt: Tarsus bleibt bei<br />
Flexion des Kniegelenkes in Extensionsstellung, der Fersensehnenstrang ist locker.<br />
Gliedmasse kann nur ungenügend vorgeführt werden. Häufig wird Zehenschleifen<br />
beobachtet (typische Hangbeinlahmheit). Diagnosesicherung: "Gonitisprobe":<br />
Betroffene Gliedmasse wird durch den Untersucher passiv angehoben und nach<br />
kaudal gezogen; dabei kann eine Flexion des Kniegelenkes bei gleichzeitiger<br />
vollständiger Extension des Tarsus erzeugt werden. Palpation des M. fib. tertius:<br />
Entzündungssymptome und Hämatom im Bereich der Rupturstelle. Therapie:<br />
Boxenruhe für 6 Wochen. Prognose: Günstig, ausser wenn Ruptur im Bereich von<br />
Ursprung oder Insertion des Muskels gelegen ist.<br />
Ruptur des M. gastrocnemius: Häufigste Muskelruptur beim Wiederkäuer. Meist<br />
liegt die Ruptur im Bereich des Muskelbauches oder am Übergang von Muskel zu<br />
Sehne. Befunde bei der Adspektion im Stall: Absinken des Tarsus bei Belastung:<br />
Gewicht kann nicht getragen werden. Grad des Absinkens ist abhängig davon, ob<br />
eine partielle oder totale Ruptur des M. gastrocnemius vorliegt. Liegt die Ruptur<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
17
proximal der Vereinigung mit der Sehne des M. soleus und ist der M. soleus selbst<br />
nicht betroffen, so sind die Symptome geringgradiger. Diagnosesicherung:<br />
Beugeprobe: Betroffene Gliedmasse wird durch den Untersucher passiv angehoben.<br />
Dabei kann eine Flexion des Tarsalgelenkes bei gleichzeitiger vollständiger<br />
Extension des Kniegelenkes erzeugt werden. Palpation des M. gastrocnemius:<br />
Entzündungssymptome und Hämatom im Bereich der Rupturstelle. Therapie: Hoher<br />
Schienenverband (Schiene kranial) mit guter Polsterung im Bereich der Tuberositas<br />
tibiae für 6 Wochen; Boxenruhe für 8 Wochen. Prognose: Ungünstig (Rind, Kuh) bis<br />
günstig (Kalb).<br />
DURCHTRENNUNG DES FERSENSEHNENSTRANGES<br />
Definition: Durchtrennung des Fersensehnenstranges ist zu differenzieren von, und<br />
nicht zu verwechseln mit einer Muskelruptur im Bereich des M. gastrocnemius (siehe<br />
dort).<br />
Befunde bei der Adspektion im Stall: Absinken des Tarsus bei Belastung: Gewicht<br />
kann nicht getragen werden, der Calcaneus berührt den Boden. Schwellung im<br />
Bereich des Fersensehnenstranges.<br />
Ursache: Direkte (Schnittwunde) oder indirekte (Sehnennekrose nach Infektion wie<br />
z.B. nach Bisswunde) Folge eines Traumas.<br />
Therapie: (i) Bei leichteren Tieren bis zu einem Körpergewicht von etwa 200 - 250 kg<br />
und nur bei frischen und nicht infizierten Wunden möglich: Wundtoilette, Adaptation<br />
und Vernähen der durchtrennten Sehne (Tenorrhaphie), Fixation des Tuber calcanei<br />
an die distale Tibia mittels Nagel mit Gewinde, und hoher Gipsverband für ca. 8<br />
Wochen. Vorzugsweise wird eine "three-loop pulley" (3 Schlingen Flaschenzug)<br />
Sehnennaht durchgeführt (Abb. 9) und ein Polyester- (Ethibond®), Polypropylen-<br />
(Prolene®) oder Polydioxanonfaden (PDS®) der Stärke 2 oder 3 (USP) verwendet.<br />
Einlegen eines Penrose-Drains mit Austritt durch eine separate Hautöffnung. (ii) Dito<br />
wie unter (i), oder Panarthrodese der Tarsalgelenke (nur beim kleinen Wiederkäuer),<br />
oder Transposition der Sehne des M. peroneus longus (bei starker<br />
Sehnenretraktion). (iii) Bei Rindern und Kühen ab ca. 250 kg, sowie bei leichteren<br />
Tieren bei Vorliegen einer Infektion resp. älterer Sehnendurchtrennung mit massiver<br />
Sehnenretraktion: Schlachtung.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
18
Positiv prognostische Indikatoren sind: Geringes Körpergewicht, keine Infektion<br />
vorliegend, Sehnendurchtrennung frisch, mit nur leichtgradiger Sehnenretraktion.<br />
DURCHTRENNUNG DER OBERFLÄCHLICHEN UND/ODER TIEFEN<br />
BEUGESEHNE<br />
Definition: Es muss unterschieden werden zwischen Durchtrennung der<br />
oberflächlichen Beugesehne (BS) (meist im Bereich des Röhrbeins), der tiefen BS<br />
(meist im Bereich ihres Ansatzes am Klauenbein) und Durchtrennung beider<br />
Beugesehnen (im Bereich des Röhrbeins). Weiterhin ist zu differenzieren, ob die<br />
Durchtrennung innerhalb oder ausserhalb der gemeinsamen Beugesehnenscheide<br />
erfolgt ist.<br />
Ätiopathogenese: Bei Durchtrennung im Bereich des Röhrbeins meist<br />
traumatischen Ursprungs als Folge von Tritt in eine Schaufel (Hintergliedmasse). Bei<br />
Ruptur der tiefen BS im Bereich ihres Ansatzes am Klauenbein ist meist ein tiefer<br />
septischer Prozess im Bereich der Zehe, wie z.B. ein kompliziertes Rusterholz'sches<br />
Sohlengeschwür (siehe Skriptum "Zehenerkrankungen beim Rind") die Ursache.<br />
Symptomatik: In > 90% ist eine Hintergliedmasse betroffen; perforierende<br />
Verletzung plantar im Bereich des Metatarsus; bei Belastung der betroffenen<br />
Gliedmasse: Hyperextension im Bereich des Fesselgelenkes (nur oberflächliche BS<br />
betroffen) oder im Bereich des Fessel- und Klauengelenkes (oberfl. und tiefe BS<br />
betroffen).<br />
Therapie: Wundtoilette mit anschliessender Adaptation der Sehne(n) und<br />
Primärverschluss der Haut nur bei frischen, nicht infizierten Wunden und bei geringer<br />
Sehnenretraktion sinnvoll. Nahttechnik siehe "Durchtrennung des<br />
Fersensehnenstranges". Falls gemeinsame BS-Scheide mitbetroffen ist: Spülung und<br />
Drainage angezeigt. Nachbehandlung: Immobilisation der Gliedmasse in<br />
Flexionsstellung im Fesselgelenk mittels Gipsverband bis unter den Tarsus. Bei 1.<br />
Gipswechsel, diesen in der Frontalebene in 2 Schalen zersägen und diese wieder<br />
verwenden. Frequenz des Verbandswechsels hängt vom Verschmutzungsgrad der<br />
Wunde ab. Immobilisationsdauer: 8-10 Wochen. Anschliessend Klauenbeschlag mit<br />
Erhöhung im Bereich der Ballen. Kontinuierliche Reduktion der Erhöhung über eine<br />
Zeitspanne von 1-2 Monaten, anschliessend Klauenbeschlag mit Eisen mit<br />
verlängerten Ruten für einen weiteren Monat.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
19
Komplikationen: Bleibende Lahmheit, bleibende Hyperextension im Fessel-<br />
und/oder Klauengelenk.<br />
Prognose: Zweifelhaft<br />
Positive prognostische Indikatoren sind: Geringes Körpergewicht, keine Infektion,<br />
Durchtrennung frisch mit nur geringer Sehnenretraktion, BS-Scheide nicht eröffnet,<br />
nur oberflächliche BS betroffen.<br />
LITERATUR<br />
Anderson DE, St-Jean G, Morin D, et al. Flexor tendon laceration in cattle: 27 cases<br />
(1982-1993). Vet Surg 1995;24:420.<br />
Easley KJ, Stashak TS, Smith FW, Van Slyke G. Mechanical properties of four suture<br />
patterns for transected equine tendon repair. Vet Surg 1990;19:102-106.<br />
Hunt RJ, Allen D, Thomas K. Repair of a ruptured calcanean tendon by transposition<br />
of the tendon of the peroneus longus muscle in a goat. JAVMA 1991;198:1640-1642.<br />
Jann HW, Steckel RR. Treatment of lacerated flexor tendons in a dairy cow, using<br />
specialized farriery. JAVMA 1989;195:772-774.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
20
D. ANDERE GLIEDMASSENERKRANKUNGEN<br />
PERITARSITIS<br />
Definition: Bei der Peritarsitis handelt es sich im Akutstadium um eine lateral im<br />
Bereich des Tarsus sich befindende Phlegmone, welche sich entweder aufgrund der<br />
Behandlung zurückbildet (Resorption) oder zu einem peritarsalen Abszess ausreift.<br />
Die Peritarsitis ist die häufigste Erkrankung im Bereich des Sprunggelenkes beim<br />
Rind.<br />
Ätiopathogenese: Die Peritarsitis wird in den meisten Fällen verursacht durch eine<br />
oder mehrere kleine Verletzungen (vorwiegend durch Aufschürfen der Haut an der<br />
Lägerkante, Dekubitus) im Peritarsalbereich mit nachfolgender Sekundärinfektion.<br />
Symptomatik: Leicht- bis hochgradige gemischte Lahmheit; massive<br />
Entzündungssymptome im Bereich des Tarsus, lateral akzentuiert. Ev. sekundäre,<br />
meist aseptische Anfüllung des Talokruralgelenkes.<br />
Differentialdiagnosen: Arthritis des Talokruralgelenkes; septischer Spat;<br />
Tendovaginitis der gemeinsamen Beugeshnenscheide von M. tibialis caudalis und<br />
flexor digitialis supf.; Bursitis calcanea.<br />
Therapie: Akut: Desinfizierende Verbände; Antibiotika parenteral. Chronisch:<br />
Leinsamenkataplasmen bis zur Resorption oder bis zum Ausreifen eines Abszesses,<br />
dann Spalten des Abszesses. Gut abgekapselter, auf der Unterlage verschieblicher,<br />
reifer Abszess kann in toto exzidiert werden (siehe Bursektomie der Bursa<br />
präcarpalis).<br />
Prognose: Meist günstig.<br />
SPASTISCHE PARESE<br />
Definitionen: Parese = unvollständige Lähmung; Spasmus = Krampf. Es handelt<br />
sich bei der spatischen Parese um einen erblichen (Elso II) ein- oder häufiger<br />
beidseitigen Spasmus der Muskulatur, welche den Fersensehnenstrang versorgt. Die<br />
Erkrankung verläuft progressiv und beginnt meistens im Alter von 2-9 Monaten.<br />
Ätiologie: Unbekannt. Elektromyographische Untersuchungen lassen den Schluss<br />
zu, dass es sich eher um ein primär muskuläres als primär neurologisches Problem<br />
handelt.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
21
Klinische Symptome: Stark gestrecktes Sprunggelenk; nach hinten gestellte<br />
Gliedmasse, meist auf der einen Seite deutlicher ausgeprägt als kontralateral. Stark<br />
gespannte Gastrocnemiusmuskulatur und brettharter Fersensehnenstrang.<br />
Gliedmasse beschreibt beim Vorführen einen nach aussen gerichteten Halbkreis.<br />
Therapie: Da die spastische Parese erblich bedingt ist, sollte auf eine Behandlung<br />
unbedingt verzichtet werden. Tenotomie der Gastrocnemiussehne unter Schonung<br />
der oberflächlichen Beugesehne oder partielle Neurektomie des Nervus tibialis<br />
werden bei Masttieren im Ausland durchgeführt; gleichzeitige Epididymektomie resp.<br />
Abklemmen der Zitzen mit der Burdizzo-Zange ist angezeigt.<br />
ANGEBORENE VERKRÜMMUNG DER VORDERGLIEDMASSEN BEIM KALB<br />
Wesen: Es handelt sich dabei um eine angeborene, ein- oder beidseitige<br />
Beugehaltung der Zehen- und/oder Vorderfusswurzelgelenke, welche trotz hoher<br />
Kraftanwendung passiv nicht vollständig gestreckt werden können. Gleichzeitig zu<br />
den Gliedmassenverkrümmungen können Verkrümmungen der Wirbelsäule und/oder<br />
der Hintergliedmassen, Herzmissbildungen, Kryptorchismus und Gaumenspalten<br />
auftreten. Häufig kommt es als Folge des Stehunvermögens des Kalbes zu<br />
Sekundärerkrankungen wie Dekubituserscheinungen, Arthritiden und<br />
Nabelentzündungen mit ihren Folgen.<br />
Aetiologie: In der Literatur werden verschiedene ursächlich an der Entstehung der<br />
angeborenen Vordergliedmassenverkrümmungen beteiligte Faktoren erwähnt:<br />
Erblichkeit, Akabane Virus, Lupinen Alkaloide, Manganunterversorgung,<br />
Bestrahlungsschäden der Mutter während der Trächtigkeit. BVD kann aufgrund<br />
neuerer Untersuchungen als Ursache ausgeschlossen werden.<br />
Pathogenese: Hypothese: Schädigung im 6. Halssegment des Rückenmarks<br />
(Ursprung des Nervus radialis) ---> Reduktion der Anzahl alpha-Motoneuronen ---><br />
erniedrigter Tonus der Zehenstrecker ---> Ungleichgewicht zum Zehenbeugertonus --<br />
-> Flexion.<br />
Einteilung: Hauptsächlich von der Flexion betroffenes Gelenk: Fesselgelenk,<br />
Carpalgelenk oder beide gleichermassen. 1. Grad: Fussen auf Zehenspitze; 2. Grad:<br />
Fussen auf Dorsalfläche der Klauen; 3. Grad: Unvermögen aufzustehen.<br />
Symptomatik: Angeborene ein- oder beidseitige leicht- bis hochgradige<br />
Flexionsstellung im Fessel- und/oder Carpalgelenk.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
22
Therapie: Da angenommen wird, dass eine erbliche Komponente bei der Entstehung<br />
mitbeteiligt ist, sollte eine Behandlung nur bei gleichzeitiger<br />
Epididymektomie/Kastration resp. Abkluppen der Zitzen durchgeführt werden. Bei<br />
Vorliegen von Begleitmissbildungen oder Sekundärerkrankungen ist die Euthanasie<br />
indiziert. Grad I: Verlängerung der Zehenspitzen mittels Holzklotz oder Metallschuh<br />
und Kalb auf rutschfesten Boden verbringen. Grad II: Gut gepolsterter hoher<br />
Schienenverband; Physiotherapie. Grad III: Tenotomie von oberflächlicher und tiefer<br />
Beugesehne (Flexion im Fesselgelenk), Tenotomie der Mm. flexor carpi radialis und<br />
ulnaris (Flexion im Carpus), oder Kombination der Techniken bei Flexion in beiden<br />
Gelenken; bei Grad III zieht der Autor aus tierschützerischen Erwägungen die<br />
Euthanasie der Tenotomie vor.<br />
LITERATUR<br />
Geishauser Th. Behandlung der angeborenen Verkrümmung der Vordergliedmassen<br />
beim Kalb. Prakt Tierarzt 1994; Suppl:881-896.<br />
Hofmann W, Heckert HP, Steinhagen P. Zur Klinik der angeborenen<br />
Vordergliedmassenverkrümmungen beim Kalb. Proc XVIII World Buiatrics<br />
Conference, Bologna 1994;I:885-887.<br />
Van Huffel X, De Moor A. Congenital multiple arthrogryposis of the forelimbs in<br />
calves. Comp Cont Educ Pract Vet 1987;9:F333-339.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
23
E. ABBILDUNGEN<br />
Abb. 1: Verlagerungsrichtungen des Femurkopfes bei HGL (Kopie aus: Larcombe<br />
MT, Malmo J. Dislocation of the coxo-femoral joint in dairy cows. Austr Vet J<br />
1989;66:351-354).<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
24
Abb. 2: Schematische Darstellung der Technik zur gedeckten Reduktion der HGL<br />
(Kopie aus: Larcombe MT, Malmo J. Dislocation of the coxo-femoral joint in dairy<br />
cows. Austr Vet J 1989;66:351-354).<br />
Abb. 3: Schematische Darstellung der chirurgischen Anatomie bei der Desmotomie<br />
des medialen Patellarbandes und der Tenotomie der Endsehne des M. vastus<br />
medialis beim Rind (Kopie aus: Greenough: Lameness in cattle; 276)<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
25
Abb. 4: Schematische Darstellung der normalen anatomischen Lageverhältnisse von<br />
Tibia und Femur (A) und bei Vorliegen einer Ruptur des kranialen Kreuzbandes (B),<br />
wobei die Tibia relativ zum Femur nach kranial verschoben ist und die Eminentia<br />
intercondylaris tibiae kranial der Femurkondylen zu liegen kommt (Pfeile).<br />
Abb. 5: Imbrikation des Kniegelenkes (Kopie aus: Nelson DR, Koch DB. Surgical<br />
stabilisation of the stifle in cranial cruciate ligament injury in cattle. Vet Rec<br />
1982;111:259-262).<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
26
Abb. 6: Kreuzbandersatz mittels autologer Faszientransplantation (Kopie aus:<br />
Crawford WH. Intra-articular replacement of bovine cranial cruciate ligaments with an<br />
autogenous fascial graft. Vet Surg 1990;19:380-388).<br />
Abb. 9: "Three-loop pulley" Sehnennaht (Kopie aus: Easley KJ, Stashak TS, Smith<br />
FW, Van Slyke G. Mechanical properties of four suture patterns for transected equine<br />
tendon repair. Vet Surg 1990;19:102-106).<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
27
Abb. 7: Bursektomie<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
28
Abb. 8a: Schematische Darstellung der Sehnenscheiden und Bursen an linken<br />
Sprunggelenk des Rindes. e: Bursa calcanei subtendineae supf., f: Bursa calcanei<br />
subtendineae prof. Bursa calcanei subcutaneae liegt über der oberfl. BS (Kopie aus<br />
Nickel, Schummer, Seiferle, Band I, 445).<br />
Abb. 8b: Ultrasonographische Darstellung einer eitrigen Bursitis calcaneae<br />
subtendineae supf.<br />
Skriptum zum Themenblock Bewegungsapparat: <strong>Proximale</strong><br />
<strong>Gliedmassenerkrankungen</strong> beim Rind Adrian Steiner<br />
29