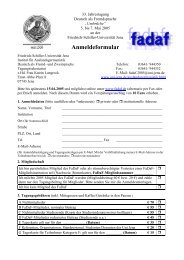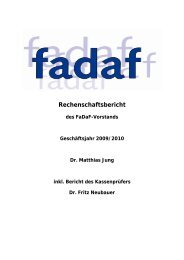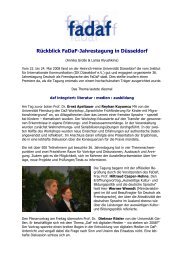Zur Sprache.kɔm Deutsch als Fremd- und ... - Fachverband DaF
Zur Sprache.kɔm Deutsch als Fremd- und ... - Fachverband DaF
Zur Sprache.kɔm Deutsch als Fremd- und ... - Fachverband DaF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Tagungsprogramm <strong>und</strong> Abstracts der Vorträge<br />
formen wird die Wahl der morphosyntaktischen <strong>und</strong> lexikalischen Mittel für viele Studierende mit<br />
DaZ oft zu einer größeren Herausforderung. Die Unsicherheit im Umgang mit der deutschen<br />
<strong>Sprache</strong> <strong>und</strong> die Unfähigkeit, Fehler selbständig zu erkennen <strong>und</strong> zu verbessern, kann zur großen<br />
Verunsicherung führen <strong>und</strong> insgesamt gravierende Folgen für den Studienverlauf haben.<br />
In diesem Vortrag möchte ich demgemäß die Lernvoraussetzungen der Studierenden mit DaZ <strong>und</strong><br />
ihre Einschätzungen der eigenen Sprachkenntnisse <strong>und</strong> Sprachbedürfnisse aufzeigen <strong>und</strong><br />
begründen. Anschließend sollen, darauf aufbauend, Erfahrungen <strong>und</strong> Überlegungen zu einer<br />
Didaktik des <strong>Deutsch</strong>en <strong>als</strong> Zweit- <strong>und</strong> Wissenschaftssprache vorgestellt werden. Der Vortrag stützt<br />
sich auf die Ergebnisse des Programms „Zwischen den <strong>Sprache</strong>n“ für Lehramtsstudierende mit DaZ<br />
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.<br />
Freitag, 01.06.<br />
10:45-11:45 Uhr<br />
Ernst Apeltauer (Universität Flensburg)<br />
Arbeit mit Sprachlernbiographien von Kindern im Vor- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schulalter<br />
Experten sind heute der Auffassung, dass Sprachförderung auf der Gr<strong>und</strong>lage einer Sprachstandsdiagnose<br />
konzipiert <strong>und</strong> durchgeführt werden sollte. Man stellt <strong>als</strong>o fest, was ein Lerner kann <strong>und</strong><br />
bestimmt dann, was er noch lernen muss. Doch woher weiß man, was die Lernenden <strong>als</strong> nächstes<br />
lernen sollen?<br />
Sprachstandsdignoseverfahren vernachlässigen die Interessen der Lernenden <strong>und</strong> ihre Versuche<br />
zur Selbststeuerung. Sie vernachlässigen auch das familiale Umfeld <strong>und</strong> damit Kontakt- <strong>und</strong><br />
Interaktionsmöglichkeiten in informellen Kontexten. Sprachstandsdiagnoseverfahren erschließen<br />
<strong>als</strong>o keine Lernervoraussetzungen, die uns etwas darüber sagen können, ob schneller oder<br />
langsamer gelernt wird, ob eigenständig oder eher umfeldsensibel gelernt wird. Sie sagen nichts<br />
über Interessen <strong>und</strong> Motive der Lernenden oder über ihre selbstinitiierten Aktivitäten (Stichwort:<br />
Zone der intensiven Beschäftigung) oder über ihre Potentiale (Stichwort: Zone der nächsten<br />
Entwicklung). Sie geben uns auch keine Hinweise auf elterliche Erwartungen <strong>und</strong> Hilfestellungen.<br />
All diese Informationen können wir aber über Befragungen <strong>und</strong> Beobachtungen herausfinden <strong>und</strong><br />
im Rahmen von Sprachlernbiografien bündeln.<br />
In der Präsentation soll auf der Gr<strong>und</strong>lage von empirischen Daten gezeigt werden, welche<br />
Informationen man in Eingangsinterviews mit Eltern vor Beginn von Sprachfördermaßnahmen<br />
gewinnen kann <strong>und</strong> wie diese Informationen im Laufe von Fördermaßnahmen ergänzt <strong>und</strong> für die<br />
„Spracharbeit“ (z. B. im Rahmen von Vorlese-Interaktionen, von Erlebnisberichten etc.) genutzt<br />
werden können.<br />
Literatur: Apeltauer, E./Senyildiz, A. (2011): Lernen in mehrsprachigen Klassen – Sprachlernbiografien<br />
nutzen. Berlin: Cornelsen.<br />
12