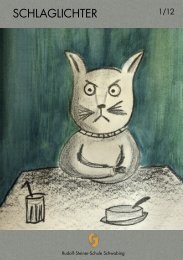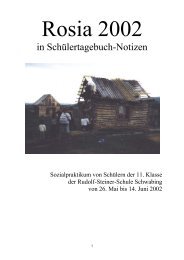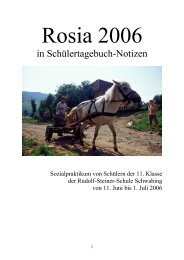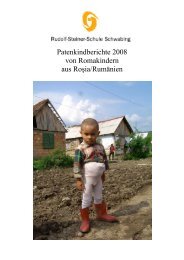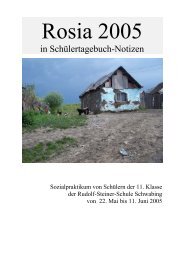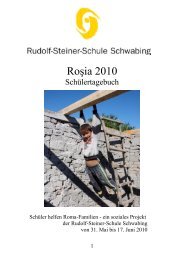2012/3 - Rudolf-Steiner-Schule Schwabing
2012/3 - Rudolf-Steiner-Schule Schwabing
2012/3 - Rudolf-Steiner-Schule Schwabing
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SCHLAGLICHTER<br />
<strong>Rudolf</strong>-<strong>Steiner</strong>-<strong>Schule</strong> <strong>Schwabing</strong><br />
3/12
Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen<br />
und zu können für die soziale Ordnung, die besteht?<br />
Sondern: was ist im Menschen veranlagt und was kann in<br />
ihm entwickelt werden?<br />
Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue<br />
Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzuführen.<br />
Dann wird in dieser Ordnung immer das leben, was die in sie<br />
eintretenden Vollmenschen aus ihr machen;<br />
nicht aber soll aus der heranwachsenden Generation das<br />
gemacht werden, was die bestehende Ordnung aus ihr machen<br />
will.<br />
<strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong>, „Die pädagogische Grundlage und Zielsetzung der Waldorfschulen“<br />
„Typisch waldorf?!“<br />
- „O Gott, nicht schon wieder...!“<br />
EDITORIAL<br />
… denkt ganz sicher der eine oder der andere, der das Heft mit unserem diesmaligen Schwerpunktthema<br />
in den Händen hält. „Typisch waldorf – ist doch sowieso klar... Namen tanzen und so... viel Kunst... schlecht in<br />
Mathe... kuschelig... Ponyhof... u.s.w.“<br />
Das finden Sie hier schon auch, aber hinter all dem steht natürlich die viel drängendere Frage: inwieweit ist<br />
für uns alle, die wir ernsthaft mit dieser <strong>Schwabing</strong>er <strong>Schule</strong> verbunden, verbandelt, verstrickt und manchmal<br />
auch verheiratet sind, dasjenige, was hier tagtäglich in den Klassen geschieht, ein Lebens- und Überzeugungsinhalt,<br />
der uns trägt und inspiriert und uns mit den Intentionen des Begründers der Waldorfpädagogik,<br />
<strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong> in Verbindung erhält?<br />
Verstehen wir, was wir tun?<br />
Verstehen Sie, was wir uns zu tun bemühen?<br />
Geht die Saat auf, die von Montag bis Freitag in Kinderseelen gepflanzt wird?<br />
Gelingt es Ihnen und uns, der sozialen Ordnung neue, originäre, unverbrauchte Kräfte durch unsere Schulabgänger<br />
zur Verfügung zu stellen?<br />
Oder bedienen wir hier das Bedürfnis einer Wirtschaft und eines Staates, unsere Kinder zu Erfüllungsgehilfen<br />
einer Ordnung zu machen, die einzig und allein dem Erhalt ihrer alten und absehbar abgewirtschafteten<br />
Strukturen dient?<br />
Bilden Sie sich selbst ein Urteil, begleiten Sie uns in diesem Heft auf einem Streifzug durch die Waldorfwelt<br />
und staunen Sie, was dort alles zu entdecken ist, wenn der Wille vorhanden ist, dasjenige aufzusuchen und<br />
aufzufinden, was hinter den Klischees verborgen liegt.<br />
Eine informative und vergnügliche Reise in die Weihnachtszeit wünscht Ihnen<br />
bodo bühling<br />
3
Inhalt<br />
Editorial 3 bodo bühling<br />
IM FOKUS: TYPISCH WALDORF?<br />
Fragebogen zu „typisch waldorf“ 6 die Redaktion<br />
Zur historie der Waldorfschule 7 institut für Medien/Kommunikationspolitik<br />
lob für Waldorfschulen<br />
8 Fanny Jiménez<br />
typisch waldorf<br />
Artikelsammlung zum Fokus-Thema<br />
10 diverse<br />
literaturverzeichnis + Quellenangaben 26<br />
AUS DEM SCHULLEBEN<br />
12.-Klass-Waldorf-Abschlussarbeiten 28<br />
Mit blick auf den Zuschauer 30 hannah Schopf<br />
hausbau-Epoche in der 3.Klasse 32 Karl hejny/Klaus Schulz<br />
Puppenspiel – Spiel oder Spielerei 34 Cilli und Mathias Ueblacker<br />
Wirtschaft anders denken 40 heinz Ullmann<br />
Amerika – das land der 1000 Mög... 42 Anna Titze<br />
bio für Kinder 44 Sara dietl/Clara Wessel<br />
PORTRAIT<br />
ines Klante 46<br />
Pia Sauerborn 47<br />
barbara gmeindl 48<br />
gabriele haslmayer 49<br />
Uwe gallenkamp 50<br />
Peter gebert 51<br />
TERMINE 52<br />
IMPRESSUM 54
6<br />
Im Rahmen unseres Fokusthemas „typisch waldorf!“ hat die<br />
Redaktion einen anonymen Fragebogen entwickelt und an<br />
Schüler, Eltern und Mitarbeiter verteilt. – Vielen Dank für die<br />
Mitarbeit.<br />
IM FOKUS<br />
Wir haben Begriffe und Vorurteile, die häufig aufgetaucht sind,<br />
ausgewählt und dazu kleine Beiträge zusammengestellt.<br />
Zum Einstieg eine Zusammenfassung der<br />
wesentlichen Fragen<br />
• Warum arbeiten Sie an einer Waldorfschule? (Mitarbeiter)<br />
• Warum ist Ihr Kind auf einer Waldorfschule? (Eltern)<br />
• Weißt Du, warum Du auf einer Waldorfschule bist? (Schüler)<br />
• Was verbinden Sie / verbindest Du mit dem Begriff Waldorfpädagogik?<br />
• Was ist für Dich / Sie typisch waldorf?<br />
• Welche Vorurteile in Bezug auf Waldorf begegnen Dir / Ihnen?<br />
Lebendig werdende Wissenschaft!<br />
Lebendig werdende Kunst!<br />
Lebendig werdende Religion!<br />
Das ist schließlich Erziehung, das ist schließlich Unterricht.<br />
R u d o l f S t e i n e r<br />
Zur Historie der Waldorfschule<br />
Aber ganz schnell, denn wir haben nur wenig Zeit...<br />
In den Umbruchszeiten am Ende des ersten Weltkrieges wurde <strong>Steiner</strong> aufgefordert, seine<br />
Gedanken zu einer Erneuerung des kulturellen, wirtschftlichen und sozialen Lebens darzustellen.<br />
In diesem Umfeld und Kontext forderte er die Loslösung der <strong>Schule</strong>n aus der Vormachtstellung<br />
des Staates (Schulautonomie) und entwarf in großen Zügen das Bild einer sich an<br />
den Entwicklungsgesetzen des Kindes orientierenden „Einheitsschule“. Diese Ideen griff<br />
der Direktor der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, Emil Molt, auf, der sich nicht nur um eine<br />
Fortbildung für seine Arbeiter bemühte, sondern auch für deren Kinder eine <strong>Schule</strong> einrichten<br />
wollte. Auf seine Bitte übernahm <strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong> Konzeption und Leitung der neuen <strong>Schule</strong><br />
und gab ihr eine breite pädagogische Grundlage. Er berief das erste Kollegium und arbeitete<br />
mit ihm in zahlreichen Vorträgen, Seminaren, Unterrichtsbesuchen und in 70 Konferenzen die<br />
Elemente der Waldorfpädagogik und der kollegialen Selbstverwaltung bis ins Praktische aus.<br />
Die „Freie Waldorfschule“ wurde am 7. September 1919 als „Einheitliche Volks- und Höhere<br />
<strong>Schule</strong>“ in Stuttgart eröffnet und war von Anfang an allgemein zugänglich.<br />
Mit ihrem 12-jährigen Bildungsgang für alle Kinder kann sie als erste deutsche Gesamtschule<br />
gelten.<br />
Diese durch <strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong> intendierte Pädagogik führte in Deutschland und anderen Ländern<br />
zu weiteren Schulgründungen. Das nationalsozialistische System verbot die <strong>Schule</strong>n.<br />
1945 setzte der Wiederaufbau der Waldorf-Bewegung und eine zunehmend rasche, weltweite<br />
Expansion ein.<br />
Heute wächst in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit für die Waldorfpädagogik in dem<br />
Maße, wie die Aufgaben von Erziehung und <strong>Schule</strong> immer drängender in das Bewusstsein von<br />
Eltern und Verantwortlichen rücken. 3<br />
7
Lob für Waldorfschulen<br />
Untersuchung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die Bildungserfahrungen<br />
von Waldorfschülern untersucht hat.<br />
8 9<br />
Waldorfschüler - sind das nicht die, die ihren Namen tanzen?<br />
Eine neue Studie zeigt, dass sie lebenstüchtigere junge Menschen entlässt.<br />
Ergebnis: Waldorfschüler lernen im Vergleich zu Schülern an staatlichen <strong>Schule</strong>n mit<br />
mehr Begeisterung, langweilen sich weniger, fühlen sich individuell gefördert und lernen<br />
in der <strong>Schule</strong> besonders ihre Stärken kennen.<br />
Auch die Identifikation mit der <strong>Schule</strong> ist größer als bei anderen Schülern, und zudem<br />
leiden Kinder an Waldorfschulen bedeutend seltener an somatischen Beschwerden<br />
wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Schlafstörungen. Für die Experten ist dies<br />
ein Hinweis darauf, dass Leistungsdruck und Prüfungsangst in Waldorfschulen weitaus<br />
weniger Raum gegeben wird als an Regelschulen - und dass den Schülern dies gut tut.<br />
Die Betonung der Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung bereite die Kinder<br />
optimal auf das Leben vor, das sie nach dem Schulabschluss erwartet.<br />
Wichtig sei, Wissen kreativ und lösungsorientiert auf neue Bereiche anzuwenden. Darauf<br />
werde in Waldorfschulen traditionell großer Wert gelegt, ebenso wie auf das lebensnahe<br />
Lernen. Es ermögliche Lernen in der Tiefe, das Wissen nicht nur bis zur nächsten<br />
Prüfung konserviere.<br />
Studien zeigen, dass es zwischen den Abschlussnoten von Waldorfschülern und denen<br />
von Schülern auf staatlichen <strong>Schule</strong>n keine statistisch bedeutsamen Unterschiede<br />
gibt, auch nicht, wenn man die Durchschnittsnoten nach der Art des Schulabschlusses<br />
vergleicht.<br />
290 Waldorfschulen mit rund 85.000 Schülern gibt es in Deutschland - weltweit sind es<br />
über 1000. Deutschland hat die meisten, gefolgt von den USA und den Niederlanden.<br />
Fanny Jiménez,Auszug aus dem Artikel aus „Die WELT kompakt“ vom 27.09.<strong>2012</strong>“<br />
Buchempfehlung:<br />
Bildungserfahrungen an Waldorfschulen:<br />
Empirische Studie zu Schulqualität und Lernerfahrungen<br />
Von Heiner Barz, Sylva Liebenwein und Dirk Randoll<br />
ISBN 978-3531185088<br />
Erscheinungsjahr: <strong>2012</strong>, Springer VS<br />
Preis: 34,95 €<br />
Beim heutigen Schulsystem kann man gar nichts anderes<br />
werden als weltfremd; man wird ja ganz herausgerissen<br />
aus der Welt. Und dann tritt sogar das Merkwürdige ein,<br />
daß die weltfremden Pädagogen den Menschen für sein<br />
Gedeihen in der Welt entwickeln sollen.<br />
<strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong> „Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik“
typisch waldorf: Der Morgenspruch<br />
10<br />
Jede Klasse Der Sonne liebes Licht,<br />
11<br />
beginnt denTag mit dem Es hellet mir den Tag;<br />
seit 1919 unveränderten Der Seele Geistesmacht,<br />
sogenannten Morgenspruch Sie gibt den Gliedern Kraft;<br />
von <strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong>, Im Sonnen-Lichtes-Glanz<br />
der sie gemeinsam Verehre ich, o Gott,<br />
in feierlicher Weise Die Menschenkraft, die Du<br />
darauf einstimmen soll, In meine Seele mir<br />
in der <strong>Schule</strong> So gütig hast gepflanzt,<br />
Erkenntnisse aufzunehmen, Dass ich kann arbeitsam<br />
die für das Leben wichtig sind. Und lernbegierig sein.<br />
Ich schaue in die Welt,<br />
In der die Sonne leuchtet,<br />
In der die Sterne funkeln;<br />
In der die Steine lagern,<br />
Die Pflanzen lebend wachsen,<br />
Die Tiere fühlend leben,<br />
In der der Mensch beseelt<br />
Dem Geiste Wohnung gibt;<br />
Ich schaue in die Seele,<br />
Die mir im Innern lebet.<br />
Der Gottesgeist, er webt<br />
Im Sonn‘- und Seelenlicht,<br />
Im Weltenraum, da draußen,<br />
In Seelentiefen, drinnen.<br />
Zu Dir, o Gottesgeist,<br />
Will ich bittend mich wenden,<br />
Dass Kraft und Segen mir<br />
Zum Lernen und zur Arbeit<br />
In meinem Innern wachse.<br />
Klasse 5-12<br />
Von Dir stammt Licht und Kraft,<br />
Zu Dir ström‘ Lieb‘ und Dank.<br />
Klasse 1-4
typisch waldorf: Epochenunterricht<br />
12 13<br />
Was die Nacht zwischen den Unterrichtstagen, das bedeutet<br />
die Pause zwischen den Epochen eines Faches.<br />
Um aus Kenntnissen Fähigkeiten zu bilden ist das Erinnern und<br />
Wiederbegegnen des Untergesunkenen genauso wichtig wie<br />
das Erwachen aus dem Schlaf.<br />
Frans Carlgren „Erziehung zur Freiheit“<br />
Die große Mehrzahl der Jugendlichen gibt in der schriftlichen Befragung (88%) an, gut<br />
bis sehr gut im Epochenunterricht zu lernen. Für diese Jugendlichen scheint die Pause<br />
zwischen den Epochen also kein oder kein großes Problem darzustellen. Vielleicht haben<br />
sie auch den von der Waldorfpädagogik intendierten tieferen Sinn des Vergessens<br />
und Wiederaufgreifens einer Sache erfahren – die Reifung und Anreicherung eines Gegenstandsbereichs<br />
gerade auch in einer Phase, in der dieser im bewußten Denken und<br />
Erleben keine Rolle spielt.<br />
Wenn wir etwas vergessen, verschwindet es nicht einfach aus unserem Bewusstsein.<br />
Das Vergessen ist ein aktiver Vorgang, bei dem das Aufgenommene verarbeitet und verwandelt<br />
wird.<br />
Interessant erscheint, dass auch bei der Befragung von Absolventen von Wal-<br />
dorfschulen die Überzeugung, Epochenunterricht sei sinnvoll, von den jün-<br />
geren zu den älteresn Jahrgängen ansteigt. Die wahrscheinlich plausibelste Er-<br />
klärung für diese Alterseffekte dürfte darin liegen, dass mit fortschreitendem<br />
Alter und grösserer Lebenserfahrung immer stärker Aspekte des nachhaltigen Lernens<br />
im Vergleich zum kurzfristigen Prüfungswissen in den Vordergrund treten. 1
typisch waldorf: Keine Noten<br />
An der Waldorfschule soll das jährliche Zeugnis keine Endabrechnung in Noten sein,<br />
sondern ein psychologisch-pädagogisches Kunstwerk im Bezug auf die charakterisie-<br />
typisch waldorf: Der Zeugnisspruch<br />
Ab der zweiten Klasse muss jeder Schüler einmal pro Woche an dem Wochentag, an<br />
dem er geboren ist, neben den anderen stehend, die dran sind, vor der Klasse<br />
einen Spruch sagen, den ihm der Klassenlehrer unter das lange - ganzseitige - Zeugnis<br />
geschrieben hat und den er sowohl selbst erdacht, wie von einem anderen - oft von<br />
bedeutenden Dichtern - übernommen haben kann.<br />
14 rende Beurteilung des Schüler, sodass für dessen Eltern ein Bild vom Entwicklungs-<br />
15<br />
gang ihres Kindes entstehen kann.<br />
Das Ideal wäre, gar keine Prüfung zu haben. Die Schlussprüfung ist ein Kompromiss<br />
mit der Behörde. Man muss ohne Prüfung wissen, so und so steht es mit den Kindern.<br />
Prüfungsangst vor der Geschlechtsreife ist sehr gefährlich für die ganze physiologische<br />
Struktur des Menschen. Sie wirkt so, dass sie die physiologisch-psychologische Konstitution<br />
des Menschen treibt. Das beste wäre die Abschaffung allen Prüfungswesens.<br />
Die Kinder werden viel schlagfertiger werden.<br />
R u d o l f S t e i n e r „ E r z i e h u n g s k u n s t : S e m i n a r b e s p r c h u n g e n u n d L e h r p l a n v o r t r ä g e “<br />
Für die älteren Schüler ist es nicht unbedingt eine freundliche Erleichterung, sondern<br />
eher eine schwierige Herausforderung, ohne Leistungsdruck durch Zensuren zu arbeiten.<br />
Es gibt Schüler, die daran scheitern und an einem Gymnasium in Bezug auf ihre<br />
Arbeitsmotivation besser zurecht kommen.<br />
Und gerade hierin liegt der zentrale Punkt: In dem Anspruch der Waldorfpädagogik<br />
nämlich, dass die Kinder und Jugendlichen aus einem inneren, geistigen Motiv heraus<br />
„arbeitsam und lehrbegiereig“ sein mögen und dass dieser Impuls unter dem sie<br />
angetreten sind, nicht durch das Prinzip des Leistungswettbewerbs korumpiert werde,<br />
der immer Ausdruck des anderen, kreatürlichen Prinzips vom Recht des Stärkeren,<br />
vom „Survival of the Fittest“ ist. Leichter machen wir es unseren Schülern, durch diese<br />
Anforderung nicht unbedingt!<br />
Lernvorgänge sind hochindividuelle Vorgänge. Sie können nicht durch Ziffern quantifi-<br />
ziert, sondern nur individuell beschrieben werden. Deshalb sollten Lehrer Zeugen und<br />
nicht Zensoren sein!<br />
G a b r i e l e B ö t t c h e r „ G e d a n k e n z u r L e r n m o t i v a t i o n i n d e r W a l d o r f s c h u l e “<br />
Der bildhafte Inhalt dieses Zeugnisspruches, der zusätzlich zum Textzeugnis gegeben<br />
wird, kann den nächsten Schritt, der zu tun ist, verdeutlichen, bei dieser Umwandlung<br />
helfen und einen Weg in die Zukunft weisen. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen<br />
„man merkt die Absicht und ist verstimmt“ und einer zu zarten Andeutung, die<br />
nicht mehr ankommt. 2<br />
„Einmal ging‘s um einen Teppichweber, der seine Teppiche nur so flüchtig und<br />
ungedultig webt. Hat auch zu mir gepasst. Aber das fand ich natürlich nicht so toll,<br />
mir jeden Montag zu erzählen, wie ungeduldig und pfuschig ich arbeite. Es hat<br />
mich schon so in meiner Würde ein bisschen angekratzt. Ich weiß nicht, in wie weit<br />
es geholfen hat. Bin immer noch ein bisschen ungeduldig.“ 1<br />
Die Waldorfschule ist nicht eine «Reformschule»<br />
wie so manche andere, die gegründet werden,<br />
weil man zu wissen glaubt, worin die Fehler dieser oder<br />
jener Art des Erziehens und Unterrichtens liegen;<br />
sondern sie ist dem Gedanken entsprungen,<br />
dass die besten Grundsätze und der beste Wille in diesem Gebiete<br />
erst zur Wirksamkeit kommen können,<br />
wenn der Erziehende und Unterrichtende ein Kenner der<br />
menschlichen Wesenheit ist.<br />
<strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong> „Erziehung zur Freiheit“
typisch waldorf: Eurythmie<br />
Die Waldorfschulen kennen als ein reguläres Unterrichtsfach die Bewegungskunst Eurythmie,<br />
bei der Elemente der Sprache und der Musik in entsprechenden künstlerischen Bewegungsformen<br />
sichtbar gemacht werden. In den ersten Klassen betreiben die Kinder Eurythmie noch<br />
als Bewegungsspiel, sie verwandeln sich in Märchenfiguren, doch bald laufen sie auf dem<br />
Boden geometrische Formen oder bilden die Laute der Sprache als Gesten mit den Armen,<br />
auf den Lauf der Füße überträgt sich der Rhythmus eines Verses, sie lernen sich geschickt im<br />
Raum zu orientieren.<br />
16 17<br />
Zu den besonderen pädagogischen Elementen der Eurythmie gehören Übungen mit Kupfer-<br />
stäben, die Stabübungen. Hier geht es bei den einfachsten und elementarsten Übungen um<br />
das Raumerfassen, bei den Gruppenübungen, bei denen die Stäbe von einem zum anderen<br />
Schüler geworfen werden, um Geschicklichkeitsübungen.<br />
Bei der gemeinsamen Gestaltung eines Musikstücks oder der Darstellung von Literatur<br />
tritt das soziale Element der Eurythmie in den Vordergrund, indem bei der gemeinsamen<br />
Darstellung die Bewegung der einzelnen Formen zur lebendigen Gruppenbewegung wird.<br />
Durch das eigene Sichtbarmachen der Töne, durch die eigene sinnliche Erfahrung können die<br />
Schüler ganz subjektiv das Werk erfassen, und über die seelische Beteiligung lernen sie mit<br />
dem ganzen Körper zu sprechen und ihr Empfinden auszudrücken. Neben den eurythmischen<br />
Bewegungen und den gestalteten Formen verstärkt die Farbigkeit der Gewänder das gedankliche<br />
und gefühlsmäßige Erleben.<br />
Gegenüber dem Turnen, das andere Funktionen bei dem Ergreifen und dem Ertüchtigen des<br />
Körpers zu erfüllen hat, kommt es bei der Eurythmie einerseits auf die seelische Anteilnahme<br />
an, mit der die Bewegung ausgeführt wird, andererseits auf die Tatsache, dass den Bewegungen<br />
objektive Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen.<br />
Ursprünglich waren Sprache, Gesang und menschliche Bewegung eine umfasende Einheit.<br />
Hört der Mensch dem gesprochenen Worte zu, gerät er in seiner Seele in Bewegung, spricht<br />
er selbst, ist er in seinem Inneren mitbewegend tätig. Diese inneren Bewegungsintentionen,<br />
die im sprechenden und hörenden Menschen entstehen, wurden durch <strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong><br />
wahrgenommen und daraus schöpfte er eine Gebärdensprache des ganzen Menschen als<br />
„sichtbare Sprache“ – Eurythmie entstand als neue Kunst. Sie entspringt keimhaft aus dem<br />
Menschenwesen selbst und bildet den Körper als Ausdrucksmittel, als Instrument heran.<br />
In den Gruppenformen ist die Konzentration auf das eigene Tun stets verbunden mit sozialem<br />
Einfühlungsvermögen für die Bewegung der anderen. Erst wenn beides gelingt, erlebt das<br />
1, 2, 4<br />
Kind die Freude an dem gemeinsamen Bewegungsstrom.<br />
„Gewiss, man muss einiges lernen - Buchstaben muss man<br />
lernen und so weiter, aber schließlich, wenn Sie einen Brief<br />
anfangen zu schreiben, so denken Sie ja auch nicht daran, wie<br />
ein I oder ein B ist, sondern Sie schreiben, weil Sie das schon<br />
können.<br />
Und so ist auch dasjenige nicht zu genießen, was der einzelne<br />
Eurythmist als ABC lernen muss, sondern dasjenige, was zuletzt<br />
daraus wird. Und das ist, so unvollkommen es heute noch ist,<br />
eine neugeschaffene bewegte Plastik. Nur natürlich muss man<br />
zur bewegten Plastik den Menschen selbst verwenden.“<br />
<strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong> „ Eurythmie – die Offenbarung der sprechenden Seele “
typisch waldorf: „man lernt nix“<br />
Die Lernvorgänge an der Waldorfschule sollen während der Klassenlehrerzeit in<br />
erster Linie durch das natürliche Lernbedürfnis der Kinder veranlasst werden.<br />
<strong>Steiner</strong> deutet den Eintritt der Schulreife als eine Entwicklung, während der sich die<br />
bildenden und formenden Kräfte des Leibes verinnerlichen und zur Grundlage der<br />
erwachenden kognitiven Fähigkeiten werden. Der Unterricht soll daher während<br />
der ersten acht Schuljahre grundsätzlich bildhaft gestaltet sein und die Phantasie<br />
der Kinder anregen. Die Lernmotivation erfolgt nicht durch angestrebte Ergebnisse<br />
einer (benoteten) Leistungsüberprüfung oder durch den Vergleich der Kinder<br />
untereinander, sondern duurch die Herausforderung der eigenen Fähigkeiten. Die<br />
Kinder sollten erleben, dass ihre Möglichkeiten von den Lehrkräften erkannt und<br />
angemessen gefordert oder behutsam gefördert werden.<br />
18<br />
19<br />
typisch waldorf: keine rechten Winkel<br />
Weil rechte Winkel viel zu einfach und zu billig sind?<br />
Damit die Lehrer keine Schüler in die Ecke stellen können?<br />
Weil man sich ohne rechte Winkel besser konzentrieren kann?<br />
Weil die Anzahl der Winkel die verschiedenen Denkweisen symbolisiert?<br />
Oft heißt es, an Waldorfschulen gebe es keine rechten Winkel. Oft bestätigt sich das<br />
auch. Waldorfschulen mit rechten Winkeln sind entweder in ein zuvor nicht „waldorfliches“<br />
Gebäude eingezogen, hatten nicht die finanziellen Mittel für diese kostenaufwendige<br />
Architektur oder legen schlichtweg doch nicht ganz soviel Wert darauf, was<br />
jedoch seltener ist.<br />
Das Prinzip dahinter ist, dass rechte Winkel anorganisch sind und nicht in der Natur<br />
vorkommen, was nicht der anthroposophischen Philosophie entspricht. Oft ist es so,<br />
dass Menschen sich in organischen Bauten wirklich wohler fühlen, auch wenn man es<br />
spontan schwer beschreiben kann.<br />
Viele Bauten nach anthroposophischem Architektur-Prinzip vermeiden, zu Teilen program-<br />
matisch, den rechten Winkel und bevorzugen den Kreisbogen, was sich jedoch in aller<br />
Regel als sehr kostentreibend erweist. Alternativ werden nicht-rechte Winkel verwendet. 4<br />
Tatsächlich geben Waldorfschüler vergleichsweise häufig an, dass sie ihren Unter-<br />
richt meist interessant fanden und Freude am Lernen verspürten. 1
20 21
typisch waldorf: „die machen,<br />
was sie wollen“<br />
22 „Traditionell sind Lehrer und <strong>Schule</strong>n die letzte ausführende Instanz eines komplexen<br />
Verwaltungsapparates. Die Waldorfsschulen hingegen müssen sich daran messen, was die<br />
<strong>Schule</strong> als selbstständige und pädagogisch verantwortliche Einheit leisten kann, die den<br />
individuellen Lernfortschritt in den Mittelpunkt stellt und Verantwortung für ihre Ergebnisse<br />
übernimmt anstatt diese auf andere Schulformen oder weniger anspruchsvolle Bildungswege<br />
abzuwälzen. Ihr Erfolg wird daran gemessen, inwieweit es ihren Lehrern gelingt, das<br />
Potential aller Schüler zu mobilisieren, die außergewöhnlichen Fähigkeiten gewöhnlicher<br />
Schüler zu entdecken und zu fördern, durch Lehr und Lernformen, die nicht defizitär angelegt<br />
sind sondern wirklich auf den einzelnen Schüler zugeschnitten sind.“<br />
23<br />
1<br />
Der runde Tisch ist eine alte Vision und vielleicht auch schon für die Schreiber des mittelalterlichen<br />
Romans der Artussage mit den Rittern der Tafelrunde ein Bild für eine Gesellschaft,<br />
die sich aus frei handelnden Individuen zusammensetzt und in deren Mitte die gemeinsame<br />
geistige Quelle ruht. Der runde Tisch ist heute der Ort, an dem Lösungen für Konflikte gefunden<br />
werden, Lösungen, die ohne diesen Dialog auf Augenhöhe nicht möglich wären.<br />
Eine <strong>Schule</strong>, deren Augenmerk sich auf das Entdecken und Entwickeln zukünftiger Fähigkeiten<br />
richtet, kann sich selbst nur in einer Form organisieren, die immer wieder Raum lässt für das,<br />
was sich entfalten will. Jeder, der an einer selbstverwalteten <strong>Schule</strong> arbeitet, wird gewissermaßen<br />
zu deren Unternehmer, entwickelt eigenverantwortliche Initiativen im Interesse des Ganzen<br />
und bleibt im Austausch mit den Kollegen. Wir arbeiten ohne institutionalisierte Hierarchien,<br />
sind uns gegenseitig verpflichtet in unserer gemeinsamen Verantwortung für das Ganze. Die<br />
Mitte unseres runden Tisches bleibt frei und offen für das, was jeweils als Frage, Vision oder<br />
Impuls an uns herangetragen wird.<br />
Führung ergibt sich aus den Kompetenzen der Einzelnen und bedeutet an einer selbstverwalteten<br />
<strong>Schule</strong> Weitsicht, Problembewusstsein und vor allem die Moderation einer dialogischen<br />
Entscheidungskultur. Das Ganze entwickelt sich aus Prozessen, die gestaltet werden wollen und<br />
Krisen, die überwunden werden wollen.<br />
„Die Freiheit des Geisteslebens beruht auf der Fähigkeit der Individualität, aus sich selbst (ohne<br />
Vorgaben) zu handeln, dabei das selbst gesetzte Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sich<br />
gleichzeitig mit der gegebenen Wirklichkeit in Einklang zu halten und das Gesamtgeschehen<br />
ebenso zu verantworten wie das eigene Handeln.“ 7<br />
GISEla MEInInG-SchOPF
typisch waldorf: „….wir können alle<br />
unseren Namen tanzen, wir tragen alle<br />
Birkenstock, wir sitzen auf selbstgeschnitzten<br />
Hockern, wir sind dumm“<br />
24 und einer deutlichen Abkoppelung von der Natur? Der Witz kanalisiert dieses Unbehagen an 25<br />
Ein in Bielefeld aufgewachsener Poetry Slammer veröffentlichte 2009 eine Sammlung von<br />
Kurzgeschichten unter dem Titel „Das Leben ist keine Waldorfschule“. Das Buch erschien in<br />
einem renommierten Jugendbuch-Verlag, der Autor gilt als der erste Poetry Slammer, dem ein<br />
derartiger Erfolg gelang. Diese Kurzgeschichten sind eine witzig verfasste Chronik des Scheiterns<br />
im und am Alltag. Der Autor erhielt einen Preis für den „kuriosesten Buchtitel“, denn<br />
inhaltlich hat diese Sammlung nichts mit den konkreten Waldorfschulen zu tun.<br />
Kann es aber sein, dass die Wahl des Titels zum Erfolg des Buches beigetragen hat? Sie<br />
schlägt zumindest in eine Kerbe, die in den Medien – vorwiegend in Comedy-Sendungen –<br />
gerne vertieft wird und in der öffentlichen Wahrnehmung inzwischen ein sattes Vorurteil gegenüber<br />
Waldorfschulen installiert hat: Über Waldorf wird gerne gescherzt, im Wald-Dorf leben<br />
Ökofreaks und Hippies, die immer Lieder singen, Bäume umarmen, ja, aus Waldorfschule wird<br />
die „Baumschule“ schlechthin, was immer das auch heißen mag….<br />
Waldorf, das heißt in Watte gepackt sein, sich der Leistungsgesellschaft entziehen, hier kommt<br />
man mit Socken-Stricken zum Abitur, da gehen die hin, die es sonst nicht schaffen, aber nur<br />
wenn sie es sich finanziell leisten können. Auch über den Unterricht weiß man viel zu erzählen<br />
(ohne ihn zu kennen): keiner lernt wirklich, alle tun, was sie wollen, es gibt keinen richtigen<br />
Unterricht und ganz besonders keinen mathematisch-naturwissenschaftlichen…<br />
Wer kann sich solche Freiheiten heutzutage leisten? Darauf folgt die nächste Spekulation:<br />
Waldorf, das heißt, jenseits der harten Realität leben, eine esoterisch angehauchte und geschlossene<br />
Gesellschaft zu sein, so etwas kann nicht mit rechten Dingen zugehen……<br />
Warum ist es eigentlich witzig, sich über Waldorf lustig zu machen?<br />
Auf meine Frage an eine Gymnasiastin, warum denn immer die Waldorfschule herhalten<br />
müsse, sagte sie völlig treffend: „weil ihr anders seid und Euch diesem ganzen Stress entzieht,<br />
das kann man einfach nicht tolerieren….“<br />
Der Witz ist psychologisch gesehen eine Technik des Unbewussten zur Einsparung von Kon-<br />
flikten und zum Zugewinn von Lust, die in erster Linie darin besteht, dass sich unangenehm<br />
Verdrängtes kurzzeitig lockern kann. Er wirkt gegen Andersdenkende (auch Minderheiten und<br />
Außenseiter) und verbindet Gleichgesinnte.<br />
(vgl. wikipedia, „der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten“ von Sigmund Freud, 1905)<br />
Insofern lässt sich der Blick wenden und auf die witzereißende Gesellschaft selbst lenken:<br />
Welche verdrängten Aspekte thematisieren eigentlich die kollektiven Spaßmacher? Was fehlt<br />
einer Gesellschaft, die sich am Anderssein der Waldorfpädagogik ergötzen will? Kann es sein,<br />
dass das lachende Publikum selbst Probleme hat mit der eigenen Einseitigkeit, dem ewigen<br />
Eingespanntsein in Sachzwänge und Leistungsanforderungen, einer fehlenden Spiritualität<br />
der eigenen Kultur und bringt das Publikum lachend wieder auf Linie.<br />
Sie können ihren Namen tanzen…...<br />
Irgendwann und irgendwie in die Welt gesetzt und tausendfach wiederholt, wird dieses fast<br />
zauberhafte Bild zur symbolischen Verdichtung dieser sehnsuchtsvollen und gleichzeitig<br />
verdrängenden Beziehung einer leistungsvernarrten Gesellschaft zu ihrem querdenkenden<br />
Pendant. Nehmen wir es als Bild und versuchen es zu deuten, dann lässt es sich auch als<br />
ein liebevolles Lob verstehen: Waldorfschüler können etwas, das andere nicht können, sie<br />
leben eine besondere Beziehung zu ihren individuellen Eigenschaften (Namen), sie vertrauen<br />
sich tanzend ihrer eigenen Energie an und sind Menschen, die sich (oder auch andere) in<br />
Bewegung setzen können, um in dieser Leichtigkeit des Seins diese Welt etwas erträglicher<br />
zu machen…… Tja, vielleicht ist das Leben halt doch eine Waldorfschule.<br />
GISEla MEInInG-SchOPF
„Was du mir sagst, das vergesse ich.<br />
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.<br />
Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“<br />
Konfuzius<br />
26 27<br />
Literaturverzeichnis und<br />
Quellenangaben<br />
1 Barz, Heiner; Liebenwein, Sylvia; Randoll, Dirk Bildungserfahrungen an Waldorfschulen:<br />
Empirische Studie zu Schulqualität und Lernerfahrungen, Springer VS<br />
2 Neuffer, Helmut, Zum Unterricht des Klassenlehrers, Verlag Freies Geistesleben<br />
3 Richter, Tobias, Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – Vom Lehrplan der<br />
Waldorfschule, Verlag Freies Geistesleben<br />
4 www.waldorfwiki.de<br />
5 Heydebrand, Caroline von, Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule, Verlag Freies<br />
Geistesleben<br />
6 Koepke, Hermann, Das neunte Lebensjahr, Verlag Goetheanum Dornach/Schweiz<br />
7 Dietz, Karl-Martin, Dialogische Schulführung an Waldorfschulen, Menon Verlag
28 aUS dEM SchUllEbEn<br />
29<br />
12.-Klass-<br />
Waldorf-Abschluss-<br />
Jahresarbeiten
30<br />
Mit Blick auf den Zuschauer<br />
Die Zuschauer blicken von der Bühne aus auf die stummen Sitzreihen des LEO 17. Der Spieß wird<br />
umgedreht. Ein Umstand, den sich sowohl Konstantin Jannone als auch Theresa Ihrler in ihren<br />
dramatischen Jahresarbeiten zu Nutze machen.<br />
„SIEh ES alS SPIEl“<br />
Ein Stück, das Konstantin Jannone geschrieben hat und in dem er selbst auch als Darsteller auftritt.<br />
Die Zuschauer schreiten direkt in das Geschehen hinein – auf der Bühne befindet sich eine Kommandozentrale,<br />
ein PC steuert eine mehrere Quadratmeter große Projektion einer Luftaufnahme.<br />
Oder sind wir hier doch bei einem Sektempfang? Auffällig viele Alkoholika sind zentral im Raum<br />
platziert. Der Raumeindruck wird noch erweitert durch die Poles, die den Raum strukturieren und<br />
die an ihnen befestigten Sanduhren, sodass die Bühne zwischen provisorischem Militärlager, barocker<br />
Metaphernbühne, High-Tech-Zentrale und Stehempfang changiert. Zwei Männer, ein Mann des<br />
Militärs und ein Computer-Nerd betrachten aufgeregt die Luftaufnahmen einer schäbigen Baracke.<br />
Untermalt wird diese Szenerie durch sakrale Musik – sofort schleicht sich das Gefühl ein, bei etwas<br />
Bedeutendem und Geheimem zuzusehen, ein Ritual? Von was werden wir hier Zeugen? Das klärt<br />
sich relativ schnell. Die Baracke zeigt den Aufenthaltsort eines mutmaßlichen Terroristen, wir<br />
befinden uns im Nahen Osten in einer Kommandostelle der US-Army und kurz vor dem Abschuss<br />
des vermeintlichen Ziels. In dieser Situation werden in der nächsten Stunde drei Figuren das ganze<br />
Dilemma solcher Eingriffe verhandeln. Da ist die Agentin, die zweifelt. Die weiß, dass das Töten auf<br />
Verdacht vermutlich auch diesmal nur Unschuldige treffen<br />
aUS dEM SchUllEbEn wird – obwohl im Nachhinein von großen Erfolgen und dem<br />
Ausschalten eines bedeutenden Terroristen gesprochen<br />
werden wird. Die Agentin, die so stark reflektiert und permanent zweifelt, dass man ihr zuschreien<br />
möchte: „dann tu doch endlich was, Mädchen, hör auf, rum zu heulen und zieh endlich Konsequenzen!“.<br />
Aber dazu ist auch sie nicht in der Lage, hier gibt es keine Helden mehr. Der Commander,<br />
der an die Richtigkeit seines Handelns glaubt. So fest daran glaubt, dass es schon fast verzweifelt<br />
wirkt. Wir kämpfen hier für Freiheit, für Demokratie und was wir tun ist notwendig. Der Programmierer,<br />
der die Welt in Zahlen auf einem Bildschirm sieht, von dem auch der titelgebende Satz „Sieh<br />
es als Spiel“ kommt. Der die Verbindung zur echten Welt, zu dem Wissen, dass es hier um echte<br />
Menschen geht, verloren hat und deshalb in der Lage dazu ist, sich auszuklinken, Musik zu hören<br />
und einfach nur seinen Job zu machen. Die im Zweifel verharrende, der verblendet Handelnde und<br />
der unreflektiert Mitmachende. So klar die Positionen umrissen sind, so nah sind sie am Klischee.<br />
So einfach ist die Realität nicht. Das scheint aber auch Konstantin Jannone zu wissen, der im Laufe<br />
des Stücks geschickt damit anfängt, die vermeintliche „Realität“ zu demontieren. Mehr und mehr<br />
Psycho-Momente schleichen sich ein. Innere Monologe, eingebildete Geräusche, Wahnvorstellungen<br />
der Figuren sorgen dafür, dass sich verschiedene Realitäten und Persönlichkeiten ineinanderschieben.<br />
Das hätte man sicher noch weiter auf die Spitze treiben können, aber schon durch die<br />
vorhandenen Ansätze entsteht aus dem Aufeinandertreffen dreier überschaubarer Positionen ein<br />
Kaleidoskop der moralischen Fragen, des Gefühlsschlamassels, des Dilemmas in dem sich westliche<br />
Staaten, die im Namen des vermeintlich Richtigen die vermeintlich Falschen töten, immer und<br />
unbedingt befinden. Der Wahnsinn im Kopf der Soldaten. Hier werden große Fragen verhandelt von<br />
richtig und falsch, Leben und Tod, Macht und Ohnmacht. Das macht das Stück, in dem eigentlich<br />
sehr wenig an tatsächlicher Handlung passiert auch zu einem extremen Diskussionsstück – und<br />
damit zu einer großen Herausforderung für die Regie. Die sehr textlastige Vorlage wird aber klug<br />
inszeniert, mit klaren Gängen (die größte Gefahr bei viel Text und wenig Geschehen ist das sinnlose<br />
Herumlaufen!), konkreten Positionen für die Figuren, überlegtem Einsatz von Licht und Interaktion<br />
mit Requisiten.<br />
Überschrieben wird die Diskussion der Figuren durch eine Stimme aus dem Off, die Positionen der<br />
Medien, geschichtliche Informationen, grundsätzliche Moralfragen und abstrakte Erkenntnisse über<br />
zum Beispiel Herrschaft an sich beigibt. Dabei schrammt der Text zwar manchmal nur knapp an<br />
Melodramatik und Allgemeinplätzen vorbei, erfüllt aber mit Sicherheit den Zweck, das Bühnengeschehen<br />
weg von einer behaupteten Pseudo-Realität hin zu einem exemplarischen Durchexerzieren<br />
eines extrem vielseitigen Konflikts auf abstrakter Ebene zu führen. Dieser Konflikt wird zwar nur von<br />
einer Seite aus gezeigt, der Seite der Schießenden, aber das ist die Seite, die ein westeuropäischer<br />
Jugendlicher sich vorstellen kann, diese Art von Auseinandersetzung ist möglich. Und das muss<br />
man Konstantin Jannone ganz besonders hoch anrechnen: seine Fantasie, die es ihm und dem<br />
Publikum ermöglicht, an diesem Abend die innere Zerrissenheit, die posttraumatischen Belastungsstörungen,<br />
die verzweifelte Suche nach klaren Antworten plastisch nachzuvollziehen. Eine einfache<br />
Lösung wird nicht angeboten. Als die Münze, die über Gehen oder Bleiben entscheiden soll, in den<br />
Zuschauerraum geworfen und so die Antwort verweigert wird, spiegelt man sich in den, einem<br />
stumm entgegen starrenden Sitzreihen des LEO17 und muss sich automatisch fragen: Was würde<br />
ich tun? Die Zuschauer aus der stummen Nicht-Verantwortung heraus mit dieser Entscheidungsfrage<br />
zu konfrontieren, ist die große Leistung dieses beeindruckenden Theaterwerks.<br />
31
„WalKInG thROUh“<br />
Auch Theresa Ihrlers Stück beginnt mit dem Blick in den nun grün ausgeleuchteten Zuschauerraum.<br />
Quer durch die Theatergeschichte, durch Länder und Epochen spielen sich Theresa Ihrler und ihre<br />
Grillen zirpen, florale Lichtmuster kreisen auf dem Bühnenboden. Plötzlich tauchen zwischen den<br />
hochmotivierten Mitstreiter Joana Verbeek van Loewis und Lukas Martin. Dabei ist es gelungen,<br />
leeren Stuhlreihen wie aus der Zeit gefallen scheinende Figuren auf und beginnen rasant ein paar<br />
sehr elegante und zarte Mini-Übergänge zwischen den einzelnen Szenen zu bauen, die dem Abend<br />
Liebesverwirrungen aus dem Sommernachtstraum hin und her zu werfen. Wundersam verwandelt<br />
einen wirklich reibungslosen Drive verleihen.<br />
sich das Theater in den Shakespearschen Wald und die Fantasie, Verspieltheit und Spielfreude dieser<br />
In dieser Vielfalt und Sprunghaftigkeit kristallisieren sich aber doch Themenkreise heraus, die die<br />
Szene werden auch im weiteren Verlauf von „Walking Through“ nicht verloren gehen.<br />
Spielenden besonders beschäftigen zu scheinen. Aber auch ernstere Themen tauchen auf: Was<br />
Theresa Ihrler hat ihren Shakespeare gelesen. Die ganze Welt ist Bühne, das Leben ein Spiel und der<br />
bedeutet es, sich für eine Sache einzusetzen, wofür kämpften Gudrun Ensslin und die Revolutionäre<br />
Stoff aus dem die Träume sind, wird hier in einer sehr freien, unterhaltsamen und temporeichen Col-<br />
von Camus, kämpfe ich für das Richtige? Und auch der Tod findet in einem bestechenden Solo von<br />
lage über die Bühne gewirbelt. Wer sich auf lineares Erzähltheater eingestellt hatte, muss sich späte-<br />
Theresa Ihrler seinen Platz in dem Stück: Unter einem Fischernetz begraben singt sie allein „Komm,<br />
stens davon verabschieden, als Hermia sich das altmodische, beinah „historische“ Kleid vom Körper<br />
süßer Tod“. Dass ihre Stimme und auch die Töne dabei nicht perfekt sind, macht das Ganze noch viel<br />
reißt, darunter ihr stoffliches 21. Jahrhundert zum Vorschein kommt und nach der Shakespeare-<br />
echter und berührender.<br />
Szene per Video-Projektion munter mit einer jungen Mutter in (so scheint es) Australien geskyped<br />
Davor muss man sowieso den Hut ziehen: Die Energie und Lust, mit der Theresa Ihrler sich in das<br />
wird. Die Montage des Textes verlässt sich dabei auf aus dem Zusammenhang gerissene Worte als<br />
Geschehen wirft. Ohne Angst vor Peinlichkeiten heben sich die drei Darsteller mit ihrer Power über<br />
alleiniges Verbindungsmedium: Sprach nicht gerade eine alte Dame davon, wie sehr es sie störe,<br />
jeden Zweifel hinweg und gerade dass sie keine Gesangs- oder Sprechausbildung genossen haben<br />
32<br />
wenn ihr beim Einkaufen Kinder in den Weg kommen, habe ich da gerade Kinder gehört und schon<br />
ist man mitten in der russischen Revolution und bei Albert Camus, wo ein Attentat daran scheiterte,<br />
und man das auch merkt, macht den Abend so wunderbar ehrlich und sorgenlos – während gleichzeitig<br />
große Fragen verhandelt werden.<br />
33<br />
dass die Terroristin Angst hatte, mit der Bombe versehentlich auch Kinder zu töten.<br />
Dabei wird auch nicht gespart und tief in die Trickkiste des Theaters gegriffen, zahlreiche Kostüm-<br />
Diese Art der Textcollage mag einem auf den ersten Blick geradezu verwerflich unbesorgt erscheiwechsel<br />
und Umbauten finden statt, sogar ein eigentliches Theater No-Go verzeiht man dem Team:<br />
nen, erlaubt aber in ihrer Inhalt-Befreitheit die Entwicklung einer faszinierenden Assoziationskette.<br />
Die Baader-Meinhof-Damen ziehen an echten Zigaretten, die aber nicht brennen, sodass das „nur so<br />
tun als ob“ wirklich jedem Zuschauer ins Auge springt. Was sonst als absoluter Bruch mit der Illusion<br />
verteufelt wird, gerät hier zum charmanten, augenzwinkernden Detail: Hey, das hier ist Theater<br />
– natürlich tun wir nur so, wie Shakespeare eben sagte: Das ganze Leben ist eine Bühne, ein Spiel.<br />
32<br />
Dieses Augenzwinkern gewinnt die Collage übrigens immer dann besonders, wenn das Publikum<br />
mit einbezogen wird. Etwa, wenn Hermia sich vorwurfsvoll an die Zuschauer wendet, oder die<br />
Geigenspielern Elena sich nicht genug motiviert fühlt und „so nicht arbeiten“ kann. Die Krönung<br />
dieses Gestus gelingt aber Joana Verbeek von Loewis in einem improvisierten Monolog gegen<br />
Ende. Um eine Umbau-Pause zu überbrücken, stellt sie sich vor das Publikum und stellt auf sehr<br />
lustige und selbstironische Art und Weise das Gesamtgeschehen an sich in Frage. Spätestens zu<br />
diesem Zeitpunkt sollte auch jeder Collagen-Grantler mit der etwas hopsigen Struktur des Abends<br />
ausgesöhnt sein.<br />
Nach einem kurzen Ausflug in das Opern-Genre endet der Abend da, wo er begonnen hat: bei<br />
Shakespeare, dem Großmeister der Bühne. Die Moral von der Geschichte ist klar. Spielt um euer<br />
Leben, denn alles ist ein Spiel und wir sind nur Figuren auf einer Bühne namens Leben. Ein so naiver<br />
und frecher Blick auf das Leben ist beneidenswert, denn den drei hervorragenden Darstellern ist<br />
es an diesem Abend gelungen, uns wieder ein Stück Kind sein zu lassen und mit dem Theater den<br />
Alltag mit all seinen Herausforderungen und Problemen wieder etwas augenzwinkernder und<br />
spielerischer zu betrachten.<br />
33<br />
hannah SchOPF<br />
(Studentin der Dramaturgie an der August-Everding-Theaterakademie, München)
Hausbauepoche in der 3. Klasse<br />
Das neunte Jahr bedeutet einen wichtigen Einschnitt in der Entwicklung des werdenden Menschen.<br />
Es ist das Alter, in dem das Kind seine Abtrennung von der Umwelt, mit der es in so großer Selbstverständlichkeit<br />
vorher lebte, erst wirklich vollzieht. Sein Bewusstsein stärkt sich merklich, sein Seelenleben<br />
wird innerlicher und unabhängiger. 5 Das gefühlte Verbundensein mit der Welt will nun begriffen<br />
und erfasst werden. Daraus kann sich in den folgenden Jahren ein Verständnis für die Natur, die Tiere,<br />
den Menschen, die Arbeit und die Technik entwickeln. 5 Alle Angaben, die <strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong> im Lehrplan<br />
der Waldorfschule für die dritte Klasse gegeben hat, haben die Aufgabe, dem Kinde für die Aufnahme<br />
seines Ich eine Hülle zu bilden, Da ist zum Beispiel die Hausbau – Epoche. Wände werden aufgestellt,<br />
das Dach darüber gedeckt, die Außenwelt abgetrennt. In diesem Tun erlebt das Kind die Bildung<br />
seines Innenraumes, und dieses Raumerleben ist es, was das Kind sucht. Es findet zu sich selbst. Auch<br />
die Arbeit des Bauern lernt das Kind in diesem Alter kennen. Es pflügt die Erde und sät. Daran erlebt<br />
es wie im Bilde: „Wie der Keim sich entfaltet, so entfaltet sich auch mein Ich, das in meiner Seele einge-<br />
PaSInG-blUMEnaU<br />
KIndERhaUS<br />
haUSbaUEPOchE dER 3.KlaSSE<br />
Der Impuls, die Idee<br />
und das Konzept<br />
Der Impuls, die Hausbauepoche in der Blumenau durchzuführen,<br />
ging auf einem Elternabend von Frau Hellfeier<br />
aus. Sie berichtete von dem langjährigen Wunsch des<br />
Kindergartens, ein Spielhaus auf ihrem Gelände zu bauen.<br />
34<br />
pflanzt ist:“<br />
Im Oktober 2011 fand dann die erste gemeinsame Be-<br />
35<br />
sichtigung des vorgesehenen Platzes für das Spielhaus<br />
statt, bei dem die Beteiligten versuchten, den genius<br />
loci in der Blumenau zu erfassen. Herr Hejny skizzierte<br />
auf ein kleines, weißes Blatt Papier zwei Kuben, verbunden<br />
durch eine Brücke. Seine gestalterische Skizze haben<br />
wir in unseren Planungen aufgegriffen, Varianten<br />
34<br />
gezeichnet, diskutiert, wieder verworfen und erneut<br />
begonnen. Zu Sylvester 2011 steht das Konzept.<br />
35<br />
6<br />
KaRl hEjny<br />
Quellenangaben: siehe Seite 26<br />
Zwischen zwei Sandspielplätzen sollen die beiden Baukörper<br />
entstehen. Gebaut aus Holz und Stein sollen die<br />
kleinen Kuben als heiter gestaltete, farbige Würfel den<br />
Gartenraum beleben und gestalterisch auf das Hauptgebäude<br />
antworten. An je eine Kalksteinmauer, gebaut<br />
aus cremig-gelben Solnhofer Platten, sollen drei Wände<br />
angehängt werden, die zimmermannsmäßig gefügt,<br />
mit großformatigen Platten geschlossen und mit farbigen<br />
Holzleisten gestaltet sind.<br />
Eine Vielzahl von Plänen entsteht, die an mehreren<br />
Abenden diskutiert und im Detail besprochen werden.<br />
Josef Lehner hat alle Grundrisse, Ansichten, Schnitte<br />
und Details gezeichnet, Perspektiven und Farbkonzepte<br />
ausgedacht. Thomas Kubsa hat ein Modell gebaut, Jo-
hannes Leiste die Metallteile konzipiert und<br />
Michel Rösch die zauberhafte Mehrfarbigkeit<br />
der Gebäude erfunden. Die Ergebnisse des Entwurfsprozesses<br />
werden vom Vorstand des Kindergartens<br />
mit großer Freude aufgenommen.<br />
Er entscheidet: so soll das Kinderhaus werden.<br />
Die nächste Phase des Hausbaus kann damit<br />
beginnen. Es wurden die Baumassen ermittelt<br />
und Baumaterialien bestellt, die Fundamente<br />
exakt eingemessen. Eine besondere Herausforderung<br />
waren dabei die Kalksteinplatten. Wir<br />
haben in mehreren mittelfränkischen Steinbrüchen<br />
nach passendem Steinmaterial gesucht<br />
und es schließlich in einem riesigen Erdloch bei<br />
Grundsteinlegung<br />
In die Fundamente, die fein säuberlich und<br />
gestochen scharf in die Wiese eingefügt sind,<br />
versenken wir einen Grundstein. Er besteht aus<br />
einem Eisenrohr, das Johannes eigens dafür<br />
hergestellt hat. Eine Schülerin hat das Rohr in<br />
die Fundamentöffnung versenkt. Der Grundsteinspruch,<br />
unsere besten Wünsche und viele<br />
liebe Dinge, die unbedingt für künftige Archäologen<br />
erhalten werden müssen, sind in dem<br />
Rohr aufbewahrt. Mit einer Kalksteinplatte wurde<br />
die Öffnung vermauert.<br />
Ziegel, Kalksteine und Balken<br />
Im Regen wurde eine Riesenschlange gebil-<br />
Ziegelschichten, werden mit großen Holzplat-<br />
ten geschlossen und mit den farbigen Leisten<br />
bestückt. Schließlich sind auch die beiden<br />
Flachdachterrassen begehbar, die Leitertürme<br />
aufgestellt und die beiden Dächer montiert.<br />
Als die Brücke die beiden Baukörper verbindet,<br />
gibt es für die Kinder kein Halten mehr. Die Baustelle<br />
wird unermüdlich getestet und hinauf<br />
und hinuntergeklettert.<br />
Am 5.Juli wird ein farbig geschmücktes, kleines<br />
Bäumchen an die oberste Spitze unserer Häuser<br />
genagelt: Wir feiern das Richtfest!<br />
Einweihung<br />
36<br />
Solnhofen gefunden.<br />
det und die Kalksteinplatten vom Lager zur<br />
Baustelle geschleppt. Stein für Stein wanderte<br />
Nur vier Tage später weihen wir bei einem kleinen<br />
Fest unsere Häuser ein. Auf beiden Terras- 37<br />
In der Woche vor Baubeginn rollen die LKW von Hand zu Hand. Eine Gruppe hat begonnen,<br />
sen stehend, singen die Kinder zusammen mit<br />
am Kindergarten an: 9 Tonnen Solnhofer Plat- die 40cm dicke Mauer aus Kalksteinriemchen<br />
Herrn Hejny und führen ein kleines Handwerten,<br />
mehrere Paletten mit Fundamentsteinen, aufzumauern – eine harte Arbeit, die nur sehr<br />
kerspiel auf. Wir freuen uns alle, das Kinderhaus<br />
Mauerziegeln und Zementsäcken werden über langsam voran geht. Andere aus der Klasse ha-<br />
tatsächlich geschafft zu haben: In unserem<br />
den Zaun gehoben, eine Ladung Sand wird ben auf das Betonfundament mehrere Lagen<br />
Haus werden jetzt die Blumenauer Kindern<br />
abgekippt sowie Berge von Kanthölzern, Lei- Ziegel gemauert oder zusammen mit Herrn<br />
spielen!<br />
36 sten und Platten angeliefert. Zuhause werden Gairola Mörtel gemischt und im Schubkarren<br />
37<br />
Werkzeuge gesammelt - Maurerhammer, Kellen,<br />
Bohrer, Akku-Schrauber, Lote, Meterstäbe<br />
zu den Maurern transportiert. Und überall ist<br />
Monika Kraft: hilft, lernt an, schiebt aber auch<br />
Und zum Schluss<br />
und vieles mehr, bis hin zur Mörtelmischma- an und erklärt Handgriffe.<br />
Wir sind richtig froh und glücklich, dass wir alle<br />
schine. Das Personal und die Eltern des Kinder-<br />
zusammen etwas gemeinsam gebaut haben.<br />
gartens fassen es kaum: mit diesen Bergen an Gleichzeitig werden die sechs Holzrahmen<br />
Toll ist, dass wir uns beim Bauen auch unter den<br />
Baustoffen soll das kleine Kinderhaus gebaut ausgerichtet. Dafür müssen wir die Kanthölzer<br />
Eltern näher kennen gelernt haben, während<br />
werden?<br />
zuschneiden, anbohren und verschrauben. An-<br />
wir mit einander gearbeitet, uns gegenseitig<br />
dere haben sich unter einer großen Plane mit<br />
geholfen und dabei viel erzählt haben.<br />
Und dann geht alles sehr, sehr schnell: Wir ha- Michel eine Malerwerkstatt eingerichtet. In vier<br />
ben ja nur zwei Wochen Zeit, das Kinderhaus Farben (Grasgrün, Hellgrün, Karminrot, weiß<br />
Wir hoffen, dass die Blumenauer Kinder viel<br />
zu bauen. Weil Kinder und Eltern kräftig mit und farblos) lasieren sie die unendlich vielen<br />
Spaß mit den beiden Häuschen haben und sie<br />
arbeiten, sogar am Samstag und einmal am Holzleisten.<br />
genauso lieb gewinnen werden, wie wir alle di-<br />
Sonntag, wird alles fertig. Besonders toll ist,<br />
ese während der Bauzeit lieb gewonnen haben.<br />
dass uns eine Kindergartenmutter aus der Blu- Die Steinmauern in ihrem expressiven Erscheimenauer<br />
dabei so gut verpflegt hat mit allerlei nungsbild wachsen langsam und Schicht um<br />
KlaUS j.SchUlz<br />
Köstlichkeiten.<br />
Schicht bis zu einer Höhe von 250cm empor.<br />
geschrieben für Marie-Muriel und ihre<br />
Die Holzrahmen dagegen stehen rasch auf den<br />
Mitschüler und Mitschülerinnen aus der 3.Klasse!
Puppenspiel – Spiel oder Spielerei?<br />
Die Anfänge des Puppenspiels an der <strong>Rudolf</strong>-<strong>Steiner</strong>-<strong>Schule</strong> in <strong>Schwabing</strong> liegen mehr als eine<br />
Generation zurück und waren geprägt von Gegebenheiten, die man sich heute gar nicht mehr<br />
vorstellen kann.<br />
Aus der Initiative der Werklehrerin Juliane Hauck entstand vor mehr als 35 Jahren die Puppenspielarbeit.<br />
Eine ferne Zeit ist das: Da führte Frau Hauck wöchentlich eine Gruppe von Schulmüttern<br />
einen Vormittag lang in die Geheimnisse des Märchens und des Puppenspiels ein und<br />
baute Figuren mit ihnen. Wenn die fertig waren, was schon mal bis zu drei Jahren dauern konnte,<br />
wurde inszeniert, geprobt und gespielt. Zu dieser Zeit entstand eine Reihe von Märchenspielen,<br />
die auf improvisierten Bühnen in Werkräumen gezeigt wurden: z. B. „Der Bärenhäuter“ und „Der<br />
Teufel mit den drei goldenen Haaren“.<br />
Immer erfahrener wurden die SpielerInnen, immer besser die Spiele, bis schließlich „Wassilissa“,<br />
ein russisches Märchen, mit hohem künstlerischen und musikalischen Anspruch zu sehen war,<br />
das auch bei der Aufführung im Goetheanum in Dornach großen Anklang fand. Damit war der<br />
Jeden Herbst wartet ein treues Stammpublikum auf den Beginn der Spielsaison. Es kommen<br />
längst nicht mehr nur die Kinder und Eltern unserer Waldorfschulen, sondern sehr viele externe<br />
Zuschauer, die sich so ein Bild vom Charakter und Leben unserer <strong>Schule</strong> machen können und ein<br />
eigenes Verständnis gewinnen dafür, was da geschieht. Das sehen wir als Beitrag zu einer positiven<br />
Außenwirkung der <strong>Schule</strong>. Manche Eltern / Kinder sind auf dem Weg über das Puppenspiel<br />
an die <strong>Schule</strong> gekommen. Ein bemerkenswertes Phänomen ist, dass sich inzwischen ebenso viel<br />
Erwachsene an den Spielen erfreuen wie Kinder, es gibt auch hier ein Bedürfnis nach den Wahr-<br />
Bildern der Märchen.<br />
Für Zuschauer und Spieler ist es ein besonderes Erlebnis, wenn die Spiele den Klassen der Unterstufe<br />
im Rahmen des Hauptunterrichts gezeigt werden können. Wenn dann die Bilder kommen,<br />
die die Kinder im Anschluss in den Klassen malen, wird deutlich, wie intensiv sie die Märchenbilder<br />
beeindruckt haben.<br />
An den Puppenspiel-Wochenenden, die seit 18 Jahren zum festen Monatsablauf der <strong>Schule</strong><br />
gehören, sind die Stücke der beiden Marionettenbühnen so auf einander abgestimmt, dass<br />
kleinere und größere Kinder „bedient“ werden, während das Tischpuppenspiel der Kindergärtne-<br />
38<br />
allgemeine Wunsch wach geworden, das Puppenspiel auf Dauer an der <strong>Schule</strong> zu etablieren und<br />
ihm einen festen Spielort zu geben. So entstand nach langer Planung die eingebaute „Große Marinnen<br />
für die ganz Kleinen gedacht ist.<br />
In der Spielsaison 2011/<strong>2012</strong> freuten sich 1150 Zuschauer an den Spielen, allein über 300 beim 39<br />
rionettenbühne“ im Raum 207. Zu deren Aufführungen kommen seit 14 Jahren die inzwischen<br />
Adventsfest, dazu kommen die 430, die an einem Wochenende im März die „Tokkel-Bühne“<br />
fünf Märchenspiele der „Blauen Marionettenbühne“, die im Raum 204 steht.<br />
gesehen haben.<br />
Seit den Anfängen des Puppenspiels an der <strong>Schule</strong> hat sich die Welt verändert; welche Mütter<br />
Die Puppenspieler arbeiten ehrenamtlich (für die Tokkel-Bühne müssen wir Gage zahlen). Aus<br />
können sich heute noch einen ganzen Vormittag lang in der <strong>Schule</strong> mit Puppenspiel beschäfti-<br />
den Kostenbeiträgen werden zunächst die jeweils neuen Inszenierungen finanziert, der weitaus<br />
gen oder welche Eltern viele Abende und Wochenenden für Proben drangeben? Das ist einer der<br />
größere Teil aber wird regelmäßig für das Rumänienprojekt der 11. Klasse, für die Partnerschule<br />
Gründe, weshalb junge Eltern nicht mehr einsteigen und die meisten Spieler ins Großelternalter<br />
in Rom und, je nach aktuellem Bedarf, für Puppenspiel-Projekte an Waldorfeinrichtungen in<br />
gekommen sind. Viele der Puppenspieler halten ihrer Aufgabe und der <strong>Schule</strong> schon über 20<br />
Georgien und Südafrika gespendet.<br />
Jahre die Treue. Sie bauen die Marionetten und schneidern die Kostüme, entwerfen und bauen<br />
So kommt es zu einer ganz besonderen Art des Geldumlaufs: die Eltern geben ihren Beitrag für<br />
das Bühnenbild, ein bis zwei Jahre dauert das, und dann beginnen die zeitaufwendigen Proben<br />
die Freude der Kinder, das Märchenspiel zu sehen, ein großer Teil der Einnahmen fließt dann in<br />
an den Abenden und Wochenenden.<br />
Warum machen sie es? Es geht nicht um „Basteln“, vielmehr ist es eine Berufung, ein Anliegen,<br />
soziale Projekte, die wiederum ihren Teilnehmern neue Chancen und Freude bringen.<br />
das mit dem der <strong>Schule</strong> konform geht. <strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong> nannte das Puppenspiel “ein Heilmittel<br />
gegen Zivilisationsschäden“, die wir heute mit aller Heftigkeit zu spüren bekommen. Besonders<br />
die Kinder, die ja Bilder aufnehmen, weil sie sich seelisch davon ernähren wollen, haben keine<br />
Möglichkeit, aus den sie überflutenden Bildern die ihrem Entwicklungsstand entsprechenden<br />
herauszufiltern. Diese Überforderung kann verhärtend und die Gefühle abtötend auf die<br />
bildsamen Seelen der Kinder wirken. Puppenspiele mit sinnerfüllten Bildern unterstützen eine<br />
positive Kindesentwicklung.<br />
An unserer <strong>Schule</strong> spielen wir hauptsächlich Märchen. Das sind keine erfundenen Geschichten,<br />
die Märchen kommen aus dem Mythenbereich und beschreiben tiefgründig urbildhaft mehr als<br />
nur menschliches Individualschicksal. Sie berichten von tiefer liegenden, den Menschen allgemein<br />
betreffenden seelischen und geistigen Zuständen. Das Kind versteht diese Bildersprache,<br />
es fühlt sich erinnert an die Welt, aus der es gekommen ist, und gewinnt daraus Sicherheit, Mut<br />
und Freude am Dasein.<br />
cIllI Und MathIaS UEblacKER
Rückblick und Ausblick<br />
WIRtSchaFt andERS dEnKEn – bRüdERlIch WIRtSchaFtEn<br />
WERKStatttaGE vOM 3. bIS 6. OKtObER <strong>2012</strong> an dER<br />
RUdOlF-StEInER-SchUlE ISManInG<br />
Wie ein roter Faden zog sich die Erkenntnis durch die Werkstatttage, dass wir Menschen weiter<br />
sind, als die Verhältnisse. Jeder von uns arbeitet durch die Arbeitsteilung schon längst selbstlos<br />
ganz für die anderen Menschen und diese arbeiten für uns selber, aber das ist nicht in unserem<br />
Bewusstsein angekommen und schon gar nicht in der Gestaltung der wirtschaftlichen Einrichtungen.<br />
Dort wird immer noch der Egoismus als Triebfeder und Dreh- und Angelpunkt genährt.<br />
Wir Menschen sind also weiter, als die Verhältnisse, aber auf der anderen Seite gilt auch die Ergänzung<br />
dieser Wahrheit durch die Ermahnung von Boniface Mabanza aus der Demokratischen<br />
Republik Kongo, die Macht der Verhältnisse nicht zu unterschätzen. Denn wie ist es möglich,<br />
dass eines der fruchtbarsten und an Bodenschätzen reichsten Länder der Erde wie der Kongo<br />
40<br />
zu den ärmsten Ländern der Erde gehört? In einer zynischen Entstellung des heilsamen brüderlichen<br />
Wirtschaftens teilen sich reiche Industrieländer und kongolesische Herrschaftscliquen<br />
„brüderlich“ die Beute aus dem geplünderten und geschundenen Land.<br />
41<br />
Die meisten Teilnehmer an den Werkstatttagen, Oberstufenschüler wie Erwachsene, beschrieben<br />
unsere gängige Wirtschaft treffend und formulierten auch übereinstimmend, dass eine<br />
Wirtschaft, die sie haben wollen, gerecht und von allen bestimmt sein muss. Es gibt bei uns<br />
und weltweit inzwischen gut funktionierende alternative Wirtschaftsformen. Sie bestehen neben<br />
dem noch vorherrschenden alten Wirtschaften und brauchen unsere Unterstützung und<br />
die Zusammenarbeit untereinander. Auch die Unterstützung nimmt zu, muss aber noch weiter<br />
um sich greifen. So wie sich die bürgerliche Gesellschaft mit ihren Freiheitsimpulsen aus dem<br />
Schoße des Feudalismus herausentwickelt hat, kann sich eine brüderliche Wirtschaft aus dem<br />
Schoße des Kapitalismus herausentwickeln.<br />
Was jeder dazu beitragen kann, ist entscheidend. So führt schon allein der Wechsel zu einer<br />
Bank, die menschengerecht handelt, zu einer maßgeblichen Unterstützung des gesundenden<br />
Prozesses. Man entzieht dadurch ungerechtem Wirtschaften den Geldhahn, zum Beispiel dem<br />
Waffenhandel mit dem Kongo, und macht sozial sinnvolle Entwicklungen und Gründungen<br />
möglich. Damit ändert jeder von uns die Macht der Verhältnisse gleich doppelt und trägt dazu<br />
bei, dass sich diese Verhältnisse unserem tatsächlichen menschlichen Entwicklungsstand anpassen.<br />
Am Ende der zwei Tage für die Oberstufenschüler zeigten diese in einer lebendigen, überraschenden<br />
Präsentation schlaglichtartig, was sie aufgenommen hatten. Im Abschlusskreis<br />
des öffentlichen letzten Tages war die Aufbruchsstimmung der meisten Teilnehmer zu neuen<br />
wirtschaftlichen Taten gegenwärtig, in einem Raum voller Licht und Wärme, nicht nur im<br />
physischen Sinne. „Brüderlich wirtschaften“ klopfte an bei den Herzen der Teilnehmer und machte<br />
bewusst, was die Schriftstellerin Christa Wolf so ausdrückte: „Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht<br />
jetzt?“ So konnte ein Blick in die Runde des Abschlusskreises auch die freudige Gewissheit auslösen,<br />
dass wir diejenigen sind, auf die wir schon immer gewartet haben.<br />
Im Herbst 2014, dann zum dritten Mal, soll voraussichtlich wieder Wirtschaft anders gedacht werden,<br />
in der Michaelszeit und damit auch ein michaelisches Zeichen während des kollektiven Rausches beim<br />
Oktoberfest setzend, eines Rausches, der ja nicht nur dem Bierkonsum geschuldet ist.<br />
Vorher soll ein anderes großes Ereignis auf die Beine gestellt werden. An der Ismaninger <strong>Schule</strong> entstand<br />
die Idee, den gesamten „Faust“, also Teil eins und Teil zwei von den zwölften Klassen der Münchner<br />
und möglicherweise auch anderer Waldorfschulen zur Aufführung zu bringen und zwar vom 21.<br />
2. bis 28. 2. 2014. Interessanterweise hat „Faust“ auch viel über das Wirtschaftsleben zu sagen. Goethe<br />
stellt Faust im zweiten Teil seines Stückes auch als Unternehmer dar. Es ist verblüffend, wie treffend er<br />
dabei unsere heutige Wirtschaftsweise beschreibt und deren geistige Hintergründe aufleuchten lässt,<br />
die sich sonst nicht so deutlich erkennen lassen.<br />
Die Werkstatttage sind weiterhin im Internet anwesend unter www. wirtschaft-anders-denken.de<br />
hEInz UllMann<br />
RUdOlF-StEInER-SchUlE ISManInG
EIndRUcK vOn MEInEM aUFEnthalt In dEn USa<br />
Amerika-<br />
das Land<br />
der tausend Möglichkeiten<br />
Sie bewegen sich außerhalb ihrer Dörfer nicht anders als in ihnen, und für den Betrachter entstehen<br />
immer wieder bizarre Momente und Situationen.<br />
Sind Kutschen auf einer Straße zugelassen, so ist sie entsprechend beschildert. Auch auf manchen<br />
Autobahnen dürfen die schwarz lackierten Kutschen der Amish People fahren – allerdings nur auf<br />
dem Seitenstreifen. Es gibt spezielle Straßenschilder für Amish People.<br />
Auf den riesigen Parkplätzen vor Supermärkten sah ich eigens ausgewiesene Parkplätze für Kutschen<br />
und Pferde, beschildert mit „Horse and Buggy Parking“, eine überdachte Unterstellmöglichkeit –<br />
auch ein sehr befremdliches Bild und im Widerspruch zur Amish People Regel, nur selbst angebaute<br />
Lebensmittel zu essen.<br />
Die Amish People haben in vielen Bereichen strenge Regeln, denen sie gehorchen, die sie aber immer<br />
wieder auch durchbrechen, indem sie sich in bestimmten Dingen doch dem modernen Leben an-<br />
42<br />
Amerika – Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Man kann auch sagen: Land der unbegrenzten<br />
Möglichkeiten, zu leben. In Amerika findet man viele verschiedene Lebensweisen. Eine davon konnte<br />
passen. Für mich war es sehr verwunderlich, zu sehen, dass die Amish People Smartphones besitzen<br />
und benutzen. Da sie keine Elektrizität haben, laden sie die Smartphones mit Solarstrom auf. In dem<br />
Dorf, das ich besuchte, gibt es eine eigens gebaute Solarstromaufladestelle, an der mitten auf dem 43<br />
ich während meines vierwöchigen USA-Aufenthaltes etwas näher kennenlernen. Ich verbrachte die<br />
Dorfplatz viele Smartphones hingen und geladen wurden. Dies sah sehr seltsam aus. Einmal sah ich<br />
vier Wochen in Pennsylvania. In diesem Bundesstaat leben sehr viele sogenannte Amish People, deren<br />
eine Amish-Frau in einem Einkaufszentrum in einem McDonald’s-Restaurant sitzen und Burger mit<br />
Vorfahren im 18. Jahrhundert eingewandert sind. Einige Mitglieder dieser Bevölkerungs-gruppe sind<br />
Pommes essen, obwohl sie eigentlich nur ihre selbst angebauten Nahrungsmittel essen dürfte. Soweit<br />
Freunde meiner Verwandten. So hatte ich die Gelegenheit, ein Dorf der Amish People zu besuchen.<br />
ich mitbekommen habe, werden die Amish People von den Amerikanern in ihrer Lebensweise nicht<br />
Deren Art zu leben, ihre Kleidung, ihre Regeln, all das war für mich sehr beeindruckend, sehr fremd<br />
nur akzeptiert, sondern durchweg toleriert. Freundschaften außerhalb der Amish Gemeinde sind<br />
und machte mich neugierig. Das Dorf mit seinen ungewohnt gekleideten Bewohnern wirkte zunächst<br />
erlaubt und werden gelebt. Für die Amerikaner, die in der Nachbarschaft von Amish Dörfern leben,<br />
wie eine Filmstadt auf mich. Es gibt keine Straßen und keine Autos. Überall stehen Kutschen herum<br />
sind die Bilder alle ganz normal - für mich ist die Lebensweise der Amish People sehr befremdlich und<br />
und sind Pferde zu sehen. Die Häuser sind alle aus Holz und die Leute tragen Bauernkleidung aus dem<br />
19. Jahrhundert. Sie wirken alle sehr freundlich und aufgeschlossen, fanden es ganz normal, dass wir<br />
irreal geblieben, eine von unbegrenzt vielen Möglichkeiten und sicherlich nicht meine!<br />
zu Besuch kamen. Die Amerikaner aus der Umgebung kommen ganz selbstverständlich in die Dörfer<br />
und kaufen in den Läden ein. Sie bieten in der Region angebaute und hergestellte Waren an.<br />
Die Amish People leben ausschließlich in ihren Dörfern und nach ihren eigenen Regeln. Die Bauernkleidung<br />
aus dem 19. Jahrhundert ist Pflicht und für alle gleich. Die Frauen und Mädchen tragen<br />
lange blaue, graue oder schwarze Kleider und Kopftücher. Die Männer tragen alle lange Bärte, ab dem<br />
Zeitpunkt ihrer Hochzeit. Ihre Kleidung, sehr schlicht, einfarbig und ohne Verzierung, besteht aus einer<br />
schwarzen Jacke, Hosenträger, weißem Hemd und einem Strohhut - wie Kostüme für einen historischen<br />
Film; die Amish People sprechen Englisch und eine spezielle Art Deutsch.<br />
Nicht nur ihre Kleider sind noch so wie vor zwei Jahrhunderten von ihren Vorfahren getragen, auch in<br />
allen anderen Arbeits- und Freizeitbereichen leben sie wie im 18. oder Übergang zum 19. Jahrhundert.<br />
So haben sie keinerlei Elektrizität. Sie bauen ihre eigenen Nahrungsmittel an und arbeiten immer noch<br />
mit Pferden auf den Feldern. Längere Strecken als Fußwege legen sie nur mit ihren Kutschen zurück.<br />
Alle Familien praktizieren sogenanntes Homeschooling: die Eltern unterrichten die Kinder zu Hause.<br />
Ihre Religion ist christlich, aber sie haben ihre eigenen Priester und Kirchen. Sie gehen nicht zu Wahlen,<br />
d.h. sie nehmen nicht am politischen Leben teil. Sie suchen auch weder Arzt noch Krankenhaus<br />
auf; auch nicht in lebensbedrohlichen Situationen.<br />
anna tItzE, 10. KlaSSE
Bio für Kinder<br />
PRESSEKOnFEREnz dER Stadt MünchEn<br />
Am 30.11.12 sind sechs Schüler aus den Klassen 8 und 9 zur Pressekonferenz „Bio für Kinder“ eingeladen<br />
worden. Unsere <strong>Schule</strong> ist seit einigen Jahren Teil dieses Projektes und war an diesem Tag<br />
stellvertretend für alle <strong>Schule</strong>n, die auch auf 100% Bio-Kost umgestellt haben, ausgewählt worden,<br />
um dort zu kochen.<br />
Im Ziemanns Kochstudio erwartete uns eine schöne große Küche mitsamt der Köchin und ihrem<br />
Gemüse. Frau Petrone teilte uns in Gruppen ein, die die verschiedenen Dinge zubereiten sollten,<br />
die dann das Menü ergaben. Wir z.B. kümmerten uns um das Dessert. Es gab Spinatspätzle mit<br />
frischer Tomatensauce, Semmelknödel mit Gemüserahmsoße, Rohkost mit Dip und zum Schluss<br />
Apfelschnee.<br />
Während wir kochten, wurden Fotos gemacht, Fragen gestellt und eifrig probiert. Am Ende ser-<br />
44<br />
vierten wir den Gästen das Essen, welches hoch gelobt wurde. Die Abendzeitung befragte zwei<br />
Schülern zum Thema Bio-Kochen und Bio-Essen in einem Interview. Es wurden Gruppenfotos<br />
gemacht und viel geplaudert. Zum Schluss sind wir froh und mit vollem Bauch wieder abgedüst.<br />
Danke an alle, die bei dem Projekt beteiligt waren!<br />
45<br />
SaRa dIEtl Und claRa WESSEl, 9. KlaSSE<br />
„Waldorfschule will und kann ihrem innersten Wesen nach<br />
immer nur täglich neu aus der vollen Hingabe und der<br />
Bereitschaft zur geistigen und moralischen Entwicklung<br />
der in ihr Tätigen entstehen.“<br />
<strong>Rudolf</strong> <strong>Steiner</strong>
Neue Gesichter an unserer <strong>Schule</strong><br />
Ines Klante<br />
Hallo! Mein Name ist Ines Klante, ich bin 30 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem unteren<br />
Bayrischen Wald (Landkreis Freyung-Grafenau). Ich unterrichte seit diesem Schuljahr Englisch in den<br />
Klassen 5 mit 7. Mit Ende des letzten Schuljahres habe ich meine Ausbildung zur Gymnasiallehrerin in<br />
Regensburg mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen. Neben Englisch habe ich auch Französisch<br />
als zweites Hauptfach an der Universität Regensburg studiert. Das Unterrichten an der <strong>Rudolf</strong>-<br />
<strong>Steiner</strong>-<strong>Schule</strong> bedeutete eine Umstellung für mich, da ich als Schülerin an der Staatsschule war und<br />
bisher nur an dieser unterrichtet habe. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Kollegen, die mir<br />
durch ihre freundliche Aufnahme den Einstieg sehr erleichtert haben.<br />
InES KlantE<br />
Pia Sauerborn<br />
Als ich kürzlich eine Vertretungsstunde in der ersten Klasse gehalten habe, kam ein aufgeregtes Kind<br />
zu mir, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte mit Bestimmtheit: „Dich kenne ich, ich habe dich<br />
hier schon mal gesehen!“. Auch wenn ich seit Beginn des Schuljahres viele Menschen der Schulfamilie<br />
kennenlernen durfte, ist es doch mit einigen bislang bei solchen flüchtigen Begegnungen geblieben,<br />
wie mit der Erstklässlerin. Besonders diesen möchte ich mich kurz vorstellen.<br />
Mein Name ist Pia Sauerborn. Ich wurde zwar in Westberlin geboren, habe meine Kindheit allerdings<br />
zunächst in Stuttgart, dann in Hamburg verbracht. Nach dem Abitur bin ich von Hamburg nach München<br />
gezogen, um an der LMU Deutsch und Erdkunde für das gymnasiale Lehramt zu studieren. Hier,<br />
in meiner Wahlheimat, bin ich, mit Ausnahme eines Auslandsjahres in Amsterdam, bis zu meinem<br />
Abschluss geblieben. Den einmal eingeschlagenen Weg zu Ende gehend, habe ich im Anschluss<br />
an das erste Staatsexamen meinen Vorbereitungsdienst in Mühldorf am Inn sowie in Lindenberg<br />
im Allgäu abgeleistet. Sowohl die Jahre an der Uni als auch die im Staatsdienst möchte ich nicht<br />
missen, haben sich mir doch neben einer Reihe an Herausforderungen auch viele neue Perspektiven<br />
und Ideen erschlossen. Allerdings wurden bereits gegen Ende meines Studiums die vielen schönen<br />
Erinnerungen an meine eigene, dreizehnjährige Waldorfschulzeit in meinem Gefühl und, durch die<br />
theoretische Beschäftigung mit Waldorfpädagogik, zunehmend auch in meinem Verstand lauter. So<br />
kam es dann, dass ich mich vergangenen Winter an der <strong>Schwabing</strong>er Waldorfschule beworben habe.<br />
Nun unterrichte ich an dieser <strong>Schule</strong> seit Beginn des Schuljahrs Deutsch und Erdkunde als Fachlehrerin<br />
ab der sechsten Klasse bis zum Abitur.<br />
Schon vom ersten Augenblick an habe ich mich in der <strong>Schule</strong> unheimlich wohl gefühlt und dieser<br />
Eindruck ist geblieben. Ich bin froh, hier zu sein.<br />
PIa SaUERbORn<br />
46 47
Barbara Gmeindl<br />
Nach meiner Schulzeit an dieser <strong>Schule</strong> und dem Studium in München unterrichtete ich lange Zeit<br />
in Siegen. Ich führte 2 Durchgänge von der ersten bis zur 8. Klasse. Dazwischen hielt ich mich in den<br />
USA auf und half beim Aufbau eines Kindergartens in einem Indianerreservat in South Dakota. Nach<br />
dem 2. Durchgang in Siegen ging ich für einige Zeit nach Peru. Ich lernte Spanisch und unterrichtete<br />
in Lima an verschiedenen Waldorfschulen und einem Lehrerinstitut. Außerdem lernte ich die Bauern<br />
in den Anden kennen, die mit einfachsten Mitteln und Geräten ihren Boden bestellten. Die Familien<br />
lebten in großer Armut, die Kinder legten weite Wege zurück, um die nächste Dorfschule besuchen zu<br />
können.<br />
Nach siebenjähriger Tätigkeit in Peru kehrte ich nach Deutschland zurück und arbeitete an verschiedenen<br />
internationalen <strong>Schule</strong>n und einer Waldorfschule im Schwarzwald. Nun finde ich hier in<br />
München ein neues Aufgabenfeld.<br />
baRbaRa GMEIndl<br />
Gabriele Haselmayer<br />
Geboren bin ich 1965 in Würzburg. Mit 15 Jahren wusste ich, dass ich Malerin werden wollte und<br />
hatte ein großes Vorbild, Leonardo Da Vinci. 1989 verfolgte ich dieses Ziel an einer privaten kleinen<br />
Kunstschule in München. 1991 wurde dieses Ziel erst einmal bis auf weiteres verschoben, da mein<br />
Sohn zur Welt kam, worüber ich mich sehr freute. 1993 fing ich an der Hochschule für Gestaltung in<br />
Offenbach an, Kommunikationsdesign zu studieren mit Schwerpunkt Malerei und Zeichnen. 2001<br />
schloss ich das Studium mit Diplom zum Thema Todesmetaphern ab. Die Auseinandersetzung mit<br />
dem Scherenschnitt veranlasste mich 2004 für zehn Wochen in die Mongolei zu reisen, in den Händen<br />
ein Stipendium des DAAD. Ich studierte die Landschaft und führte Interviews mit den Nomaden zum<br />
Begriff Heimat.<br />
Es blieb nicht bei der Malerei und den Scherenschnitten, zudem bildete ich mich weiter in Techniken<br />
wie Hoch- und Tiefdruck aus. Ich unterrichtete zuletzt an der Fachhochschule Mainz diese Techniken<br />
und leitete die Werkstatt für Hoch- und Tiefdruck. Seit September arbeite ich an der <strong>Schwabing</strong>er<br />
<strong>Schule</strong> als Vertretung von Frau Heitsch und bringe den Oberstufenklassen die verschiedenen Formen<br />
und Techniken der bildnerischen Praxis nahe.<br />
Das Spannende im Kunstunterricht ist für mich der Prozess des Sehens, Beobachtens und sich Herantastens<br />
an die Dinge und dieses Sehen in ein Entstehen zu transformieren.<br />
GabRIElE haSElMayER<br />
48 49
Uwe Gallenkamp<br />
Nach einer knapp zwanzigjährigen wissenschaftlichen Tätigkeit bei der Gesellschaft für Anlagen- und<br />
Reaktorsicherheit in Garching bei München konnte ich meine ersten Erfahrungen als Gymnasiallehrer<br />
bei der Schulstiftung Seligenthal, einer staatlich anerkannten katholischen Privatschule in Landshut<br />
an der Isar sammeln. Das Unterrichten von Schulklassen bereitet mir seitdem große Freude. Das<br />
Verzichten auf einen zentralistisch vorgegebenen Lehrplan, wie es Waldorfschule ermöglicht, scheint<br />
mir gerade im Zeitalter der nicht mehr enden wollenden Globalisierung als der für Schüler und Lehrer<br />
überzeugendere Weg. Seit Beginn des Schuljahres <strong>2012</strong>/13 unterrichte ich als Vertretungslehrer in<br />
den Klassen 11 und 12 an der RSS München-<strong>Schwabing</strong> und bereite die MR-Klasse auf die Realschulprüfung<br />
in Mathematik vor.<br />
Dr. rer. nat. Uwe Ernst Heinrich Gallenkamp, Diplomphysiker, geboren 1963, evangelisch, verheiratet<br />
seit 1990 mit der Cellistin und Musikpädagogin Ruth Ritzkowski-Gallenkamp, vier gemeinsame Kinder:<br />
Juliane Gallenkamp, geboren 1993, Charlotte Gallenkamp, geboren 1995, Alexandra Gallenkamp<br />
geboren im Jahr 2000 und Caroline Gallenkamp, geboren 2009.<br />
Peter Gebert<br />
KaUFMännISchER GESchäFtSFühRER<br />
Ich freue mich sehr, mich Ihnen in den Schlaglichtern vorstellen zu können. Peter Gebert, seit 1.6.<strong>2012</strong><br />
Kaufmännischer Geschäftsführer. Geboren wurde ich 1964 in Nordbayern an der Grenze von Oberpfalz<br />
und Mittelfranken. Seit 1987 lebe ich in Oberbayern, zunächst in München und seit 2001 im<br />
Alpenvorland rund um Bad Tölz.<br />
Mein beruflicher Werdegang ist von zwei wesentlichen Stationen geprägt: meine medizinische Ausbildung<br />
als Fachpfleger für Chirurgie, Über- und Unterdruckmedizin, Luftrettungs- und Katastrophenmedizin.<br />
Nach einigen Jahren im OP, auf dem Rettungshubschrauber und in Krisen- und Katastrophengebieten<br />
auf der ganzen Welt zwang mich ein Reitunfall beruflich einen anderen Weg einzuschlagen.<br />
So kam ich zu meiner zweiten Station: Steuerrecht und Betriebswirtschaftslehre. Berufsbegleitend zu<br />
einer Ausbildung studierte ich BWL, arbeitete anschließend als Abteilungsleiter in mittelständischen<br />
Unternehmen. 2006 übernahm ich die wirtschaftliche Leitung einer Privatschule mit Internat. In den<br />
6 Jahren als wirtschaftlicher Leiter habe ich viel Erfahrung in schulischen, reformpädagogischen und<br />
außerschulischen Dingen sammeln können.<br />
Meine wenige Freizeit gehört in der Hauptsache den Vierbeinern. Mit Pferden, Hunden und Katzen<br />
bin ich aufgewachsen und auch heute gehören zwei Katzen (Papageno und Figaro), ein Hund (Mr. Big,<br />
den ich auch immer wieder im Büro dabei habe), und unsere beiden Pferde (D`Aragorn und Lacoste)<br />
zu unserer Familie. Schon als Jugendlicher begann ich mit dem Turnierreiten und gehe auch heute<br />
noch regelmäßig an den Start, wenn es die Zeit und der Trainingszustand zulassen.<br />
Ich bin begeisterter Hobbykoch. Dabei finde ich dann auch die Gelegenheit meine Lieblingsmusik zu<br />
hören: Swing und Big Band Sound.<br />
Ich freue mich sehr, dass ich Teil der <strong>Rudolf</strong>-<strong>Steiner</strong>-<strong>Schule</strong> <strong>Schwabing</strong> und der gesamten Waldorfbewegung<br />
werden konnte.<br />
IhR PEtER GEbERt (hIER bEIM tRaInInG MIt lacOStE)<br />
50 51<br />
51
52<br />
Das Beste zum Schluss:<br />
„Da haben wir den Salat!“<br />
Waldorfsalat<br />
Im Jahre 1893 wurde der Waldorfsalat erfunden. Sein Name<br />
geht auf das berühmte New Yorker Hotel Waldorf Astoria<br />
zurück, dessen damaliger Oberkellner, der Schweizer Oscar<br />
Tschirk, hatte nämlich die Idee für den Klassiker.<br />
Einige Jahre später veröffentlichte er die Rezeptur für<br />
Waldorfsalat in seinem Kochbuch „The Cook Book by Oscar of<br />
the Waldorf“.<br />
Zutaten:<br />
250 g Sellerie<br />
250 g Äpfel<br />
100 g Walnüsse<br />
100 g Mayonnaise<br />
2 EL Zitronensaft<br />
4 EL süße Sahne<br />
etwas Salz<br />
Sellerie schälen, roh in sehr feine Streifchen schneiden (oder<br />
auch bißfest kochen und dann schneiden). Äpfel schälen,<br />
vom Kerngehäuse befreien, ebenfalls in Streifen schneiden.<br />
Nüsse abziehen und feinhacken, einige davon zum Garnieren<br />
zurücklegen.<br />
Mayonnaise mit Zitronensaft und Salz abschmecken, Sahne<br />
schlagen und unterheben oder ungeschlagen mit der Mayonnaise<br />
verrühren.<br />
Zutaten mit der Soße vermengen, in eine Salatschüssel<br />
geben, mit restlichen Walnüssen garnieren.<br />
Vor dem Servieren 2 Stunden kühl<br />
ziehen lassen.<br />
Do 20.12.12 20:00 TheaTer Oberufer Weihnachtsspiele<br />
52 tERMInE<br />
53<br />
Fr<br />
18.01.2013<br />
20:00<br />
Pavillon Informationswochenende zur Aufnahme in die<br />
Sa 19.01.2013 9-13:00<br />
neue 1. Klasse<br />
Mo-Fr 04.-08.02-2013 20:00 TheaTer Theateraufführungen der 12. Klasse<br />
Fr 08.03.2013 18:00 TheaTer öffentliche Monatsfeier<br />
Do 21.03.2013 19:00 TheaTer Frühlingskonzert<br />
Sa 13.04.2013 10:00 SchulhauS Hausputztag<br />
Sa 27.04.2013 9:00 SchulhoF Flohmarkt<br />
Sa 04.05.2013 14-18:00 SchulhauS Maifest<br />
TERMinE<br />
<strong>2012</strong><br />
2013<br />
Mo-Fr 13.-17.05.2013 20:00 TheaTer Theaterspiel der 8. Klasse<br />
Do, Fr 27./28.06.2013 19:00 TheaTer Präsentation der Jahresarbeiten der 8. Klasse<br />
Fr 05.07.2013 19:00 TheaTer Öffentliche Monatsfeier<br />
Do 11.07.2013 19:00 TheaTer Eurythmieaufführung der 11. Klasse<br />
Do 25.07.2013 15:00 loDenFrey- Circus Leopoldini<br />
Fr 26.07.2013 15:00 gelänDe<br />
Sa 27.07.2013 15:00<br />
So 28.07.2013 15:00<br />
Do 25.07.2013 20:00 loDenFrey- Leopoldini „das Variete“<br />
Fr 26.07.2013<br />
gelänDe<br />
Sa 27.07.2013<br />
Di 30.07.2013 8:15 TheaTer Feier zum letzten Schultag
54 IMPRESSUM<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
herausgegeben von der <strong>Rudolf</strong>-<strong>Steiner</strong>-<strong>Schule</strong><br />
<strong>Schwabing</strong> leopoldstr.17 80802 München<br />
www.waldorfschule --schwabing.de<br />
Mitglied im bund der Freien Waldorfschulen<br />
Mitarbeiter dieser Ausgabe:<br />
REdAKTion:<br />
Michaela bodensteiner, bodo bühling,<br />
Saba bussmann, gisela Meining-Schopf,<br />
Julia Schützenberger<br />
lAYoUT + bildbEARbEiTUng:<br />
Saba bussmann<br />
EndKoRREKTUR:<br />
gisela Meining-Schopf<br />
Redaktionsanschrift:<br />
redaktion@waldorfschule-schwabing.de<br />
Ausgabe 3 dezember <strong>2012</strong><br />
druck: flyermaschine.de<br />
bankverbindung: hypoVereinsbank<br />
blZ 70020270, Konto 6060269406<br />
Unverlangt eingesendete beiträge können<br />
nicht zwangsläufig berücksichtigt werden.<br />
die Redaktion behält sich Kürzungen<br />
vor (Richtwert 2000 Zeichen).<br />
bildnachweis:<br />
Fotos von Arbeiten der Schüler unserer <strong>Schule</strong>:<br />
Julia Schützenberger<br />
Die Redaktion<br />
sucht Verstärkung<br />
in den Bereichen<br />
Themenrecherche,<br />
Artikel-Scouting<br />
und<br />
Anzeigenverkauf.<br />
redaktion@waldorfschule-schwabing.de<br />
Anzeige in eigener sAche
w w w . l e h m k u h l . n e t<br />
BUCHHANDLUNG LEHMKUHL OHG<br />
L e o p o l d s t r a s s e 4 5 8 0 8 0 2 M ü n c h e n<br />
TEL 089. 380 150- 0 FAX 089. 39 68 40<br />
e m a i l : s e r v i c e @ l e h m k u h l . n e t<br />
Lehmkuhl