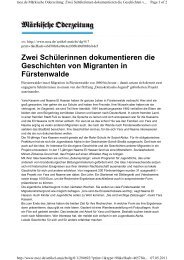Zum Download - Landesjugendring Berlin
Zum Download - Landesjugendring Berlin
Zum Download - Landesjugendring Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beispiel von Bertolt Brechts Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters« kann<br />
dies verdeutlicht werden. Es wird deutlich, dass die Sichtweisen anderer, hier<br />
die der Arbeiter, nicht vorkommen. Das heißt, die (heterogene) Zielgruppe der<br />
Geschichtslernenden wird unterschiedlich bei der Erzählung angesprochen. Die<br />
einen erfahren »Bestätigung« und die anderen »Entfremdung«. Mechanismen<br />
von Ein- und Ausgrenzung schließen sich hier leicht an. Dies muss beim historischen<br />
Lernen beachtet und reflektiert werden.<br />
Gegenwärtig wird unzureichend reflektiert, dass Geschichte / Geschichtsschreibung<br />
bis heute meist dominant, hegemonial, eben »imperialistische« Züge aufweist,<br />
die national, patriarchalisch, elitär, christlich und europäisch sind. 41 Diese<br />
Betrachtungsweisen (wie Männerhistorie, Oberschichtengeschichte, weiße Erzählungen<br />
…) sind kenntlich zu machen und sollten einer Reflektion unterzogen<br />
werden. Die Identitäten der Zielgruppe und das Niveau des Verunsicherungsvermögens<br />
und dem Verständnis, dass Geschichte und letztlich auch die eigene<br />
Identität von Aushandlungsprozessen abhängig ist, muss berücksichtigt werden.<br />
Daher sind existentielle Erzählungen (wie Krieg) anfangs zu vermeiden oder setzen<br />
Erfahrungen im Geschichtslernen / historischen Denken voraus. Ansonsten<br />
schnappt die Falle zu und ein historisches Lernen (wie Multiperspektivität, Kontroversität,<br />
Pluralität) wird unmöglich.<br />
2.5.3. Falle der »Heterogenität« und »Hybridität« von<br />
Identitäten<br />
Bei jeder Gruppenzuschreibung – erst recht bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund<br />
– sind Differenzierungen zwangsläufig geltend zu machen. Gruppen<br />
sind heterogen, nicht geschlossen und einheitlich. Die Mitglieder unterscheiden<br />
sich in der Kultur (Sprache, Religion, Werte, Gesellschaftsmodelle …), im Rechtsstatus<br />
(manche haben nur eine »Duldung« um hier zu leben) oder sie kommen<br />
aus unterschiedlichen Einwanderungsgenerationen (Urgroßeltern 1945/48,<br />
Großeltern um 1960/65, Eltern um 1990) oder sie sind als Kind selbst nach dem<br />
Jahr 2000 eingewandert. Zudem spielt die ökonomische, kommunikative und<br />
bildungsmäßige Integration in der Aufnahmegesellschaft eine Rolle. 42<br />
Gruppen sind in sich vielfältig und dies muss auch im historischen Denken beachtet<br />
werden. Im Geschichtslernen sollen gruppenspezifische Themen (wie Religion<br />
oder Gastarbeiter) einbezogen werden. Dies bedeutet aber kein automatisches<br />
Identifizieren der vermeidlichen oder tatsächlichen Lerngruppenmitglieder mit<br />
den historischen Figuren, die angeblich zu ihnen passen. Auch Abgrenzungen<br />
sind möglich, denn Migranten_innen haben oft eine hybride Identität, die einer<br />
gruppenspezifischen Zuschreibung von außen widerstrebt. Ein »Deutschtürke«<br />
etwa »sitzt eben zwischen zwei Stühlen oder auf zwei Stühlen«.<br />
41 Ebd. S. 34.<br />
42 Ebd. S. 36.<br />
50