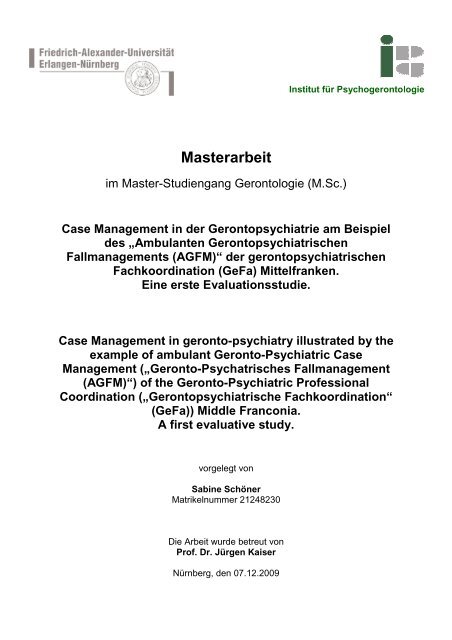Ambulanten Gerontopsychiatrischen ... - Angehörigenberatung e.V.
Ambulanten Gerontopsychiatrischen ... - Angehörigenberatung e.V.
Ambulanten Gerontopsychiatrischen ... - Angehörigenberatung e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Masterarbeit<br />
im Master-Studiengang Gerontologie (M.Sc.)<br />
Case Management in der Gerontopsychiatrie am Beispiel<br />
des „<strong>Ambulanten</strong> <strong>Gerontopsychiatrischen</strong><br />
Fallmanagements (AGFM)“ der gerontopsychiatrischen<br />
Fachkoordination (GeFa) Mittelfranken.<br />
Eine erste Evaluationsstudie.<br />
Case Management in geronto-psychiatry illustrated by the<br />
example of ambulant Geronto-Psychiatric Case<br />
Management („Geronto-Psychatrisches Fallmanagement<br />
(AGFM)“) of the Geronto-Psychiatric Professional<br />
Coordination („Gerontopsychiatrische Fachkoordination“<br />
(GeFa)) Middle Franconia.<br />
A first evaluative study.<br />
vorgelegt von<br />
Sabine Schöner<br />
Matrikelnummer 21248230<br />
Die Arbeit wurde betreut von<br />
Prof. Dr. Jürgen Kaiser<br />
Nürnberg, den 07.12.2009<br />
Institut für Psychogerontologie
Inhaltsverzeichnis Seite<br />
1. Einführende Bemerkungen...................................................................................6<br />
2. Zentrale Aspekte und theoretische Grundlage von Case Management ...........8<br />
2.1 Definitionen von Case Management......................................................................9<br />
2.2 Klassifizierung von Case Management-Konzepten .............................................10<br />
2.3 Qualifikation und Funktionen im Case Management ...........................................11<br />
2.4 Abgrenzung von Case Management und Care Management<br />
(Managed Care) ........................................................................................................12<br />
2.5 Die Entwicklung von Case Management im historischen Kontext .......................14<br />
2.6 Methodisches Vorgehen im Case Management ..................................................21<br />
3. Case Management in der Altenhilfe bei Pflegebedürftigkeit<br />
im gerontopsychiatrischen Bereich.......................................................................31<br />
3.1 Case Management in der Altenhilfe.....................................................................31<br />
3.2 Case Management bei Pflegebedürftigkeit..........................................................32<br />
3.2.1 Definition von Pflegebedürftigkeit .....................................................................33<br />
3.2.2 Rechtliche Grundlagen für Case Management in der Pflege............................33<br />
3.2.3 Voraussetzungen für das Case Management in der Pflege..............................35<br />
3.3 Case Management in der Gerontopsychiatrie .....................................................36<br />
3.3.1 Definition von Gerontopsychiatrie und<br />
gerontopsychiatrischer Versorgung ...........................................................................36<br />
3.3.2 Gerontopsychiatrische Erkrankungen...............................................................37<br />
3.3.3 Anmerkungen zur praktischen Umsetzung.......................................................40<br />
4. Das Modellprojekt „Ambulantes gerontopsychiatrisches Fallmanagement<br />
(AGFM)“ der <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Fachkoordination (GeFa) Mfr .................41<br />
4.1 Vorstellung der Koordinierungsstelle Gerontopsychiatrische<br />
Fachkoordination (GeFa) Mfr.....................................................................................43<br />
4.2 Ausgangssituation für das Modellprojekt .............................................................44<br />
4.3 Die Darstellung des Projektes AGFM ..................................................................46<br />
4.4 Ergebnisse aus dem gerontopsychiatrischen Fallmanagement (AGFM).............54<br />
2
4.4.1 Zugangsweg zum Fallmanagement/ Regionale Verteilung/<br />
Alter und Geschlecht .................................................................................................54<br />
4.4.2 Krankheitsbilder und eingesetzte Testverfahren...............................................56<br />
4.4.3 Lebenssituation, Problemstellungen und daraus abgeleiteter Hilfebedarf ........60<br />
4.5 Die konkrete Fallbearbeitung...............................................................................64<br />
4.6 Hürden und Effekte des Fallmanagements..........................................................69<br />
5. Die Befragung von Fallmanagerinnen und Klienten, Alternativen zum<br />
Konzept und Weiterentwicklungsbemühungen....................................................73<br />
5.1 Ergebnisse und Tendenzen aus der Befragung von Betroffen/ Angehörigen......75<br />
5.2 Auswertung der Fragebögen für die Fallmanagerinnen<br />
und Interpretation der Ergebnisse .............................................................................76<br />
5.3 Alternativen zum Konzept AGFM/ (strukturelle)<br />
Weiterentwicklungsbemühungen...............................................................................83<br />
5.3.1 Das Konzept der <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Behandlungspflege<br />
von HALMA e.V. Würzburg und Entwicklungen in Mittelfranken ...............................84<br />
5.3.2 Strukturwandel in den ambulanten Pflegediensten...........................................90<br />
6. Fazit und Ausblick...............................................................................................93<br />
7. Literatur................................................................................................................96<br />
Anhang 1-13<br />
3
Abkürzungen<br />
AGFM Ambulantes gerontopsychiatrisches Fallmanagement<br />
BA Bundesagentur für Arbeit<br />
DBfK Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe<br />
DBSH Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit und Pflege<br />
DGGC Deutsche Gesellschaft für Care- und Case Management<br />
DGGPP Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie<br />
GDS Geriatrische Depressionsskala nach Yesavage<br />
GeFa Gerontopsychiatrische Fachkoordination<br />
GQ Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie<br />
HALMA e.V. Hilfen für altersverwirrte Menschen im Alter<br />
HMO Health-Maintenance-Organisation<br />
MMST Minimental Status nach Folstein<br />
NIMH National Institute of Mental Health<br />
OBA Offene Behindertenarbeit<br />
PfWG Pflege-Weiterentwicklungsgesetz<br />
SGB Sozialgesetzbuch<br />
TN Teilnahme<br />
4
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Prävalenz von Demenzen in Abhängigkeit vom Alter ...............................39<br />
Tabelle 2: Mindest- und Höchstalter für weibliches und<br />
männliches Geschlecht .............................................................................................56<br />
Tabelle 3: Anzahl nach Geschlechterverteilung.........................................................56<br />
Tabelle 4: Anzahl somatischer Erkrankungen ...........................................................57<br />
Tabelle 5: Anzahl der erzielten Punkte im MMST......................................................58<br />
Tabelle 6: Anzahl der erzielten Punkte im DemTect..................................................59<br />
Tabelle 7: Anzahl der erzielten Punkte bei der GDS .................................................59<br />
Tabelle 8: Pflegeeinstufung zu Beginn ......................................................................61<br />
Tabelle 9: Pflegeeinstufung am Ende........................................................................62<br />
Tabelle 10: Anteil der Haus- und Facharztversorgung ..............................................62<br />
Tabelle 11: Anzahl der Diagnosen pro Klient.............................................................62<br />
Tabelle 12: Medikamentenverabreichung..................................................................63<br />
Tabelle 13: Befragung der Angehörigen zu den Effekten des Fallmanagements......75<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Grafik 1: Der Zugangsweg zum Fallmanagement .....................................................55<br />
Grafik 2: Anzahl der Fälle nach Regionen .................................................................55<br />
Grafik 3: Anzahl der Krankheitsbilder ........................................................................57<br />
Grafik 4: Diagnosestellung durch Arzt oder Fallmanagerin .......................................57<br />
Grafik 5: Familienstand der Erkrankten .....................................................................60<br />
Grafik 6: Wohnsituation der Klienten .........................................................................61<br />
Grafik 7: Verhaltensauffälligkeiten/ Risiken ...............................................................64<br />
Grafik 8: Hilfebedarf in den Versorgungskategorien ..................................................65<br />
Grafik 9: Vermittlung an weitere Unterstützungsangebote ........................................66<br />
Grafik 10: Grund der Beendigung von AGFM............................................................69<br />
5
1. Einführende Bemerkungen<br />
In der Bundesrepublik Deutschland und auch anderen westlichen Industrienationen<br />
hat eine nachhaltige Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung begonnen, die<br />
auch zukünftig in Richtung einer Alterung der Bevölkerung voranschreiten wird. Es<br />
gibt Modellrechnungen in Deutschland, die auf diese Entwicklung hinweisen, welche<br />
auf den Rückgang der Geburten und eine Zunahme der Lebenserwartung zurück-<br />
zuführen ist. In diesem Zusammenhang ist auch vom „Dreifachen Altern“ die Rede,<br />
das gekennzeichnet ist durch die Zunahme der absoluten Zahl älterer Menschen,<br />
dem wachsenden Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung und der<br />
Zunahme hochaltriger Menschen. Dem gegenüber steht die Entwicklung der Ab-<br />
nahme des Anteils und der Anzahl jüngerer Menschen, so dass eine Verschiebung<br />
der Altersstruktur der Bevölkerung stattfindet (vgl. Bäcker, Bispinck, Hofemann &<br />
Naegele 2000, S. 232). Einige Veränderungen sind laut aktuellsten Bevölkerungs-<br />
vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes zu erwarten. Zu nennen sind<br />
hier das Absinken der Gesamtbevölkerung von 82 Millionen im Jahr 2009 auf etwa<br />
65 bis 70 Millionen bis zum Jahr 2060, ein Anstieg des Anteils der über 60-jährigen<br />
(für 2060 wird erwartet, dass jeder dritte Bundes-Bürger mindestens 65 Jahre alt sein<br />
wird) und eine Steigerung des Anteils der 80-jährigen und älteren Menschen von<br />
derzeit sieben Prozent auf 14% im Jahr 2060 (vgl. Nürnberger Nachrichten,<br />
19.11.2009). In Zukunft wird das Erreichen eines hohen Lebensalters also zum<br />
kollektiven Phänomen werden, was rein quantitativ betrachtet eine bislang<br />
einzigartige Entwicklung darstellt (vgl. BMFSFJ 2002, S.24f). Obgleich die<br />
Entwicklung von Morbidität und Mortalität im Alter in Zukunft nur schwer zu<br />
bestimmen ist und Alter nicht zwangsläufig mit Krankheit gleichgesetzt werden kann,<br />
ist derzeit davon auszugehen, dass ab dem 80. bis 85. Lebensjahr die<br />
Wahrscheinlichkeit des Einsetzens von Multimorbidität zunimmt. Durch eine<br />
Beeinträchtigung ihres Gesundheitszustandes kommen viele ältere Menschen in die<br />
Lage, dass sie ihr alltägliches Leben nicht mehr aus eigener Kraft alleine bewältigen<br />
können, sondern auf die Hilfe und Pflege anderer angewiesen sind (vgl. ebd. S.26).<br />
Maßgeblich beteiligt an der Entstehung von Pflegebedürftigkeit im hohen Alter sind<br />
psychische Störungen und zwar hauptsächlich demenzielle Erkrankungen (vgl.<br />
Bickel 2001, S.42ff). In Deutschland gibt es derzeit 1,1 Millionen demenzkranke<br />
Menschen, deren Zahl sich in Zukunft deutlich erhöhen wird (vgl.<br />
http://www.deutschealzheimer de/index. php?id=37&no_cache=1&file=7&uid=224,<br />
6
Stand 09.05.09). Gegenwärtig findet die überwiegende Betreuung und Pflege von<br />
Demenzerkrankten in der häuslichen Umgebung - hauptsächlich durch Angehörige -<br />
statt. Eine ambulante Pflege älterer bedürftiger Menschen entspricht dabei auch den<br />
Wünschen der Betroffenen, die möglichst lange zu Hause leben möchten. Außerdem<br />
gewinnt diese Versorgungsform auch in Anbetracht der zunehmenden Kosten im<br />
Sozial- und Gesundheitswesen an Bedeutung (vgl. Engel & und Engels, 2000, S.8).<br />
Darüber hinaus wurde der Grundsatz „ambulant vor stationär“ mit Einführung der<br />
Pflegeversicherung gesetzlich verankert (elftes Sozialgesetzbuch „Soziale Pflege-<br />
versicherung“, SGBXI, §3). Allerdings reichen Familienangehörige alleine nicht aus,<br />
die Pflege der Erkrankten zu übernehmen. Denn in vielen Fällen sind Familien-<br />
angehörige - häufig im ähnlichen Alter wie der Betroffene - selbst nur noch ein-<br />
geschränkt leistungsfähig. Oft fühlen sich die Angehörigen durch die Pflegesituation<br />
überfordert und schlimmstenfalls ist ein pflegebedürftiger Mensch durch Tod oder<br />
Umzug von Angehörigen plötzlich auf sich selbst gestellt (vgl. Engel & Engels 2000,<br />
S.7). Strukturelle Entwicklungen wie sinkende Geburtenraten und zunehmende<br />
Kinderlosigkeit (in Zukunft wird etwa ein Drittel der älteren Menschen keine Kinder<br />
und Enkel haben), veränderte Familienstrukturen (Zunahme von nicht-ehelichen<br />
Lebensgemeinschaften), Zunahme der Single-Haushalte sowie zunehmende<br />
Erwerbstätigkeit von Frauen (vgl. BMFSFJ 2002, S.179ff) werden in Zukunft die<br />
Pflege im Verbund Familie erschweren. Aus diesen Gründen kommt bei der Pflege<br />
von morgen der zusätzlichen Unterstützung durch professionelle Pflegedienste und<br />
andere Unterstützungsformen eine tragende Bedeutung zu (vgl. ebd.). Dieser<br />
Umstand wiederum stellt ältere pflegebedürftige Menschen und pflegende<br />
Angehörige vor neue Herausforderungen: So ist die Vielfalt der zur Verfügung<br />
stehenden Dienste und Hilfeleistungen oft unüberschaubar für die Betroffenen. Hier<br />
kann ein qualifiziertes Case Management dazu beitragen, dass der konkrete Hilfe-<br />
und Pflegebedarf des älteren Menschen sondiert und das Angebot an<br />
professionellen und ehrenamtlichen Hilfestellungen mit seinem individuellen Hilfe-<br />
bedarf, seiner sozialen Lebenssituation und seiner Wohnsituation in optimaler Art<br />
und Weise abgestimmt wird (vgl. Engel & Engels 2000, S.7).<br />
In der vorliegenden Arbeit wird die derzeitige Verwendung von Case Management im<br />
gerontopsychiatrischen Bereich an dem Modellprojekt „ambulantes geronto-<br />
psychiatrisches Fallmanagement (AGFM)“ der gerontopsychiatrischen Fachkoordi-<br />
7
nation Mittelfranken (GeFa)/ <strong>Angehörigenberatung</strong> Nürnberg e.V.“ exemplarisch dar-<br />
gestellt und konzeptionell überprüft.<br />
Im Folgenden werden zunächst zentrale Aspekte und theoretische Grundlagen von<br />
Case Management im Allgemeinen (zweites Kapitel) und Case Management in der<br />
Altenhilfe bei Pflegebedürftigkeit im gerontopsychiatrischen Bereich im Speziellen<br />
vorgestellt (drittes Kapitel). Des Weiteren erfolgt eine Beschreibung des Konzeptes<br />
und der Ergebnisse aus dem Modellprojekt (Viertes Kapitel). Aus der Intention, mit<br />
der Befragung von ambulanten Pflegediensten ihre Eignung als Projektpartner zu<br />
evaluieren, ergibt sich die Notwendigkeit, die Strukturen von ambulanten Pflege-<br />
diensten und die konzeptionellen Gegebenheiten von AGFM zu überprüfen und<br />
Alternativen bzw. Weiterentwicklungen aufzuzeigen (fünftes Kapitel). Abschließend<br />
soll ein Fazit der Ausführungen und ein Ausblick für die Zukunft erfolgen (sechstes<br />
Kapitel).<br />
Aufgrund besserer Lesbarkeit werden in der Arbeit die geläufigsten Ausdrucksformen<br />
(z.B. Klient, Patient, Case Manager) in männlicher Form verwendet. Dies schließt<br />
immer auch das andere Geschlecht mit ein. Lediglich beim Begriff „Fallmanagerin“ ist<br />
die weibliche Form vorzufinden, da im Projekt ausschließlich Frauen in dieser<br />
Funktion tätig waren.<br />
2. Zentrale Aspekte und theoretische Grundlagen von Case Management<br />
Reformen im Sozial- und Gesundheitswesen verlangen eine veränderte Arbeitsweise<br />
in den entsprechenden Diensten und Einrichtungen, die mit der Pflege, Betreuung<br />
und Heilung von Menschen beauftragt sind. Dabei geht es bei der Neugestaltung der<br />
Versorgungsdienste immer in Richtung Rationalisierung, wobei im Idealfall nicht nur<br />
auf Kostenbegrenzung, sondern gleichzeitig auf die Gewährleistung von Qualität<br />
geachtet wird. Beide Aspekte kommen zum Tragen, indem eine Integration der<br />
Leistungserbringung, abgestimmt mit den Nutzern, angestrebt wird. In der<br />
beruflichen Tätigkeit findet derzeit eine Verschiebung statt: Nicht nur ein einzelner<br />
Professioneller kommt bei einem Klienten zum Einsatz. Vielmehr steht die<br />
Zusammenarbeit einer Mehrzahl von Beteiligten zur Koordination in der<br />
Ressourcennutzung und Leistungserbringung im Vordergrund. In diesem Zu-<br />
sammenhang hat sich ein neues Verständnis von Management auch im Dienst „am<br />
Menschen“ durchgesetzt. Ein solches Management ist zuständig für Kooperation und<br />
8
Koordination sowie die Kontrolle von Kosten und Qualität von Hilfen. Unnötige bzw.<br />
unwirksame Leistungen sollen hiermit vermieden werden. Um eine „Zielgenauigkeit“<br />
von Leistungen zu erreichen, muss die gesamte Arbeitsweise betrachtet und geprüft<br />
werden (vgl. Wendt 2008, S.7). Dieses Kapitel soll einen umfassenden Einblick in die<br />
zentralen Aspekte des Case Managements, als relativ neuen Ansatz in der Arbeit<br />
„am Menschen“ bieten. Zunächst werden Definitionen des Begriffs vorgestellt. In<br />
einem nächsten Schritt gewährt die Arbeit Einblick in die Klassifizierung von Case<br />
Management-Konzepten und die Funktionen sowie Qualifikation im Case<br />
Management. Da die Begriffe „Case Management“ und „Care Management“ oft als<br />
identisch behandelt werden, sich aber dennoch unterscheiden, wird des Weiteren<br />
eine Abgrenzung beider Termini vorgenommen. Wie sich Case Management im<br />
historischen Kontext entwickelt hat - sowohl im anglo-amerikanischen Raum als auch<br />
in Deutschland - findet ebenso in diesem Kapitel Eingang. Abschließend soll dem<br />
Leser das methodische Vorgehen im Case Management, das eine phasenorientierte<br />
Struktur aufweist, erläutert werden.<br />
2.1 Definitionen von Case Management<br />
In der Literatur gibt es aufgrund des breiten Anwendungsspektrums eine Vielzahl von<br />
Definitionen zu Case Management. Wörtlich übersetzt heißt Case „Fall“. Das<br />
bedeutet, dass es beim Case Management um Planung und Koordinierung von<br />
Einzelfällen geht. Die zuerst genannte Definition von Manfred Neuffer steht kenn-<br />
zeichnend für einen sozialarbeiterischen Einsatz und versteht Case Management als<br />
„ein Konzept zur Unterstützung von Einzelnen, Familien, Kleingruppen. Case<br />
Management gewährleistet durch eine durchgängige fallverantwortliche<br />
Beziehungs- und Klärungshilfe, Beratung und den Zugang zu notwendigen<br />
Dienstleistungen. Case Management befähigt Klienten, Unterstützungsleistungen<br />
selbständig zu nutzen und greift so wenig wie möglich in die Lebenswelt von<br />
Klienten ein“(2002, S19).<br />
Eine umfassendere Definition findet sich bei Rainer Wendt:<br />
„Case Management ist eine Verfahrensweise in Sozial- und Gesundheitsdiensten,<br />
mit der im Einzelfall die nötige Unterstützung, Behandlung und Versorgung von<br />
Menschen rational bewerkstelligt wird. Diese Handhabung des Vorgehens und des<br />
Einsatzes von Mitteln wird bei einem längeren Ablauf gebraucht, nicht wenn in<br />
einer Notsituation sofort geholfen oder eingegriffen werden muss. Angezeigt ist das<br />
9
gemeinte Vorgehen bei einer in der Regel komplexen Problematik mit einer<br />
Mehrzahl von Beteiligten und in vernetzten Bezügen. Im Case Management wird<br />
ein zielgerichtetes System der Zusammenarbeit organisiert“ (2008, S.17).<br />
Sämtliche Definitionen von Case Management unterliegen sieben gemeinsamen<br />
Kriterien, die als konstituierend für das Konzept begriffen werden können:<br />
• Der Prozess des Case Managements ist angelegt entlang des Betreuungs-<br />
verlaufs der Klienten.<br />
• Das Case Management beinhaltet eine ganzheitliche Sichtweise der Klienten<br />
und ihrer Bedürfnisse.<br />
• Der Beratungsprozess verläuft quer zu den Grenzen der jeweiligen Ver-<br />
sorgungseinrichtungen und deren Zuständigkeiten sowie der verschiedenen<br />
Professionen.<br />
• Das Case Management ist ein dynamischer Prozess: Es ist auf regelmäßige<br />
Kooperation mit fallrelevanten Personen und Organisationen ausgerichtet.<br />
• Case Manager verbinden fallrelevante Personen und Organisationen zu einem<br />
Hilfenetz (= integriertes Hilfesystem).<br />
• Mittels Koordination fallrelevanter Personen und Organisationen sollen vor-<br />
handene Probleme gelöst und vorher festgelegte Ergebnisse erreicht werden (=<br />
Zielorientierung).<br />
• Es findet Qualitätsentwicklung und -sicherung statt: Die Arbeit von Case<br />
Managern sowie die Versorgung und Zufriedenheit von Klienten werden<br />
reflektiert, gesichert und weiterentwickelt (vgl. Ewers 2000, S.57).<br />
2.2 Klassifizierung von Case Management-Konzepten<br />
Neben den zahlreichen Definitionen für Case Management gibt es ebenso eine<br />
Vielzahl von Klassifizierungen der unterschiedlichen Case Management-Konzepte.<br />
Die im Folgenden aufgeführte Klassifizierung wurde 1985 von Merill unternommen<br />
und ergänzt. In den USA findet diese Klassifizierung immer noch Anwendung.<br />
Demnach werden die unterschiedlichen Case Management Konzepte unterschieden<br />
nach Art der angebotenen Dienstleistung und der Zielgruppe.<br />
a) Soziales Case Management wurde für sozial und gesundheitlich gefährdete<br />
Bevölkerungsgruppen entwickelt und hat einen präventiven Charakter.<br />
10
) Case Management in der beruflichen Rehabilitation ist aus dem sozialen Case<br />
Management entstanden und hat die Wiedereingliederung von behinderten oder<br />
gesundheitlich beeinträchtigten Menschen in das Arbeitsleben zum Ziel.<br />
c) Case Management in der Primärversorgung koordiniert die primäre<br />
Gesundheitsversorgung von Personen im ambulanten Sektor.<br />
d) Case Management für Katastrophen oder kostenintensive medizinische Er-<br />
eignisse richtet sich an spezifische Zielgruppen (z.B. Aids- oder Schlag-<br />
anfallpatienten). Es dient der Zugangssteuerung und Kostenersparnis.<br />
e) Medizinisch-soziales Case Management. Es handelt sich hierbei um eine<br />
Mischform, bei der soziale, medizinische und pflegerische Dienstleistungen<br />
miteinander verbunden werden. Es richtet sich hauptsächlich an chronisch<br />
kranke Menschen und Langzeitpatienten (vgl. Ewers 2000, S.58ff).<br />
2.3 Qualifikation und Funktionen im Case Management<br />
Da in der Bundesrepublik der Titel bzw. die Zusatzbezeichnung eines Case<br />
Managers bisher nicht geschützt sind, kann sich theoretisch jeder dieses Titels be-<br />
mächtigen. Ernst zu nehmende Case Manager jedoch absolvieren als Professionelle<br />
nach ihrer Grundausbildung eine anerkannte Weiterbildung zur Erlangung dieser<br />
Zusatzbezeichnung. Die Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management<br />
(DGGC) hat in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden in den Bereichen Soziale<br />
Arbeit (DBSH) und Pflege (DBfK) sowie der Bundesagentur für Arbeit (BA) gemein-<br />
same Richtlinien für diese Weiterbildung verabschiedet und ein Zertifizierungssystem<br />
erstellt. Absolventen dieser Weiterbildungen dürfen sich „Zertifizierte Case Manager<br />
(DGGC)“ nennen (vgl. Löcherbach 2009, S.226). Bislang können weder Gesund-<br />
heits-, Pflege- noch Sozialprofessionen für sich verbuchen, Case Manager hin-<br />
reichend auf ihr Arbeitsgebiet vorzubereiten. Am ehesten schaffen dies vermutlich<br />
noch die Sozialprofessionen, da der Ursprung von Case Management in der Sozial-<br />
arbeit als die Weiterentwicklung des Case Work zu betrachten ist (vgl. ebd. S.227);<br />
(vgl. Punkt 2.5). Wie aus der Klassifizierung von Case Management-Konzepten in<br />
Punkt 2.2. ersichtlich wird, findet eine Ausdifferenzierung von Case Management in<br />
der Praxis statt. Dies muss bei Qualifizierungsmaßnahmen berücksichtigt werden.<br />
Die im jeweiligen Tätigkeitssektor benötigten oder auch erworbenen spezifischen<br />
Kompetenzen stellen die Basisqualifikation dar, auf die eine Case Management-<br />
Qualifikation aufbaut (vgl. ebd. S.228). Ein Case Manager hat drei Kernfunktionen,<br />
11
die je nach Auftraggeber, Berufsfeld und Einsatzgebiet unterschiedliche Gewichtung<br />
haben:<br />
• Advocacy Funktion: Hier übernimmt der Case Manager eine Anwaltsfunktion für<br />
den Klienten. Durch diese Position sollen Interessen von Patienten- bzw.<br />
Klienten durchgesetzt werden, die selbst nicht in der Lage sind, ihre<br />
persönlichen Belange zu vertreten. Der Case Manager muss sich unmittelbar in<br />
die Situation seiner Klienten hineinversetzen, konsequent und mit<br />
professionellem Fallverständnis Probleme analysieren und den daraus<br />
entstehenden Versorgungsbedarf ermitteln. Des Weiteren gehört zu seiner<br />
Aufgabe, Lücken im Versorgungssystem aufzudecken und dies an zuständige<br />
Stellen weiter zu leiten.<br />
• Broker-Funktion: Der Case Manager hat als Broker eine Vermittlerfunktion<br />
zwischen Klienten und Organisationen/ Institutionen des Gesundheitswesens.<br />
Der Broker hat die Aufgabe aus dem „Versorgungsdschungel“ das bestmögliche<br />
Versorgungspaket für den Klienten zu eruieren.<br />
• Gate-Keeper-Funktion: Im Vordergrund stehen in der Funktion des Case<br />
Managers Zugangssteuerung sowie Selektion und Kostenkontrolle. In erster<br />
Linie fokussiert der Case Manager ökonomische Interessen (vgl. Ewers 2000,<br />
S.63ff).<br />
Die genannten Funktionen zeigen, dass an die Person des Case Managers hohe<br />
Erwartungen gerichtet sind. Case Manager haben es dabei in ihrer Funktion stets<br />
mit komplexen Situationen, schwierigem Klientel und unzureichenden Rahmen-<br />
bedingungen zu tun. Dies gilt als Merkmal für diesen neuen Dienstleistungstypus.<br />
Bisherige Praxiserfahrungen bestätigen die hohe Relevanz der Personal-<br />
qualifikation und Professionalität im Case Management (vgl. Löcherbach 2009,<br />
S.226).<br />
2.4 Abgrenzung von Case Management und Care Management (Managed Care)<br />
Da in der Literatur und auch in der Praxis Case Management und Care Management<br />
häufig synonym verwendet werden - obwohl sie unterschiedliche Ziele ansteuern –<br />
soll an dieser Stelle eine Abgrenzung zwischen beiden Begrifflichkeiten<br />
vorgenommen werden. So verfolgt Case Management in erster Linie die Intention,<br />
die bestmögliche Versorgung des Klienten zu erreichen. Care Management hingegen<br />
12
zielt eher auf eine Senkung der Kosten ab. Heutzutage stehen in fast allen Industrie-<br />
nationen die Gesundheitssysteme unter enormen Kostendruck. Aus Gründen der<br />
optimierten Lebensbedingungen und besseren (sowie teueren) medizinischen<br />
Versorgung steigt die Lebenserwartung in diesen Ländern an. Dadurch erhöht sich<br />
allerdings auch eine Vielzahl von chronischen Erkrankungen, die hohe Kosten für die<br />
Gesundheitssysteme verursachen (vgl. Ewers 2000, S.33). Laut Ewers führt dies in<br />
allen Sparten der Gesundheitsversorgung zu einer „Ökonomisierung“ (2000, S.33). In<br />
diesem Zusammenhang ist auch immer häufiger von Rationalisierung und<br />
Rationierung von Gesundheitsleistungen die Rede (vgl. ebd.). Seit den 80er Jahren<br />
arbeiten viele Organisationen des Gesundheitssektors in den USA mit Managed-<br />
Care-Programmen. Vor allem die Health-Maintenance-Organisations (HMO) ver-<br />
wenden Managed Care. Solche Organisationen sind Kostenträger und Leistungs-<br />
erbringer für den Klienten zugleich. Dies führt zu einer „Integration der Funktion<br />
Versicherung und Versorgung“ (Kühn 1997, zit. nach Ewers 2000, S.39).<br />
An dieser Stelle seien einige Merkmale des Care Managements dargestellt:<br />
• Eingeschränkte Arztwahl und Gatekeeping<br />
meistens handelt es sich bei einem Gatekeeper um den Hausarzt, der alle<br />
Leistungen koordiniert und kontrolliert. Er kann eine Überweisung des Patienten<br />
an einen Facharzt oder in eine Klinik vornehmen.<br />
• Selektives Kontrahieren<br />
es besteht keine freie Arztwahl des Patienten. Er ist an vertragliche Versorger<br />
gebunden.<br />
• Utilization review<br />
die Angemessenheit einer medizinischen Leistung wird vom Leistungs-<br />
finanzierer kontrolliert und überwacht.<br />
• Präventionsorientierung<br />
• Standardisierung über Guidelines, Behandlungspfade und Positivlisten<br />
Guidelines bezeichnen Vorgaben über standardisierte medizinische sowie<br />
pflegerische Versorgung; Behandlungspfade sollen zur Verbesserung und<br />
Effizienz der Versorgung beitragen; Positivlisten sind katalogisierte preis-<br />
günstige Medikamente, deren Wirksamkeit belegt ist und die vom Leistungs-<br />
anbieter vorgegeben sind.<br />
• Integrierte Behandlungsprozesse wie z.B. durch Case Management<br />
13
• Outcome Management<br />
Ergebnisse der Versorgung werden ständig kontrolliert und evaluiert, damit eine<br />
evidenz-basierte Medizin gewährleistet werden kann (vgl. Schwartz 2003, S.<br />
711).<br />
Wie aus den dargestellten Merkmalen ersichtlich, wird Case Management durchaus<br />
in einem Managed-Care-Programm als Instrumentarium eingesetzt. Allerdings<br />
kommt hier der Gate-Keeper-Funktion ein wesentlich höherer Stellenwert zu als der<br />
Advocacy-Funktion.<br />
Sehr wohl ist Case Management hier jedoch als ein Korrektursystem eingebunden,<br />
damit trotz Kostendruck die optimale Versorgung für den Klienten erreicht wird (vgl.<br />
Ewers 2000, S.40). Eine unzureichende Versorgung würde ja auch die Gesund-<br />
heitskosten langfristig erhöhen, weshalb trotz Kostendruck auf gewisse Qualitäts-<br />
kriterien nicht verzichtet werden kann. Managed Care ist trotzdem eher auf der Seite<br />
der Kostenträger anzusiedeln, weil Effizienz im Mittelpunkt steht. Case Management<br />
ist „näher“ am Klienten/ Patienten, da es ihm in einem unüberschaubaren Gesund-<br />
heitssystem die bestmöglichen Versorgungsleistungen vermitteln soll (vgl. Ewers<br />
2000, S.33).<br />
2.5 Die Entwicklung von Case Management im historischen Kontext<br />
Case Management stellt eine Weiterentwicklung der klassischen Methode des Social<br />
Case Work dar und hat seinen Ursprung in den USA (vgl. Neuffer 2002, S.38). Im<br />
Folgenden soll zunächst die historische Entwicklung von Case Work und Case<br />
Management im anglo-amerikanischen Raum aufgezeigt werden. Soziale Einzelhilfe<br />
in Deutschland ist als eine adaptierte Form des Case Work zu verstehen und ist stark<br />
von dessen Konzept beeinflusst. Da die Entwicklung der Einzelfallhilfe und des<br />
Fallmanagements in Deutschland sich dennoch geschichtlich von Case Work/ Case<br />
Management in den USA unterscheidet, wird diese eigens unter einem weiteren<br />
Punkt dargelegt.<br />
a) Case Work und Case Management im anglo-amerikanischen Raum<br />
Mit ihrer Schrift ‚Social Diagnosis’ 1917 gilt Mary Richmond in den USA als<br />
Begründerin des Ansatzes von Case Work. Eine wesentliche theoretische Weiter-<br />
entwicklung erfuhr der Ansatz zum einen durch Gordon Hamilton, als Vertreterin der<br />
14
sogenannten ‚diagnostic school’, in der das Individuum im Mittelpunkt und dessen<br />
Umwelt eher im Hintergrund steht. Weiterhin geprägt wurde die Methode Case Work<br />
durch Jassie Taft, welche die sogenannte ‚functional school’ ins Leben rief. Von ihr<br />
wird Case Work als prozessorientierte Hilfe verstanden (vgl. Neuffer 2002, S. 38).<br />
Beeinflusst wurde das Konzept Case Work in den 50er Jahren von der Ich-<br />
Psychologie, der Arbeit mit Familien (Fancis Scherz) sowie der ganzheitlichen Be-<br />
trachtung von Mensch und Situation (Kurt Lewin) (vgl. ebd.).<br />
Grundprinzipien wie Wertschätzung der menschlichen Persönlichkeit, aktive und<br />
bewusste Partizipation der Klienten, Selbstreflexion des Sozialarbeiters und Verant-<br />
wortung des Einzelnen für die Gesellschaft bildeten zunächst das Fundament von<br />
Case Work. Die beiden, sich ausdifferenzierenden Schulen, vertraten folgende<br />
Grundannahmen: Die ‚diagnostic school’ konzentrierte sich auf die Problem-<br />
lösungskompetenz des Individuums und der Funktion des Sozialarbeiters als<br />
Katalysator. Zentrale methodische Mittel in diesem Konzept waren die Diagnose des<br />
Problems sowie die Krisenintervention. In Erweiterung hierzu wurde die Not-<br />
wendigkeit der Mobilisierung der Stärken des Klienten und die Herstellung einer<br />
tragfähigen Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Klient gesehen. Bei der<br />
‚functional school’ hingegen standen professionell gestaltete Dienstleistung und<br />
Beratung im Mittelpunkt. Hier entscheidet der Klient in Eigenverantwortung über die<br />
Annahme eines institutionellen Angebots, während der Sozialarbeiter Verantwortung<br />
übernimmt für den Prozess der Hilfestellung und die Entwicklung des Klienten (vgl.<br />
Neuffer 2008, S.38).<br />
In den 60er Jahren veränderten sich Konzept und Praxis des Case Work. Auslöser<br />
hierfür waren neue soziale Strömungen und Bewegungen wie z.B. Civil Rights- oder<br />
Poor People-Movement. Adressaten spezifischer Techniken waren benachteiligte<br />
Gruppen mit speziellen Problemlagen, wie z.B. Drogenabhängige. Praxistheoretische<br />
Neuerungen stellten z.B. Krisenintervention und Streetwork dar. Dennoch blieb die<br />
therapeutisch- und behandlungsorientierte Ausrichtung des Case Work im Großen<br />
und Ganzen erhalten (vgl. ebd. S.39).In den 70er Jahren fand in den USA eine<br />
Kampagne der „Deinstitutionalisierung“ statt. Es wurden seiner Zeit sehr viele<br />
psychisch kranke Menschen, geistig Behinderte und pflegebedürftige Menschen aus<br />
stationären Einrichtungen entlassen. Grund hierfür war zum einen, dass eine<br />
Unterbringung in Heimen u.ä. von Menschenrechts wegen her nicht mehr als<br />
vertretbar erschien. Außerdem musste man feststellen, dass die Versorgung in den<br />
15
stationären Einrichtungen eine Lebensuntüchtigkeit und Unselbständigkeit der<br />
Insassen erzeugte und der Schaden dadurch größer war als der Nutzen. Stationäre<br />
Angebote wurden in den USA und auch anderen Ländern reduziert und es folgte<br />
eine Umorientierung zu offenen, ambulanten Hilfen. Dieser Umstand brachte die<br />
Notwendigkeit mit sich, für die kurzfristig und oft hilflos „Entlassenen“ hinreichende<br />
soziale und medizinische Dienste für deren ambulante Betreuung zu organisieren<br />
(vgl. Wendt 2008, S. 19). Die zunehmende Differenzierung von Dienstleistungen und<br />
die daraus entstehende Multidisziplinarität erforderte nun vom Case Work eine<br />
Orientierung und Organisationsplanung sowie die Vernetzung von Dienstleistungen.<br />
Dies führte schließlich dazu, dass das Konzept des Case Managements als Zweig<br />
des Case Work entstand (vgl. Neuffer 2002, S.39). So gab es damals mehrere<br />
Versuche, ambulante Angebote in ein dem Bürger erschlossenes bzw.<br />
erschließbares Dienstleistungssystem zu integrieren (service integration). Zu dieser<br />
Zeit fand erstmalig eine gesetzliche Verankerung von Case Management statt: Im<br />
amerikanischen Developmental Disabilities Act von 1975 (Public Law 95-602) wurde<br />
festgelegt, dass Behinderte durch Case Management einen Dienst erhalten sollten,<br />
der ihnen notwendige soziale, erzieherische und medizinische Hilfen bietet und diese<br />
koordiniert. Durch die Unbeholfenheit vieler „deinstutionalisierter“ Menschen und<br />
deren offensichtliche Not wurden weiterhin Programme entwickelt, die eine vernetzte<br />
Versorgung der Betroffenen im kommunalen Umfeld ermöglichen sollten. In einer<br />
gemeindenahen Unterstützung (community care) erhielt Case Management den<br />
Auftrag, klientenbezogen die entsprechende Hilfestellung zu erbringen. 1977<br />
entwickelte das National Institute of Mental Health (NIMH) ein Community Support<br />
Program, in dem zum ersten Mal dem Case Manager eine zentrale Rolle eingeräumt<br />
wurde (vgl. Wendt 2008, S.19f). In den USA ist Case Management mittlerweile nicht<br />
mehr Teilaufgabe, sondern ein eigenständiger Bereich sozialer Arbeit. Außerdem<br />
verfügen Case Manager über ein eigenständiges Budget, aus dem Hilfestellungen<br />
finanziert werden. Dies verdeutlicht, dass Case Manager in den USA eine starke<br />
Position einnehmen. Im Jahr 2002 wurden 100.000 beschäftigte Case Manager in<br />
den USA geschätzt (vgl. Neuffer 2002, S.40). Es existieren unterschiedliche Modelle<br />
von Case Management in den USA. Im sogenannten broker model - als einfachen<br />
Typus des Case Managements - liegt der Fokus auf der Vermittlertätigkeit des Case<br />
Managers. Er tritt als eine Art Makler auf, der Dienste personenbezogen - für die im<br />
Einzelfall entsprechende Situation - passend beschafft. Ein weiteres Modell ist z.B.<br />
16
das rehabilitation model. Es arrangiert Hilfen zur Eingliederung von Menschen, die in<br />
ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt sind. Seit den 80er Jahren entwickeln sich für<br />
verschiedenste Anwendungsbereiche weitere Ansätze von Case Management (vgl.<br />
Wendt 2008, S.20).<br />
Während der achtziger Jahre blieb Case Management in Theorie und Praxis<br />
hauptsächlich ein Ressort der beruflichen Sozialarbeit (v.a. der Sozialdienste). Mit<br />
weitläufigen Reformen im Gesundheitswesen befassten sich jedoch auch andere<br />
Berufssparten mit Case Management. Durch den zunehmenden Wettbewerb im<br />
Gesundheitswesen nahm in den USA auch die professionelle Krankenpflege Case<br />
Management für sich in Anspruch. Beginnend mit einem „internen Case Manage-<br />
ment“ im Krankenhaus wurde die Akutversorgung mit der nachfolgenden Pflege und<br />
Rehabilitation systematisch verbunden. Angeschlossen daran wurde ein „externes<br />
Case Management“ in der Überleitungspflege und Nachsorge. Ab 1985 wurde das<br />
entstandene Nursing Case Management in verschiedenen Krankenhäusern<br />
Amerikas eingesetzt und weiterentwickelt. Allerdings beruft sich das Nursing Case<br />
Management im Gegensatz zur Sozialarbeit nicht auf das Case Work, sondern<br />
lediglich auf die Erfordernisse im System der Gesundheitsversorgung (vgl. Wendt<br />
2008, S.24). Aufgrund der Kostenexplosion im Sozial- und Gesundheitswesen<br />
entwickelten sich zunehmend Managed Care Programme zur Steuerung der<br />
Patientenversorgung mit einhergehender Kosteneinsparung (vgl. Ewers 2000, S.<br />
41f). Parallel zur USA wurde auch in Großbritannien das Case Management als ein<br />
Instrumentarium eines gemeindegestützten Versorgungssystems (communitiy care)<br />
eingeführt. Allerdings war hier communitiy care eine politische Entscheidung auf<br />
nationaler Ebene im Gegensatz zur USA mit seinen verstreuten Diensten und<br />
Förderprogrammen. Die Regierung Margaret Thatcher forderte eine Reform des<br />
öffentlichen Dienstes, dem auch das staatliche Gesundheitssystem (National Health<br />
Service) in Großbritannien unterliegt. Diese Reform sollte sich an der freien<br />
Wirtschaft orientieren. Ziel war eine unternehmerisch kompetentere und produktive<br />
Administration. Nachdem im Auftrag des britischen Parlaments eine Kommission<br />
unter der Leitung des Unternehmers Roy Griffiths 1983 in ihrem Bericht einen<br />
Mangel an klarer Verteilung der Funktionen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten<br />
feststellte und Case Management für die kommunalen Sozialbehörden vorschlug,<br />
wurde nach mehreren erfolgreichen Modellversuchen als Ergebnis der National<br />
Health Service and Community Care Act 1990 vom Parlament beschlossen. Das<br />
17
Gesetz verankert die Zuständigkeit von Care Managern in der örtlichen Sozial- und<br />
Gesundheitsbehörde für die Bedarfsprüfung und Hilfeplanung bei Versorgungs-<br />
bedürftigen. Anleitungen, wie das Care Management in seinen Grundfunktionen<br />
ablaufen kann, wurden vom zuständigen Ministerium herausgegeben. Amtlich setzte<br />
sich in Großbritannien der Begriff „Care Management“ anstatt „Case Management“<br />
durch, weil laut dem Department of Health nicht der Einzelne als „Fall“ zu managen<br />
sei, sondern der Prozess der Versorgung (vgl. Wendt 2008, S. 21f).<br />
Vom anglo-amerikanischen Raum wurde der Ansatz des Case Managements in<br />
andere Länder getragen. Insbesondere im Bereich der Pflege alter Menschen konnte<br />
beispielsweise in Ländern wie Holland, Italien oder Frankreich das Case Manage-<br />
ment Fuß fassen (vgl. ebd. S. 25).<br />
b) Soziale Einzelhilfe und Fallmanagement in Deutschland<br />
Alice Salomon beeinflusste Anfang des 20. Jahrhunderts maßgeblich die Anfänge<br />
professioneller sozialarbeiterischer Methoden in Deutschland. Mit der Veröffent-<br />
lichung ihres Buches Soziale Diagnose (1926) brachte sie die von Mary Richmond<br />
entwickelte Methode des Case Work nach Deutschland. Diese wurde als soziale<br />
Einzelhilfe auf deutsche Verhältnisse angepasst. Die soziale Einzelhilfe bezieht sich<br />
auf Individuen und Familien und beleuchtet deren Bedürfnislagen und Probleme in<br />
Wechselwirkung mit der relevanten Umwelt. Sie versucht dabei, Klienten zur<br />
Problemlösung zu motivieren. Folgende Grundprinzipien prägen die soziale Einzel-<br />
hilfe: Annahme und Akzeptanz, Individualisierung, individuelle Selbstbestimmung,<br />
Abholen der Klienten, wo sie gerade stehen, sowie die Arbeit mit den Ressourcen<br />
des Einzelnen. Dabei wird in einem „Methodischen Dreischritt“ verfahren. Erster<br />
Schritt: Fallstudie und Anamnese; zweiter Schritt: Soziale Diagnose; dritter Schritt:<br />
Behandlung. Im Zentrum des Ansatzes stehen eine helfende Beziehung und das<br />
Gespräch (vgl. Kleve 2006, S.21f). Ab den 30er Jahren nahm die Psychoanalyse<br />
immer mehr Einfluss auf dieses Konzept - analog zur Entwicklung in den USA. V.a.<br />
nach der Auswanderung einiger deutscher und österreichischer Psychoanalytiker<br />
nach Amerika aufgrund der faschistischen Machtergreifung, beeinflussten psycho-<br />
analytische Ideen maßgeblich die amerikanische Sozialarbeit. Psychoanalyse wurde<br />
zur psychologischen Bezugstheorie für Case Work in den USA. Allerdings wurde sie<br />
in den 50er Jahren relativ schnell durch die sich verbreitende Bewegung der<br />
humanistischen Psychologie abgelöst. Zudem gewann die Systemtheorie des<br />
18
Soziologen Talcott Pason zunehmend an Bedeutung (vgl. ebd. S.22). Die<br />
methodisch-theoretische Weiterentwicklung der sozialen Einzelhilfe (z.B. Marie<br />
Baum/ Hans Scherpner: Methode der Familienfürsorge) brach zunächst in der NS-<br />
Zeit ab. Nach Kriegsende 1945 wurden sehr viele Methoden aus den USA nach<br />
Deutschland übernommen, wie z.B. neben der sozialen Einzelhilfe die soziale<br />
Gemeinwesenarbeit (bezieht sich auf Menschen, die etwa durch räumliche Nähe und<br />
gemeinsamen Problemlagen verbunden sind) sowie soziale Gruppenarbeit (bezieht<br />
sich auf pädagogische Gruppen oder auf themenbezogene Gruppen in allen<br />
Bereichen der sozialen Arbeit). Die Ich-Psychologie war Kern der sozialen Einzelhilfe<br />
in der Nachkriegszeit. Die Stärkung des Ich als Hilfe zur Anpassung und nur die<br />
Arbeit im Hier und Jetzt standen im Gegensatz zur Psychoanalyse im Mittelpunkt.<br />
Übertragungsphänomene konnten zwar beobachtet werden, blieben aber unauf-<br />
gearbeitet. In der Übernahme verschiedener Ansätze aus den USA erkannte man in<br />
Deutschland in der Fort- und Weiterbildung eine Chance zur Professionalisierung<br />
sozialer Arbeit, die bis dahin als soziale Fürsorge ihren Namen hatte (vgl. Neuffer<br />
2002, S.39).<br />
Ende der 60er Jahre - im Zusammenhang mit der 68er Studentenbewegung - kam es<br />
in der Sozialen Arbeit zur Methodenkritik. Diese richtete sich gegen Individualisierung<br />
von gesellschaftlich ausgelösten Problemlagen und das unselbständige Übernehmen<br />
der klassischen Methoden aus den USA. Das Fehlen mehrdimensionaler Problem-<br />
definitionen wurde bemängelt, wie etwa die Überprüfung infrastruktureller Ge-<br />
gebenheiten im Gemeinwesen, die ökonomischen Lebensverhältnisse, Grenzen und<br />
Möglichkeiten von Institutionen etc. (vgl. ebd. S. 39f). In den 80er und 90er Jahren<br />
fand eine Ausdifferenzierung neuer Methoden in der sozialen Arbeit statt. Moderne<br />
psychotherapeutische Methoden, wie etwa Gestalt- und Familientherapie oder<br />
Gesprächspsychotherapie, hielten Einzug in die Sozialarbeit. Aufgrund der<br />
professionellen Etablierung Sozialer Arbeit entstanden viele neue Methoden, die bis<br />
heute die Sozialarbeit prägen. Zu nennen sind hier systemische Beratung,<br />
Empowerment, Mediation, Supervision, Sozialmanagement, Selbstevaluation und<br />
eben auch Case Management. Der Begriff Case Management wird in Deutschland<br />
häufig übernommen. Es existieren jedoch auch Bereiche in denen bewusst die<br />
Übersetzung „Fallmanagement“ gewählt wird, da diese bedürftigen Personen eher<br />
zugänglich ist. Dabei handelt es sich bei den verwendeten Begrifflichkeiten um<br />
dasselbe Konzept (vgl. Frommelt et al. 2008, S.16). Aufgrund immer knapper<br />
19
werdender öffentlicher Mittel ist auch Sozialarbeit mittlerweile verpflichtet, Hilfen<br />
stärker als früher an ökonomischen Effektivitäts- und Effizienzkritierien zu orientieren.<br />
Hilfen müssen evaluiert und dokumentiert werden. Zu überprüfen gilt es, ob und wie<br />
Ergebnisse der Arbeit mit den Zielen übereinstimmen und welcher Aufwand welchem<br />
Nutzen gegenübersteht (vgl. Kleve 2008, S.24). In Deutschland etabliert sich Case<br />
Management in der Gegenwart zunehmend als innovatives Konzept. Allerdings sind<br />
die Abläufe noch sehr unübersichtlich, da es kaum Untersuchungen über die<br />
Verbreitung von Case Management gibt. Es zeigen sich außerdem enorme Unter-<br />
schiede in verschiedenen Anwendungsfeldern, obwohl der generelle Ablauf des<br />
Konzeptes für fast alle Bereiche gleich ist (vgl. www.cms.uk-koeln.de/live/case-<br />
management..., Stand 01.03.09). Bei der Übernahme von Case Management in der<br />
Sozialarbeit stand zunächst - wie bereits erwähnt - im Vordergrund das Anliegen<br />
einer Neuorientierung und Modernisierung sozialer Arbeit. Trotz der Unterschiede im<br />
Gesundheitssystem zu den Ländern im anglo-amerikanischen Raum ist auch<br />
Deutschland von explodierenden Sozial- und Gesundheitskosten sowie den Folgen<br />
von diskontinuierlichen und fragrementierten Versorgungsstrukturen betroffen. Daher<br />
nehmen in Deutschland auch zunehmend die Sozialleistungsträger (Krankenkassen)<br />
Case Management ins Visier. Mittlerweile hält das Case Management in vielen<br />
Arbeitsfeldern Einzug. Es ist zu finden in der Altenhilfe und Rehabilitation,<br />
Psychiatrie, Jugendhilfe, Drogenarbeit, in der Arbeit mit HIV-Patienten und chronisch<br />
kranken Menschen. Allerdings handelt es sich bei Case Management in Deutschland<br />
bislang oftmals lediglich um Modellprojekte, bei denen es keine solide finanzielle und<br />
strukturelle Absicherung gibt. Erfahrungen mit Case Management zeigen auch<br />
hierzulande, dass mit zunehmender Popularität des Konzepts, die Gefahr besteht,<br />
dass Case Management einseitig zur ökonomischen Umgestaltung des Sozial- und<br />
Gesundheitswesens eingesetzt wird. Umso wichtiger ist es, bei der Diskussion um<br />
Case Management sich auf die ursprüngliche Intention dieses Steuerungs-<br />
instruments zu besinnen. Dies bedeutet, dass neben vorhandenen ökonomischen<br />
Potentialen der Methode der Klient die bestmögliche, für ihn passende Versorgung<br />
erhalten soll (vgl. Ewers et al. 2000, S. 20). Vermutlich gibt es nur wenige Bereiche,<br />
in denen sich Case Management bis jetzt als regelhaft finanziertes Handlungs-<br />
konzept durchgesetzt hat.<br />
Dennoch ist aufgrund aktueller sozialpolitischer Entwicklungen, Maßnahmen (z.B.<br />
integrierte Versorgungsformen) die Tendenz zu erkennen, dass Case Management-<br />
20
Konzepte in Zukunft weiterentwickelt und gefördert werden. Als Beispiel für eine<br />
gesetzliche Grundlage von Case Management sei hier das Pflege-Weiter-<br />
entwicklungsgesetz (PfWG) genannt. In sein Regelungskonzept wurde nach langer<br />
Diskussion das Thema Beratung und Unterstützung von Menschen mit Pflegebedarf<br />
aufgenommen. Es sieht einen Anspruch auf Pflegeberatung und den Aufbau von<br />
Pflegestützpunkten vor. Den Kommunen als Sozialhilfeträger wird hierbei die Ver-<br />
pflichtung übertragen, sich ebenfalls an der Koordination und der Beratung pflege-<br />
bedürftiger Menschen im Rahmen der Pflegestützpunkte zu beteiligen, womit Case<br />
Management-Strukturen in der Pflege verbindlich gemacht werden (vgl. Klie 2008,<br />
S9f). (näheres hierzu siehe Kapitel 3.2.2).<br />
2.6 Methodisches Vorgehen im Case Management<br />
Im Zentrum der Arbeit des Case Managements steht der konkrete Einzelfall. Dies<br />
bedeutet, dass subjekt- und fallbezogene und auch individuelle Netzwerke entwickelt<br />
und gestaltet werden müssen. Diese Netzwerke sollten subjekt- und fallbezogen<br />
effizient und effektiv sein (vgl. Müller 2008, S.63f). Deutlich gemacht sei an dieser<br />
Stelle, dass Case Management die Steuerung und Gestaltung von Handlungs-<br />
zusammenhängen ist und diese herbeiführt. Für eine einzelne Beratung oder<br />
medizinische Akutversorgung ist Case Management nicht das richtige Instrument.<br />
Wenn allerdings Zeit und eine Vielzahl an Ressourcen notwendig zur Zielerreichung<br />
sind, sollte Case Management zum Einsatz kommen. Gleiches gilt, wenn mehrere<br />
Alternativen vorhanden sind und mehrere Fachdienste und Personen in das<br />
Geschehen involviert sind (vgl. Wendt 2008, S.111). Wie im Kapitel über die<br />
Entwicklung von Case Management bereits beschrieben, waren es schließlich Multi-<br />
problemlagen von chronisch Kranken und die Komplexität von Versorgungssystemen<br />
in einem unkoordinierten Nebeneinander, die ein Case Management ins Leben<br />
riefen.<br />
Bei der Vorgehensweise im Case Management findet sich eine phasenorientierte<br />
Struktur. Auch wenn das Verständnis von Case Management je nach Berufszweig<br />
variiert und es in den einzelnen Arbeitsfeldern unterschiedlich angewendet wird, so<br />
besteht doch Einigkeit über seine Kernfunktionen. Sie kommen in der Ablauf-<br />
organisation eines Hilfegeschehens nacheinander vor (vgl. Wendt 2008, S.112). Es<br />
existieren hinsichtlich der Phasen des Case Managements unterschiedliche<br />
Konzepte und zum Teil unterschiedliche Bezeichnungen in der Literatur. So stellt<br />
21
Wendt 2008 ein achtphasiges Modell und Neuffer 2002 ein sechsphasiges vor. Trotz<br />
der unterschiedlichen Darstellung der Prozessschritte gibt es eine inhaltliche<br />
Übereinstimmung und die Logik ihres Zusammenhangs bleibt dieselbe (vgl. ebd.<br />
S.112). Das fünfteilige Modell nach David Moxley (1989) gilt als Ausgangsbasis für<br />
alle anderen entstandenen Konzepte und ist als Kern der Methode zu verstehen.<br />
Demnach beinhaltet das Case Management folgende Phasen:<br />
„a) ‚assessment’ (Einschätzung, Abklärung),<br />
b) ‚planning’ (Planung),<br />
c).,intervention’ (generell: die Durchführung),<br />
d) ‚monitoring’ (Kontrolle, Überwachung),<br />
f).‚evaluation’ (Bewertung, Auswertung)“ ( zit. nach Wendt 2008, S.112).<br />
Dabei sind die genannten Phasen, die im weiteren Verlauf näher erläutert werden,<br />
nicht streng abzuhandelnde Teilstücke, sondern sie verhelfen dazu, Komplexität zu<br />
erfassen und diese durch eine strukturierte Vorgehensweise zu reduzieren. Somit<br />
soll an den Kern der Problemstellung gelangt und die effektivste und effizienteste<br />
Hilfestellung erarbeitet werden. So kann es im Hilfegeschehen durchaus vorkommen,<br />
dass eine vorhergehende Phase erneut aufgegriffen werden muss, wenn sich<br />
während des Hilfeprozesses Situationen deutlich verändern (z.B. Trennung,<br />
Krankheit etc.). Dann kann es sein, dass eine neue Analyse erfolgen oder ein<br />
Handlungsplan neu überdacht werden muss (vgl. Neuffer 2002, S.49).<br />
„Die Steuerung der Verfahren in der Prozesskette verlangt, dass sie einerseits als<br />
ganze überblickt und gestaltet wird und dass man sie andererseits in ihren<br />
einzelnen Gliedern wahrnimmt und zu handhaben weiß. Zu jeder Komponente von<br />
Case Management gehören Konzepte, Handlungsempfehlungen und methodische<br />
Varianten, die selbständig bedacht und in verschiedenen Humandiensten<br />
Anwendung finden können. Die Selbständigkeit der Komponenten geht soweit,<br />
dass sie auch ohne ein Case Management in den Handlungsfeldern der Sozialen<br />
Arbeit, der Pflege und der Rehabilitation beispielsweise als (Methoden von)<br />
Planung oder als (Methoden der) Evaluation und Qualitätssicherung vorkommen.<br />
Case Management bindet sie ganz oder teilweise in die zielgerichtete Steuerung<br />
von Unterstützungs-, Behandlungs- und anderen Versorgungsprozessen ein.“<br />
(Wendt 2008, S.111).<br />
22
Vor dem Einstieg in die genannten Phasen ist zunächst die Frage, ob und wie man<br />
die Menschen erreicht, für die ein Dienst gedacht und konzipiert ist. Diese<br />
Fragestellung lässt sich wiederum in drei Funktionen gliedern:<br />
• Wohin reicht der Dienst? (= outreach)<br />
Die Frage nach der Reichweite bzw. der Erreichbarkeit kann nur beantwortet<br />
werden, wenn zuvor die Zielgruppe feststeht bzw. eine ausreichende Definition<br />
über die ihr zuzurechnenden Fallgruppen vorliegt. Man kann sie nach der Art der<br />
Problemstellung abgrenzen, zu deren Bewältigung ein Dienst verhelfen will oder<br />
z.B. nach einem Einzugsgebiet, für das ein Dienst zuständig ist, etc.<br />
• Wie ist der Zugang zum Dienst gestaltet? (= access)<br />
Mehrere Faktoren bestimmen, ob für einen festgelegten Personenkreis ein Dienst<br />
leicht oder schwer zugänglich ist. Beispielsweise kann der Zugang rechtlich<br />
beschränkt sein. Oder der Zugang ist abhängig vom finanziellen Aufwand, der<br />
damit verbunden ist. Ein weiterer Faktor kann die Öffnungszeit einer Einrichtung<br />
sein. Soziokulturelle oder psychologische Barrieren könnten bestimmten Personen-<br />
gruppen den Zugang erschweren, etc.<br />
• Wie läuft die Aufnahme von Personen und ihre Identifikation als Klient oder<br />
Patient ab? (= intake)<br />
Das intake umfasst die Anmeldung und Information über die Einrichtung. Es wird<br />
festgestellt, ob jemand sich an die richtige Stelle gewandt hat oder an andere<br />
Fachdienste zu verweisen ist. Es wird eine Vereinbarung getroffen, dass jemand<br />
von jetzt an betreut, behandelt oder unterstützt wird. Ist der Klient beim<br />
„passenden“ Dienst, wird sich dieser für ihn engagieren und ihn aktiv in den nun<br />
beginnenden Prozess der Beratung mit einbinden. Dem Klienten wird dargelegt,<br />
was der eingeleitete Vorgang für ihn bedeuten kann. Das intake stellt im Case<br />
Management die Fallaufnahme dar. (vgl. Wendt 2008, S.119ff).<br />
Wie bereits erwähnt, sind die Phasen als Kernaufgabe eines Case Managements zu<br />
verstehen und sollen in allen ihren Funktionen zur Stärkung eines Unterstützungs-<br />
netzwerks beitragen, in dem der Klient seine Situation bewältigt. Dabei dehnt sich<br />
dieses Netz aus in drei Dimensionen:<br />
• In der Erstreckung der Selbstsorge.<br />
• In der Erstreckung der professionellen Fürsorge durch die Sozialdienste.<br />
23
• In der Erstreckung wechselseitiger Anteilnahme im individuellen Beziehungs-<br />
netz von Menschen.<br />
Bei allen Phasen spielen Selbstsorge, sozialdienstliche Versorgung und informelle<br />
Hilfestellung eine Rolle (vgl. Wendt 2008, S. 113f).<br />
a) Einschätzung und Abklärung (Assessment)<br />
Das englische Verb „to assess“ bezeichnet den Vorgang einer kritischen Beurteilung<br />
und Bewertung eines Sachverhaltes. Assessment meint einen Prozess der Ein-<br />
schätzung und ihr Produkt, dass im weiteren Verlauf verwendet und zu den Akten<br />
hinzugefügt wird (vgl. Wendt 2008, S. 125).<br />
„Das Assessment ist die systematische Erfassung und Bewertung von Bedarf,<br />
Risiken und Ressourcen durch einen strukturierten Prozess der Erhebung,<br />
Beschaffung und Bewertung von Daten in bezug auf Fähigkeiten und Möglichkeiten<br />
des Lebensmanagements“ (Klug 2003, S.85).<br />
Zunächst erfolgt eine Problemanalyse. Bei der Problemanalyse wird der Klient oder<br />
werden die Klienten (z.B. Familie) zur eigenen Problemeinschätzung befragt und die<br />
bisher eigens versuchten Lösungsansätze ermittelt. Bei der Analyse sollten folgende<br />
Fragen eruiert werden:<br />
• Wie stellen sich Problemkonstruktionen dar?<br />
• Welche Problemattributionen finden statt? Wer schreibt wem, welches Problem<br />
und auf welche Art und Weise zu?<br />
• Besteht ein Bedarf zur Problembewältigung?<br />
• Auf welche Weise soll ein Problem bewältigt werden? Was könnte das<br />
Problembewältigungsziel sein? (vgl. Müller 2008, S. 69f).<br />
Ob die Problemsituation nun primär sozialer, gesundheitlicher oder pflegerischer<br />
Natur ist - es bleibt auf jeden Fall die individuelle Disposition im relevanten<br />
Lebensumfeld festzustellen. Weiterhin müssen die Erwartungen seitens der Klienten<br />
an den Case Manager abgefragt werden. Anhand der geschilderten Probleme und im<br />
Hinblick auf deren Lösungen ist eine erstmalige Ressourcen- und Netzwerkanalyse<br />
durchzuführen (vgl. Kleve 2008, S.50). Neben den zu ermittelnden intrapersonalen<br />
Ressourcen (Fähigkeiten aus Sicht des Klienten und aus Sicht des Case Managers)<br />
werden auch soziale und organisatorische Netzwerke, die vorhanden sind, erfasst<br />
und als soziale Ressourcen im Case Management-Prozess begriffen. Es wird auch<br />
überprüft, inwiefern bereits professionelle Helfer (z.B. Ärzte, Sozialpädagogen etc.)<br />
24
ereits mit den Klienten in Kontakt stehen. In diesem Fall ist - nach Absprache mit<br />
den Klienten - auch mit diesen eingebundenen Personen über die Problemsichten<br />
und -erklärungen, bereits unternommene Lösungsversuche sowie über Hilfebedarf<br />
und die vermuteten Ressourcen zu sprechen. Hier kann gegebenenfalls bereits<br />
geprüft werden, für welche Problemstellungen Professionelle oder auch Laien (z.B.<br />
Freunde und Verwandte) aktiviert werden können (vgl. ebd. S.50f). Für das<br />
Assessment sollten - je nach Arbeitsfeld - spezielle Fragebögen entwickelt werden,<br />
die dabei helfen, Interviews mit Klienten hinsichtlich Problemerfassung sowie<br />
Netzwerk- und Ressourcenanalyse und die Hilfebedarfsermittlung zu strukturieren<br />
(vgl. Kleve 2008, S. 50). Die Erfassung sozialer und organisatorischer Netzwerke<br />
kann auch durch verschiedene Techniken erfolgen. Laut Müller bietet sich für die<br />
Arbeit eines Case Managers z.B. die graphische Darstellungsform des „Ego-<br />
zentrierten Netzwerkes nach Jansen 1999“ an (vgl. Müller 2008, S. 70). Im ego-<br />
zentrierten Netzwerk ist der Klient, der zu seinen sozialen Beziehungen befragt wird,<br />
im Mittelpunkt. Um ihn herum werden die Menschen, die mit ihm in Kontakt stehen,<br />
platziert. Um zwischen männlichen und weiblichen Kontakten zu unterscheiden<br />
werden die aus der Genogrammarbeit bekannten Formen zur Darstellung verwendet<br />
(Kreis = weiblich; Quadrat = männlich). Für die Einschätzung der Beziehungsinten-<br />
sivität kann eine gestrichelte Linie für schwache Beziehungen, eine durchgezogene<br />
Linie für mittlere Beziehungen und eine doppelte Linie für starke Bindungen stehen<br />
(vgl. ebd. 2008, S. 70f). Diese Technik sei an dieser Stelle nur exemplarisch als<br />
Beispiel erwähnt. Je nach Fähigkeiten, Problemlagen oder Alter des Klienten ist zu<br />
entscheiden, welche Verfahrensweisen zur Erfassung im Assessment geeignet sind.<br />
Eine Dokumentation ist in jedem Fall unerlässlich. Nach der Ermittlung der sozialen<br />
und organisatorischen Netzwerke, sollen diese mit dem Klienten besprochen werden.<br />
Da durch die Ermittlung von Netzwerken bisher nicht genutzte eventuell aktiviert<br />
werden und im Hilfeprozess nützlich sein können, ist das Assessment nicht nur als<br />
reine Informationsbeschaffung anzusehen. Vielmehr ist es bereits Teil des Hilfe-<br />
handelns und als Basis für eine gelingende Weiterentwicklung im Case Managemen-<br />
Prozess zu verstehen (vgl. Klug 2003, S.90).<br />
b) Hilfeplanung (Planning)<br />
Der festgestellte Bedarf und aufgezeigte Ressourcen im Assessment dienen als<br />
Grundlage für den nun zu erstellenden Hilfeplan. In dieser Phase gilt es, Ziele zu<br />
25
vereinbaren, Mittel und Wege, die zu ihnen führen zu erörtern und Entscheidungen<br />
herbeizuführen (vgl. Wendt 2008, S.136). Demnach besteht die Planung aus einer<br />
Reihe von Aktivitäten, deren Ergebnis das Arbeitsinstrument „Hilfeplan“ darstellt. Der<br />
Hilfeplan ist als Aufgabenverteilung zu verstehen, die vorgibt, welche Handlungen<br />
zur Erlangung von (Teil-)Zielen notwendig sind. Dadurch wird ersichtlich, welche<br />
Einzelpersonen und/ oder Instanzen sich konkret in der Ausführung beteiligen<br />
müssen. Damit bildet der Hilfeplan einen roten Faden für alle Beteiligten und<br />
insbesondere das Fundament für den Case Manager in seiner Funktion. Des<br />
Weiteren dient der Hilfeplan als Basis, um die Resultate aller Aktivitäten und<br />
Bemühungen zur Verwirklichung der Klientenanliegen zu evaluieren (vgl. van Riet/<br />
Wouters 2002, S. 187). Der Hilfeplanprozess gliedert sich also in Teilschritte, in<br />
denen zu Beginn Ziele formuliert werden müssen und am Ende ein Hilfeplan zu<br />
vereinbaren ist. Ziele sichern die Effektivität im Case Management, da am Ende<br />
eines Hilfeprozesses erörtert werden kann, ob und in welchem Umfang sich erhoffte<br />
Wirkungen zeigen. Da in multibelasteten Fallkonstellationen verschiedene Arbeits-<br />
weisen und Techniken eingesetzt werden, kann anhand von formulierten Zielen<br />
eingeschätzt werden, ob die eingesetzten Arbeitsweisen hilfreich waren, Strukturen<br />
und Beziehungen in einem Klientensystem transparent zu machen oder ob ein<br />
Kontrakt zu verbindlichem Handeln führte. So können Zielvereinbarungen auch die<br />
Effizienz steigern. Bereits bei der Zielformulierung kann der Effizienzgedanke mit der<br />
Frage nach der Realisierbarkeit und Dringlichkeit eingearbeitet werden (vgl. Neuffer<br />
2002, S.82). Ziele beschreiben gewünschte Zustände in der Zukunft und stellen<br />
Transparenz her, „wenn sie zeitlich und in der Reichweite differenziert werden.<br />
Allgemeine Ziele, die in Hilfeplänen oft zu finden sind, geben wohl eine Richtung an,<br />
steuern aber in keiner Weise unmittelbar zu folgende Handlungen“ (Neuffer 2002,<br />
S.84). Daher ist es unabdingbar, unterschiedliche Zielebenen (Grundsatzziele,<br />
Rahmenziele, Ergebnisziele) festzulegen. „Die Zielebenen legen in ihrer vertikalen<br />
Struktur den Zielfindungsprozess fest. Aus ihren Inhalten lässt sich ablesen,<br />
inwieweit in ihrem Mittelpunkt ein angestrebtes Ergebnis, ein Prozess oder eine<br />
Struktur bzw. Rahmenbedingungen liegen“ (ebd. S.86). Der unmittelbare Zweck<br />
dieses Teilschritts im Case Management besteht darin, Pläne entwickeln zu können,<br />
die ein raum- und zeitbezogenes Handlungskonzept zur Realisierung der ange-<br />
strebten Ziele beinhalten.<br />
26
Bei der Ausgestaltung der Hilfeplanung ist festzulegen, wer etwas und in welchem<br />
Umfang zu leisten hat. Zudem ist zu bestimmen, wie und mit welchen Mitteln dies zu<br />
geschehen hat. Dabei gelten folgende Prinzipien:<br />
• Es wird im Case-Management generell von der Fähigkeit der selbständigen<br />
Lebensführung des Klienten ausgegangen, sei sie auch noch so eingeschränkt.<br />
Der Klient wird als Experte in eigener Sache gesehen. Durch das Case<br />
Management soll er in seiner Handlungskompetenz und Alltagsbewältigung<br />
gestärkt werden. Dabei wird das Wahlrecht, der Eigenwillen und die Selbst-<br />
verantwortung des Klienten respektiert und dementsprechend mit einbezogen.<br />
Daher gestaltet sich die Hilfeplanung als systematischer Aushandlungsprozess.<br />
• Beim Umgang mit gesundheitsbezogenen Einschränkungen und deren<br />
Bewältigung ist ein In-Beziehung-Setzen von Bedarfslagen und Risiken, von<br />
biografischen Prägungen und individuellen Lebenszielen erforderlich, die sich in<br />
Versorgungspräferenzen ausdrücken. Interventionen müssen sich in diesem<br />
Beziehungsgefüge einpassen. Ist dies nicht der Fall, so steht eine Wirksamkeit<br />
von Interventionen im Zweifel (vgl. van Riet/ Wouters 2002,S.186).<br />
Die Planung von Hilfen ist als ein Prozess zu begreifen, da sie meistens nicht in<br />
einem Schritt abgehandelt werden kann. Planung wird im Fallgeschehen schon im<br />
Assessment vorbereitet, in dem bereits Handlungsperspektiven aufgezeigt werden.<br />
Nach der Zielformulierung bzw. Zielvereinbarung findet im Idealfall eine Hilfe-<br />
plankonferenz statt.<br />
Neben anfänglichen Partnern (z.B. demenzkranke Frau und Ehemann) und dem<br />
Case Manager sind hier auch Kooperationspartner und involvierte Fachkräfte (z.B.<br />
ambulante Dienste, Ärzte, Psychologen etc.) anwesend. In der Konferenz werden<br />
notwendig befundene Leistungen mit allen Beteiligten besprochen und Aufgaben<br />
verteilt. Die Konferenz ist eine Art Vorausschau, wie sich Unterstützung praktisch<br />
gestalten lässt. Eine Konferenz kann auch öfter statt finden, um gegebenenfalls eine<br />
Planung zu revidieren. Mit der Aufgabenverteilung übernimmt jeder Beteiligte<br />
Verantwortung und es werden Aufträge fixiert. Der Hilfeplan wird in jedem Fall als<br />
Schriftstück dokumentiert, in welchem festgehalten wird, was vereinbart wurde und<br />
zu welchen Feststellungen die Beteiligten gekommen sind. In der Regel existieren je<br />
nach Arbeitsfeld Formblätter bzw. Vorlagen im Computer zur schriftlichen Aus-<br />
fertigung des Hilfeplans. Der Hilfeplanungsprozess endet in der Regel mit einer<br />
27
getroffenen Entscheidung und einem Kontrakt, um das im Hilfegeschehen Ver-<br />
einbarte für alle Beteiligten verbindlich zu machen (vgl. Wendt 2008, S. 138ff).<br />
c) Intervention und Monitoring (Kontrollierte Durchführung)<br />
Wendt fasst die bei Moxley separat aufgeführten Phasen „Intervention“ und<br />
„Monitoring“ zur „kontrollierten Durchführung“ zusammen (vgl. 2008, S.142). In dieser<br />
Phase leistet der Case Manager die einzelnen Hilfen nicht selbst, sondern „führt sie<br />
zusammen, koordiniert sie in individueller Fallführung und lenkt ihren Ablauf in der<br />
Phase der Umsetzung (Implementation) des Hilfeplans“ (Wendt 2008, S.142). Er<br />
überwacht die Durchführung der vereinbarten Hilfen bzw. Dienstleistungen und<br />
beobachtet ihren Verlauf (= monitoring). Ziel ist es, damit die Dienstleistungen und<br />
Bewältigungsleistungen einer Person sicherzustellen. Monitoring meint eine<br />
fortlaufende Überprüfung des geregelten Ablaufs der Versorgung sowie der Fort-<br />
schritte, die ein Klient macht (gemäß dem Plan, der zu seiner Bedarfsdeckung für ihn<br />
erarbeitet wurde) (vgl. ebd.). Klug sieht in der bereits beschriebenen Hilfekonferenz<br />
ein geeignetes Hilfsmittel für das Monitoring. Allerdings wird dies gerade in<br />
Deutschland aufgrund des hohen Aufwandes wenig eingesetzt und unterschätzt. Es<br />
ist jedoch als effektives Instrument zu betrachten, da die Dokumentation, die dabei<br />
erfolgt, der laufenden Vergewisserung einer angemessenen Verfahrensweise dient.<br />
Sie ist ein Leistungsnachweis, der zur Qualitätssicherung beiträgt und zur späteren<br />
Auswertung und Rechenschaftsablegung herangezogen werden kann (vgl. 2003 S.<br />
54f). Was das Monitoring im Einzelfall darstellt, entspricht auf der betrieblichen<br />
Ebene dem „Controlling“. Dies ist die Servicefunktion, die in einem komplexen<br />
System die Teilfunktionen auf die Funktion des ganzen Systems beobachtet und<br />
wiederum im System - vor allem im Management - rückmeldet.<br />
Wenn der Case Manager den Vorgang der Leistungserbringung überwacht, fällt ihm<br />
auch eine Anwaltschaftsfunktion für den Klienten zu. Die Anwaltschaft kann darin<br />
bestehen, dass der Case Manager von sich aus die Einhaltung von Leistungs-<br />
erbringungen bei Diensten oder von Absprachen innerhalb der Familie anmahnt.<br />
Anwaltschaft kann weiterhin bedeuten, dass der Case Manager Beschwerden<br />
seitens der Klienten nachgeht. Allerdings kann anwaltliches Handeln dann schwierig<br />
werden, wenn Interessenskonflikte vorliegen und nicht frühzeitig geklärt werden<br />
können. So lassen sich etwa Wünsche von Klienten nicht immer mit den<br />
Notwendigkeiten eines Dienstbetriebes vereinbaren. Hier ist Verhandlungs- und<br />
28
Vermittlungsgeschick seitens des Case Managers gefragt (vgl. Wendt 2008, S.143f).<br />
Da Case Management Klienten grundsätzlich fördern soll, selbständig Hilfen und<br />
professionelle Dienste aufzusuchen, kann es nötig werden, dass der Case Manager<br />
als „Anwalt“ zunächst die Kontakte für seine Klienten zu bestimmten Stellen<br />
aufnimmt oder die Klienten durch Beratung befähigt, Angebote anzunehmen und<br />
Anliegen zu artikulieren. Dies ist vor allem vor Beendigung des Case Managements<br />
sehr wichtig, damit den Klienten ein informelles und formelles Netzwerk zur Ver-<br />
fügung steht, dass sie selbständig und ohne großen Aufwand in Anspruch nehmen<br />
können (vgl. Kleve 2008, S.54).<br />
d) Evaluation<br />
Das Wort Evaluation bezeichnet einen Prozess der Einschätzung dessen, was<br />
geschieht oder eingetreten ist. Es findet eine Überprüfung statt, ob und inwieweit der<br />
Sollzustand erreicht ist. Für Evaluation gibt es eine Vielzahl an Verfahrensweisen. Im<br />
Rahmen eines Qualitätsmanagements wird z.B. die Einhaltung von Standards und<br />
die Fachgerechtigkeit eines Vorgehens evaluiert. Dies können die beruflich<br />
Handelnden selbst vornehmen (Selbstevaluation) oder extern einschätzen lassen<br />
(Fremdevaluation). Dies ist angebracht zur Beurteilung der Qualität der Arbeit eines<br />
Dienstbetriebes. Auf der Ebene des Einzelfalles mit dem sich Case Management<br />
befasst, sollte in erster Linie der Nutzer einschätzen, was ihm eine Dienstleistung<br />
gebracht hat. Natürlich ist Selbstevaluation in Betrieben sinnvoll, um fallübergreifend<br />
Stärken und Schwächen des beruflichen Handelns zu überprüfen. Im Case<br />
Management verlangt Evaluation jedoch im Versorgungszusammenhang jedes<br />
Einzelfalles eine Bewertung vorzunehmen (vgl. Wendt 2008, S.146): „In der Praxis<br />
und als Teil von ihr wird evaluiert, was in ihr geschieht (reflecting in practice). Etwas<br />
anderes ist eine Besinnung der Praktiker über das (reflecting on practice), was sie<br />
tun oder getan haben“ (Wendt 2008, S.146). Natürlich findet auch eine Evaluation<br />
auf formativer Ebene statt. Sie begleitet das Handeln im Dienst und bewertet die<br />
Gestaltung eines Geschehens. Hier geht es um Fragen, wie sich seine Qualität ent-<br />
wickelt und ob sie den Absichten im Einzelfall und den Standards entspricht, an<br />
welche der Dienst sich halten will. Es wird auch beurteilt, wie es einem Klienten im<br />
Verlauf einer Behandlung oder Betreuung ergeht. Allerdings hat diese Art der<br />
Evaluation eine Kontrollfunktion und gehört daher in die Phase des Monitoring. In der<br />
Evaluationsphase im Case Management erfolgt eine Orientierung an der indi-<br />
29
viduellen Lebenslage, d.h. also daran, was sich in den einzelnen Dimensionen getan<br />
hat. Dabei ergänzen sich folgende Bewertungen:<br />
• Eine vergangenheitsorientierte und am Lebenslauf orientierte Bewertung (was<br />
wurde erreicht?)<br />
• Eine umweltorientierte Bewertung (welche soziale Akzeptanz erfährt das<br />
gewählte Unterstützungs- und Bewältigungsverfahren sowie sein Ergebnis?<br />
Was hat sich sozial verändert?)<br />
• Eine subjektive Bewertung (welche persönliche Befriedigung erfährt der Klient?<br />
Wie wird die physische und psychische Stabilisierung und Besserung beur-<br />
teilt?).<br />
• Eine perspektivische Bewertung (welche Chancen wurden wahrgenommen?<br />
Welche neuen Perspektiven konnten geschaffen werden?) (vgl. Wendt 2008,<br />
S.146f).<br />
Da individuelle Wahrnehmung für manche Klienten schwer formuliert oder reflektiert<br />
werden kann, ist daher eventuell eine gemeinsame Evaluation sinnvoll. Hier können<br />
Aspekte erhellt werden, die ein Einzelner womöglich von sich aus nicht erkennt. Dies<br />
kann in Gruppengesprächen mit den Beteiligten im Hilfegeschehen erfolgen. Anhand<br />
der beobachteten Veränderungen und gesetzten Kriterien in der Hilfeplanung kann<br />
ein Case Manager erkennen, wann eine Unterstützung für den Klienten zu beenden<br />
ist. Eine Evaluation des Erreichten kann mit einer abschließenden Besprechung<br />
zusammenfallen. Hierbei ist jedoch Umsicht seitens des Case Managers gefragt. Er<br />
muss sich vergewissern, ob sich der Klient hinreichend auf das Ende der Unter-<br />
stützung vorbereitet hat und ob in der Versorgung die notwendigen Schritte einge-<br />
leitet sind, die eine Beendigung der Hilfen rechtfertigen (Verselbständigung, Über-<br />
leitung, Absprache mit Angehörigen, etc.) und vom Case Manager verantwortet<br />
werden kann. (vgl. Wendt 2008, S.147f). In der Abschlussphase fungiert die<br />
Evaluation als Neueinschätzung der Situation des Klienten (= reassessement). Falls<br />
der Status des Klienten es nötig erscheinen lässt, knüpft an das Reassessment eine<br />
weitere Planung und Entscheidungsfindung an.<br />
Neben der beschriebenen klientenbezogenen Evaluation ist allerdings auch ein<br />
systembezogener Erfolg des Case Managements zu überprüfen. Denn mit Case<br />
Management soll Unterversorgung bzw. Überversorgung und Fehlversorgung<br />
entgegengewirkt werden. Es soll nicht nur effektiv, sondern auch effizient sein, d.h.<br />
dass kostengünstig ein möglichst optimaler Ressourceneinsatz erreicht werden soll.<br />
30
Dies kann jedoch nicht am Einzelfall geprüft werden, sondern nur über einen<br />
längeren Zeitraum hinweg und bezogen auf die ganze Population, der sich ein<br />
Leistungsträger mit dem Einsatz von Case Management verpflichtet (vgl. ebd.<br />
S.149).<br />
3. Case Management in der Altenhilfe bei Pflegebedürftigkeit im geronto-<br />
psychiatrischen Bereich<br />
Nachdem im vorhergehenden Kapitel das Konzept Case Management ausführlich<br />
dargestellt wurde, wird im Folgenden erläutert, wie derzeit der Stand der Umsetzung<br />
von Case Management in der Altenhilfe in Deutschland ist und zwar speziell bei<br />
Pflegebedürftigkeit im gerontopsychiatrischen Bereich. Es erscheint sinnvoll,<br />
zunächst die Anwendung von Case Management in der Altenhilfe generell dar-<br />
zustellen und auch die Anwendung in der Pflege und in der Gerontopsychiatrie<br />
getrennt voneinander auszuführen, auch wenn diese Elemente in sich verzahnt sind.<br />
Dennoch gibt es Besonderheiten, die in der einzelnen Aufstellung deutlich werden.<br />
3.1 Case Management in der Altenhilfe<br />
Nahezu alle europäischen Länder widmen Case Management in Anbetracht der<br />
demografischen Entwicklung verstärkte Aufmerksamkeit. Modellprojekte erproben<br />
dabei die bedarfsorientierte Weiterentwicklung heutiger (Alten-) Hilfesysteme (vgl.<br />
Kuhlmann 2005, S. 76f). Das Ziel ist „älteren Menschen, die im Verlauf des Alterns-<br />
prozesses erforderlichen spezifischen Hilfen entsprechend ihren individuellen Be-<br />
dürfnissen in fachlich abgesicherter Weise und aufeinander abgestimmt...“ (Engel &<br />
Engels 2000, S.122) zukommen zu lassen, um somit die Selbständigkeit und<br />
Selbstversorgung alter Menschen, auch bei Pflegebedürftigkeit, so lange als möglich<br />
zu gewährleisten. Auch in Deutschland gewinnt Case Management als Arbeitsfeld in<br />
der Altenhilfe zunehmend an Bedeutung. Dies wird belegt durch den sozial-<br />
politischen Stellenwert des Ansatzes und der entsprechenden Förderung von<br />
Modellprojekten (vgl. ebd. S.16). Das Case Management in der Altenhilfe sieht sich<br />
einer charakteristischen Trennung des Sozial- und Gesundheitswesens gegenüber,<br />
indem folglich nötige soziale und pflegerische Hilfen sinnvoll aufeinander abgestimmt<br />
werden müssen (vgl. ebd. S.109). Außerdem hat sich Case Management in diesem<br />
Bereich unter anderem mit infrastrukturellen und sozialplanerischen Notwendigkeiten<br />
wie etwa Versorgungslücken und Unterstützungsbedarf, psychosozialen Aspekten<br />
31
des Alters (Singularisierung) sowie Stigmatisierung und Ausgrenzung gefährdeter<br />
Gruppen (z.B. demenzkranker Menschen) auseinander zu setzen (vgl. Steiner-<br />
Hummel 1995, S. 165). In aktuellen (Modell-) Projekten der Altenhilfe findet Case<br />
Management nur in Ansätzen Realisierung. Die Anwendung der gesamten Prozess-<br />
schritte des Case Managements erfolgt in Deutschland eher selten. Dies liegt daran,<br />
dass Case Manager meist nicht über ausreichend Kapazitäten verfügen, um das<br />
gesamte Case Management-Regelwerk umzusetzen. Diese Tatsache wirft die Frage<br />
auf, inwiefern Case Management als Ansatz praxistauglich ist (vgl. Kuhlmann 2005,<br />
S. 79). Laut Ewers kann bezüglich der Umsetzung der Ansatz grundsätzlich „diskret<br />
in das Versorgungshandeln“ (2000, S.84) der Sozial- und Gesundheitsprofessionen<br />
integriert werden. Dies erfordert jedoch neben der Qualifikation von Anwendern den<br />
Auf- und Ausbau von Case Management-gerechten Strukturen (vgl. ebd.). Die<br />
personenbezogene Methode Case Management kann in Humandiensten nur erfolg-<br />
reich eingesetzt werden, falls<br />
„sie mit einer Organisationsentwicklung verbunden ist, welche die Strukturen der<br />
humandienstlichen Versorgung auf die prozessualen Anforderungen des Case<br />
Managements abstimmt und ihm das Netzwerk zur Koordination und Kooperation<br />
der beteiligten Stellen und Fachkräfte schafft“ (Wendt 2009, S.14f).<br />
Eine ansatzweise Umsetzung von Case Management ist insofern kritisch zu<br />
betrachten, als dass besonders die Vermittlung von Hilfen und die Überwachung des<br />
Versorgungsprozesses konstitutive Bestandteile des Case Managements sind. Bei<br />
der Umsetzung sollten alle Elemente des Case Management-Prozesses berück-<br />
sichtigt werden, damit der Ansatz nicht in einen reinen Beratungsprozess mündet<br />
(vgl. Engel & Engels 2000, S.116). Bislang bleibt umstritten, inwiefern der Einsatz<br />
einzelner Case Management Elemente die Bezeichnung Case Management recht-<br />
fertigt (vgl. Kuhlmann 2005, S. 80).<br />
3.2 Case Management bei Pflegebedürftigkeit<br />
Das Case Management in der Pflege als zentraler Bestandteil der Altenhilfe soll<br />
unter diesem Punkt genauer dargelegt werden. Zunächst erfolgt eine Definition von<br />
Pflegebedürftigkeit. Weiterhin werden gesetzliche Grundlagen für Case Management<br />
in der Pflege dargestellt und die Voraussetzungen die ein Case Management in<br />
diesem Bereich erfüllen muss, geschildert.<br />
32
3.2.1 Definition von Pflegebedürftigkeit<br />
Per Gesetz sind Personen pflegebedürftig,<br />
„die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder<br />
Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im<br />
Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs<br />
Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen<br />
(http://www.gesetzliche-pflegeversicherung.com.,Stand 02.05.09).<br />
3.2.2 Rechtliche Grundlagen für Case Management in der Pflege<br />
Mittels der aktuellen Reform der Pflegeversicherung soll für Pflegebedürftige eine<br />
bessere Beratung und Hilfestellung zur Bewältigung der Lebenssituation und zur<br />
Sicherung der Versorgung geschaffen werden. Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz<br />
(PfWG) gewährt allen Versicherten der Pflegeversicherung einen Rechtsanspruch<br />
auf so genannte Pflegeberatung (vgl. Frommelt et al. 2008, S.11). § 7a Pflege-<br />
beratung, SGBXI:<br />
„(1)Personen, die Leistungen nach diesem Buch erhalten, haben ab dem 1. Januar<br />
2009 Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch einen Pflege-<br />
berater oder eine Pflegeberaterin bei der Auswahl und Inanspruchnahme von<br />
bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen sowie sonstigen<br />
Hilfsangeboten, die auf die Unterstützung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs-<br />
oder Betreuungsbedarf ausgerichtet sind (Pflegeberatung). Aufgabe der Pflege-<br />
beratung ist es insbesondere,<br />
1. den Hilfebedarf unter Berücksichtigung der Feststellung der Begutachtung<br />
durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung systematisch zu<br />
erfassen und zu analysieren<br />
2. einen individuellen Versorgungsplan mit den im Einzelfall erforderlichen<br />
Sozialleistungen und gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabili-<br />
tativen oder sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfen zu<br />
erstellen.<br />
3. auf die für die Durchführung des Versorgungsplans erforderlichen Maßnahmen<br />
einschließlich deren Genehmigung durch den jeweiligen Leistungsträger hin-<br />
zuwirken.<br />
4. Die Durchführung des Versorgungsplans zu überwachen und erforderlichenfalls<br />
einer veränderten Bedarfslage anzupassen sowie<br />
33
5. bei besonders komplexen Fallgestaltungen den Hilfeprozess auszuwerten und<br />
zu dokumentieren.“ (zit. nach Frommelt et al. 2008, S. 71).<br />
Weiterhin ist im PfWG der Aufbau von Pflegestützpunkten rechtlich in §92c, SGB XI<br />
festgeschrieben. Die Aufnahme der Termini „Beratung“ und „Unterstützung“ in<br />
diesem Gesetz machen Care- und Case-Management-Strukturen in der Pflege<br />
verbindlich. Somit sehen sich Kranken- und Pflegekassen als auch die Länder und<br />
Kommunen vor die Herausforderung gestellt, die Aufgaben der Pflegeberatung und<br />
den Aufbau von Pflegestützpunkten gemeinsam vorzunehmen. Einrichtungen der<br />
Altenhilfe und der Pflege sind hierdurch in ein sich neu strukturierendes Netzwerk<br />
eingebunden. Im Zuge dieser Entwicklung haben viele dieser Einrichtungen sich<br />
oftmals selbständig in den letzten Jahren um Qualifikation und Aufbau von Case<br />
Management bemüht. Trotz der gesetzlichen Verankerung von Pflegeberatung und<br />
Pflegestützpunkten bleiben hinsichtlich der Implementierung und Ausgestaltung noch<br />
viele Fragen offen. In positiver Hinsicht bietet dieser Umstand einen großen<br />
Gestaltungsraum für die Akteure. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass<br />
Pflegeberatung und Pflegestützpunkte in der Vielfältigkeit oder Beliebigkeit unter-<br />
zugehen drohen (Klie, 2008, S.9). Zusammenfassend betrachtet hat das Pflege-<br />
Weiterentwicklungsgesetz ein erweitertes Pflegeverständnis aufgenommen, das<br />
seitens der Fachwelt längst fällig war. Hiernach impliziert Pflege über pflegerische<br />
Verrichtungen hinaus Lebensbewältigung und Alltagsbesorgung in gesundheitlicher<br />
und sozialer Hinsicht, sowie die Bewirtschaftung der hierfür notwendigen Kräfte,<br />
Mittel und Möglichkeiten. Weil es sich bei der Pflegesituation um einen komplexen<br />
Zusammenhang handelt (Pflegebedürftige, pflegende Angehörige, informelle Helfer,<br />
pflegeberuflich und administrativ Beteiligte), kann eine effektive begleitende Unter-<br />
stützung nur durch eine organisierende, steuernde und vernetzte Weise stattfinden<br />
(vgl. Frommelt et al. 2008, S. 11f). Hinsichtlich der Konzipierung, Ausstattung und<br />
Ansiedelung der vorgesehenen Unterstützung sind Prinzipien zu beachten, die<br />
überall in den Reformen des Sozialleistungssystems gelten:<br />
„Integrierte Versorgung, die sektorenübergreifend zu gestalten ist, Anspruch von<br />
Leistungsberechtigten auf Rehabilitation und Teilhabe, Individualisierung der<br />
Bedarfsfeststellung, der Hilfeplanung und der Bedarfsdeckung, eigenverant-<br />
wortliche Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an der humandienstlichen<br />
Versorgung“ (ebd., S.12).<br />
34
Diese Prinzipien stehen im Sinne eines Case Managements und lassen eine<br />
Positionierung der geplanten Pflegeunterstützung zwischen der Lebenswelt der<br />
Betroffenen und dem formell strukturierten Versorgungssystem erwarten (vgl. ebd.<br />
S.12).<br />
3.2.3 Voraussetzungen für das Case Management in der Pflege<br />
Angesichts der Ausweitung und Favorisierung der häuslichen Versorgung<br />
pflegebedürftiger älterer Menschen durch Angehörige, mit oder ohne formelle<br />
Unterstützung durch ambulante Dienste (unter Einbeziehung teilstationärer oder<br />
zeitweise stationärer Versorgung), muss das Case Management bestimmte Voraus-<br />
setzungen erfüllen. Seine Hauptaufgabe besteht hierbei<br />
„in der Abstimmung professioneller Dienstleistungen mit dem informellen Hilfe-<br />
system, also mit der Selbstpflege der Leistungsnehmer und mit der Angehörigen-<br />
pflege. Diese Abstimmung ist Sache des Assessments, der Zielvereinbarung und<br />
Hilfeplanung sowie der Pflegeplanung, der kontrollierten Durchführung (Koordi-<br />
nation und Kooperation) und der Evaluation“ (Wendt 2008, S. 189).<br />
Formelle häusliche Pflege muss laut Wendt in ein „Alltagsmanagement“ übergehen.<br />
Das bedeutet, dass die professionelle Unterstützung von außen „in die Bewältigungs-<br />
weise selbständigen Lebens und Haushaltens eingefügt“ (ebd. S.189) wird. Ein<br />
Beitrag hierzu sind Hilfestellungen unterschiedlicher fachlicher Herkunft zur all-<br />
täglichen Lebensführung. Diese müssen gegebenenfalls bei chronischer Krankheit<br />
oder Behinderung an Erfordernisse der Behandlung und Versorgung angepasst<br />
werden. Somit steuert das Case Management fallbezogen den Hilfe-, Behandlungs-,<br />
Pflege-, oder Rehabilitationsprozess. Das Reassessment hat in diesem Bereich<br />
einen hohen Stellenwert, d.h. dass eine regelmäßige Kontrolle der Passung<br />
zwischen Hilfepaket und Versorgungsbedarf des Pflegebedürftigen im Vordergrund<br />
steht (vgl. Kuhlmann 2005, S.77ff). Bezüglich des Anforderungsprofils eines Case<br />
Managers ergeben sich aus der Lebens- und Versorgungssituation älterer pflege-<br />
bedürftiger Klienten und ihrer Angehörigen einige Besonderheiten:<br />
- „Die Notwendigkeit der zugehenden Arbeit aufgrund der Abgeschiedenheit von<br />
Lebens- und Pflegekonstellationen und der mangelnden Inanspruchnahme von<br />
Diensten.<br />
- Schaffung einer Vertrauensbasis und eines Arbeitsbündnisses mit allen an der<br />
Versorgung Beteiligten, insbesondere mit pflegenden Angehörigen.<br />
35
- Bei der Erstellung des Hilfeplans ist zu berücksichtigen, dass Ziele für den<br />
Pflegebedürftigen (z.B. Aktivierung) und Ziele für das Umfeld (z.B. Entlastung)<br />
divergieren können und in Einklang gebracht werden müssen.<br />
- Die Öffnung der Pflegesituation, das heißt die Hinzunahme von Diensten sollte<br />
kleinschrittig erfolgen und an der bisherigen Lebensform des älteren Menschen<br />
orientiert sein.<br />
- Eine wesentliche Aufgabe des Case Managers in der Altenarbeit stellt die<br />
Befähigung des älteren Menschen zur Inanspruchnahme von Hilfen dar“ (Steiner<br />
Hummel 1995, S. 173ff ).<br />
3.3 Case Management in der Gerontopsychiatrie<br />
Aufgrund des komplexen und vielschichtigen Hilfe- und Unterstützungsbedarfs<br />
demenzkranker und anders gerontopsychiatrisch erkrankter älterer Menschen findet<br />
das einzelfallbezogene Case Management auch für diese Zielgruppe in Modell-<br />
projekten Anwendung. Allerdings befindet sich der Ansatz in diesem Bereich noch in<br />
der Erprobungsphase und findet nur vereinzelt Berücksichtigung (vgl. Kuhlmann<br />
2005, S.83). Daher werden nach der Definition von Gerontopsychiatrie und Geronto-<br />
psychiatrischer Versorgung und Beschreibung von Krankheitsbildern allgemeine<br />
Anmerkungen zur derzeitigen praktischen Umsetzung von Case Management in der<br />
Gerontopsychiatrie in den weiteren Ausführungen dargestellt. Im Anschluss erfolgt in<br />
einem extra Kapitel als Beispiel für ein Modellprojekt die Vorstellung des „Geronto-<br />
psychiatrischen Fallmanagements (AGFM)“ der <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Fach-<br />
koordination Mittelfranken - kurz GeFa genannt - .<br />
3.3.1 Definition von Gerontopsychiatrie und gerontopsychiatrischer Ver-<br />
sorgung<br />
Laut der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie<br />
(DGGPP) ist die Gerontopsychiatrie ein eigenständiger Teilbereich der Psychiatrie,<br />
„wobei sie jedoch nicht als eine einfache Extrapolation der ‚Erwachsenen’-<br />
Psychiatrie aufzufassen sei, sondern vielmehr unter Bezug auf die Ergebnisse der<br />
Forschung der Gerontologie und der Geriatrie ihre eigenen präventiven,<br />
diagnostischen, therapeutischen und rehabilitativen Strukturen entwickelt“<br />
(http://de.wikipedia.org/wiki/Gerontopsychiatrie...,Stand 09.05.09).<br />
36
Unter gerontopsychiatrischer Versorgung versteht man<br />
„die psychiatrische, psychotherapeutische und psychosoziale Versorgung von<br />
Menschen über 65 Jahren...In der gerontopsychiatrischen Versorgung hat neben<br />
der klinischen die ambulante und häusliche gesundheitliche und soziale Ver-<br />
sorgung eine große Bedeutung. Im ambulanten wie im (teil-)stationären Sektor<br />
fehlen aber häufig spezifische gerontopsychiatrische Angebote. Deshalb ist eine<br />
enge Abstimmung zwischen Geriatrie, Gerontopsychiatrie und kommunaler<br />
Gesundheitsplanung (Rehabilitation, Pflege, Kostenträger, soziale Hilfen) not-<br />
wendig. Nur so können Alterserkrankungen die häufig durch Multimorbidität und<br />
Chronizität gekennzeichnet sind, adäquat behandelt werden“<br />
(http://www.duesseldorf.de/gesundheit/bericht...,Stand 09.05.09).<br />
3.3.2 Gerontopsychiatrische Erkrankungen<br />
Zu den typischen gerontopsychiatrischen Erkrankungen gehören die Demenz, die<br />
Altersdepression, das Delir und Schizophrenie (http://www.duesseldorf.de-<br />
/gesundheit/bericht...,Stand 09.05.09). Bei der Häufigkeit gerontopsychiatrischer Er-<br />
krankungen wird davon ausgegangen, dass ca. 25% der älteren Menschen von einer<br />
nicht geringfügigen Störung betroffen sind (vgl. Häfner 1994 S.156). Eingegangen sei<br />
an dieser Stelle lediglich auf die Krankheitsbilder Demenz und Depression. Zum<br />
einen, weil sie als psychische Erkrankung im Alter am häufigsten auftreten (vgl. ebd.)<br />
und zum anderen, weil sie hauptsächlich in den Modellprojekten des geronto-<br />
psychiatrischen Case Managements aufgegriffen werden. Allerdings können beide<br />
Erkrankungen nur kurz umrissen werden, da andernfalls der Rahmen dieser Arbeit<br />
gesprengt würde.<br />
a) Demenz<br />
Bei Demenz (aus dem lateinischen: Dementia = Wahnsinn, Tollheit) handelt es sich<br />
um ein definiertes Muster von Störungen, das Einbußen von Gedächtnis- und<br />
Orientierungsleistung als auch der intellektuellen Leistungen beinhaltet. Durch die<br />
Demenz findet eine Einschränkung von ehemals bewältigten Alltagsanforderungen<br />
statt. Außerdem treten Auffälligkeiten in der Stimmung (Depressivität) und des Ver-<br />
haltens auf (motorische Unruhe). (vgl. http://www.duesseldorf.de/gesundheit/<br />
bericht..., Stand 09.05.09). Auffallende Beispiele für die genannten Störungen sind<br />
Einbußen in der Sprachfähigkeit (Schwierigkeiten, Objekte und Dinge zu benennen;<br />
37
Probleme beim Verstehen gesprochener und geschriebener Sprache), Beein-<br />
trächtigung beim Ausführen von Handlungen (Anziehen, Zähneputzen), Orien-<br />
tierungsprobleme (nicht nach Hause finden) sowie Gedächtnisstörungen<br />
(Schwierigkeiten, sich Neues zu merken, Vergessen von Dingen, die man vorher<br />
wusste) (vgl. Engel 2006, S.14). Eine Demenz kann unterschiedliche Ursachen<br />
haben. Es wird unterschieden zwischen primärer und sekundärer Demenz. Bei der<br />
sekundären Demenz ist das Gehirn selbst ursprünglich nicht erkrankt. Es ist lediglich<br />
in seiner Funktionstüchtigkeit eingeschränkt, weil ein anderes Organ in Mitleiden-<br />
schaft gezogen wird. Seine Funktionsstörungen sind also nur Folge von anderen<br />
körperlichen Erkrankungen. Sie kann z.B. durch chronische Vergiftungen, hormonelle<br />
Störungen oder Mangelzustände auftreten. Wenn die körperlichen Beschwerden<br />
behandelt werden, kann sich die sekundäre Demenz im günstigsten Fall wieder<br />
zurückbilden. Bei den primären Demenzen ist hingegen das Gehirn unmittelbar<br />
erkrankt und sie sind in der Verlaufsform progredient (fortschreitend) und nicht<br />
heilbar. Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Krankheit, die langsam<br />
fortschreitet. 60-70% aller Demenzkranken sind von einer Alzheimer-Demenz<br />
betroffen. Sie führt durchschnittlich nach acht bis zehn Jahren zum Tod. Bei<br />
Alzheimer bilden sich Eiweißablagerungen (Amyloid-Plaques) zwischen den<br />
Gehirnzellen in bestimmten Gehirnregionen. Zudem entstehen fadenförmige<br />
Eiweißablagerungen innerhalb der Gehirnzellen. Dies führt letztlich zum<br />
fortschreitenden Absterben der Gehirnzellen (vgl. Engel 2006, S. 15f). In Deutsch-<br />
land gibt es derzeit ca. 1,1 Millionen Demenzkranke. Zwei Drittel hiervon leidet unter<br />
der Alzheimer Krankheit. Jährlich treten mehr als 250.000 Neuerkrankungen auf.<br />
Aufgrund der demografischen Entwicklung nimmt die Zahl der Demenzerkrankungen<br />
stetig zu. Sollte kein einschneidender Durchbruch hinsichtlich Prävention und<br />
Therapie zu verzeichnen sein, wird sich nach voraussichtlichen Berechnungen der<br />
Bevölkerungsentwicklung die Krankenzahl bis zum Jahr 2050 auf ca. 2,6 Millionen<br />
erhöhen. Dies entspricht einem mittleren Anstieg der Patientenzahlen um nahezu<br />
35.000 pro Jahr. Laut umfangreichen Studien aus Deutschland und anderen<br />
Industrienationen liegen die Zahlen für die Prävalenz (= Anzahl der Kranken in der<br />
Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt) von demenziellen Erkrankungen<br />
zwischen sechs und knapp neun Prozent der Menschen im Alter über 65 Jahren (vgl.<br />
http://www.deutsche-alzheimer.de..., Stand 09.05.09). Die Prävalenzrate steigt mit<br />
zunehmendem Alter an. Wie aus der nachgehenden Tabelle ersichtlich wird,<br />
38
„verdoppelt sich die Krankheitsziffer im Abstand von jeweils etwa 5 Altersjahren<br />
und nimmt von knapp über 1% in der Altersgruppe der 65-69-Jährigen auf mehr als<br />
30% unter den über 90-Jährigen zu. Überträgt man die altersbezogenen<br />
Prävalenzen auf die deutsche Altersstruktur, so zeigt sich, dass rund zwei Drittel<br />
aller Erkrankten bereits das 80. Lebensjahr vollendet hat. Weniger als 3% der<br />
Erkrankungen treten bereits im Alter von unter 65 Jahren auf. In Deutschland sind<br />
ca. 20.000 Patienten von diesen früh beginnenden Demenzen betroffen<br />
(http://www.deutsche-alzheimer.de..., Stand 09.05.09).<br />
Tabelle 1: Prävalenz von Demenzen in Abhängigkeit vom Alter<br />
(Quelle: http://www.deutsche-alzheimer.de..., Stand 09.05.09)<br />
b) Depression im Alter<br />
Bei Depressionen spricht man von affektiven Störungen. Das bedeutet, dass die<br />
Hauptsymptome sich durch eine Veränderung der Stimmung oder der Affektivität<br />
auszeichnen, die zum negativen, also depressiven Pol verschoben sind.<br />
Eine Depression im Alter stellt eine schwere Erkrankung dar. Es kommt häufig zu<br />
einem Verlust der Lebensfreude, zu Einschränkungen im Kontaktverhalten und in der<br />
Bewältigungsfähigkeit der Alltagsaufgaben. Dies kann wiederum zu Isolation, Verein-<br />
samung und vorzeitiger Hospitalisierung im Heim führen. Zudem konnte nachge-<br />
wiesen werden, dass die genannten Störungen mit einem höheren Mortalitätsrisiko<br />
einhergehen. Dies liegt nicht alleine an einem höheren Suizidrisiko, sondern auch an<br />
einer höheren somatischen Komorbidität. Energieverlust, Schmerzsyndrome,<br />
Gewichtsverlust, depressive Verstimmung, Angst, Neigung zum Grübeln sowie<br />
Apathie oder gesteigerte Erregbarkeit zählen zu den Leitsymptomen von<br />
Depressionen im Alter (http://www.duesseldorf.de/gesundheit/bericht..., Stand<br />
39
09.05.09). Dies allein ist jedoch noch kein klares Anzeichen von Depression: Die<br />
Symptome müssen über einen Zeitraum von zwei Wochen ununterbrochen<br />
bestehen. Zudem muss eine einschneidende Veränderung im Vergleich zu einem<br />
früheren beschwerdefreien Zustand feststellbar sein. Einschneidende Lebens-<br />
ereignisse, wie beispielsweise Tod des Partners, Pensionierung, Rollenverlust<br />
gefolgt von Inaktivität und Kompetenzverlust durch Krankheit, stellen bekannte<br />
psychosoziale Faktoren für die Auslösung einer Depression im höheren Lebensalter<br />
dar. Konflikte und Überforderung einhergehend mit gleichzeitig hohen Erwartungen<br />
an sich selbst, spielen ebenso eine Rolle bei der Krankheitsentstehung. Da<br />
Depressionen gut zu therapieren sind, ist es wichtig, sie frühzeitig zu erkennen<br />
(vgl.http://www.duesseldorf.de/gesundheit/bericht/...,Stand 09.05.09). Die Prävalenz<br />
einer Depression im Alter wird mit 15% – 25% angegeben. (http://www.<br />
psychiatriegespraech.de/psychische_krankheiten, Stand 22.10.09)<br />
3.3.3 Anmerkungen zur praktischen Umsetzung<br />
Für unser Sozial- und Gesundheitssystem stellt die Versorgung von Menschen mit<br />
gerontopsychiatrischer Erkrankung eine große Herausforderung dar. Auch gegen-<br />
wärtig sind die Altenhilfestrukturen nur unzulänglich hierauf vorbereitet. Daher wird<br />
diese Zielgruppe nicht hinreichend vom bestehenden (Alten-) Hilfenetz aufgefangen<br />
(vgl. Weber & Oppl 1997, S.3ff). Die Anwendung von Case Management in diesem<br />
Bereich soll dem Umstand gerecht werden, dass psychisch erkrankte ältere<br />
Menschen und deren Angehörige eine abgestufte Versorgung brauchen, die in einem<br />
fragmentierten (ambulanten) Hilfesystem geleistet werden muss. In Hirsch et al.<br />
(1999, S. 307ff zit. nach Kuhlmann 2005, S83f) ist eine Übersicht zu Modellprojekten<br />
in der ambulanten und teilstationären gerontopsychiatrischen Versorgung enthalten,<br />
die u.a. die Verwendung von Case Management berücksichtigt. Laut Kuhlmann<br />
unterscheiden sich die Projekte im wesentlichen in drei Aspekten:<br />
„-Projekte, in denen Tätigkeiten ausgeführt werden, die dem Ansatz des Case<br />
Managements zugeordnet werden können, aber den Begriff ‚Case Management’<br />
nicht verwenden.<br />
-Projekte, in denen einzelne Case Management-Elemente isoliert verwendet und<br />
dennoch unter dem Begriff Case Management zusammengefasst werden (z.B.<br />
isolierte Verwendung von: Hilfe bei der Organisation entlastender Hilfen<br />
(Implementation); Fallabsprachen und Überleitung zwischen Versorgungsformen;<br />
40
Überleitung von der stationären Akutbehandlung in die häusliche Umgebung und<br />
Einleitung ambulanter Interventionen; Hilfestellung bei der individuellen<br />
Pflegeplanung).<br />
-Projekte, in denen mehrere Case Management-Elemente verwendet werden,<br />
wobei die (Pflege-) Planung und Dokumentation, Vermittlung und Koordination der<br />
Hilfen, also die Phasen der Planung und Implementation überwiegen. Die Verlaufs -<br />
und Zielkontrolle erfolgen eher selten (Monitoring, Evaluation)“ (2005, S83f).<br />
Zusammenfassend betrachtet entspricht die Anwendung von Case Management in<br />
der Gerontopsychiatrie dem Stand der Umsetzung in der Altenhilfe, wie in Punkt 3.1<br />
ausgeführt. In der gegenwärtigen praktischen Umsetzung in Deutschland gibt es<br />
mehrere Modellprojekte, die folgende Merkmale aufweisen:<br />
• Durchführung im ambulanten Bereich<br />
• Eindeutige Verwendung von Case Management<br />
• Demenzkranke Menschen und pflegende Angehörige als Zielgruppe (vgl.<br />
Kuhlmann 2005, S.85).<br />
Als Beispiele sind zu nennen: Das Modellprojekt „Gerontopsychiatrisches<br />
Verbundnetz“ in der Altenhilfe Würzburg, Fachberatungsstellen für demenzkranke<br />
Menschen, die Case Management in das Beratungskonzept aufgenommen haben<br />
(DRK-Alzheimerhilfe Bochum, Alzheimergesellschaft Bochum, <strong>Angehörigenberatung</strong><br />
e.V. Nürnberg).<br />
4. Das Modellprojekt „Ambulantes gerontopsychiatrisches Fallmanagement<br />
(AGFM)“ der <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Fachkoordination (GeFa) Mfr.<br />
In den vergangenen vier Jahren wurde in Mittelfranken eine umfassende Bestands-<br />
aufnahme Gerontopsychiatrie von der GeFa Mittelfranken vorgenommen. Parallel<br />
hierzu und zum Teil auch dadurch initiiert hat sich die Versorgungslandschaft in<br />
diesem Bereich verändert. Unter dem Dach der Psychosozialen Arbeitsgemein-<br />
schaften entstanden in nahezu allen Regionen sogenannte „Arbeitskreise Geronto-<br />
psychiatrie“. Diese widmen sich in unterschiedlicher zeitlicher Intensität ver-<br />
schiedenen Aufgaben. Dazu zählen neben Information der Öffentlichkeit zu diversen<br />
Krankheitsbildern auch die Herstellung von Transparenz über bestehende geronto-<br />
psychiatrische Angebote. Wegweiser und Broschüren werden erstellt und eine frei<br />
zugängliche Datenquelle über das Internet zu gerontopsychiatrischen Angeboten im<br />
41
Bezirk Mittelfranken ist im Entstehen (vgl. GeFa 2006, S.5f). Die Anzahl der<br />
gerontopsychiatrischen Erkrankten, die durch ambulante Pflegedienste versorgt<br />
wurden, lag laut der Bestandsaufnahme etwa bei einem Drittel der insgesamt<br />
Versorgten. Nach Aussagen von Pflegedienstleitungen steigt deren Anzahl dra-<br />
matisch an. Diagnosen liegen in vielen Fällen jedoch nicht vor. Dies schuf u.a. den<br />
Anlass für die <strong>Angehörigenberatung</strong> Nürnberg e.V., eine Schulung für ambulante<br />
Pflegedienstmitarbeiter im gerontopsychiatrischen Bereich durchzuführen (siehe<br />
Punkt 4.2.2). Diese wurde positiv von den Geschulten aufgenommen. Dadurch<br />
entstand auch die Idee für das Modellprojekt „Ambulantes gerontopsychiatrisches<br />
Fallmanagement (AGFM)“ (vgl. ebd. S.6f). Ambulante Pflegedienste als Projekt-<br />
partner zu wählen (anstelle der Implementierung eines eigenständigen ambulanten<br />
gerontopsychiatrischen Case-Management-Dienstes), schien aus mehreren Gründen<br />
von Vorteil zu sein. Zum einen kann durch die Nutzung ambulanter Pflegedienste<br />
das Angebot flächendeckend und ohne lange Fahrtzeiten umgesetzt werden und es<br />
kann zugehend gearbeitet werden, da bereits adäquate Arbeitsstrukturen vorhanden<br />
sind. Andererseits zeigt die ältere Generation, vor allem in der ländlichen Region,<br />
gegenüber psychiatrischen Leistungsanbietern immer noch starke Berührungs-<br />
ängste. Dabei spielt die Angst vor Stigmatisierung eine wesentliche Rolle. Ambulante<br />
Pflegedienste hingegen erfahren in der Bevölkerung eine große Akzeptanz. Somit<br />
besitzt das Angebot mit ambulanten Pflegediensten einen eindeutig niedrig-<br />
schwelligen Charakter. Des Weiteren liegt ein Vorteil darin, dass eventuell schon im<br />
Vorfeld Kontakte zu einem ambulanten Pflegedienst wegen Inanspruchnahme<br />
pflegerischer Leistungen im Rahmen der Pflegeversicherung besteht. Somit ist auch<br />
nicht die Einbindung eines zusätzlichen Dienstes notwendig, wodurch die<br />
Bezugspersonen minimiert werden können. Dieser Umstand ist für die Arbeit mit<br />
gerontopsychiatrisch Erkrankten auch als förderlich zu betrachten (vgl. GeFa 2006,<br />
S.10f).<br />
Bevor nun in diesem Kapitel die Darstellung des Projektes erfolgt und Ergebnisse<br />
hieraus, die konkrete Fallbearbeitung, sowie Hürden und Effekte des Fall-<br />
managements näher erläutert werden, soll zunächst die Stelle Geronto-<br />
psychiatrische Fachkoordination (GeFa) Mittelfranken (angesiedelt bei der Ange-<br />
hörigenberatung e.V. Nürnberg) als Initiator des Projektes vorgestellt und auf die<br />
Ausgangssituation für das Projekt näher eingegangen werden.<br />
42
4.1 Vorstellung der Koordinierungsstelle Gerontopsychiatrische Fach-<br />
koordination (GeFa) Mfr.<br />
Seit dem 02. August 2000 existiert die Einrichtung Gerontopsychiatrische Fach-<br />
koordination (GeFa) für Mittelfranken. Träger ist die <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V.<br />
Nürnberg, die zusammen mit der GeFa den Sitz ihrer Büroräume in der Adam-Klein-<br />
Str. 6, 90429 Nürnberg, hat. Finanziell gefördert wird die Fachkoordination vom<br />
Bezirk Mittelfranken (vgl. GeFa 2004, S.2). Geschaffen wurde diese Stelle im Zuge<br />
des Rahmenkonzepts des Verbands der Bayerischen Bezirke zur Verbesserung der<br />
gerontopsychiatrischen Versorgungsstruktur. In diesem Konzept wurde für jede<br />
Region in Bayern eine gerontopsychiatrische Koordination gefordert. Neben der<br />
<strong>Angehörigenberatung</strong> Nürnberg e.V. bewarben sich drei weitere Einrichtungen um<br />
diese Stelle beim Bezirk. Schließlich wurde dieses bundesweite innovative Angebot<br />
bei der <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V. angesiedelt. Dies hat zwei sachlich fundierte<br />
Gründe: Zum einen zeichnet sich die <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V. durch eine<br />
Beratungsstruktur aus, die neutral und unabhängig ist von Trägerinteressen, da die<br />
Beratungsstelle selbst keine Versorgungsleistungen anbietet. Zum anderen wurde in<br />
dem langjährigen Bestehen der Beratungsstelle fundiertes und hochspezifisches<br />
Fachwissen bezüglich des Themas Gerontopsychiatrie gesammelt und entwickelt.<br />
In ihren fachlichen Grundsätzen stimmt die GeFa mit Erkenntnissen der geronto-<br />
logischen Forschung überein. Diese lauten in ihren Überschriften:<br />
a) Alter ist nicht mit Kompetenzverlust gleichzusetzen.<br />
b) Therapie bzw. Rehabilitation zeigen auch im hohen Alter Erfolg.<br />
c) Entwicklung ist möglich bis ins hohe Alter.<br />
Die GeFa Mittelfranken sieht sich in einer anwaltschaftlichen Funktion für ältere<br />
Menschen mit psychiatrischen Symptomen. Grundsätzliches Ziel der Fachkoordi-<br />
nation ist die Integration gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen. Daher strebt sie<br />
zum einen die Ausweitung des Angebots an gerontopsychiatrischen Dienst-<br />
leistungssystemen (quantitativer Aspekt) in Regionen an, die eine Unterversorgung<br />
aufweisen. Zum anderen unterstützt sie aktuell bestehende Angebote im Hinblick auf<br />
eine verbesserte Zusammenarbeit sowie der Weiterentwicklung im inhaltlich-<br />
konzeptionellen Bereich (qualitativer Aspekt). Zielgruppe der GeFa sind demenziell,<br />
depressiv und schizophren erkrankte ältere Menschen sowie Suchtkranke im Alter.<br />
Voraussetzung für die Zuständigkeit ist, dass sie im Bezirk Mittelfranken leben (vgl.<br />
GeFa 2004, S.2f).<br />
43
Das Aufgabenprofil der GeFa ergibt sich aus dem Unterstützungsbedarf geronto-<br />
psychiatrisch erkrankter Menschen. Dazu gehören folgende Aufgaben:<br />
• Bestandsaufnahme: Erfassung von vorhandenen Versorgungsbausteinen in<br />
Mittelfranken<br />
• Koordination: Förderung der Kooperation von Versorgungsanbietern<br />
• Case Management: Organisation einer fallbezogenen Zusammenarbeit unter-<br />
schiedlicher Leistungserbringer<br />
• Fachberatung: Beratung für Einrichtungen der Gesundheits- und Altenhilfe über<br />
innovative Konzepte der Gerontopsychiatrie<br />
• Bedarfsermittlung (wo bestehen z.B. Versorgungsdefizite?)<br />
• Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Informationsmaterialien zur GeFa-Arbeit, Gremien-<br />
arbeit)<br />
• Fortbildung (Organisation von Fortbildung für Berufsgruppen wie Klinikpersonal<br />
und Mitarbeiter in der Altenhilfe<br />
• Tätigkeitsberichte (einmal pro Jahr, Information für den Bezirk)<br />
Die GeFa Mittelfranken umfasst eine Vollzeitstelle mit 38,5 Wochenstunden. Derzeit<br />
teilen sich diese Stelle zwei Diplom-Sozialpädagoginnen mit gerontologischer<br />
Zusatzausbildung. Die Fachkoordination arbeitet eng zusammen mit der Ange-<br />
hörigenberatung e.V. Es finden regelmäßige Teamsitzungen mit der Angehörigen-<br />
beratung statt. Hier kommt es zum gegenseitigen Austausch von Informationen und<br />
einer Berichterstattung gegenüber dem Geschäftsführer (vgl. GeFa 2004, S.5f).<br />
4.2 Ausgangssituation für das Modellprojekt<br />
Die Häufigkeit gerontopsychiatrischer Erkrankungen in Mittelfranken und die positive<br />
Bewertung der Fortbildung „Qualifizierungskonzept Mittelfranken“ gaben für die<br />
Gerontopsychiatrische Fachkoordination den Anlass, das Modellprojekt „Geronto-<br />
psychiatrisches Fallmanagement (AGFM)“ zu konzipieren.<br />
a) Häufigkeit von Demenzerkrankungen und Depressionen in Mittelfranken<br />
In Mittelfranken leben zur Zeit etwa 1,7 Mio. Menschen, von denen 314.384<br />
Menschen ab 65 Jahre und älter sind (Bayerisches Landesamt für Statistik und<br />
Datenverarbeitung, Stand 24.02.2006, zit. nach GeFa 2009, S.5). Laut dem<br />
Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (zit. nach GeFa<br />
44
2009, S.5) liegt die Zahl der Demenzerkrankten in Mittelfranken bei 21.848 Demenz-<br />
erkrankten. Geht man von einer Prävalenz von zehn Prozent für Altersdepressionen<br />
aus (siehe Punkt 3.3.2), läge die Anzahl in Mittelfranken bei 31.438 Betroffenen. Laut<br />
der von der GeFa durchgeführten „Bestandsaufnahme zur gerontopsychiatrischen<br />
Versorgungsstruktur im Bezirk Mittelfranken“ lag die Anzahl der ermittelten geronto-<br />
psychiatrisch Erkrankten, die von ambulanten Pflegediensten versorgt wurden, ca.<br />
bei einem Drittel der insgesamt erfassten Versorgten. Aussagen von Pflege-<br />
dienstleitungen zufolge ist deren Anteil in der Zwischenzeit drastisch angestiegen.<br />
Nach deren Einschätzungen würden jedoch häufig keine Diagnosen vorliegen (vgl.<br />
GeFa 2009, S.5).<br />
b) Das Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie (GQ)<br />
Seit Ende November 2002 führte die <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V. Nürnberg die<br />
Schulung „Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie“ durch. Daran nahmen Mit-<br />
arbeiter von rund 130 ambulanten Pflegediensten aus der Region Mittelfranken teil.<br />
Das Qualifizierungskonzept bietet eine Basisqualifikation im Umfang von 32 Fort-<br />
bildungseinheiten im ersten Teil an. In einem zweiten Teil findet eine Schulung zur<br />
Entwicklung von Handlungskompetenz zum Umgang mit Demenzpatienten im Um-<br />
fang von 16 Fortbildungseinheiten statt. Dieses Fortbildungsangebot, das vom Bezirk<br />
Mittelfranken finanziert wird und für die Pflegedienste kostenlos ist, stieß bei den<br />
Teilnehmern auf große Resonanz (vgl. GeFa 2009, S.6). Die Auswertung von<br />
Fragebögen zur Evaluation des Fortbildungsangebotes im Jahr 2005 (TN= 27,6%<br />
von insgesamt ca. 600 Mitarbeitern plus zusätzlich 37 Fragebögen der Pflege-<br />
dienstleitungen, die für 46 Dienste in 16 Orten Mittelfrankens zuständig waren) kam<br />
zu dem Ergebnis, dass sich durch die Fortbildung bei 80% der Mitarbeiter das<br />
Verständnis für gerontopsychiatrische Erkrankungen wesentlich erhöht hatte. Zwei<br />
Drittel der Befragten gab an, dass die Vermittlung an weiterführenden Hilfen für<br />
Betroffene und Angehörige angestiegen sei. Außerdem gaben 61% an, dass dem<br />
Arbeitsbereich Gerontopsychiatrie ein höherer Stellenwert innerhalb der eigenen<br />
Organisation zukommt. Laut Befragung erschien der Mehrzahl der Pflegedienst-<br />
leitungen (51,7%) die Übernahme eines gerontopsychiatrischen Fallmanagements<br />
vorstellbar (vgl. GeFa 2009, S.6).<br />
45
4.3 Die Darstellung des Projektes AGFM<br />
Das Projekt startete mit einer Einführungsveranstaltung für die Fallmanagerinnen im<br />
April 2006. Im Anschluss daran konnten im Mai 2006 die ersten Fälle angenommen<br />
werden. Für die „Bearbeitung“ eines Falles waren maximal sechs Monate ver-<br />
anschlagt. Da das Projekt im Dezember 2008 abgeschlossen sein sollte, konnten<br />
Fälle bis Ende Juni 2008 angenommen werden. Somit standen für die Fallaufnahme<br />
insgesamt 25 Monate während des Projektlaufs zur Verfügung. Der Abschluss des<br />
Projektes konnte zum geplanten Zeitpunkt erfolgen (vgl. GeFa 2009, S.6). Die Dar-<br />
stellung des Projektes umfasst im Folgenden die Beschreibung der Zielgruppe von<br />
AGFM und Ziele/ Aufgaben der Projektpartner. Eingegangen wird weiterhin an dieser<br />
Stelle auf die Teilnahmevoraussetzungen für die Fallmanagerinnen, auf Koopera-<br />
tionspartner und die regionale Verteilung im Fallmanagement. Außerdem gehört zur<br />
Darstellung des Projektes das verwendete Dokumentationsmaterial, die Schulungen<br />
der Fallmanagerinnen, die Finanzierung und die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von<br />
AGFM.<br />
a) Zielgruppe und Ziele/ Aufgaben der Projektpartner<br />
Zur Zielgruppe des Projektes zählten demenzerkrankte und depressiv erkrankte<br />
ältere Menschen ab ca. 65 Jahren, deren Lebensumstände beratende, koordi-<br />
nierende und lösungsorientierte Hilfe erfordern, unabhängig davon, ob sie allein oder<br />
mit Angehörigen zusammenlebten (vgl. ebd.). Voraussetzung für die Teilnahme war<br />
eine Diagnosestellung in Form einer Syndrombeschreibung seitens des Hausarztes<br />
oder einer anderen Einrichtung. Eine Differentialdiagnose musste nicht vorliegen.<br />
Ausreichend war in gewissen Fällen auch der Verdacht auf Demenz, wenn z.B. eine<br />
depressive Symptomatik im Vordergrund stand. Die Bereitschaft, sich einer um-<br />
fassenden diagnostischen Untersuchung zu unterziehen, konnte eben erst nach<br />
einer intensiven Hilfestellung erreicht werden. Ausgeschlossen vom Fallmanagement<br />
waren Menschen, deren Erkrankung bereits so weit fortgeschritten war, dass die<br />
Pflege im Mittelpunkt der Versorgung stand (vgl. GeFa 2006, S.11).<br />
Ziel des Projektes war es, durch ein wenn möglich frühzeitiges, koordiniertes Fall-<br />
management für die o.g. Zielgruppe und deren Angehörige einen Beitrag zur Ver-<br />
meidung von Krisensituationen zu leisten, die zu einer verfrühten bzw. unnötigen<br />
Einweisung in eine stationäre Einrichtung der Alten- und Gesundheitshilfe geführt<br />
hätten. Mit dem Angebot eines Fallmanagements (Unterstützung, Begleitung, Ent-<br />
46
lastung) sollten die kranken Menschen und ihre Angehörigen in der Stabilisierung<br />
ihrer Lebenssituation unterstützt werden und der Verbleib im eigenen zu Hause<br />
erhalten oder zumindest verlängert werden. Daraus leitet sich ein nicht zu ver-<br />
nachlässigender Begleitaspekt aus der Perspektive der Kostenträger ab: Durch die<br />
Vermeidung von stationärer Dauerversorgung, hervorgerufen durch evtl. nicht not-<br />
wendige oder verfrühte Einweisung in stationäre Pflegeeinrichtungen, ist eine<br />
Kostendämpfung von Sozialleistungen, Behandlungskosten und Pflegekosten<br />
möglich. (vgl. GeFa 2009, S.7). Um die genannten Ziele zu gewährleisten, mussten<br />
die Projektpartner auch schon im Vorfeld bestimmte Aufgaben übernehmen.<br />
Hauptaufgaben der GeFa waren die Planung, Entwicklung und Koordination des ge-<br />
samten Projektes sowie das Coaching der teilnehmenden ambulanten Pflegedienste.<br />
Daraus ergaben sich mehrere Teilaufgaben:<br />
• Erarbeitung einer Modellskizze sowie von Förderanträgen<br />
• Anfertigung einer ausführlichen Projektbeschreibung<br />
• Entwicklung des Instrumentariums (Dokumentationssystem) für die ambulanten<br />
Pflegedienste<br />
• Auswahl, Information und Vernetzung aller Beteiligten<br />
• Verhandlungen mit Kostenträgern<br />
• Coaching für die ambulanten Pflegedienste in Form von Schulungen und Fall-<br />
konferenzen<br />
• Einbindung von Ärzten zur Durchführung der Fallkonferenzen<br />
• Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Dokumentation und Auswertung.<br />
Die Mitarbeiterinnen bzw. Fallmanagerinnen der ambulanten Pflegedienste waren<br />
zuständig für die aufsuchende Beratung, die Erstellung eines individuellen Hilfe-<br />
planes und dessen Umsetzung. Dies beinhaltete folgende Teilaufgaben:<br />
• Herstellung des Erstkontaktes und Aufbau eines Vertrauensverhältnisses<br />
• Kontraktvereinbarung zur Übernahme des Fallmanagements<br />
• Erschließung von Hilfen (z.B. aus Familie und Nachbarschaft)<br />
• Arztvermittlungen<br />
• Vermittlung von niedrigschwelligen Angeboten (z.B. Helferinnenkreis oder<br />
Gruppenangebote für Angehörige)<br />
• Unterstützung bei Antragstellungen sowie anderen Formalitäten<br />
47
• Vermittlung von Wohnberatung<br />
• Vermittlung von Krisenintervention und Verweisung an <strong>Angehörigenberatung</strong>s-<br />
stellen (vgl. GeFa 2006, S.9f).<br />
b) Teilnahmevoraussetzung der Fallmanagerinnen<br />
Als Voraussetzung für die Beteiligung am Projekt mussten die Fallmanagerinnen im<br />
Vorfeld mindestens am „Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie“ Teil 1 teilge-<br />
nommen haben und möglichst zeitnah an Teil 2 (siehe Punkt 4.2). Eine höherwertige<br />
Fort-/ Aus- oder Weiterbildung war nicht verbindlich. Dies ist damit zu erklären, dass<br />
ein Kontakt zu den ambulanten Pflegediensten erst über das Angebot des<br />
„Qualifizierungskonzepts Gerontopsychiatrie“ zustande kam und nicht davon ausge-<br />
gangen werden konnte, dass in Mittelfranken flächendeckend gerontopsychiatrische<br />
Fachkräfte in ambulanten Pflegediensten zur Verfügung stehen. Darüber hinaus war<br />
eine weitere Voraussetzung, dass die teilnehmenden Pflegedienste eine Verein-<br />
barung mit folgenden Punkten unterzeichneten (vgl. GeFa 2009, S.8). Damit<br />
erklärten sie sich bereit<br />
- „zur Einhaltung völliger Neutralität bei der Durchführung des ambulanten<br />
Fallmanagements,<br />
- zur träger- und personenneutralen Vermittlung der notwendigen Hilfen und<br />
Unterstützungsmaßnahmen,<br />
- zur Beachtung des Vorranges der Wünsche und Erfordernisse von Seiten der<br />
Betroffenen bei der Vermittlung und Zuschaltung weitergehender Maßnahmen<br />
und<br />
- zur Kooperation mit allen notwendigen weiteren informellen und professionellen<br />
Unterstützern“ (GeFa 2009, S.8).<br />
Die durchzuführenden Maßnahmen sollten auf der Basis der Biografiekenntnis<br />
erfolgen. Größtmögliche Reaktivierung und Motivierung sowie die Stärkung des<br />
Selbstwertgefühls der kranken Senioren und deren Angehörigen waren seitens der<br />
Fallmanagerinnen anzustreben (vgl. ebd. S. 8).<br />
c) Kooperationspartner und regionale Verteilung<br />
Es konnten nach persönlichen Gesprächen vor Ort mit vorab interessierten Ge-<br />
schäftsführern und Pflegedienstleitungen 12 Diakoniestationen, eine Caritasstation<br />
48
und eine offene Behindertenarbeit (OBA) mit insgesamt 40 namentlich genannten<br />
Fallmanagerinnen für die Beteiligung am Projekt gewonnen werden (vgl. ebd. S.9).<br />
Die Einrichtungen, die an AGFM teilnahmen verteilten sich auf folgende Regionen:<br />
• Stadt Nürnberg 2 Einrichtungen<br />
• Landkreis Nürnberger Land 1 Einrichtung<br />
• Landkreis Fürth<br />
(mit einer Außenstelle) 1 Einrichtung<br />
• Stadt Erlangen<br />
(Sozialstation mit vier Dienststellen) 1 Einrichtung<br />
• Stadt und Landkreis Ansbach<br />
(mit zwei Fachstellen Beratung für pflegende Angehörige) 4 Einrichtungen<br />
• Landkreis Roth/Stadt Schwabach 2 Einrichtungen<br />
• Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen<br />
(mit je einer Fachstelle Beratung pflegende Angehörige<br />
und einer Außenstelle) 2 Einrichtungen<br />
• Neustadt/A. / Bad Windsheim<br />
(mit einer Fachstelle Beratung für pflegende Angehörige) 1 Einrichtung<br />
(vgl. GeFa 2009,S.8).<br />
d) Das Dokumentationsmaterial<br />
Eine Mitarbeiterin der <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Fachkoordination (GeFa) Mittelfranken<br />
konzipierte das Dokumentationssystem, um eine standardisierte Dokumentation der<br />
bearbeiteten Fälle im Rahmen des Fallmanagements zu ermöglichen. Basis hierfür<br />
waren umfangreiche Internet- und Literaturrecherchen zum Thema Case Manage-<br />
ment. Des Weiteren wurde auf verwendete Unterlagen im Bezirk Mittelfranken zum<br />
Gesamtplanverfahren nach §58 SGBXII zurückgegriffen. Auch persönliche Beratung<br />
durch die Geschäftsführung von Halma e.V. in Würzburg - eine Einrichtung, die<br />
ebenso Case Management durchführt - wurde in Anspruch genommen. Außerdem<br />
fand Rücksprache mit den beteiligten Pflegedienstleitungen zur Praktikabilität statt<br />
(vgl. GeFa 2009, S.9).<br />
Die Fallmanagerinnen erhielten das umfassende Dokumentationsmaterial zum einen<br />
in Papierform und zum anderen auf CD-ROM. Somit konnten alle Unterlagen von<br />
49
den Fallmanagerinnen per Hand oder PC bearbeitet werden. Eine Weiterleitung der<br />
bearbeiteten Fälle an die GeFa erfolgte per Post, per Fax oder per E-Mail (vgl. ebd.).<br />
Zur Einsicht befinden sich die im folgenden kurz dargestellten Unterlagen im Anhang.<br />
• Anforderungsprofil der Fallmanagerinnen<br />
Ein Anforderungsprofil mit 15 Items sollte den Fallmanagerinnen zur Kontrolle und<br />
Selbsteinschätzung dienen, ob sie das Anforderungsprofil der Fallmanagerin<br />
fachlich und persönlich erfüllen können.<br />
• Neutralitätserklärung<br />
Die kooperierenden ambulanten Pflegedienste mussten eine Neutralitätserklärung<br />
unterzeichnen. Dies war verbindlich vorgeschrieben. Bei der konkreten Fall-<br />
bearbeitung sollte das Angebot von Trägern vor Ort berücksichtigt werden. Außer-<br />
dem waren die Wünsche von Erkrankten und Angehörigen die Basis für die<br />
Koordination weiterführender Hilfsangebote.<br />
• Datenschutzerklärung der GeFa<br />
Die GeFa Mittelfranken verfasste eine Datenschutzerklärung, die den beteiligten<br />
Pflegediensten für die Erkrankten und Angehörigen als Vorlage zur Verfügung<br />
standen.<br />
• Rückfax Fallmeldung<br />
Bevor die Fallmanagerinnen begannen, einen Fall zu bearbeiten, wurde voraus-<br />
gesetzt, dass sie zu jedem Fall ein Fax mit Rahmendaten an die GeFa mit der Bitte<br />
um Bestätigung übermittelten. Durch diese verbindliche Anmeldung sollte gewähr-<br />
leistet werden, dass keine Überschreitung des Budgets erfolgte und die GeFa<br />
Rücksprachemöglichkeit hatte.<br />
• Schweigepflichtentbindung und Schweigepflichterklärung<br />
Die Unterschrift der Erkrankten oder ihrer Angehörigen unter die Schweigepflicht-<br />
entbindung war eine wichtige Zugangsvoraussetzung, da andernfalls eine Fall-<br />
bearbeitung nicht möglich war. Im Gegenzug verpflichtete sich der Pflegedienst<br />
durch Unterzeichnung, erforderliche Kontakte, die zu anderen Dienstleistern im<br />
Zuge der Fallbearbeitung aufgenommen wurden, offen zu legen. (vgl. ebd. S.10).<br />
50
• Dokumentationsbogen<br />
Im Dokumentationsbogen waren von den Fallmanagerinnen Angaben zur Person,<br />
psychiatrische und somatische Diagnose, Medikation, Verhaltensauffälligkeiten,<br />
Kontaktverhalten, Mobilität, Hilfsmittel, verordnete Therapien sowie ambulante, teil-<br />
stationäre und (klinisch) stationäre Unterstützungsmaßnahmen des Erkrankten zu<br />
erfassen.<br />
• Bedarfsermittlung<br />
Hier war für die Bereiche ärztliche Versorgung, Haushalt, Ernährung, Wohnung,<br />
soziale Kontakte, Tagesgestaltung, Mobilität und Aktivierung sowie Finanzen und<br />
Post der Hilfebedarf zu ermitteln und in Zusammenarbeit mit den Angehörigen und/<br />
oder den Betroffenen zu klären, welche Unterstützungsmaßnahmen und -<br />
leistungen durch welche Personen oder Dienstleister erbracht werden könnten.<br />
• Zeittabelle<br />
In der Zeittabelle wurde die Fahrtzeit der Fallmanagerinnen mit Kilometerangabe<br />
erfasst. Weiterhin schriftlich festgehalten wurde stichpunktartig der Inhalt der<br />
Gespräche bei den drei veranschlagten Hausbesuchen, die Angaben zur Anzahl<br />
der fallbezogenen Telefonkontakte und durch wen die Kontaktaufnahme vor-<br />
genommen wurde (vgl. ebd.).<br />
• Abschlussbericht<br />
In einem Abschlussbericht wurde Anfang und Ende des Fallmanagements, die<br />
durchgeführten Testverfahren und -ergebnisse, Pflegeeinstufung bei Beginn und<br />
Ende der Fallbearbeitung, die vermittelten Institutionen, verordnete Therapie-<br />
maßnahmen und weitere Unterstützungsleistungen sowie der Grund für die Be-<br />
endigung des Fallmanagements dokumentiert. Es konnte hier auch eine Eigen-<br />
beurteilung der Effekte des Fallmanagements seitens der Fallmanagerin und durch<br />
Klienten und Angehörige vermerkt werden.<br />
• Zahlungsanweisungsformular<br />
Die Fallmanagerinnen bzw. der kooperierende ambulante Pflegedienst erhielten<br />
nach Abschluss eines Falles eine pauschale Aufwandsentschädigung. Es war hier-<br />
51
für eine Anweisung zum Nachweis für die Buchhaltung erforderlich (vgl. GeFa<br />
2009, S. 11).<br />
e) Schulungen der Fallmanagerinnen<br />
Im Rahmen des Projekts war im Kooperationsvertrag mit den teilnehmenden Pflege-<br />
diensten festgelegt, dass begleitend für die Fallmanagerinnen halbjährliche<br />
Schulungen abgehalten werden. Ehe das Projekt startete, wurde eine Einführungs-<br />
veranstaltung durchgeführt. Ebenso gab es nach Beendigung des Projektes eine<br />
Abschlussveranstaltung. Die für das Projekt zuständige Mitarbeiterin der GeFa<br />
organisierte, moderierte und begleitete inhaltlich die Schulungen. Unterstützend hier-<br />
zu erhielten die Fallmanagerinnen umfangreiche Skripten und Protokolle. Von<br />
insgesamt 40 gemeldeten Fallmanagerinnen bearbeiteten 19 davon einen oder<br />
mehrere Fälle. Von diesen nahmen wiederum jeweils zwischen 15 und 17 Fall-<br />
managerinnen an den halbjährlichen Schulungen teil (vgl. GeFa 2009,S.11f).<br />
In einem Umfang von vier Fortbildungseinheiten wurden die künftigen Fall-<br />
managerinnen bei der Einführungsveranstaltung anhand eines exemplarischen Fall-<br />
beispiels an die Vorgehensweise im Fallmanagement herangeführt. Grundkenntnisse<br />
zum Case Management nach W.R. Wendt konnten bereits im Rahmen des<br />
„Qualifizierungskonzepts Gerontopsychiatrie“ gewonnen werden. Während der<br />
Einführungsveranstaltung wurden die Teilnehmerinnen vom Leiter der Gedächtnis-<br />
sprechstunde des Klinikums Nürnberg Nord zum Mini-Mental-Status-Test (MMST<br />
nach Folstein), zum Dem Tect (nach J. Kessler und P. Calabrese) sowie zur<br />
Geriatrischen Depressionsskala (GDS nach Yesavage) geschult. Dadurch erhielten<br />
die Fallmanagerinnen die Berechtigung, die Testverfahren selbständig durchzuführen<br />
(vgl. GeFa 2009, S.12). Ebenso erhielten die Fallmanagerinnen die Dokumentations-<br />
materialien (Punkt 4.3.4), die bei der Einführung ausführlich besprochen wurden. An<br />
der Einführungsveranstaltung nahmen 34 Fallmanagerinnen von 15 ambulanten<br />
Pflegediensten teil. Ein Pflegedienst entschied sich nach der Einführungsver-<br />
anstaltung gegen die Teilnahme am Projekt (vgl. ebd. S.12).<br />
Folgende Inhalte wurden in regelmäßigen Schulungen im Umfang zu je vier Fort-<br />
bildungseinheiten vermittelt:<br />
• Krankheitsbilder von Depression und Demenz<br />
• Das Konzept Case Management nach Wendt<br />
• Exemplarische Falldarstellung<br />
52
• Coaching zur Fallbearbeitung<br />
• kollegialer Austausch zur konkreten Durchführung des Fallmanagements<br />
• Schulung zur Wohnberatung und Wohnanpassung für Pflegekräfte (bezogen<br />
auf das Krankheitsbild Demenz)(vgl. ebd.).<br />
Die Referenten für die Schulungen kamen aus unterschiedlichen Bereichen. Zum<br />
Einsatz kamen:<br />
• ein Arzt des Klinikums Nürnberg Nord<br />
• eine Ärztin für Gerontopsychiatrie aus dem Bezirksklinikum Ansbach<br />
• ein Supervisor der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSV)<br />
• eine Mitarbeiterin der „Fachstelle Wohnberatung in Bayern“<br />
• der Geschäftsführer der <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V. Nürnberg<br />
• Mitarbeiterinnen der <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Fachkoordination Mittelfranken<br />
Verwendet wurden zur Vermittlung und Veranschaulichung von Inhalten Folien,<br />
Power-Point-Präsentationen, Video-Vorführungen und Moderationstechniken aus der<br />
Erwachsenenbildung.<br />
Außerdem gab es für die Fallmanagerinnen im Rahmen von AGFM eine Abschluss-<br />
schulung. Diese Veranstaltung diente der Besprechung ausgewählter Ergebnisse<br />
des Projektes und der Diskussion über die Frage nach einer potentiellen Fortführung<br />
des Projektes oder der Weiterentwicklung von Angeboten der ambulanten Pflege-<br />
dienste. Für Inhalte und Moderation waren die Mitarbeiterinnen der GeFa und der<br />
Geschäftsführer der <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V. Nürnberg zuständig. In diesem<br />
Rahmen erhielten die Fallmanagerinnen eine Bestätigung über die Teilnahme an<br />
dem Projekt ausgehändigt (vgl. GeFa 2009, S.12f).<br />
f) Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Finanziert wurde das Projekt AGFM durch den Bezirk Mittelfranken über das Budget<br />
für die Fortbildung „Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie“. Zusätzliche Mittel<br />
standen dafür nicht zur Verfügung. Es fand eine Umwidmung der zur Verfügung<br />
gestellten Gelder statt, welche die <strong>Angehörigenberatung</strong> Nürnberg e.V. für das Fort-<br />
bildungsangebot erhielt. Die Fallmanagerinnen bzw. der ambulante Pflegedienst<br />
bekamen pro abgeschlossenen Fall eine pauschale Aufwandsentschädigung. Eine<br />
Durchführung des „Qualifizierungskonzepts Gerontopsychiatrie“ fand im Zeitraum<br />
des Projekts weiterhin statt (vgl. GeFa 2009, S.13).<br />
53
Um das Projekt AGFM der Öffentlichkeit nahe zu bringen, wurden verschiedene<br />
Maßnahmen und Medien eingesetzt:<br />
• Um den ambulanten Pflegediensten eine Werbung vor Ort zu ermöglichen,<br />
erhielten diese von der GeFa ein Faltblatt mit Rahmendaten zu AGFM.<br />
• Das neue Angebot wurde von einer Mitarbeiterin der GeFa Mittelfranken in<br />
verschiedenen Gremien (z.B. Arbeitskreis Gerontopsychiatrie, Pflegekonferen-<br />
zen, Verbrauchermesse sowie mittelfränkischer Geriatrietag) vorgestellt.<br />
• Die GeFa schickte an Ärzte vor Ort Briefe mit Anschreiben und Faltblättern.<br />
Damit wurde über das Projekt informiert und um Kooperation gebeten.<br />
• Im „Bezirks-Report“ fand ein Hinweis auf das Fallmanagement-Projekt statt.<br />
• Auf einer Pressekonferenz, bei welcher der Bezirkstagspräsident von Mittel-<br />
franken, eine GeFa-Mitarbeiterin und einige Fallmanagerinnen zugegen waren,<br />
wurde über das Projekt berichtet (vgl. ebd. S.13).<br />
4.4 Ergebnisse aus dem gerontopsychiatrischen Fallmanagement (AGFM)<br />
Nach Abschluss des Projektes im Dezember 2008 lagen der GeFa zur Auswertung<br />
Unterlagen von insgesamt 46 Fällen vor. Im Folgenden werden Ergebnisse aus der<br />
Auswertung dargestellt und zwar bezogen auf den Zugangsweg zum Fall-<br />
management, der regionalen Verteilung der Fälle, Alter und Geschlecht der Klienten,<br />
die auftretenden Krankheitsbilder und der dabei eingesetzten Testverfahren, die<br />
Lebenssituation der Betroffenen sowie auf die Problemstellungen, aus denen sich ein<br />
Hilfebedarf herauskristallisierte (vgl. GeFa 2009, S. 14 ff).<br />
4.4.1 Zugangsweg zum Fallmanagement/ Regionale Verteilung/ Alter und<br />
Geschlecht<br />
Den eingegangenen Fallunterlagen konnten die Zugangswege der Betroffenen zum<br />
Fallmanagement entnommen werden. Es ließen sich vier Kategorien erschließen:<br />
Der häufigste Zugang erfolgte mit 22 Nennungen über die GeFa/ Angehörigen-<br />
beratung e.V., Angehörige, Nachbarn, Bekannte oder Betreuer, was unter die Kate-<br />
gorie „Sonstige“ zusammengefasst wurde. An zweiter Stelle stand der Zugangsweg<br />
direkt über den Pflegedienst mit 21 Nennungen, d.h. dass die Fallmanagerinnen z.B.<br />
bei einem Pflege- oder Beratungsbesuch auf das Angebot hinwiesen. Bei diesen<br />
beiden Kategorien kamen Mehrfachnennungen zustande, da es sein konnte dass ein<br />
Angehöriger z.B. den Zugang über die GeFa hatte und der Pflegedienst gleichzeitig<br />
54
das erkrankte Familienmitglied auf AGFM hinwies. In fünf Fällen nahm der Klient<br />
selbst Kontakt zum Pflegedienst auf, um im Fallmanagement aufgenommen zu<br />
werden. Lediglich in einem Fall war ein Arzt für die Kontaktaufnahme verantwortlich<br />
(vgl. GeFa 2009, S.14).<br />
Grafik 1: Der Zugangsweg zum Fallmanagement (Quelle: Gefa 2009, S.14)<br />
Was die regionale Verteilung betrifft, kristallisierte sich heraus, dass die meisten<br />
dokumentierten Fälle im ländlichen Bereich bearbeitet wurden, was aus der nach-<br />
folgenden Grafik ersichtlich wird. An der Spitze steht hier die Region Landkreis<br />
Weißenburg-Gunzenhausen mit 41% aller bearbeiteten Fälle. In der Stadt Nürnberg<br />
gab es 21,7% Fälle, gefolgt von der Region Stadt und Landkreis Ansbach mit 19,6%.<br />
In der Region Landkreis Roth/ Stadt Schwabach und in der Region Landkreis<br />
Neustadt Aisch/ Bad Windsheim waren es jeweils 6,5% und in der Stadt Erlangen<br />
4,3% bearbeitete Fälle (vgl. GeFa 2009, S.15).<br />
Grafik 2: Anzahl der Fälle nach Regionen (Quelle GeFa 2009, S.15)<br />
55
Aus der nachstehenden Tabelle wird die Altersstruktur der Klienten (n = 46) im Fall-<br />
management-Projekt ersichtlich:<br />
Tabelle 2: Mindest- und Höchstalter für weibliches und männliches Geschlecht<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.15).<br />
Das Durchschnittsalter lag bei 78,4 Jahren. Von den weiblichen Klienten war die<br />
jüngste 56 Jahre und die älteste 93 Jahre alt. Bei den teilnehmenden Männern war<br />
der jüngste 67 Jahre und der älteste 91 Jahre alt.<br />
Tabelle 2 spiegelt die Geschlechterverteilung wider (n = 46):<br />
Tabelle 3: Anzahl nach Geschlechterverteilung (Quelle: GeFa 2009, S.16)<br />
Mehr als drei Viertel der Erkrankten war weiblichen und knapp ein Viertel war<br />
männlichen Geschlechts (vgl. ebd. S.16).<br />
4.4.2 Krankheitsbilder und eingesetzte Testverfahren<br />
Die Klienten des Fallmanagements litten unter psychiatrischen und somatischen<br />
Erkrankungen.<br />
Den Angaben der Fallmanagerinnen konnte entnommen werden, dass von den 46<br />
Fällen 30 Personen (rund zwei Drittel) von einer Demenz betroffen waren. Bei 11<br />
Fällen traten eine Demenz und eine Depression gleichzeitig auf und bei fünf Fällen<br />
lag eine Depression vor. Bei der Fallaufnahme eines Klienten war es den Fall-<br />
managerinnen möglich, eine Eigenbeurteilung abzugeben, welche in einem Rück-<br />
meldebogen angegeben werden sollte. Zur Spezifizierung konnten die Fall-<br />
managerinnen Testverfahren einsetzen (vgl. GeFa 2009, S.16).<br />
56
Grafik 3: Anzahl der Krankheitsbilder (Quelle: GeFa 2009, S. 16)<br />
Bei rund 59% der Klienten lag bei der Fallaufnahme bereits eine ärztliche Diagnose<br />
vor. Bei rund 41% der Teilnehmer handelte es sich um eine Eigenbeurteilung durch<br />
die Fallmanagerinnen (vgl. ebd.). Die Verteilung der Diagnosestellung durch Arzt<br />
oder Fallmanagerin wird in der nachstehenden Grafik veranschaulicht.<br />
Grafik 4: Diagnosestellung durch Arzt oder Fallmanagerin (Quelle: GeFa 2009, S.17)<br />
Des Weiteren waren die Teilnehmer auch somatisch erkrankt (vgl. GeFa 2009,<br />
S.18f). Art und Anzahl der Erkrankung ist in der folgenden Tabelle dargestellt.<br />
Tabelle 4: Anzahl somatischer Erkrankungen (Mehrfachnennungen möglich) (Quelle GeFa 2009,<br />
S.18)<br />
57
Zur Eigenbeurteilung von psychiatrischen Erkrankungen konnten die Fall-<br />
managerinnen Testverfahren anwenden, zu denen sie in ihrer Fortbildung geschult<br />
worden waren. Zum Einsatz kamen der Mini-Mental Status Test (MMST), der<br />
DemTect sowie die Geriatrische Depressionsskala (GDS). Die Fallmanagerinnen<br />
konnten insgesamt 27 mal eines oder mehrere der genannten Testverfahren<br />
einsetzen. In 12 Fällen musste die Testung abgebrochen werden, da die Situation für<br />
den Kranken zu belastend war oder die Aufmerksamkeitsspanne des Betroffenen zu<br />
kurz war (vgl. ebd. S.17). Im Anschluss werden die eingesetzten Testverfahren kurz<br />
erklärt und deren Ergebnisse innerhalb des Projekts dargestellt.<br />
a) Der Mini-Mental Status Test (MMST)<br />
„Der Mini-Mental-Status-Test (MMST) nach Folstein u.a. ist wegen seiner raschen<br />
Durchführungszeit ein beliebtes Screening-Verfahren zur Erfassung zerebraler<br />
Insuffizienz bzw. Demenz. Er prüft mit wenigen Fragen sowie durch Schreiben und<br />
Abzeichnen einer einfachen geometrischen Figur grob die Orientierung,<br />
Aufmerksamkeit, Konzentration, Merkfähigkeit und das Sprachverständnis (Füsgen<br />
1996, S. 192).<br />
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass er jedoch nicht für eine exakte Analyse<br />
kognitiver Fähigkeiten eingesetzt werden kann. Beim MMST kann ein Wert von null<br />
bis 30 Punkten erreicht werden. Dabei stehen 30 Punkte für uneingeschränkte und<br />
null Punkte für schwerst beeinträchtigte kognitive Funktionen. Ein Wert unter 20<br />
Punkten weist auf eine leichte bis mittlere Demenz hin. Eine Punktzahl unter zehn<br />
deutet auf eine schwere Demenz hin (vgl. ebd.). Im Projekt AGFM lagen die Ergeb-<br />
nisse beim MMST bei einem Wert von fünf bis 24 Punkten (vgl. GeFa 2009, S.17).<br />
Tabelle 5: Anzahl der erzielten Punkte im MMST (Quelle GeFa 2009, S.18)<br />
b) Der DemTect<br />
Der DemTect ist ein relativ neues Testverfahren, das im Jahr 2000 von Josef Kessler<br />
vom Max-Planck-Institut für neurologische Forschung in Köln und Pasquale<br />
Calabrese von der Neurologischen Uni-Klinik des Knappschaftskrankenhauses in<br />
Bochum entwickelt wurde. Der DemTect stellt ein einfaches, rasch und objektiv<br />
58
durchzuführendes und auszuwertendes Screening-Verfahren zu Demenz dar. Das<br />
Testinstrumentarium setzt sich zusammen aus den Subtests für Gedächtnis, Zahlen-<br />
transkodieren, Wortflüssigkeit, Wortspanne und verzögerter Abruf. Die Ergebnisse<br />
der Einzelaufgaben werden in Punkte umgerechnet. Die Testsummenwerte reichen<br />
von null bis 18 Punkte. Werte von 13-18 Punkten sprechen für eine altersgemäße<br />
kognitive Leistung. Bei einem Ergebnis von neun bis 12 Punkten geht man von einer<br />
leichten kognitiven Beeinträchtigung aus und bei einem Wert von acht Punkten und<br />
weniger besteht Demenzverdacht (vgl. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv..., Stand<br />
15.10.09). Die Ergebnisse bei den getesteten Personen innerhalb von AGFM<br />
ergaben Punktwerte zwischen eins und fünf Punkten (vgl. GeFa 2009, S.18).<br />
Tabelle 6: Anzahl der erzielten Punkte im DemTect (Quelle:GeFa 2009, S.18)<br />
c) Die Geriatrische Depressionsskala (GDS)<br />
Die Geriatrische Depressionsskala nach Yesavage umfasst in ihrer Kurzform 15<br />
Fragen zu Depression, die jeweils mit „ja“ und „nein“ zu beantworten sind. Bei einem<br />
Wert von null bis fünf Punkten wird von normaler Befindlichkeit ausgegangen. Mehr<br />
als fünf Punkte weisen auf eine leichte bis mäßige Depression hin und bei 11 und<br />
mehr erreichten Punkten ist von einer schweren oder manifesten Depression<br />
auszugehen (vgl. http://www.buergerspital.ch..., Stand 15.10.09).<br />
Die Ergebnisse der Geriatrischen Depressionsskala im Rahmen von AGFM wiesen<br />
bei fünf Personen auf das Vorliegen einer Depression hin. Es gab zwischen sechs<br />
und 11 Ja-Antworten (vgl. GeFa 2009, S.18).<br />
Tabelle 7: Anzahl der erzielten Punkte bei der GDS (Quelle: GeFa 2009, S.18)<br />
59
4.4.3 Lebenssituation, Problemstellungen und daraus abgeleiteter Hilfebedarf<br />
Auch Angaben zum Familienstand konnten aus den Rückmeldungen der<br />
Fallmanagerinnen erschlossen werden. Von den 46 Teilnehmern waren 22 (= 47,8%)<br />
verwitwet. 17 Personen (= 36,9%) gaben an, verheiratet zu sein und 6 Personen (=<br />
13%) waren ledig. In einem Fall wurde keine Angabe zum Familienstand vorge-<br />
nommen (vgl. GeFa 2009, S.19).<br />
Grafik 5: Familienstand der Erkrankten (Quelle: GeFa 2009, S.19)<br />
Von den 46 Teilnehmern lebten 30 Personen (= 65,2%) mit ihren Angehörigen<br />
zusammen. 16 Personen (= 34,8%) lebten alleine. Auch zur Wohnsituation selbst<br />
gab es Angaben. 28 Personen hatten Treppen zu überwinden, 5 Personen hatten<br />
keinen Aufzug. Die Nutzung eines Bades stand 27 Personen zur Verfügung, 15<br />
Personen war eine Dusche zugänglich. 20 Teilnehmer lebten in einem<br />
Einfamilienhaus und 19 in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner eines<br />
Einfamilienhauses waren sämtlich in der ländlichen Region Mittelfranken ansässig.<br />
Bei sieben Personen lagen keine Angaben vor (vgl. ebd.). Die Wohnsituation wird in<br />
der nachfolgenden Grafik veranschaulicht:<br />
60
Grafik 6: Wohnsituation der Klienten (Quelle: GeFa 2009, S.20)<br />
Hinsichtlich der Pflegeeinstufung, der ärztlichen Versorgung und der im Verlauf der<br />
Erkrankung auftauchenden Verhaltensänderungen ergab sich laut Angaben der Fall-<br />
managerinnen der hauptsächliche Hilfebedarf.<br />
Häufig war es für die Erkrankten und ihre Angehörigen wichtig, eine Pflegeeinstufung<br />
bzw. eine Höherstufung durchzusetzen. Zu Beginn des Fallmanagements lag bei den<br />
meisten Klienten (= 20 Personen) noch gar keine Einstufung oder lediglich die Ein-<br />
stufung in Pflegestufe I vor (= 20 Personen). Nur sechs Teilnehmer befanden sich zu<br />
Beginn in der Pflegestufe II (vgl. GeFa 2009, S.20).<br />
Tabelle 8: Pflegeeinstufung zu Beginn (Quelle: GeFa 2009, S.21)<br />
Während AGFM konnte in 6 Fällen eine Höherstufung mit Hilfe der Fallmanagerinnen<br />
erreicht werden. Eine Pflegeeinstufung bzw. eine Höherstufung wurde in 15 Fällen<br />
beantragt. In einem Fall kam es zu einer Rückstufung (vgl. ebd.).<br />
61
Tabelle 9: Pflegeeinstufung am Ende (Quelle: GeFa 2009, S.21)<br />
Eine weitere Aufgabe der Fallmanagerinnen war es, Unterstützung beim Zugang zu<br />
notwendiger medizinischer Diagnostik und Therapie zu bieten. Eine Versorgung<br />
durch einen Facharzt fand bereits bei mehr als der Hälfte (= 56,5%) der Klienten<br />
statt. Etwas mehr als ein Drittel (= 37%) wurde bisher jedoch nur von einem Hausarzt<br />
betreut (vgl. ebd. S. 21).<br />
Tabelle 10: Anteil der Haus- und Facharztversorgung (Quelle GeFa 2009, S.21)<br />
Die in der Fachliteratur häufig genannte Multimorbidität der Zielgruppe erfordert<br />
intensive medizinische Betreuung und Unterstützung. Der Anteil der Klienten von<br />
AGFM mit einer oder mehreren Diagnosen wird aus der nachstehenden Tabelle<br />
ersichtlich.<br />
Tabelle 11: Anzahl der Diagnosen pro Klient (Quelle GeFa 2009, S.21)<br />
Bezüglich der Diagnosen liegen weiterhin Angaben zur medikamentösen Versorgung<br />
vor. Aufgrund ihrer psychiatrischen Symptome bekamen jeweils 15 Personen Anti-<br />
dementiva oder Antidepressiva verordnet. Sieben Klienten bekamen Sedativa, drei<br />
Neuroleptika und eine Person Hypnotika verschrieben. 20 Personen erhielten da-<br />
rüber hinaus weitergehende Medikamente. Dies waren Medikamente zur Behand-<br />
62
lung von somatischen Erkrankungen, wie etwa Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-<br />
erkrankungen sowie Stoffwechselkrankheiten. Zudem kam es zu einer Verab-<br />
reichung von Antiepileptika, Gichtmittel sowie Cholesterin- oder Prostatamedi-<br />
kamenten (vgl. GeFa 2009, S.22).<br />
Da in der Betreuung und Versorgung gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen die<br />
Sicherstellung einer korrekten Medikamenteneinnahme eine wichtige Aufgabe ist,<br />
sollten die Fallmanagerinnen diesen Hilfebedarf mit überprüfen und ggf. für eine<br />
Sicherstellung sorgen.<br />
Bei 21 Klienten (= 45,7%) wurden die Medikamente gerichtet und die Einnahme<br />
durch einen ambulanten Pflegedienst beaufsichtigt. Bei sieben Klienten wurden die<br />
Medikamente gerichtet, allerdings erfolgte die Einnahme ohne Aufsicht. Bei neun<br />
Personen erfolgte nur die Einnahme unter Aufsicht und bei wiederum neun Personen<br />
waren entweder keine Hilfen nötig oder es gab keine Angaben über erforderliche<br />
Hilfen (vgl. ebd.).<br />
Tabelle 12: Medikamentenverabreichung (Quelle GeFa 2009, S.22)<br />
Die besonderen Probleme der Menschen mit einer Demenz und/ oder einer<br />
Depression sind häufig Verhaltensauffälligkeiten, aus denen sich ein spezieller Hilfe-<br />
bedarf ergibt. Im Projekt wurde durch die Fallmanagerinnen bei 25 Personen (=<br />
54,3%) ein verminderter Antrieb festgestellt. Bei 19 Personen (= 41,3%) zeigte sich<br />
ein Abwehrverhalten, 16 (= 34,8%) wurden von den Fallmanagerinnen als schwer<br />
motivierbar eingeschätzt. Weiterhin machte sich bei 18 Teilnehmern (= 39%) Unruhe<br />
bemerkbar und zehn Klienten (= 21,7%) hatten eine Weglauftendenz. Aggressivität<br />
wurde bei 13 Personen (= 28,3%) festgestellt. Immerhin 14 Personen (= 30,4%)<br />
zeigten Angstzustände und bei sieben Klienten (= 15,2%) stellten die Fall-<br />
managerinnen sogar Suizidalität fest (vgl. GeFa 2009, S.23).<br />
63
Grafik 7: Verhaltensauffälligkeiten/Risiken (Mehrfachnennungen möglich) (Quelle: GeFa 2009, S.23)<br />
Alle aufgeführten Symptome erschweren die Betreuung und Versorgung der Er-<br />
krankten. Da nur ein geringer Teil der Klienten bei Beginn des AGFM in Pflegestufe II<br />
eingestuft war, besteht die berechtigte Annahme, dass die Betreuung und Pflege der<br />
Erkrankten noch überwiegend von den Angehörigen geleistet wurde. Der Umgang<br />
mit den Betroffenen im häuslichen Alltag stellt aufgrund der genannten Symptome<br />
eine große Belastung für die Angehörigen dar. Die teils schwerwiegenden<br />
Verhaltensauffälligkeiten machen neben der notwendigen medizinischen Versorgung<br />
eine angepasste Vorgehensweise erforderlich. Hier konnten die Fallmanagerinnen<br />
Unterstützung bieten, u.a. auch durch die Vermittlung von niedrigschwelligen Ange-<br />
boten, die einen wichtigen Beitrag zur Entlastung leisten (vgl. ebd.).<br />
4.5 Die konkrete Fallbearbeitung<br />
Im Fokus bei der Fallbearbeitung standen Hilfebedarf und Hilfeplanung, die Ver-<br />
mittlung und Einbindung von Einrichtungen und Diensten sowie die Gestaltung von<br />
Kontakten und deren Zeitaufwand. Wie bereits in Punkt 3.1 erörtert, findet die<br />
Durchführung der gesamten Schritte des Case Managements in der Altenhilfe eher<br />
selten statt, wie auch an dieser Stelle deutlich wird. Dies liegt vermutlich auch im<br />
Modellprojekt an den nicht vorhandenen Kapazitäten und dem generellen Stand der<br />
Umsetzung von Case Management in diesem Bereich.<br />
a) Hilfebedarf und Hilfeplanung<br />
Anhand des Hilfebedarfplanes, der den Fallmanagerinnen zur Ermittlung und<br />
anschließenden Organisation entsprechender Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen<br />
64
zur Verfügung stand, wurde von den Fallmanagerinnen in Absprache mit den<br />
Klienten und gegebenenfalls mit deren Angehörigen bestimmte Bereiche ermittelt, in<br />
denen Unterstützung erfolgen sollte (vgl. GeFa 2009, S.24). Diese Bereiche sind der<br />
nachstehenden Grafik zu entnehmen.<br />
Grafik 8: Hilfebedarf in den Versorgungskategorien (Quelle GeFa 2009, S.24)<br />
Die Ermittlung des Bedarfs war in 32 von 46 Fällen (= 69,6%) möglich. Als zentrale<br />
Problematik wurde von den Fallmanagerinnen die zunehmende Einschränkung der<br />
Alltagsbewältigung und die fortschreitende fehlende Strukturierung bewertet. Weitere<br />
ermittelte Schwierigkeiten waren eine zunehmende Vereinsamung bei Allein-<br />
lebenden oder vereinzelte Tendenzen zur Verwahrlosung. In diesem Zusammen-<br />
hang gewann der Aufbau von sozialen Kontakten besonders an Bedeutung. Dies<br />
wurde in 38 Fällen (= 82,6%) für notwendig befunden. Bei den Erkrankten, die mit<br />
ihren Angehörigen zusammen lebten, wurde vor allem die Belastung der Ange-<br />
hörigen thematisiert (vgl. ebd.).<br />
65
) Vermittlung/ Einbindung<br />
Der ermittelte Hilfebedarf stellte die Basis für die zu organisierenden Unterstützungs-<br />
leistungen dar, deren Nutzung dazu beitragen sollte, die häusliche Situation zu<br />
stabilisieren. Dies erfolgte in Absprache mit den Klienten und den Angehörigen (vgl.<br />
GeFa 2009, S.25). Die nachstehende Grafik veranschaulicht, an welche Dienste und<br />
Einrichtungen die Erkrankten mit ihren Angehörigen zur Unterstützung weiter<br />
vermittelt wurden.<br />
Grafik 9: Vermittlung an weitere Unterstützungsangebote (Quelle: GeFa 2009, S. 25).<br />
Die Fallmanagerinnen verwiesen bei 15 Klienten an Beratungsstellen, in denen den<br />
Angehörigen Informationen über die Erkrankung, den Umgang mit dem Erkrankten<br />
und andere wichtige Informationen übermittelt werden konnten. Dieser Unter-<br />
stützungsleistung kam besonderer Bedeutung zu, da rund zwei Drittel der Erkrankten<br />
mit oder bei ihren Angehörigen lebte. Außerdem wurden ebenso 15 mal entweder die<br />
66
Betroffenen selbst und/ oder die Angehörigen in spezielle Gruppenangebote ver-<br />
mittelt. Wiederum kam es in 15 Fällen zur Verweisung an ambulante Pflegedienste<br />
oder die Pflege wurde durch den eigenen Pflegedienst ausgeweitet bzw. ergänzende<br />
Pflegeleistungen erbracht (vgl. GeFa 2009 S.25f). Neunmal kam der sogenannte<br />
„Helferinnenkreis“ zum Einsatz, der durch stundenweise Betreuung der Erkrankten<br />
den Angehörigen Entlastung und den Betroffenen selbst Anregung und sozialen<br />
Kontakt bietet. Siebenmal gab es eine Weitervermittlung an ambulante Wohnformen,<br />
wie z.B. Betreutes Wohnen oder eine spezielle Wohngemeinschaft. In ebenfalls<br />
sieben Fällen erfolgte aufgrund zunehmender Pflegebedürftigkeit bzw. akuter Er-<br />
krankung eine Weiterverweisung in die Kurzzeitpflege bzw. in ein Pflegeheim. Die<br />
Vermittlung zur Diagnostik und Therapie für eine verbesserte medizinische<br />
Versorgung wurde bei sieben Klienten entweder durch den Haus- oder Facharzt, die<br />
Gedächtnissprechstunde oder die Tagesklinik eingeleitet (vgl. ebd. S.26). Sechs<br />
Erkrankte wurden an die Tagesstätte/ Tagespflege vermittelt - ein Angebot, das den<br />
Betroffenen Aktivierung und soziale Kontakte sowie den Angehörigen Entlastung<br />
ermöglicht. In drei Fällen konnte das soziale Umfeld (z.B. Nachbarn) in die Ver-<br />
sorgung integriert werden. Unter „Sonstiges“ waren zehn Nennungen zu verzeichnen<br />
bezüglich des Einsatzes von einem Hausnotruf, Putzhilfen, Essen auf Rädern etc.<br />
Bei sieben Personen wurde auch die Verbesserung bzw. Sicherstellung der<br />
Medikamentenversorgung genannt, jeweils einmal durch Antidementiva und Anti-<br />
depressiva. Ebenso jeweils einmal wurde die Einleitung von Ergotherapie und<br />
Krankengymnastik genannt (vgl. ebd.).<br />
c) Kontakte und deren Zeitaufwand während AGFM<br />
Während des Projektes waren drei Haubesuche pro Fall vorgesehen. Weitere Kon-<br />
takte zu den Betroffenen und deren Angehörigen unterhielten die Fallmanagerinnen<br />
per Telefon. Eine wichtige Information für die GeFa bezüglich der praktischen Um-<br />
setzung des Projektes war der Zeitaufwand der Hausbesuche und die Erfassung der<br />
Anzahl der notwendigen Telefonkontakte (vgl. ebd.).<br />
• Die Hausbesuche<br />
Der überwiegende Anteil der Teilnehmer von AGFM lebte in der ländlichen Region.<br />
Als weiteste zurückgelegte Entfernung für einen Hausbesuch wurde von den Fall-<br />
managerinnen 30 Kilometer angegeben. Die kürzeste Strecke betrug einen Kilo-<br />
67
meter. Dementsprechend variierte die aufgewendete Fahrtzeit, die zwischen 2,5<br />
Minuten und 30 Minuten pro Fahrtstrecke lag.<br />
Der erste Hausbesuch war für die Kontaktaufnahme, Bedarfsermittlung,<br />
Information, Dokumentation, Testung der Erkrankten und Absprache über das<br />
weitere Vorgehen geplant. Pro Fall wurden für den ersten Besuch durchschnittlich<br />
62,5 Minuten bzw. ca. eine Stunde verwandt. Der höchste Zeiteinsatz lag bei knapp<br />
zwei Stunden und der niedrigste bei 20 Minuten (vgl. ebd.). Der zweite Hausbesuch<br />
war vorgesehen für die weitere Bedarfsermittlung, zur Erläuterung und Abstimmung<br />
von Maßnahmen, zur Planung, zur Testung und als Abschlussgespräch. Die<br />
verwendete Zeit für diesen zweiten Besuch lag zwischen fünf und 120 Minuten. Pro<br />
Hausbesuch wurden durchschnittlich 49,7 Minuten eingesetzt.<br />
Der dritte Hausbesuch diente der weiteren Bedarfsfeststellung, der Besprechung<br />
und Erkundung der Wünsche, der Information, Planung und Organisation, der<br />
Testung sowie einem Abschlussgespräch. Die eingesetzte Zeit lag zwischen zehn<br />
und 125 Minuten. Durchschnittlich wurden hier 55 Minuten pro Hausbesuch<br />
benötigt (vgl. GeFa 2009, S.27).<br />
• Die Telefonkontakte<br />
Dokumentiert wurden bei 38 Fällen 165 Telefonkontakte. Dies sind pro Fall rund<br />
vier Telefongespräche. Die überwiegende Anzahl fallbezogener Telefonate wurde<br />
123 mal durch die Fallmanagerinnen getätigt (= 74,5 %). 43 Telefonkontakte waren<br />
unter „Sonstige“ festgehalten worden, womit z.B. Angehörige, Nachbarn, Mit-<br />
arbeiter von Institutionen, Diensten und anderen Stellen gemeint sind. Dreimal<br />
erfolgte der telefonische Kontakt durch den Erkrankten selbst. Die Telefonate<br />
dienten hauptsächlich der Absprache und Informationsvermittlung und hatten in<br />
einem Fall auch die Funktion der Entlastung. Der Zeitaufwand pro Telefonat lag bei<br />
fünf und 25 Minuten (vgl. ebd. S.27).<br />
d) Grund der Beendigung von AGFM<br />
Für die Beendigung des Fallmanagements gaben die Fallmanagerinnen im Rück-<br />
meldebogen 26 mal als Grund an, dass es zu einer Stabilisierung der Situation des<br />
Erkrankten gekommen sei und keine weiteren Hilfen notwendig wären bzw. der<br />
Versorgungs- oder Hilfebedarf von der Familie gewährt oder geregelt würde.<br />
68
In sechs Fällen (= 13%) kam es zu einem Umzug in ein Pflegeheim, in das Betreute<br />
Wohnen, in eine Wohngruppe, eine ambulante Wohn- oder eine Hausgemeinschaft.<br />
Zweimal wurde eine Einweisung in die Psychiatrie veranlasst. In zwei anderen Fällen<br />
war das vorgesehene Zeitbudget von einem halben Jahr für die abschließende Fall-<br />
bearbeitung ausgeschöpft. In zwei Fällen war der Beendigungsgrund das Ver-<br />
sterben der Klienten. In drei Fällen wurde jegliche Hilfe vom Erkrankten abgelehnt,<br />
weshalb das Fallmanagement abgebrochen wurde. Sonstige Gründe waren einmal<br />
die Beendigung des Fallmanagements auf Grund der Einschätzung des Ehepartners,<br />
die Übernahme der Betreuung durch einen Angehörigen sowie Kontaktabbruch der<br />
Angehörigen wegen Wegzug (vgl. GeFa 2009, S.28).<br />
Grafik 10: Grund der Beendigung von AGFM (Quelle: GeFa 2009, S.28)<br />
4.6 Hürden und Effekte des Fallmanagements<br />
Ein wichtiger Aspekt für die GeFa und die Kostenträger war die Klärung, welche<br />
Effekte das gerontopsychiatrische Fallmanagement mit sich brachte. Bevor diese<br />
näher aus der Perspektive der Klienten und des Bezirks erläutert werden, soll auf die<br />
Hürden bei der Umsetzung eingegangen werden, die sich auf das Modellprojekt<br />
auswirkten.<br />
a) Hürden bei der Umsetzung<br />
Bei der Umsetzung des Fallmanagements ergaben sich einige Hürden, die u.a. dazu<br />
beigetragen haben, dass die Fallzahlen nach Einschätzung der GeFa nicht über die<br />
69
46 dokumentierten Fälle hinausgingen. Die hierzu auftretenden Fragestellungen<br />
wurden zwar in den begleitenden Schulungen thematisiert, konnten aber nicht immer<br />
gelöst werden (vgl. GeFa 2009, S. 29). Eine Hürde liegt in der Tatsache begründet,<br />
dass Erkrankte in vielen Fällen keine Krankheitseinsicht haben und dem zufolge<br />
nicht selbst die Initiative ergreifen, um Hilfen und Unterstützung zu verlangen.<br />
Angebotene Hilfen werden daher entweder gar nicht oder zu einem relativ späten<br />
Zeitpunkt der Erkrankung wahrgenommen. In einem Fall, der für AGFM in Frage<br />
gekommen wäre, lag beispielsweise ein Migrationshintergrund vor. Da die Erkrankte<br />
hier keine fremden Personen in ihrer häuslichen Ungebung duldete, konnten<br />
bestehende Versorgungsstrukturen nicht nutzbar gemacht werden. Die Angehörigen<br />
beugten sich - wie viele andere auch - trotz Überlastung dem Willen der Erkrankten.<br />
Weiterhin bestand manchmal keine Einsicht der Angehörigen bezüglich des<br />
bestehenden Hilfebedarfs. Aus professioneller Sicht wurde häufig ein dringender<br />
Handlungsbedarf gesehen und versucht, die notwendigen Maßnahmen nahe zu<br />
bringen. Allerdings stießen die Fallmanagerinnen mit ihren Vorschlägen bei einigen<br />
Angehörigen auf Ablehnung. Hier vermuteten die Fallmanagerinnen eine fehlende<br />
Auseinandersetzung mit dem Krankheitsverlauf oder finanzielle Gründe (vgl. ebd.).<br />
Auch die Haltung einiger Fallmanagerinnen stellte eine Hürde für die Durchführung<br />
des Projektes dar. Dies spiegelt die Anzahl der teilnehmenden Fallmanagerinnen<br />
wider: Von 40 gemeldeten Fallmanagerinnen bearbeiteten lediglich 19 einen oder<br />
mehrere Fälle. In den Schulungen äußerten sich einige Fallmanagerinnen skeptisch.<br />
Es kamen Äußerungen wie etwa, „das machen wir ja sowieso schon“ oder „die<br />
Beratungssituation ist nicht geeignet, um das Fallmanagement anzubieten“. In den<br />
Schulungen wurde diese Einstellung diskutiert und hinterfragt. Es fanden Versuche<br />
statt, neue Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten auszuloten (vgl. ebd. S.29f).<br />
Dies gelang aber nur bedingt, da meistens nur die sowieso aktiven Fallmanagerinnen<br />
bei den Schulungen anwesend waren. Diese nahmen das Coaching und die<br />
kollegiale Beratung für sich in Anspruch, was sich als hilfreich für ihre Arbeit erwies.<br />
Die mangelnde Zeit einiger Fallmanagerinnen für die Durchführung stellte ebenso ein<br />
Problem dar: Mit den teilnehmenden ambulanten Pflegediensten wurde zwar eine<br />
Kooperationsvereinbarung über das Fallmanagement getroffen, allerdings gestaltete<br />
sich für einige Fallmanagerinnen die Bearbeitung eines Falles als schwierig, da ihnen<br />
innerbetrieblich und trotz der gewährten Aufwandsentschädigung keine Zeit für die<br />
Bearbeitung und Dokumentation eingeräumt wurde. Dies hatte zur Folge, dass<br />
70
manche Fallmanagerinnen unter schwierigen Bedingungen und hin und wieder sogar<br />
außerhalb ihrer Arbeitszeit - zum Teil als Projektarbeit - die Fälle bearbeiteten und<br />
durchführten (vgl. ebd. S.30).<br />
Schließlich liegt ein weiteres Hindernis für das Projekt vermutlich darin begründet,<br />
dass zum einen aus der Sicht einiger Fallmanagerinnen eine zu geringe Aufwands-<br />
entschädigung gezahlt wurde und zum anderen der zur Verfügung gestellte Zeit-<br />
rahmen als zu gering bemessen angesehen wurde. Letzteres kritisierten allerdings<br />
nur wenige Fallmanagerinnen. Hierzu lautet das Zitat einer Fallmanagerin:<br />
„Bei professioneller, kontinuierlicher Begleitung der Erkrankten und ihrer<br />
Angehörigen sind weit mehr als die vorgesehenen drei Besuche nötig! Dazu<br />
müssen weiterhin und vermehrt finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden!<br />
Denn: Betreuung und Versorgung demenzkranker Menschen und ihrer<br />
Angehörigen wird angesichts der demographischen Entwicklung auch in Zukunft<br />
immer noch, immer wieder und immer Thema sein“ (zit. nach GeFa 2009, S.30).<br />
Die zum Teil unvollständige Dokumentation könnte weiterhin darauf hinweisen, dass<br />
die Pflegedienstmitarbeiterinnen großer zeitlicher Belastung ausgesetzt sind (vgl.<br />
GeFa 2009, S.30).<br />
b) Positive Effekte<br />
Für die Zukunft von Fallmanagement im gerontopsychiatrischen Bereich ist die Frage<br />
nach positiven Effekten von enormer Bedeutung. Trotz der vorher dargestellten<br />
Hürden, die während des Projekts auftraten, konnten in der Region Mittelfranken<br />
immerhin 46 Fälle bearbeitet werden. Dass sich hinter diesen sogenannten „Fällen“<br />
schwierigste menschliche Schicksale verbergen, darf dabei nicht vergessen werden.<br />
Es werden an dieser Stelle die Effekte für die Klienten und für den Bezirk dargestellt.<br />
Da in einer anonymen Erhebung die Pflegedienste nochmals gesondert zu AGFM<br />
befragt wurden und im Abschlussbericht der GeFa hierzu keine eigenen<br />
Informationen vorlagen, finden erst in Kapitel 5 (im Zusammenhang mit der<br />
Befragung) die Effekte für die ambulanten Pflegedienste Berücksichtigung.<br />
• Effekte für die Klienten<br />
Betroffene bzw. Angehörige äußerten sich überwiegend positiv über das<br />
Fallmanagement. Dies geht aus persönlichen Briefen an die GeFa und aus ein-<br />
71
geholten Beurteilungen der Fallmanagerinnen für den Abschlussberichtbogen<br />
hervor. Ein Angehöriger schreibt hierzu in einem Brief:<br />
„...Ich danke... für die gute Beratung, die mich ermutigt hat, den Antrag an die<br />
Pflegekasse zu stellen. Dieser Schritt ist mir schwer gefallen, denn damit<br />
verbunden ist auch eine starke emotionale Komponente, nämlich das<br />
Eingeständnis, dass eine einstmals tüchtige, umsichtige Partnerin,...nun auf die<br />
Hilfe von anderen angewiesen ist. Deswegen war der Kontakt mit der GeFa und die<br />
Beratung von Frau...ein wichtiger Impuls in unserer Situation,...“(zit. nach GeFa<br />
2009, S.31).<br />
Im Abschlussberichtsbogen lagen 40 positive Rückmeldungen (= 87%) vor.<br />
Angehörige und Klienten brachten ihre Dankbarkeit und Zufriedenheit zum Ausdruck<br />
(vgl. GeFa 2009, S.31). Es wurde eine spürbare Verbesserung oder/ und der<br />
Entlastung der Situation geäußert. Die Angehörigen gaben an, besser informiert zu<br />
sein und eine gesteigerte Motivation zu haben. sechsmal gab es auch negative<br />
Anmerkungen der Teilnehmer. Diese bezogen sich z.B. auf die fehlende Kooperation<br />
der Erkrankten, einen fehlenden Fahrdienst, die fehlende Überweisung zu einem<br />
Facharzt, die Verschlechterung der Situation, die unvermeidbare Einweisung eines<br />
Erkrankten in die geschlossene Abteilung (vgl. ebd.).<br />
• Effekte für den Bezirk Mittelfranken<br />
Ob eine Kosteneinsparung für den Bezirk Mittelfranken durch ein angebotenes<br />
Fallmanagement erfolgt, kann aus Sicht der GeFa nicht eindeutig beantwortet<br />
werden. Eine kostenneutrale Finanzierung des Fallmanagements ist nicht möglich,<br />
da es aus dem Budget für das „Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie“ nicht zu<br />
finanzieren ist. Die Kostenhöhe hängt ab von der Höhe der Vergütung pro Fall und<br />
der Anzahl der Fälle die in Zukunft zu bearbeiten wären. Die GeFa verweist in<br />
diesem Zusammenhang auf folgende hypothetische Rechnung für Deutschland mit<br />
sehr konservativen Zahlen für Demenzkranke, die vom ehemaligen Leiter des<br />
Instituts für Psychogerontologie in Erlangen, Prof. Oswald bei seinem Vortrag „Ist<br />
Alzheimer unser Schicksal oder können wir etwas dagegen tun?“ aufgestellt wurde:<br />
550.000 Senioren in Pflegeheimen (Stand 1999/ Quelle: Statistisches Bundesamt<br />
(2002), davon desorientiert: 45% (Stand 1997, Quelle: Dritter Altenbericht der<br />
Bundesregierung 2001); Kosten eines Pflegeplatzes durchschnittlich 2500 Euro pro<br />
Monat (Stand 2002, Quelle: Akademischer Dienst Berlin 2003)<br />
72
Vermeidet man: spart man:<br />
Ein Monat Versorgung im Heim 0,62 Milliarden Euro<br />
Sechs Monate Versorgung im Heim 3,71 Milliarden Euro<br />
(zit. nach GeFa 2009, S.33).<br />
Laut dem ersten Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und<br />
Jugend über die Situation der Heime und die Betreuung der Bewohner (Stand<br />
15.08.2006) deckt die Pflegeversicherung nicht sämtliche Pflegekosten ab. Ihre<br />
Leistungen sind einerseits begrenzt und andererseits übernimmt sie bestimmte<br />
Kosten nicht (z.B. Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten<br />
im stationären Sektor). Können Bewohner von Pflegeheimen die Kosten, die auf sie<br />
entfallen nicht selbst - auch nicht durch Angehörige - leisten, muss für die zu<br />
entrichtenden Kosten die Sozialhilfe einspringen (vgl. GeFa 2009, S.33). In einer<br />
anonymen Befragung der an AGFM teilnehmenden Pflegedienste ( ausführlicher in<br />
Kapitel 5) kristallisierte sich heraus, dass durch das Projekt Heimeinweisung<br />
überwiegend vermieden oder zumindest verzögert werden konnte. Die Umsetzung<br />
des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ stellt - nicht nur aus Kostengründen - ein<br />
sozialpolitisches Ziel dar. Denn der Verbleib in der häuslichen Umgebung hat -<br />
insbesondere für demenzerkrankte Menschen - auch therapeutischen Charakter,<br />
da diese Zielgruppe ein besonderes Bedürfnis nach Kontinuität und Stabilität der<br />
räumlichen und sozialen Umwelt besitzt (vgl. Kuhlmann 2005, S. 34). Da die<br />
Belastbarkeitsgrenzen pflegender Angehöriger, die immer noch hauptsächlich den<br />
wesentlichen Teil der Versorgung und Betreuung der Erkrankten übernehmen,<br />
maßgeblich über das Aufrechterhalten der häuslichen Pflegesituation entscheiden,<br />
ist es wichtig, diesen eine entsprechende Unterstützung an die Seite zu stellen.<br />
Aufgrund der Rückmeldungen zu AGFM kann davon ausgegangen werden, dass<br />
das Fallmanagement Entlastung bot, was oftmals zu einer Stabilisierung oder Ver-<br />
besserung der häuslichen Situation für Erkrankte und Angehörige beitrug (vgl.<br />
GeFa 2009, S.33).<br />
5. Die Befragung von Fallmanagerinnen und Klienten, Alternativen zum<br />
Konzept und Weiterentwicklungsbemühungen<br />
Wie bereits in Punkt 4.3 erläutert, konnten im Rahmen des Projektes „ambulantes<br />
gerontopsychiatrisches Fallmanagement (AGFM)“ bis Juni 2008 Fälle neue Fälle an-<br />
73
genommen werden. Im August 2008 - kurz vor Beendigung des Projektes im<br />
Dezember desselben Jahres - entwickelte ich in Zusammenarbeit mit der zu-<br />
ständigen Mitarbeiterin der GeFa je einen Fragebogen für die ambulanten Pflege-<br />
dienste sowie für die teilnehmenden Klienten bzw. Angehörigen (siehe Anhang). Ziel<br />
der Befragung war einerseits, einen Eindruck im nachhinein zu erhalten, ob die<br />
ambulanten Pflegedienste tatsächlich geeignet sind, das ambulante Fallmanagement<br />
durchzuführen. Dies sollte mittels einer Abfrage der Einschätzung der eigenen<br />
Durchführung der Fallmanagerinnen erfolgen. Hierzu wurden die Fragebögen direkt<br />
an die teilnehmenden ambulanten Pflegedienste verschickt.<br />
Mit der Befragung der Klienten bzw. Angehörigen sollte parallel hierzu heraus-<br />
gefunden werden, ob sich deren häusliche Situation durch AGFM stabilisiert hatte.<br />
Die Weiterleitung der Fragebögen für die Klienten/ Angehörigen erfolgte durch die<br />
zuständigen Fallmanagerinnen, da ihnen die Einschätzung überlassen blieb, für<br />
welche Betroffenen es überhaupt zumutbar war, einen Fragebogen auszufüllen. Im<br />
Anschluss folgt eine deskriptive Auswertung der jeweiligen Fragebögen und eine<br />
kurze Interpretation der Ergebnisse. Bei den Fallmanagerinnen erfolgte von August<br />
2008 bis November 2008 ein Rücklauf von 22 Fragebögen (von insgesamt 40<br />
Fallmanagerinnen), also von ca. 50%. Dies ist ein hoher Rücklauf. Dennoch werden<br />
an dieser Stelle keine statistischen Auswertungen vorgenommen, weil das Projekt für<br />
sich gesehen eher klein ist und derartige Vorgehensweise wenig Aussagekraft<br />
besitzt. Der Rücklauf der Befragung von den Betroffenen war - wie zu erwarten -<br />
eher gering. Es gingen lediglich acht Fragebögen von Angehörigen ein. Hier gilt zu<br />
berücksichtigen, dass durch die Einschätzung der Fallmanagerinnen, wem eine<br />
Befragung zumutbar sei, die Teilnahme vermutlich von vorneherein nicht sehr hoch<br />
war. Um die Betroffenen in ihrer bereits belasteten Situation nicht übermäßig zu<br />
beanspruchen wurden hier auch nur wenige Fragen gestellt. Aufgrund des geringen<br />
Rücklaufs von Angehörigen wird im Folgenden nur kurz auf die Ergebnisse<br />
eingegangen, zumal auf die Effekte für die Klienten bereits in Punkt 4.6 verwiesen<br />
wurde. Im Fokus soll die Befragung der Fallmanagerinnen und deren Auswertung<br />
stehen. Im Anschluss an die Auswertung und deren Ergebnisse bzw. Tendenzen<br />
finden in einem weiteren Schritt die Vorstellung einer Alternative zum Konzept des<br />
Projektes und eine Beschreibung von Weiterentwicklungen Eingang in diesem<br />
Kapitel. In diesem Zusammenhang wird außerdem die Notwendigkeit eines Struktur-<br />
wandels der ambulanten Pflegedienste erörtert.<br />
74
5.1 Ergebnisse und Tendenzen aus der Befragung von Angehörigen/<br />
Betroffenen<br />
Bei der Befragung von Angehörigen/ Betroffenen (siehe Anhang) gingen wie bereits<br />
erwähnt acht Fragebögen bei der GeFa ein. Sie wurden ausschließlich von<br />
Angehörigen beantwortet (Töchter/ Ehepartner, Nichte). Von den acht Befragten<br />
antworteten lediglich sechs Personen auf folgende Fragestellungen:<br />
Tabelle 13: Befragung der Angehörigen zu den Effekten des Fallmanagements (Quelle GeFa 2009,<br />
S.31)<br />
Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Resonanz bei den Befragten bezüglich<br />
AGFM eindeutig positiv ist und dies auf eine Stabilisierung der häuslichen Situation<br />
hindeutet. Zwei Angehörige beantworteten die dargestellten Fragen nicht. In einem<br />
Fall gab die Angehörige an, dass es lediglich zu einem Erstkontakt kam und sie<br />
selbst ausgebildete Fachkraft ist, was vermuten lässt, dass sie sich selbst weiterhin<br />
um die Belange des Betroffenen kümmerte. In dem anderen Fall schrieb der Ehe-<br />
mann, dass trotz der Bemühen der Fallmanagerin keine Fallübernahme zustande<br />
kam. In einem ausführlichen Brief als Anlage zur Befragung schreibt er:<br />
„...Meine Frau geht zur Zeit in die Tagespflege nach Bad Windsheim (montags bis<br />
einschließlich donnerstags von 7.30 bis 16.00 Uhr). Bad Windsheim ist 13 km<br />
75
entfernt. Da meine Frau eine starke Abneigung gegen das Autofahren hat, war der<br />
Gedanke, ihr dies einen weiteren Tag durch den Besuch einer Dame der zentralen<br />
Diakoniestation zu ersparen. Frau... hat sich wöchentlich 2 Stunden redlich bemüht,<br />
fand aber doch keinen Zugang zu meiner Frau (lag nicht an Frau..., sondern an<br />
meiner Frau, die jede Neuerung ablehnt)“.<br />
Trotz des Bemühens des Ehemanns, der sich durch das Fallmanagement Ab-<br />
wechslung und Beteiligung für seine Frau erhoffte, kam das Fallmanagement auf-<br />
grund der Haltung der Ehefrau nicht zustande. In seinem Schreiben bedankt sich<br />
dieser Herr nochmals ausdrücklich für das Angebot und betont, dass er das<br />
Fallmanagement trotzdem für sehr sinnvoll hält.<br />
Die Befragung der Betroffenen war ein Versuch, die Ergebnisse der GeFa in diesem<br />
Punkt (vgl. Punkt 4.6.2) nochmals zu konkretisieren. Aufgrund der geringen Teil-<br />
nahme an der Befragung können die Ergebnisse an dieser Stelle allerdings nur als<br />
beispielhaft gelten.<br />
5.2 Auswertung der Fragebögen für die Fallmanagerinnen und Interpretation<br />
der Ergebnisse<br />
Der Fragebogen (siehe Anhang) für die Fallmanagerinnen bestand aus 16 Fragen,<br />
die an dieser Stelle mit den Ergebnissen ausgewertet und interpretiert werden:<br />
• Die Grundqualifikation und Fort-/ Weiterbildung der Fallmanagerinnen:<br />
Die Frage nach der Grundqualifikation ergab, dass die teilnehmenden Fall-<br />
managerinnen überwiegend eine Ausbildung zur examinierten Krankenschwester<br />
haben (12 von 22 Befragten). Acht von den Gesamtbefragten gaben an, eine<br />
Grundqualifikation zur examinierten Altenpflegerin zu besitzen. Andere Berufs-<br />
gruppen waren bei den Befragten kaum vertreten ( eine Nennung Sozialpädagogin<br />
und eine Nennung „Sonstige“). Das Ergebnis zu der Frage nach Fort- und Weiter-<br />
bildung konnte verdeutlichen, dass ein großer Teil der Fallmanagerinnen am<br />
Qualifizierungskonzept I und II der <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V. teilgenommen hat<br />
(16 der Befragten an GQ I und II und eine an GQ I). Vier der Befragten hatten ihre<br />
Qualifikation für das Fallmanagement bei einer Weiterbildung zur Fachkraft<br />
Gerontopsychiatrie erworben. Bei „sonstige“ gab es eine Nennung.<br />
76
• Die Anzahl der bearbeiteten Fälle<br />
Von insgesamt 22 Befragten haben 17 Personen Fälle in unterschiedlicher Anzahl<br />
bearbeitet. Insgesamt waren es von den Befragten 41 Fälle, die bearbeitet wurden.<br />
Fünf Personen gaben an, keine Fälle bearbeitet zu haben. Hier ist anzumerken,<br />
dass bei einer Nichtbearbeitung die Beantwortung der weiteren Fragen kaum<br />
vorgenommen wurde, weshalb auch nicht bei jeder Frage 22 Nennungen zu<br />
verzeichnen sind. Zu der Frage gab es auch Platz für eigene Anmerkungen, der<br />
jedoch in diesem Fall nur wenig genutzt wurde. Eine Person gab an, dass sie keine<br />
Unterstützung vom Leitungsteam hatte, eine andere gab an, dass ein Fall wegen<br />
fehlender Einverständniserklärung der Angehörigen nicht angenommen werden<br />
konnte. Beide dieser Personen hatten jedoch Fälle bearbeitet, so dass aus den<br />
Anmerkungen keine Rückschlüsse darüber gezogen werden können, warum es<br />
nicht zu einer Fallbearbeitung kam.<br />
• Umfang der vorgesehenen Hausbesuche<br />
Die drei vorgesehenen Hausbesuche im Rahmen von AGFM wurden von 13<br />
Fallmanagerinnen als „ausreichend“ gewertet. Sechs Befragte befand die Anzahl<br />
der Hausbesuche als „nicht ausreichend“. Drei Personen beantworteten die Frage<br />
nicht. Aus den Anmerkungen zu dieser Frage ging hervor, dass laut der Fall-<br />
managerinnen die Anzahl der notwendigen Hausbesuche je nach Fall stark<br />
variieren kann. Zum zeitlichen Umfang waren zehn Befragte der Meinung, dass bis<br />
zu einer Stunde dafür angemessen seien. Acht Befragte bevorzugten allerdings<br />
einen zeitlichen Umfang von mehr als einer Stunde. Dies wurde wiederum mit der<br />
Spezifität der Fälle begründet. Vier mal wurden hierzu keine Angaben gemacht.<br />
• Vermittlung geeigneter ambulanter Maßnahmen<br />
Die Frage, ob geeignete ambulante Maßnahmen an die Betroffenen vermittelt<br />
werden konnten, fiel positiv aus. Eine Befragte gab an, dass dies voll und ganz zu-<br />
trifft und 14 gaben an, dass dies zutrifft. Nur in einem Fall wurde die Rubrik „trifft<br />
überhaupt nicht zu“ angegeben und zwei Personen befanden, dass dies weniger<br />
zutrifft. Viermal wurde die Frage nicht beantwortet. Bei den „Negativnennungen“<br />
gab es keine Anmerkungen, aus denen sich eine Begründung ableiten ließe. Bei<br />
den Anmerkungen der positiven Antworten, kam des öfteren die schwierige<br />
Kooperation mit den Angehörigen zur Sprache.<br />
77
• Verbesserung der Lebensqualität der Erkrankten/ Angehörigen<br />
Ebenso 14 Personen gaben mit dem Item „trifft zu“ an, dass durch das geronto-<br />
psychiatrische Fallmanagement die Lebensqualität der Erkrankten verbessert<br />
werden konnte. Drei Befragte gaben sogar an, dass dies voll und ganz zutrifft,<br />
wohingegen nur zwei Personen der Meinung waren, dass dies weniger zutrifft. In<br />
diesem Fall wurde dies mit einer Anmerkung wieder mit der mangelnden<br />
Kooperation der Angehörigen erklärt. Positive Anmerkungen waren meist, dass<br />
durch die Stabilisierung des Pflegeverhältnisses und geeignete ambulante Maß-<br />
nahmen die Lebensqualität der Erkrankten verbessert werden konnte. Drei Be-<br />
fragte machten keine Angaben. Ähnlich gestaltet sich das Ergebnis zur Frage nach<br />
der Verbesserung der Lebensqualität bei den Angehörigen: Hier gaben 13 der Be-<br />
fragten an, dass dies zutrifft und vier sogar, dass dies voll und ganz zutrifft. Das<br />
Item „trifft weniger zu“ wurde nur von einer Person gewählt. Vier Fallmanagerinnen<br />
beantworteten diese Frage nicht. Aus den Anmerkungen ging überwiegend hervor,<br />
dass die Angehörigen durch das Fallmanagement Entlastung erfuhren und sich<br />
einen Freiraum schaffen konnten. Vor allem die Gespräche über ihre Situation<br />
seien laut der Fallmanagerinnen für viele Angehörige hilfreich gewesen.<br />
• Verzögerung bzw. Vermeidung von Heimeinweisung<br />
Bei der Einschätzung, ob Heimeinweisung durch AGFM verzögert werden konnte,<br />
gaben 11 Personen an, dass dies der Fall sei, eine Person verneinte dies und<br />
sechs Befragte kreuzten das Item „weiß nicht“ an. Vier machten wiederum keine<br />
Angaben. Ob Heimeinweisung vermieden werden konnte, wurde dahingegen nur<br />
von drei Befragten bejaht und von zwei Befragten verneint. Hier überwog mit zehn<br />
Nennungen „weiß nicht“. Sieben Personen machten keine Angaben. Aus den An-<br />
merkungen lassen sich kaum Rückschlüsse ziehen. Die vielen Nennungen des<br />
Items „weiß nicht“ können eventuell so interpretiert werden, dass die Fall-<br />
managerinnen nach Abschluss des Projektes keinen Kontakt mehr zum Klienten<br />
hatten und daher auch nicht wissen, wie sich der weitere Krankheitsverlauf<br />
gestaltete.<br />
78
• Annahme der Vorschläge der Fallmanagerinnen durch Angehörige/ Erkrankte<br />
Weiterhin wurde danach gefragt, ob die Vorschläge der Fallmanagerinnen von den<br />
Angehörigen angenommen wurden. „Trifft voll und ganz zu“ wurde von fünf Per-<br />
sonen, „trifft zu“ von 11 und „trifft weniger zu“ von drei Personen gewählt. Dreimal<br />
gab es hierzu keine Angabe. Die gleiche Frage bezogen auf die Erkrankten wurde<br />
dreimal mit „trifft voll und ganz zu“, achtmal mit „trifft zu“, fünfmal mit „trifft weniger<br />
zu“ und einmal mit „trifft überhaupt nicht zu“ eingeschätzt. Fünfmal gab es keine<br />
Angabe. Aus den Anmerkungen zu den Angehörigen ging hervor, dass diese über-<br />
wiegend dankbar waren für die Vorschläge der Fallmanagerinnen, in manchen<br />
Fällen kam es allerdings auch zu keiner Kooperation. Was die Erkrankten anbetrifft<br />
wurde ihre Fähigkeit zur Kooperation als stark abhängig vom Erkrankungsgrad<br />
bewertet.<br />
• Zusammenarbeit mit Versorgungsanbietern<br />
Die Zusammenarbeit mit Versorgungsanbietern (andere ambulante Dienste, Ärzte<br />
etc.) wurde überwiegend als „gut“ eingestuft (zehn Nennungen). Drei Befragte<br />
empfanden die Zusammenarbeit als „zufriedenstellend“ und eine Befragte als<br />
„weniger gut“. Hier gab es neunmal keine Beantwortung der Frage. Bei Nicht-<br />
beantwortung gaben jedoch einige Fallmanagerinnen in der Anmerkung an, dass<br />
es zu keiner Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsanbietern während ihrer<br />
Fallbearbeitung gekommen war.<br />
• Die Höhe der Aufwandsentschädigung<br />
Die nächste Frage bezog sich auf die Höhe der Aufwandsentschädigung. Dass<br />
diese kostendeckend sei, gaben drei Personen mit „ja“, sieben mit „nein“ und<br />
sieben Personen mit „weiß nicht“ an. Fünf Befragte machten keine Angaben. Es<br />
gab an dieser Stelle die Möglichkeit einen Vorschlag für die Höhe anzugeben.<br />
Dieser Vorschlag lag im Rahmen von 200 bis 250 Euro pro Fall. Die tatsächliche<br />
Aufwandsentschädigung lag bei 100 Euro pro Fall. Den Anmerkungen war zu ent-<br />
nehmen, dass die Aufwandsentschädigung wegen des intensiven zeitlichen Be-<br />
darfs einfach höher liegen müsste.<br />
79
• Abrechnungsart<br />
Weiterhin sollten die Fallmanagerinnen mitteilen, welche Abrechnungsart sie im<br />
Rahmen des Projektes bevorzugten. Hier wünschten sich 15 Personen eine<br />
stundenweise Abrechnung und nur zwei waren für eine Pauschale. Fünfmal wurde<br />
die Frage nicht beantwortet. Die Bevorzugung einer stundenweise Abrechnung<br />
wurde in den Anmerkungen überwiegend damit begründet, dass der Zeitaufwand -<br />
je nach Fall - unterschiedlich hoch sei.<br />
• zeitliche Angemessenheit des Dokumentationssystems<br />
Als nächstes wurde das Dokumentationssystem des gerontopsychiatrischen<br />
Fallmanagements abgefragt. Dies gliedert sich in Dokumentationsbogen, Bedarfs-<br />
ermittlung, Zeittabelle und Abschlussbericht. Ob der Dokumentationsbogen zeitlich<br />
angemessen sei, beantworteten sieben der Befragten mit „ja“ und sechs mit „nein“.<br />
Neunmal gab es keine Angabe. An dieser Stelle konnte ein zeitlicher Vorschlag<br />
gemacht werden. Dieser lag bei den Befragten bei einer Zeitspanne von zehn bis<br />
60 Minuten. Die Bedarfsermittlung wurde von fünf Personen als zeitlich ange-<br />
messen eingeschätzt. Sieben Befragte hielten sie nicht für zeitlich angemessen und<br />
zehn machten keine Angaben. Hier lag die angegebene Zeitspanne zwischen 15<br />
und 60 Minuten. Die Zeittabelle wurde von sechs Befragten als zeitlich<br />
angemessen und von sechs Befragten als nicht zeitlich angemessen befunden.<br />
Zehnmal gab es hierzu wieder keine Angaben. Der zeitliche Vorschlag reichte von<br />
fünf bis 60 Minuten. Beim Abschlussbericht waren es sieben Personen, die diesen<br />
als zeitlich angemessen und sechs die ihn als nicht zeitlich angemessen einstuften.<br />
Neun Fallmanagerinnen beantworteten diese Frage nicht. Hier lag die angegebene<br />
Zeitspanne zwischen acht und 60 Minuten. Auch hier war den Anmerkungen zu<br />
entnehmen, dass die stark variierenden Zeitvorstellungen mit dem unter-<br />
schiedlichen Zeitaufwand je nach Fall zusammenhängen. Fallmanagerinnen, die<br />
das Dokumentationssystem überwiegend für nicht zeitlich angemessen hielten,<br />
gaben an, dass neben der Dokumentation viel Zeit für Gespräche mit Betroffenen<br />
oder Angehörigen benötigt wurde. Die zeitliche Angemessenheit ist laut den<br />
Anmerkungen auch stark abhängig von der Routine beim Ausfüllen des<br />
Dokumentationssystems.<br />
80
• Praktikabilität des Dokumentationssystems<br />
Die Praktikabilität des Dokumentationssystems wurde in der Befragung über-<br />
wiegend bestätigt. So hielten 16 Befragte den Dokumentationsbogen für prakti-<br />
kabel, zwei verneinten dies und vier machten keine Angaben. Bei der Bedarfs-<br />
ermittlung antworteten 15 Personen mit „ja“, drei mit „nein“ und keine Angaben<br />
machten fünf Befragte. Bei der Zeittabelle bestätigten 14 Fallmanagerinnen die<br />
Praktikabilität, vier verneinten sie und wiederum vier beantworteten diese Frage<br />
nicht. Den Abschlussbericht bezeichneten 16 Befragte als praktikabel, zwei<br />
Personen verneinten dies und vier machten keine Angaben. Angemerkt wurde hier<br />
lediglich, dass zum Teil mehr Platz zum Schreiben vorhanden sein sollte.<br />
• Schulungen im Rahmen von AGFM<br />
Hier wurden die Fallmanagerinnen gefragt, ob sie Schulungen im Rahmen von<br />
AGFM für hilfreich halten. Neun von ihnen gaben an, dass dies voll zutrifft, sieben<br />
gaben „trifft zu“ an, eine Person gab „trifft weniger zu“ an und eine Person<br />
entschied sich für das Item „trifft überhaupt nicht zu“. Viermal gab es keine An-<br />
gaben. Anmerkungen hierzu waren zum Beispiel, dass die Testungen von Ärzten<br />
oder Gedächtnissprechstunden durchgeführt werden sollten, auch wenn es gut<br />
war, die Tests in den Schulungen kennen zu lernen. Eine Fallmanagerin wünschte<br />
sich Fortbildung in kürzeren zeitlichen Abständen, dafür nicht so zeitintensiv. An-<br />
sonsten wurde angemerkt, dass die Fortbildungen hilfreich und gut waren.<br />
• Kosten-Nutzen-Effekt von AGFM für Patienten/ Klienten sowie die ambulanten<br />
Dienste<br />
Auch der Kosten-Nutzen-Effekt für die Patienten/ Klienten sollte von den Fall-<br />
managerinnen bewertet werden. Drei gaben an dass das Projekt diesbezüglich<br />
„sehr effektiv“ sei, 14 befanden es als „effektiv“, zwei als „weniger effektiv“ und eine<br />
Person als „überhaupt nicht effektiv“. Viermal gab es keine Angaben. Der Kosten-<br />
Nutzen-Effekt bestand laut den Anmerkungen darin, dass den Betroffenen keine<br />
Kosten entstanden und sie dafür Entlastung erhielten.<br />
Bei der Einschätzung des Kosten-Nutzen-Effekts für die ambulanten Dienste<br />
befand keiner der Befragten AGFM für „sehr effektiv“, sieben wählten das Item<br />
„effektiv“, sieben das Item „weniger effektiv“. Drei Personen befanden das Projekt<br />
diesbezüglich als „überhaupt nicht effektiv“ und fünf Fallmanagerinnen beant-<br />
81
worteten diese Frage nicht. Hier ging aus den Anmerkungen hervor, dass der Zeit-<br />
aufwand zu groß war, als dass davon die ambulanten Dienste profitieren konnten.<br />
Den erhofften „Werbeeffekt“ stellten einige Fallmanagerinnen in den Anmerkungen<br />
positiv dar, andere wiederum gaben an, dass der erhoffte erweiterte Zugang zu<br />
neuem Klientel ausblieb, da das Fallmanagement zu unbekannt war.<br />
• Fortführung von AGFM<br />
Ob sie an einer Fortführung des gerontopsychiatrischen Fallmanagements<br />
interessiert seien, beantworteten 12 Fallmanagerinnen mit „ja“ und sieben mit<br />
„nein“. Drei machten keine Angaben. Ein Votum für die Fortführung wird in den<br />
Anmerkungen damit begründet, dass psychiatrische Erkrankungen im Alter<br />
zunehmen. Ein Argument der Fallmanagerinnen, die eine Weiterführung des<br />
Projekts ablehnten war, dass sie ähnliche Tätigkeit in ihren Diensten bereits<br />
vornähmen.<br />
• zusätzliche Fortbildung als Fallmanagerin<br />
Abschließend wurde der Wunsch nach zusätzlichen Fortbildungen als Fall-<br />
managerin abgefragt. Dies wurde von acht Personen gewünscht und zehn sahen<br />
für sich keinen zusätzlichen Fortbildungsbedarf. Vier Fallmanagerinnen äußerten<br />
sich hierzu nicht. Hier konnte angegeben werden welche Fortbildungen gewünscht<br />
werden. Angegeben wurden eine Fortbildung zu Beraterqualifikationen, zu<br />
aktuellen Veränderungen, zu Formulierungsmöglichkeiten für das Dokumentations-<br />
system sowie Supervision.<br />
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Frage, ob ambulante<br />
Pflegedienste als Projektpartner für das gerontopsychiatrische Fallmanagement ge-<br />
eignet sind, durch die Befragung nicht eindeutig geklärt werden kann. Die Rück-<br />
meldung der Fallmanagerinnen war zwar in einigen Bereichen überwiegend positiv,<br />
dennoch gibt es in der Befragung Hinweise darauf, dass ein Verbesserungsbedarf<br />
hinsichtlich der Strukturen der ambulanten Dienste aber auch des Konzeptes AGFM<br />
(z.B. Abrechnungsart, Dokumentationssystem etc.) besteht. Wie bereits erwähnt,<br />
haben auch Fallmanagerinnen den Fragebogen beantwortet, die kein Fall-<br />
management durchgeführt haben. Daher wurden auch bei vielen Fragen keine An-<br />
gaben gemacht. Zu klären wäre u.a. mit diesen Personen, warum es zu keiner<br />
82
Fallbearbeitung kam. Vermutlich könnten Aussagen darüber - neben der Haltung der<br />
Fallmanagerinnen - ebenso auf die Notwendigkeit hindeuten, dass das Konzept<br />
selbst überarbeitet werden muss und eine Anpassung der Strukturen der ambulanten<br />
Dienste erfolgen sollte, wenn sie Case Management als Projektpartner durchführen<br />
wollen.<br />
5.3 Alternativen zum Konzept AGFM/ (strukturelle) Weiterentwicklungs-<br />
bemühungen<br />
Nicht nur aufgrund der Tendenzen, die sich aus der Befragung ableiten lassen, soll in<br />
den weiteren Ausführungen eine Alternative zum ambulanten gerontopsychiatrischen<br />
Fallmanagement aufgezeigt werden. Laut der zuständigen Mitarbeiterin der GeFa<br />
wird das Projekt noch einmal für ein Jahr weitergeführt. Es wird immer noch über das<br />
Fortbildungsbudget „Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie“ finanziert. Aufgrund<br />
der Resultate aus der Befragung der Fallmanagerinnen hat die GeFa bereits<br />
Änderungen im Konzept vorgenommen, um eine Fallbearbeitung zu erleichtern. So<br />
wurde die pauschale Aufwandsentschädigung von ursprünglich 100 Euro auf 200<br />
Euro erhöht. Außerdem müssen die Fallmanagerinnen nicht mehr das Doku-<br />
mentationssystem der GeFa bei der Fallbearbeitung verwenden. Sie können selbst<br />
bestimmen, wie sie die Dokumentation vornehmen. Auffällig ist, dass nach Aussagen<br />
der Mitarbeiterin der GeFa trotz dieser Veränderungen nur drei Fälle aktuell in Mittel-<br />
franken bearbeitet werden. Aufgrund der geringen Resonanz wird das Projekt nach<br />
der einjährigen Laufzeit nicht mehr weitergeführt. Vielmehr gibt es bei der GeFa<br />
Bestrebungen, neue Konzepte zu entwickeln, die Case Management weiterhin als<br />
Ansatz enthalten. Dies erfolgt auch als Antwort auf gesetzliche Bestimmungen (siehe<br />
Punkt 5.3.2). Unabhängig davon fanden Diskussionen mit der Mitarbeiterin der GeFa<br />
statt, inwieweit es sinnvoll ist, dass die Fallmanagerinnen die Pflege und das Case<br />
Management gleichermaßen durchführen. In Kapitel 4 wurden bereits die Vorteile<br />
(z.B. Niedrigschwelligkeit des Angebotes, flächendeckende Versorgung, geringe<br />
Fahrtzeiten) geschildert, die den Anlass für die GeFa gaben, die ambulanten Dienste<br />
als Projektpartner zu wählen. Während des beschriebenen Projektzeitraums konnten<br />
ja auch durchaus mehrere Fälle erfolgreich bearbeitet werden und die Vorzüge einer<br />
„Hilfe aus erster Hand“ genutzt werden. Allerdings deutet die niedrige Anzahl der<br />
Fallbearbeitung in der Fortführung des Projektes darauf hin, dass lediglich eine<br />
geringe Bereitschaft bei den ambulanten Pflegediensten besteht, das Case<br />
83
Management durchzuführen. Dies wurde auch von der Mitarbeiterin der GeFa so<br />
bewertet. Um ein Case Management optimal in den Pflegediensten zu integrieren,<br />
muss an dieser Stelle auf jeden Fall ein Strukturwandel stattfinden. Diese Über-<br />
legungen werden in Punkt 5.3.2 genauer erörtert. Aufgrund der bestehenden Struk-<br />
turen, die in ambulanten Diensten momentan vorherrschen, ist ein von ambulanten<br />
Pflegediensten unabhängiges Case Management trotz der genannten Vorteile zu<br />
bevorzugen. Dies kann damit begründet werden, dass die Fallmanagerinnen in der<br />
Befragung häufig äußerten, zu wenig Zeit für die Fallbearbeitung zu haben also über-<br />
fordert waren. Des Weiteren hielten sich hinsichtlich der Bearbeitung des Doku-<br />
mentationssystems und der Testverfahren nicht alle Fallmanagerinnen für aus-<br />
reichend geschult. Ein weiteres Kriterium, das für ein von Trägern der ambulanten<br />
Pflege unabhängiges Case Management spricht, ist die Neutralität des Case<br />
Managers. Dadurch kann eher gewährleistet werden, dass nur im Interesse des<br />
Klienten Maßnahmen ergriffen und geeignete Hilfsangebote vermittelt werden. Bei<br />
der Befragung der Fallmanagerinnen zum Kosten-Nutzen-Effekt für die ambulanten<br />
Dienste wird ersichtlich, dass einige ambulante Dienste das Case Management<br />
durchführten, da sie sich einen Werbeeffekt und somit neues Klientel erhofften. Ob<br />
daher ein echtes Interesse besteht, das Fallmanagement im Sinne der optimalen<br />
Hilfestellung für den Klienten durchzuführen, steht und fällt mit dem Engagement der<br />
einzelnen Fallmanagerinnen. Laut Aussage der Mitarbeiterin der GeFa besteht<br />
außerdem seitens der Fallmanagerinnen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit<br />
anderen ambulanten Dienststellen nicht selten eine Hemmschwelle, da diese oft als<br />
Konkurrenten angesehen werden. Auf die Frage, ob Sie es für sinnvoll halte, als<br />
Pflegedienstmitarbeiterin auch für die Durchführung des Case Managements<br />
zuständig zu sein antwortete eine teilnehmende Fallmanagerin: „Eine Mitarbeiterin<br />
des ambulanten Dienstes schaut oft durch die Brille einer ‚Pflegerin’. Im Falle dieser<br />
ratsuchenden Menschen bedarf es Weitsicht und Umsicht. Meiner Meinung nach<br />
wäre das Case Management besser bei den Fachstellen o.ä. angesiedelt“ (eine<br />
Fallmanagerin, 03.11.09).<br />
5.3.1 Das Konzept der <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Behandlungspflege von HALMA<br />
e.V. Würzburg und Entwicklungen in Mittelfranken<br />
Das Konzept der „<strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Behandlungspflege“ soll im Folgenden als<br />
Alternative zum Projekt „Ambulantes gerontopsychiatrisches Fallmanagement<br />
84
(AGFM)“ im Vergleich und als Beispiel für ein von ambulanten Pflegediensten unab-<br />
hängiges Case Management vorgestellt werden. Außerdem sind Weiterent-<br />
wicklungen in Mittelfranken Gegenstand der Ausführungen.<br />
Der Ansatz der „<strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Behandlungspflege“ wurde von HALMA e.V.<br />
(Hilfen für altersverwirrte Menschen im Alter) konzipiert und wird aktuell umgesetzt.<br />
Der Verein ist eine Beratungs-, Unterstützungs- und Vernetzungsstelle in Würzburg.<br />
Seit 1996 handelt es sich bei HALMA e.V. um einen Trägerverein, bestehend aus der<br />
Stadt Würzburg, den fünf Wohlfahrtsverbänden Arbeiterwohlfahrt, Bayerisches Rotes<br />
Kreuz, Caritasverband, Diakonisches Werk und Paritätischer Wohlfahrtsverband<br />
sowie der Alzheimer Gesellschaft für Würzburg und Unterfranken. Aktuell gibt es in<br />
der Einrichtung 3,25 Planstellen, die mit einer Stelle für die Leitung, einer Dipl.<br />
Pädagogin und einer Dipl. Soziologin jeweils halbtags, zwei gerontopsychiatrischen<br />
Fachpflegekräften (eindreiviertel Stellen) und einer Verwaltungsfachkraft (halbtags)<br />
besetzt sind. Zusätzlich erhält das Team ärztliche Unterstützung durch einen Fach-<br />
arzt der Universitätsnervenklinik. Die Finanzierung von Halma e.V. erfolgt durch den<br />
Bezirk Unterfranken als sozialpsychiatrischer Dienst, durch das Bayerische Projekt<br />
„Netzwerk Pflege“ des Bayerischen Landesamtes für Versorgung und Familien-<br />
förderung für Angehörigenarbeit und HelferInnenkreise und die Stadt Würzburg im<br />
Rahmen ihres Programms Soziale Dienste (vgl. Weber 2003, S. 49 f). Die Zielgruppe<br />
und die Ziele der gerontopsychiatrischen Behandlungspflege sind identisch mit<br />
denen des Projektes AGFM. Der gravierende Unterschied zu AGFM besteht darin,<br />
dass das Case Management direkt von HALMA e.V. mittels der geronto-<br />
psychiatrischen Fachpflegekräfte für die Klienten im Raum Würzburg angeboten und<br />
durchgeführt wird (anstelle der Ansiedlung von Fallmanagerinnen in den jeweiligen<br />
ambulanten Pflegediensten). Im Vergleich zu AGFM handelt es sich dabei<br />
ausschließlich um gerontopsychiatrische Fachpflegekräfte.<br />
„Das Konzept der <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Behandlungspflege stellt eine gelungene<br />
Verknüpfung von psychiatrischer Pflege und der Arbeitsweise des Case Manage-<br />
ment aus der Sozialarbeit dar. Dieser Arbeitsansatz setzt damit die Ziele der<br />
psychiatrischen Pflege wie die Verbesserung der Lebensqualität psychisch<br />
erkrankter älterer Menschen in ihrer häuslichen Umgebung, den Erhalt bzw. die<br />
Förderung der Ressourcen und Kompetenzen, die Stärkung des Selbstwertgefühls<br />
um und versucht hierdurch die Abhängigkeit von Fremdhilfe möglichst gering zu<br />
halten. Das Case Management koordiniert die vorhandenen Einrichtungen der<br />
85
Altenhilfe im Sinne einer anwaltlichen Unterstützung einer bedürfnis- und patienten-<br />
orientierten Betreuung der Patienten“ (Weber 2003, S.51).<br />
Die Prozessschritte des Case Managements werden dabei eingesetzt:<br />
• Einschätzung der individuellen Bedürfnisse<br />
Es erfolgt zunächst ein umfassendes Assessment. Hier wird der Hilfebedarf im<br />
Einzelfall nach pflegerischen, medizinischen, hauswirtschaftlichen, sozialen und<br />
finanziellen Aspekten festgelegt.<br />
• Entwicklung des individuellen Versorgungspaketes<br />
Ein symptombezogener individueller Hilfeplan wird aufbauend auf den Ressourcen<br />
der Klienten, den eigenen Kompetenzen und bestehenden Hilfen erstellt.<br />
• Sicherstellung des Zugangs zu den ermittelten Hilfen<br />
Bei gerontopsychiatrischen Patienten beinhaltet dieser Arbeitsschritt die Erarbei-<br />
tung der Hilfeannahme und die Befähigung der Pflegepersonen im Umgang mit<br />
dem Patienten.<br />
• Qualitätssicherung, Koordination und Absprachen<br />
Dies wird erreicht durch regelmäßige Zielkontrollen und Rückmeldungen.<br />
• Anpassung des Hilfeplans<br />
Wenn das Hilfeniveau verändert werden muss kann es zur Ausweitung oder<br />
Reduzierung der Hilfen kommen (vgl. ebd. S.52f).<br />
Falls es zu einer Übernahme der gerontospsychiatrischen Behandlungspflege und<br />
somit dem Case Management durch HALMA e.V. kommt, gilt es zunächst einmal, ein<br />
Vertrauensverhältnis zum Patienten herzustellen. In der praktischen Umsetzung<br />
bedeutet dies, dass die gerontopsychiatrische Pflegefachkraft Kontakt zum Klienten<br />
aufnimmt und ihn regelmäßig besucht. Um ein Vertrauensverhältnis zu schaffen,<br />
findet hierbei eine enge Begleitung statt. Die Fachkraft kommt in der Regel zwei- bis<br />
dreimal in der Woche für zwei bis drei Stunden zu verschiedenen Tageszeiten. Dabei<br />
konzentriert sich die Fachkraft auf den Patienten und stellt ihn und seine Erlebniswelt<br />
in den Mittelpunkt. Über die enge Alltagsbegleitung wird es der Fachkraft möglich,<br />
Handlungsroutinen aber auch Störfaktoren im Alltag des Betroffenen zu erkennen.<br />
86
Außerdem kann sie ausprobieren, auf welche Impulse die Klienten ansprechen (das<br />
Umlegen einer Schürze signalisiert beispielsweise, dass Hausarbeit angesagt ist).<br />
Gemeinsame Einkäufe werden getätigt. Hierdurch kann z.B. festgestellt werden,<br />
inwieweit der Patient noch in der Lage ist, sich zu orientieren. Im gemeinsamen<br />
Alttagshandeln kristallisiert sich heraus, welche Hilfen im konkreten Fall erforderlich<br />
sind und wie die Hilfen angelegt sein sollten (vgl. Weber 2003, S.53). Zudem können<br />
sich die Patienten durch diese Vorgehensweise als kompetente Wesen erleben, was<br />
auch zur Stärkung des Selbstwertgefühls beiträgt. Ressourcen sollen beim Patienten<br />
dadurch soweit als möglich geweckt und zur Alltagsbewältigung eingesetzt werden<br />
(vgl. ebd. S.55).<br />
Erforderliche Hilfen hält die Pflegefachkraft in einem individuellen Hilfeplan fest. Falls<br />
noch nicht im Einsatz, werden weitere Pflegepersonen eingeführt, wie etwa die<br />
ambulanten Pflegedienste für die Grundpflege. In einer Helferkonferenz werden<br />
Hilfen und Vorgehensweise aufeinander abgestimmt sowie die Finanzierung von<br />
Hilfen besprochen. Hier werden auch Themen wie Beantragung zur Einstufung nach<br />
der Pflegeversicherung oder Einrichtung einer amtlichen Betreuung aufgegriffen. Die<br />
eingesetzten Pflegepersonen erhalten fachliche Unterstützung von der Fach-<br />
pflegekraft, damit sie wissen, wie ihre Hilfen von den Klienten angenommen werden.<br />
Bei der Übernahme der gerontopsychiatrischen Behandlungspflege wird ein so-<br />
genanntes „Patientenheft“ angelegt. Darin werden systematisch pflegerelevante<br />
Informationen festgehalten (vgl. ebd. S.55). In einer von HALMA e.V. entwickelten<br />
Verlaufsdokumentation werden alle durchgeführten Hilfen aufgezeichnet. Durch die<br />
Erstellung des Hilfeplanes und der Einführung der Pflegepersonen wird die geronto-<br />
psychiatrische Behandlungspflege vervollständigt. Sind erforderliche Hilfen ein-<br />
geleitet, zieht sich die Fachkraft schleichend aus dem Pflegeprozess zurück und<br />
steht als Ansprechpartner für Angehörige, Helfer und Mitarbeiter ambulanter Dienste<br />
zur Verfügung (vgl. Weber 2003, S. 56).<br />
Allerdings gibt es auch Grenzen der <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Behandlungspflege.<br />
Diese sind erreicht, wenn<br />
• eine Herstellung einer Vertrauensbasis nicht gelingt,<br />
• die Hilfeannahme trotz intensiver Bemühungen abgelehnt oder aus finanziellen<br />
Gründen nicht zugelassen wird,<br />
• der Schweregrad der Erkrankung zu hoch ist und eine „Rund-um-die-Uhr-<br />
Versorgung“ (v.a. bei allein lebenden älteren Menschen) notwendig ist,<br />
87
• keine verlässlichen Bezugspersonen gefunden werden können.<br />
Bei einer Bewertung der Langzeitpflege im Verbund Würzburg zeigte sich, dass<br />
aufgrund der gerontopsychiatrischen Behandlungspflege die Hälfte der bearbeiteten<br />
Fälle länger zu Hause verweilen kann (vgl. Weber 2003, S.56).<br />
Aus der Darstellung des Konzeptes der „<strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Behandlungspflege"<br />
wird ersichtlich, dass im Vergleich zu AGFM in diesem Ansatz ein zeitintensiveres<br />
Fallmanagement statt findet. Dies ist möglich, da ein Case Management gesondert<br />
durch die gerontopsychiatrischen Fachpflegekräfte erfolgt und lediglich die Grund-<br />
pflege von den ambulanten Pflegediensten übernommen wird. Die Schwierigkeiten in<br />
der Versorgung gerontopsychiatrischer Patienten ergeben sich aus dem Zusammen-<br />
wirken von somatischen und psychischen Erkrankungen. Sie erfordern einen um-<br />
fassenden ganzheitlichen Pflegeansatz, der ein hohes Maß an fachlicher und<br />
sozialer Kompetenz bei den Pflegenden verlangt (vgl. Weber 2003, S.57). Deswegen<br />
scheint eine Trennung von Case Management und der Grundpflege ( ausgeführt von<br />
den ambulanten Pflegediensten) sinnvoll zu sein. Zum einen kann eine ausgebildete<br />
gerontopsychiatrische Fachkraft sich einem qualitativ hochwertigen Case<br />
Management widmen und zum anderen können Mitarbeiter von ambulanten<br />
Pflegediensten sich auf die Grundpflege konzentrieren, ohne unter Zeitdruck noch<br />
weitere Aufgaben übernehmen zu müssen. Vielmehr können sie die Unterstützung<br />
der gerontopsychiatrischen Fachpflegekraft für ihre Tätigkeit in Anspruch nehmen,<br />
was als Entlastung bei der ohnehin knapp bemessenen Pflegezeit begriffen werden<br />
kann. Für das Konzept der Behandlungspflege spricht zudem, dass es sich seit<br />
nunmehr zehn Jahren als Arbeitsansatz in der ambulanten Versorgung<br />
gerontopsychiatrischer Patienten bewährt hat (vgl. Weber 2003, S.57).<br />
In Mittelfranken gab es weiterhin Bemühungen, ein von der GeFa entwickeltes<br />
Konzept in der ambulanten gerontopsychiatrischen Versorgungslandschaft um-<br />
zusetzen. Es handelt sich dabei um die sogenannte „Ambulante Geronto-<br />
psychiatrische Pflege in Mittelfranken“. Das Konzept sollte über die Pflegekassen<br />
finanziert werden. Da eine Finanzierung von dieser Seite aktuell abgelehnt wurde,<br />
findet eine Implementierung der „<strong>Ambulanten</strong> <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Pflege“ in<br />
Mittelfranken nicht statt. Daher möchte ich nur kurz auf die konzeptionellen Inhalte<br />
eingehen. Als gesetzliche Grundlage für diesen Ansatz galt § 37 Absatz 1 und 2<br />
i.V.m. 132a SGB V in der seit dem 01. Juli 2005 die Verordnungsfähigkeit der<br />
ambulanten Psychiatrischen Krankenpflege bundeseinheitlich geregelt ist. Zudem<br />
88
erfolgte 2008 eine Ergänzung der „Richtlinien über die Verordnung von häuslicher<br />
Krankenpflege“ nach §92 Abs.1 Satz 2 Nr.6 und Abs.7 SGB V um die Leistung<br />
ambulanter psychiatrischer Pflege (vgl. Lezius 2009, S. 39ff ). Wesentlich an dem<br />
Konzept ist, dass eine Kooperationsvereinbarung zwischen ambulanten Pflege-<br />
diensten, Sozialpsychiatrischen Diensten und <strong>Angehörigenberatung</strong> Nürnberg e.V.<br />
bzw. GeFa vorgesehen war. Als Kooperationspartner sollte ein ambulanter Pflege-<br />
dienst die gerontopsychiatrische Pflege beim Betroffenen übernehmen. An-<br />
forderungsprofil der Pflegekassen war, dass es sich hierbei um einen eigenständigen<br />
gerontopsychiatrischen Pflegedienst handeln müsse, der mindestens fünf<br />
Pflegefachkräfte mit gerontopsychiatrischer Zusatzausbildung vorweisen kann.<br />
Anders als bei dem Modell in Würzburg sollte der zuständige sozialpsychiatrische<br />
Dienst das Case Management durch geschulte Fachkräfte (Sozialpädagogen mit<br />
Zusatzausbildung) bei Bedarf übernehmen und die <strong>Angehörigenberatung</strong> Nürnberg<br />
e.V. die Beratung und Belange der Angehörigen vertreten. Die Verordnung der<br />
ambulanten gerontopsychiatrischen Pflege war entweder vorgesehen durch einen<br />
Facharzt (Neurologie, Psychiatrie), oder einen Hausarzt bei erfolgter Diagnose-<br />
stellung durch einen Facharzt. Die Zielgruppe wurde im Vergleich zum Projekt AGFM<br />
erweitert und zwar zusätzlich zu Demenz und Depressiven Störungen um die<br />
Diagnosegruppen bipolare affektive Störungen, Angststörungen, wahnhafte<br />
Störungen, Schizophrenie und Suchtkranke (vgl. Lezius 2009, S. 39ff). Eine Hürde<br />
beim Konzept war laut Aussagen der GeFa von Beginn an, einen eigenständigen<br />
gerontopsychiatrischen Pflegedienst mit den genannten Anforderungen als<br />
Kooperationspartner bei den Kassen vorweisen zu können. Es bestanden<br />
Überlegungen einen „virtuellen“ Dienst aufzubauen. Dies hätte bedeutet, dass sich<br />
mehrere Pflegedienste mit den entsprechenden Fachkräften zusammenschließen zu<br />
einem Dienst. Ob dieses Vorhaben umgesetzt hätte werden können bleibt fraglich<br />
und ist in Anbetracht der Tatsache einer Ablehnung seitens der Pflegekassen<br />
hinfällig. Vermutet wird von den Mitarbeiterinnen der GeFa, dass die Pflegekassen<br />
aufgrund großer finanzieller Belastungen dem Konzept nicht statt gaben.<br />
„Grünes Licht“ für die Implementierung eines gerontopsychiatrischen Case Manage-<br />
ments im ambulanten Bereich Mittelfranken wurden nach neuesten Informationen,<br />
die sich im Gespräch mit der GeFa-Mitarbeiterin ergaben (10.11.2009), von anderer<br />
Stelle gegeben: Im Sozialausschuss des Bezirks Mittelfranken wurde dem Antrag<br />
verschiedener sozialpsychiatrischer Dienste, eigene Fachstellen für Case Manage-<br />
89
ment zu errichten, stattgegeben. Das heißt, das ab Januar 2010 nach und nach bei<br />
den sozialpsychiatrischen Diensten Stellen für Sozialpädagogen vom Bezirk ge-<br />
schaffen und finanziert werden, die ein Case Management in diesem Sektor an-<br />
bieten. Geplant ist, dass die GeFa Mfr. bzw. die <strong>Angehörigenberatung</strong> Nürnberg e.V.<br />
die Schulungen zum Case Management für die Mitarbeiter der geplanten Stellen<br />
vornimmt. Leider liegt der GeFa zu diesen neuesten Entwicklungen noch keine<br />
verbindliche schriftliche Information vor.<br />
5.3.2 Strukturwandel in den ambulanten Pflegediensten<br />
Im Projekt AGFM sind die ambulanten Pflegedienste Projektpartner für das Case<br />
Management. Wie bereits dargestellt, ist ein „unabhängiges“ Case Management aus<br />
den genannten Gründen - anders als im Projekt durchgeführt - von Vorteil. Auch die<br />
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Case Management fördern diese<br />
Entwicklung. Die zum 01.07.2008 in Kraft getretene Reform der Pflegeversicherung<br />
(Pflegeweiterentwicklungsgesetz), sieht in §92c SGB XI die Möglichkeit vor, in den<br />
Bundesländern sogenannte Pflegestützpunkte zu errichten. Hierdurch soll eine<br />
wohnortnahe Beratung, Versorgung und Betreuung der Versicherten erfolgen. Die<br />
Entscheidung über die Etablierung von Pflegestützpunkten liegt bei den obersten<br />
Landesbehörden, in Bayern beim Sozialministerium, das derzeit eine Errichtung der<br />
Pflegestützpunkte über die Pflegekassen plant (vgl. www.pflegen-online.de/-<br />
nachrichten..., Stand 16.11.2009). Wie bereits in Punkt 3.2.2 geschildert, gibt es<br />
hinsichtlich der Implementierung und der Ausgestaltung noch Klärungsbedarf. Es ist<br />
verständlich, dass es seitens der ambulanten Pflegedienste aufgrund der geplanten<br />
Pflegestützpunkte kaum Bemühungen gibt, Case Management eigenständig in ihren<br />
Diensten anzubieten. Dies könnte auch ein Grund dafür sein, dass das Projekt<br />
AGFM im zweiten Anlauf nur wenig von den ambulanten Diensten angenommen<br />
wird. Da durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz (PFWG) Case Management-<br />
Strukturen in der Pflege verbindlich gemacht werden und ambulante Dienste<br />
zukünftig Netzwerkpartner im Case Management-Geschehen sein werden, ist ein<br />
Strukturwandel bzw. ein neues Selbstverständnis in den ambulanten Diensten<br />
trotzdem eine unabdingbare Voraussetzung. Es muss daher eine qualitative Weiter-<br />
entwicklung des Dienstleistungsangebots der ambulanten Pflege erfolgen, um ein<br />
optimales, auf die Bedarfe des Kunden zugeschnittenes Leistungsangebot ver-<br />
mitteln zu können. Die Qualität der ambulanten Dienste ist dabei auch für deren<br />
90
wirtschaftliches Überleben entscheidend. Das Hauptaugenmerk der ambulanten<br />
Dienste muss sich abwenden von der Berufsgruppe der Mediziner als Nachfrager<br />
von pflegerischen Dienstleistungen und sich auf die Patienten als „Koproduzenten<br />
der Pflege“ richten. Deswegen hat sich die ambulante Pflege spezialisierten<br />
Modellen und Konzepten zu widmen (vgl. Hasseler, Meyer 2004, S.9). Gerade im<br />
Hinblick auf die gerontopsychiatrische Versorgung herrscht bei den ambulanten<br />
Pflegediensten dringend Handlungsbedarf. Derzeit ist noch ein mangelndes<br />
gerontopsychiatrisches Fachwissen in der pflegerischen Aus- Fort- und Weiter-<br />
bildung festzustellen (vgl. Kuhlmann 2005, S.42). Dieser Umstand spiegelt sich auch<br />
in der Befragung der Teilnehmerinnen an AGFM wider (siehe Punkt 5.2), bei der die<br />
Grundqualifikation abgefragt wurde. Lediglich vier der Befragten hatten eine<br />
gerontopsychiatrische Zusatzausbildung.<br />
Immer noch zielen Leistungen der ambulanten Pflegedienste vorrangig auf die<br />
Befriedigung physischer Grundbedürfnisse ab, was bei gerontopsychiatrischen<br />
Patienten alleine nicht ausreicht. Bei dieser Zielgruppe stehen zunächst Bedürfnisse<br />
nach Sicherheit, Geborgenheit und Anerkennung im Vordergrund. Erst nach<br />
Realisierung dieser Aspekte im Rahmen der Pflegebeziehung kann sich ein<br />
gerontopsychiatrischer Patient auf somatische oder hauswirtschaftliche Hilfen<br />
einstellen (vgl. Weber & Oppl 1997, S.84). Um sich in diesem Bereich zu<br />
positionieren, bedarf es eines vermehrten Einsatzes gerontopsychiatrischer Pflege-<br />
fachkräfte in den ambulanten Diensten. Denn nur fachlich geschultes Personal ist in<br />
der Lage, die Situation des Erkrankten professionell einzuschätzen und als Netz-<br />
werkpartner für ein Case Management dementsprechend zu agieren. Des Weiteren<br />
wäre es sinnvoll, Schulungen zum Konzept des Case Managements für die<br />
Mitarbeiter von ambulanten Diensten zu ermöglichen, um ihnen die Notwendigkeit<br />
der Netzwerkarbeit zu verdeutlichen. Das Konzept AGFM der gerontopsychiatrischen<br />
Fachkoordination Mittelfranken hat in jedem Fall einen Beitrag hinsichtlich der<br />
gerontopsychiatrischen Schulung von Mitarbeitern der Dienste und der Sensibili-<br />
sierung für das Thema Case Management geleistet. Als Modellprojekt ist es allein<br />
jedoch nicht geeignet, Strukturen in ambulanten Pflegediensten zu verändern. Viel-<br />
mehr müssen die ambulanten Pflegedienste von sich aus erkennen, dass ihr<br />
weiteres Fortbestehen von Weiterentwicklungsbemühungen hin zu einer qualifi-<br />
zierten gerontopsychiatrischen Pflegebegleitung in der sich zukünftig gestaltenden<br />
Versorgungslandschaft abhängig sein wird. Unterstützung brauchen die ambulanten<br />
91
Pflegedienste hierbei auch in finanzieller Hinsicht: Experten bemängeln, dass der<br />
ambulante Pflegebereich, trotz der demografischen Entwicklungen und dem Wandel<br />
der Versorgungsstrukturen, in den letzten Jahren unter dem restriktiven Einsparungs-<br />
willen der Kassen gelitten hat. Dies hatte eine Flut von Insolvenzen von ambulanten<br />
Pflegediensten zur Folge (Ludwig 2004, S.17). Aufgrund erhöhter Anforderungen,<br />
wie etwa im Bereich des Qualitätsmanagements, die aus einer Vielzahl von<br />
Gesetzesänderungen resultierten, haben mittlerweile viele Dienste ihre Rationali-<br />
sierungsreserven weitgehend aufgebraucht (vgl. ebd.).<br />
„Diese von einem Bürokratiewahn begleitete Fremdbestimmung, hat in ihrer Folge<br />
Unmengen von Energie der Leistungserbringer verschlungen und dazu geführt,<br />
dass die Zunahme von Administration zu Lasten der direkten Pflege vor Ort ging,<br />
u.a. hierdurch die Berufszufriedenheit der Pflegekräfte deutlich abgenommen hat<br />
und wesentliche Innovationen auf der Strecke geblieben sind“ (Ludwig 2004, S.17).<br />
Die Finanzierung von ambulanten Pflegediensten wird zu mehr als Drei Viertel von<br />
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung übernommen. Die ent-<br />
sprechenden Regelungen dieser Leistungssysteme stellen die entscheidenden öko-<br />
nomischen Rahmenbedingungen der ambulanten Pflege dar. Erbrachte Leistungen<br />
für ambulante Pflege von den Diensten werden als sogenannte Pflegesachleistungen<br />
von der gesetzlichen Pflegeversicherung in begrenzter Höhe übernommen, wobei<br />
hier eine Staffelung der maximalen Leistungshöhen nach dem Schweregrad der<br />
Pflegebedürftigkeit erfolgt. Die Leistungshöhen wurden seit Verabschiedung des<br />
Pflegeversicherungsgesetzes im Mai 1994 nicht erhöht, obwohl Personalkosten<br />
stetig anstiegen und der Bedarf an ambulanter Versorgung wächst. Die maximalen<br />
Leistungshöhen waren bisher nicht bedarfsdeckend (vgl. Rothgang 2004, S. 37f).<br />
Nach langen Verhandlungen konnte sich die große Koalition 2008 auf Eckpunkte bei<br />
der Pflegereform verständigen. Erst seitdem ist der Beitragssatz zur Pflege-<br />
versicherung zum 1.Juli 2008 um 0,25 Punkte auf 1,95% des Bruttolohns gestiegen.<br />
Zeitgleich mit dem Beschluss der Pflegestützpunkte ist vorgesehen, dass die Beträge<br />
für ambulante Sachleistungen bis 2012 stufenweise angehoben werden: In der<br />
Pflegestufe I von 384 auf 450 Euro, in der Pflegestufe II von 921 auf 1100 Euro und<br />
in der Stufe III von 1432 auf 1550 Euro im Monat (vgl. http://www.focus.de/<br />
finanzen/versicherungen/pflegereform..., Stand 16.11.09). Inwieweit die ambulanten<br />
Pflegedienste von dieser Entwicklung profitieren können, wird sich erst in Zukunft<br />
zeigen.<br />
92
6. Fazit und Ausblick<br />
In der vorliegenden Arbeit wurde das Modellprojekt „Ambulantes Geronto-<br />
psychiatrisches Fallmanagement (AGFM)“ der GeFa Mittelfranken vorgestellt und<br />
evaluiert.<br />
Insgesamt betrachtet hatte das Fallmanagement - sofern ein Zugang zu den<br />
Betroffenen und deren Familien hergestellt werden konnte - einen eindeutig positiven<br />
Effekt auf die Lebenssituation der Erkrankten und deren Angehörige ergeben.<br />
Allerdings kristallisierte sich im Verlauf der vorliegenden Arbeit heraus, dass<br />
ambulante Pflegedienste als durchführende Organe für das Case Management nicht<br />
in erster Linie in Frage kommen bzw. geeignet sind. Dies konnte nicht alleine durch<br />
die vorgenommene Befragung der Fallmanagerinnen, die im Projekt tätig waren,<br />
geklärt werden, sondern muss auch mit den dargestellten gesetzlichen und<br />
strukturellen Entwicklungen im Zusammenhang bewertet werden. Die Beendigung<br />
des Projektes nach Ablauf des zweiten „Durchgangs“ seitens der GeFa bestätigt<br />
diesen Eindruck. Ebenso die Weiterentwicklungsbemühungen der Einrichtung be-<br />
züglich neuer Konzepte zeigen, dass AGFM als Projekt für die Zukunft nicht<br />
richtungsweisend sein kann. Aufgrund der positiven Effekte für die Betroffenen kann<br />
jedoch nicht von einem Scheitern des Projektes gesprochen werden. Vielmehr muss<br />
darauf verwiesen werden, dass AGFM als eines von vielen Modellprojekten in<br />
Deutschland ein Versuch war, Case Management in der gerontopsychiatrischen<br />
Versorgungslandschaft zu erproben. Dies entspricht dem Stand der bisherigen<br />
Verwendung von Case Management in der Altenhilfe (vgl. Kuhlmann 2005, S.84).<br />
Der Start des Projektes erfolgte 2006, also noch vor der Reform der Pflege-<br />
versicherung mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (01. Juli 2008), das Case<br />
Management-Strukturen in der Pflege nun verbindlich macht und andere Ent-<br />
wicklungen bezüglich Case Management vorantreibt. In Bayern hat Sozialministerin<br />
Christine Haderthauer erst am 30. Oktober 2009 den Startschuss zur Errichtung von<br />
Pflegestützpunkten in Bayern gegeben, die im Pflegeweiterentwicklungsgesetz fest-<br />
geschrieben sind und in Zukunft das Case Management für die Betroffenen anbieten<br />
sollen (vgl.http://www.pflegen-online.de/nachrichten..., Stand 16.11.2009) Mit der<br />
vom Sozialministerium erlassenen Allgemeinverfügung tritt nun auch in Bayern die<br />
bundesrechtlich vorgesehene Verpflichtung der Kranken- und Pflegekassen, Pflege-<br />
stützpunkte einzurichten, in Kraft. Die Allgemeinverfügung sieht in Bayern die<br />
Errichtung von bis zu 60 Pflegestützpunkten vor, die in allen Regierungsbezirken,<br />
93
sowohl in ländlich strukturierten Regionen als auch in städtischen Ballungsräumen<br />
angesiedelt werden sollen (vgl.http://www.stmas.bayern.de..., Stand 16.11.2009).<br />
„§92c Abs.2 Satz2 und 3SGB XI verpflichtet die Pflegekassen, bei der Errichtung<br />
von Pflegestützpunkten auf vorhandene vernetzte Strukturen zurückzugreifen. Mit<br />
der Festschreibung, dass vorhandene vernetzte Beratungsstrukturen die Möglich-<br />
keit haben müssen, sich in die Pflegestützpunkte zu integrieren, wird diesem<br />
gesetzlichen Auftrag Rechnung getragen. In Bayern besteht ein vernetztes Be-<br />
ratungsangebot durch die staatlich geförderten Fachstellen für pflegende<br />
Angehörige“ (http://www.stmasbayern.de..., Stand 16.09.2009).<br />
Hiermit soll eine Vermeidung von eventuellen Doppelstrukturen - was wiederum zur<br />
Unübersichtlichkeit für die Betroffenen führen würde - gewährleistet werden. Dazu<br />
äußerte sich auch Sozialministerin Haderthauer:<br />
„Ich erwarte, dass bei der konkreten Ausgestaltung vor Ort Neutralität und Qualität<br />
der Beratung gewährleistet ist. Wichtig ist, dass einheitliche Anlaufstellen<br />
geschaffen werden, ohne bereits bestehende und gewachsene Strukturen zu<br />
zerschlagen. Neben der Beteiligung der Kranken- und Pflegekassen und der<br />
Kommunen sollen auch die Fachstellen für pflegende Angehörige die Möglichkeit<br />
erhalten, sich in die Pflegestützpunkte zu integrieren“ (http://www.pflegen-<br />
online.de/nachrichten..., Stand 16.11.2009).<br />
Wie diese Integration vorhandener Strukturen stattfinden soll, ist allerdings laut der<br />
GeFa noch nicht geklärt und es bestehen diesbezüglich noch viele Unsicherheiten.<br />
Die Entwicklung der Pflegestützpunkte ist als Antwort auf ein neues Pflege-<br />
verständnis - wie bereits in dieser Arbeit dargestellt - sicherlich positiv zu bewerten,<br />
v.a. auch im Hinblick auf eine ambulante gerontopsychiatrische Versorgung. Dieses<br />
neue Verständnis entspricht auch den Forderungen, die seit einigen Jahren aus<br />
Fachkreisen an die Politik herangetragen wurden. Modellprojekte wie das<br />
„Ambulante Gerontopsychiatrische Fallmanagement“ der GeFa Mittelfranken und<br />
andere Projekte in Deutschland, die eine Vernetzung durch Case Management in der<br />
Altenhilfe anstreben, können durchaus als Wegbereiter für die neuen gesetzlichen<br />
Entwicklungen gesehen werden. Abzuwarten bleibt in Zukunft, ob durch die Er-<br />
richtung der Pflegestützpunkte in der Pflegerealität tatsächlich eine an den<br />
Bedürfnissen der Betroffenen zugeschnittene Dienstleistung erfolgt. Die von Hadert-<br />
hauer erhoffte Neutralität der Pflegeberater bei den Stützpunkten ist in Frage zu<br />
stellen, da diese bei den Pflegekassen angesiedelt sind. Dadurch besteht die Gefahr<br />
94
dass kassenorientierte und nicht wirklich bedarfsorientierte Beratung im Vordergrund<br />
steht. Dies wurde auch in der Zeitschrift „Pflege Konkret“ in einer ersten Bilanz zur<br />
Einführung der Pflegestützpunkte so bewertet:<br />
„Wenn Stützpunkte bei den Kostenträgern angesiedelt sind, ist sowohl für den<br />
Versicherten als auch für pflegende Angehörige die Situation der Vergangenheit<br />
einer kassenorientierten und nicht personenbedarfsorientierten Beratung fort-<br />
geschrieben“ (Ausgabe 07/2009, S.2).<br />
Diese Kritik darf daher bei der Umsetzung der Pflegestützpunkte in Bayern nicht<br />
unberücksichtigt bleiben. Da die Stützpunkte in ihrer Entwicklung erst am Anfang<br />
stehen, wird sich erst in Zukunft zeigen, ob sie die geeignete Antwort sind auf die<br />
Notwendigkeiten und Herausforderungen, welche die eingangs erwähnte demo-<br />
grafische Entwicklung - auch im gerontopsychiatrischen Bereich - mit sich bringt.<br />
Eine Evaluation diesbezüglich könnte auch Thema für eine weiterführende Arbeit<br />
sein.<br />
95
7. Literatur<br />
Bäcker,G., Bispinck, R., Hofemann, K. & Naegele, G. (2000).Sozialpolitik und soziale<br />
Lage in Deutschland. Bd. 2. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.<br />
Bickel, H. (2001). Epidemologie von Demenz und Pflegebedürftigkeit. In Bickel, H.<br />
(Hrsg.). Demenz und Pflegebedürftigkeit. Beiträge zum gemeinsamen Symposium<br />
von Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen<br />
Universität München und Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Bayern.<br />
Berlin: Meta Data.<br />
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.).<br />
(2002). Vierter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik<br />
Deutschland: Risiken, Lebensqualität und Versorgung Hochaltriger - unter<br />
besonderer Berücksichtigung demenzieller Erkrankungen. Bonn: Bonner<br />
Universtitäts-Buchdruckerei.<br />
Engel, H. & Engels, D. (2000). Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und<br />
Jugend (Hrsg.). Case Management in verschiedenen nationalen Altenhilfesystemen.<br />
Stuttgart: Kohlhammer-Verlag.<br />
Engel, S. (2006). Alzheimer und Demenzen. Unterstützung für Angehörige. Stuttgart:<br />
Trias-Verlag.<br />
Ewers, M. & Schaefer, D. (2000). Einleitung: Case Management als Innovation im<br />
deutschen Sozial- und Gesundheitswesen. In: Ewers, M. & Schaefer D. (Hrsg.).<br />
Case Management in Theorie und Praxis. Bern: Huber.<br />
Ewers, M. (2000). Case Management im Schatten von Managed Care: Sozial- und<br />
gesundheitspolitische Grundlagen. In: Ewers, M. & Schaefer D. (Hrsg.). Case<br />
Management in Theorie und Praxis. Bern: Huber.<br />
96
Ewers, M. (2000). Das anglo-amerikanische Case Management: Konzeptionelle und<br />
methodische Grundlagen. In: Ewers, M. & Schaefer D. (Hrsg.). Case Management in<br />
Theorie und Praxis. Bern: Huber.<br />
Frommelt, M., Klie, Th., Löcherbach, P., Mennemann, H., Monzer, M., Wendt.,W. R.<br />
(2008). Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management (dgcc) (Hrsg.).<br />
Pflegeberatung, Pflegestützpunkte und das Case Management. Die Aufgaben<br />
personen- und familienbezogener Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und ihre<br />
Realisierung in der Reform der Pflegeversicherung. Freiburg i. Br.: Verlag<br />
Forschung - Entwicklung - Lehre (FEL).<br />
Füsgen, I. (1996). Der ältere Patient. Problemorientierte Diagnostik und Therapie. 2.<br />
Auflage: München; Wien; Baltimore: Urban & Schwarzenberg.<br />
Gerontopsychiatrische Fachkoordination (GeFa) Mfr./ <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V.<br />
Nürnberg (2009). Abschlussbericht „Ambulantes gerontopsychiatrisches<br />
Fallmanagement“ (AGFM). Ein Angebot für ältere Menschen in Mittelfranken mit<br />
Demenz oder Depression.<br />
http://angehoerigenberatung-nbg.de/uploads/media/Abschlussbericht_AGFM.pdf.<br />
Gerontopsychiatrische Fachkoordination (GeFa) Mfr./ <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V.<br />
Nürnberg (2006). Projektbeschreibung. Fallmanagement für gerontopsychiatrisch<br />
erkrankte Menschen in der häuslichen Versorgung. Unveröffentlichtes Manuskript.<br />
Gerontopsychiatrische Fachkoordination (GeFa) Mfr./ <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V.<br />
Nürnberg (2004). Konzept der GeFa Mittelfranken (Gerontopsychiatrische<br />
Fachkoordination) der <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V. Nürnberg.<br />
http://www.agvb.de/ pdf/konzept_gefa_nuernberg.pdf.<br />
Hasseler M., Meyer M. (2004). Einführung: Ambulante Pflege vor neuen<br />
Herausforderungen. In: Hasseler M., Meyer M. (Hrsg.). Ambulante Pflege: Neue<br />
Wege und Konzepte für die Zukunft. Professionalität erhöhen - Wettbewerbsvorteile<br />
sichern. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.<br />
97
Häfner H. (1994) Psychiatrie des höheren Lebensalters. In: Baltes P.B., Mittelstraß<br />
J., Staudinger U.M. (Hrsg.) Alter und Altern. Berlin New York: de Gruyter.<br />
Kleve H. (2008). Methodische Grundlagen Sozialer Arbeit. Eine fragmentarische<br />
Skizze. In: Kleve H., Haye B., Hampe-Grosser A., Müller M. Systemisches Case<br />
Management. Falleinschätzung und Hilfeplanung in der sozialen Arbeit. 2. Auflage.<br />
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.<br />
Klie, Th. (2008). Vorwort. In: Frommelt, M., Klie, Th., Löcherbach, P., Mennemann,<br />
H., Monzer, M., Wendt., W. R. Deutsche Gesellschaft für Care und Case<br />
Management (dgcc) (Hrsg.). Pflegeberatung, Pflegestützpunkte und das Case<br />
Management. Die Aufgaben personen- und familienbezogener Unterstützung bei<br />
Pflegebedürftigkeit und ihre Realisierung in der Reform der Pflegeversicherung.<br />
Freiburg i. Br.: Verlag Forschung - Entwicklung - Lehre (FEL).<br />
Klug, W. (2003). Mit Konzept planen - effektiv helfen. Ökosoziales Case<br />
Management in der Gefährdetenhilfe. Freiburg i.Br.: Lambertus-Verlag.<br />
Kuhlmann, A. (2005). Case Management für demenzkranke Menschen. Eine<br />
Betrachtung der gegenwärtigen praktischen Umsetzung. Münster: Lit Verlag.<br />
Lezius M. & Schröter B. (2009). „Ambulante gerontopsychiatrische Pflege - was ist<br />
nötig, was ist möglich“. Ein Workshop. In: GeFa. Tagungsdokumentation zum 8.<br />
Fachtag Gerontopsychiatrie. „Lebensqualität und Demenz“. Ideen für den<br />
ambulanten, teilstationären und stationären Alltag. Nürnberg, 14.05.2009.<br />
Eigenverlag.<br />
Löcherbach P. (2009). Qualifizierung im Case Management. Bedarf und Angebote.<br />
In: Löcherbach P., Klug W., Remmel-Faßbender R., Wendt W.R. (Hrsg.). Case<br />
Management. Fall- und Systemsteuerung in Theorie und Praxis. 4. Auflage.<br />
München: Ernst Reinhardt Verlag.<br />
.<br />
Ludwig, A. (2004). Pflege und Begleitung in der Lebenswelt gerontopsychiatrisch<br />
veränderter Menschen - Herausforderungen an die ambulante Pflege. Vortrag. In:<br />
98
GeFa. Tagungsdokumentation zum 3. Fachtag Gerontopsychiatrie. Einstellungen<br />
ändern - Strukturen anpassen. Nürnberg, 31.03.2004. Eigenverlag.<br />
Müller M. (2008). Verfahren (Techniken) und Struktur im Case-Management-<br />
Prozess. Theorie-Praxis-Handreichungen. In: Kleve H., Haye B., Hampe-Grosser A.,<br />
Müller M. Systemisches Case Management. Falleinschätzung und Hilfeplanung in<br />
der sozialen Arbeit. 2. Auflage. Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.<br />
Neuffer, M. (2002). Case Management. Soziale Arbeit mit Einzelnen und Familien.<br />
Weinheim und München: Juventa-Verlag.<br />
Nürnberger Nachrichten: Deutschland überaltert. 19.11.2009<br />
Pflege konkret. (Ausgabe 07/2009).<br />
Editorial. Ein Jahr Pflegeweiterentwicklungsgesetz. Zeitschrift des Deutschen<br />
Pflegeverbandes (DPV).<br />
Rothgang, H. (2004). Ökonomische Rahmenbedingungen der ambulanten Pflege. In:<br />
Hasseler M., Meyer M. (Hrsg.). Ambulante Pflege: Neue Wege und Konzepte für die<br />
Zukunft. Professionalität erhöhen - Wettbewerbsvorteile sichern. Hannover:<br />
Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.<br />
Schwartz, F.W. (2003) (Hrsg.). Das Public Health Buch. Gesundheit und<br />
Gesundheitswesen 2. Auflage. München: Urban & Fischer.<br />
Steiner-Hummel, I. (1995). Case Management in der Altenhilfe. In: Wendt, W.R.<br />
(Hrsg.). Unterstützung fallweise: Case Management in der Sozialarbeit. Freiburg i.<br />
Br.: Lambertus-Verlag.<br />
Van Riet, N., Wouters, H. (2001). Case Management. Ein Lehr und Arbeitsbuch über<br />
die Organisation und Koordination von Leistungen im Sozial- und<br />
Gesundheitswesen. Luzern: Interact Verlag.<br />
99
Weber, U. & Oppl, H, (1997). Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.).<br />
Modellprojekt Gerontopsychiatrisches Verbundnetz in der Altenhilfe Würzburg:<br />
Integration und ambulante Versorgung älterer Menschen mit psychischen Störungen.<br />
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.<br />
Weber, U. (2003). Halma e.V. hilft altersverwirrten Menschen. Vernetzung von<br />
ambulanten Hilfsangeboten. In: Füsgen I., Hallauer J., Frölich, L. (Hrsg). Demenz-<br />
auf dem Weg zu einem Disease-Management-Programm? 5. Workshop des<br />
„Zukunftforum Demenz“. Dokumentationsband 1. Wiesbaden: Medical Tribune<br />
Verlagsgesellschaft mbH.<br />
Wendt, W.R. (2008). Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Eine<br />
Einführung. 4. Auflage. Freiburg i.Br.: Lambertus-Verlag.<br />
Wendt, W.R. (2009). Case Management: Stand und Positionen in der<br />
Bundesrepublik. In: Löcherbach P., Klug W., Remmel-Faßbender R., Wendt W.R.<br />
(Hrsg.). Case Management. Fall- und Systemsteuerung in Theorie und Praxis. 4.<br />
Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag.<br />
Quellen aus dem Internet:<br />
Allgemeinverfügung zur Errichtung von Pflegestützpunkten in Bayern.<br />
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung,<br />
Familie und Frauen (22.10. 2009). Az.: III3/022/4/09.<br />
http://www.stmas.bayern.de/pflege/rechtsgrundlagen/pflegestuetzpunkte.pdf,<br />
Stand 16.11.2009.<br />
Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Die Epidemologie der Demenz.<br />
http://www.deutsche-alzheimer.de/index.php?id=37&no_cache=1&file=7&uid=224,<br />
Stand 09.05.2009.<br />
Die Prävalenz und Verteilung der Depression.<br />
(http://www.psychiatriegespraech.de/psychische_krankheiten/depression/depression<br />
_epidemiologie.php, Stand 22.10.2009)<br />
100
Focus-online-Magazin. Finanzen. Pflegereform. Höhere Beiträge, mehr Leistungen.<br />
(19.06.2007).<br />
http://www.focus.de/finanzen/versicherungen/pflegereform_aid_63809html,<br />
Stand 16.11.2009.<br />
Geriatrische Klinik St. Gallen. GDS Geriatrische Depressionsskala.<br />
http://www.buergerspital.ch/contento/LinkClick.aspx?fileticket=J4Aa%2BHAUo54%3<br />
D&tabid=196&mid=582, Stand 15.10.2009.<br />
Gesetzliche Pflegeversicherung.com. Wer ist pflegebedürftig? Die Definition per<br />
Gesetz. http://www.gesetzliche-pflegeversicherung.com/pflegebeduerftig.html,<br />
Stand 02.05.2009.<br />
Gesundheitsbericht zur <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Versorgung in Düsseldorf.<br />
(November 2001)<br />
http://www.duesseldorf.de/gesundheit/bericht/gerontopsychiatrie.pdf,<br />
Stand 09.05.2009.<br />
Löcherbach, P. Einsatz der Methode Case Management in Deutschland. Übersicht<br />
zur Praxis im Sozial und Gesundheitswesen. (24.05.2003). http://www.cms.uk-<br />
koeln.de/live/case-management/content/e59/LcherbachCMinDeutschland.pdf,<br />
Stand 01.03.2009.<br />
Pflegen-online.de. Startschuss für Pflegestützpunkte in Bayern. (30.10.2009).<br />
http://www.pflegen-online.de/nachrichten/aktuelles/startschuss-fuer-<br />
pflegestuetzpunkte-in-bayern.htm?PHPSESSID=a, Stand 16.11.2009.<br />
Perneczky, R.G. Kurze kognitive Tests (02.09.2003).<br />
http://deposit.ddb.de/cgi-<br />
bin/dokserv?idn=972057870&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=972057870.pdf,<br />
Stand 15.10.2009.<br />
wikipedia. Gerontopsychiatrie. http://de.wikipedia.org/wiki/Gerontopsychiatrie, Stand<br />
05.08.2009.<br />
101
Lebenslauf<br />
Name: Sabine Schöner<br />
Geburtsdatum: 08. Oktober 1968<br />
Familienstand: ledig<br />
Kinder: Paul 2001, Rebekka 2004<br />
Ausbildung:<br />
1975 – 1979 Grundschule Neualbenreuth<br />
1979 – 1981 Stiftlandgymnasium Tirschenreuth<br />
1981 – 1985 Klosterrealschule Waldsassen (mittlere Reife)<br />
1985 – 1988 Ausbildung zur Hotelfachfrau, Schlosshotel Ernestgrün<br />
1989 – 1991 Fachhochschulreife an der staatlichen FOS Bayreuth<br />
1991 – 1996 Studium der Sozialpädagogik an der Georg-Simon-Ohm-<br />
FH, Nürnberg; Schwerpunkt Jugendarbeit<br />
Seit 10/2005 Diplom-Aufbaustudium Psychogerontologie an der<br />
Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen<br />
Seit 10/2007 Master-Studiengang Gerontologie (M.Sc.) an der Friedrich<br />
Berufserfahrung<br />
Alexander Universität Erlangen (Teilzeitstudium;<br />
Fortführung des vorherigen Studiums)<br />
1988 – 1989 Arbeit als Hotelfachfrau im Schoßhotel Ernestgrün<br />
1996 – 2001 Arbeit als Diplom-Sozialpädagogin (FH) in der Maßnahme<br />
2001 – 2007 in Elternzeit<br />
ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) beim Internationalen<br />
Bund, Mathildenstr.40, 90762 Fürth<br />
2007 – 2009 Pädagogische Leitung des Schülertreffs beim<br />
Praktika<br />
Internationalen Bund, Mathildenstr.40, 90762 Fürth<br />
04/1993 – 07/1993 Studienbegleitendes Praktikum beim Reso-Kreis,<br />
Stadtmission Nürnberg: Betreuung von Strafgefangenen<br />
10/1993 – 02/1994 Auslandspraktikum in Israel in verschiedenen<br />
Einrichtungen der Stadt Beer-Sheva im Rahmen des<br />
Sozialpädagogik-Studiums (davon Anerkennung eines
sechswöchigen Praktikums in der Altenarbeit für das<br />
Psychogerontologie-Studium)<br />
04/1994 – 07/1994 Degrin e.V.- Ausländer und Deutsche gemeinsam e.V.<br />
Nürnberg, Betreuung von Kindern und Jugendlichen im<br />
Rahmen des Sozialpädagogikstudiums<br />
09/2006 – 06/2007 Praktikum während des Psychogerontologie-Studiums bei<br />
Nürnberg, 07.12.2009<br />
der <strong>Gerontopsychiatrischen</strong> Fachkoordination (GeFa) Mfr./<br />
<strong>Angehörigenberatung</strong> e.V., Nürnberg
Eidesstattliche Versicherung<br />
Ich versichere an Eides statt, dass ich die vorgelegte Arbeit ohne fremde Hilfe<br />
und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen angefertigt habe.<br />
Die vorgelegte Arbeit wurde weder in gleicher noch in ähnlicher Form<br />
publiziert und auch bei keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.<br />
Alle Ausführungen, die wörtlich oder sinngemäß übernommen wurden, sind<br />
als solche gekennzeichnet.<br />
Ort und Datum<br />
Nürnberg,07.12.2009<br />
Unterschrift<br />
Institut für Psychogerontologie<br />
Institut für Psychogerontologie, Leiter: Prof. Dr. Frieder R. Lang<br />
Anschrift: Nägelsbachstr. 25, 91052 Erlangen, Telefon: +49 9131 85-26526, Telefax: +49 9131 85-26554<br />
psycho@geronto.uni-erlangen.de www.geronto.uni-erlangen.de
Zusammenfassung<br />
Case Management in der Gerontopsychiatrie am Beispiel des „<strong>Ambulanten</strong><br />
Gerontospychiatrischen Fallmanagements (AGFM)“ der Gerontopsychiat-<br />
rischen Fachkoordination (GeFa) Mittelfranken. Eine erste Evaluationsstudie.<br />
Die derzeitige demografische Entwicklung ist gekennzeichnet durch die Zunahme der<br />
absoluten Zahl älterer Menschen, dem wachsenden Anteil älterer Menschen an der<br />
Gesamtbevölkerung und der Zunahme hochaltriger Menschen. Obwohl Alter nicht<br />
generell gleichgesetzt werden kann mit Krankheit, ist davon auszugehen, dass ab<br />
dem 80.- 85. Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit des Einsetzens von Multimorbidität<br />
zunimmt. Dies wiederum führt in vielen Fällen zur Pflegebedürftigkeit. Maßgeblich<br />
beteiligt an der Pflegebedürftigkeit im Alter sind gerontopsychiatrische Erkrankungen.<br />
Der in der Pflegeversicherung verankerte Grundsatz „ambulant vor stationär“, der<br />
auch den Wünschen der Betroffenen nach einem möglichst langen Verbleib in der<br />
häuslichen Umgebung entspricht, stellt die Pflegebedürftigen und deren pflegende<br />
Angehörige vor neue Herausforderungen. Die Vielfalt der zur Verfügung stehenden<br />
Dienste und Hilfeleistungen, die Betroffene und Angehörige zur Unterstützung in<br />
Anspruch nehmen wollen und müssen, sind oft unüberschaubar für diese Zielgruppe.<br />
Hier kann ein Case Management dazu beitragen, die passende Versorgungsleistung<br />
für die Betroffenen zu ermitteln.<br />
Als Beispiel für ein gerontopsychiatrisches Case Management wurde das<br />
Modellprojekt „Ambulantes Gerontopsychiatrisches Fallmanagement (AGFM)“ der<br />
Gerontospychiatrischen Fachkoordination (GeFa) Mfr. gewählt. Neben der Dar-<br />
stellung des Projektes in seiner Umsetzung und dessen Ergebnissen, wurde<br />
überprüft, inwieweit ambulante Pflegedienste als Projektpartner geeignet sind, das<br />
Fallmanagement durchzuführen. Dies sollte mittels einer Befragung der Fall-<br />
managerinnen erfolgen. Aufgrund der Interpretation der Ergebnisse der Befragung<br />
und in Anbetracht neuer gesetzlicher Entwicklungen (Pflegestützpunkte), kann davon<br />
ausgegangen werden, dass ambulante Pflegedienste als Projektpartner nicht in<br />
erster Linie geeignet sind. Aufgrund dieser Feststellung wurde eine Alternative zum<br />
Projekt dargestellt und die Notwendigkeit eines Strukturwandels bei den ambulanten<br />
Pflegediensten erläutert.
Abstract<br />
Case Management in geronto-psychiatry illustrated by the example of ambulant<br />
Geronto-Psychiatric Case Management („Geronto-Psychatrisches Fallmanage-<br />
ment (AGFM)“) of the Geronto-Psychiatric Professional Coordination<br />
(„Gerontopsychiatrische Fachkoordination“ (GeFa)) Middle Franconia. A first<br />
evaluative study.<br />
The present demographic development is characterized by the increase in the<br />
absolute numbers of elderly people, the growing proportion of the elderly in the total<br />
population, and an increase in the numbers of very old people. Although old age<br />
does not necessarily mean illness, it is fair to assume that the probability of the<br />
occurrence multi-morbidity increases from the age of 80 to 85. In many cases, this<br />
leads to care dependency. Geronto-psychiatric diseases are among the most<br />
prominent factors to necessitate care among old people. The motto “ambulant before<br />
stationary care”, which is both the basic principle of the German care insurance and<br />
also meets the wishes of the people concerned for remaining in their familiar<br />
environments for as long as possible, poses new challenges for people dependent on<br />
care and their caring relatives. The great variety of the services and aid programmes<br />
available that the people concerned and their relatives can or must use are often<br />
hardly manageable for this target group. Under these circumstances, case-<br />
management can contribute to finding the appropriate model of care for the people<br />
concerned.<br />
As an example of geronto-psychiatric case-management, the model-project<br />
“Ambulantes Gerontopsychiatrisches Fallmanagement (AGFM)“ of the Geronto-<br />
Psychiatric Professional Coordination (“Gerontopsychiatrische Fachkoordination“<br />
(GeFa)) has been chosen for this thesis. Apart from describing the implementation<br />
and the results of this project, the study evaluates the question to what extent<br />
ambulant care services can be adequate partners for case-management. This was<br />
done by questioning case-managers and subsequently interpreting these<br />
questionnaires. In view of the results and of new legislative developments (e.g. care-<br />
centers), it is safe to assume that ambulant care-services cannot ultimately be seen<br />
as adequate partners for case-management projects. Thus, the study outlines an<br />
alternative to this project and highlights the necessity for structural changes in<br />
ambulant care-services.
Anhang<br />
Anhang 1: Fallbeispiel<br />
Anhang 2: Anforderungsprofil Fallmanagerinnen<br />
Anhang 3: Neutralitätserklärung<br />
Anhang 4: Datenschutzerklärung<br />
Anhang 5: Rückfax Fallmeldung<br />
Anhang 6: Schweigepflichtentbindung<br />
Anhang 7: Dokumentationsbogen<br />
Anhang 8: Bedarfsermittlung<br />
Anhang 9: Zeittabelle<br />
Anhang 10: Abschlussbericht<br />
Anhang 11: Zahlungsanweisung<br />
Anhang 12: Fragebogen Fallmanagerinnen<br />
Anhang 13: Fragebogen Angehörige
Anhang 1: Fallbeispiel<br />
Eine Fallmanagerin aus der Stadt Nürnberg stellt folgenden Fall dar:<br />
Bericht über einen unserer Klienten unseres ambulanten gerontopsychiatrischen<br />
Fallmanagements um einen Einblick in die Arbeit zu ermöglichen: Wir kamen zu<br />
unserem Klienten durch seine Ehefrau, die wir mit Behandlungspflege ambulant<br />
versorgen. Die bereits 88-jährige Dame leidet an Diabetes und Beschwerden nach<br />
einem Schlaganfall, versorgt aber trotz ihrer eigenen Probleme ihren an Alzheimer<br />
erkrankten Ehemann. Der Mann hat zudem Probleme mit Inkontinenz und bereits<br />
eine Prostata-Operation hinter sich. Dazu kommen Probleme mit Schwindel und<br />
aufgrund seines Alters von 86 Jahren altersgemäße körperliche Beschwerden. Sein<br />
Verhalten wechselt von Antriebslosigkeit in starke Unruhe, der Tag-Nacht-Rhythmus<br />
ist gestört und immer wieder irrt er orientierungslos in der Wohnung umher. Der<br />
Alkoholkonsum stieg an. Bei Aufforderung der Ehefrau zur Medikamenteneinnahme<br />
und zur - stark vernachlässigten - Körperpflege, zu der ihm zum einen die Einsicht<br />
fehlt und zu deren selbstständiger Durchführung er nicht mehr in der Lage ist, kam<br />
es regelmäßig zu starkem Abwehrverhalten bis hin zu verbaler Aggressivität. Die<br />
Ehefrau war stark überfordert, als sie uns ihre Probleme anvertraute. Die Kinder<br />
halfen zwar bei den Einkäufen und bei der Wohnungspflege, sollten aber nicht zu<br />
sehr belastet werden.<br />
Wir konnten in dieser Situation Hilfe anbieten, zu deren Umsetzung wir das<br />
„Ambulante gerontopsychiatrische Fallmanagement (AGFM)“ nahmen, wenngleich<br />
wir zunächst Mühe hatten unseren Klienten zur Annahme unserer Hilfe zu bewegen.<br />
Bei unseren genaueren Betrachtungen konnten wir offensichtliche Beein-<br />
trächtigungen im kognitiven Bereich und Einschränkungen im Orientierungs-<br />
vermögen feststellen, zudem zeigten sich depressive Symptome. Unter Berück-<br />
sichtigung der Biografie des Mannes und seiner Gewohnheiten - er war viele Jahre<br />
selbstständiger Handwerker und aktiv im Sportverein, zuletzt aber hatte er keinerlei<br />
Aufgaben mehr - erstellten wir unter Berücksichtigung der Wünsche der Angehörigen<br />
einen Bedarfsplan, der die Situation entspannen sollte. Dazu benötigten wir ein Netz<br />
verschiedener Hilfen: Wir nahmen Kontakt zum Hausarzt unseres Klienten auf und<br />
schilderten die Probleme, die wir von der Ehefrau wussten. Hausbesuche des Arztes<br />
hatten unregelmäßig stattgefunden, jedoch hatten bei den Besuchen weder der<br />
Klient noch die Ehefrau konkrete Probleme geschildert, so dass der Arzt nicht den
nötigen Einblick in die belastenden Verhaltensauffälligkeiten unseres Klienten haben<br />
konnte. Eine Diagnosestellung beim Facharzt über die Alzheimererkrankung hatte<br />
zwar vor längerem stattgefunden, jedoch war die medikamentöse Behandlung zum<br />
Zeitpunkt unserer Erhebungen nicht mehr angepasst. Nach Absprache mit dem Arzt<br />
vereinbarten wir eine Wiedervorstellung unseres Klienten beim Facharzt, für welche<br />
der Arzt eine Überweisung ausstellte. Der Sohn erklärte sich bereit, mit dem Vater<br />
den Besuch bei dem von unserem Klienten bereits bekannten Facharzt<br />
durchzuführen, um die Verhaltensänderungen gezielter behandeln zu lassen. Dies<br />
stieß wie erwartet, wegen fehlender Einsicht unseres Klienten generell zu<br />
Arztbesuchen, auf Probleme. Wir nahmen zusätzlich Telefonkontakt zum Arzt auf,<br />
erläuterten die uns bekannten aktuellen Probleme und vereinbarten, künftige<br />
Arztkontakte wenn möglich über Hausbesuche stattfinden zu lassen und aktuelle<br />
Veränderungen telefonisch an die miteinbezogenen behandelnden Ärzte<br />
weiterzuleiten. Über einen längeren Zeitraum konnte dadurch für unseren Klienten<br />
eine geeignetere medikamentöse Behandlung erzielt werden. Um Konfrontationen zu<br />
Lasten der Ehefrau zu vermeiden, regelten wir die Verabreichung der<br />
Medikamentengabe nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten über<br />
Verordnung durch häusliche Krankenpflege. Wir rieten den Angehörigen, nochmals<br />
einen Antrag bei der Pflegekasse zu stellen, der im Vorfeld bereits einmal abgelehnt<br />
worden war. Durch genaue Begründung und Dokumentation über den tatsächlichen<br />
zeitlichen Aufwand an nötiger Beaufsichtigung, Anleitung sowie Übernahme bei der<br />
Pflege des Klienten konnten wir endlich eine Pflegeeinstufung erreichen. Wir rieten<br />
zudem, einen Antrag auf Betreuung zu stellen, da der Klient wegen seiner Ein-<br />
schränkungen nicht mehr in der Lage war, seine Angelegenheiten selbst zu regeln<br />
und auch die Ehefrau nicht mehr in der Lage war, für alles Sorge zu tragen. Die<br />
Tochter stellte sich für diese Aufgabe zur Verfügung. Der angeforderte Besuchs-<br />
dienst der <strong>Angehörigenberatung</strong> konnte der Ehefrau zusätzlich zur Seite stehen, was<br />
sich als gute Ergänzung und Weiterführung unserer Arbeit erwies. Wir vereinbarten<br />
gemeinsam, dass es hilfreich wäre, den Besuch unseres Klienten in der Tagespflege<br />
anzustreben, beginnend zumindest einmal wöchentlich. Um eventuelle Widerstände<br />
des Klienten besser abfangen zu können, vereinbarten wir für den Tag, an dem der<br />
Klient die Tagespflege besuchen sollte, ambulante Hilfe am Morgen, welche bei der<br />
Grundpflege und beim Ankleiden behilflich sein sollte, sowie den Klienten positiv auf<br />
den Besuch in der Tagespflege einzustimmen und vorzubereiten. Dies geschah sehr
umsichtig und durch langsame Vorgehensweise, um den Klienten nicht zu<br />
überfordern. Je nach Verfassung des Mannes gelingt dies nicht immer, was wir<br />
akzeptieren müssen, aber im Laufe der Zeit und Gewohnheit und auch unter der<br />
nach und nach besseren medikamentösen Behandlung doch oftmals. Dies entlastet<br />
die Ehefrau, die dadurch zumindest ein wenig freie Zeit zur Verfügung hat. Zudem<br />
wirkt es sich positiv auf unseren Klienten aus, der sonst nur noch wenige soziale<br />
Anreize hat. Ambulante Hilfe wurde unter Berücksichtigung des möglichen<br />
finanziellen Rahmens zusätzlich vereinbart, um die Ehefrau sowohl körperlich zu<br />
entlasten als auch problematische Situationen zu vermindern. Die Pflege wird ein-<br />
fühlend und motivierend gestaltet und nur in dem Rahmen, in dem unser Klient sie<br />
akzeptiert, ohne sie als Bevormundung zu empfinden. Dies setzt eine gute Planung<br />
der Pflege und ausreichende Absprachen unter den Pflegenden voraus. Nötige<br />
Hilfsmittel wurden organisiert und auch die passende Inkontinenzversorgung wurde<br />
geregelt. Zwischenzeitlich gelang auch eine Wiedervorstellung unseres Klienten<br />
beim Urologen für weitere nötige Untersuchungen. Die Kinder unseres Klienten<br />
konnten aufgeklärt und dazu angeregt werden, den Vater soweit möglich auf kleinere<br />
Spaziergänge und zu Beschäftigungen mitzunehmen, um die dringend nötige<br />
körperliche Auslastung am Tage zu erreichen. Die Angehörigen wurden ebenfalls<br />
über die Krankheit informiert und konnten sich zusätzliche Hilfe und Beratung durch<br />
die <strong>Angehörigenberatung</strong> einholen, welche weiteren Behandlungs- und Betreuungs-<br />
möglichkeiten noch möglich sind und über welche Wege sie dazu kommen. Wegen<br />
Sturzgefahr und zur allgemeinen Sicherheit beider Eheleute wurde ein Hausnotruf<br />
organisiert. Weitere Gefahrenquellen und Unsicherheiten in der Wohnung konnten<br />
verringert werden. Einer der wichtigsten Punkte war es, die Ehefrau in Gesprächen<br />
über das Krankheitsbild der Demenz und damit verbundener möglicher Verhaltens-<br />
änderungen besser zu informieren. Wir erreichten damit, dass sie etwas gelassener<br />
damit umgehen und auf kritische Situationen entsprechend reagieren kann. Durch<br />
Umsetzung eines geregelteren Tagesrhythmus, Kontinuität in der Pflege, schnelles<br />
Reagieren auf Probleme von Seiten aller miteinbezogenen Dienste konnte so eine<br />
Basis geschaffen werden, die es unserem Klienten und seiner Ehefrau erlaubt, ihren<br />
Alltag in angenehmerer Weise miteinander zu verbringen. Unser Klient ist<br />
mittlerweile viel zufriedener, der Alkoholkonsum konnte verringert werden und auch<br />
die Nächte sind mittlerweile ruhiger geworden. Die Ehefrau ist ebenfalls<br />
ausgeglichener als vor Beginn unseres Fallmanagements. Auch die Angst der
Angehörigen, hilflos in unüberschaubaren Situationen alleine zu stehen, konnte<br />
durch bessere Informationen verringert werden, auch im Hinblick darauf, wie die<br />
Krankheit weiter fortschreitet. Zeitliche, fachliche, körperliche und psychische<br />
Entlastung durch verschiedene Dienste und Hilfen und genaue Absprachen und<br />
Abstimmung aller Beteiligten erwiesen sich als ein hilfreiches Netz für unseren<br />
Klienten und seine Angehörigen und wurden dankbar angenommen.<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.36ff)
Anhang 2: Anforderungsprofil Fallmanagerinnen<br />
Anforderungsprofil<br />
für Pflegedienst-Mitarbeiter/-innen bei der Übernahme des ambulanten<br />
gerontopsychiatrischen Fallmanagements in Mittelfranken.<br />
Bereitschaft, insbesondere mit demenziell und depressiv erkrankten<br />
Menschen nicht primär pflegerisch, sondern koordinierend arbeiten zu wollen<br />
Bereitschaft zur Einbeziehung der Angehörigen und/oder anderer<br />
Bezugspersonen<br />
Teilnahme am Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie Teil I und Teil II<br />
bzw. die Zusage, an Teil II teilzunehmen<br />
Alternativ eine höherwertige (geronto-) psychiatrische Aus-/ Fort-/<br />
Weiterbildung<br />
Erfahrungen mit demenziell und/ oder depressiv Erkrankten durch vorherige/<br />
bisherige Tätigkeiten<br />
Kommunikationsfähigkeit und - bereitschaft und gute Sprachkenntnisse in der<br />
Muttersprache der Klientin/ des Klienten<br />
Wertschätzender und respektvoller Umgang mit den Erkrankten und<br />
ihren Angehörigen<br />
Anwaltschaftliches Handeln unter Beachtung der Wünsche der<br />
Erkrankten und ihrer Angehörigen<br />
Bereitschaft zur Dokumentation der geleisteten Arbeit<br />
Bereitschaft zur Teilnahme an den regionalen Fallbesprechungen<br />
Wahrung der Neutralität bei der trägerunabhängigen Organisation bzw.<br />
Vermittlung der benötigten Hilfen<br />
Wahrung der Schweigepflicht und Einholung der Entbindung von der<br />
Schweigepflicht bei der Koordination der verschiedenen Leistungserbringer<br />
Erkennen und Akzeptieren der Grenzen des eigenen Handelns<br />
(Quelle: GeFa 2009, S. 42)
Anhang 3: Neutralitätserklärung<br />
Erklärung<br />
Der unterzeichnende Pflegedienst erklärt sich hiermit zur Einhaltung völliger<br />
Neutralität bei der Durchführung des ambulanten Fallmanagements bereit.<br />
Notwendige Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen werden träger- und<br />
personenneutral vermittelt.<br />
Vorrangig bei der Vermittlung und Zuschaltung weitergehender Maßnahmen sind die<br />
Wünsche und Erfordernisse von Seiten der Betroffenen.<br />
Die durchzuführenden Maßnahmen erfolgen auf der Grundlage der<br />
Biographiekenntnis und haben als Ziel die größtmögliche Motivierung, Reaktivierung<br />
und Stärkung des Selbstwertgefühls des erkrankten Menschen und seiner<br />
Angehörigen.<br />
Es wird eine Kooperation mit allen notwendigen weiteren informellen und<br />
professionellen Unterstützern angestrebt.<br />
________________________________ _________________________<br />
Ort/Datum Stempel/Unterschrift<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.44)
Anhang 4: Datenschutzerklärung<br />
Datenschutzerklärung<br />
zum „<strong>Ambulanten</strong> gerontopsychiatrischen Fallmanagement“<br />
Die GeFa Mittelfranken erklärt hiermit, dass die durch die ambulanten Pflegedienste<br />
erhobenen Daten nur im Rahmen des Projektes genutzt und für die<br />
Abschlussdokumentation ausschließlich in anonymisierter Form bearbeitet und<br />
dargestellt werden.<br />
Die erhobenen Daten werden nicht außerhalb des Projektes weitergegeben und<br />
keiner weiteren Nutzung - sei es kommerziell oder nichtkommerziell - außerhalb des<br />
Projekteszugeführt.<br />
Nürnberg, den 26. April 2006<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.45 )
Anhang 5: Rückfax Fallmeldung<br />
Absender:<br />
Rückfax Fallmeldung<br />
............................................... Bitte Rückfax senden an<br />
............................................... Fax- Nr.: 0911/28 760 80<br />
Ich habe Kenntnis von einem Fall erhalten, der die Kriterien für das AGFM erfüllt.<br />
Zugangsweg:<br />
eigene/r Kunde/-in durch Patient/-in selbst Arzt<br />
sonstiger Zugangsweg ______________________________________<br />
Die Person ist:<br />
männlich weiblich<br />
Alter:_______________<br />
Demenz Eigenbeurteilung<br />
Depression Ärztliche Diagnose<br />
Pflegestufe: keine 1 2<br />
Schweigepflichtentbindung liegt vor<br />
Fallmanager/-in<br />
(Name, Vorname):____________________________________________<br />
Ich bitte um Bestätigung.<br />
Bestätigung durch GeFa<br />
wird erteilt<br />
nicht erteilt<br />
_______________________________ _________________________<br />
(Datum und Unterschrift) (Datum und Unterschrift GeFa<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.46 )
Anhang 6: Schweigepflichtentbindung<br />
Schweigepflichtentbindung<br />
Zum Zweck einer möglichst umfassenden Unterstützung ist eine gute Zusammenarbeit<br />
zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der eingebundenen<br />
Institutionen notwendig.<br />
Um diese zu ermöglichen, entbinde ich die MitarbeiterInnen von der Schweigepflicht,<br />
die unmittelbar mit der Durchführung spezieller Aufgaben betraut sind, die mit meiner<br />
Person bzw. meiner/m Angehörigen zusammenhängen.<br />
Ort/Datum Unterschrift<br />
durch den beteiligten Sozialdienst<br />
Schweigepflicht-Erklärung<br />
Die Art und der Umfang des vorgesehenen Austauschs mit anderen Organisationen<br />
oder beteiligten Personen wird der Klientin/ dem Klienten bzw. Patientin/-en bzw.<br />
seiner Betreuerin stets offen gelegt und nur in begründbarem Umfang vorgenommen.<br />
Ort/Datum Stempel/Unterschrift<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.47)
Anhang 7: Dokumentationsbogen<br />
Dokumentationsbogen<br />
Klientendaten:<br />
Name:..................................................................Geburtsdatum:.................................<br />
Straße:...........................................................................................................................<br />
PLZ:......................Ort:...........................................................Region:...........................<br />
Familienstand: ledig verheiratet bzw. Partnerschaft<br />
seit...........................................<br />
geschieden seit........ .... verwitwet seit.................<br />
Wohnform: mit Ehe-/Partner mit Angehörigen alleine<br />
Sonstige:..............<br />
Wohnsituation: EFH MFH Treppe Aufzug Bad Dusche<br />
Konfession: evang. kathol. Sonstige:..............................<br />
Ausgeübte Berufe:<br />
Spezielle Interessen:<br />
Besondere Lebensereignisse:<br />
Tabuthemen:<br />
Angehörige/r: Tel.:<br />
Bezugsperson: Tel.:<br />
Gesetzl. BetreuerIn: Tel.:<br />
Patientenverfügung Vorsorgevollmacht Betreuungsverfügung<br />
liegt vor<br />
Pflegeeinstufung: keine 1 2 3 beantragt für<br />
Stufe...........<br />
Ärztliche Versorgung:<br />
Hausarzt: Tel.:<br />
Facharzt: Tel.:<br />
Facharzt: Tel.:
Somatische und psychiatrische Diagnosen:<br />
Demenzielle Erkrankung Herz-/Kreislauferkrankung<br />
Depressive Störung Stoffwechselerkrankung<br />
Wahnhafte Erkrankung Neurologische Erkrankung<br />
Suchterkrankung Degenerative Erkrankung<br />
Medikamente:<br />
Antidementiva Antidepressiva Sedativa Hypnotika<br />
Anxiolytika Atypisches Neuroleptikum<br />
Sonstige:................................................<br />
Ärztlich verordnete Medikamente: werden gerichtet Einnahme unter Aufsicht<br />
Psychiatrische Symptome:<br />
Bewusstsein: wach schläfrig<br />
Orientierung: zeitlich immer / teilweise / nie<br />
Örtlich immer / teilweise / nie<br />
Situativ immer / teilweise / nie<br />
Gedächtnisstörungen:<br />
Wahn (Art):<br />
Halluzination (Art):<br />
Substanzmissbrauch: Alkohol Medikamente Tabak Sonstige<br />
Stimmung: gehoben depressiv gereizt ängstlich<br />
Kontaktverhalten / Kommunikation:<br />
Muttersprache: benutzte Sprache:<br />
verbal nonverbal Verständigung<br />
verlangsamtes Denken verlangsamte Sprache unverständliche Sprache<br />
Schwerhörigkeit: Gehörlosigkeit: Sehbehinderung: Blindheit:<br />
sucht Kontakt lehnt Kontakt ab Distanzminderung sozialer Rückzug<br />
Besonderheiten:<br />
Verhaltensauffälligkeiten / Risiken:<br />
Abwehrverhalten bei:<br />
Aggressivität / Art und Situation:<br />
Angstzustände / Art und Situation:<br />
Antriebsstörung: Antrieb vermindert Passivität schwer motivierbar<br />
Antrieb gesteigert Unruhe<br />
Weglauftendenzen Suizidalität suizidale Äußerungen Suizidversuch<br />
Sonstige Risiken:<br />
Mobilität:<br />
selbstständig eingeschränkt rastlos Apraxie<br />
benötigt Hilfe bei:<br />
Sturzprophylaxe durch:
Hilfsmittel:<br />
Brille Hörgerät: rechts / links Zahnprothese: oben / unten<br />
Toilettensitz Badewannenlifter Rollator Rollstuhl Sonstige:<br />
Benötigte Hilfsmittel:<br />
Durchgeführte Therapien/Name/Tel.:<br />
Atemtherapie Krankengymnastik<br />
Bewegungstherapie Logopädie<br />
Ergotherapie Physiotherapie<br />
Haushaltstraining Psychotherapie<br />
Kognitives Training Sonstige<br />
Ambulante Versorgung:<br />
Unterstützung durch/Vermittlung an:<br />
Angehörige/n: Tel.:<br />
Angehörige/n: Tel.:<br />
Nachbar/in: Tel.:<br />
Nachbar/in: Tel.:<br />
ambulanten Pflegedienst: Tel.:<br />
Beratungsstelle: Tel.:<br />
Beratungsstelle: Tel.:<br />
Besuchsdienst: Tel.:<br />
Einkaufsdienst: Tel.:<br />
Essen auf Rädern: Tel.:<br />
Gruppenangebot: Tel.:<br />
Haushaltshilfe: Tel.:<br />
Putzhilfe: Tel.:<br />
Sonstige: Tel.:<br />
Sonstige: Tel.:<br />
Teilstationäre Versorgung:<br />
Tagesklinik: Tel.:<br />
Tagespflege: Tel.:<br />
Stationäre Versorgung:<br />
Klinikaufenthalt: von bis von bis<br />
von bis von bis<br />
Kurzzeitpflege: von bis von bis<br />
Pflegeheim: Eintritt ab: in:<br />
Grund der stationären Versorgung:<br />
Anmerkungen:<br />
Datum, Unterschrift<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.48ff)
Anhang 8: Bedarfsermittlung<br />
Bedarfsermittlung<br />
für<br />
Frau/Herrn___________________________________________________________<br />
Zentrale<br />
Problematik__________________________________________________________<br />
Bereich Fachlich<br />
Notwendige<br />
Maß-<br />
Kontaktaufnahme <br />
Grundpflege <br />
Behandlungspflege<br />
Haus-/<br />
Facharztbesuche<br />
Ernährung<br />
nahme<br />
Ziel<br />
Interventionswünsche<br />
der Klientin/<br />
d. Klienten<br />
des/ der<br />
Angehörigen<br />
Vereinbarte<br />
Maßnahme<br />
Durchführung<br />
von/ am
Bereich Fachlich<br />
Notwendige<br />
Maßnahme<br />
Kontaktaufnahme <br />
Wohnungspflege<br />
Soziale<br />
Kontakte<br />
Tagesgestaltung<br />
Mobilität/<br />
Aktivierung<br />
Finanzen/<br />
Post<br />
Sonstiges<br />
Ziel<br />
Interventionswünsche<br />
der Klientin/<br />
d. Klienten<br />
des/ der<br />
Angehörigen<br />
Vereinbarte<br />
Maßnahme<br />
Klient/-in oder (gesetzl.) Vertreter/-in Mitarbeiter/-in des Pflegedienstes<br />
_____________________________ ___________________________<br />
Datum/Unterschrift<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.51ff)<br />
Durchführung<br />
von/ am
Anhang 9: Zeittabelle<br />
Zeittabelle<br />
Für<br />
Frau/Herrn......................................................................................................................<br />
Hausbesuch Fahrzeit<br />
in Min.<br />
1.Hausbesuch<br />
2.Hausbesuch<br />
3.Hausbesuch<br />
Telefonkontakt<br />
KM-<br />
Angabe<br />
Kontaktaufnahme<br />
durch<br />
Klient/-in<br />
Mitarbeiterin<br />
Sonstige:<br />
Klient/-in<br />
Mitarbeiterin<br />
Sonstige<br />
Klient/-in<br />
Mitarbeiterin<br />
Sonstige<br />
Klient/-in<br />
Mitarbeiterin<br />
Sonstige<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.54f)<br />
Dauer Inhalt Datum/Zeichen<br />
Dauer Inhalt<br />
Datum/Zeichen
Anhang 10: Abschlussbericht<br />
Abschlussbericht<br />
für<br />
Herrn/Frau:.....................................................................................................................<br />
Krankheitsgruppe:<br />
Demenz Depression<br />
Eigenbeurteilung oder Ärztliche Diagnose<br />
Durchgeführte Tests:<br />
DemTect =>Ergebnis: MMST =>Ergebnis:<br />
Geriatric Depression Scale => Ergebnis:<br />
Sonstige:<br />
Beginn des Fallmanagements: Beendigung des Fallmanagements:<br />
Pflegestufe bei Beginn: bei Ende:<br />
Vermittelte Institutionen:<br />
1. 3.<br />
2. 4.<br />
Eingeleitete Therapiemaßnahmen:<br />
1. 3.<br />
2. 4.<br />
Weitere Unterstützungsmaßnahmen:<br />
1. 3.<br />
2. 4.<br />
Grund für Beendigung des Fallmanagements:<br />
Eigenbeurteilung der Effekte:<br />
Beurteilung des Fallmanagements durch Klienten oder Angehörige:<br />
Stempel/Unterschrift<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.56)
Anhang 11: Zahlungsanweisung<br />
Zahlungsanweisung<br />
für das Ambulante Gerontopsychiatrische Fallmanagement<br />
Bitte als Rückfax an <strong>Angehörigenberatung</strong> e.V. Nürnberg<br />
0911/ 287 60 80<br />
Hiermit bestätigen wir den Abschluss des folgenden Fallmanagements:<br />
Region:<br />
Fallmanagerin:<br />
Beginn: Ende:<br />
Bitte überweisen Sie die pauschale Aufwandsentschädigung von 100.-Euro an:<br />
Empfängeranschrift:<br />
Institution:<br />
Straße:<br />
PLZ: Ort:<br />
Kontoverbindung:<br />
Bank:<br />
BLZ:<br />
Konto-Nr.:<br />
Anmerkungen:<br />
Datum<br />
Stempel/Unterschrift<br />
(Quelle: GeFa 2009, S.57)
Anhang 12: Fragebogen Fallmanagerinnen<br />
Fragebogen zum gerontopsychiatrischen Fallmanagement (AGFM)<br />
Sehr geehrte Fallmanagerinnen,<br />
im Rahmen des gerontopsychiatrischen Fallmanagements in Mittelfranken hatten Sie<br />
die Möglichkeit an dem Projekt teilzunehmen. Da uns Ihre Erfahrungen und<br />
Einschätzungen in Ihrer Tätigkeit als Fallmanagerin wichtig sind, bitten wir Sie heute<br />
darum, diesen Fragebogen für uns auszufüllen. Wir versichern Ihnen, dass diese<br />
Umfrage anonym bleibt und wir dem Datenschutz unterliegen. Ihre Daten werden<br />
lediglich für Auswertungszwecke verwendet.<br />
I. Welche Grundqualifikation haben Sie?<br />
examinierte Krankenschwester examinierte Altenpflegerin Sozialpädagogin<br />
Sonstiges ...................................................<br />
II. Welche Fort-/Weiterbildung haben Sie im (geronto-)psychiatrischen Bereich<br />
absolviert?<br />
„Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie I“<br />
„Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie II“<br />
Weiterbildung zur Fachkraft Gerontopsychiatrie (720 Std.)<br />
Sonstige: ....................................................<br />
1. Haben Sie im Rahmen des gerontopsychiatrischen Fallmanagements Fälle<br />
bearbeitet?<br />
ja nein<br />
Anzahl der Fälle:...........<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
2. Halten Sie die drei vorgesehenen Hausbesuche für ausreichend, um das<br />
Fallmanagement durchführen zu können?<br />
ja nein<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
3. Welchen zeitlichen Umfang halten Sie pro Hausbesuch für angemessen?<br />
bis zu einer Stunde mehr als eine Stunde<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
4. Konnten geeignete ambulante Maßnahmen an die Betroffenen vermittelt<br />
werden?<br />
trifft voll und ganz zu<br />
trifft zu<br />
trifft weniger zu<br />
trifft überhaupt nicht zu<br />
Anmerkung:....................................................................................................................
5a. Konnte Ihrer Meinung nach die Lebensqualität der Erkrankten durch das<br />
Fallmanagement verbessert werden?<br />
trifft voll und ganz zu<br />
trifft zu<br />
trifft weniger zu<br />
trifft überhaupt nicht zu<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
5b. Konnte Ihrer Meinung nach die Lebensqualität der Familienangehörigen<br />
durch das Fallmanagement verbessert werden?<br />
trifft voll und ganz zu<br />
trifft zu<br />
trifft weniger zu<br />
trifft überhaupt nicht zu<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
6. Konnte Ihrer Einschätzung nach durch das Fallmanagement eine<br />
Heimeinweisung<br />
- verzögert werden?<br />
ja nein weiß nicht<br />
- vermieden werden?<br />
ja nein weiß nicht<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
7. Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit den Angehörigen ein?<br />
7a. Ihre Vorschläge als Fallmanagerin wurden von den Familienangehörigen<br />
angenommen.<br />
trifft voll und ganz zu<br />
trifft zu<br />
trifft weniger zu<br />
trifft überhaupt nicht zu<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
7b. Ihre Vorschläge als Fallmanagerin wurden von den Erkrankten<br />
angenommen.<br />
trifft voll und ganz zu<br />
trifft zu<br />
trifft weniger zu<br />
trifft überhaupt nicht zu<br />
Anmerkung:....................................................................................................................
8. Die Zusammenarbeit mit den vermittelten Versorgungsanbietern (Ärzten,<br />
Beratungsstellen, anderen ambulanten Diensten etc.) war Ihrer Meinung nach<br />
sehr gut<br />
gut<br />
zufriedenstellend<br />
weniger gut<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
9. Halten Sie die Höhe der zur Verfügung gestellten Aufwandsentschädigung<br />
für das Fallmanagement für Kosten deckend?<br />
ja nein weiß nicht<br />
Vorschlag:...........€<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
10. Welche Abrechnungsart halten Sie im Rahmen des Fallmanagements für<br />
sinnvoll?<br />
Pauschale stundenweise Abrechnung<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
11. Halten Sie den Bearbeitungsaufwand des Dokumentationssystems für<br />
zeitlich angemessen und wie viel Zeit haben Sie aufgewendet?<br />
Dokumentationsbogen ja nein<br />
Bedarfsermittlung ja nein<br />
Zeittabelle ja nein<br />
Abschlussbericht ja nein<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
12. Halten Sie das Dokumentationssystem in seiner Handhabung für<br />
praktikabel?<br />
Dokumentationsbogen ja nein<br />
Bedarfsermittlung ja nein<br />
Zeittabelle ja nein<br />
Abschlussbericht ja nein<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
13. Halten Sie die Schulungen im Rahmen des gerontopsychiatrischen<br />
Fallmanagements für hilfreich?<br />
trifft voll und ganz zu<br />
trifft zu<br />
trifft weniger zu<br />
trifft überhaupt nicht zu<br />
Anmerkung:....................................................................................................................
14. Wie schätzen Sie persönlich den Kosten-Nutzen-Effekt des<br />
Fallmanagements ein?<br />
Für<br />
- die Klienten/Patienten:<br />
sehr effektiv effektiv weniger effektiv überhaupt nicht effektiv<br />
- die ambulanten Dienste:<br />
sehr effektiv effektiv weniger effektiv überhaupt nicht effektiv<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
15. Sind Sie an einer Fortführung des gerontopsychiatrischen<br />
Fallmanagements interessiert?<br />
ja nein<br />
Anmerkung:....................................................................................................................<br />
16. Wünschen Sie sich als Fallmanagerin zusätzliche Fortbildungen, um diese<br />
Tätigkeit weiterhin erfolgreich durchführen zu können?<br />
ja nein<br />
welche?..........................................................................................................................<br />
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!
Anhang 13: Fragebogen Angehörige<br />
Angehörigen-Fragebogen<br />
zum gerontopsychiatrischen Fallmanagement (AGFM)<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
Sie haben durch einen ambulanten Pflegedienst an einem Fallmanagement<br />
teilgenommen. Als Auftraggeber interessiert uns nun, ob Sie als Angehörige/r bzw.<br />
Erkrankte/r von dieser Maßnahme profitiert haben. Daher möchten wir Sie bitten,<br />
diesen Fragebogen für uns auszufüllen. Wir versichern Ihnen hiermit, dass Ihre<br />
Angaben anonym bleiben und wir dem Datenschutz unterliegen. Die von Ihnen<br />
beantworteten Fragen dienen lediglich Auswertungszwecken.<br />
I. Sie sind<br />
Angehörige/r Erkrankte/r<br />
Ehefrau Tochter<br />
Ehemann Sohn Sonstige ...........................................<br />
II. Geschlecht w m<br />
Alter 40-49J. 50-59J. 60-69J. 70-79J. 80-89J.<br />
Sonstiges.......<br />
III. Aufgrund welcher Erkrankung haben Sie das Fallmanagement in Anspruch<br />
genommen?<br />
Demenzielle Erkrankung Depression Sonstiges<br />
1. Empfanden Sie das Fallmanagement insgesamt für Ihre persönliche<br />
Situation als hilfreich?<br />
trifft voll und ganz zu<br />
trifft zu<br />
trifft weniger zu<br />
trifft überhaupt nicht zu<br />
Anmerkung:.............................................................................................................<br />
2. Konnte in Ihrer Situation durch das Fallmanagement eine Heimeinweisung<br />
-verzögert werden?<br />
ja nein<br />
-vermieden werden?<br />
ja nein<br />
Anmerkung:.............................................................................................................<br />
3. Konnten geeignete ambulante Maßnahmen für Sie oder den/die Angehörige<br />
vermittelt werden?<br />
trifft voll und ganz zu<br />
trifft zu<br />
trifft weniger zu<br />
trifft überhaupt nicht zu<br />
Anmerkung:.............................................................................................................
4. Sind Sie seit der Teilnahme am Fallmanagement mit Ihrer Lebenssituation<br />
zufriedener?<br />
trifft voll und ganz zu<br />
trifft zu<br />
trifft weniger zu<br />
trifft überhaupt nicht zu<br />
Anmerkung:.............................................................................................................<br />
5. Fühlen Sie sich durch die vermittelten Maßnahmen des Fallmanagements in<br />
Ihrem Alltag entlastet?<br />
trifft voll und ganz zu<br />
trifft zu<br />
trifft weniger zu<br />
trifft überhaupt nicht zu<br />
Anmerkung:.............................................................................................................<br />
6. Würden Sie das Fallmanagement bei Bedarf wieder in Anspruch nehmen?<br />
ja nein weiß nicht<br />
Anmerkung:.............................................................................................................<br />
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-mail an:<br />
Elfi Ziebell<br />
Gerontopsychiatrische Fachkoordiantion (GeFa) Mittelfranken<br />
Tel.: 0911/26 98 39<br />
E-Mail: gefa@angehoerigenberatung-nbg.de<br />
Den ausgefüllten Fragebogen senden Sie bitte in dem beigefügten<br />
Freiumschlag zurück an die GeFa Mittelfranken.<br />
Wir bedanken uns sehr für Ihre Unterstützung!