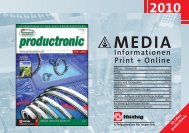DAS VENTIL AUS DER KÄLTE - Hüthig GmbH
DAS VENTIL AUS DER KÄLTE - Hüthig GmbH
DAS VENTIL AUS DER KÄLTE - Hüthig GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ANLAGEN · APPARATE · VERFAHREN · MESSTECHNIK · UMWELTTECHNIK<br />
ANLAGENBAU Hat Anlagenbau made in Germany Zukunft? 18<br />
RESSOURCEN Wie Schiefergas die Chemiewelt verändert 38<br />
AUTOMATISIERUNG Energieoptimierte Fördersysteme 77<br />
ROHRE Fiberglas statt Edelstahl 46<br />
1 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
113<br />
Februar 2013,<br />
D 19066<br />
www.chemietechnik.de<br />
42. Jahrgang<br />
unverb. Preisempfehlung<br />
19,00 Euro<br />
AUTOMATISIERUNG Industrie 4.0 85<br />
SICHERHEIT 1x1 der Stickstoff-Inertisierung 58<br />
HEIZTECHNIK Solare Prozesswärme 66<br />
DICHTUNGEN Werkstoffe gegen explosive Dekompression 74<br />
ARMATUREN FÜR DEN FLÜSSIGGAS-BOOM<br />
<strong>DAS</strong> <strong>VENTIL</strong><br />
<strong>AUS</strong> <strong>DER</strong> <strong>KÄLTE</strong>
Polyethylenanlage PE4 in Schwechat / Österreich für die Borealis Polyolefine <strong>GmbH</strong><br />
www.poerner.at www.edl.poerner.de<br />
faszination anlagenbau<br />
Wir bauen Anlagen mit dem gewissen Mehr an Innovation, Flexibilität und Produktivität.<br />
Unser verfahrenstechnisches Know-how ist die Grundlage, moderne Technologien weltweit umzusetzen und Projekte von der klassischen<br />
Ingenieur leistung bis zur Turn-Key-Realisierung komplett aus einer Hand abzuwickeln.<br />
Unsere umfassenden Referenzen bieten Ihnen die Sicherheit, Ihre Investition einem<br />
erprobten Partner anzuvertrauen, der auf weltweit erworbene Erfahrung, Spezialwissen<br />
und bewährte Lösungen zurückgreifen kann. Kontaktieren Sie uns!<br />
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Österreich<br />
Hamburgerstraße 9, 1050 Wien<br />
E-Mail: vienna@poerner.at<br />
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Deutschland<br />
Lindenthaler Hauptstraße 145, 04158 Leipzig<br />
E-Mail: gf@edl.poerner.de<br />
Die Pörner Gruppe ist das in Zentraleuropa führende Ingenieurunternehmen, wenn es um die Planung und Realisierung von verfahrenstechnischen Anlagen für Raffinerie und Petrochemie,<br />
Chemie- und Pharmaindustrie sowie um Energie- und Umwelttechnik geht. Das Technologieangebot umfasst u.a. Biturox ® Bitumen, Formalin und –Derivate, Lösungsmittel-Entasphaltierung (PDA/SDA)<br />
sowie umfangreiches Revamp-Know-how. Mit über 500 Spezialisten an sieben Standorten und aus über 2000 durchgeführten Projekten hat die Pörner Gruppe 40 Jahre Erfahrung im Anlagenbau.
CHEMIE TECHNIK 4.0<br />
Am 30. Januar 2013 ist die vierte industrielle Revolution bei den Ingenieuren<br />
angekommen. Auf dem VDI-Kongress (Bericht ab Seite<br />
85) fiel der Startschuss. Nach Mechanisierung, Massenfertigung und<br />
Automatisierung nun also die „Informatisierung der klassischen Industrien“<br />
– zu deutsch: die „smarte Fabrik“. Fast zwei Jahre haben die<br />
Automatisierer gebraucht, um zu verstehen, dass die ITler nach ihrer<br />
Macht greifen. Vom Tisch ist dieser Wachwechsel durch den VDI-<br />
Kongress im Januar aber nicht. Und meiner Meinung nach wäre es<br />
industriehistorisch gesehen auch logisch: Nach den Maschinenbauern<br />
und Fertigungstechnikern gaben die Automatisierer ein halbes<br />
Jahrhundert lang den Ton an. Wenn heute selbst Paare oder Cliquen<br />
keinen Abend im Restaurant mehr überstehen, ohne alle fünf Minuten<br />
eine Smartphone-App zu checken, dann ist es nur konsequent,<br />
wenn in der vernetzten Welt der Industrie 4.0 Informatiker das Ruder<br />
übernehmen.<br />
Die Chemieindustrie wird, schon allein aus Sicherheitsgründen, voraussichtlich<br />
erst einmal zuschauen, wie sich in anderen Branchen<br />
alles mit allem vernetzen wird. Doch auch die Namur hat das Thema<br />
Informationsintegration bereits auf die Agenda gesetzt.<br />
Umbrüche zeichnen sich auch im deutschen Anlagenbau ab. „Der<br />
Großteil des typisch deutschen Anlagenbaus ist tot“, konstatiert<br />
BASF-Engineeringchef Dr. Volker Knabe mit Blick auf globale Großprojekte<br />
im Bericht ab Seite 18. Der Anlagenbau sucht nach Konzep-<br />
Wird es in 10 bis 15 Jahren keinen „europäischen<br />
Anlagenbau mehr geben“, oder reicht die Wut der<br />
Anbieter für einen Neustart? Seite 18<br />
Internationalisierung bietet für Anlagenbauer und<br />
Lieferanten große Chancen, birgt aber auch Risiken.<br />
Erfolgsrezepte finden Sie ab Seite 22<br />
EDITORIAL<br />
ten, um sich für die Zukuft aufzustellen. Beispielsweise im USA-<br />
Geschäft, denn dort verheißt die Schiefergas-Revolution lukrative<br />
Aufträge (Special ab Seite 30).<br />
All diese Themen haben wir für Sie in der aktuellen Ausgabe der CT<br />
aufbereitet. Und zwar in neuer Optik und komplett vernetzt mit<br />
unserem Crossmedia-Angebot auf www.chemietechnik.de. Nun<br />
auch mit einer mobilen Version. Kurze URL-Adressen unter den<br />
Beiträgen sowie QR-Codes, die Sie mit dem Smartphone oder Tablet-Computer<br />
scannen können, bringen Sie zur Onlineversion. Dort<br />
erhalten Sie weitere Informationen und Direktlinks, beispielsweise<br />
zu Produktseiten des Anbieters. Die Google-Suche nehmen wir Ihnen<br />
damit ab. Und weil die CT ihren vierzigsten Geburtstag feiert,<br />
schenken wir Ihnen ab Seite 6 auch einige Preziosen aus vier Jahrzehnten<br />
chemischer Technik. Wir hoffen, Sie bleiben uns auch in<br />
den kommenden vier Jahrzehnten gewogen und begleiten unseren<br />
Start in das CHEMIE-TECHNIK-4.0-Zeitalter.<br />
Was meinen Sie?<br />
armin.scheuermann@chemietechnik.de<br />
Wie die Schiefergas-Revolution die Welt der Chemie<br />
und des Anlagenbaus verändert, erfahren Sie<br />
ab Seite 31<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
3
INHALT<br />
CT-Trendbericht<br />
Anlagenbau – total global<br />
Der deutsche Anlagenbau ist in der<br />
Zwickmühle: Für die weltweit steigende<br />
Zahl an Megaprojekten sind die Anbieter<br />
häufig nicht groß genug, um die Verantwortung<br />
als Generalunternehmer zu<br />
übernehmen<br />
CT-Trendbericht<br />
Globaler Goldrausch<br />
Unkonventionelle Vorkommen an Schiefergas<br />
und -öl sind inzwischen ein geopolitischer<br />
Faktor geworden – und eine<br />
interessante Alternative für die Industrie<br />
Titelthema<br />
Armaturen für Flüssiggas<br />
4 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
22<br />
38<br />
40<br />
Der boomende LNG-Markt sorgt für<br />
wachsenden Bedarf an Armaturen für das<br />
tiefkalte Gas. Die Einsatztemperatur<br />
muss schon bei der Konstruktion berücksichtigt<br />
werden (Bild: KSB)<br />
Branche<br />
Editorial 3<br />
Nachrichten 10<br />
chemietechnik.de – meistgeklickt 14<br />
Spotlight 98<br />
Jubiläum<br />
Vier Jahrzehnte Chemie 6<br />
Anlagenbau<br />
CT exklusiv<br />
Baupreisindex für Chemieanlagen 16<br />
CT-Trendbericht<br />
Deutsche Anlagenbauer<br />
zwischen Baum und Borke 18<br />
CT-Trendbericht<br />
Internationalisierung im Anlagenbau –<br />
Mehr Chance als Risiko 22<br />
Special Gase<br />
Wie Schiefergas nicht nur die Chemie und den<br />
Anlagenbau verändert 31<br />
Übersicht<br />
Aktuelle Anlagenprojekte in den USA 36<br />
22<br />
CT-Trendbericht<br />
Schiefergas und LNG beflügeln Nationen<br />
und Industrie 38<br />
Titelthema<br />
Armaturen für Flüssiggas müssen extremen<br />
Anforderungen standhalten 40<br />
Werkstoffe<br />
Korrosionsfeste Fiberglas-Rohre<br />
ersetzen Edelstahl 46<br />
Schüttguttechnik<br />
Konustrockner für<br />
anspruchsvolle Anwendungen 52<br />
Sicherheitstechnik<br />
Auswahlkriterien für<br />
Stickstoff-Schutzgasabdeckungen 58<br />
Armaturen<br />
Lesen von Druckregler-<br />
Durchflussdiagrammen (Teil 1) 62<br />
Energietechnik<br />
Solare Prozesswärme in<br />
der chemischen Industrie 66
Dosiertechnik<br />
Zentralversorgung für flüssige Chemikalien<br />
aus Behältern 70<br />
Dichtungen<br />
Hochleistungswerkstoffe gegen<br />
explosive Dekompression 74<br />
Automatisierung<br />
Energieoptimierte Fördersysteme<br />
als Komplettlösung 77<br />
Zerstörungsfreie Prüfverfahren<br />
bei Thermometer-Schutzrohren 80<br />
Software schlägt die Brücke zwischen<br />
PLT-Planung und SIL-Berechnung 82<br />
SPECIAL GASE<br />
In unserem Special gehen wir der Frage nach, welchen<br />
Einfluss der Erdgasboom auf den verfahrenstechnischen<br />
Anlagenbau und die weltweite Chemieindustrie haben<br />
wird. Daneben zeigen wir die gigantischen Anlagenbauprojekte,<br />
die derzeit in den USA aufgrund der dortigen<br />
Schiefergasrevolution angeschoben werden<br />
Mit diesem QR-Code geht´s ganz fix zu<br />
www.chemietechnik.de<br />
38 40<br />
CT exklusiv: VDI-Kongress „Industrie 4.0“ 85<br />
Markt<br />
VCI-Umfrage: Chemie erreicht Höchstwerte 90<br />
Management<br />
Lean Management: Vom Probleme lösen<br />
und den Problemen damit 94<br />
Service<br />
Produkte 28, 44, 49, 54, 61, 65, 73, 88<br />
Markt & Kontakt 92<br />
Firmenverzeichnis/Impressum 97<br />
30
JUBILÄUM<br />
40 Jahre CHEMIE TECHNIK<br />
Vier Jahrzehnte Chemie<br />
Highlights der chemischen Technik<br />
Schwaben werden bekanntlich im 40. Lebensjahr<br />
gescheit. Die Fachzeitschrift CHEMIE<br />
TECHNIK war es bereits bei der Geburt.<br />
Nicht nur wegen ihrer Inhalte, sondern<br />
weil sie bereits bei der Gründung auf 96<br />
Jahre Erfahrung bei der Aufbereitung von<br />
Fachwissen zurückgreifen konnte. Denn:<br />
Die CHEMIE TECHNIK war ein „Spin<br />
Off “ der bereits 1876 gegründeten Chemiker-Zeitung<br />
(CZ). Als „Technische Ausgabe“<br />
der CZ wendet sich die CT seit 1972 an<br />
70er Jahre<br />
Nicht nur die Formel 1<br />
hat ihre Gridgirls. In den<br />
70er Jahren schmückten<br />
auch Apparatebauer ihre<br />
Produkte mit Mädchen.<br />
Das Pressefoto von Thyssen<br />
zeigt einen 58 Tonnen<br />
schweren Druckbehälter<br />
mit Kugelkalotte, der<br />
durch „formgebendes<br />
Schmelzen“ hergestellt<br />
wurde.<br />
Bild: Thyssen<br />
Bild: CEphoto, Uwe Aranas<br />
Praktiker und Entscheider in der Chemie,<br />
aber auch an Planer und Anlagenbauer.<br />
Die Startauflage von 10.000 Exemplaren<br />
hat sich in den vergangenen 40 Jahren<br />
verdreifacht. CHEMIE TECHNIK ist damit<br />
das auflagenstärkste Monatsmagazin<br />
unter den deutschen Titeln für chemische<br />
Technik. Einige Highlights aus den vergangenen<br />
vier Jahrzehnten chemischer<br />
Technik haben wir für Sie auf den folgenden<br />
Seiten zusammengestellt.<br />
1973<br />
Infolge der von der Opec durch Preiserhöhungen<br />
ausgelösten ersten Ölkrise kommt es zu Sonntagsfahrverboten.<br />
Für Italien-Urlauber werden Benzingutscheine<br />
ausgegeben.<br />
1976<br />
Die Ursache der Seveso-Katastrophe:<br />
Bei der Produktion von Trichlorphenol,<br />
einem Vorprodukt für das Desinfektionsmittel<br />
Hexachlorophen, entsteht bei<br />
erhöhter Temperatur das hochgiftige<br />
2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin (TCDD).<br />
1972<br />
1976<br />
Der Chemieunfall im italienischen Seveso<br />
führte zur Freisetzung hochgiftigen Dioxins<br />
und löste weltweit Maßnahmen zum Schutz<br />
gegen toxische Chemikalien aus. Darunter die<br />
Seveso- bzw. Störfall-Richtlinie.<br />
1979<br />
1972-2012 – 40 Jahre CHEMIE TECHNIK<br />
6 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Bild: Titelseite CHEMIE TECHNIK 1/1972<br />
Bilder: mnovelo / chocorange - fotolia.com
Bild: RAG<br />
40 Jahre CHEMIE TECHNIK JUBILÄUM<br />
70er und 80er Jahre<br />
Ölkrise sendet Schockwellen durch die deutsche (Chemie-)Industrie<br />
Als die Opec im Oktober 1973 beschließt,<br />
den Ölpreis um 70 Prozent<br />
anzuheben, sendet dies Schockwellen<br />
durch die Industrienationen. Als Protest<br />
der arabischen Länder gegen die<br />
westliche Unterstützung Israels im<br />
Jom-Kippur-Krieg gedacht, führt die<br />
Aktion dem Westen seine Abhängigkeit<br />
von fossilen Energieträgern vor<br />
Augen. Sonntagsfahrverbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen<br />
zeigten<br />
in Deutschland keinen nennenswerten<br />
Spareffekt. Das Bundeswirtschaftsministerium<br />
startete aber die<br />
Kampagne „Energiesparen – unsere<br />
1981<br />
Öl aus deutscher Kohle ist keine<br />
Utopie mehr: In der Kohleöl-<br />
Großversuchsanlage in Bottrop<br />
verflüssigt die Ruhrkohle AG<br />
täglich 200 Tonnen Kohle zu<br />
100 Tonnen Mineralölprodukten<br />
und Flüssiggas.<br />
beste Energiequelle“. In der Chemieindustrie<br />
wurden Projekte wie die<br />
Kohleverflüssigung umsgesetzt. Außerdem<br />
forcierte der Wunsch nach<br />
Energieautarkie den Bau von Kernkraftwerken.<br />
Auch die BASF plante,<br />
auf ihrem Werksgelände in Ludwigshafen<br />
ein Kernkraftwerk zu bauen,<br />
gab das Projekt allerdings 1976 auf.<br />
Alternative Energiequellen und Energiesparmaßnahmen<br />
rückten in den<br />
Fokus. 1979 verdoppelte sich der Ölpreis<br />
infolge der islamischen Revolution<br />
im Iran innerhalb kurzer Zeit und<br />
führte zu einer zweiten Ölkrise.<br />
Bild: Foxboro<br />
80er Jahre<br />
Durch die Einführung der Mikrocontroller<br />
werden mehr und mehr Abläufe in<br />
der Chemie automatisiert. Steuerungsfunktionen<br />
werden auf Funktionskarten<br />
wie der im Bild gespeichert. Das<br />
komplette Magazin stellt lediglich ein<br />
Regelmodul dar.<br />
1988<br />
„Touchscreen“ und Vokuhila: Bei<br />
Bayer in Leverkusen wird die neue<br />
Klärschlamm- und Abwasserkonzentratverbrennungsanlage<br />
per<br />
Computer gesteuert.<br />
1985 1991<br />
1972-2012 – 40 Jahre CHEMIE TECHNIK<br />
Bild: Bayer<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar<br />
2013 7<br />
Bild: Krupp
Bild: Bayer<br />
JUBILÄUM<br />
40 Jahre CHEMIE TECHNIK<br />
90er Jahre<br />
Chemie-Strukturwandel: Werke werden zu Industrieparks<br />
In den 90er Jahren vollzog sich in der deutschen Chemie ein<br />
tiefgreifender Strukturwandel. Konzentration auf das Kerngeschäft<br />
lautete die Devise. Jürgen Dormann, Vorstandschef der<br />
Hoechst AG, gliederte Chemie-, Pharma- und Standortgeschäft<br />
in verschiedene Gesellschaften aus. Aus den einstmals geschlossenen<br />
Werksstandorten wurden Chemieparks, die von<br />
Infrastrukturgesellschaften wie Infraserv, Bayer Industrie Services<br />
(heute Currenta) oder Infracor (ehem. Degussa, heute<br />
Evonik Site Services). Die Blaupause für die rechtlich anspruchsvolle<br />
Neuordnung der Industrieparks hatten Anfang<br />
der 90er Jahre die aufgelösten Chemiekombinate der wiedervereinigten<br />
DDR geliefert. Bis heute ist das Chemiepark-Konzept<br />
der deutschen Chemieindustrie eine weltweit vielbeachtete<br />
Erfolgsstory. Auch Chemiestandorte in China und Indien orientieren<br />
sich an diesem Vorbild.<br />
90er Jahre<br />
Der Chemieanlagenbau<br />
erlebte in den<br />
90er Jahren durch<br />
das Aufblühen der<br />
CAE-Technik einen<br />
deutlichen Produktivitätszuwachs.<br />
Bild: BASF<br />
1995<br />
In einem Gasteditorial<br />
in der CHEMIE<br />
TECHNIK warb die<br />
damalige Bundesumweltministerin<br />
Angela Merkel für<br />
die Vereinfachung<br />
des Umweltrechts.<br />
1994<br />
An ihrem Standort in<br />
Antwerpen nahm die<br />
BASF im Jahr 1994 den<br />
damals weltweit größten<br />
Steamcracker in Betrieb.<br />
Den Bau ließ sich<br />
der Chemiekonzern<br />
1,3 Mrd. DM kosten.<br />
1997<br />
1999<br />
Zum Jahrtausendwechsel drohte zwar kein<br />
Maya‘scher Weltuntergang, doch das Jahr-<br />
2000-Problem bereitete den Automatisierern<br />
in der Chemie Kopfzerbrechen.<br />
2003<br />
Auf Grund der kurzen Übergangsfrist<br />
von 1994 bis 2003<br />
trifft das Inkrafttreten der<br />
Atex-Richtlinie 94/9/EG Gerätehersteller<br />
und Betreiber so<br />
unerwartet wie Weihnachten.<br />
1972-2012 – 40 Jahre CHEMIE TECHNIK<br />
Bild: Bundespresseamt<br />
Bild: Infraserv/Hoecst AG<br />
2003
Bild: Lanxess<br />
2000 bis heute<br />
China-Boom und Megaprojekte<br />
Die Jahre seit dem Jahrtausendwechsel<br />
sind von einer zunehmenden Globalisierung<br />
der Chemieindustrie geprägt.<br />
Die Direktinvestitionen deutscher<br />
Chemieunternehmen im Ausland<br />
übertreffen die Investitionen an<br />
deutschen Standorten. Einen wichtigen<br />
Schwerpunkt bilden neue Werke<br />
in China. Sowohl Bayer als auch<br />
BASF und Degussa bauen in Ostchina<br />
eigene Werke oder integrieren sich<br />
in dortige Chemieparks. Aber auch<br />
Malaysia und Singapur werden zu<br />
wichtigen Sprungbrettern in den asiatischen<br />
Markt.<br />
2005<br />
Globalisierung wörtlich genommen:<br />
Lanxess schickte eine<br />
komplette Hydrazinhydrat-<br />
Anlage auf die Reise von Baytown,<br />
USA, ins ostchinesische<br />
Weifang.<br />
Für den deutschen (Groß-)Anlagenbau<br />
werden die Jahre bis 2008 zur<br />
goldenen Ära. Linde, Lurgi und Uhde<br />
wickeln vor allem im Mittleren Osten<br />
Megaprojekte ab, darunter den World<br />
Scale Cracker im Bild oben rechts,<br />
den Linde für Borouge in Abu Dhabi<br />
baut. Seit der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise<br />
2008/2009 hat sich das<br />
Projektgeschäft allerdings stark verändert.<br />
Globale Anbieter und neue<br />
Wettbewerber aus China und Südkorea<br />
machen dem deutschen Anlagenbau<br />
zu schaffen. Neue Chancen entstehen<br />
derzeit in den USA.<br />
Bild: Redaktion<br />
2005<br />
„Verbund“ auf chinesisch: Im September<br />
2005 eröffnete die BASF ihren integrierten<br />
Verbundstandort Nanjing in China.<br />
Das Werk ist ein 50:50 Joint Venture mit<br />
der China Petroleum & Chemical Company<br />
(Sinopec).<br />
40 Jahre CHEMIE TECHNIK JUBILÄUM<br />
2011<br />
Mit dem 1. Engineering Summit schaffen<br />
VDMA und Süddeutscher Verlag<br />
eine Netzwerk-Plattform für den Anlagenbau<br />
europäischer Prägung.<br />
Heute<br />
Der durch Fracking unkonventioneller Gasvorkommen<br />
in den USA ausgelöste Gas-Boom verändert<br />
Chemie und Anlagenbau. LNG-Tanker machen den<br />
Energieträger mobil.<br />
19XX<br />
2012<br />
1972-2012 – 40 Jahre CHEMIE TECHNIK<br />
Bild: BASF<br />
Bild: R. Stahl/Pixelio<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
9<br />
Bild: Nasa Bild: Linde
NACHRICHTEN<br />
Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.chemietechnik.de abonnieren<br />
PROJEKTE<br />
• Lanxess errichtet im Chemiepark Ningbo in<br />
China eine Produktionsanlage für Eisenoxidrot-Pigmente.<br />
Das Investitionsvolumen<br />
liegt bei 55 Mio. Euro, die Kapazität ist zunächst<br />
auf 25.000 t p.a. ausgelegt.<br />
• Evonik und Petronas haben einen Letter of<br />
Intent für ein Projekt unterzeichnet. In Malaysia<br />
sollen bis 2016 Produktionsanlagen<br />
mit einer Kapazität von 220.000 t Isononanol,<br />
110.000 t 1-Buten und 250.000 t<br />
Wasserstoffperoxid entstehen.<br />
• Toyo Engineering und PT Rekayasa Industri<br />
bauen den Düngemittelkomplex „Pusri IIB“<br />
für die staatliche Indonesische Düngemittelfirma<br />
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.<br />
Die Anlage in Sumatra soll ab 2015 pro<br />
Tag 2.000 t Ammoniak und 2.750 t Harnstoff<br />
produzieren.<br />
• Evonik baut in Marl bis 2015 die Kapazität<br />
für 1-Buten um 75.000 t, in Antwerpen die<br />
für Butadien um 100.000 t sowie in Marl<br />
und Antwerpen die Kapazitäten für MTBE<br />
um insgesamt 150.000 t aus.<br />
• Die BASF wird ihre globale Kapazität zur<br />
Produktion des chemischen Zwischenprodukts<br />
1,6-Hexandiol (HDO) bis 2014 um<br />
mehr als 20 % auf über 50.000 t p.a. erhöhen.<br />
• Evonik wird seine Jahreskapazität für gefällte<br />
Kieselsäure im US-amerikanischen<br />
Chester um rund 20.000 t erweitern.<br />
• Fluor hat von Ma‘aden einen Auftrag über<br />
200 Mio. US-Dollar für den Standort Umm<br />
Wu‘al erhalten, der PMC-Leistungen im<br />
Zusammenhang mit der Ausführung des<br />
Phosphatprojektes Umm Wu‘al in Saudi-<br />
Arabien umfasst.<br />
• Die M+W Group hat von der BASF einen<br />
Großauftrag für eine schlüsselfertige Salpetersäure-Anlage<br />
erhalten. Der Auftrag<br />
umfasst Planung, Beschaffung, schlüsselfertigen<br />
Bau sowie die Inbetriebnahme bis<br />
Ende 2014.<br />
NEU: Noch mehr Projekte<br />
auf www.chemietechnik.de,<br />
rechte Leiste „Projekte“<br />
10 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Vorplanungen für GTL-Komplex<br />
und Ethan-Cracker laufen<br />
Megaprojekt<br />
nimmt Formen an<br />
Das südafrikanische Chemieunternehmen Sasol<br />
hat mit der Vorplanung (FEED) für eine integrierte<br />
GTL-Anlage und einer Ethan-Cracking-<br />
Großanlage mit nachgeordneten Derivaten in<br />
Louisiana, USA, begonnen. Das geschätzte<br />
Investitionsvolumen für beide Anlagen zusammen<br />
liegt zwischen 16 und 21 Mrd. US-Dollar.<br />
David Constable, CEO von Sasol, hat gemeinsam<br />
mit Bobby Jindal, dem Gouverneur von Louisiana,<br />
erklärt, dass weitreichende Möglichkeiten vorliegen,<br />
um die reichlich vorhandenen Gasreserven in<br />
den Vereinigten Staaten mithilfe der GTL-Erfahrung<br />
(Gas-to-Liquids) und Technologie von Sasol<br />
aufzubereiten. Das kommerziell bewährte GTL-<br />
Verfahren diversifiziert die Verwendung von Erdgas<br />
durch die Produktion von hochwertigen Flüssigtreibstoffen<br />
und Chemikalien. Gouverneur Jindal<br />
berichtet: „Dieses Projekt wird die größte Einzelinvestition<br />
in Produktionsanlagen in der Geschichte<br />
Louisianas sein, stellt aber auch eine der größten<br />
ausländischen Direktinvestitionen in Produktionsanlagen<br />
in der Geschichte der gesamten Vereinigten<br />
Staaten dar. Die GTL-Anlage, die erste ihrer Art<br />
in den USA, wird 4 Mio. t/a (mtpa) bzw. 96.000<br />
Doppelspitze übernimmt Geschäftsleitung<br />
Ralf Müller und Dr. Clemens Mittelviefhaus wurden<br />
von den Gesellschaftern mit der Geschäftsleitung<br />
der Infraserv Knapsack zum 1. Januar 2013 betraut.<br />
Ralf Müller ist neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung.<br />
Müller und Mittelviefhaus wurden<br />
Nachfolger von Helmut Weihers, der zum 31. Dezember<br />
vergangenen Jahres in den Ruhestand<br />
gegangen ist. Mit der internen Nachbesetzung<br />
schreibt der Betreiber und Dienstleister seinen<br />
Wachstumskurs mit Industriedienstleistungen außerhalb<br />
des Chemieparks Knapsack fort.<br />
Ralf Müller war maßgeblich an der Entwicklung,<br />
der Implementierung sowie der ersten Umsetzung<br />
des Weges, der vor zwei Jahren eingeschlagen<br />
wurde, beteiligt. In seiner Rolle als COO verantwortete<br />
er bereits mit Helmut Weihers das operative<br />
Geschäft. Dr. Clemens Mittelviefhaus ist seit Sep-<br />
Barrel pro Tag an qualitativ hochwertigem Transportkraftstoff,<br />
darunter auch GTL-Diesel und andere<br />
chemische Produkte produzieren. Die aktuellen<br />
Projektkosten für die GTL-Anlage liegen voraussichtlich<br />
zwischen 11 und 14 Mrd. US-Dollar. Das<br />
GTL-Projekt wird in zwei Phasen geliefert, die eine<br />
Kapazität von jeweils 48.000 Barrel pro Tag haben.<br />
Die erste Anlage wird voraussichtlich im Kalenderjahr<br />
2018, die zweite Anlage im darauf folgenden<br />
Kalenderjahr in Betrieb genommen.<br />
Die Ethan-Cracking-Großanlage ermöglicht Sasol,<br />
sein differenziertes Ethylenderivate-Geschäft in<br />
den USA auszubauen. Der Cracker wird auch von<br />
den momentan niedrigen Erdgaspreisen in den<br />
USA und dem Reichtum an Ethan profitieren. Die<br />
aktuellen Projektkosten für den Cracker liegen etwa<br />
zwischen 5 und 7 Mrd. US-Dollar. Sasol erwar-<br />
Die Infraserv Knapsack hat eine neue Doppelspitze<br />
in der Geschäftsleitung<br />
tember 2010 Leiter Fertigungstechnik sowie als<br />
Mitglied der Unternehmensleitung der Infraserv<br />
Knapsack tätig. www.infraserv-knapsack.de<br />
Bild: Infraserv Knapsack
TICKER<br />
Ausführliche Nachrichten unter: www.chemietechnik.de<br />
Bild: Shirophoto – Fotolia.com<br />
tet, einen gewinnbringenden Betrieb im Laufe des<br />
Kalenderjahrs 2017 zu erzielen. Es werden rund<br />
1,5 Mio. t/a an Ethylen mit nachgeschalteten Derivat-Anlagen<br />
produziert werden. Das Chemieunternehmen<br />
hat außerdem ein Portfolio an ethylenbasierten<br />
Technologien, um der zunehmenden Nachfrage<br />
nach Chemikalien mit einer hohen Wertschöpfung<br />
gerecht werden zu können.<br />
Sasol kündigte ebenfalls an, dass die nächste<br />
Stufe seiner im Westen Kanadas geplanten GTL-<br />
Anlage schrittweise angegangen wird. Die Investitionsmöglichkeit<br />
wird, in Übereinstimmung mit der<br />
Priorisierung des Wachstumsportfolios, nach den<br />
integrierten GTL- und Cracker-Projekten in Lake<br />
Charles stufenweise durchgeführt. Eine Entscheidung,<br />
mit FEED fortzufahren, wird später in Betracht<br />
gezogen werden. www.sasol.com<br />
• UL, ein US-amerikanisches Unternehmen im<br />
Bereich Sicherheitsverbesserung aus Northbrook,<br />
hat Innovadex in Overland Park übernommen,<br />
die eine Such- und Informationsaustausch-Plattform<br />
für Chemikalien, Polymere, Inhaltsstoffe<br />
und Rohmaterialien betreibt.<br />
• Das schweizer Spezialchemie-Unternehmen<br />
Clariant mit Hauptsitz in Muttenz hat eine Übernahmevereinbarung<br />
mit dem Unternehmen<br />
CRM International unterzeichnet. Die Firma hat<br />
ihren Sitz in Frankreich und stellt natürliche Inhaltsstoffe<br />
für die Personal-care-Industrie her.<br />
Currenta ordnet Chempark-Leitung neu<br />
Die Chemiepark-Betreibergesellschaft Currenta<br />
hat zum 1. Januar 2013 die Führung seines Chemieparks<br />
und die Nachbarschaftsarbeit neu geordnet.<br />
Ernst Grigat leitet seitdem die Standorte Leverkusen,<br />
Dormagen und Krefeld-Uerdingen.<br />
Bisher gab es drei Chempark-Leiter, die diese<br />
Funktion neben anderen geschäftsbezogenen Aufgaben<br />
erfüllt haben. In der neuen Currenta-Struktur<br />
gibt es jetzt mit Grigat einen Chempark-Leiter,<br />
der für die Gemeinschaft der 70 Unternehmen an<br />
den drei Standorten zentrale Themen vertritt. Dies<br />
sind Infrastruktur-, Logistik-, Planungs- und Genehmigungsfragen<br />
sowie der intensive Dialog mit<br />
der Nachbarschaft.<br />
Zusätzlich gibt es an jedem Standort einen Leiter<br />
Politik- und Bürgerdialog für Fragen der Nachbarschaft<br />
rund um den Chempark. In Leverkusen<br />
übernimmt Christian Zöller, in Dormagen Jobst<br />
Wierich und in Krefeld-Uerdingen Mario Bernards<br />
diese Aufgabe. Sichtbar wird der verstärkte Dialog<br />
bald auch in den Innenstädten von Leverkusen,<br />
• Swagelok hat den US-Ventilhersteller Innovative<br />
Pressure Technologies übernommen.<br />
• Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 hat die Bilfinger<br />
Group das neue Segment Bilfinger Industrial<br />
organisatorisch neu ausgerichtet: Die beiden<br />
Teilkonzerne Bilfinger Industrial Services und<br />
Bilfinger Industrial Technologies vertreten dieses<br />
Segment künftig gemeinsam.<br />
• Der Aufsichtsrat der GEA Group hat Markus<br />
Hüllmann, bisher Präsident des Segments GEA<br />
Mechanical Equipment, mit Wirkung zum 1. April<br />
2013 zum Vorstandsmitglied der GEA Group<br />
Uerdingen und Dormagen durch die geplanten<br />
Nachbarschaftsbüros „Chempunkt“. Zudem hat Dr.<br />
Stefan Dresely, der bisherige Leiter des Chempark<br />
Krefeld-Uerdingen, die Leitung des Currenta-Geschäftsfelds<br />
Energie übernommen.<br />
www.currenta.de<br />
Investment: 350 Mio. US-Dollar in Ethanol-Produktion<br />
BP Biofuels plant, in seine Ethanol-Produktion in<br />
Brasilien 350 Mio. US-Dollar zu investieren, um die<br />
Prozessmenge für Ethanol in seiner Zuckerrohr-<br />
Verarbeitungsanlage zu erhöhen. Die Erweiterung<br />
umfasst unter anderem den Neubau einer Mühle in<br />
Edeia in Brasilien. Die Kapazität für die Zuckerrohr-<br />
Verarbeitung von Tropical, einem Unternehmen von<br />
Bild: Currenta<br />
Tägliche Nachrichten und ausführliche Berichte<br />
finden Sie auf www.chemietechnik.de oder scannen<br />
Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder<br />
Tablet-Computer ein.<br />
Chempark-Leiter Dr. Ernst Grigat (l.) gemeinsam<br />
mit Christian Zöller (r.), seit Januar 2013 Leiter<br />
Politik- und Bürgerdialog<br />
BP, wird sich dadurch von 2,5 auf 5 Mio. t verdoppeln.<br />
Das entspricht einer Produktion von 450<br />
Mio. l Ethanol p.a.. Die Mühle soll Anfang 2015<br />
ihre volle Produktionskapazität erreicht haben.<br />
Neben dem Ethanol wird die Anlage zudem voraussichtlich<br />
340 GWh Strom in das brasilianische<br />
Stromnetz einspeisen. www.bp.com<br />
ernannt. Er folgt Niels Graugaard, der am 18.<br />
April in den Ruhestand geht.<br />
• Mit der Übernahme der US-amerikanischen<br />
Gayesco beabsichtigt Wika, das Produktportfolio<br />
für die petrochemische und Prozessindustrie<br />
zu erweitern.<br />
• Dr. Wilhelm Sittenthaler, Mitglied des Vorstands<br />
und Arbeitsdirektor der Wacker Chemie in München,<br />
hat zum 31. Dezember 2012 sein Amt<br />
niedergelegt und ist aus dem Unternehmen<br />
ausgeschieden. Für ihn ist Dr. Tobias Ohler in<br />
den Vorstand nachgerückt.<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
11
NachrichteN<br />
Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.chemietechnik.de abonnieren<br />
Düngemittelfabrik entsteht in der Türkei<br />
Der Anlagenbauer Thyssenkrupp Uhde<br />
hat nach drei Großprojekten in<br />
den USA nun ein Düngemittelprojekt<br />
in der Türkei gewonnen: Für rund<br />
141 Mio. Euro soll das Unternehmen<br />
für Bandirma Gübre Fa bri ka lari<br />
(BAGFAS) eine Anlage zur Herstellung<br />
von Kalzium-Ammonium-Nitrat<br />
(CAN) liefern. Die neue Anlage wird in<br />
das bereits existierende Werksgelände<br />
an der Südküste am Marmara-<br />
Meer integriert. Die schlüsselfertig<br />
gelieferte Düngerfabrik soll Anfang<br />
2015 in Betrieb gehen. Der neue<br />
Komplex besteht aus einer Salpeter-<br />
BASF: strategische Planung und<br />
„Verbund“ neu besetzt<br />
Die BASF hat für den Standort Ludwigshafen ab 1. Juni 2013 einen<br />
neuen Werksleiter<br />
Dr. Bernhard Nick, derzeit President,<br />
Verbund Site Management Europe,<br />
wird zum 1. Juli 2013 die Leitung<br />
des Bereichs Strategic Planning &<br />
Controlling übernehmen. Er folgt auf<br />
Dr. Walter Gramlich, der nach 34<br />
Jahren bei der BASF zum 30. Juni<br />
2013 in den Ruhestand geht. Dr.<br />
Friedrich Seitz, derzeit President,<br />
Process Research & Chemical Engineering,<br />
übernimmt zum 1. Juni<br />
12 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Dünger geht immer: Thyssenkrupp<br />
Uhde baut in der Türkei<br />
eine Düngemittelanlage<br />
Bild: BASF<br />
Bild: Sinisa Botas – Fotolia.com<br />
säure-Anlage mit einer Kapazität von<br />
1.195 t/d. Die Salpetersäure soll<br />
wahlweise in 2 kt/d CAN-Granulat<br />
oder in 1,55 kt/d Ammoniumnitrat<br />
(AN) umgesetzt werden. Außerdem<br />
soll ein atmosphärisches Ammoniak-<br />
Tanklager mit einer Kapazität von<br />
20.000 t geplant und geliefert werden.<br />
Für Thyssenkrupp Uhde ist es<br />
der zweite Großauftrag von BAGFAS.<br />
1980 wurden am gleichen Standort<br />
eine Anlage für Mischdünger, Nitrophosphat-<br />
sowie für Diammonphosphatschlüsselfertig<br />
übergeben.<br />
www.thyssenkrupp-uhde.de<br />
2013 die Leitung des Bereichs Verbund<br />
Site Management Europe von<br />
Nick und damit auch die Werksleitung<br />
für den Standort Ludwigshafen.<br />
Dr. Peter Schuhmacher tritt zum 1.<br />
Mai 2013 die Nachfolge von Seitz als<br />
Leiter des Bereichs Process Research<br />
& Chemical Engineering an.<br />
Schuhmacher ist derzeit Senior Vice<br />
President Strategic Planning.<br />
www.basf.de<br />
ABB-Geschäftsbereich<br />
Chemie unter neuer Leitung<br />
Dr. Peter Hortig hat zum 1. Februar<br />
2013 die Leitung der lokalen Business<br />
Unit Öl, Gas und Petrochemie<br />
(LBU OGP) innerhalb der ABB-Division<br />
Prozessautomation in Deutschland<br />
übernommen. Er folgte auf Daniel<br />
Huber, der die LBU OGP kommissarisch<br />
zusätzlich zu seiner Aufgabe<br />
als Divisionsleiter Prozessautomation<br />
in Zentraleuropa geführt hat. Hortig<br />
absolvierte ein Maschinenbaustudium<br />
an der Technischen Universität<br />
Darmstadt. Er wechselt von Linde zu<br />
ABB; bei Linde bekleidete er verschiedene<br />
Managementpositionen<br />
im Engineering und im Industriegasegeschäft,<br />
zum Beispiel als Project<br />
Director des Hammerfest LNG Projektes<br />
(Liquefied Natural Gas) oder<br />
Thomas Steckenreiter wechselt<br />
von Endress+Hauser zu BTS<br />
Dr. Thomas Steckenreiter wird neuer<br />
Divisionsleiter Operation Support &<br />
Safety bei Bayer Technology Services<br />
(BTS) in Leverkusen. Er wird dort<br />
Nachfolger von Dr. Norbert Kuschnerus,<br />
der in den Ruhestand geht. Steckenreiter,<br />
bislang Direktor Marketing<br />
bei Endress+Hauser Conducta<br />
in Gerlingen, wechselt zum 1. Juli<br />
2013 zu BTS. Als Mitglied des BTS<br />
Management Committees übernimmt<br />
er die weltweite Verantwortung<br />
für die Division Operation Sup-<br />
Neuer Vorsitzender bei der Dechema<br />
Prof. Dr. Rainer Diercks übernimmt<br />
zum 1. Januar 2013 den Vorsitz der<br />
Dechema Gesellschaft für Chemische<br />
Technik und Biotechnologie in<br />
Frankfurt. Diercks ist Präsident des<br />
Unternehmensbereichs Petrochemicals<br />
der BASF; er gehört dem Vorstand<br />
des Vereins seit 2006 an. Zudem<br />
war Diercks Vorsitzender der<br />
Deutschen Gesellschaft für Katalyse<br />
und Mitglied des Processnet-Vorstands.<br />
„Wichtige Herausforderungen<br />
wie die Rohstoff- und Energiesi-<br />
Bild: ABB<br />
Dr. Peter<br />
Hortig ist der<br />
neue Leiter<br />
des Geschäftsbereiches<br />
Chemie bei<br />
ABB<br />
bei der Kommerzialisierung eines<br />
von Linde mit einem Partnerunternehmen<br />
entwickelten Erdgasverflüssigungskonzeptes<br />
für den Offshore-<br />
Einsatz. Zuletzt war er als Senior<br />
Manager Business Development für<br />
die Akquisition von großen Onsite-<br />
Industriegasegeschäften in der Region<br />
Europe, Middle East & Africa verantwortlich.<br />
www.abb.de<br />
port & Safety als Nachfolger von<br />
Kuschnerus. „Dr. Steckenreiter besitzt<br />
fundierte Erfahrung in den Bereichen<br />
Prozesssicherheit und -analysentechnik.<br />
Er verfügt über besondere<br />
Qualitäten, die für den fokussierten<br />
Ausbau unseres Portfolios<br />
und damit unseres zukünftigen Geschäfts<br />
von großer Bedeutung sind“,<br />
sagte BTS-Geschäftsführer Dr. Dirk<br />
Van Meirvenne. Steckenreiter ist seit<br />
2001 bei Endress+Hauser tätig.<br />
www.bayertechnology.com<br />
cherung können nur interdisziplinär<br />
und im Zusammenspiel von Industrie<br />
und Forschungseinrichtungen gelöst<br />
werden“, berichtet Diercks. „Die Dechema<br />
sorgt dafür, dass die richtigen<br />
Leute zusammenarbeiten, und gibt<br />
der angewandten Forschung eine<br />
starke Stimme.“ Diercks folgt auf Dr.<br />
Hans Jürgen Wernicke, der das Amt<br />
seit 2010 innehatte. Wernicke wird<br />
auch weiterhin dem Dechema-Vorstand<br />
angehören.<br />
www.dechema.de
Bild: VDMA<br />
Tägliche Nachrichten und ausführliche Berichte<br />
finden Sie auf www.chemietechnik.de oder scannen<br />
Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder<br />
Tablet-Computer ein.<br />
Auftragseingang knapp unter Vorjahresniveau<br />
Auftragseingang im deutschen Maschinenbau<br />
preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2010 = 100<br />
saisonbereinigte, geglättete Indizes<br />
Originalindizes<br />
Im Geschäft mit den Inlandskunden setzte sich die bereits im Oktober zu<br />
beobachtende Stabilisierung fort<br />
Der Verband Deutscher Maschinen-<br />
und Anlagenbau (VDMA) hat die Zahlen<br />
des Auftragseingangs im Maschinen-<br />
und Anlagenbau für den November<br />
2012 vorgestellt: Er liegt um<br />
real 3 % unter dem Ergebnis des<br />
Vorjahres. Das Inlandsgeschäft sank<br />
um 2 %, das Auslandsgeschäft lag<br />
um 4 % unter dem Vorjahresniveau.<br />
In dem von kurzfristigen Schwankungen<br />
weniger beeinflussten<br />
Dreimonatsvergleich September bis<br />
November 2012 ergibt sich insgesamt<br />
ein Plus von 5 % im Vorjahres-<br />
Mehrere Geschäfte an SK Capital veräußert<br />
Das Chemieunternehmen Clariant<br />
veräußert die Geschäfte Textile Chemicals,<br />
Paper Specialties sowie<br />
E mul sions an die private Investmentgesellschaft<br />
SK Capital in New York.<br />
Die Gesamtsumme der Transaktion<br />
beläuft sich auf etwa 502 Mio. CHF.<br />
Clariant erhält davon rund 460 Mio.<br />
CHF in bar. Vorbehaltlich der Zustimmung<br />
der Wettbewerbsbehörden soll<br />
sie bis zum Ende des 2. Quartals<br />
2013 abgeschlossen sein.<br />
„Nach der erfolgreichen Akquisition<br />
der Süd-Chemie 2011 ist diese<br />
Transaktion für Clariant ein bedeutender<br />
Meilenstein in der Umsetzung<br />
der profitablen Wachstumsstrategie“,<br />
berichtet Clariant-CEO Hariolf<br />
vergleich. Die Inlandsaufträge lagen<br />
bei minus 6 %, die Auslandsaufträge<br />
bei plus 10 %. „Nach zwei Zuwächsen<br />
in Folge verfehlte der Auftragseingang<br />
des Maschinenbaus im November<br />
2012 knapp das Vorjahresniveau.<br />
Im Auslandsgeschäft konnten<br />
die ungewöhnlich hohen Orders der<br />
Monate September/Oktober aus dem<br />
Nicht-Euro-Raum nicht noch einmal<br />
wiederholt werden“, kommentierte<br />
VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers<br />
das Ergebnis.<br />
www.vdma.org<br />
Kottmann. Barry Siadat, Managing<br />
Director bei SK Capital, sagte: „Wir<br />
sind der Ansicht, dass die drei Geschäfte<br />
eine attraktive Plattform bilden,<br />
um von den Gemeinsamkeiten<br />
in den Bereichen Technologie, Produktion,<br />
Lieferkette und Logistik zu<br />
profitieren.“ Die Neupositionierung<br />
des Portfolios ist Bestandteil der<br />
Wachstumsstrategie von Clariant.<br />
Zum Erreichen der für 2015 gesetzten<br />
Ziele konzentriert sich das Unternehmen<br />
auf Märkte mit Zukunftsperspektiven<br />
und hohen Wachstumsraten.<br />
Das Unternehmen hatte Anfang<br />
2012 bekannt gegeben, bis Ende<br />
2013 nach strategischen Optionen<br />
zu suchen. www.clariant.com<br />
Der Preisbrecher<br />
aus Edelstahl<br />
CT.1/2.13, 1/2-Seite, hoch<br />
(86x 257 mm)<br />
Bewährte<br />
Getränke-, Chemie-<br />
und Parmakupplung<br />
Magnetgekuppelte Kreisel-<br />
und Zahnradpumpe<br />
Tribologische Keramik –<br />
robust und langlebig<br />
Ingenieurberatung<br />
vor Ort<br />
Schnellkupplungen<br />
und Dosierpumpen<br />
www.gather-industrie.de<br />
Telefon: 02104 / 77 07-0<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
13
Best of chemietechnik.de<br />
14 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Bild: ©kbuntu - Fotolia.com<br />
Die beliebtesten Berichte auf chemietechnik.de<br />
Wer klickt denn da?<br />
Der Leser, das unbekannte Wesen? Wer ab und an die<br />
CHEMIE TECHNIK zur Hand nimmt, dem wird nicht<br />
entgangen sein, dass die Redaktion auch eine Homepage<br />
mit Inhalten befüllt. Alle Beiträge aus dem Heft stehen<br />
– mit einem kleinen zeitlichen Abstand – auch online<br />
zum Lesen bereit. Das bringt nicht nur den Rezipienten,<br />
also Ihnen, den Vorteil, dass Sie sich jederzeit und vor<br />
allem umfassend auf www.chemietechnik.de über die<br />
neuesten Entwicklungen der chemischen und pharmazeutischen<br />
Prozesstechnik informieren können, auch<br />
wenn Sie das Heft vielleicht mal nicht zur Hand haben.<br />
Nein, auch wir erfahren durch die Abrufe auf unserer<br />
„Verstärkt mit Partnern“<br />
Interview mit Peter Gress,<br />
Corporate Engineering, BASF<br />
Die BASF will bis 2020 ihre Investitionstätigkeit<br />
deutlich ausweiten. Im Gespräch mit der CT-Redaktion<br />
erläutert Engineering-Chef Peter Gress,<br />
wie die Anlagenplaner die Projektflut bewältigen<br />
wollen, wie sich das BASF-Engineering strategisch<br />
aufstellt und welche Rolle die Kontraktoren in Zukunft<br />
spielen werden.<br />
chemietechnik.de/1301ct801<br />
damit‘s nicht knallt<br />
Sicherheitsventile regelkonform<br />
warten und prüfen<br />
Sicherheitsventile sind Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion.<br />
Die Armaturen stellen die letzte<br />
mechanische Instanz bei Versagen aller MSR-seitigen<br />
Überwachungsgeräte dar, damit ein Druckgerät<br />
vor unzulässigem Überdruck geschützt ist. Um<br />
zu gewährleisten, dass Funktionsfähigkeit gegeben<br />
ist, bedarf es einer regelmäßigen Prüfung und<br />
Wartung.<br />
chemietechnik.de/1301ct802<br />
Homepage, welche Themen heiß und welche Produkte<br />
besonders interessant sind. Und diese meistgeklickten<br />
Artikel erstrecken sich über alle Ressorts, von Anlagenbau,<br />
über Pumpen und Armaturen bis hin zu Normung<br />
und Gesetzgebung. Vermutlich ist auch Ihnen der ein<br />
oder andere Beitrag aus 2012 im Heft entgangen – das<br />
muss jetzt nicht mehr sein. Abrisse der Beiträge, die online<br />
besonders viel Aufmerksamkeit erzeugt haben, finden<br />
Sie auf diesen Seiten – natürlich mit den passenden<br />
Direkt-Links und für diejenigen, die die Nahrung fürs<br />
Hirn „to go“ bevorzugen, gibt‘s gleich noch die passenden<br />
QR-Codes zum Abscannen.<br />
erfolgreich realisiert<br />
Automatisierte Probenahme aus<br />
Miniplant-Anlagen<br />
Durch den Wettbewerb bei chemischen Produkten<br />
müssen die Herstellprozesse optimiert werden, um<br />
kostengünstig zu produzieren. Das bedeutet für<br />
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ständige<br />
Anstrengungen, Verfahren zu verbessern, um<br />
das Ergebnis besser zu realisieren. Dies gilt auch<br />
für die Probenahme.<br />
chemietechnik.de/1301ct803<br />
angriff der Zwerge<br />
Siemens will mit Kompaktgeräten den<br />
Coriolis-Markt aufmischen<br />
In puncto Genauigkeit und Nullpunktstabilität führt<br />
bei der Durchflussmessung nach dem Coriolis-<br />
Messprinzip kein Weg am gebogenen Messrohr<br />
vorbei. Auch Siemens setzt nun auf die U-Form und<br />
will sich mit einem hochautomatisiert gefertigten<br />
und nach SIL entwickelten kompakten Massemesser<br />
ein großes Stück vom Coriolis-Kuchen abschneiden.<br />
chemietechnik.de/1301ct804
gute alternative<br />
Spaltrohrmotorpumpen für Flüssiggase<br />
Für Flüssiggase-Förderung kommen vermehrt wellendichtungslose<br />
Spaltrohrmotorpumpen zum Einsatz.<br />
Sie sind kompakt, leicht zu installieren und geräuscharm.<br />
Im Vergleich zu konventionellen Kreisel-<br />
und Magnetkupplungspumpen sind sie eine sicherheitsrelevante<br />
Alternative.<br />
chemietechnik.de/1301ct805<br />
„Der Markt sortiert sich<br />
Derzeit ganz neu“<br />
Interview mit Jürgen Nowicki,<br />
Geschäftsleitung, Linde Engineering<br />
Jürgen Nowicki erläuert im CT-Gespräch Herausforderungen<br />
im Anlagenbau, wie den Umgang mit<br />
asiatischen Wettbewerbern und der Schiefergas-<br />
Revolution und die Frage, wie Lieferanten Teil der<br />
Risiko-Minimierung sind.<br />
chemietechnik.de/1301ct806<br />
neue auswahlkriterien<br />
Chemie-Schlauchnorm EN 12115 : 2011<br />
Mit der Neufassung der Chemie-Schlauchnorm EN<br />
12115 wird die elektrische Leitfähigkeit von Chemieschläuchen<br />
ab sofort in einer erweiterten Form<br />
angegeben. Was der Anwender beachten muss,<br />
lesen Sie hier.<br />
chemietechnik.de/1301ct807<br />
Den MoMent einfangen<br />
Trendbericht Energiespeicher-Lösungen<br />
Wenn die bevorstehende Energiewende gelingen<br />
soll, müssen effiziente Speicherlösungen für Strom<br />
und Wärme gefunden werden. In einer zweiteiligen<br />
Artikelserie haben wir die aktuellen Entwicklungen<br />
recherchiert.<br />
chemietechnik.de/1301ct808<br />
Bits&„Bites“: Machterosion<br />
Dieter Schaudels Kolumne mit Biss<br />
Wenn Emerson zur „Global Exchange“ lädt, kommen<br />
über 1.000 Automatisierer. Die Namur muss<br />
den Zugang zur Hauptsitzung für 600 Teilnehmer<br />
mit Strafgebühren drosseln. Von den über 21.000<br />
Mitgliedern der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und<br />
Automatisierungstechnik kamen weniger als 500<br />
zu deren Hauptereignis Automation 2012, also<br />
keine 2,4 Prozent.<br />
chemietechnik.de/1301ct809<br />
Best of chemietechnik.de<br />
„ VEGA-Sensoren garantieren<br />
die optimale Auslastung<br />
Ihrer Silos.“<br />
Füllstandmessung mit VEGAPULS-Radarsensoren<br />
für alle Schüttgüter.<br />
Speziell für Schüttgüter entwickelte Radarsensoren liefern<br />
exakte Messwerte – unabhängig von Umgebungsbedingungen<br />
wie Staub oder Lärm. Sie werden für alle Schüttgüter<br />
universell eingesetzt. Dank einfacher Inbetriebnahme ohne<br />
Abgleich und einfachstem Handling sparen Sie Zeit und<br />
Kosten. Die zuverlässige Messung, auch während Silobefüllung<br />
und -austrag, ermöglicht eine wirtschaftliche Nutzung<br />
des Silovolumens.<br />
www.vega.com/de/schuettgut.htm
Markt<br />
Weitere Beiträge zum<br />
Baupreisindex unter<br />
www.chemietechnik.<br />
de/1301ct601 oder<br />
einfach QR-Code<br />
scannen.<br />
16 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
CT exklusiv: Baupreisindex für Chemieanlagen<br />
Die Kostenschraube<br />
dreht sich wieder<br />
Profi-GuiDe<br />
Funktion Branche<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ● ●<br />
Ausrüster ● ● ●<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer ● ● ●<br />
Manager ● ● ●<br />
entSCheiDer-fACtS<br />
Für Planer<br />
Chemieanlagen zu kalkulieren, gleicht einem Blick in die<br />
Kristallkugel: Da zwischen Angebot und Fertigstellung<br />
häufig mehrere Jahre liegen, entscheidet die Preisentwicklung<br />
für die Elemente der Anlagenausrüstung darüber,<br />
ob ein Projekt mit Gewinn oder mit Verlust abgeschlossen<br />
wird. Unser Baupreisindex gibt zumindest<br />
Anhaltspunkte für die Preis- und Kostenentwicklung.<br />
Zur Jahresmitte 2012 konnten Anlagenplaner durchatmen<br />
– die Preise für Chemieanlagen legten damals eine<br />
Verschnaufpause ein. Inzwischen dreht sich die Kostenspirale<br />
wieder. Lag die Teuerung im Zeitraum zwischen<br />
Mai und August 2012 noch bei -0,1 Prozent, sind<br />
Chemieanlagen im Folgequartale um 0,3 % teurer geworden.<br />
Im Vergleich zum Vorjahr betrug das Plus 1,2<br />
Prozent. Während sich die sonst dominierende Untergruppe<br />
„Maschinen und Apparate“ im Quartalsver-<br />
Was die Chemie braucht, ist ihr<br />
lieb und wird immer teurer<br />
● Chemieanlagen sind 2012 im Jahresdurchschnitt um 2,4 Prozent teurer geworden.<br />
● Die Preise für Maschinen und Apparate schwankten im vergangenen Jahr besonders<br />
stark.<br />
● Armaturen legten im Quartalsvergleich um 0,5 Prozent, MSR-Einrichtungen um<br />
0,6 Prozent zu.<br />
● Der CT-Preisindex für Chemieanlagen wird von uns vierteljährlich aktualisiert.<br />
gleich um lediglich 0,1 Indexpunkte verteuerte, legten<br />
Armaturen um 0,5 Prozent und Einrichtungen der<br />
Mess- und Regelungstechnik um 0,6 Prozent zu. Im<br />
Jahresvergleich führt das dazu, dass Chemieanlagen<br />
insgesamt um 1,4 Prozent teurer geworden sind.<br />
Starke Schwankungen bei Apparaten<br />
und Maschinen<br />
Interessant ist ein Blick auf die Entwicklung bei Apparaten<br />
und Maschinen. Diese sind im direkten Vergleich zwischen<br />
November 2012 und November 2011 sogar um 0,8<br />
Prozent billiger geworden. Allerdings waren hier über das<br />
Jahr gesehen auch die stärksten Schwankungen zu verzeichnen.<br />
Im Vergleich der Jahresdurchschnittswerte legten<br />
Maschinen und Apparate um 1,3 Prozent zu.<br />
Bild: ©Andrei Merkulov – Fotolia.com
Grafiken: Redaktion<br />
Leicht aufwärts<br />
130<br />
125<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
Mai 09<br />
Aug 09<br />
Nov 09<br />
Feb 10<br />
Mai 10<br />
Der CT-Preisindex für Chemieanlagen wird vierteljährlich<br />
aktualisiert. In ihm werden nach einer von H.<br />
Kölbel und J. Schulze entwickelten Methode die Gewerke<br />
Apparate Apparate und und Maschinen, Maschinen Rohrleitungen und Arma-<br />
10,0%<br />
Rohrleitungen und Armaturen<br />
turen, MSR-Einrichtungen, MSR-Einrichtungen Isolierung und Anstrich,<br />
Elektrotechnische Isolierung und Anstrich<br />
8,0%<br />
Ausrüstung sowie Bauteilkosten zu<br />
Elektrotechnische Ausrüstung<br />
einem Index Bauteilkosten berechnet, dessen Basis das Jahr 2005<br />
6,0%<br />
4,0%<br />
2,0%<br />
0,0%<br />
-2,0%<br />
-4,0%<br />
-6,0%<br />
-8,0%<br />
Mai 09<br />
Aug 09<br />
Apparate und Maschinen<br />
Rohrleitungen und Armaturen<br />
MSR- Einrichtungen<br />
Malerarbeiten, Beschichtungen<br />
Elektrotechnische Ausrüstung<br />
Bauteilkosten<br />
Planungskosten<br />
Chemieanlagen insgesamt<br />
Chemieanlagen ohne Planungskosten<br />
Planungskosten<br />
Nov 09<br />
Feb 10<br />
Mai 10<br />
Aug 10<br />
Nov 10<br />
Aug 10<br />
Feb 11<br />
Nov 10<br />
Mai 11<br />
Feb 11<br />
Aug 11<br />
Mai 11<br />
Nov 11<br />
Feb 12<br />
Aug 11<br />
Mai 12<br />
Nov 11<br />
Aug 12<br />
Indexbasis: 2005 = 100<br />
Entwicklung des Baupreisindex für Chemieanlagen sowie für Einzelgewerke<br />
Chemieanlagen insgesamt<br />
Chemieanlagen ohne Planungskosten<br />
Feb 12<br />
Nov 12<br />
Mai 12<br />
Aug 12<br />
Nov 12<br />
Mai 09<br />
Aug 09<br />
Nov 09<br />
Feb 10<br />
Schwankend bergauf<br />
10,0%<br />
8,0%<br />
6,0%<br />
4,0%<br />
2,0%<br />
0,0%<br />
-2,0%<br />
-4,0%<br />
-6,0%<br />
-8,0%<br />
Mai 09<br />
Aug 09<br />
Mai 10<br />
Aug 10<br />
Nov 10<br />
Apparate und Maschinen<br />
Rohrleitungen und Armaturen<br />
MSR-Einrichtungen<br />
Isolierung und Anstrich<br />
Elektrotechnische Ausrüstung<br />
Bauteilkosten<br />
Planungskosten<br />
Chemieanlagen insgesamt<br />
Chemieanlagen ohne Planungskosten<br />
Nov 09<br />
Feb 10<br />
(=100) bildet. Aus der Gewichtung der Einzelgewerke<br />
resultiert ein Index für die Preisentwicklung von Chemieanlagen.<br />
Die detaillierten Daten senden wir Ihnen per E-Mail<br />
gegen Rechnung gerne zu. Zahlende Abonnenten der<br />
CHEMIE TECHNIK erhalten den Preisindex kostenlos.<br />
Anfragen an: susanne.berger@huethig.de [AS]<br />
Mai 10<br />
Aug 10<br />
Nov 10<br />
Feb 11<br />
Mai 11<br />
Feb 11<br />
Aug 11<br />
Mai 11<br />
Nov 11<br />
Feb 12<br />
Aug 11<br />
Mai 12<br />
Nov 11<br />
Feb 12<br />
Mai 12<br />
Markt<br />
Preisentwicklung für Chemieanlagen und Anlagengewerke im Jahresvergleich<br />
Aug 12<br />
Nov 12<br />
Aug 12<br />
Nov 12
Anlagenbau<br />
Der Autor:<br />
Armin Scheuermann<br />
ist Chefredakteur der<br />
CHEMIE TECHNIK<br />
18 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Deutsche Anlagenbauer zwischen Baum und Borke<br />
Positionsbestimmung<br />
Profi-Guide<br />
Funktion Branche<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ●<br />
Ausrüster ● ● ●<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber ● ●<br />
Einkäufer ●<br />
Manager ● ● ●<br />
entscheider-facts<br />
Für Planer und Manager<br />
Wut kann ein guter Motivator sein. „Wenn ich daran<br />
denke, welche Projekte der deutsche Anlagenbau in den<br />
vergangenen Jahren verloren hat, dann macht mich das<br />
wütend!“, sagte Helmut Knauthe, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft<br />
Großanlagenbau im VDMA auf dem 2.<br />
Engineering Summit im vergangenen November:<br />
„Schaffen wir es, unsere Wut umzuwandeln und aggressiver<br />
am Weltmarkt aufzutreten?“<br />
Knauthes Standpunkte machen deutlich, dass deutsche<br />
Anlagenbau-Unternehmen in der Zwickmühle stecken:<br />
Bekannt für High-tech-Lösungen und überwiegend<br />
spezialisiert auf eigene Verfahrenstechnik laufen<br />
sie derzeit den Großprojekten oft nur hinterher. Diese<br />
werden vor allem von global aufgestellten Engineeringfirmen<br />
gewonnen, die weniger Technologie, aber vielmehr<br />
Abwicklungskompetenz und Risikobereitschaft als<br />
Generalunternehmer zeigen. „Reicht die Veränderungsbereitschaft<br />
im europäischen Anlagenbau aus, um sich<br />
dem globalen Wettbewerb zu stellen?“, fragt Knauthe,<br />
der auch Mitglied der Geschäftsleitung bei Thyssenkrupp<br />
Uhde ist.<br />
„Wenn Sie mich als Betreiber fragen, muss ich sagen,<br />
dass der europäische Anlagenbau zu langsam ist“, stellt<br />
Dr. Volker Knabe, Leiter des Kompetenzzentrums Engineering<br />
& Maintenance bei der BASF fest: „Es wird in 10<br />
bis 15 Jahren in Europa keinen eigenen Anlagenbau<br />
mehr geben, sondern nur noch eine Anlagenbau-Struktur,<br />
die von großen globalen Unternehmen besetzt sein<br />
wird. Der Großteil des typisch deutschen Anlagenbaus<br />
ist tot.“ Für Großprojekte, wie sie von der BASF auf der<br />
ganzen Welt realisiert werden, gibt es laut Knabe kaum<br />
noch einen deutschen Anlagenbauer, der in der Lage ist,<br />
die Gesamtverantwortung zu übernehmen. Aktuelle<br />
Helmut Knauthe ist Sprecher der<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Großanlagenbau im VDMA<br />
„Reicht die Veränderungsbereitschaft<br />
im<br />
europäischen Anlagenbau<br />
für den globalen<br />
Wettbewerb?“<br />
● Der deutsche Anlagenbau ist in der Zwickmühle: Für globale Megaprojekte sind die<br />
Anbieter häufig nicht groß genug, um als Generalunternehmer zu agieren.<br />
● Eine klare Positionierung – ob in der Nische oder als global aufgestellter Player mit<br />
der Fähigkeit zum Generalunternehmer – tut Not.<br />
● Partnerschaften eröffnen sowohl kleinen als auch mittelständischen Anbietern die<br />
Möglichkeit, im Wettbewerb mitzuhalten.<br />
World-scale-Projekte wie die 1 Mrd. Euro schwere TDI-<br />
Anlage, die derzeit in Ludwigshafen realisiert wird, vergibt<br />
der Chemiekonzern an internationale Engineering-<br />
Multis, darunter die amerikanische Fluor Corp. Diese<br />
werden von den BASF-Ingenieuren in strategischen<br />
Partnerschaften eingebunden werden.<br />
Doch auch dort wachsen die Bäume nicht in den<br />
Himmel. Denn strategische Partnerschaften sind für den<br />
Anlagenbauer „margenschwaches“ Geschäft, gibt zum<br />
Beispiel Taco de Haan vom Anlagenbauer Fluor zu. Wie<br />
viel „strategische Partnerschaft“ sich ein Anlagenbauer<br />
leisten kann, muss jedes Unternehmen mit Blick auf<br />
seine Eigner selbst beantworten. Für de Haan, der als<br />
Senior Vice President Energy & Chemicals für den amerikanischen<br />
Engineeringkonzern die Regionen Europa,<br />
Afrika und Mittlerer Osten verantwortet, ist allerdings<br />
klar, dass globale strategische Partnerschaften für EPC-<br />
Kontraktoren die Chance bieten, das Geschäft ihrer<br />
Kunden besser verstehen zu lernen. De Haan: „Strategische<br />
Partnerschaften erfordern allerdings eine Organisation,<br />
die in der Lage ist sich ständig zu verändern.“<br />
Projektstruktur hat sich deutlich gewandelt<br />
Doch weshalb hat sich das Wettbewerbsumfeld für deutsche<br />
und europäische Anlagenbauer in den Jahren seit<br />
der Wirtschaftskrise 2008 so dramatisch verändert? Eine<br />
wesentliche Ursache ist, dass sich die Projektstruktur<br />
deutlich gewandelt hat. Der Anteil an Megaprojekten,<br />
die von Großinvestoren gestemmt werden, ist deutlich<br />
gestiegen, die Zahl mittelgroßer Projekte privater Unternehmen<br />
ist dagegen rückläufig. Dazu kommt, dass die<br />
Großprojekte zunehmend an entlegenen Orten und in<br />
Ländern mit höheren Risiken realisiert werden. „Nur<br />
Dr. Volker Knabe ist Leiter des Kompetenzzentrums<br />
Engineering & Maintenance bei der BASF<br />
„Es wird in zehn bis 15 Jahren in Europa<br />
keinen eigenen Anlagenbau mehr geben,<br />
sondern nur noch eine Anlagenbau-Struktur,<br />
die von großen globalen Unternehmen<br />
besetzt sein wird. Der Großteil des typisch<br />
deutschen Anlagenbaus ist tot“
Bild: ©quka - Fotolia.com<br />
ZUR VERANSTALTUNG<br />
Networking für Anlagenbauer<br />
Mit der zweiten Veranstaltung im November 2012 hat sich der der<br />
Engineering Summit mit über 275 Teilnehmern als wichtigstes<br />
Networking-Forum für Führungskräfte im deutschen und europäischen<br />
Anlagenbau etabliert. In intensiven Diskussionen und hochkarätigen<br />
Vorträgen tauschten sich Experten aus mittelständischem<br />
und Großanlagenbau sowie Betreibern und Lieferanten aus.<br />
Der 3. Engineering Summit wird am 1. und 2. Juli 2014 – ebenfalls<br />
in Mannheim – stattfinden. Zentrales Thema wird dann die Frage<br />
sein, welche Antworten die Branche auf den Wettbewerbsdruck aus<br />
Asien und die fortgesetzte Globalisierung gibt. Weitere Informationen<br />
unter www.engineering-summit.de<br />
Anlagenbau<br />
Gemeinsam geht es besser: Partnerschaften<br />
können für Anlagenbauer ein Weg zur Wettbewerbsfähigkeit<br />
sein<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
19
Anlagenbau<br />
Taco de Haan verantwortet als Senior Vice President Energy &<br />
Chemicals bei Fluor die Regionen Europa, Afrika und ME<br />
„Strategische Partnerschaften erfordern eine<br />
Umgebung und Organisation, die in der Lage<br />
ist zu lernen, sich zu verbessern und sich<br />
ständig zu verändern“<br />
Wolfram Gstrein ist Geschäftsführer der deutschen<br />
VTU Engineering<br />
„Schaut man bei einigen unserer Kunden,<br />
die das Thema Partnerschaft hoch aufhängen,<br />
in die Verträge, dann bleibt von Partnerschaft<br />
nicht mehr viel übrig“<br />
Dr. Rainer Hauenschild ist CEO der Business Unit Energy<br />
Solutions beim Kraftwerksbauer Siemens<br />
„Wir kommen gar nicht darum herum, partnerschaftlich<br />
mit Kunden und Lieferanten zu<br />
agieren“<br />
Bild: ©Sashkin - Fotolia.com<br />
wer groß genug ist, kann mit den damit verbundenen<br />
Risiken umgehen“, verdeutlicht Knauthe. Thyssenkrupp<br />
hat im Januar 2013 seine Anlagenbau-Aktivitäten mit<br />
der Sparte Marine Systems zusammengeführt. Über die<br />
Größe sollen Vorteile im Weltmaßstab erzeugt werden.<br />
Auch global agierende Engineeringunternehmen wie<br />
zum Beispiel Foster Wheeler setzen auf Größe: Der Anlagenbaukonzern<br />
hat in den vergangenen Monaten<br />
mehrere Planungsunternehmen geschluckt, um sich für<br />
die Abwicklung von Megaprojekten zu verstärken.<br />
Schlucken oder geschluckt werden?<br />
Doch nur den wenigsten Anlagenbauern steht dieser<br />
Weg offen. Es bleibt die Frage, wie sich deutsche Anlagenbauer<br />
in Zukunft aufstellen müssen. Eine Möglichkeit<br />
ist die Fokussierung als lokaler Nischenanbieter für<br />
Engineeringleistungen, eine Weitere die Konzentration<br />
auf Technologie. Ein dritter Weg ist die enge Zusammenarbeit<br />
mit anderen Anlagenbauern und Lieferanten,<br />
um gemeinsam Projekte zu stemmen, die für einen Anbieter<br />
allein zu groß wären. Doch alle drei Wege bergen<br />
Risiken und greifen eventuell auch nur mittelfristig.<br />
Denn international tätige Kunden schließen immer häufiger<br />
Rahmenverträge mit global tätigen Anlagenbauern<br />
ab. Dadurch treten ausländische Wettbewerber verstärkt<br />
auch im Heimmarkt des Nischenanbieters auf. „Auf<br />
Dauer wird die Nische nicht ausreichen“, ist Helmut<br />
Knauthe überzeugt.<br />
Die Konzentration auf Technologie erfordert Investitionen,<br />
die wiederum erwirtschaftet werden müssen – Unternehmen<br />
mit einem Scope, der auch EPC-Projekte einschließt,<br />
haben hier ebenfalls Größenvorteile. Der Hütten-<br />
und Walzwerksbauer SMS Siemag geht beispielsweise<br />
diesen Weg. „Wir streben einerseits die Tech no lo-<br />
gie füh rer schaft an, andererseits agieren wir fallweise auch<br />
als Generalunternehmer“, verdeutlicht Dieter Rosenthal,<br />
Vorstandsmitglied des Unternehmens. Der Balanceakt<br />
besteht dabei darin, einerseits durch Regionalisierung der<br />
Wertschöpfung zu wettbewerbsfähigen Kosten anbieten<br />
zu können, andererseits die Technologie komplett im eigenen<br />
Haus zu halten. „Wir haben genau beobachtet, was<br />
im Kraftwerksbau geschehen ist und wie sich der Chemieanlagenbau<br />
entwickelt hat. Deshalb beteiligen wir uns<br />
nicht an Konsortien, in denen ein Know-how-Abfluss zu<br />
befürchten ist. Wenn man beispielsweise deshalb keine<br />
Kooperationen mit klassischen EPC-Unternehmen eingeht,<br />
dann bleibt in manchen Projekten nur noch der<br />
Weg, selbst als Generalunternehmer aufzutreten“, erklärt<br />
Rosenthal.<br />
„Partnerschaft“ ist, wenn der Partner schafft<br />
Ein bislang unterschätzter Erfolgsfaktor sind Partnerschaften,<br />
in denen sich Anlagenbauer und Lieferanten<br />
die Aufgaben eines Projektes teilen und gemeinsam<br />
Technologien entwickeln. „Kunden fordern Größe<br />
als Sicherheit – und hier müssen auch Mittelständler<br />
Antworten finden und über Partnerschaften am<br />
Weltmarkt agieren“, ist Helmut Knauthe überzeugt.<br />
Und auch die enge Zusammenarbeit mit Lieferanten<br />
wird von Führungskräften im Anlagenbau als wichtiges<br />
Element zur Technologieführerschaft gesehen.<br />
„Wir kommen gar nicht darum herum,<br />
partnerschaftlich mit Kunden und Liefe-
Foto: S. Witter/Shotshop<br />
ranten zu agieren“, verdeutlicht Dr. Rainer Hauenschild,<br />
CEO der Business Unit Energy Solutions beim Kraftwerksbauer<br />
Siemens, und plädiert dafür, Lieferanten<br />
bereits in der Entwicklungsphase von Projekten einzubinden:<br />
„Wir haben gelernt, dass Lieferanten in Teilsystemen<br />
oft besser Bescheid wissen als wir.“ Aus Hauenschilds<br />
Sicht ist es deshalb sinnvoller, für Teilsysteme<br />
funktionale Spezifikationen zu erstellen, als die Ausführung<br />
detailliert zu spezifizieren. „Daraus entsteht eine<br />
Art von Partnerschaft, die für beide Seiten interessant<br />
ist. Der Kraftwerksbauer hat so die Möglichkeit, möglichst<br />
kostenoptimierte Lösungen anzubieten, und Lieferanten<br />
profitieren durch einen neuen Marktzugang.“<br />
„Partnerschaftliche Beziehungen sollten auf einen langfristigen<br />
Projekterfolg ausgerichtet sein. Aber das heißt<br />
nicht, dass man auf vertraglich vereinbarte Leistungen<br />
verzichtet“, nennt Dr. Ralf Nowack, Geschäftsführer bei<br />
RWE Technology, den „Owners Engineers“ des Energiekonzerns<br />
RWE, Grenzen der Partnerschaftsmodelle.<br />
Auch bei RWE Technology versucht man Lieferanten<br />
und Betreiber in der Entwicklungsphase mit einzubinden.<br />
Mittelständischen Unternehmen eröffnet der Verbund<br />
mit Großanlagenbauern ebenfalls Chancen.<br />
„Schaut man bei einigen unserer Kunden, die das<br />
Thema Partnerschaft hoch aufhängen, in die Verträge,<br />
dann bleibt von Partnerschaft nicht mehr viel übrig“,<br />
gießt Wolfram Gstrein, Geschäftsführer der deutschen<br />
VTU Engineering, allerdings Wasser in den Wein: „Häufig<br />
findet man im Vertrag Gemeinheiten bei den Punkten<br />
Haftung und Zahlungsziele – und dann wird auch<br />
noch auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen,<br />
die von Anwälten durchdekliniert wurden“, berichtet<br />
Gstrein und stellt die Frage, ob sich der Wunsch<br />
nach partnerschaftlichem Miteinander auch in den<br />
Verträgen der Großanlagenbauer wiederfindet. Ein<br />
Spannungsfeld, das je nach Vertragskonstellation – ob<br />
Lump Sum Turnkey, Konsortialvertrag oder Abrechnung<br />
nach Aufwand – mehr oder weniger stark ausgeprägt<br />
ist. „Vertrauen und Misstrauen haben auch etwas<br />
mit der Unternehmenskultur und Abwicklungserfah<br />
Intelligente Energie-Dienstleistungen.<br />
Contracting-Lösungen von GETEC sind wirtschaftlich,<br />
innovativ und umweltschonend.<br />
Jetzt informieren! www.getec.de<br />
Anlagenbau<br />
Dr. Ralf Nowack ist Geschäftsführer bei RWE Technology<br />
„Partnerschaftliche Beziehungen sollten auf<br />
einen langfristigen Projekterfolg ausgerichtet<br />
sein. Aber das heißt nicht, dass man auf vertraglich<br />
vereinbarte Leistungen verzichtet“<br />
Dieter Rosenthal ist Mitglied des Vorstands bei SMS Siemag<br />
„Wir streben einerseits die Technologieführerschaft<br />
an, andererseits agieren wir als<br />
Generalunternehmer“<br />
rungen zu tun“, weiß Ralf Nowack, und Helmut Knauthe<br />
plädiert dafür, dass Anlagenbauer neben einer Kultur<br />
des Dokumentenmanagements auch eine Ko o pe ra tionskultur<br />
entwickeln: „Wir müssen das anders auf die<br />
Agenda setzen, da gibt es Handlungsbedarf.“<br />
Fazit: Die Diskussion zeigt, dass Bewegung in die<br />
Geschäftsmodelle der deutschen Anlagenbauer kommt<br />
und auch kommen muss. Eine klare Positionierung – ob<br />
in der Nische oder als global aufgestellter Player – tut<br />
not. Partnerschaften eröffnen sowohl kleinen als auch<br />
mittelständischen Anbietern die Möglichkeit, im Wettbewerb<br />
mitzuhalten. ●<br />
Sie möchten weitere Fachartikel zu Trends im Anlagenbau<br />
sowie zum Engineering Summit? Klicken<br />
Sie rein: www.chemietechnik.de/1301ct603<br />
oder einfach QR-Code scannen!
Anlagenbau<br />
Internationalisierung im Anlagenbau – Mehr Chance als Risiko<br />
Total global<br />
Profi-Guide<br />
Funktion Branche<br />
Die Autorin:<br />
Tina Walsweer,<br />
Redaktion<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ● ●<br />
Ausrüster ● ● ●<br />
Planer ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer ● ● ●<br />
Manager ● ●<br />
22 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
eNTScheider-fAcTS<br />
Für Anlagenbauer, Einkäufer und Betreiber<br />
● Die Internationalisierung eines Unternehmens bietet sowohl Chancen, als auch Risiken.<br />
● Eine ausgefeilte Strategie für die Globalisierung ist unbedingt vonnöten, damit ein Unternehmen sich an einem<br />
neuen Markt möglichst schnell und langfristig positionieren kann.<br />
● Welche (Teil-)Arbeiten ins Ausland verlegt werden, sollte sorgfältig abgewogen werden, um das Know-how der<br />
einzelnen Standorte möglichst effizient einzubinden.<br />
● Internationale Zusammenarbeit verlangt, gemessen an deutschen Standards, ein gewisses Maß an Kontrolle.<br />
Am Scheideweg zwischen hier und dort – In nahezu allen<br />
Branchen schreitet die Internationalisierung voran,<br />
das ist nichts Neues. Doch wie lässt sich damit am besten<br />
umgehen? Auch Konzerne, die seit Jahrzehnten global<br />
tätig sind und Standorte in vielen Ländern und abgelegenen<br />
Winkeln der Welt betreiben, haben häufig noch<br />
nicht den goldenen Weg gefunden, um problemlos allen<br />
Ansprüchen einer globalisierten Welt zu begegnen.<br />
Internationalisierung findet längst nicht mehr nur im<br />
Englisch lernen und Flugmeilen sammeln Ausprägung;<br />
sie bringt vielmehr komplexe Anforderungen an alle international<br />
agierenden Abteilungen eines Unternehmens<br />
mit – sowohl im Heimatland, als auch vor Ort. Für<br />
Anlagenbauer beginnt dies bereits bei den ersten Gesprächen<br />
mit Investoren, aus denen sich eines glückli-<br />
chen Tages ein Vertragsabschluss anbahnen soll. Anschließend<br />
ziehen sich die oft diffizilen Aufgabenstellungen<br />
von der Projektierungsphase über Beschaffung,<br />
Konstruktion und Abnahme und betreffen zudem Überwachung<br />
während und Serviceleistungen nach Inbetriebnahme.<br />
Dabei kommen direkte Einflüsse wie lokale<br />
Sicherheitsvorschriften, die Zuverlässigkeit regionaler<br />
Zulieferer oder klimatische Widrigkeiten ebenso zum<br />
Tragen wie indirekte, die etwa kulturelle Unwägbarkeiten<br />
des Landes, religiöse Gepflogenheiten oder auch die<br />
familiäre Situation der eigenen Expats betreffen.<br />
Mittelständler mit kompletter Neuausrichtung<br />
Dem Globalisierungsprozess lässt sich nur mit einer<br />
Strategie begegnen, welche die individuellen Gegeben-
Bild: ©imageteam - Fotolia.com<br />
heiten des Unternehmens berücksichtigt, damit es international<br />
nachhaltig und wettbewerbsfähig agieren kann.<br />
Sie richtet sich auch nach den Rahmenbedingungen, die<br />
die heimische Politik der Wirtschaft vorgibt. Das bekam<br />
auch die Firma Zeppelin Systems zu spüren – ein mittelständischer<br />
Anlagenbauer, der sich in den 90er Jahren<br />
einer strategischen Neupositionierung unterzogen hat,<br />
als sich die Grenzen nach Osteuropa geöffnet hatten.<br />
Denn das stellte den Mittelständler, der seinen Fokus auf<br />
Silo- und Apparatebau für die Prozessindustrie gelegt<br />
hat, vor eine veränderte Wettbewerbssituation und setzte<br />
ihn durch die neuen Konkurrenten einem hohen Preisdruck<br />
aus.<br />
Doch erste Schritte, wie die eigenen (Personal-)Kosten<br />
zu reduzieren, die Produktion ins Ausland zu verlegen<br />
und neue Produkte sowie neue Märkte zu erschließen,<br />
erbrachten nicht den gewünschten Erfolg. Schwindende<br />
Wettbewerbsfähigkeit, Qualitätsprobleme an den<br />
neuen Standorten und eine Fehleinschätzung der Wettbewerbssituation<br />
der neuen Märkte waren unvorhergesehene<br />
Stolpersteine. Nach diesen Erfahrungen haben<br />
sich bei Zeppelin schließlich vier Maßnahmen herauskristallisiert,<br />
die auf dem Weg zum global agierenden<br />
Unternehmen den langfristigen Erfolg ermöglicht haben:<br />
Zuerst hat das Unternehmen den zukünftigen Zielmarkt<br />
definiert und daran anschließend das Portfolio<br />
bereinigt. „Die Bereinigung war für uns ein sehr<br />
schmerzhafter Schritt: Die Produktion von Geräten, die<br />
man über 50 Jahre erfolgreich hergestellt hat, einzustellen“,<br />
erzählt Rochus Hofmann, Mitglied der Geschäftsführung<br />
bei Zeppelin Systems . So kam es, dass Zeppelin<br />
sich nur noch auf die Produktion von Silos konzentriert<br />
hat, hier jedoch sein Know-how voll ausgeschöpft und<br />
noch erweitert hat – und das auf globaler Ebene. „Der<br />
Schlüssel zum Erfolg war jedoch, eine eigene Know-<br />
LIEFERANTENBEZIEHUNG<br />
Verlässlichkeit vergrößert Erfolg des Anlagenbaus<br />
Wenn Anlagebauer ihren Auftraggebern gegenüber<br />
als verlässliche Partner auftreten<br />
wollen, müssen sie sicher sein, dass sie<br />
sich auf ihre Lieferanten verlassen können.<br />
Denn jeder Kontraktor kann nur so viel<br />
Qualität weitergeben, wie er selbst erhält.<br />
Regelmäßige Audits, langjährige Geschäftsbeziehungen<br />
und eigene regionale Standorte<br />
führen dazu, dass lokale Zulieferer die<br />
how-Basis für die Prozesse der Zielmärkte aufzubauen“,<br />
berichtet Hofmann. Dies geschah zum einen durch<br />
Fachkräfte im eigenen Haus, zum anderen durch den<br />
Zukauf anderer Firmen, die das entsprechende Engineering-Wissen<br />
für die lokalen Märkte haben. „Diese Zukäufe<br />
waren jedoch nicht ganz ungefährlich, denn dadurch<br />
wurden wir vom Zulieferer zum Engineering-<br />
Unternehmen und damit zum Wettbewerber unserer<br />
ehemaligen Kunden. Daher sind alle Schritte in diese<br />
Richtung sorgfältig abzuwägen.“<br />
Hofmann sieht die globale Ausrichtung seines Unternehmens<br />
seit den 90er Jahren als unumgänglich, um die<br />
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Nachdem es rund<br />
zehn Jahre auf der Suche nach dem richtigen Weg hin zu<br />
einem global wettbewerbsfähigen Unternehmen war<br />
und sich weitere zehn Jahre mit der Umsetzung seiner<br />
Strategie beschäftigt hatte, ist Zeppelin heute ein Turnkey-Lieferant<br />
für die Chemie-, Kunststoff-, Gummi- und<br />
Lebensmittelindustrie mit rund 50 % Auslandsgeschäft<br />
gegenüber 9 % am Anfang der 90er Jahre.<br />
Commitment zum Unternehmen fördert Integration<br />
Doch auch Konzerne, die sich seit Jahrzehnten auf dem<br />
weltweiten Parkett bewegen und behaupten, haben immer<br />
noch mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen, bei<br />
denen nur eine ausgeklügelte Strategie hilft, um die<br />
Stolpersteine von vorne herein zu vermeiden. Diese Erfahrung<br />
hat auch der Österreichische Metallurgiezweig<br />
des Weltkonzerns Siemens gemacht, die Siemens VAI<br />
Metals Technology . Dort wird die Strategie verfolgt, mithilfe<br />
von lokalen Engineering-Einheiten und international<br />
besetzten Teams vor allem vor Ort die Zuarbeiten für<br />
den Engineering-Bereich zu unterstützen, also lokale<br />
Projekte von lokalen Standorten aus zu betreuen. Diese<br />
Vorgehensweise hat sich zum einen deshalb etabliert,<br />
Anlagenbau<br />
Anforderungen an sie kennen und sie gewissenhaft<br />
erfüllen. So können die Anlangenbauer<br />
sich auf ihr Hauptarbeitsgebiet<br />
konzentrieren – und dies am besten mit<br />
Augenmaß: Nicht bei allen Aufgabenstellungen<br />
lohnt es sich, die Arbeit ins (günstige)<br />
Ausland zu verlegen, wenn am Ende nicht<br />
die gewünschte Performance erzielt wird<br />
und Mehrkosten oder -arbeit entstehen.<br />
Globale Strukturen<br />
innerhalb einer Firma<br />
und internationale<br />
Geschäftsabwicklung<br />
stellen hohe Ansprüche<br />
an die Unternehmensführung<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
23
Anlagenbau<br />
Mehr Verantwortung<br />
an Standorte im Ausland<br />
zu geben, birgt<br />
nicht nur Risiken, sondern<br />
auch Chancen<br />
Bild: ©Eisenhans - Fotolia.com<br />
Zulieferer sollten zunächst die Wirtschaftlichkeit<br />
der eigenen Globalisierungsstrategie<br />
hinterfragen, anschließend den Zielmarkt<br />
definieren und sukzessive dort eintreten.<br />
Denn einen profitablen Markt zu fin-<br />
24 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
weil seit Jahren in Deutschland und Österreich ein Mangel<br />
an Ingenieuren herrscht. So setzt man bei Siemens<br />
VAI darauf, gut ausgebildetes Personal durch Recruiting-Center<br />
an den einzelnen Auslandsstandorten zu<br />
rekrutieren. Allerdings müssen deutsche Anlagenbauer<br />
lernen, damit umzugehen, dass vor allem in asiatischen<br />
Ländern bei diesen Ingenieuren häufig das kaufmännische<br />
Denken und somit ein Kosten- und Terminbewusstsein<br />
nicht so ausgeprägt ist, wie sie das von in Europa<br />
ausgebildeten Spezialisten gewöhnt sind. Ein weiterer<br />
Aspekt, der Firmen dazu veranlasst, vor Ort geschultes<br />
Personal zu akquirieren, ist, dass die Flexibilität der<br />
Mitarbeiter nicht immer ausreicht, um viele Jahre als<br />
Expat in einem fremden Land zu verbringen. Zudem<br />
bieten regional angesiedelte Fachkräfte einen Wissensvorsprung<br />
hinsichtlich des lokalen Zuliefermarktes sowie<br />
ein kulturelles Know-how.<br />
Siemens VAI bietet diesen Mitarbeitern die passenden<br />
Rahmenbedingungen, damit die Standorte ihre Organisationsverantwortung<br />
lokal wahrnehmen können.<br />
Für die reibungslose Übernahme der Eigenverantwortung<br />
vor Ort gehört auf der einen Seite eine klare Zuordnung<br />
zum Produkt, sodass sie sich nicht auf verschiedene<br />
Arbeitsgebiete einstellen müssen, auf der anderen<br />
Seite aber auch seriöse Coaches, die zudem das Netz-<br />
Lohnt der AufwAnd?<br />
Zulieferer sollten gezielt internationalisieren<br />
den, der nicht bereits durch (lokale) Anbieter<br />
gesättigt oder am Aufwand gemessen zu<br />
langsam zu durchdringen wäre, ist häufig<br />
nicht innerhalb der Zeit geschafft, den manche<br />
Rendite-Versprechen erfordern.<br />
werk zum Stammhaus aufrecht erhalten. „Klare Kommunikationswege<br />
zum Stammhaus und innerhalb der<br />
Standorte sind ein absolutes Muss, sonst gibt es ein großes<br />
Durcheinander“, weiß Johann Siegl, Vice President<br />
Order Management bei Siemens VAI Metals Technologies.<br />
„Allerdings müssen diese Eigenverantwortlichkeiten<br />
sukzessive übergeben werden, damit kontinuierliche<br />
Arbeitsprozesse möglich sind“, erklärt Siegl.<br />
Kommt ein Mitarbeiter in einem Land zum Einsatz,<br />
das sich vor allem kulturell von der eigenen Heimat unterscheidet,<br />
ist es unablässig, dass sein Unternehmen<br />
ihm ein gewisses Maß an Kenntnissen über die sozialen<br />
und religiösen Gepflogenheiten der Region mitgibt. Ist<br />
er über die „Do‘s“ and „Don‘ts“ gegenüber der lokalen<br />
Bevölkerung nicht informiert, gibt er schnell ein falsches<br />
Bild ab und die Akzeptanz seiner Person wird nur<br />
schwierig aufzubauen sein. „Auch die Anforderungen<br />
der Mitarbeiter im Auslandseinsatz haben sich im Laufe<br />
der Zeit verändert“, konstatiert Helmut Knauthe, Mitglied<br />
der Geschäftsführung bei Thyssenkrupp Uhde.<br />
Doch für das Unternehmen bedeutet der Einsatz von<br />
Expats nicht nur einen Mehraufwand und zumeist erhöhte<br />
Kosten: Wenn die Mitarbeiter von ihren Auslandseinsätzen<br />
zurückkommen, genießen sie häufig ein<br />
höheres Ansehen unter den Kollegen, haben viele neue<br />
Erfahrungen gesammelt und im besten Fall ihre Führungs-<br />
und Teamfähigkeiten deutlich ausgebaut. Knauthe<br />
gibt aber gleichzeitig zu bedenken, dass die Besetzung<br />
von Positionen aus Deutschland heraus gezielter<br />
und punktuell erfolgen sollte. „Um lokale Organisationen<br />
und Standorte aufzubauen, müssen wir die Stellen<br />
mithilfe eines internationalen Networkings besetzen –<br />
danach, wer sich für die Erfüllung der Aufgabenstellung<br />
am besten eignet und gleichzeitig den größten Kostenvorteil<br />
für den Kunden erzielen kann.“ Eine klare Strategie<br />
für den Aufbau eines Auslandsstandortes, Schwer-
punktsetzung auf Kernregionen bzw. -märkte, Technologien<br />
oder Produkte sowie harmonisierte Abläufe mit den<br />
etablierten Vorgehensweisen sind Punkte, die jedes Unternehmen<br />
gut durchdenken sollte, das den Schritt in<br />
einen neuen Markt gehen will.<br />
Von theoretischen Ansätzen<br />
in die praktische Umsetzung<br />
Sind die Projekte vom (lokalen) Personal erst einmal an<br />
Land gezogen, geht es an die Feinarbeiten. Die Beschaffung<br />
spielt hierbei eine ganz entscheidende Rolle. Denn<br />
günstiger und effizienter Einkauf tragen entscheidend<br />
zu dem Gesamterfolg eines Anlagenbauprojektes bei.<br />
Dabei kommt der Auswahl der Lieferanten eine wesentliche<br />
Bedeutung zu, denn der Anlagenbauer muss sich<br />
auf die Produkte, deren Langlebigkeit und alles, wofür er<br />
sich gegenüber seinen Auftraggebern verbürgt, verlassen<br />
können – schließlich kann er nicht jedes Ventil, das er<br />
verbaut, daraufhin überprüfen, ob seine Dichtungen den<br />
eigenen Standards entsprechen, oder die Armaturen<br />
vielleicht in der Massenproduktion heimlich durch billigen<br />
Kitt abgedichtet wurden, um als Zulieferer Kosten<br />
zu sparen. Langfristige Lieferantenbeziehungen scheinen<br />
hier das Mittel der Wahl, um kurze Bauzeiten und<br />
eine dauerhaft hohe Qualität der eigenen Anlagen zu<br />
garantieren. Doch wie schafft es ein Unternehmen,<br />
fruchtbare Beziehungen zu Lieferanten auf der ganzen<br />
Welt zu erschaffen? Und lassen sich diese Verbindungen<br />
aufrecht erhalten, auch wenn einmal ein Lieferant nicht<br />
die geforderte Performance bringt?<br />
Beim Energy Sector des Siemens-Konzerns besteht<br />
die Vorgabe, jeden Lieferanten im Vorhinein einen Qualifizierungsprozess<br />
durchlaufen zu lassen. Es gibt auch<br />
keine Ausnahmen für Firmen aus Drittwelt-Ländern<br />
oder ähnliche. Dabei werden nicht nur Fragen wie die<br />
einer eventuellen Sprachbarriere oder voraussichtlicher<br />
Lieferzeiten geprüft. Im Fokus stehen in erster Linie die<br />
Referenzen des potenziellen Geschäftspartners und die<br />
Qualitätsstandards, nach denen er seine Produkte fertigt.<br />
Der Großkonzern hat eigens für das Lieferantenma-<br />
Vakuumförderer nach GMP und ATEX; leicht zu reinigen; für Pulver, Pigmente,<br />
Stäube, Granulate, Tabletten, Kapseln, Kleinteile; 10 - 10.000 kg/h Förderleistung.<br />
VOLKMANN <br />
www.Volkmann.eu<br />
nagement ein Tool namens click4suppliers easy eingerichtet,<br />
das sowohl für den Qualifizierungsprozess, als<br />
auch für die späteren Geschäftskontakte ein wichtiges<br />
Hilfsmittel darstellt, auf welches sich zu jeder Zeit und<br />
von jedem Ort aus zugreifen lässt. „Dadurch können<br />
auch leistungsfähige regionale Lieferanten zu uns einen<br />
Kontakt aufbauen, der sonst vielleicht nicht zustande<br />
gekommen wäre“, erläutert Jonny Schmidt, Chief Procurement<br />
Officer Siemens Energy Sector.<br />
Doch der Konzern will nicht nur die Beziehungen zu<br />
seinen Lieferanten auf der ganzen Welt pflegen, sondern<br />
ihnen auch dabei helfen, neuen Anforderungen im<br />
Markt oder regionalen Gegebenheiten auf neuen Märkten<br />
erfolgreich zu begegnen – ein Beispiel ist die Energieeffizienz.<br />
Das Energy Efficiency Program schreibt<br />
sich der Konzern nicht nur auf die eigene Fahne, sondern<br />
verlangt ähnliche Maßnahmen auch von seinen<br />
Partnerunternehmen. Allerdings bietet er diesen Hilfe-<br />
VOLKMANN Vakuumförderer<br />
Anlagenbau<br />
Thomas Kügerl, Servicebereich Verfahrenstechnik<br />
und Engineering, Evonik<br />
„Ein guter Draht zu den lokalen Lieferanten<br />
ist unerlässlich, vor allem um die kulturellen<br />
und sprachlichen Barrieren zu überwinden“<br />
Rochus Hofmann, Mitglied der Geschäftsführung,<br />
Zeppelin Systems<br />
„Der Schlüssel zum Erfolg war, eine eigene<br />
Know-how-Basis für die Prozesse der Zielmärkte<br />
aufzubauen“<br />
einfach hygienisch anwenderfreundlich<br />
NEUE SYSTEME<br />
+ Noch einfacher zu installieren.<br />
+ Noch leichter zu betreiben.<br />
+ Noch schneller zu reinigen.<br />
Neue und verbesserte Abscheider, Filter, Entleerklappen, Vakuumpumpen,<br />
<br />
.<br />
Systeme für das sichere und<br />
hygienische Pulverhandling.<br />
VOLKMANN<br />
... powder-handling unlimited ...
Anlagenbau<br />
Egal ob made in<br />
Germany, China, USA<br />
oder India – für erfolgreiche<br />
Geschäfte<br />
sollte Qualität bei Produkten<br />
und Dienstleistungen<br />
immer an erster<br />
Stelle stehen<br />
26 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
stellungen an, wie sie die Anforderungen für ihre eigene<br />
lokale Produktion umsetzen können – nicht zuletzt, damit<br />
er als Abnehmer den Vorteil auch aus preislicher<br />
Sicht an seine Auftraggeber weitergeben kann.<br />
„Wir wollen künftig die Zahl unserer strategischen<br />
Lieferanten noch weiter reduzieren und uns auf eine<br />
Kerngruppe fokussieren, von der wir allerdings auch eine<br />
entsprechende Leistung verlangen. Beispielsweise<br />
müssen sie Exporterfahrung haben, damit wir als Siemens<br />
nicht die Zollprobleme unserer Zulieferer lösen<br />
müssen“, berichtet Schmidt. „Zudem fordern wir, dass<br />
unsere strategischen Lieferanten international tätig sind,<br />
damit sie lokale Standards und Regelwerke kennen.“<br />
Nur so kann der Anlagenbauer seinen Kunden garantieren,<br />
dass die Qualität seiner Technologie sich trotz global<br />
abweichender Standards nicht ändert.<br />
Verantwortlichkeiten als künftiger Betreiber<br />
gezielt übergeben<br />
Auf Seiten der meisten europäischen Betreiberfirmen<br />
steht im In- wie Ausland die Qualität der Anlagen an<br />
erster Stelle. Dass deutsche und europäische Kontraktoren<br />
in Deutschland diesen Anforderungen gewachsen<br />
sind, haben Sie über Jahrzehnte bewiesen. Doch für den<br />
Bau einer leistungsfähigen und profitablen Produktionsanlage<br />
im Ausland gelten andere Spielregeln. Betreiber,<br />
die beispielsweise auch im fernen China nicht auf höchste<br />
Qualität verzichten wollen, haben verschiedene Erfahrungen<br />
gemacht, wie sich im Ausland diese Ansprüche<br />
realisieren lassen.<br />
Qualität hat ihren Preis<br />
Betreiber sollten nicht am falschen Ende sparen<br />
Nur weil in Asien viele Produkte deutlich<br />
günstiger zu beziehen sind, als hierzulande,<br />
ist der Weg ins Ausland nicht zwangsläufig<br />
der goldene. Viele Betreiber haben sich im<br />
Laufe der Jahrzehnte die Finger an scheinbar<br />
vielversprechenden Geschäftsbeziehun-<br />
gen verbrannt. Denn wer den Anlagen, die<br />
er betreibt, viel abverlangt, muss auch bereit<br />
sein, einen entsprechenden Preis zu<br />
zahlen. Das gilt nicht nur in Europa, sondern,<br />
wie die Erfahrung gezeigt hat, auch an<br />
vermeintlichen Billigstandorten.<br />
Bild: ©Feng Yu - Fotolia.com<br />
Evonik ist einer dieser Betreiber, der seine globale<br />
Strategie seit vielen Jahren erfolgreich umsetzt. Allein in<br />
China betreibt der Chemiekonzern 19 Produktionsstandorte<br />
und macht dort 1,2 Mrd. Euro Umsatz im Jahr<br />
– damit knapp 10 % des Gesamtergebnisses. Doch der<br />
Konzern hat in China einmal klein angefangen, mit wenigen<br />
Mitarbeitern die erste Dependance aufzubauen<br />
und größtenteils vom Hauptquartier aus zu steuern.<br />
Über die weiteren Jahre der Entwicklung mit stetig steigender<br />
Mitarbeiterzahl ist er jedoch dazu übergegangen,<br />
Verantwortlichkeiten mehr und mehr an die chinesischen<br />
Mitarbeiter zu übergeben und die Zahl der Expats<br />
sukzessive zu reduzieren. „Wir setzen auf den Einsatz<br />
guter, lokaler Mitarbeiter, die wir entsprechend unseren<br />
Anforderungen trainieren, denn in China sind persönliche<br />
Beziehungen sehr wichtig für den Projekterfolg“, berichtet<br />
Thomas Kügerl. Er vertritt das Engineering innerhalb<br />
des Servicebereiches Verfahrenstechnik und Engineering<br />
bei Evonik und war fünf Jahre lang unter anderem<br />
als Leiter der China-Dependance in China tätig war.<br />
Kügerl betont, dass ein guter Draht zu den lokalen Lieferanten<br />
unerlässlich sei, vor allem um die kulturellen und<br />
sprachlichen Barrieren zu überwinden, aber auch um<br />
beispielsweise das Behördenmanagement zu vereinfachen.<br />
Diese Strategie unterstützt auch Dr. Rainer Hauenschild,<br />
CEO der Business Unit Energy Solutions bei Siemens:<br />
„Das Delegationsprinzip funktioniert bei uns nicht<br />
mehr. Wir werden es zunehmend dadurch ersetzen, dass<br />
wir in den einzelnen Regionen präsent sind und lokale<br />
Einheiten aufbauen.“ Hauenschild sieht auch die schwindende<br />
Reisebereitschaft und den zunehmenden Kostendruck,<br />
den Expats verursachen, als Faktoren, welche die<br />
neue Strategie der Regionalisierung untermauern.<br />
Trotzdem ist es ratsam, nicht alle Verantwortlichkeiten<br />
direkt an die ausländischen Kontraktoren zu übergeben.<br />
Kügerl rät dazu, die Vor- und Basisplanung eines<br />
Projektes in Deutschland bzw. Europa oder den USA<br />
abzuschließen und auch die Terminplanung fest in eigenen<br />
Händen zu behalten. Seiner Erfahrung nach ist besonders<br />
die zeitliche Planung nicht unbedingt eine Stärke<br />
ausländischer Kontraktoren. Wenn die Projektdefinition<br />
und die Feed-Packages vorher festgeschrieben sind, ist<br />
eine sichere Projektbasis gelegt. „Außerdem haben wir<br />
zumeist ein Tandem aus westlichen und chinesischen<br />
Montageleitern vor Ort im Feld, sodass der Transfer unserer<br />
Wünsche hinein in die chinesischen Bau- und<br />
Montagefirmen reibungslos gelingt“, erläutert Kügerl.<br />
Zudem verfolgt der Spezialchemiekonzern – ebenso<br />
wie auch Siemens und viele andere global aufgestellte<br />
Firmen – den Ansatz, seine (potenziellen) Lieferanten,<br />
Apparatebauer und Kontraktoren regelmäßig zu auditieren,<br />
um zu erreichen, dass die Qualität der Produkte<br />
dauerhaft hoch gehalten wird. Doch egal, ob Zulieferer,<br />
Kontraktor oder Betreiber, eines muss allen klar sein: In<br />
anderen Ländern gilt, genauso wie in Deutschland: Qualität<br />
hat ihren Preis. ●<br />
Informationen zu dem deutschlandweit einzigartigen<br />
Großanlagenbaukongress Engineering Summit<br />
sowie weitere Artikel zum Thema Anlagenbau<br />
gefällig? Klicken Sie sich rein auf www.chemie<br />
technik.de/1301ct618 – oder QRCode scannen!
Technik, die begeistert<br />
Wenn‘s mal wieder schnell gehen muss<br />
Das Internet der Dinge startet heute: Mit der vorliegenden CHEMIE TECHNIK beginnt<br />
die intelligente Vernetzung von klassischer Papier-Ausgabe und Zusatzinformationen<br />
im Web. Per Tablet-Computer und Smartphone geht das spielend leicht.<br />
Sicher sind auch Ihnen bereits einige<br />
Neuerungen in dieser Ausgabe der<br />
CHEMIE TECHNIK aufgefallen. Das<br />
Magazin hat sich nicht nur optisch<br />
verändert und verjüngt – auch inhaltlich<br />
wollen wir noch mehr bieten.<br />
Dreh- und Angelpunkt dafür sind jede<br />
Menge kleiner, schwarzer Quadrate,<br />
die Sie über das gesamte Heft<br />
verteilt ab dieser Ausgabe finden. Die<br />
zweidimensionalen QR-Codes finden<br />
sich bei jedem einzelnen Beitrag und<br />
auf den übrigen Seiten mit Produktberichten,<br />
Nachrichten und Ähnlichem.<br />
Dies ist ein Service für Sie,<br />
unsere Leser! Denn mithilfe der QR-<br />
Codes (kurz für „Quick Response“)<br />
gelangen Sie via Smartphone oder<br />
Tablet-PC zu weiterführenden Informationen,<br />
Bildern und hilfreichen<br />
Links unserer Texte. Richtig Spaß<br />
macht das zum Beispiel mit einem<br />
iPad ab Version 2.<br />
Die Codes generieren wir nach einem<br />
festgelegten Schema, sodass<br />
Sie auf eine unserer Unterseiten von<br />
www.chemietechnik.de geleitet werden,<br />
auf der die Zusatzinfos zu finden<br />
sind. Also keine Scheu beim<br />
Ausprobieren!<br />
Gratis App installieren<br />
Sie benötigen noch ein paar kleine<br />
Tipps, wie Sie die Codes nutzen<br />
können? Egal, mit welchem Betriebssystem<br />
Ihr Mobiltelefon läuft –<br />
ob iOS von Apple, Android, Windows<br />
Mobile oder Symbian – auf vielen<br />
Geräten lassen sich Applikationen<br />
installieren, die QR-Codes auslesen<br />
können. Einzige zwingende Voraussetzung<br />
ist, dass Sie eine Kamera an<br />
Ihrem Telefon oder Tablet-PC haben.<br />
Nun können Sie sich einen der vielen<br />
QR-Code-Reader installieren, die<br />
gratis in den entsprechenden App-<br />
Shops erhältlich sind. Als Beispiele<br />
seien hier der „QR Reader for iPhone“<br />
und „Scan“ (für iOS), „QR Droid“<br />
oder der „QR Barcode Scanner“ (für<br />
Android), der „NeoReader“ und „UP-<br />
Code“ (für Symbian) sowie der „Esponce<br />
QR Reader“ (für Windows<br />
Mobile) genannt. Nach der Installation<br />
der Software kann es direkt losgehen.<br />
Gleich ausprobieren? Hier geht‘s zu<br />
www.chemietechnik.de<br />
ThyssenKrupp Uhde –<br />
Engineering with ideas.<br />
Die Basis unseres Erfolges ist die Kreativität und der Erfindungsreichtum<br />
unserer Mitarbeiter. So entstehen immer wieder aus<br />
großen Herausforderungen großartige Lösungen, die innovativ<br />
und oft wegweisend für die gesamte Ingenieurbranche sind.<br />
www.thyssenkrupp-uhde.de<br />
QR-Codes bringen Sie<br />
schnell zu weiteren<br />
Informationen<br />
ThyssenKrupp Uhde<br />
Produkte
Produkte<br />
Kreiselpumpe<br />
Produktschonend und<br />
energieeffizient<br />
• Leistungsbereich bis 210 m 3 /h<br />
• Förderhöhen bis 90 m WS<br />
• Reinigung in CIP/SIP-Verfahren<br />
Sorgfältig dimensionierte Hocheffizienzmotoren<br />
der Variflow Pumpen von GEA Tuchenhagen sorgen<br />
für einen geringen Energieverbrauch. Exakt konstruierte,<br />
totraumfreie Fließwege und speziell entwickelte<br />
Laufräder bewirken eine gleichmäßige und<br />
schonende Produktförderung. Diese Merkmale<br />
sorgen außerdem für eine ausgezeichnete Reinigungsfähigkeit<br />
der Pumpen. Dadurch erreichen Sie<br />
eine höhere Produktqualität und können den Verbrauch<br />
von wertvoller Energie, Wasser und Reinigungsmitteln<br />
sowie den Zeit- und Personalaufwand<br />
für die Reinigung und Wartung deutlich redu-<br />
Verdampfer<br />
Mehr Proben<br />
• inerte Werkstoffe<br />
• kein Leistungsverlust<br />
• säurebeständige Komponenten<br />
Die Materialien des Verdampfers EZ-<br />
2 HCl von Genevac halten auch<br />
12-moliger Salzsäure und anderen<br />
Säurechloriden stand. Die Komponenten<br />
im Verdampfer sind eine<br />
PTFE-beschichtete Verdampfungskammer,<br />
ein Glaskondensator und<br />
Ganzmetallteile, die aus säurebeständigem<br />
Hasteloy-C-Stahl hergestellt<br />
wurden, sollten diese in Kontakt<br />
mit entfernten Lösungsmitteln<br />
kommen.<br />
chemietechnik.de/1302ct086<br />
28 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
zieren. Das Portfolio<br />
umfasst dabei einen<br />
Leistungsbereich von<br />
bis zu 210 m 3 /h bei Förderhöhen von bis zu 90 m<br />
WS. Die Kreiselpumpen sind EHEDG-zertifiziert und<br />
entsprechen dem 3A-Standard. Das Spiralgehäuse<br />
ist aus kaltbearbeitetem Walzstahl gefertigt. Dieses<br />
Material verfügt über eine sehr gute Oberflächengüte<br />
und erfüllt damit die Voraussetzungen<br />
zur optimalen Reinigung in CIP/SIP-Verfahren. Zudem<br />
bieten Wanddicken von 6 bis 8 mm hohe<br />
Stabilität bei schwierigen Rohrleitungsanbindun-<br />
Metallsuchgerät<br />
Zuverlässiger Schutz<br />
• für schwierige Bedingungen<br />
• hohe Tastempfindlichkeit<br />
• zuverlässiger Schutz<br />
Das Metallsuchgerät Protector Professional<br />
von S+S kann unter<br />
schwierigen Bedingungen Metallpartikel<br />
detektieren. Selbst bei schweren<br />
Aufbauten bis 500 kg bietet das<br />
Gerät eine um 25 % höhere Tastempfindlichkeit<br />
als die Standard-<br />
Ausführung. So können auch schwere<br />
Geräte aufgebaut werden, und die<br />
Verarbeitungsmaschine wird weiterhin<br />
zuverlässig vor Metallpartikeln<br />
geschützt.<br />
chemietechnik.de/1302ct099<br />
gen und hohen Zulaufdrücken. Die Abdichtung erfolgt<br />
über eine hygienische Gleitringdichtung mit<br />
einer außerhalb des Produktraums liegenden Feder.<br />
Optional können gespülte und doppeltwirkende<br />
Gleitringdichtungen eingesetzt werden.<br />
Anlagenplanungssoftware<br />
Planungslösung für Lean Construction<br />
• 3D-Grafiken<br />
• 2D- und 3D-Geometrie-Interfaces<br />
• leicht zu bedienen<br />
Die Software Everything 3D von Aveva<br />
ermöglicht Anlagenplanern die<br />
Einführung von Lean Construction<br />
mit durchgängigen Arbeitsabläufen<br />
in der Planung und Konstruktion, so<br />
dass die gesamten Projektkosten,<br />
der Terminplan und die Risiken reduziert<br />
werden. Anlagenbetreiber profitieren<br />
ebenso vom Einsatz der Soft-<br />
Powtech Halle 6 – 229<br />
chemietechnik.de/1302ct160<br />
ware, da sich zum einen die Zeit bis<br />
zur produktiven Inbetriebnahme der<br />
Anlage verkürzt und sie zum anderen<br />
vom EPC eine digitale Anlage erhalten,<br />
die eine echte Abbildung der<br />
physikalischen Anlage darstellt. Die<br />
Software bietet eine Reihe technologischer<br />
Neuerungen an, die unter<br />
anderem integrierte Laser-Scanning-<br />
Lösungen sowie Mobil- und Cloud-<br />
Computing umfassen.<br />
chemietechnik.de/1302ct124
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Seite: www.chemietechnik.de/1301ct908 oder<br />
QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
Paletten-Stapelrahmen<br />
Ordnungshüter<br />
• flexibel und platzsparend<br />
• Traglast 1.000 kg<br />
• für Euro- und CP3-Paletten<br />
Der Stapelrahmen von APE Engineering<br />
besteht aus einer soliden Stahlkonstruktion,<br />
ist lackiert und in den<br />
drei Nutzhöhen bzw. Höhenausführungen<br />
500, 750 und 1.000 erhältlich.<br />
Er eignet sich für das Stapeln<br />
von Euro- bzw. CP3-Paletten und<br />
ermöglicht mehr Lagerkapazität in<br />
Räumen, wo Regale keinen Platz<br />
haben oder deren Bestückung zu<br />
umständlich ist. Durch ihren Einsatz<br />
ist eine bis zu fünffache Stapelbarkeit<br />
gegeben mit einer Traglast<br />
von jeweils 1.000 kg, sodass sich<br />
Raumhöhen optimal nutzen lassen.<br />
Der Rahmen eignet sich für beengte<br />
Produktionsräume.<br />
chemietechnik.de/1302ct112<br />
bis zu 65%<br />
weniger Schaltschrankplatz<br />
als vergleichbare Antriebe<br />
Vibrationsmessumformer<br />
Zustandsüberwacher<br />
• zugelassen für Ex-i-Bereiche<br />
• schnell und günstig installiert<br />
• Peakview-Technologie<br />
Die Einsatzmöglichkeiten des Vibrationsmessumformers<br />
CSI 9420 von<br />
Emerson wurden durch die Zulassung<br />
für Ex-i-Bereiche in Europa,<br />
den USA und Kanada erweitert.<br />
Durch Zulassungen für Atex-Zone 0<br />
und Class I, Div 1 kann der CSI 9429<br />
jetzt direkt in Ex-Bereichen chemischer,<br />
petrochemischer und Offshore-Einrichtungen<br />
sowie in anderen<br />
explosionsgefährdeten Umgebungen<br />
installiert werden. Das Gerät<br />
ermöglicht wichtige Einblicke in den<br />
Zustand von Pumpen, Gebläsen und<br />
andere Anlagen-Assets, die in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen installiert<br />
sind.<br />
chemietechnik.de/1302ct079<br />
QR-Codes und<br />
shoRtlink<br />
Wozu noch googeln?<br />
Ab 2013 finden Sie in der CHEMIE TECHNIK auf den Seiten mit<br />
Nachrichten und Produktinformationen am oberen Seitenrand<br />
QR-Codes und kurze Webadressen. Wenn Sie diese mit einer<br />
entsprechenden App mit dem Smartphone oder Tablet PC (Android-Gerät<br />
oder ab iPad 2) scannen oder den Kurzlink in Ihren<br />
Webbrowser eintragen, gelangen Sie über das Online-Angebot<br />
der CHEMIE TECHNIK umgehend zu mehr Informationen: In der<br />
Regel direkt zur Produktseite des Anbieters oder dessen Homepage.<br />
Probieren Sie‘s aus!<br />
Hygrometer<br />
Schnell und leicht zu bedienen<br />
• basiert auf Taupunktspiegelprinzip<br />
• keine externe Kühlung nötig<br />
• bis -90 °C Td<br />
Der Taupunktspiegel S8000 RS von<br />
Michell bietet verlässliche Messungen<br />
in allen Industrieanwendungen,<br />
in denen hohe Präzision im Bereich<br />
sehr trockener Gase kritisch, aber<br />
einfache Bedienung wichtig ist. Das<br />
Gerät kann präzise und wiederholbar<br />
bis -90 °C Td (0,1 ppmV) messen,<br />
ohne zusätzliche externe Kühlung zu<br />
benötigen. Der Taupunktspiegel verwendet<br />
ein optisches System, das<br />
Produkte<br />
die Detektion von bereits sehr geringen<br />
Änderungen der Kondensation<br />
auf dem Spiegel erlaubt. Dies führt<br />
zu hoher Sensitivität und schnellem<br />
Ansprechverhalten im Bereich sehr<br />
niedriger Taupunkte. Der kontrastreiche<br />
LCD-Touch-Screen des Taupunktspiegels<br />
erlaubt die einfache<br />
und intuitive Bedienung. USB- und<br />
Ethernet-Anschlüsse sind Standard<br />
für den Fernzugriff und die Datenaufnahme<br />
über PC und Netzwerk.<br />
chemietechnik.de/1302ct006<br />
690 V – VLT® AutomationDrive<br />
Mehr Platz für Ihre Ideen<br />
mit den neuen Frequenzumrichtern<br />
Danfoss erweitert seine 690 V-Umrichter in IP 20 ab 1,1 kW – 75 kW:<br />
Sie sparen damit Schalt schrank platz und reduzieren somit Ihre<br />
Systemkosten. Die Fequenzumrichter regeln Motoren ab 0,37 kW<br />
ohne Anpasstransformator. Das Leistungsspektrum der 690 V-Geräte<br />
reicht nun von 1,1 kW bis 1,4 MW.<br />
Besuchen Sie uns auf der ISH Weltleitmesse 2013 in Halle 11.0,<br />
Stand C11 sowie auf dem Automatisierungstre 2013 in der<br />
Kongresshalle Böblingen.<br />
www.danfoss.de/vlt<br />
Danfoss <strong>GmbH</strong> · VLT® Antriebstechnik<br />
Carl-Legien-Straße 8, D-63073 Oenbach<br />
Telefon: +49 69 8902-0, E-Mail: vlt@danfoss.de
Special<br />
Gase<br />
Der Gas-Verfahrenstechnik gehört die Zukunft. Betrachtet<br />
man die derzeit technisch erreichbaren Funde an konventionellen<br />
Lagerstätten und insbesondere an unkonventionellem<br />
(Schiefer-)Erdgas, dann wird klar, dass die Welt auf absehbare<br />
Zeit kein Energieproblem haben wird.<br />
In unserem Special gehen wir der Frage nach, welchen Einfluss<br />
der Erdgasboom auf den verfahrenstechnischen Anlagenbau<br />
und die weltweite Chemieindustrie haben wird. Daneben<br />
zeigen wir die gigantischen Anlagenbauprojekte, die<br />
derzeit in den USA aufgrund der sich dort vollziehenden<br />
Schiefergasrevolution angeschoben werden. Außerdem stellen<br />
wir Ihnen interessante technische Lösungen für das<br />
Handling von tiefkalten Gasen bzw. LNG vor.<br />
30 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Links und Quellen zum Special<br />
per QR-Code-Scan und<br />
chemietechnik.de/1301ct900<br />
CT-TrendberiChT:<br />
Wie Schiefergas nicht nur die Chemie und den Anlagenbau verändert 31<br />
Aktuelle Anlagenbau-Großprojekte in den USA 36<br />
CT-TrendberiChT:<br />
Schiefergas und LNG beflügeln Nationen und Industrie 38<br />
Armaturen für Flüssiggas müssen extremen Anforderungen standhalten 40<br />
Bild: © WoGi - Fotolia.com
Bild: © Tomas Sereda - Fotolia.com<br />
Der Autor:<br />
Armin Scheuermann<br />
ist Chefredakteur der<br />
CHEMIE TECHNIK<br />
Wie Schiefergas nicht nur die Chemie und den Anlagenbau verändert<br />
Auf dem Weg ins<br />
„Golden Gas Age“<br />
PRofi-GuiDe<br />
Funktion Branche<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ●<br />
Ausrüster ● ● ●<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer ● ●<br />
Manager ● ● ●<br />
entsCheiDeR-fACts<br />
Für Planer und Manager<br />
Die amerikanische Chemieindustrie kleckert nicht, sie<br />
klotzt: 14 neue Ethancracker – Kostenpunkt bis zu 34<br />
Milliarden US-Dollar – wurden in den vergangenen<br />
Monaten angekündigt. Der südafrikanische Sasol-Konzern<br />
plant für 14 Milliarden US-Dollar eine Anlage, die<br />
Erdgas zu Diesel umwandeln soll. Daneben sollen mehr<br />
als ein Dutzend neue Großanlagen zur Produktion von<br />
Methanol, Ammoniak und Düngemittel entstehen. Der<br />
Grund dafür ist ein unscheinbares Molekül: CH 4 .<br />
Die Rohstoffquelle – billiges Schiefergas – beflügelt<br />
nicht nur die Chemie. Auch Stahlhersteller wie die amerikanische<br />
Nucor wollen den preiswerten Rohstoff nutzen:<br />
Der niedrige Gaspreis macht die Direktreduktion<br />
von Eisenschwamm aus Eisenerz attraktiv. Und auch die<br />
Special<br />
● Die USA stehen aufgrund der ausgeweiteten Schiefergasförderung von einem Anlagenbau-Boom.<br />
Zwischen 2010 und 2035 sollen Investitionen in Höhe von 1,9 Billionen<br />
US-Dollar angestoßen werden.<br />
● Zahlreiche Projekte werden von Chemieunternehmen realisiert. Neben Düngemittel<br />
und Methanol geht es um die Verwertung der in einzelnen Gasvorkommen vorhandenen<br />
flüssigen Kohlenwasserstoffe.<br />
Energieversorger setzen auf Schiefergas. Kohlebefeuerte<br />
Kraftwerke werden durch umweltfreundlichere Gaskraftwerke<br />
ersetzt. Und: Die nordamerikanischen Gaserzeuger<br />
träumen von über einem Dutzend neuer LNG-<br />
Terminals, über die der verflüssigte Energieträger zu<br />
deutlich höheren Renditen an Abnehmer in Asien, Afrika<br />
und Europa verschifft werden soll. Die Phantasie der<br />
US-Industrie scheint keine Grenzen zu kennen.<br />
Reale Zukunftsszenarien oder nur Luftschlösser?<br />
Betrachtet man das Gesamtbild, dann könnten sich einzelne<br />
Planungen als Luftschlösser entpuppen. „Selbst mit<br />
optimistischen Annahmen ist die in den USA zur Verfügung<br />
stehende Ethanmenge geringer als die angekündig-<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
31
Special<br />
GaSpreiS<br />
Mehrfach nach unten korrigiert<br />
In den vergangenen vier Jahren hat die US-<br />
Energiebehörde ihre Erwartungen für den<br />
mittel- bis langfristigen Gaspreis jährlich<br />
nach unten korrigiert. Während die AEO im<br />
Jahr 2009 noch davon ausgegangen war,<br />
Auch die Ölförderung<br />
blüht in den USA durch<br />
Einsatz neuer Methoden<br />
wieder auf<br />
32 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
dass der Gaspreis in 2020 bei 8 Dollar/<br />
mmBTU liegen wird, gehen Schätzungen<br />
von 2012 davon aus, dass sich der Gaspreis<br />
bis 2020 unter 5 US-Dollar pro mmBTU<br />
bewegen wird.<br />
ten Cracker-Projekte“, wirft Dr. Marc Schier, Business<br />
Development Manager beim Anlagenbauer Linde, ein<br />
Schlaglicht auf die Projektpläne. Das Beispiel macht<br />
deutlich, dass die Euphorie, aber auch die Ungewissheit,<br />
derzeit enorm ist. Die Nutzung des Schiefergas-Schatzes,<br />
nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Weltregionen,<br />
hat viele Variablen und beeinflusst ebenso viele<br />
Faktoren: Welcher Weg, um Erdgas zu Geld zu machen,<br />
wird in naher Zukunft dominieren? Wie wird sich der<br />
Gaspreis in den USA und auf dem Weltmarkt entwickeln,<br />
und welche Konsequenzen hat dies für den Anlagenbau<br />
und die Chemie und das weltweit? Welche Projekte<br />
haben Potenzial, und welche Technologien werden<br />
durch das billige Gas unwirtschaftlich werden?<br />
Um diese Fragen zu beantworten, lohnt ein Blick in<br />
die fundamentalen Daten. Die US-Energiebehörde<br />
schätzt die Schiefergasvorkommen in Nordamerika auf<br />
55 Billionen (2012) Kubikmeter. An zweiter Stelle stehen<br />
Vorkommen im Asia-Pazifikraum (50,5 Billionen Kubikmeter),<br />
gefolgt von südamerikanischen Vorkommen<br />
(34,7 Billionen Kubikmeter). In Afrika werden immerhin<br />
noch 29 Billionen Kubikmeter vermutet, in Europa<br />
und Eurasien sollen es 16,8 Billionen Kubikmeter sein.<br />
Seit 2005 ist die Erdgasförderung in den USA um mehr<br />
als ein Viertel gewachsen.<br />
Der Gasmarkt wird also auf Jahrzehnte hinaus nicht<br />
vom Angebot, sondern von der Nachfrage getrieben<br />
werden. Aufgrund des enormen Preisverfalls von Erdgas<br />
in den USA – der Preis einer mmBtu (siehe Kasten) ist<br />
von 9,7 USD in 2005 auf 2,5 USD in 2012 gefallen – wurden<br />
in den vergangenen Jahren vor allem Vorkommen<br />
mit Nassgasen verstärkt ausgebeutet. Diese Schiefergase,<br />
zu denen die Bakken-, Eagle-Ford- und Marcellus-Felder<br />
gehören, enthalten 5 bis 20 Prozent Ethan und andere<br />
Flüssig-Kohlenwasserstoffe (Natural Gas Liquids,<br />
NGL). Dazu kommt, dass sich durch die Fördermethode<br />
Fracking auch neue Ölvorkommen erschließen lassen.<br />
Die Internationale Energieagentur IEA erwartet, dass<br />
sich die amerikanische Schieferölförderung bis 2020<br />
mehr als verdreifachen wird. Nach konservativen Schätzungen<br />
könnte die Ölproduktion von derzeit 7,8 Millionen<br />
Barrel pro Tag auf 11,6 Millionen Barrel pro Tag in<br />
2020 steigen. Die USA würde damit wieder zur größten<br />
Öl-Fördernation der Welt.<br />
Chemieindustrie plant neue Ethylenanlagen<br />
Noch vor fünf Jahren schien der Bau neuer Gascracker<br />
in den USA undenkbar – die Produktion von Ethylen<br />
war weltweit nirgends so teuer wie in den USA. Doch die<br />
flüssigen Bestandteile des Schiefergases haben das Blatt<br />
gewendet. Das Beratungsunternehmen Global Data<br />
Bild: ©Edelweiss - Fotolia.com
schätzt, dass die Ethylenkapazität in den USA bis 2017<br />
um 35 Prozent von derzeit 26 auf 35 Megatonnen pro<br />
Jahr steigen wird. Zu den geplanten Projekten gehören<br />
die Vorhaben des Chemiekonzerns Dow in Hahnville,<br />
Louisiana: Dieser will an der Golfküste nicht nur einen<br />
neuen Ethancracker, sondern auch zwei Propan-Dehydrieranlagen<br />
bauen. Die BASF erweitert im texanischen<br />
Port Arthur die Kapazität ihres Crackers, und auch<br />
Westlake Chemical vergrößert sowohl in Kentucky als<br />
auch in Lake Charles, Louisiana, ihre Ethylenanlagen.<br />
Der Ölkonzern Shell will in den Appalachen in der Nähe<br />
des Marcellus Schiefergasfeldes einen Ethancracker bauen.<br />
Aufgrund der geschätzten verfügbaren Menge an<br />
flüssigen Erdgasbestandteilen, den hohen Investitionskosten<br />
und Finanzierungsbedarf so wie der limitierten<br />
Verfügbarkeit geeigneter Montagekräfte glaubt man<br />
beim Anlagenbauer Linde allerdings, dass es in den USA<br />
in den kommenden fünf Jahren Potenzial für drei bis<br />
sechs Cracker-Neubauprojekte gibt.<br />
Ammoniak, Methanol und Dünger<br />
Aber nicht nur höherwertige Kohlenwasserstoffe versprechen<br />
den amerikanischen Chemieunternehmen<br />
profitable Geschäfte auf Basis von Schiefergas. Methan<br />
bildet die Grundlage von Ammoniak und damit der<br />
Düngemittelproduktion. In Kombination mit großen<br />
Abnehmern in den „Kornkammern“ des Mittleren Westens<br />
sorgt billiges Schiefergas dafür, dass der ehedem<br />
schon für tot erklärten amerikanischen Düngemittelproduktion<br />
neues Leben eingehaucht wird: Mindestens sieben<br />
Neubauprojekte werden derzeit erörtert, einige davon<br />
sogar bereits geplant und gebaut. Drei der Großprojekte<br />
wurden im vergangenen Jahr von Thyssen Krupp<br />
Uhde gewonnen.<br />
Doch auch der Methanolmarkt ist durch Schiefergas<br />
in Bewegung geraten. Wurde der Alkohol bislang vor<br />
allem aus Südamerika importiert, soll die Produktionskapazität<br />
in Nordamerika nun durch eine Reihe neuer<br />
Öl-FaktEn<br />
Ölmacht USA<br />
Die USA trugen im vergangenen Jahr am meisten<br />
zum Wachstum der weltweiten Ölproduktion bei.<br />
Die Produktion stieg um 395.000 Fässer pro Tag.<br />
EinhEitEn<br />
Was verbirgt sich unter mmBtu?<br />
Der Energieinhalt von Erdgas wird häufig in<br />
mmBTU angegeben. mmBtu steht für „million British<br />
thermal units“, wobei mit „mm“ „tausend<br />
tausend“ gemeint sind. 1 mmBtu entspricht<br />
26,4 Kubikmeter Gas, basierend auf einem Energieinhalt<br />
von 40 Megajoule/m³. Die Btu gehört<br />
„Noch vor fünf Jahren<br />
schien der Bau neuer<br />
Cracker in den USA undenkbar<br />
– die Produktion<br />
von Ethylen war weltweit<br />
nirgends so teuer wie in<br />
den USA“<br />
Innerhalb von zehn Jahren stieg der Selbstversorgungsanteil<br />
von 50 Prozent auf inzwischen<br />
72 Prozent.<br />
nicht zum SI-System und ist definiert als die Wärmeenergie,<br />
die benötigt wird, um ein britisches<br />
Pfund Wasser um 1 Grad Fahrenheit zu erwärmen.<br />
Wegen der temperaturabhängigen Wärmekapazität<br />
existieren mehrere Definitionen der „British<br />
thermal unit“.<br />
PLANEDS online<br />
ÄN<strong>DER</strong>UNG?<br />
Dank Redlining in der<br />
PLANEDS-App ist das Team<br />
immer mit vor Ort.<br />
KEIN PROBLEM!<br />
PLANEDS – CAE für Fließbild<br />
und EMSR-Technik<br />
In der Prozessindustrie seit über<br />
20 Jahren erfolgreich im Einsatz<br />
Planets Software <strong>GmbH</strong><br />
Planetenfeldstr. 97<br />
D-44379 Dortmund<br />
Tel: +49 231 555783-0<br />
www.planeds.de<br />
33<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
RZ_Anzeige_Planets_56x257.indd 1 10.01.13 19:04
Special<br />
Der Export von Schiefergas<br />
in Form von<br />
LNG ist in den USA<br />
umstritten: Die Chemie<br />
beansprucht den günstigen<br />
Rohstoff für sich<br />
WirtSchaft<br />
US-Industrie reloaded<br />
Niedrige Gas- und Energiepreise verschaffen<br />
der US-Industrie ungeahnte Vorteile:<br />
Das Beratungsunternehmen IHS Global Insights<br />
schätzt, dass Schiefergas in den USA<br />
zwischen 2010 und 2035 Investitionen in<br />
34 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Projekte und Wiedereröffnung bestehender Anlagen<br />
steigen. Die wohl spektakulärste Aktion in diesem Zusammenhang<br />
dürfte die Verlagerung einer von Methanex<br />
in Chile betriebenen 850 kt/a-Methanol-Anlage<br />
nach Geismar in den USA sein. Celanese plant in Bayport,<br />
Texas, eine 1,3 Mt/a-Anlage und auch die Dakota<br />
Gas Company will das Schiefergas in North Dakota für<br />
die Produktion von Treibstoffen aus Methanol nutzen.<br />
Gas to Liquids: Profit aus der Preisspanne<br />
zwischen Öl und Gas<br />
Das wohl ambitionierteste Einzelprojekt in den USA<br />
dürfte die von der südafrikanischen Sasol geplante GTL-<br />
Anlage sein. In dem integrierten GTL- und Ethancracker-Komplex<br />
sollen ab 2017 aus Erdgas Diesel, weitere<br />
Treibstoffe und Chemikalien produziert werden. Anfang<br />
Dezember vergangenen Jahres gab das Sasol-Management<br />
nach Bewertung der Machbarkeitsstudie bekannt,<br />
dass nun mit der FEED-Phase (front-end engineering<br />
and design) begonnen werden soll. Insgesamt will das<br />
Unternehmen 21 Milliarden US-Dollar in das Projekt<br />
investieren. Für den Bundesstaat Louisiana ist die in<br />
Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar anstoßen<br />
wird. Bis 2035 sollen durch Schiefergas in<br />
den Vereinigten Staaten rund 1 Million zusätzliche<br />
Arbeitsplätze in der Industrie entstehen.<br />
Westlake geplante Anlage von enormer Bedeutung:<br />
Mehr als 1.200 direkte und über 5.800 indirekte Arbeitsplätze<br />
sollen dadurch entstehen.<br />
Interessant werden Gas-to-liquid-Projekte, wenn der<br />
Unterschied zwischen Gaspreis und Ölpreis hoch ist –<br />
nutzt GTL doch günstiges Erdgas, um daraus teure Mineralölprodukte<br />
zu erzeugen. Der Ölkonzern Shell setzt<br />
bei seinem in Katar realisierten Megaprojekt „Pearl“ auf<br />
diesen Unterschied. Aufgrund langer Entwicklungszeiten<br />
und einem hohen erforderlichen Kapitaleinsatz<br />
rechnen sich GTL-Projekte allerdings nur langfristig –<br />
das Investitionsrisiko ist entsprechend hoch.<br />
Energiebranche ersetzt Kohle durch Erdgas<br />
Erdgas kann in den USA inzwischen von der Kostenseite<br />
mit Kohle mithalten, erzeugt aber bei der Stromerzeugung<br />
lediglich halb so viel Kohlendioxid. Außerdem<br />
sind Gaskraftwerke im Bau deutlich günstiger als kohlebasierte<br />
Kraftwerke. Dazu kommen neue Grenzwerte<br />
der US-Umweltbehörde für Emissionen von Partikeln,<br />
Quecksilber und anderen toxischen Stoffen, die in den<br />
kommenden Jahren dazu führen werden, dass fast<br />
9 Prozent der Kohlekraftwerke (28 GW) vom Netz gehen<br />
werden. Gleichzeitig schätzt das US-Energieministerium,<br />
dass bis 2035 zusätzliche 223 GW Stromerzeugungskapazität<br />
notwendig sein werden – mindestens<br />
60 Prozent davon soll in Gaskraftwerken erzeugt werden.<br />
Der Stahlkonzern Nucor investiert in St. James<br />
Parish am Ufer des Mississippi 750 Mio. US-Dollar in<br />
eine Anlage zur Direktreduktion von Eisenerz. „Ohne<br />
den durch Schiefergas gesunkenen Gaspreis wäre das<br />
Projekt nicht wirtschaftlich“, erklärt Dan DiMicco, CEO<br />
von Nucor.<br />
Bild: ©Carabay - Fotolia.com
Politikum LNG-Export<br />
Der Preis von Erdgas wurde in der Vergangenheit nicht<br />
nur in den USA je nach Region unterschiedlich festgesetzt.<br />
Denn im Gegensatz zu Erdölprodukten lässt sich<br />
Gas nur über Pipelines wirtschaftlich transportieren.<br />
Die großen Vorkommen im Bakken-Shale von North<br />
Dakota wurden deshalb ursprünglich primär aufgrund<br />
der darin enthaltenen Öl- und Flüssigkohlenwasserstoffe<br />
ausgebeutet. Noch 2011 wurde deshalb rund ein Drittel<br />
des geförderten Gases schlichtweg abgefackelt. Doch die<br />
Situation hat sich geändert. Rund 108.000 km umfasst<br />
das Gasnetz der USA, das inzwischen fast jedes Gasfeld<br />
mit den Abnehmermärkten verbindet. Dass der Schiefergas-Boom<br />
kein Strohfeuer sein wird, erwartet beispielsweise<br />
der Pipelinebetreiber Kinder Morgan.<br />
38 Milliarden Dollar hat das Unternehmen kürzlich in<br />
den Kauf des Pipelinenetzes von El Paso gesteckt und<br />
verfügt damit über 22 Prozent des Gasnetzes der USA.<br />
Experten erwarten, dass die Transaktion den Erdgasmarkt<br />
in den USA stabilisieren wird.<br />
Pipelines eröffnen den Schiefergas-Erzeugern zusätzlich<br />
auch die Möglichkeit, LNG zu exportieren. Die<br />
Förderunternehmen erwarten sich vom LNG-Export<br />
steigende Gaspreise und damit höhere Gewinnmargen.<br />
Dass dies wirtschaftlich ist, zeigt eine einfache Rechnung:<br />
Zu Feedgas-Kosten zwischen 3 und 5 USD und<br />
Verflüssigungskosten von 3 bis 4 USD kommen LNG-<br />
Transportkosten von 1 bis 2 USD pro mmBtu. „Den<br />
Gesamtkosten von 7 bis 11 USD/mmBtu stehen in Asien<br />
LNG-Importpreise bis zu 18 Dollar pro mmBtu gegenüber“,<br />
erläutert Dr. Marc Schier. Der US-Energieregulierungsbehörde<br />
FERC liegen deshalb Projekte für den Bau<br />
von Exportterminals vor, mit denen jährlich 100 Mio. t<br />
LNG verschifft werden könnten.<br />
Eine Studie des US-Energieministeriums kommt<br />
zum Schluss, dass die Gesamtwirtschaft von einem Gasexport<br />
profitieren würde. Downstream-Investoren wie<br />
der Chemiekonzern Dow sehen das erwartungsgemäß<br />
anders. Sie fürchten um den günstigen Rohstoff, der ihren<br />
Projektplanungen zugrunde liegt. Wie sehr die Nerven<br />
blank liegen, zeigt ein ungewöhnlich scharfer Angriff<br />
des Dow-Chefs Andrew Liveris: „Die Studie des<br />
Energieministeriums im Hinblick auf den Export von<br />
LNG ist fehlerhaft, irreführend und basiert auf veralteten,<br />
fehlerhaften oder unvollständigen Daten.“<br />
„Wenn mehr Erdgas die Märkte erreicht, wird der<br />
Preis aufgrund der vielfältigen Abnehmer steigen“, glaubt<br />
Charlotte Batson vom Beratungsunternehmen Batson &<br />
Company: „Das wird negative Auswirkungen auf die<br />
Chemie und andere Industrien haben, die Erdgas als<br />
Rohstoff nutzen. Auf der anderen Seite wird dies<br />
Upstream-Aktivitäten in Feldern mit trockenem Schiefergas<br />
wie Haynesvill und Barnett stimulieren.“<br />
Anlagenbau-Boom mit Risiken<br />
Doch spätestens hier wird klar, dass die Rechnung für<br />
die vielfältigen Projekte, um Schiefergas zu Geld zu machen,<br />
kaum aufgehen kann: Chemie-, Energie- und Ex-<br />
portsektor konkurrieren um ein und denselben Rohstoff<br />
und könnten den Gaspreis insgesamt wieder so in die<br />
Höhe treiben, dass die Kalkulation einzelner Projekte<br />
kippt. „Wir glauben nicht, dass alle Projekte umgesetzt<br />
werden. Es wird sicher eine bemerkenswerte Zahl sein,<br />
aber viele Projekte werden wieder sterben“, ist Linde-<br />
Experte Marc Schier überzeugt. „Einige der Projekteentwicklungen<br />
dienen vielleicht auch dazu, den Buchwert<br />
der Schiefergasreserven nach oben zu bringen“, vermutet<br />
Schier und erwartet eine Konsolidierung auf der Seite<br />
der Gas-Fördergesellschaften.<br />
Zeit könnte für die Investoren ein wichtiger Faktor<br />
werden: Einerseits, um sich einen langfristig niedrigen<br />
Gaspreis vertraglich zu sichern, andererseits; um ihr<br />
Projekt rechtzeitig in Stahl und Eisen zu gießen, bevor<br />
Planungs-, Montage- und Ausrüstungsressourcen knapp<br />
und damit teuer werden. An Erfahrungen dieser Art<br />
fehlt es dem (Chemie-)Anlagenbau nicht: 2005 hatten<br />
beispielsweise die Owners Engineers bei der BASF mit<br />
massiven Preissteigerungen bei der Projektabwicklung<br />
in den USA zu kämpfen: Ein lukrativer Ölpreis hatte<br />
damals zahlreiche Modernisierungs- und Erweiterungsprojekte<br />
in amerikanischen Raffinerien angestoßen und<br />
damit nicht nur Engineering-, Bau- und Montageleistungen<br />
an der Golfküste verteuert, sondern auch Maschinen<br />
und Apparate.<br />
Kommentar<br />
Energiewende ade<br />
Was für eine Entwicklung! Während unsere<br />
Klimakanzlerin erstmals von der „Energiewende“<br />
träumte und die deutsche Öffentlichkeit<br />
Obama als Heilsbringer in Richtung<br />
einer grünen Zukunft verehrte, vollzog sich<br />
in den USA klammheimlich eine Revolution<br />
der ganz anderen Art. Die Nation setzt massiv<br />
auf Sonnenenergie – und zwar auf die,<br />
die vor Jahrmillionen von Pflanzen eingefangen<br />
und in Form von Öl und Gas im Gestein<br />
gespeichert wurde. Amerikaner kennen<br />
zwar das deutsche Wort „Kindergarten“,<br />
doch „Energiewende“ werden sie<br />
wohl nie lernen müssen. In der Europäi-<br />
Dr. Marc Schier Business Development Manager<br />
beim Anlagenbauer Linde<br />
„Wir glauben nicht, dass alle Projekte<br />
umgesetzt werden. Es wird sicher eine bemerkenswerte<br />
Zahl sein, aber viele Projekte<br />
werden wieder sterben“<br />
schen Union wird das Thema zwar (noch)<br />
diskutiert, aber irgendwie stehen wir Deutschen<br />
angesichts der nackten Zahlen zur<br />
globalen Nutzung fossiler Energien inzwischen<br />
ziemlich alleine da. Im Sinne des<br />
nachhaltigen Wirtschaftens wäre die Energieerzeugung<br />
aus Wind und Sonne ja schon,<br />
aber mich beschleicht das Gefühl, dass wir<br />
mit der „Energiewende“ vom Vorreiter zum<br />
Alleingänger werden. Der Wettbewerbsfähigkeit<br />
wird das kaum helfen...<br />
Ihre Meinung? Schreiben Sie an armin.<br />
scheuermann@chemietechnik.de<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
35
Special<br />
Aktuelle Anlagenprojekte in den USA<br />
Land Standort Projektart Betreiber / Investor Inbetriebnahme<br />
USA Texas EPCM-Auftrag Erweiterung Acrylsäure-<br />
Anlage, Methylacrylat-Projekt<br />
Arkema<br />
USA Ausbau Methylamnin-Kapazitäten Taminco Ende 2014<br />
USA Lousiana Erweiterung Adsorbtionsmittel-Anlage BASF Mitte 2013<br />
USA Michigan Bau Elektrolyt-Anlage Advanced Elektrolyt Tech. Ende 2012<br />
USA Arkansas Bau Luftzerlegungsanlage Linde 4. Quartal 2013<br />
USA Calvert City, Kentucky Ausbau PVP-Produktion Ashland 2012<br />
USA Geismar Ameisensäure-Produktion BASF 2. Quartal 2014<br />
USA Fort Dodge Bau Lysin-Anlage CJ Bio America 2014<br />
USA Colorado Biokraftstoff-Anlage Sundrop Fuels Ende 2014<br />
USA Texas Chemieanlage für Shalegas-Feedstock Exxon Mobil 2016<br />
USA Pace Ausbau Methylamin-Produktion Taminco 2014<br />
USA Nevada, Iowa Ethanol-Anlage Dupont Ende 2013<br />
USA Geismar Methanol-Anlage Shale Gas Feedstock Methanex Ende 2014<br />
USA Philadelphia Modernisierung Propylen-Anlage Braskem<br />
USA North Carolina Bioraffinerie Chemtex 2014<br />
USA Freeport, Texas Propylen-Produktion Dow Chemical Company 2015<br />
USA Wever, Iowa Flüssigdüngemittel-Anlage Iowa Fertilizer / Orascom 2015<br />
USA Chicago Neubau Luftzerlegungsanlage für O , N 2 2<br />
und Ar<br />
Airgas 2014<br />
USA Calvert City, Kentucky Neue Rohstoffbasis für Ethylen-Anlage/<br />
PVC-Kapazitätsausbau<br />
Westlake 2014<br />
USA Baton Rouge, Louisiana Ausbau Schmierstoff-Kapazität Exxonmobil 2014<br />
USA Deer Park, Texas Neue Harze-Produktionsanlage Lubrizol 2014<br />
USA Donaldsonville/Port Neal Zwei Düngemittelkomplexe CF Industries 2015/2016<br />
USA St. James Parish, Louisiana Bau Ammoniak-Anlage zur Düngerproduktion<br />
36 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Ähnliches war in jüngster Zeit in Australien zu besichtigen:<br />
Zahlreiche Minen- und Gas-Förderprojekte<br />
führten dazu, dass die Bau- und Montagekosten enorm<br />
nach oben geschnellt sind. „Bis vor fünf Jahren kostete<br />
eine LNG-Exportanlage rund 1.000 US-Dollar pro Jahrestonne.<br />
Inzwischen sind es in Australien 2.000 bis<br />
3.000 Dollar“, berichtet Schier: „Wer spät dran ist, dessen<br />
Kosten werden steigen.“<br />
Auch scheint wahrscheinlich, dass der sich in den<br />
USA abzeichnende Anlagenbau-Boom zumindest zum<br />
Teil auf Kosten anderer Projekte und Regionen gehen<br />
könnte: So stehen zumindest an Techniken wie der Kohlevergasung<br />
oder der Nutzung von Ölsanden wirtschaftliche<br />
Fragezeichen. Außerdem wird die Erschließung<br />
von Schiefergasvorkommen in verschiedenen Weltregio-<br />
nen den Gaspreis unter Druck setzen. Ob sich die Entwicklung<br />
und der Bau von schwimmenden LNG-Produktionseinrichtungen<br />
rechnen werden, muss eventuell<br />
im Einzelfall neu kalkuliert werden. Derzeit lässt beispielsweise<br />
Shell von einem Konsortium aus Technip<br />
und Samsung eine entsprechende Anlage bauen, und<br />
auch die malaysische Petronas hat ein entsprechendes<br />
Gasschiff auf Kiel legen lassen.<br />
Werden deutsche Anlagenbauer<br />
am US-Boom partizipieren?<br />
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Frage,<br />
ob deutsche Engineeringunternehmen vom Anlagenbau-Boom<br />
in den USA profitieren werden. Denn während<br />
südkoreanische und chinesische Wettbewerber<br />
Mosaic FEED bis Mitte<br />
2013<br />
USA Lake Charles Erweiterung Ethylen-Anlage Westlake<br />
USA Chester Erweiterung Produktion gefällte Kieselsäuren<br />
Evonik 2014<br />
USA Louisiana GTL-Komplex und Ethan-Cracker Sasol 2018<br />
USA Erweiterung PET-Kapazitäten Indorama Ventures 4. Quartal 2015
hiesigen Anbietern in den Megaprojekten im Mittleren<br />
Osten und in Asien stark zusetzen, sehen sich diese Angreifer<br />
in den USA dem Wettbewerb mit Unternehmen<br />
wie Fluor, Bechtel und Foster Wheeler ausgesetzt. Aus<br />
Sicht von Anbietern wie Linde oder Thyssen Krupp Uhde<br />
stehen die Chancen für europäische Anlagenbauer<br />
deshalb nicht schlecht, um am amerikanischen Boom zu<br />
partizipieren. ●<br />
Zahlreiche Links zu weiterführenden Informationen<br />
finden Sie unter www.chemietechnik.de/1301ct616<br />
oder einfach QR-Code scannen!<br />
„Durch die geplanten LNG-<br />
Exporte fürchten Chemieunternehmen<br />
um den<br />
günstigen Rohstoff, der<br />
ihren Projektplanungen<br />
zugrunde liegt“<br />
Investitionsvolumen Kapazität Kontraktor CT-Meldung vom<br />
Jacobs 01.11.2011<br />
20 Mio. Euro<br />
07.12.2011<br />
15.12.2011<br />
5 kt/a Elektrolyte 16.12.2011<br />
470 t/d Sauerstoff und<br />
Stickstoff<br />
19.12.2011<br />
14.02.2012<br />
50 kt/a 08.05.2012<br />
320 Mio. USD 100 kt/a Lysin 18.05.2012<br />
3,5 kbpd Uhde Corp. (FEED, Lizenz)<br />
30.05.2012<br />
Multi-Mrd.-USD-Projekt 1,5 Mio.t/a Ethylen,<br />
650 kt/a Polyethylen<br />
05.06.2012<br />
07.06.2012<br />
1,3 kt/d Mais KBR 10.07.2012<br />
550 Mio. USD Jacobs 26.07.2012<br />
Jacobs 31.07.2012<br />
99 Mio. USD 20 Mio. Gallonen Ethanol<br />
p.a.<br />
23.08.2012<br />
Fluor 18.09.2012<br />
1,4 Mrd. USD 4,3 kt/d OCI (EPC); Uhde (EP) 12.10.2012<br />
400 t pro Tag 17.10.2012<br />
240 Mio. USD 1.300 Pfund PVC pro Tag 22.10.2012<br />
200 Mio. USD 90 Mio. Gallonen p.a. 24.10.2012<br />
125 Mio. USD 26.10.2012<br />
3,8 Mrd. USD Donaldsonville: 12,8 kt<br />
N-Produkte; Port Neal:<br />
2.2 kt NH , 3.5 kt Urea<br />
3<br />
Uhde Corp. 06.11.2012<br />
2.200 t/d Technip (FEED, EPC Vorbereitung)<br />
17.01.2012<br />
+120 kt/a 15.01.2012<br />
+20 kt/a 03.01.2012<br />
16 bis 21 Mrd. USD 4 Mt/a Kraftstoffe 06.12.2012<br />
+540 kt/a 28.11.2012<br />
Baubeginn in Lake Charles<br />
Bild: © Andrei Merkulov - Fotolia.com<br />
Auch der US-Chemiekonzern West Lake Chemical<br />
nutzt billiges Gas als Rohstoff<br />
West Lake Chemical in Houston, USA, hat mit dem<br />
Ausbau der Petro-2-Ethylen-Anlage im Petrochemiekomplex<br />
in Lake Charles begonnen. Diese Anlagenerweiterung<br />
wird in Verbindung mit einer<br />
geplanten Anlagenwartung abgeschlossen und<br />
wird die ethanbasierte Ethylen-Kapazität um etwa<br />
115 bis 120 kt erhöhen. Die bestehende Anlage<br />
soll dazu ungefähr 60 Tage außer Betrieb genommen<br />
werden. Westlake Chemical ist ein Hersteller<br />
und Lieferant von Petrochemikalien, Polymeren<br />
und Bauprodukten. Die Produkte des Unternehmens<br />
umfassen: Ethylen, Polyethylen, Styrol, Propylen,<br />
Ätzmittel, VCM, PVC und PVC-Rohre, Fenster<br />
und Zäune. Das Chemieunternehmen plant derzeit<br />
auch den Ausbau seiner PVC-Produktion in Calvert<br />
City, Kentucky, und will dazu 240 Mio. US-Dollar<br />
investieren. www.westlake.com<br />
Feed-Auftrag für Ammoniak-<br />
Anlage in USA<br />
Technip Der amerikanische Düngemittelhersteller<br />
Mosaic hat dem französischen Anlagenbauer Technip,<br />
Paris, einen „Front End Engineering and<br />
Design“-Auftrag erteilt sowie mit der Vorbereitung<br />
der entsprechenden „Engineering, Procurement<br />
and Construction“- Vorschläge (EPC) für eine neue<br />
Ammoniak-Anlage beauftragt.<br />
Die Anlage soll neben der bestehenden Faustina-<br />
Düngemittelproduktion in St. James Parish, Louisiana,<br />
entstehen. Die Kapazität soll bei 2.200 t/d<br />
liegen. Die vorgeschlagene Auslegung der Anlage<br />
würde auf der Ammoniak-Verfahrenstechnik von<br />
Haldor Topsøe beruhen, die Technip weiter entwickelt<br />
hat und mit der der Anlagenbauer seit mehr<br />
als 40 Jahren entsprechende Anlagen gebaut hat.<br />
Technip wird auch die vorläufigen Entwürfe für die<br />
Nebenanlagen, Medienversorgungen, Verschaltungen<br />
und andere unterstützende Einheiten für die<br />
Anlage erstellen. www.technip.com<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
37
Special<br />
Der Autor:<br />
Armin Scheuermann<br />
ist Chefredakteur der<br />
CHEMIE TECHNIK<br />
38 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
CT-Trendbericht: Schiefergas und LNG beflügeln Nationen und Industrie<br />
Globaler Goldrausch<br />
PrOfi-GuidE<br />
Funktion Branche<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ●<br />
Ausrüster ●<br />
Planer ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer ●<br />
Manager ● ● ●<br />
EntsChEidEr-faCts<br />
Für Manager<br />
Selbst die Schlapphüte des Bundesnachrichtendienstes interessieren<br />
sich für Schiefergas. Eine von der Nachrichtenagentur<br />
Reuters verbreitete BND-Studie kommt zum Ergebnis,<br />
dass die USA aufgrund eigener Öl- und Gasvorkommen<br />
ihr Interesse an der Region um den Persischen<br />
Golf verlieren wird. Verlierer, so der BND, könnte China<br />
sein, denn die Volksrepublik ist immer stärker auf Öl und<br />
Gas aus dem Mittleren Osten angewiesen, gleichzeitig<br />
fehlen China bislang die militärischen Mittel, um ihre Öl-<br />
Transportwege zu schützen.<br />
Unkonventionelle Gasvorkommen sind inzwischen<br />
ein geopolitischer Faktor. Am Rande des Weltwirtschaftsforums<br />
in Davos vereinbarten im Januar die Ukraine<br />
und der Energiekonzern Shell die gemeinsame<br />
Erschließung des Yuzivska-Erdgasfelds. Sollte sich das<br />
Potenzial der Fundstätte bestätigen, könnte die Produk-<br />
● Unkonventionelle Vorkommen an Schiefergas und -öl sind inzwischen ein geopolitischer<br />
Faktor geworden.<br />
● Deutschland wird allerdings auf Jahre hinaus von Erdgas-Importen abhängig bleiben.<br />
Mindestens bis 2014 wird der Gaspreis in Deutschland weiter deutlich steigen.<br />
● Mittel- bis langfristig könnte der Gaspreis aufgrund der Schiefergasförderung und<br />
zunehmenden Flüssiggastransporten fallen.<br />
tion bereits in fünf Jahren aufgenommen werden und<br />
jährlich 7 bis 20 Mrd. Kubikmeter Erdgas liefern. Für die<br />
Ukraine ist der Schritt von enormer Bedeutung, da das<br />
Land seine Abhängigkeit von Russland zu verringern<br />
sucht.<br />
Auch in Polen hegt man aus den gleichen Gründen<br />
große Erwartungen an die im Boden verborgenen Schiefergas-Vorkommen,<br />
musste aber bereits einige Fehlschläge<br />
bei Probebohrungen hinnehmen. Dennoch gehen<br />
Geologen davon aus, dass das Land neben Frankreich<br />
die größten Vorkommen in Europa besitzt.<br />
Optimistische Pläne in China, Zögern in Europa<br />
China hat im aktuellen Fünfjahresplan (2011 bis 2015) das<br />
Ziel ausgegeben, dass bis 2015 jährlich 6,5 Mio. Kubikmeter<br />
Schiefergas gefördert werden sollen. Doch in China
sind die Vorkommen – anders als in den USA – wesentlich<br />
schwieriger zu erreichen. Sie liegen größtenteils in deutlich<br />
tieferen Gesteinsschichten und zudem noch in Regionen,<br />
in denen kaum genug Wasser für den Fracking-Prozess<br />
vorhanden ist. Vor diesem Hintergrund gehen Beobachter<br />
davon aus, dass der chinesische Fünfjahresplan in Bezug<br />
auf Schiefergas zu optimistisch ist.<br />
Weitere wesentliche Vorkommen gibt es in Südamerika,<br />
vor allem in Argentinien. Dort will beispielsweise<br />
der US-Energiemulti Chevron in den kommenden Jahren<br />
über einhundert Bohrlöcher einrichten.<br />
Auch in Europa – vor allem in Frankreich, Polen, Norwegen<br />
und der Ukraine – gibt es nennenswerte Vorkommen.<br />
Aufgrund potenzieller Risiken für das Grundwasser<br />
und die Umwelt ist Fracking in Frankreich bislang verboten.<br />
Doch die Stimmen nach einer Aufhebung des Verbots<br />
werden immer lauter. Zuletzt forderte Gérard Mestrallet,<br />
Chef des mächtigen Energieriesen GDF Suez, im<br />
Januar die Regierung auf, ihre Haltung zu überdenken.<br />
Europa: erst ab 2015 sinkende Gaspreise in Sicht<br />
Nicht zuletzt Deutschland wird dagegen auf Jahre hinaus<br />
von Erdgas-Importen abhängig bleiben. Das Beratungsunternehmen<br />
A.T. Kearney schätzt, dass die Gaspreise in<br />
Deutschland bis 2014 um 30 bis 40 Prozent steigen werden.<br />
Ab 2015, so die Studie, werden globale Überkapazitäten<br />
zu einem Einbruch beim Gaspreis führen. Bereits<br />
heute ist der Einfluss von LNG-Spotmengen zu spüren:<br />
Stromerzeuger wie E.on und RWE verhandeln ihre langfristigen<br />
Lieferverträge neu, um die immer weiter aufgehende<br />
Schere zwischen börsenbasierten Gaspreisen und<br />
langfristigen Imporverträgen abzufedern.<br />
Konsequenzen dürften Schiefergas-Funde und steigende<br />
LNG-Mengen mittelfristig auch in Deutschland<br />
und anderen europäischen Ländern haben. Denn derzeit<br />
wird die Gasimport-Infrastruktur für Pipelinegas und<br />
LNG massiv ausgebaut. Bis 2020 erwartet A.T. Kearney<br />
eine Zunahme der Pipelinekapazitäten um mehr als 65<br />
Prozent und gleichzeitig doppelt so viele LNG-Importterminals.<br />
Ab 2018 will beispielsweise Aserbaidschan<br />
jährlich 16 Mio. Kubikmeter Gas über die Pipeline Nabucco<br />
(OMV, RWE) oder alternativ über Seep (BP) nach<br />
Europa leiten. Auch dies könnte die These von mittelfristig<br />
sinkenden Gaspreisen stützen. Doch dass der<br />
Preisunterschied zwischen den USA und Europa kompensiert<br />
werden wird, bleibt bei einem derzeit dreimal<br />
so hohen Gaspreis unrealistisch. ●<br />
Zahlreiche Links zu weiterführenden Informationen<br />
finden Sie unter www.chemietechnik.de/1301ct615<br />
oder einfach QR-Code scannen!<br />
Chemiebasis<br />
Erdgas versus Naphta<br />
In Sachen Rohstoffbasis ist die Chemiewelt<br />
derzeit zweigeteilt. Während die deutsche,<br />
europäische und asiatische Chemie ihre<br />
Grundstoffe aus Öl (Naphta) synthetisiert,<br />
kommt in den USA Erdgas zum Einsatz. Und<br />
während der Ölpreis stetig steigt, wird Erd-<br />
beurteilte Basins, deren Vorkommen geschätzt wurde<br />
beurteilte Basins, deren Vorkommen nicht geschätzt wurde<br />
Länder, die in der eia-Studie erfasst wurden<br />
Länder, die in der eia-Studie nicht erfasst wurden<br />
Die wesentlichen<br />
Schiefergasvorkommen<br />
sind über die<br />
ganze Welt verteilt<br />
gas in den USA aufgrund massiver Ausweitung<br />
der Schiefergas-Förderung stetig billiger.<br />
Von 16 US-Dollar pro mmBtu (Erläuterung<br />
auf Seite 33) in 2005 fiel der Preis auf<br />
2,5 USD in 2012. Das macht die USA für<br />
Investitionen der Chemie interessant.<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
39<br />
Bilder: ©Dreidesign - Fotolia.com und US Energy Information Administration
Special<br />
1<br />
Armaturen für Flüssiggas müssen extremen Anforderungen standhalten<br />
40 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Der Gas-Boom schlägt voll auf die Armaturentechnik<br />
durch: Schlauchverbindungen über mehrere 100 m und<br />
Wellenbewegungen von plus-minus fünf Meter bei der<br />
Verladung von -162 °C kaltem Flüssig-Erdgas (LNG) auf<br />
dem offenen Meer – für die dort eingesetzten Armaturen<br />
gelten extreme Anforderungen. Aber auch „normale“<br />
LNG-Armaturen müssen einiges aushalten. Zum<br />
Glück gibt es Konstrukteure, denen auch dafür immer<br />
noch etwas einfällt…<br />
Der Gasmarkt ist in Bewegung – und zwar durchaus<br />
im Wortsinn: Wurde der unsichtbare Energieträger bis<br />
vor wenigen Jahren ausschließlich regional und allen-<br />
1: Die Funktion der Kältearmaturen<br />
wird in einem Bad<br />
aus flüssigem Stickstoff<br />
getestet<br />
Die Armatur, die aus der Kälte kam<br />
Profi-GuiDe<br />
Funktion Branche<br />
Der Autor:<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma<br />
Ausrüster<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer<br />
Manager<br />
Armin Scheuermann<br />
ist Chefredakteur der<br />
CHEMIE TECHNIK<br />
entscheiDer-fActs<br />
Für Planer und Betreiber<br />
● Der Markt für Flüssiggas wächst derzeit stark. Neue LNG-Terminals, Verflüssigungsanlagen und schätzungsweise<br />
25 neue LNG-Tanker pro Jahr sorgen für einen wachsenden Bedarf nach Armaturen für das tiefkalte Gas.<br />
● Für die Verflüssigung des Erdgases wird dieses auf -161 °C abgekühlt. Die in diesen Anlagen eingesetzten<br />
Armaturen werden aus kaltfesten Werkstoffen und mit speziellen Geometrien gefertigt.<br />
● Um auch die steigenden Drücke zu beherrschen, wurden die Armaturen Triodis entwickelt. Die dreifach exzentrische<br />
Klappenkonstruktion sorgt für eine hohe Dichtigkeit bei hohen Drücken.<br />
falls per Pipeline über größere Distanzen bewegt, wird<br />
Erdgas durch den Bau von LNG-Terminals, -Tankschiffen<br />
und Verflüssigungsanlagen zunehmend mobil.<br />
Gleich drei riesige schwimmende Gas-Raffinerien, sogenannte<br />
FPSO-Tanker, werden derzeit auf Kiel gelegt.<br />
FPSO steht dabei für Floating Production Storage and<br />
Offloading. Mit dem vier Fußballfelder langen, geschätzte<br />
8 Mrd. Euro teuren und 600.000 t schweren<br />
„Gas-Schiff “, das der Ölkonzern Shell vom Anlagenbaukonsortium<br />
Technip/Samsung bauen lässt (wir berichteten<br />
in CT 7/2011), will der Konzern jährlich 3,6 Mio.<br />
Tonnen Erdgas vor der nordaustralischen Küste verar-
eiten. Etwas kleiner (2,9 Mrd. Euro, 2,7 MTPA) ist das<br />
von Petrobras geplante FLNG-Projekt (Konsortium<br />
Technip, Modec und JGC), und der malaysische Ölkonzern<br />
Petronas (Konsortium Technip-Daewoo ) plant eine<br />
FLNG-Anlage mit einer LNG-Kapazität von<br />
1,2 MTPA. Neu ist dabei, dass das Gas nicht mehr wie<br />
bislang offshore gefördert und onshore verflüssigt wird,<br />
sondern die komplette Prozesskette inklusive Verflüssigung<br />
auf hoher See geschieht. „FLNG-Anlagen eröffnen<br />
neue Chancen für Erdöl- und Erdgasproduzenten. Damit<br />
können einerseits bislang unzugängliche Offshore-<br />
Ressourcen erschlossen werden, andererseits ist es möglich,<br />
bei der Ölproduktion anfallende Gase zu Geld zu<br />
machen statt abzufackeln“, erklärt Cyril Morand, Substructure<br />
& System Manager beim Anlagenbauer Technip.<br />
FLNG-Anlagen produzieren unter<br />
extremen Bedingungen<br />
Doch ob Timor-See, Atlantik oder Chinesisches Meer –<br />
die Umgebungsbedingungen für diese Gasschiffe können<br />
denkbar unwirtlich sein. Die von Shell projektierte<br />
Anlage muss beispielsweise schwersten Wirbelstürmen<br />
der Kategorie 5 standhalten. Bei der Verladung des Flüssiggases<br />
auf Hochsee-LNG-Tanker müssen Wellenbewegungen<br />
von ± 5,5 m kalkuliert werden. Zuvor wird das<br />
Erdgas in der schwimmenden Raffinerie auf -162 °C<br />
gekühlt, wobei sein Volumen um das 600-fache sinkt.<br />
Das stellt hohe Anforderungen an die eingesetzten<br />
Komponenten wie zum Beispiel Armaturen. Zur mechanischen<br />
Belastung kommt die Korrosivität der Meeresumgebung.<br />
Außerdem werden die meisten Metalle bei<br />
den tiefen Temperaturen des LNG spröde und verlieren<br />
ihre Festigkeit. Mechanische Teile und Abdichtung müssen<br />
deshalb aus besonders kaltfesten Werkstoffen gefertigt<br />
werden. „Nur wenige Metalle erfüllen die hohen Anforderungen,<br />
welche die Betriebssicherheit, die Lebensdauer<br />
und die Funktionssicherheit an sie stellen“, erläutert Loic<br />
Boussault, Produktmanager beim Armaturenhersteller<br />
KSB , der in Gradignan bei Bordeaux unter der Marke<br />
Amri Armaturen für Tieftemperaturen entwickelt und im<br />
THERMISCHES MANAGEMENT: Das Modell zeigt die<br />
Temperaturverteilung in einem Lithium-Ionen-Akku.<br />
Grafiken: KSB<br />
Kälte erfordert Exzentriker (1)<br />
2<br />
3<br />
sphärisch<br />
geformte<br />
Scheibe<br />
max. Öffnungs-/<br />
Schließweg mit<br />
Reibung<br />
Rohrleitungsachse<br />
Kälte erfordert Exzentriker (2)<br />
Rohrleitungsachse<br />
1. Versatz<br />
Funktion: Begrenzung der Reibung<br />
zwischen Scheibe und Sitz<br />
sphärisch<br />
geformte<br />
Scheibe<br />
© 2013 COMSOL<br />
Öffnungsweg<br />
der Scheibe<br />
nahegelegenen La Roche-Chalais produziert. Da die Armaturen<br />
auch bei -200 °C noch sicher funktionieren<br />
müssen, wird jede Armatur einer Prüfung mit flüssigem<br />
Stickstoff (-196 °C) unterzogen. Und auch dem Explosions-<br />
und Brandrisiko von LNG müssen die Armaturen<br />
Rechnung tragen: Leckagen sind ein „no go“.<br />
Neben den Belastungen durch die niedrigen Temperaturen<br />
müssen alle am Prozess beteiligten Komponenten<br />
auch noch enorme Wärmeausdehnungen meistern,<br />
die bei den Übergangsphasen während der Abkühlung<br />
sowie der Wiedererwärmung auf die Umgebungstemperatur<br />
auftreten. Ein weiterer Belastungsfaktor für die<br />
Armaturen ist der Betriebsdruck und der damit verbundene<br />
Differenzdruck. Die in solchen Anlagen verwende-<br />
Sitzachse<br />
1. Versatz<br />
Funktion: Trennung des Sitzes<br />
und Dichtung der Welle<br />
Sitzachse<br />
1. Versatz<br />
2: Klappen mit einfach<br />
exzentrischer Scheibe.<br />
Da der Sitz während<br />
des Öffnungs- und<br />
Schließwegs mit vollem<br />
Kontaktdruck gegen<br />
die Scheibe reibt,<br />
ist die Standzeit gering<br />
3: Bei der doppelt exzentrischen<br />
Klappe löst<br />
sich der Sitz rasch vom<br />
Kontakt mit der Scheibe,<br />
der Reibdruck ist<br />
geringer: lange Standzeiten<br />
und dichter Abschluss<br />
Analysieren und Optimieren mit<br />
COMSOL Multiphysics ®<br />
Analysieren und Optimieren mit<br />
COMSOL Multiphysics<br />
COMSOL Multiphysics unterstützt Sie bei der<br />
Verwirklichung innovativer Ideen. Die Kombination aller<br />
relevanten physikalischen Eekte Eekte in einer Simulation<br />
ermöglicht eine präzise Analyse Ihres Designs. Erfahren Sie<br />
mehr unter www.comsol.de.<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
41
SPECIAL<br />
4 5<br />
4: Dreifach exzentrischesDrei-Kegel-Konzept<br />
der Klappen Triodis<br />
300 und 600 sorgt<br />
für höhere Dichtheit bei<br />
hohen Drücken<br />
5: Das Verladesystem<br />
Connectis vereinfacht<br />
die Verladung von LNG<br />
auf hoher See<br />
42 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
ten Druckklassen sind Ansi Class 150, 300 und 600, was<br />
Drücken von 20, 50 und 100 bar entspricht. „Der Trend<br />
bei Armaturen für diese Anwendungen geht sogar in<br />
Richtung Ansi Class 900, was 150 bar entspricht. Die<br />
Entwicklungen hierfür sind bereits voll im Gange“, weiß<br />
Sébastien Lageois der bei KSB im Bereich Oil, Gas &<br />
Marine arbeitet. Je nach Einsatzstelle werden die Armaturen<br />
in die Rohrleitung eingeflanscht oder eingeschweißt.<br />
Bei FPSO-Anlagen kommen alle Druckklassen<br />
und die unterschiedlichsten Durchmesser vor.<br />
Weiterentwicklung doppelt und dreifach<br />
exzentrischer Klappen<br />
„Die Bauweise von Tieftemperatur-Armaturen ist geprägt<br />
durch drei Faktoren: niedrige Temperaturen<br />
(Werkstoffe), Betriebsdruck (Gehäusekonstruktion) und<br />
Differenzdruck (Abdichtung im Durchgang)“, erläutert<br />
Loic Boussault. Klassische Elastomer- oder Packungsdichtungen<br />
kommen bei diesen Temperaturen nicht in<br />
Frage, lediglich metallische Dichtungen können eingesetzt<br />
werden. Boussault: „Das bedingt drei konstruktive<br />
Besonderheiten, die solche Absperrklappen<br />
deutlich von weichdichtenden, zentrisch gelagerten Absperrklappen<br />
unterscheidet“.<br />
● Im Wellendurchgang ist die Antriebswelle exzentrisch<br />
angeordnet (Bild 2), das heißt sie liegt nicht in der<br />
Sébastien Lageois arbeitet bei KSB im Bereich<br />
Oil, Gas & Marine<br />
„Der Trend bei Armaturen für LNG-<br />
Anwendungen geht in Richtung<br />
Ansi Class 900, was 150 bar entspricht.<br />
Die Entwicklungen hierfür<br />
sind bereits voll im Gange“<br />
Ebene der Sitz-Achse, sondern ist davon versetzt. Die<br />
Welle ist zum Gehäuse mit einem Grafit-Dichtring und<br />
O-Ringen ausgestattet. Diese Lösung sorgt im Brandfall<br />
für eine zeitlich begrenze Abdichtung. Der Betreiber hat<br />
somit eine dichte und wartungsfreie Armatur.<br />
● Eine weitere Exzentrizität bezieht sich auf die Welle,<br />
die zur Rohrleitungsachse seitlich versetzt ist (Bild 3).<br />
Das verkleinert den Winkel, in dem die Klappenscheibe<br />
während der Betätigung mit dem Sitz in Kontakt kommt;<br />
dieser Winkel beträgt nur 35° gegenüber 70° bei einer<br />
einfachen exzentrischen Bauweise. Kontaktdruck und<br />
Verschleiß sind geringer und die Standzeit ist höher.<br />
● Um aber Dichtheit bei noch höheren Drücken zu<br />
erreichen, ist eine dritte Exzentrizität erforderlich<br />
(Bild 4). Diese bezieht sich auf die Geometrie der Klappenscheibe<br />
und reduziert den Winkel, bei dem das<br />
Dichtelement Kontakt mit der Dichtfläche hat auf nur<br />
5°. Das kommt trotz höherer Drücke einer längeren<br />
Einsatzdauer zugute. Diese sogenannte „konische Exzentrizität“<br />
wird weltweit von den wichtigsten Armaturenbauern<br />
genutzt.<br />
Temperaturen bis -250 °C und Drücke bis 150 bar<br />
Diese Technik der dreifachen Exzentrizität kommt bei<br />
den Klappen der Baureihen Triodis 300 und 600 zum<br />
Einsatz, die auf der Achema im vergangenen Jahr vorge-<br />
Loic Boussault ist Produktmanager beim<br />
Armaturenhersteller KSB<br />
„Nur wenige Metalle erfüllen die<br />
hohen Anforderungen, welche die<br />
Betriebssicherheit, die Lebensdauer<br />
und die Funktionssicherheit an<br />
sie stellen“<br />
Bilder: KSB
Bild: Technip<br />
6 7<br />
stellt wurden. Demnächst soll eine noch größere Klappe<br />
unter der Bezeichnung Triodis 900 folgen. Diese Armaturen<br />
werden in La Roche-Chalais gebaut und einzeln in<br />
einem Bad aus flüssigem Stickstoff auf ihre Dichtheit<br />
getestet. Sie sind für Betriebsdrücke bis 100 bar und für<br />
Temperaturen zwischen - 250 und 200 °C ausgelegt.<br />
Dank ihrer besonderen Konstruktion weisen die<br />
Klappen ein geringeres erforderliches Schließmoment<br />
als doppelt exzentrische Bauweisen auf und können so<br />
von kleineren Antrieben betätigt werden. Mit ihrer dreifach<br />
exzentrischen Lagerung und ihren speziell geformten<br />
konischen Dichtflächen sind die Armaturen auch bei<br />
sehr hohen Differenzdrücken dicht.<br />
Die Tieftemperatur-Klappe gibt es mit Durchmessern<br />
von 200 bis 1.200 mm. Die Edelstahlgehäuse sind mit<br />
Flanschen oder mit Anschweißenden lieferbar. Als bauliche<br />
Besonderheit gibt es noch eine sogenannte „Buttweld-side-entry“-Version.<br />
Diese verfügt über Schweißenden,<br />
mit denen die Armatur in die Rohrleitung eingeschweißt<br />
wird. Zu Wartungszwecken kann man die Innenteile<br />
aus dem Gehäuse herausziehen, ohne die ganze<br />
Absperrklappe ausbauen zu müssen. Ein Vorteil, der vor<br />
allem bei beengten Platzverhältnissen von großer Bedeutung<br />
ist.<br />
Gemeinschaftsentwicklung für Offshore-Verladung<br />
„Die Verladung des LNG auf dem offenen Meer zwischen<br />
den Tankern und den zukünftigen FPSO, FSRU<br />
und Offshore-Terminals eröffnet uns einen neuen<br />
Markt“, meint Pascal Vinzio, der Leiter der Abteilung<br />
Forschung und Vorentwicklung von Armaturen. Die<br />
durch den Seegang hervorgerufene Bewegung des Tankers<br />
erfordert eine elastische Verbindung und ein sehr<br />
sicheres Anschlusssystem. Dazu wurde das Verladesystem<br />
Connectis als Gemeinschaftsprojekt zwischen Technip,<br />
Eurodim und KSB entwickelt. Technip beschäftigt<br />
sich bereits seit mehr als 50 Jahren mit der LNG-Technik<br />
und hatte bereits 1964 das erste Verladeterminal für<br />
LNG in Algerien gebaut. Mit dem Verladesystem Connectis<br />
packte die Entwicklungsgemeinschaft gleich meh-<br />
rere Probleme bei der Verladung von LNG an: Einerseits<br />
ist das System deutlich leichter als bisherige Verladearmaturen,<br />
und Andockvorgänge werden deutlich schneller.<br />
Andererseits treten bei einer Nottrennung weniger<br />
als 2 l Flüssiggas aus – ein wichtiger Sicherheitsaspekt.<br />
Die Dichtheit im Abschluss wird durch eine doppelte<br />
Klappenscheibe erreicht. Das Verladesystem umfasst eine<br />
Vorrichtung zur genauen Ausrichtung des anzuschließenden<br />
Schlauches per Verladearm mit Fernverriegelung.<br />
Die Entwicklung des Systems begann im Jahr<br />
2000 und wurde 2008 nach Erprobung im Terminal von<br />
Montoir mit einer Zulassung durch die Det Norske Veritas<br />
abgeschlossen.<br />
Das System könnte auch in anderen Bereichen zum<br />
Einsatz kommen. So zum Beispiel beim Verladen von<br />
flüssigen Gütern von Schiff zu Schiff auf See. Schwere<br />
mechanische Arme wären dann nicht mehr erforderlich.<br />
Auch der Einsatz in Offshore-Hafenanlagen ist denkbar.<br />
Um das Verladen großer Mengen zu ermöglichen,<br />
wurde in Zusammenarbeit mit Petrobras, einem Unternehmen<br />
mit langjähriger Erfahrung im Bereich Schläuche,<br />
eine schwimmende Tandem-Ausführung des Connectis<br />
entwickelt.<br />
Fazit: Flüssigerdgas wird in den kommenden Jahren<br />
weiter an Bedeutung gewinnen. Die Anlagen dafür erfordern<br />
spezielle und vor allem sehr zuverlässige Armaturen,<br />
die für die Eigenschaften des tiefkalten Gases ausgelegt<br />
sind. Dazu kommt, dass die Anforderungen an die<br />
Druckfestigkeit steigen und die Armaturen künftig verstärkt<br />
auch schwankenden Drücken standhalten müssen.<br />
Konstruktionen wie die dreifach exzentrische Triodis<br />
tragen dem Rechnung. ●<br />
Bild: KSB<br />
Weitere Beiträge könnten für Sie interessant sein?<br />
Für den schnellen Zugriff surfen Sie auf www.<br />
chemietechnik.de/1301ct617 oder scannen Sie den<br />
QR-Code mit Ihrem Smartphone ein!<br />
6: Auf „Floating Production<br />
Storage and<br />
Offloading“-Schiffen<br />
(FPSO) wird Erdgas<br />
gefördert, verflüssigt<br />
und bis zum Verladen<br />
gespeichert<br />
7: Bei der LNG-Produktion<br />
wird Erdgas auf<br />
-162 °C gekühlt, wobei<br />
sein Volumen um das<br />
600-fache sinkt. Deshalb<br />
werden die dort<br />
eingesetzten Armaturen<br />
in flüssigem Stickstoff<br />
geprüft<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
43
Produkte<br />
Sicherheitstemperaturbegrenzer<br />
Eigensicher für Sicherheit sorgen<br />
• frei konfigurierbar<br />
• Eingänge eigensicher<br />
• entspricht Atex-Richtlinie 94/9/EG<br />
Die Sicherheitstemperaturbegrenzer/-wächter Jumo<br />
safety M STB/STW Ex dienen dazu, wärmetechnische<br />
Prozesse sicher zu überwachen und<br />
die Anlagen bei Störung in den betriebssicheren<br />
Zustand zu versetzen. Die Geräte mit Atex-Zulassung<br />
sind kompakt und frei konfigurierbar. Es giebt<br />
sie als Einsensor- sowie Zweisensor-Variante. Zu<br />
den Zulassungen gehören: DIN EN 14597, PL d<br />
(Performance Level ), GL und Atex. Außerdem erreichen<br />
sie SIL 3. Die Eingänge sind eigensicher<br />
[Ex ia] ausgeführt, sodass sich entsprechende<br />
Fühler direkt anschließen lassen. Ebenso ist das<br />
Gerät laut Hersteller gemäß DIN EN 50495 SIL2<br />
und DIN EN 13463-6 IPL 2 als Zündquellenüberwachung<br />
in explosionsfähiger Atmosphäre (Gas<br />
und Staub) im Sinne der Atex-Richtlinie zertifiziert.<br />
Zudem erfüllt es die Anforderungen der DIN EN<br />
61508 bzw. DIN EN ISO 13849 durch ein Geräte-<br />
Dampfreinigung<br />
Reinigt ohne Chemie<br />
• schnelle Schmutzentfernung<br />
• für beliebige Materialien<br />
• für große Werkstücke<br />
Eco C Steam von Dürr Ecoclean ist<br />
ein Dampf-Reinigungsverfahren, das<br />
Verunreinigungen wie Öle, Fette,<br />
Staub und Fingerabdrücke von beliebigen<br />
Materialien schnell und ohne<br />
Chemiakalien entfernt. Die Reinigungswirkung<br />
basiert auf dem Zusammenspiel<br />
von gesättigtem<br />
Dampf und einem Hochgeschwindigkeitsluftstrom.<br />
Das Verfahren eignet<br />
sich auch für große Teile.<br />
chemietechnik.de/1302ct061<br />
44 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
konzept, das aufgrund seiner 1oo2-<br />
Struktur zu einem sicheren Erkennen<br />
von Fehlern führt. Somit lassen sie<br />
sich bei Anwendungen, denen die Maschinenrichtlinie<br />
2006/42/EG zugrunde<br />
liegt, einsetzen. Das klar strukturierte<br />
Display mit Klartextanzeige und<br />
Hintergrundbeleuchtung sorgt in Verbindung<br />
mit der Tastatur für eine<br />
schnelle und unkomplizierte Konfiguration<br />
direkt am Gerät. Für die Konfiguration über<br />
einen PC oder Laptop ist frontseitig ein Mini-USB-<br />
Stecker vorhanden. Leuchtdioden zeigen an, ob die<br />
Anlage einwandfrei funktioniert oder ob ein Voralarm<br />
bzw. ein Grenzwertalarm ausgelöst wurde.<br />
Der Messeingang verfügt über zahlreiche Linearisierungsfunktionen<br />
und ist frei konfigurierbar für<br />
Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie<br />
Damen-Sicherheitsschuhe<br />
Elegant mit Absätzen<br />
• kein Schuhwechsel nötig<br />
• Mode und Arbeitsschutz<br />
• nach ISO EN 20345 S2<br />
Bisher mussten Damen, die im Business-Outfit<br />
die Fertigung durchquerten,<br />
die Schuhe wechseln, um den<br />
geltenden Sicherheitsanforderungen<br />
gerecht zu werden. Mit den Absatzschuhen<br />
von damen-sicherheitsschuhe.de<br />
werden Damenmode und<br />
Arbeitsschutz vereint. Die Modelle<br />
sind nach ISO EN 20345 S2 zertifiziert<br />
und können damit im Fertigungsumfeld<br />
eingesetzt werden.<br />
chemietechnik.de/1302ct084<br />
Taupunkt-Messung<br />
Erdgasqualität im Blick<br />
• Kombigerät Erdgas/KW-Taupunkt<br />
• driftfreie Funktion<br />
• keine Rekalibrierung nötig<br />
Mit dem Gasfeuchte- und Kohlenwasserstoff-Taupunktmessgerät<br />
Hygrophil HCDT hat Bartec Benke<br />
ein Kombigerät zur Qualitätsüberwachung<br />
für Erdgas entwickelt.<br />
Ds gerät kann kontinuierlich die<br />
Qualität des Gases überwachen<br />
und damit auch zum Schutz der<br />
Anlagen beitragen. Das Messsystem<br />
besteht aus dem Anzeigegerät<br />
Hygrophil F 5673, dem<br />
Feuchtesensor L1661 und dem<br />
HCDT-Sensor. Beide Sensoren<br />
sind in einem speziellen Probenahme-System<br />
verbaut und ermöglichen<br />
die genaue, driftfreie und schnelle<br />
Bestimmung des Kohlenwasserstoff-<br />
und des Wasser-Taupunktes. Die Genauigkeit<br />
des mit Platin-Temperatursensoren<br />
ausgestatteten Taupunktspiegel-Sensors<br />
liegt bei 0,5 °C. Da<br />
Strom-, Spannungs- und Differenzmessung. Über<br />
den serienmäßigen Analogausgang lassen sich<br />
Prozesswerte an ein Registriergerät oder einen<br />
Regler bzw. ein übergeordnetes Leitsystem weitergeben.<br />
chemietechnik.de/1302ct114<br />
die Pt-Sensoren driftfrei arbeiten, ist<br />
eine zyklische Rekalibrierung des<br />
Sensors nicht erforderlich. Im Gas<br />
mitgeführte Verschmutzungen haben<br />
laut Anbieter keinen Einfluss auf die<br />
Messung.<br />
chemietechnik.de/1302ct041
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Doppelseite: www.chemietechnik.de/1301ct904 oder<br />
QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
Vibrationsgrenzschalter<br />
Füllstand unter extremen Bedingungen schalten<br />
• Temperaturbereich -196 bis 450 °C<br />
• für Flüssiggase<br />
• erreicht SIL 2<br />
Vega hat mit dem Vibrationsgrenzschalter<br />
Vegaswing 66 einen Füllstandschalter<br />
für kryogene Flyssigkeiten<br />
entwickelt. Das Gerät schaltet<br />
auch bei -196 bis 450 °C und Drücken<br />
von Vakuum bis 160 °C. Dadurch<br />
ist es möglich, auch im TieftemperaturbereichVibrationsgrenzschalter<br />
zur Prozessüberwachung<br />
einzusetzen. Zu den Einsatzgebieten<br />
gehören Sicherheitseinrichtungen bei<br />
Gasverflüssigungsanlagen und Flüssiggastanks<br />
zur Verarbeitung, dem<br />
Transport oder der Lagerung von LNG<br />
(Liquefied Natural Gas), flüssigem<br />
Sauerstoff oder flüssigem Stickstoff.<br />
Der Sensor schaltet, unabhängig von<br />
der Füllgutdichte, sicher und reproduzierbar<br />
bei Erreichen einer bestimmten<br />
Füllhöhe. Zur Inbetriebnahme<br />
ist dafür kein Abgleich mit dem<br />
Füllgut erforderlich. Durch integrierte<br />
TOC-Messgerät<br />
Klarheit bei Verunreinigungen<br />
• katalysatorenfrei<br />
• ferngesteuerte Kalibrierung<br />
• FDA-konforme Software<br />
Das TOC-Messgerät Quick TOC<br />
Pharma von LAR Process Analysers<br />
bestimmt zuverlässig den echten gesamten<br />
organischen Kohlenstoffgehalt<br />
(TOC) in niedrigsten Messbereichen.<br />
Durch die FDA-konforme Software<br />
(CFR 21 Part 11) wird das<br />
Analysensystem vollständig kontrolliert.<br />
Datenspeicherung und elektronische<br />
Signatur werden entsprechend<br />
der Forderungen umgesetzt.<br />
Mit dem katalysatorfreien Hochtemperaturverfahren<br />
bei 1.200 °C werden<br />
alle Bestandteile der Probe vollständig<br />
oxidiert. Eine einfache und<br />
ferngesteuerte Kalibrierung und Validierung<br />
wird durch die jederzeit einsatzbereite<br />
Quickcalibration ermöglicht.<br />
Mit dieser Methode sind Kontaminationen<br />
und lange Ausfallzeiten,<br />
wie bei der Verwendung von Flüssigstandards,<br />
ausgeschlossen. Das<br />
Analyse- und Überwachungsfunktionen<br />
erreicht das Gerät SIL2. Weitere<br />
Merkmale sind Zulassungen für den<br />
Explosionsschutz in Gasen nach Atex<br />
und FM sowie für den Einsatz auf<br />
Schiffen und Offshore. Das Gerät gibt<br />
es als Kompaktsensor oder mit einer<br />
Rohrverlängerung, die bis zu sechs<br />
Meter lang sein kann.<br />
chemietechnik.de/1301ct511<br />
Messgerät bestimmt zuverlässig<br />
kleinste Verunreinigungen und ermöglicht<br />
eine sichere und einfache<br />
Steuerung der Produktionsabläufe in<br />
Unternehmen der Pharmazeutischen<br />
Industrie.<br />
chemietechnik.de/1302ct116<br />
Mu?llerGmbh_Chemie-Technik d 86x126_2011.qxd:MullerGmbh_<br />
Chemie-Technik d 1_6 86x126 09/2011<br />
Kontaminationsfreies<br />
Umfüllen von<br />
toxischen<br />
Medien<br />
Müller Containment Klappe MCV<br />
– Einsatz bis OEB 4 (OEL 1-10 µg/ m 3)<br />
– Baugrößen NW 100, 150, 200 und 250<br />
– Druckfeste Ausführung bis + 3bar<br />
– Vakuumfeste Ausführung bis - 1bar<br />
– Ex-Ausführung nach ATEX für Zone 0/20<br />
– Ebene Wischflächen<br />
– Edelstahl Rostfrei AISI 316L,<br />
wahlweise Hastelloy<br />
– GMP konforme Ausführung<br />
Müller <strong>GmbH</strong> - 79618 Rheinfelden (Deutschland)<br />
Industrieweg 5 - Tel.: +49(0)7623/969-0 - Fax: +49(0)7623/969-69<br />
Ein Unternehmen der Müller Gruppe<br />
info@mueller-gmbh.com - www.mueller-gmbh.com<br />
Wir liefern<br />
DOSIERANLAGEN<br />
nach Ihren Spezifikationen<br />
für Kraftwerke (Beispiel:<br />
Ammoniak-Dosierstation<br />
im 20-Fuß-Container),<br />
für die chemische Industrie<br />
(Beispiel: Amin-Dosierstation),<br />
für die Petrochemie<br />
(Beispiel:<br />
Korrosionsinhibitor-<br />
Dosierstation)<br />
und setzen dabei Standards!<br />
MPT<br />
MPT Meß- und<br />
Prozeßtechnik <strong>GmbH</strong><br />
Ferdinand-Porsche-Ring 8<br />
63110 Rodgau<br />
Tel. 06106-4853<br />
info@mpt-rodgau.de<br />
www.mpt-rodgau.de<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
T_Anzeige.indd 1 29.01.2013 11:48:<br />
45
Werkstoffe<br />
Der Autor:<br />
Alexander Bamberger,<br />
Geschäftsführer<br />
Fiberpipe<br />
46 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Korrosionsfeste Fiberglas-Rohre ersetzen Edelstahl<br />
Leichtgewichte<br />
leiten ins Abendland<br />
PRofi-GuiDE<br />
Funktion Branche<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ● ●<br />
Ausrüster ● ● ●<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber ● ●<br />
Einkäufer<br />
Manager<br />
● ●<br />
EntscHEi<strong>DER</strong>-fActs<br />
Für Anlagenbauer<br />
Die Rahmenbedingungen sind sportlich: In der Türkei<br />
soll ein neu zu bauendes Gas-Kombikraftwerk binnen<br />
17 Monaten eine kleinere Großstadt versorgen. Den<br />
Zuschlag für Engineering, Planung und Bauleitung der<br />
Kühl- und Prozessleitungen des Kraftwerkes erhält ein<br />
mittelständischer Rohrhersteller aus dem Rheinland. Er<br />
muss sich verschiedenen Rahmenbedingungen anpassen:<br />
Dazu zählen knappe Bauzeit, internationale Partner<br />
und der Spagat zwischen zwei Kulturkreisen.<br />
Herausforderungen mit Know-how begegnen<br />
Als im Januar 2008 die österreichische A-Tec Power<br />
Plant Systems den rheinländischen Rohrhersteller mit<br />
dem Rohrleitungsbau für das Gas-Kombikraftwerk mit<br />
Niederdruck-Dampfturbinen und 920 Megawatt Leistung<br />
beauftragt, ist die Zeit bereits eng: In drei Monaten<br />
ist Baubeginn. Edelstahl hat in dem Zeit- und Kostenplan<br />
von vornherein keine Chance, jedoch kann der<br />
Rohrleitungsspezialist die Haupt- und Nebenkühlwasserleitungen<br />
DN 25 bis 2.400 aus glasfaserverstärktem<br />
Kunststoff (GFK) liefern. Dieser Werkstoff ist im Großanlagenbau<br />
und in der Energiewirtschaft auf dem Vormarsch,<br />
denn er ist unempfindlich gegenüber Meerwasser,<br />
Hitze, Chemie- und Kräfteeinwirkung. Geringes<br />
Gewicht und vorteilhafte Verarbeitungseigenschaften<br />
ermöglichen schnelle Montageabläufe, die Preisvorteile<br />
mit sich bringen.<br />
Im Kraftwerksbau ist das Mittelstandsunternehmen<br />
zudem erfahren: Die Ingenieure aus Stolberg haben bereits<br />
Großanlagen wie das Steinkohlekraftwerk RWE<br />
Ibbenbüren, die Müllverbrennung Enertec Hameln und<br />
Anlagen des Kühlturmspezialisten Hamon Thermal<br />
Germany umgebaut, ausgestattet oder saniert. Durch<br />
ihre Produkte ermöglichen sie Planungssicherheit und<br />
liefern das gesamte Projekt nach deutschen Standards -<br />
von der Planung bis zur Montage aus einer Hand.<br />
German Engineering am türkischen Meer<br />
Bei der neuen Energieversorgung an der Küste des Marmarameeres<br />
geht es nicht um eine Erweiterung einer<br />
bereits vorhandenen Infrastruktur, sondern vielmehr<br />
um einen kompletten Kraftwerksneubau auf der grünen<br />
● Rohre aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) sind unempfindlich gegenüber<br />
Meerwasser, Hitze, Chemie- und Kräfteeinwirkung. Zudem ermöglicht ihr geringes<br />
Gewicht schnelle und einfache Montage.<br />
● Durch Salzwasser und Wasserdampf besteht Korrosionsgefahr, zudem stellen große<br />
Druckschwankungen und extreme Temperaturverhältnisse hohe Anforderungen an<br />
die Werkstoffe – Fiberglasrohre erfüllen diese.<br />
Wiese, direkt an der Küste. Bei dem Combined-Cycle<br />
Power-Plant-Gas-Kombikraftwerk (CCPP) sind die Anforderungen<br />
an die Leitungssysteme extrem: Die Rohre<br />
müssen unempfindlich gegen das Wasser des Marmarameeres<br />
und beständig gegenüber entstehenden Wasserdämpfen<br />
sein sowie extreme Druckschwankungen und<br />
Temperaturverhältnisse aushalten. Fiberglasrohre lassen<br />
sich auf diese speziellen Eigenschaften hin auslegen.<br />
Die Produktion von Rohren für die Kühlwasserkreisläufe<br />
begann im Januar 2009 direkt mit der Planung, da<br />
die technische Beratung bereits in der Angebotsphase<br />
vorgenommen wurde. Die Ingenieure des Rohrherstellers<br />
führen Stressanalysen im Computer durch, berechnen<br />
Strömungen, erstellen Halterungskonzepte, fertigen 3D-<br />
Zeichungen an und übernehmen die Baustellenaufsicht<br />
„Leichte Fiberglas-Rohre bieten Vorteile bei<br />
Handling und Montage“<br />
am zukünftigen Kraftwerksstandort in Bandirma. Vor Ort<br />
ist ein türkisches Montageteam aus 40 Personen zu steuern,<br />
die klimatischen Bedingungen sind hart. Die deutschen<br />
Ingenieure schulen das türkische Team in der Verarbeitung<br />
und der Montage von Fiberglaswerkstücken.<br />
GFK lässt sich schnell mittels Verkleben, Laminieren,<br />
Stecken und Flanschen verbinden. Ein schulungserfahrenes<br />
Technikteam aus Deutschland führt die lokalen<br />
Arbeiter ein und stellt sicher, dass alle Verbindungen sicheren<br />
Standards entsprechen. Verfahrensprüfungen<br />
und Druckversuche sichern im Verlauf das gesamte<br />
System ab.<br />
1: Die extremen klimatischen Bedingungen und der Spagat zwischen<br />
zwei Kulturkreisen stellen hohe Anforderungen an Bau-<br />
und Montageteams<br />
2: Die Fiberglasrohre müssen unempfindlich gegen das Wasser<br />
des Marmarameeres sein, das für die Kühlung dem Kraftwerk<br />
zugeleitet wird
1 2<br />
Werkstoffe<br />
Die Rohre aus GFK sind so leicht,<br />
dass sie sich häufig sogar tragen<br />
lassen, was Handling und Montage<br />
deutlich vereinfacht<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
47
Werkstoffe<br />
Korrosionsgefahr durch<br />
Wasserdämpfe sowie<br />
große Druckschwankungen<br />
sind Extreme,<br />
die eine hohe Beständigkeit<br />
der Rohre nötig<br />
machen<br />
48 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Planung und Bau parallel<br />
Beim Combined-Cycle-Power-Plant-Gas- und -Dampf-<br />
Kombikraftwerk werden die heißen Abgase der Gasturbinen<br />
in einem Abhitzedampfkessel verwendet, um<br />
Wasserdampf zu erzeugen. Der Dampf wird anschließend<br />
über einen herkömmlichen Dampfturbinenprozess<br />
entspannt. Zwei Drittel der elektrischen Leistung<br />
„Bei GFK lassen sich durch Verkleben, Laminieren,<br />
Stecken und Flanschen schnell und sicher alle Verbindungen<br />
beim Bau der Anlage herstellen“<br />
entfallen dabei auf die Gasturbine, ein Drittel auf den<br />
Dampfprozess. Der Abdampf der Turbine wird anschließend<br />
im Kondensator gekühlt. Aus der Kombination der<br />
Turbinenarten ergeben sich hohe Wirkungsgrade.<br />
Während auf der Baustelle gearbeitet wird, ist die<br />
Planung der Gesamtanlage en détail noch nicht erfolgt<br />
– sie bleibt ein langer kontinuierlicher Prozess. Der<br />
Rohrspezialist erstellt Konstruktionszeichnungen von<br />
getesteten Rohrverläufen und sendet diese online an den<br />
Kunden. Dieser fügt die Rohrplanung in das Gesamt-3D-<br />
Modell der Anlage ein und sendet die aktualisierten<br />
Datensätze wiederum nach Deutschland zurück. So bewegen<br />
sich die deutschen Ingenieure virtuell im gesamten<br />
Kraftwerk, analysieren alle fremden Komponenten<br />
sowie die eigenen Rohrleitungen in 3D, identifizieren<br />
Halterungsmöglichkeiten in der Anlage und planen weitere<br />
Rohrverläufe. Im Laufe der Bauphase entsteht eine<br />
Zeichnung mit über 18.000 Einzelteilen für die Kühlwasserleitungen.<br />
Erschwerte Bedingungen erfordern hohe<br />
Leistungsfähigkeit<br />
Im engen Zeitplan ist die schnelle Lieferung aller Rohre<br />
und Teile essenziell. Das beauftragte Rohrvertriebsunternehmen<br />
ist Teil einer internationalen Gruppe, alle<br />
Rohre sind kompatibel nach ISO-Abmessungen. Die<br />
GFK-Rohre für das Kraftwerk in Bandirma werden im<br />
italienischen Povoletto bei einem Partner des<br />
deutschen Unternehmens gefertigt, was die<br />
Transportwege verkürzt und Kosten senkt.<br />
Zudem sind die leichtgewichtigen Fiberglasrohre<br />
einfach im Handling: Wo Edelstahl<br />
nicht selten durchgängig mit Geräten bewegt<br />
werden muss, lassen sich Fiberglas-Rohre oft<br />
sogar tragen. Das ist vor allem bei der Montage von<br />
Vorteil.<br />
Das Projekt in Bandirma, die Abstimmung vor Ort<br />
und die projektbegleitende Planung, stellt die Ingenieure<br />
vor besondere Herausforderungen. Hinzu kommen extreme<br />
klimatische Bedingungen von im Sommer über<br />
40 °C im Schatten und im Winter mit Schneefall. Das<br />
Gas-Kombikraftwerk wurde dennoch innerhalb des<br />
Zeitplans fertiggestellt und ist seit Dezember 2010 am<br />
Netz. ●<br />
Weitere Anlangenbauprojekte mit GFK-Produkten<br />
sowie einen aktuellen GFK- und CFK-Marktbericht<br />
der Industrievereinigung verstärkte Kunststoffe gefällig?<br />
Klicken Sie sich rein auf www.chemietechnik.de/1301ct604<br />
– oder QR-Code scannen!<br />
Bilder: Fiberpipe
Frequenzumrichter<br />
Für Wand- und Schrankmontage<br />
• Leistung bis 132 kW<br />
• EMV-Filter integriert<br />
• IP 20/21<br />
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf diesen<br />
Seiten: chemietechnik.de/1301ct909 oder QR-Code<br />
mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
Die IP20/21-Version des<br />
Frequenzumrichters<br />
Emotron FDU/VFX von<br />
Crompton Greaves zielt<br />
auf Anwender von<br />
wand- oder schrankmontiertenFrequenzumrichtern<br />
ab und basiert<br />
auf den IP54-Geräten<br />
FDU und VFX. Eine robuste<br />
mechanische Konstruktion, ein<br />
einfacher Zugang zu Anschlussklemmen<br />
und hohe Bauteilintegration<br />
waren Schwerpunkte bei der<br />
Entwicklung. Die Reihe umfasst zudem<br />
Standardfunktionen wie direkte<br />
Drehmomentsteuerung für genaue<br />
und schnelle Kontrolle, Pumpen- und<br />
Ventilatorsteuerung, programmierbare<br />
logische Funktionen, einschließlich<br />
Komparator und Timer<br />
Förderschlauch<br />
Ökologisch wertvoll<br />
• Shore-Härte 80 A<br />
• für Abrieb-verursachende Stoffe<br />
• 52 % nachwachsende Rohstoffe<br />
Die Master-PUR-green-Absaug- und<br />
Förderschläuche bietet Masterflex in<br />
einer leichten (L), einer mittelschweren<br />
(H) und einer schweren, wandungsverstärkten<br />
(HX) Variante an.<br />
Sie werden aus einem TPU gefertigt,<br />
das eine Shore-Härte von etwa 80 A<br />
aufweist und 52 % an nachwachsende<br />
Rohstoffe enthält. Die Schläuche<br />
eignen sich für Abrieb-verursachende<br />
Feststoffe sowie gasförmige<br />
und flüssige Medien.<br />
Powtech Halle 1 – 156<br />
chemietechnik.de/1302ct091<br />
sowie einen Motorbelastungssensor<br />
mit automatischer<br />
Alarmpegel-Einstellung.<br />
Zudem sind die Geräte mit<br />
einer mehrsprachigen Bedieneinheit<br />
mit Einzelfunktionstasten<br />
und Kopierfunktion<br />
sowie einer integrierten Zwischenkreisdrossel<br />
für reduzierte<br />
harmonische Oberschwingungen<br />
und maximale<br />
Spannungsauslastung ausgerüstet.<br />
Ein integrierter EMV-Filter<br />
der Kategorie 3 sowie ein<br />
drehzahlgeregelter Ventilator bei allen<br />
Leistungen gehören ebenso zu<br />
ihren Merkmalen. Umrichter sind für<br />
den Einbau in Schaltschränken<br />
(IP20) oder die direkte Montage an<br />
einer Wand im Kontrollraum (IP21)<br />
optimiert und decken Leistungen bis<br />
132 kW ab.<br />
chemietechnik.de/1302ct107<br />
Tauschpalette<br />
Unsichtbare Zeichen<br />
• RFID-Technik integriert<br />
• automatisierte Bestandsverwaltung<br />
• gut lesbar<br />
Falkenhahn hat die RFID-Technik unsichtbat<br />
in eine Europalette integriert.<br />
Das ermöglicht die automatisierte<br />
Erfassung von Palette und<br />
Ware und somit eine automatische<br />
Warenbestandsverwaltung per<br />
Knopfdruck – ohne Sichtkontakt zwischen<br />
Datenträger und Lesegerät –<br />
und zwar mit einer Reichweite bis<br />
fünf Meter. Einzige Voraussetzung für<br />
eine einwandfreie Abwicklung ist,<br />
dass die Ware eindeutig der Palette<br />
zugeordnet wurde.<br />
chemietechnik.de/1302ct028<br />
LÖSUNGEN<br />
<strong>AUS</strong> EINER HAND<br />
Wir bieten Rohrleitungssysteme<br />
für anspruchsvolle Anwendungen<br />
in der chemischen<br />
Prozessindustrie. Orientiert an<br />
Ihren Anforderungen und<br />
Prozessen entwickeln wir<br />
individuelle Lösungen für den<br />
sicheren und wirtschaftlichen<br />
Transport von Flüssigkeiten und<br />
Gasen. Verlassen Sie sich weltweit<br />
auf unsere Expertenteams!<br />
Adding Quality<br />
to People’s Lives<br />
GF Piping Systems<br />
Ebnatstrasse 111<br />
8201 Schaffhausen/Switzerland<br />
Tel. 052 631 11 11<br />
E-Mail: ch.ps@georgfischer.com<br />
www.gfps.com<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
49
Produkte<br />
Temperaturmessumformer<br />
Modularer Aufbau ermöglicht<br />
Nachrüstung von Funktionen<br />
• modularer Aufbau<br />
• individuelle Anpassung möglich<br />
• vereinfachtes Transmitter-Interface<br />
Emerson Process Management hat den Rosemount-644-Temperaturmessumformer<br />
verbessert.<br />
Das modulares Design ermöglicht Funktionen anwendungsspezifisch<br />
für jeden Punkt der Anlage zu<br />
integrieren. Dazu kommt die einfache Bedienung.<br />
Der modulare Aufbau des Temperaturmessumformers<br />
ermöglicht es, die Ausgaben in die Instrumentierung<br />
zu verbessern. So lässt sich das Basismodell<br />
durch die Auswahl an zusätzlichen Funktionen<br />
an jede Anwendung anpassen. Durch das<br />
Human-Centered-Design ist das Gerät mittels einfacher<br />
Grafik und guter Zugänglichkeit einfach zu<br />
installieren. Ein vereinfachtes Transmitter-Interface<br />
und ein zweiter Sensoreingang sparen Zeit für Installation<br />
und Wartung und erhöhen so die Produktivität.<br />
Wichtige Funktionen, die in dieses Modell<br />
integriert sind, sind ‚Hot Backup‘ und ein Alarm für<br />
Transmitter<br />
Stark und beständig<br />
• Sensor aus Titan<br />
• keine Verformungen bis 120 °C<br />
• keine Korrosion<br />
Bei Keller werden die Transmitter der<br />
Serie 3L bis Serie 10L, an die hohe<br />
Stabilitätsanforderungen gestellt<br />
werden, in Titan gefertigt. Die implementierbaren<br />
Sensoren dieser Serie<br />
mit einem Durchmesser ab 9 mm<br />
zeigen auch bei Temperaturen bis<br />
120 °C keine Verformungen, wohingegen<br />
aus Stahl gefertigte Sensoren<br />
dieser Art maximal einer Temperatur<br />
von 60 °C ausgesetzt werden dürfen.<br />
Denn die temperaturbedingte Ausdehnung<br />
des Öls verformt die Stahlmembrane<br />
sonst so weit, dass sie<br />
nicht mehr in die Ursprungslage zurückkehrt.<br />
Durch die hohe Temperaturbeständigkeit<br />
sind zudem Stabilitätsfehler<br />
unwahrscheinlicher, verglichen<br />
mit Produkten mit Stahlmembrane.<br />
Grund dafür ist der halb<br />
so große Elastizitätsmodul. Titan ist<br />
chemisch und biologisch neutral,<br />
50 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
die Sensordrift.<br />
Dieser ermöglicht<br />
nahtlose<br />
Performance im<br />
Falle eines eines Sensorfehlers<br />
und und vorausschauende<br />
Warnung<br />
vor vor möglichen ProProblemen. Der Messumformer<br />
ist SIL2-zertifiziert und<br />
erfüllt alle alle notwendigen Sicherheitsanforderungen.<br />
Nutzer erhalten eine vollstänvollständige Dokumentation für einfache SIS-Compliance.<br />
Die neue Local-Operator-Interface-Option (LOI)<br />
bietet eine kosteneffektive und komfortable Lösung<br />
zur Inbetriebnahme ‚on-the-spot‘ und der<br />
Konfigurierung vor Ort. Durch die intuitive Menü-<br />
und durch eine feste Oxidschicht auf<br />
der Oberfläche des Materials zeigen<br />
Komponenten aus Titan im Gegensatz<br />
zu branchenüblichen Edelstählen<br />
auch in Salz- oder Chlorwasser<br />
keine Korrosion. Dadurch eignen sie<br />
sich für den Einsatz bei Abwässern,<br />
die mit unbekannten korrosiven Stoffen<br />
belastet sein können.<br />
chemietechnik.de/1302ct037<br />
Heizleitung<br />
Umweltfreundliche Alternative<br />
• Einsatz bis 150 °C<br />
• keine fluorierten Kunstsstoffe<br />
• halogenfrei<br />
Die selbstlimitierende MSB-Heizleitung<br />
von Bartec eignet sich für den<br />
Einsatz in der Temperaturklasse T4<br />
im explosionsgefährdeten Bereich<br />
(94/9/EG) und ist bis 150 °C temperaturbeständig.<br />
Aus Sicherheitsgründen<br />
ist die Heizleitung für die maximale<br />
Arbeitstemperatur von 110 °C<br />
im eingeschalteten und 130 °C im<br />
ausgeschalteten Zustand zugelassen.<br />
Bei der Heizleitung wird vollständig<br />
auf fluorierte Kunststoffe<br />
verzichtet. Sie ist halogenfrei und<br />
setzt im Brandfall oder bei der Entsorgung<br />
keine giftigen oder ätzenden<br />
Gase frei. Durch die eingesetzte<br />
TPC-Ummantelung ist sie beständig<br />
gegen Korrosion und chemische Einflüsse<br />
von Ölen, Fetten und nahezu<br />
allen Chemikalien. Die Investitionskosten<br />
sind gegenüber Fluorpolymer-Heizleitungen<br />
bei einem sol-<br />
struktur hat das Personal Zugang zu Informationen,<br />
die zur Lösung von Problemen erforderlich<br />
sind, etwa Messungen zu überprüfen, oder um<br />
Anpassungen vorzunehmen.<br />
chemietechnik.de/1302ct104<br />
chen Heizkreis geringer. Ergänzend<br />
zu den Heizleitungen bietet der Hersteller<br />
die passende Anschlusstechnik,<br />
um komplette Heizkreise zu installieren,<br />
die nach IEC und EN<br />
60079-30-1 zertifiziert sind. Die Variation<br />
und Kombination des bauartgeprüften<br />
Heizsystems macht eine<br />
Einzelabnahme vor Ort unnötig.<br />
chemietechnik.de/1302ct055
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Seite: www.chemietechnik.de/1301ct907 oder<br />
QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
Andocksystem<br />
Griffe eingeschweißt<br />
• flexibles Andocksystem<br />
• hohes Containment<br />
• neuartige Schlauchverbindung<br />
Die Flecotwin-Technologie von Andocksysteme<br />
Untch ist ein flexibles<br />
Andocksystem. Es eignet sich für<br />
Abfüll- bzw. Umfüll-Prozesse unterschiedlicher<br />
Medien, zu denen auch<br />
Flüssigkeiten zählen, welche der Anwender<br />
unter höchsten Containmentaspekten<br />
ausführen muss. Zudem<br />
sind Sterilapplikationen mithilfe des<br />
Andocksystems vorstellbar. Grundsätzlich<br />
ist das System aus zwei parallel<br />
geschalteten und gemeinsam<br />
wirkenden Andockmechanismen<br />
aufgebaut. Durch diese Konstruktion<br />
stellt das Andocksystem eine doppelte<br />
Containment-Barriere dar, bei<br />
dessen Einsatz Emissionswerte unterhalb<br />
der Detektionsgrenze möglich<br />
werden.<br />
Powtech Halle 1 – 432<br />
chemietechnik.de/1302ct051<br />
Sicherheitsschrank<br />
Bitte Türen schließen<br />
• Türflügel in sieben Farben<br />
• einfacher Transport<br />
• einhändiges Öffnen<br />
Der Sicherheitsschrank Q-Pegasus<br />
von Asecos bietet die Vorteile der<br />
Pegasus-Baureihe mit dem Komfort<br />
der Q-Line. Er ist baumustergeprüft<br />
(Typprüfung) gemäß DIN EN 14470-<br />
1, GS-zertifiziert und CE- sowie DIN<br />
EN 14727-konform (Labormöbel).<br />
Die Feuerwiderstandsfähigkeit liegt<br />
bei 90 min. Der Schrank hat zudem<br />
hohe Verwindungssteifigkeit.<br />
chemietechnik.de/1302ct093<br />
ENGINEER<br />
SUCCESS<br />
New technologies<br />
New solutions<br />
New networks<br />
Weitere Informationen erhalten Sie unter<br />
Tel. +49 511 89-0, hannovermesse@messe.de<br />
Speise- und Eingangstrennverstärker<br />
Platzsparend, auch im Ex-Bereich<br />
• Einsatz in Ex-Zone 2<br />
• aktive und passive Betriebsart<br />
• DIP-Schalter<br />
Der Ex-i Speise- und Eingangstrennverstärker<br />
von Jumo ist für den Betrieb<br />
von eigensicheren Ex-i-Messumformern<br />
und mA-Stromquellen,<br />
die im Ex-Bereich oder auch im<br />
Nicht-Ex-Bereich installiert sind,<br />
ausgelegt. Zweidraht-Messumformer<br />
werden mit Energie versorgt,<br />
Vierdraht-Messumformer sowie mA-<br />
Stromquellen (0/4...20 mA) kann der<br />
Anwender über den nicht speisenden<br />
Eingang anschließen. Die mA-<br />
Messwerte stehen im Nicht-Ex-Bereich<br />
am Ausgang als 0/4...20 mA in<br />
aktiver oder passiver Signalbetriebsart<br />
bereit. Über einen frontseitigen<br />
DIP-Schalter lässt sich der Ausgang<br />
auch mit einem Spannungssignal<br />
0/1...5 V nutzen. Die digitalen Kommunikationssignale<br />
der angeschlossenen<br />
Hart-fähigen Messumformer<br />
können dem analogen Messwert auf<br />
Wie können Sie Ihre<br />
Produktionseffizienz<br />
erhöhen?<br />
Produkte<br />
Die Industrial Automation präsentiert<br />
Ihnen alle Innovationen im Bereich der<br />
Fertigungsautomation.<br />
Intelligente Robotiklösungen und<br />
nachhaltige Technologien für effizientere<br />
und sichere Produktionsabläufe in der<br />
industriellen Fertigung.<br />
Besuchen Sie das weltweit wichtigste<br />
Technologieereignis.<br />
Mehr unter hannovermesse.de<br />
Jetzt Termin vormerken:<br />
8.–12. April 2013<br />
der Ex- oder Nicht-Ex-Seite überlagert<br />
und bidirektional übertragen<br />
werden. Um die Hart-Impedanz bei<br />
niederohmigen Systemen zu erhöhen,<br />
lässt sich über einen DIP-Schalter<br />
auf der Gehäusefront ein zusätzlicher<br />
Widerstand in den Ausgangskreis<br />
schalten. Das Gerät hat eine<br />
galvanische 3-Wege-Trennung, und<br />
die Energieversorgung ist als Weitbereichsversorgung<br />
(24 bis 230 V)<br />
ausgelegt. Mit der Baubreite von<br />
17,5 mm ist er platzsparend und<br />
kann in Zone 2 installiert werden.<br />
chemietechnik.de/1302ct115<br />
NEW TECHNOLOGY FIRST<br />
8.–12. April 2013 · Hannover · Germany
Konustrockner für anspruchsvolle Anwendungen<br />
Ganz schön schräg<br />
PRofi-GuiDe<br />
Funktion Branche<br />
Der Autor:<br />
Anlagenbau ●<br />
Chemie ● ●<br />
Pharma ● ● ●<br />
Ausrüster ●<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer ●<br />
Manager ●<br />
Werner Kanzinger,<br />
Vice President<br />
Process, IKA-Werke<br />
52 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
enTScHeiDeR-facTS<br />
Für Betreiber<br />
● Der Konustrockner wurde für besonders anspruchsvolle Anwendungen in der Pharmaindustrie entwickelt.<br />
● Das Gerät erzielt gute Mischergebnisse mit Hilfe der Schwerkraft. Aufgrund der Schrägstellung seines Mischbehälters<br />
erzeugt es ein freies Spiel der Kräfte.<br />
● Die Maschine arbeitet bei Temperaturen zwischen -20 und 200 °C, unter einem Druck von bis zu 6 bar und<br />
unter Vakuum. Damit eignet sie sich zur Separation von Fluiden sowie zur Suspensionstrennung und thermischen<br />
Trocknung.<br />
Die Schwerkraft hilft diesem Konustrockner dabei, gute<br />
Misch- und Trocknungsergebnisse zu erzeugen. Aufgrund<br />
der Schrägstellung seines Mischbehälters erzeugt<br />
er ein freies Spiel der Kräfte. Ausgelegt für die Vakuum-<br />
Kontakt-Trocknung von lösemittelfeuchten Feststoffen,<br />
eignet sich der Konustrockner CD für anspruchsvolle<br />
Anwendungen in der Pharmaindustrie.<br />
Die schonende Trennung der Lösemittel von pharmazeutisch<br />
aktiven Substanzen ist eine hohe Kunst bei<br />
der Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen. Die<br />
oft hochsensiblen Wirkstoffe dürfen beim Trennvorgang<br />
– in diesem Fall der Trocknung – nicht verändert werden.<br />
Feuchtegehalt und Fließverhalten der Substanzen<br />
vor der Trocknung hängen wiederum stark ab von den<br />
Kristalleigenschaften des zu bearbeitenden Produktes –<br />
eine echte Herausforderung für den Verfahrenstechniker.<br />
Denn die Trocknung feuchter, stumpfer oder klebriger<br />
Schüttgüter stellt an die Ausrüstung unterschiedliche<br />
Anforderungen. Deshalb ist der Trockner so flexibel<br />
ausgestattet wie möglich: Namensgeber des Konustrockners<br />
ist der konusförmige Behälter mit beheizbarem<br />
Doppelmantel. Darin sorgen ein beheizbarer Spiralrührer,<br />
eine Brüdenabsaugung mit rückspülbarem Staubfilter<br />
sowie ein totraumfreies, metallisch dichtendes Bodenablassventil<br />
für eine homogene Mischung und einen<br />
Die strömungsgünstige Konstruktion<br />
des Konustrockners begünstigt den<br />
Trocknungsprozess<br />
Bild: IKA-Werke<br />
optimalen Trocknungsprozess. Die Maschine arbeitet<br />
bei Temperaturen zwischen -20 und 200 °C, unter einem<br />
Druck von bis zu 6 bar und unter Vakuum. Damit eignet<br />
sie sich zur Separation von Fluiden sowie zur Suspensionstrennung<br />
und thermischen Trocknung.<br />
Heizen, Rühren, Trocknen<br />
Ein wichtiges Kennzeichen des Konustrockners ist der<br />
schrägstehende Behälter, denn die Schräge bietet Vorteile:<br />
Auch extrem schlecht fließende Produkte durchmischen<br />
sich vollständig und zuverlässig. Der starke Verbündete<br />
dahinter ist die Schwerkraft. Sie verleiht dem<br />
Mischvorgang zusätzliche Dynamik. Ein von oben eingebauter<br />
Strömungsbrecher mit Temperatursensor passt<br />
das Mischergebnis dem Rieselverhalten des Produkts an.<br />
Lösemittelbrüden zieht der auf dem Deckel montierte<br />
rückspülbare Staubfilter ab. Beim Trocknen konglomeratbildender<br />
Substanzen sorgt ein Klumpenbrecher für<br />
ein agglomeratfreies Mischergebnis.<br />
Der Spiralrührer mit feststehendem Strömungsbrecher<br />
vermengt das Mischgut sowohl tangential als auch<br />
radial. Seine strömungsgünstige Form senkt den Reibwiderstand<br />
und erhöht die vertikale Auftriebskraft. Ein<br />
leistungsstarker Antrieb verbirgt sich in einem frequenzgeregelten<br />
Getriebemotor, der zusammen mit der war-
tungsarmen, doppelwirkenden Gleitringdichtung und<br />
der Lagerung auf dem Behälterdeckel montiert ist.<br />
Keine Kondensatbildung<br />
Das getrennte Beheizen des Rührers, des Deckels und<br />
des Behälters ist besonders für wärmesensible Stoffe<br />
günstig. Da der Behälter und der Rührer über Wasser,<br />
Dampf oder Öl direkt beheizt sind, gelangt viel Wärme<br />
in den Produktraum. Feuchtigkeit und Temperatur verteilen<br />
sich gleichmäßig – ein wichtiger Vorteil gegenüber<br />
herkömmlichen Vakuumkontakt-Trocknern. Das<br />
gleichzeitige Beheizen des Behälterdeckels vermeidet<br />
Kondensatbildung während des Trocknungsvorgangs.<br />
Eine deutliche Arbeitserleichterung ist die kombinierte<br />
Kipp- und Schwenkvorrichtung in einem Rahmen,<br />
der auch die Steuerung aufnehmen kann. Die<br />
Kippvorrichtung des Konustrockners bietet eine einfache<br />
Öffnungsmöglichkeit für den Behälterdeckel. Die<br />
optional angebotene Schwenkvorrichtung für den gesamten<br />
Behälter verbessert den Trocknungsprozess. Die<br />
Schrägstellung fördert die Durchmischung, da neben<br />
den Mischwerkzeugen auch die Schwerkraft auf die zu<br />
trocknenden Produkte einwirkt. Auch sehr schlecht fließende<br />
Produkte werden so zuverlässig und schonend<br />
durchmischt. In der Standardausführung steht der Behälter<br />
auf Rohrfüßen, die über stabile Fußplatten am<br />
Boden befestigt sind. Bei der Option mit Kipp- und<br />
Schwenkvorrichtung ist der Behälter in einen Rahmen<br />
integriert, aus dem er sich mit Rollen herausfahren lässt.<br />
www.ceotronics.com<br />
verkauf@ceotronics.com<br />
Telefon +49 6074 8751-0<br />
Vorteil: Der Trocknungsbehälter lässt sich auch als innerbetriebliches<br />
Transportmittel des Wirkstoffes nutzen.<br />
Pharmagerechtes Scale-Up<br />
Optional verfügbar ist der Konustrockner mit CIP-Reinigung,<br />
pharmagerechten Oberflächen, Wiegezellen,<br />
Heiz- und Kühlaggregat, Vakuumpumpe, Kondensator<br />
mit Kondensatbehälter, Probeentnahmeventil und anderen<br />
Zusatzteilen. Gerade im Pharma-Bereich ist die<br />
Verfahrensentwicklung sehr zeit- und kostenintensiv.<br />
Der Konustrockner ist in den Größen von 10 bis zu<br />
4.000 l Nutzvolumen erhältlich. So lässt sich im Labormaßstab<br />
erproben, was später in der Massenproduktion<br />
umgesetzt wird. Damit bleibt die hohe Qualität der<br />
Trocknungsergebnisse in jedem Produktionsmaßstab<br />
reproduzierbar.<br />
Nach dem Trocknen wird das Produkt über den elektropneumatisch<br />
gesteuerten Kugelsegmenthahn in voller<br />
Nennweite ausgetragen. Frei von Toträumen, ist der<br />
Konustrockner leicht zu reinigen. Speziell für die pharmazeutische<br />
Industrie kann die elektrische Steuerung<br />
nach 21 CFR part 11 ausgeführt werden. ●<br />
Schüttgut- und Mischtechnik<br />
Powtech Halle 5 – 322<br />
Weitere Bilder sowie nützliche Links zum Beitrag<br />
gefällig? Scannen Sie den QR-Code oder klicken<br />
Sie rein auf www.chemietechnik.de/1301ct619<br />
CT-ClipCom: das Im-Ohr-Headset!<br />
Erhältlich als Ohrmikrofon- oder<br />
Schwanenhals-Variante.<br />
CeoTronics wurde als erstes Unternehmen seiner Kommuni kationsbranche nach<br />
ATEX-Richtlinie 94 / 9 zertifi ziert. Bitte fragen Sie nach unseren Produkten in ATEX.
Schüttgut- und Mischtechnik<br />
Vorschau Powtech 2013<br />
Hightech für´s Schüttgut<br />
In Nürnberg rieselt´s wieder: Das Messezentrum<br />
in Nürnberg wird vom 23. bis 25. April 2013 wieder<br />
ganz im Zeichen der Schüttgut-, Pulver- und Pharmatechnologie<br />
stehen. Während zur Powtech über<br />
700 Aussteller aus den Bereichen Zerkleinern,<br />
Dosieren, Mischen, Sieben und Granulieren von<br />
Pulvern und Schüttgütern erwartet werden, werden<br />
in der parallel stattfindenden Pharma-Ausrüstungsmesse<br />
Hightech-Lösungen für die Pharma-,<br />
Food- und Kosmetikbranche zu sehen sein. Außerdem<br />
lockt der internationale Partikeltechnologiekongress<br />
Partec die Fachcommunity nach Nürnberg.<br />
Einen weiteren Schwerpunkt im Ausstellungsbereich<br />
zur Pharmaindustrie bildet das Thema<br />
Reinraumtechnik: das Cleanroom Village in<br />
Halle 9 sowie der Cleanroom-Congress.<br />
Dispergierorgan<br />
Energiesparer<br />
• dispergiert vielfältige Produkte<br />
• hohe Energieeffizienz<br />
• wirtschaftlicher Betrieb<br />
Das Dispergierorgan Omega von<br />
Netzsch ist sowohl zur Verarbeitung<br />
von Standard- als auch von Hightech-Produkten<br />
geeignet. Durch die<br />
Nutzung von Turbulenz, Kavitation<br />
und Scherkräften wird eine hohe<br />
Energieeffizienz erreicht. Dadurch ist<br />
der Betrieb des Dispergierers sehr<br />
wirtschaftlich.<br />
Powtech Halle 4A – 223<br />
chemietechnik.de/1302ct070<br />
54 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Schüttguttechnik satt<br />
wird vom 23. bis 25. April<br />
wieder in Nürnberg zu<br />
besichtigen sein<br />
Einen Vorgeschmack auf<br />
die Messe und die Neuheiten,<br />
die dort zu sehen<br />
sein werden, finden Sie auf den folgenden Seiten.<br />
Außerdem berichten wir auf chemietechnik.de in<br />
den kommenden Wochen tagesaktuell über Neuheiten<br />
und Ereignisse rund um die Messe und<br />
zeigen Ihnen die neuesten Trends. Dadurch können<br />
Sie sich gezielt auf Ihren Besuch in Nürnberg vorbereiten.<br />
Klicken Sie rein! ●<br />
Durchgangsventil<br />
Spart Platz und Kosten<br />
• platzsparend<br />
• hoher Kv-Wert<br />
• Zwischengröße erhältlich<br />
Das kompakte 2/2-Wege-Durchgangsventil<br />
647 von Gemü gibt es<br />
jetzt mit optimierter Körpergeometrie<br />
als R647. Es kommt überall dort zum<br />
Einsatz, wo auf eine Schließfeder<br />
verzichtet werden kann oder wo die<br />
Einbauverhältnisse nur kleine Komponenten<br />
zulassen. Es hat einen hohen<br />
Kv-Wert bei kleinerer Antriebsgröße.<br />
Powtech Halle 9 – 442<br />
chemietechnik.de/1302ct125<br />
Zusatzalarmgerät<br />
Auch für raue Einsatzbedingungen<br />
• optischer und<br />
akustischer Alarm<br />
• Alarmweiterleitung<br />
• für -10 bis 60 °C<br />
Das Zusatzalarmgerät ZAG<br />
01 von Afriso lässt sich zur<br />
Anzeige und Weiterleitung<br />
von Alarmsignalen von<br />
Warn- oder Leckanzeigegeräten<br />
einsetzen Es kann<br />
über eine Signalleitung<br />
entweder an einen potenzialfreien<br />
Ausgangsschaltkontakt oder<br />
an einen 230-V-Alarmausgang eines<br />
Warngerätes angeschlossen werden<br />
und gibt optischen und akustischen<br />
Alarm, wobei der akustische Alarm<br />
über eine Quittiertaste abschaltbar<br />
ist. Der optische Alarm bleibt jedoch<br />
bis zur Beseitigung der Alarmursache<br />
weiterhin bestehen. Über zwei Ausgangs-Relais<br />
(zwei potenzialfreie<br />
Wechselkontakte, davon einer quittierbar)<br />
kann das Alarmsignal auch<br />
Alle Berichte zur Powtech 2013 unter<br />
www.chemietechnik.de/1301ct915<br />
oder QR-Code scannen<br />
an zusätzliche externe Zusatzgeräte<br />
(Alarmgeber, Fernmeldegeräte, Gebäudeleittechnik<br />
etc.) weitergeleitet<br />
werden. Über eine Prüftaste ist eine<br />
(regelmäßig empfohlene) Funktionskontrolle<br />
durchführbar. Das Gerät ist<br />
für Umgebungstemperaturen von -10<br />
bis 60 °C geeignet und wird mit AC<br />
230 V versorgt.<br />
Powtech Halle 6 – 211<br />
chemietechnik.de/1302ct002
Katalog<br />
Neue Ausgabe<br />
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Doppelseite: www.chemietechnik.de/1301ct913<br />
oder QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
• 270 Seiten Fittings<br />
• Informationen zur Montage<br />
• geeignet als Nachschlagewerk<br />
Der Katalog „Instrumentation IT3 –<br />
Edelstahl Rohrverbindungstechnik“<br />
von Schwer Fittings ist ein Fundus an<br />
Informationen rund um die Themen<br />
Aseptik-Verbindungen, Ecotube-Verschraubungen,Klemm-Keilringverschraubungen,Orbitalschweiß-Fittings<br />
und VC-Verbinder sowie IC-Adapterfittings.<br />
Der 270 Seiten umfassende<br />
Katalog enthält Wissenswertes<br />
über Produktvarianten, technische<br />
Maße und die zugehörigen Informationen<br />
zur Montage oder zur Anwendung<br />
von Edelstahl-Fittings. Neben<br />
Abbildungen und technischen Zeichnungen<br />
bietet der Katalog zahlreiche<br />
Varianten innerhalb eines Artikels<br />
und eignet sich daher sehr gut als<br />
Nachschlagewerk für Einkäufer, Konstrukteure<br />
und Fachkräfte, die Rohrverbindungen<br />
auswählen und planen.<br />
Die Verbindungen finden ihren Ein-<br />
Mühle<br />
Frostiger Zerkleinerer<br />
• Schwingfrequenz von 30 Hz<br />
• optimierte Stickstoffführung<br />
• neun SOPs speicherbar<br />
Für die kryogene Vermahlung von<br />
Proben, die sich nicht bei Raumtemperatur<br />
zerkleinern lassen, eignet<br />
sich die Cryomill von Retsch . Ein integriertes<br />
Kühlsystem ermöglicht die<br />
kontinuierliche Kühlung des Mahlbechers<br />
mit flüssigem Stickstoff vor<br />
und während der Zerkleinerung. Dadurch<br />
wird die Probe versprödet und<br />
leichtflüchtige Bestandteile bleiben<br />
erhalten. Das Autofill-Systems dosiert<br />
den flüssigen Stickstoff automatisch,<br />
sodass der Anwender zu<br />
keinem Zeitpunkt damit in direkten<br />
Kontakt kommt, was die Bedienung<br />
der Mühle sicher macht. Bei der<br />
Entwicklung der neuen Mühlengeneration<br />
waren verbesserte Endfeinheiten<br />
ein wichtiger Aspekt. Diese wird<br />
durch den Einsatz einer erhöhten<br />
Schwingfrequenz von 30 Hz erreicht.<br />
Außerdem ist es möglich, bis zu<br />
satz in der Biotechnologie, der Pharmatechnik<br />
und Chemieindustrie sowie<br />
in zahlreichen weiteren High-<br />
Tech-Anwendungen unterschiedlicher<br />
Industrien.<br />
Powtech Halle 9 – 563<br />
chemietechnik.de/1302ct139<br />
neun SOPs für Routinevermahlungen<br />
zu speichern. Weitere Optimierungen<br />
sind ein verstärktes Gehäuse, verbesserte<br />
Stickstoffführung sowie<br />
Zubehör wie ein Adapter für sechs<br />
Reaktionsgefäße und ein 10 ml<br />
Mahlbecher.<br />
Powtech Halle 4 – 313<br />
chemietechnik.de/1302ct100<br />
Schüttgut- und Mischtechnik<br />
Schlauchpumpe<br />
Schläuche in wenigen Sekunden wechselbar<br />
• Ein-Hebel-Bedienung<br />
• schneller Schlauchwechsel<br />
• wiederverwendbarer Schlauch<br />
Ponndorf hat mit der Schlauchpumpe<br />
P Delta eine platzsparende Bauform<br />
entwickelt, die über eine wartungsfreundlicheEin-Hebel-Bedienung<br />
verfügt. Zudem können die<br />
Schläuche in wenigen Sekunden<br />
ohne zusätzliches Werkzeug gewechselt<br />
werden. Die Pumpe ist auf<br />
eine Förderleistung bis 850 l/h, einen<br />
Förderdruck bis 2 bar und eine<br />
Saughöhe bis 7 m Wassersäule ausgelegt.<br />
Dabei ist es gelungen, diese<br />
Leistungsdaten in einer kompakten<br />
Baugröße zu verpacken. Dies erlaubt<br />
eine Integration der Pumpe auch<br />
dort, wo wenig Montageplatz zur<br />
Verfügung steht – sei es in einer<br />
engen Maschine oder in einem<br />
„dicht besiedelten" Anlagenumfeld.<br />
Mit der wartungsfreundlichen Ein-<br />
Hebel-Bedienung lässt sich das<br />
Pumpengehäuse schnell und ohne<br />
R+B Filterelemente für reine Luft<br />
n Individuelle Lösungen<br />
n Kompetente technische Beratung<br />
n Innovative Produkte<br />
n Schneller und flexibler Service<br />
n Hervorragende Produktqualität<br />
n Größtes Staubfilter-Programm auf dem Markt<br />
Powtech 2013<br />
Halle 5 ·Stand 131<br />
Nürnberg, 23. – 25. 4. 2013<br />
Werkzeug öffnen und der Schlauch<br />
wechseln, beispielsweise bei einem<br />
Produkt- oder Farbwechsel. Ein weiteres<br />
Merkmal: Der entnommene<br />
Schlauch ist kein Abfall, der entsorgt<br />
werden muss, sondern kann mehrfach<br />
wiederverwendet werden. Entsprechend<br />
einfach lässt sich diese<br />
Schlauchpumpe auch reinigen.<br />
Powtech Halle 4 – 421<br />
chemietechnik.de/1302ct090<br />
R+BFilter <strong>GmbH</strong> ·74243 Langenbeutingen ·Tel. +49 (0) 79 46 91 27-0 ·www.rb-filter.de<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
55
Schüttgut- und Mischtechnik<br />
Flügelschleuse<br />
Gleichmäßiger Austrag<br />
• für Dosier- und Austragsaufgaben<br />
• Einbaulage beliebig<br />
• wartungsfrei<br />
Die Flügelschleuse FS-M von Ebro<br />
wird als Austragsorgan für Granulate<br />
und pulverförmige Medien eingesetzt.<br />
Die Konstruktion zeichnet sich<br />
durch eine dreifache Wellenlagerung<br />
aus und kann in beliebiger Einbaulage<br />
montiert werden. Auch brückenbildende<br />
Produkte können sicher<br />
und gleichmäßig ausgetragen werden.<br />
Powtech Halle 4A – 203<br />
chemietechnik.de/1302ct189<br />
Kühlmischer<br />
Effizient in Sachen Kühlung<br />
• 1.700 bis 6.000 l<br />
• gekühltes Werkzeug<br />
• doppelwandiger Mischbehälter<br />
Unbestritten ist Mischen<br />
ein sehr energieintensiver<br />
Prozess, insbesondere<br />
dann,wenn dabei noch<br />
gekühlt werden muss. Mit<br />
der neuen HCE-Baureihe<br />
entwickelte Zeppelin einen<br />
Kühlmischer, der<br />
durch seine effiziente Kühlleistung<br />
überzeugt. Der Mischer HCE (Horizontal<br />
Cooler EFF), der in den Größen<br />
1.700 bis 6.000 l zur Verfügung<br />
steht, erreicht dies auf mehreren<br />
Wegen. Zum einen sorgt seine sehr<br />
gute Mischgüte für kurze Misch- und<br />
Kühlzeiten. Zum anderen besitzt der<br />
Mischer ein neu konstruiertes Behältersystem<br />
und ein gekühltes<br />
Mischwerkzeug mit großer Oberfläche.<br />
So besteht der Mischbehälterraum<br />
aus einem doppelwandigen<br />
56 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Sensor<br />
Gut mit anderen Gasen<br />
• kaum Querempfindlichkeit<br />
• überwacht Grenzwerte<br />
• reduzierter Kalibrieraufwand<br />
Der Smartmodul-Flow-Sensor von<br />
der Firma Smartgas Mikrosensorik<br />
misst Schwefeldioxid (SO 2 ) in einem<br />
Konzentrationsbereich von 0 bis<br />
2.000 ppm. Der Sensor arbeitet auf<br />
Basis von Infrarotabsorption (NDIR)<br />
und zeigt dadurch kaum Querempfindlichkeiten<br />
zu anderen Gasen. Der<br />
Sensor kann in industriellen Anlagen<br />
oder in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie<br />
eingesetzt werden.<br />
Ein Altern der Sensoren, wie man es<br />
von elektrochemischen Sensoren her<br />
kennt, gibt es prinzipbedingt nicht,<br />
was den Kalibrier- und Wartungsaufwand<br />
erheblich reduziert. Der OEM-<br />
Sensor ist mit unterschiedlichen<br />
Standard-Schnittstellen (4...20 mA,<br />
RS485, UART) erhältlich.<br />
chemietechnik.de/1302ct018<br />
Wärmeübertrager, der mit Hilfe eines<br />
speziellen Schweißverfahrens und<br />
anschließendem Verformen und Aufblasen<br />
hergestellt wird. Auch die<br />
dreidimensionale Geometrie der radial<br />
bzw. axial arbeitenden<br />
Mischwerkzeuge wurde vollkommen<br />
neu konstruiert. Die ausgeklügelte<br />
Form trägt entscheidend zur Effizienzsteigerung<br />
bei.<br />
Powtech Halle 4 – 305<br />
chemietechnik.de/1302ct069<br />
Trocknungs- und Abfüllanlage<br />
Erst entwässern, dann trocknen<br />
• kurze Durchlaufzeit<br />
• energiesparend<br />
• verkürzte Trocknungszeit<br />
Ein führender Hersteller von Kunststoffpulver<br />
zur Folienfertigung beauftragte<br />
Engelsmann mit dem Bau der<br />
Trocknungs- und Abfüllanlage. Die<br />
hohe Durchsatzleistung, die der Auftraggeber<br />
vorgab, machte die besondere<br />
Größe der Anlage notwendig.<br />
Ein großer Vakuum-Trockner bildet<br />
das Kernstück der Anlage, die zum<br />
Entwässern, Trocknen und Abfüllen<br />
von Kunststoffpulver eingesetzt wird.<br />
Neben dem Trockner, der ein Bruttovolumen<br />
von 20.000 dm³ fasst, besteht<br />
die 8,5 m lange und 6,6 m hohe<br />
Anlage aus einer Siebmaschine als<br />
Schutzsieb, einer Abfülleinheit für<br />
Big-bags bzw. Säcke sowie aus der<br />
Steuerungseinheit des Trockners. Der<br />
Vorteil der Anlage liegt in deren Wirtschaftlichkeit,<br />
bedingt durch das Zusammenlegen<br />
von Entwässern und<br />
Trocknen innerhalb eines Geräts. Die<br />
• eigensicher<br />
• kostengünstige Installation<br />
• breitbandig einsetzbar<br />
Bei der Entwicklung des Durchflussmessgeräts<br />
Promag P/H 200 ist es<br />
Endress+Hauser gelungen, die magnetisch-induktiveDurchflussmessung<br />
in Zweileiter-Technik umzusetzen<br />
und dies mit gleichzeitiger Absicherung<br />
der gewünschten Leistungsfähigkeit.<br />
Dabei stand die<br />
Messgenauigkeit von 0,5 % v. M.<br />
genauso im Fokus wie die Messwertstabilität.<br />
In der chemischen Industrie<br />
ist seit vielen Jahren die<br />
Zweileiter-Technik die bevorzugte Art<br />
der Messgeräteinstrumentierung.<br />
Kostengünstige Installation und maximale<br />
Sicherheit durch Eigensicherheit<br />
sind dabei die Argumente. Bislang<br />
standen aber noch nicht alle<br />
Messtechnologien in Zweileiter-<br />
Technik zur Verfügung. Gerade im<br />
Bereich der Durchflussmessung<br />
wurde in der Vergangenheit der<br />
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Seite: www.chemietechnik.de/1301ct917 oder<br />
QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
dadurch verkürzte Durchlauf- bzw.<br />
Trocknungszeit spart Energie und<br />
Kosten. Eine weitere Zeitersparnis<br />
bietet die Abfülleinheit, die gleichermaßen<br />
eine Befüllung von Big-bags<br />
und Säcken ermöglicht. Mit dem voluminösen<br />
Vakuum-Trockner wird<br />
das Kunststoffpulver erst entwässert<br />
und danach getrocknet.<br />
Powtech Halle 4 – 323<br />
chemietechnik.de/1302ct140<br />
Durchflussmessgerät<br />
Zweileiter-Technik senkt Installationskosten<br />
Wunsch nach magnetisch-induktiven<br />
Durchflussmessgeräten in Zweileiter-Technik<br />
immer lauter. Die Forderung<br />
lautet: Breitbandig einsetzbar,<br />
ohne Einbußen bei der Messwertstabilität<br />
und Genauigkeit.<br />
Powtech Halle 6 – 311<br />
chemietechnik.de/1302ct054
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Seite: www.chemietechnik.de/1301ct914 oder<br />
QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
Absaug- und Förderschlauch<br />
Hart im Nehmen<br />
• Werkstoff ist chemisch beständig<br />
• elektrisch ableitfähiges Polyethylen<br />
• Einsatz in Zone 0 und 20<br />
Zur Herstellung des Absaug- und Förderschlauchs<br />
Master-PE L-EL von Masterflex wird Polyethylen<br />
eingesetzt. Dieser Werkstoff ist beständig gegenüber<br />
Säuren, Laugen und anderen Chemikalien.<br />
Der Schlauch eignet sich beispielsweise für den<br />
Transport aggressiver gasförmiger und flüssiger<br />
Medien oder feinkörniger Partikel wie Stäube und<br />
Pulver im Chemiebereich. Im Vergleich zu Absaug-<br />
und Förderschläuchen aus PU besitzt PE eine viel<br />
höhere chemische Beständigkeit. So sind bei der<br />
Absaugung von hoch aggressiven Lösemitteln<br />
viele Standardwerkstoffe nicht mehr geeignet, sie<br />
fallen nach kurzer Zeit aus; der Schlauch aus Polyethylen<br />
ist langlebig, auch gegenüber Aceton,<br />
Benzenen, Toluenen und Xylenen. Lange Standzeiten<br />
und wenig Produktverschleiß sind Vorteile, die<br />
diese Schlauchkonstruktion mit sich bringt. Durch<br />
Universaltrockenmühle<br />
Zwei auf einen Streich<br />
• hohe Zerkleinerungsqualität<br />
• schnelle Reinigung<br />
• modularer Aufbau<br />
Die Universaltrockenmühle Pilotina<br />
MU von Ika ist modular aufgebaut<br />
und lässt sich innerhalb kurzer Zeit<br />
als Schneidmühle oder als Prallmühle<br />
zusammensetzen. Sie hat in beiden<br />
Betriebsarten eine hohe Zerkleinerungsqualität.<br />
Ein frequenzgeregelter<br />
3-kW-Antrieb ermöglicht es,<br />
die Umfangsgeschwindigkeit des<br />
Werkzeugs anzupassen.<br />
Powtech Halle 5 – 322<br />
chemietechnik.de/1302ct188<br />
seine spezielle Rohstoffkombination ist der<br />
Schlauch elektrisch ableitfähig < 104 Ohm und für<br />
den Einsatz in Gefahrenzonen gemäß TRBS 2153<br />
(Zone 0, 20) für brennbare Stäube und Flüssigkeiten,<br />
zur Ableitung elektrostatischer Aufladung konzipiert<br />
worden. Er erfüllt die Anforderungen der<br />
Richtlinie 94/9/EG (Atex) und ist frei von Halogenen<br />
und Weichmachern. Das leichte Wandungsmaterial<br />
verleiht dem Schlauch flexible Eigenschaften. Da<br />
Polyethylen von seiner Beschaffenheit härtere<br />
Materialeigenschaften als Polyurethan aufweist,<br />
Drehkolbenverdichter<br />
Neue Baugröße<br />
• energieeffizient<br />
• für Förderpneumatik und Abwasser<br />
• bis 8.900 m³/h<br />
Der Verdichterspezialist Aerzener<br />
erweitert seine Drehkolbenverdichter-Baureihe<br />
Delta Hybrid. Mit den<br />
neuen Baugrößen D152S sowie der<br />
D152H werden Volumenströme bis<br />
zu 8.900 Kubikmeter pro Stunde<br />
abgedeckt. Die energieeffizienten<br />
Maschinen erreichen Drücke bis<br />
1.000 mbar bzw. 1.500 mbar. Die<br />
Verdichter sollen im April 2013 in<br />
den Markt eingeführt werden und<br />
sind für Anwendungen im pneumatischen<br />
Transport, zum Beispiel von<br />
Schüttgütern, sowie zur Drucklufterzeugung<br />
beispielsweise zur Belüftung<br />
von Klärbecken in der Abwassertechnik<br />
konzipiert.<br />
Powtech Halle 4 – 115<br />
chemietechnik.de/1302ct190<br />
Rohrleitung<br />
Schalldämpfer integriert<br />
• leiser Betrieb<br />
• materialschonend<br />
• Leckagen identifizieren<br />
Für Ruhe und Sicherheit beim Fördern<br />
von Kunststoff-Granulaten sorgt<br />
die doppelwandige Edelstahlrohrleitung<br />
Silentline von Motan. Der Zwischenraum<br />
ist ein Luftpuffer, der das<br />
Innenrohr – und damit das zu transportierende<br />
Material – von der Umgebung<br />
akustisch isoliert und gleichzeitig<br />
wärmedämmend ist. Der Zwischenraum<br />
dämpft den Schall erheblich:<br />
Die Rohrleitung reduziert<br />
den Lärmpegel um mindestens<br />
12 dB(A). Das entspricht 50 % Geräuschverringerung.<br />
Zusätzliche<br />
sechs dB(A) Schalldämmung bringt<br />
die materialschonende Förderung<br />
mit Intelliflow. Die Vakuum-Verlust-<br />
Erkennung innerhalb der Rohrleitung<br />
sorgt mit Hilfe eines außen angebrachten<br />
Strömungsmessers dafür,<br />
dass Leckagen sofort identifiziert<br />
und behoben werden können. Damit<br />
Schüttgut- und Mischtechnik<br />
bietet der Schlauch eine sehr stabile Konstruktion<br />
und Außenwand. Diese ist innen weitgehend glatt,<br />
so dass sich gute Strömungseigenschaften ergeben.<br />
Der Schlauch findet bei Temperaturen zwischen<br />
-35 bis 80 °C, kurzzeitig auch bis 120 °C,<br />
seine Anwendung. Passende Anschluss- und Verbindungselemente<br />
stehen zur Verfügung.<br />
Powtech Halle 1 – 156<br />
chemietechnik.de/1302ct078<br />
erübrigen sich herkömmliche Methoden<br />
wie zeit- und kostenintensive<br />
visuelle Kontrollen entlang von hunderten<br />
Metern Rohrlinien und aufwendige<br />
Reparaturen. Die Rohrleitung<br />
wirkt präventiv gegen angesaugte<br />
Falschluft an Schadstellen,<br />
unterbrochene Materialförderung<br />
oder gar Produktionsausfall. Sie hat<br />
zudem den Vorteil der Wärme-Isolierung<br />
und Energie-Einsparung. Das<br />
getrocknete Material erreicht die<br />
Verarbeitungsmaschine ohne kritische<br />
Abkühlung.<br />
Powtech Halle 4 – 347<br />
chemietechnik.de/1302ct073<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
57
Sicherheitstechnik<br />
Auswahlkriterien für Stickstoff-Schutzgasabdeckungen<br />
Schutz-Element<br />
ProfI-GuIDE<br />
Funktion Branche<br />
Die Autoren:<br />
Anlagenbau ●●●●●<br />
Chemie ●●●●●<br />
Pharma<br />
Ausrüster<br />
●●●●●<br />
Planer ●●●●●<br />
Betreiber<br />
Einkäufer<br />
Manager<br />
●●●●●<br />
Paul Yanisko, Commercial<br />
Technology,<br />
Air Products<br />
Dr. Shiying Zheng,<br />
Research Associate,<br />
Air Products<br />
Joe Dumoit, Regional<br />
Sales Manager,<br />
Cashco<br />
Bill Carlson, Product<br />
Line Manager,<br />
Neutronics<br />
58 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Explosionsgefahr? Stickstoff drüber! In Chemieanlagen<br />
ist die Inertisierung mit Stickstoff eine weit verbreitete<br />
Anwendung. Doch auch bei der Schutzgasabdeckung<br />
schlummern enorme Produktivitätspotenziale. Falsche<br />
Entscheidungen bei der Anlagenauslegung können zu<br />
unnötigen Kosten, Verschwendung von Stickstoff und<br />
auch unnötigen Emissionen führen. Wie überall ist auch<br />
hier Know-how der Schlüssel zur optimalen Lösung.<br />
In Industrien, in denen die Herstellung, Verarbeitung<br />
und Lagerung von brennbaren, entzündbaren oder explosiven<br />
Stoffen im Mittelpunkt steht, hat Sicherheit<br />
oberste Priorität. Schutzgase schirmen diese Produkte<br />
gegen einen Kontakt mit dem Luftsauerstoff ab und eliminieren<br />
damit eines der drei Elemente des Zünddreiecks,<br />
das aus Zündquelle, Brennstoff und Sauerstoff besteht.<br />
Um die Inertisierung eines Lagertanks zu erreichen<br />
gibt es prinzipiell folgende drei Möglichkeiten:<br />
●● Reduzierung des Sauerstoffgehalts im Dampfraum<br />
auf einen kleineren Wert als die Konzentration, die für<br />
eine Verbrennung notwendig ist (als Sauerstoffgrenz-<br />
konzentration (SGK)) bezeichnet;<br />
●● Reduzierung der Brennstoffkonzentration im<br />
Dampfraum auf einen kleineren Wert als die Mindestkonzentration,<br />
die für eine Verbrennung notwendig ist<br />
(untere Explosionsgrenze (UEG) oder Entzündbarkeits-<br />
grenze);<br />
EntSchEIDEr-fActS<br />
Für Planer und Betreiber<br />
●● Die Auswahl der geeigneten Stickstoffversorgung und des Stickstoffregelsystems hängt vom Design der<br />
Anlage und der jeweiligen Anwendung ab.<br />
●● Die Stickstoffeindüsung ist ein weit verbreitetes, einfaches und effizientes Verfahren, mit dem Betriebskosten<br />
eingespart werden können.<br />
●● Auf Basis eines Gutachtens lassen sich die Zielgrößen Sicherheit, Qualität und minimale Investitions- und<br />
Betriebskosten optimieren.<br />
●● Erhöhung der Brennstoffkonzentration im Dampfraum<br />
auf einen höheren Wert als die Höchstkonzentration,<br />
die für eine Verbrennung notwendig ist (obere Explosionsgrenze<br />
(OEG) oder obere Entzündbarkeitsgrenze,<br />
Bild 3).<br />
Welches Inertisierungssystem ist das richtige?<br />
Bei der Neuinstallation eines Stickstoffabdecksystems<br />
oder der Nachrüstung eines vorhandenen Systems müssen<br />
folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden: Die<br />
Art des zu inertisierenden Behältnisses, die erforderlichen<br />
Regeleinrichtungen (druckbasiert oder Sauerstoffkonzentration)<br />
und das zu verwendende Inertgas – zumeist<br />
Stickstoff, obwohl auch Argon oder Kohlendioxid<br />
zum Einsatz kommen können. Bei der Entwicklung eines<br />
neuen oder optimierten Konzepts für eine Abde-<br />
ckung ist zunächst der Behältertyp zu berücksichtigen.<br />
Er legt fest, ob eine Abdeckung benötigt wird, und falls<br />
dies der Fall sein sollte, ob eine Druck- oder eine Konzentrationsregelung<br />
vorzuziehen ist. Der häufigste Tanktyp<br />
ist der Festdachtank (Bild 4). Bei Lagerung von entzündbaren<br />
oder empfindlichen Stoffen in diesen Tanks<br />
wird nachdrücklich eine Stickstoffabdeckung empfohlen.<br />
Ein weniger verbreiteter Tanktyp ist der Schwimmdachtank.<br />
Diese Tanks werden normalerweise nicht abgedeckt,<br />
da hier kein Dampfraum mit entzündbaren<br />
Dämpfen entsteht. Der seltenste Tanktyp ist der Festdachtank<br />
mit Schwimmdecke, auch bekannt als Festdachtank<br />
mit innerer Schwimmdecke. Der Dampfraum<br />
oberhalb der inneren Decke dieser Tanks wird gelegentlich<br />
abgedeckt.<br />
Neben Lagertanks und ähnlichen Anlagenbehältern<br />
kann bei einigen geschlossenen Räumen, die nicht mit<br />
Druck beaufschlagt sind – beispielsweise pneumatische<br />
Förderanlagen, Vorratsbehälter für Pulver oder Stäube<br />
oder Behälter mit kontrollierter Atmosphäre – eine<br />
Gaseindüsung erforderlich sein. Die Stickstoffabdeckung<br />
ist auf jeden Fall in Räumen einzusetzen, die<br />
mangels ausreichender Abdichtung keinen geringfügig<br />
positiven Druck aufrechterhalten können.<br />
Drei Verfahren ein Ziel: die Stickstoffregelung<br />
Für die Stickstoffregelung werden üblicherweise folgen-<br />
de drei Verfahren verwendet:<br />
●● Kontinuierliche Spülung: Systeme mit kontinuierlicher<br />
Spülung nutzen eine konstante Stickstoffzufuhr, die<br />
1: Das Element Stickstoff spielt nicht nur in chemischen<br />
Verbindungen eine wichtige Rolle, sondern auch zum Schutz<br />
von Anlagen und Produktqualität<br />
2: Im Vergleich zu einer kontinuierlichen Spülung kann ein<br />
integrierter Begasungsregler mit Pilotsteuerung zu erheblichen<br />
Betriebseinsparungen führen<br />
3: Beispiel (H 2 ) für eine Entzündbarkeitskurve in Luft bei normalen<br />
atmosphärischen Bedingungen (Temperatur, Luftdruck).<br />
Jenseits der SGK (Sauerstoffgrenzkonzentration) kann keine<br />
Verbrennung stattfinden
Bild: ©agsandrew - Fotolia.com<br />
1<br />
Bild: Cashco<br />
2 3<br />
% Brennstoff in N 2 /O 2 -Gemisch<br />
Bilder: Air Products<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
21%<br />
Entzündbarkeitsdiagramm<br />
OEG in Luft: 75%<br />
Hüllkurve für<br />
Entzündbarkeit<br />
UEG in Luft: 4%<br />
14%<br />
% O in N<br />
2<br />
2<br />
7%<br />
Sicherheitstechnik<br />
„Nase“ oder SGK<br />
0%<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
59
Sicherheitstechnik<br />
4<br />
Dampfraum<br />
Entlüftung<br />
Festdachtank<br />
normalerweise mit N 2 -Begasung<br />
4: Der Behältertyp ist<br />
ein wichtiger Aspekt<br />
bei der Auslegung oder<br />
Nachrüstung eines<br />
Tankbegasungssystems<br />
5: Ein Prozessbehälter,<br />
der über eine Konzentrationsregelunginertisiert<br />
wird, misst den<br />
Sauerstoffgehalt direkt<br />
im Dampfraum und regelt<br />
die Stickstoffeindüsung<br />
in den Tank,<br />
um den gewünschten<br />
Sollwert einzuhalten<br />
60 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
kein Dampfraum<br />
Schwimmdachtank<br />
niemals mit N 2 -Begasung<br />
einfach umzusetzen ist, jedoch zu einem hohen Stickstoffverbrauch<br />
führt. Zudem kann der Stickstoff die<br />
Dämpfe im Dampfraum auswaschen und die Abluftreinigungssysteme<br />
einer Anlage zusätzlich belasten. Auch<br />
kann bei einer zu schnellen Entleerung des Tanks und<br />
einem zu schnellen Absinken des Flüssigkeitspegels Luft<br />
in den Dampfraum eindringen. Trotz dieser Nachteile<br />
wird dieses Verfahren weiterhin verwendet, da es schnell<br />
und einfach zu realisieren ist. Durch einen Ersatz dieser<br />
Methode mit druck- oder konzentrationsgeregelten Ver-<br />
fahren lassen sich Einsparungen erzielen.<br />
●● Druckregelung: Druckregelungssysteme kommen bei<br />
geschlossenen Tanks zum Einsatz, die mit Druck beaufschlagt<br />
werden können. Ein Ventil misst den Druck im<br />
Dampfraum des Tanks und speist Stickstoff in der benötigten<br />
Menge ein. Dies sorgt für eine sichere Gaszusam-<br />
mensetzung im Luftraum.<br />
Entlüftung<br />
●● Konzentrationsregelung: Konzentrationsregelsysteme<br />
mit sehr hoher Effizienz eignen sich für offene Tanks, die<br />
den Druck nicht halten können (Bild 5). Hier ist der<br />
Stickstoffverbrauch wegen der bedarfsabhängigen Stickstoffzufuhr<br />
optimiert. Ein Sauerstoffanalysesystem misst<br />
die tatsächliche Konzentration des Sauerstoffs im<br />
Dampfraum und regelt die Stickstoffzufuhr zum Tank.<br />
Ein wesentlicher Bestandteil des Analysesystems ist die<br />
Probenkonditionierungseinheit. Der Einsatz von integrierten<br />
Sauerstoffsensoren wird durch die Bedingungen<br />
bei den meisten dieser Prozesse ausgeschlossen. Mit einem<br />
entsprechend ausgelegten Probenkonditionierungssystem<br />
kann der Analysator zuverlässige Messungen<br />
bei unterschiedlichsten Prozessbedingungen, einschließlich<br />
Extremwerten bei Druck, Unterdruck und<br />
Temperatur, vornehmen, spezifische Bedingungen durch<br />
grobe Partikel oder hohe Feuchte mit eingeschlossen.<br />
Durch die kontinuierliche Konzentrationsüberwachung<br />
und Druckregelung kann die Stickstoffnutzung<br />
optimiert werden. Dadurch lässt sich Stickstoff einsparen,<br />
wodurch sich die Überwachungs- und Regeleinrichtungen<br />
schnell amortisieren.<br />
Art der Stickstoffversorgung hängt von Bedarf<br />
und Stromkosten ab<br />
Für die Versorgung mit Stickstoff kommen verschiedene<br />
Optionen in Frage: vom Flüssigstickstofftank über Dewar-Behälter,<br />
Tubes, Flaschenbündel oder Einzelflaschen.<br />
Eine weitere Möglichkeit ist die Vor-Ort-Erzeugung<br />
von Stickstoff über eine Kryogen-, Druckwechsel-,<br />
Adsorptions- (PSA) oder Membrananlage. Welche Ver-<br />
mögliche Dämpfe<br />
Flüssigkeit Flüssigkeit Flüssigkeit<br />
Festdachtank mit Schwimmdecke<br />
gelegentlich mit N 2 -Begasung<br />
5<br />
Stickstoffsammelrohr<br />
Probenkonditionierungssystem<br />
Prozessbehälter<br />
Sauerstoffanalysator<br />
/<br />
Regler<br />
sorgungsart gewählt wird, hängt von den spezifischen<br />
Anforderungen an Reinheit, Nutzungsmuster, Volumen,<br />
Transportfähigkeit, Platzbedarf und örtlichen Stromkosten<br />
ab.<br />
Per PSA-Anlage oder Membrangenerator kann Stickstoff<br />
in verschiedenen Reinheiten hergestellt werden.<br />
Dabei gilt: je geringer die Reinheit, desto niedriger die<br />
Anlagenkosten. Die Kosten für den Stickstoff werden<br />
reduziert, wenn eine Reinheit von 94 bis 97,5 % akzeptabel<br />
ist. Das Nutzungsmuster ist ein weiterer wichtiger<br />
Parameter zur Bestimmung des Gasversorgungssystems.<br />
Es gibt drei grundlegende Nutzungsmuster: eine konstante,<br />
erratische oder periodische Zufuhr. Bei einer<br />
konstanten Basislinie ist die Gaszufuhr konstant – beispielsweise<br />
bei der Begasung einer großen Tankfarm.<br />
Hier ist eine Vor-Ort-Erzeugung die geeignete Versorgungsform.<br />
Bei einem erratischen Muster lässt sich der<br />
Gasbedarf schwer einschätzen. Häufig liegt das an Abfüll-<br />
oder Spülprozessen. Für diese Fälle eignet sich die<br />
Versorgung über einen Flüssigstickstofftank, um den<br />
variablen Anforderungen an die Gaszufuhr zu entsprechen.<br />
Bei dem periodischen Nutzungsmuster ist der<br />
Stickstoffverbrauch vorhersagbar, aber nicht konstant.<br />
Die optimale Lösung wäre hier eine Vor-Ort-Erzeugungsanlage<br />
mit Flüssigstickstoff-Back-up. In vielen<br />
Anlagen kommen kombinierte Nutzungsmuster vor.<br />
Das Nutzungsmuster einer Anlage kann durch Messung<br />
des Stickstoffdurchsatzes über einen bestimmten Zeitraum,<br />
in der Regel eine Woche, ermittelt werden.<br />
Fazit: Durch die Stickstoffabdeckung steigen Produktqualität<br />
und Prozesssicherheit. Die Auswahl der<br />
geeigneten Stickstoffversorgung und des Stickstoffregelsystems<br />
hängen vom Design der Anlage und der jeweiligen<br />
Anwendung ab. Die Stickstoffeindüsung ist ein weit<br />
verbreitetes, einfaches und effizientes Verfahren, mit<br />
dem Betriebskosten eingespart werden können. Auf Basis<br />
eines Gutachtens lassen sich die Zielgrößen Sicherheit,<br />
Qualität und minimale Investitions- und Betriebskosten<br />
optimieren. ●<br />
Bilder: Air Products<br />
Powtech Halle 4 – 423<br />
Weitere Bilder sowie erläuternde Informationen<br />
des Herstellers zum Thema Inertisierung gefällig?<br />
Klicken Sie rein auf chemietechnik.de/1301ct605<br />
oder scannen Sie den QR-Code!
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Seite: www.chemietechnik.de/1301ct910 oder<br />
QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
Frequenzumrichter<br />
Neuer Vorfüllmodus<br />
• für Pumpen- und Wasseranlagen<br />
• Vorfüllmodus<br />
• SPS-Funktion integriert<br />
Die Frequenzumrichter-Serie FR-<br />
F700-EC von Mitsubishi Electric<br />
wurden mit Funktionen aufgerüstet,<br />
die auch die speziellen Anforderungen<br />
des Pumpen- und Wassermanagements<br />
erfüllen. Hierzu zählen<br />
ein Vorfüllmodus, eine integrierte<br />
SPS-Funktion, sowie erweiterbare<br />
E/A. Somit werden Leistungsfähigkeit,<br />
Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten<br />
der Serie gesteigert und die<br />
Steuerung optimiert. Gleichzeitig lassen<br />
sich Kosten und Komplexität in<br />
vielen Applikationen reduzieren, da<br />
zusätzliche Komponenten entfallen.<br />
chemietechnik.de/1302ct082<br />
Analysenmessgerät<br />
Effiziente Verwaltung<br />
• modularer Aufbau<br />
• parallele Messungen<br />
• intuitive Benutzerführung<br />
Seven Excellence von Mettler Toledo<br />
ist ein Tischmessgerät für die Messung<br />
von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration<br />
oder Redoxpotenzial<br />
(Oxidation Reduction Potential,<br />
ORP). Das modular aufgebaute<br />
Messinstrument führt parallele Messungen<br />
für einen, zwei oder drei Kanäle<br />
durch. Der 7‘‘-Touchscreen-<br />
Bildschirm und die intuitive Benutzerführung<br />
machen die Gerätebedienung<br />
denkbar einfach. Es eignet sich<br />
für Arbeitsbereiche wie die Qualitätskontrolle<br />
oder in der F&E.<br />
Powtech Halle 1 – 413<br />
chemietechnik.de/1302ct095<br />
Schwingflügel<br />
Good vibrations<br />
• robust<br />
• zuverlässig<br />
• energieeffizient<br />
Der Schwingflügel MBA700 von MBA<br />
Instruments wird zur Grenzstanderfassung<br />
in Schüttgütern eingesetzt.<br />
Er ist kaum 20 mm schmal und dünn<br />
wie ein Messer. Das Gerät zeichnet<br />
sich durch seinen robusten Aufbau,<br />
Zuverlässigkeit und Energieeffizienz<br />
aus. Der Schwingflügel-Geber muss<br />
nur wenige Millimeter in extrem<br />
leichtes Schüttgut eingetaucht werden,<br />
um ein Signal auszusenden.<br />
Dies gilt auch für Materialien wie<br />
Granulat, Pellets oder Kieselsteine,<br />
doch sollte hier die Sensibilität etwas<br />
verringert werden.<br />
Mit unseren Druckreglern lässt sich nicht nur<br />
Ihr Kostendruck regeln.<br />
chemietechnik.de/1302ct157<br />
Messumformer<br />
Neue Features<br />
Produkte<br />
• für den HLK-Bereich<br />
• Messgenauigkeit ±2,5 % rF<br />
• Arbeitsbereich 10 bis 95 % rF<br />
Der speziell für den HLK-Bereich<br />
konzipierte Messumformer EE160<br />
von E+E Elektronik ist eine gute Lösung<br />
für eine kostengünstige, aber<br />
dennoch hochgenaue und zuverlässige<br />
Messung von relativer Luftfeuchte<br />
und Temperatur. Als Feuchte/<br />
Temperatursensor kommt bei dem<br />
System der langzeitstabile, chemisch<br />
resistente Sensor HCT01 zum<br />
Einsatz. In Kombination mit langjähriger<br />
Kalibrationserfahrung ergibt<br />
sich eine Messgenauigkeit von<br />
± 2,5 % rF über den gesamten Arbeitsbereich<br />
von 10 bis 95 % rF.<br />
chemietechnik.de/1302ct081<br />
Profi s an den Armaturen.<br />
Qualität zahlt sich aus.<br />
Wer kosteneffi zient produzieren<br />
will, muss sich auf<br />
erstklassige Qualität verlassen<br />
können. Wir beraten<br />
und beliefern Sie so anforderungsgerecht,<br />
dass sich<br />
Ihre Investition auf Jahre<br />
hinaus rechnet.<br />
www.zuercher.ch
Messtechnik<br />
Lesen von Druckregler-Durchflussdiagrammen (Teil 1)<br />
Richtig interpretiert?<br />
PROFI-GUIDE<br />
Funktion Branche<br />
Anlagenbau ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ● ● ●<br />
Ausrüster ● ●<br />
Planer ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer<br />
Manager<br />
● ● ●<br />
Wird der falsche Druckregler ausgewählt, kann es zu<br />
erheblichen Störung in der Produktion kommen. Die<br />
beste Methode zur Auswahl eines Druckreglers für die<br />
jeweilige Anwendung ist die Untersuchung des Durchflussdiagramms<br />
des Druckreglers, das oft vom Hersteller<br />
zur Verfügung gestellt wird. „Durchflussdiagramm“ ist<br />
eine nicht ganz korrekte Bezeichnung. Diese Kurve ließe<br />
sich ebenso als „Druckdiagramm“ bezeichnen, da ein<br />
Druckregler den Druck und nicht die Strömung regelt.<br />
Bei der Auswahl eines Druckreglers sollte der Anwender<br />
nicht nur nach der richtigen Größe suchen,<br />
sondern nach bestimmten Fähigkeiten, die eine Funktion<br />
der Druckreglerkonstruktion sind. Ein Durchflussdiagramm<br />
illustriert den Umfang der Druckreglerfähigkeiten<br />
auf einen Blick. Wenn das Verständnis da ist, wie<br />
ein Durchflussdiagramm aufgebaut ist, sind sie einfach<br />
und schnell zu lesen.<br />
Eine gängigere Methode zur Auswahl eines Druckreglers<br />
ist leider, sich an dessen Durchflusskoeffizienten<br />
(C v ) zu orientieren. Wenn sich der Systemdurchfluss innerhalb<br />
des Bereichs des Durchflusskoeffizienten C v befindet,<br />
kann das in manchen Fällen bedeuten, dass der<br />
Druckregler die richtige „Größe“ hat. Aber das muss<br />
nicht unbedingt stimmen. Der C v repräsentiert die maximale<br />
Durchflusskapazität des Druckreglers. Bei maximalem<br />
Durchfluss kann ein Druckregler den Druck<br />
nicht mehr regeln. Wenn man Druckraten erwartet, die<br />
den C v des Druckreglers erreichen, ist der Druckregler<br />
wahrscheinlich nicht der richtige für das System.<br />
Diagramm richtig lesen<br />
Der Hauptzweck eines Druckreglers ist, an einer Seite<br />
Der Autor:<br />
Bill Menz,<br />
Manager Field Engineering<br />
Swagelok<br />
62 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
ENTSCHEI<strong>DER</strong>-FACTS<br />
Für Betreiber<br />
des Reglers einen konstanten Druck<br />
beizubehalten, obwohl an der anderen<br />
Seite ein anderer oder fluktuierender<br />
Druck herrscht. Mit einem Druckminderungsregler<br />
wird der Druck an der<br />
Ausgangsseite geregelt, mit einem Vordruckregler<br />
der Druck an der Eingangsseite.<br />
Ein Durchflussdiagramm<br />
● Bei der Auswahl eines Druckreglers für die jeweilige Anwendung sollte die Durchflusskurve und nicht der<br />
Durchflusskoeffizient C v zu Rate gezogen werden.<br />
● Von großer Wichtigkeit ist, sich die für den individuellen Fall passende Kurve anzusehen. Die Kurve muss den<br />
richtigen Druck wiederspiegeln, auf den der Druckregler eingestellt werden soll.<br />
● Darüber hinaus sollten die richtigen Einheiten verwendet werden.<br />
● Beim Systemmedium Gas sind möglicherweise Korrekturen vorzunehmen.<br />
zeigt die Druckreglerleistung im Hinblick<br />
auf Ausgangsdruck (Y-Achse) und DurchDurchflussrate (X-Achse). (X-Achse). Der Durchfluss wird<br />
nicht nicht vom Druckregler Druckregler gesteuert; er wird<br />
nach dem Druckregler von einem Ventil<br />
oder einem Durchflussmesser gesteuert. gesteuert.<br />
Das Diagramm Diagramm zeigt, wie wie ein Druckregler<br />
reagiert, wenn sich sich der Durchfluss im SysSystem ändert.<br />
Die Kurve in Bild 3 beginnt bei 27,5 bar.<br />
Dies ist der ursprüngliche ursprüngliche Einstelldruck für<br />
den den Druckregler. Es wurden keine Einstellungen<br />
am Druckregler vorgenommen,<br />
aber die Kurve zeigt eine Druckänderung<br />
an. Die Einstellung des Druckreglers<br />
passt sich an, um den ursprünglichen<br />
Einstelldruck mit sich<br />
änderndem Durchflusses beizubehalten.<br />
Aber kein Druckregler ist<br />
perfekt. Mit zunehmendem Systemdurchfluss<br />
sinkt der Druck an der<br />
Ausgangsseite des Druckreglers ab –<br />
aber um wie viel?<br />
Zuerst identifiziert der Anwender<br />
beim Lesen eines Durchflussdiagramms<br />
den Durchflussbereich, den<br />
er im System erwarten kann und<br />
markiert diese Durchflüsse auf der<br />
Kurve, lässt sich ablesen, wie sich<br />
der Ausgangsdruck dementsprechend<br />
verändern wird. Ist dieser<br />
Druckbereich akzeptabel für die<br />
Anwendung? Wenn nicht, muss<br />
der Anwender nach einem anderen<br />
Druckregler suchen.<br />
Idealerweise sollte der Druckregler<br />
auf dem geraden Teil der Kur-<br />
1<br />
ve betrieben werden. Dort wird der<br />
Druckregler auch mit starken starken Durchflussänderungen<br />
relativ konstante konstante Drücke Drücke
2 3<br />
Ausgangsdruck (bar)<br />
beibehalten. An den Enden fallen die<br />
Kurven stark ab; dies bedeutet, dass sich<br />
der Druck mit einer geringfügigen<br />
Durchflussänderung dramatisch ändern<br />
wird. Ein Betrieb des Druckreglers in<br />
diesen Bereichen ist zu vermeiden.<br />
Form der Kurven muss ähnlich sein<br />
Jeder Druckregler kann eine fast unendliche<br />
Anzahl von Kurven erzeugen, daher<br />
muss sichergestellt sein, dass die richtige<br />
Kurve betrachtet wird. Für jeden Einstelldruck<br />
gibt eine bestimme Kurve. Bild 3 zeigt<br />
zwei Kurvensätze: einen für einen Einstelldruck<br />
von 27,54 bar und einen für einen<br />
Einstelldruck von 13,7 bar. Es ist hilfreich,<br />
wenn ein Hersteller mehr als einen Kurvensatz<br />
zur Verfügung stellt, und<br />
diese den Bereich von Einstelldrücken,<br />
die mit einem bestimmten<br />
Druckregler möglich sind, repräsentieren.<br />
Wenn der Einstelldruck<br />
zwischen den Kurven liegt, lässt<br />
sich interpolieren: Wichtig ist, dass<br />
die beiden Kurven fast dieselbe<br />
Form haben, sich aber an verschiedenen<br />
Stellen auf dem Diagramm<br />
befinden.<br />
Es gibt eine weitere Variable,<br />
die sich auf die Form<br />
einer Kurve auswirkt: der<br />
Eingangsdruck, das heißt<br />
der Druck, der an der Eingangsseite<br />
in den Regler<br />
gelangt. Die zwei Kurvensätze<br />
in Bild 3 bestehen<br />
aus jeweils drei Kurven, die<br />
einen Bereich von Eingangsdrücken<br />
darstellen.<br />
Zum Bestimmen der richti- richti-<br />
Druckregelbereiche<br />
Stickstoffdurchfluss l/min im Normalzustand<br />
Messtechnik<br />
1: Dombelastete Druckregler mit externer Rückmeldung<br />
erzeugen die breitesten horizontalen Abschnitte für einen völlig<br />
mechanischen Druckregler<br />
2: Das Lesen von Durchflussdiagrammen und die richtige Interpretation<br />
– Vorausetzung für eine störungsfreie Produktion<br />
3: Hersteller bieten oft mehrere Durchflusskurven für einen<br />
Druckregler bei unterschiedlichen Eingangsdrücken, um verschiedene<br />
Betriebsmöglichkeiten des Druckreglers zu zeigen<br />
gen Kurve sind der Einstelldruck, der Eingangsdruck<br />
und der Durchflussbereich ausschlaggebend.<br />
Druckangaben erfolgen meist in bar oder psig.<br />
Durchflussraten variieren je nach Systemmedium. Deshalb<br />
muss überprüft werden, ob der Druckregler für den<br />
Einsatz mit Flüssigkeiten oder mit Gasen zugelassen ist.<br />
Der Durchfluss von Flüssigkeiten wird in der Regel als<br />
l/min angegeben, während Gasdurchfluss als Liter pro<br />
Minute im Normzustand angegeben wird.<br />
Die Kurven werden in der Regel unter Verwendung<br />
von Luft oder Stickstoff (für Gasanwendungen) oder<br />
Wasser (für Flüssigkeitsanwendungen) erstellt. Falls das<br />
Systemmedium ein Gas ist, muss die Kurve des Herstellers<br />
eventuell entsprechend angepasst werden. Gase<br />
verdichten sich unterschiedlich, daher muss die Volumeneinheiten<br />
des Durchflussdiagramms eventuell mit<br />
einem Gaskorrekturfaktor multipliziert werden. Beispielsweise<br />
ist der Korrekturfaktor für Wasserstoff 3,8.<br />
Dies bedeutet, dass 3,8 Wasserstoffmoleküle dasselbe<br />
Volumen haben wie ein Luftmolekül. Der Punkt auf einer<br />
Durchflusskurve, der ein Luftdurchflussvolumen<br />
von 2.831 l/min im Normzustand anzeigt, zeigt einen<br />
vergleichbaren Wasserstoffdurchfluss von 10.760 l/min<br />
im Normzustand an. Die Kurve bleibt gleich, aber die<br />
Durchflussskalierung ändert sich. Bei Flüssigkeiten ist<br />
der Durchflussunterschied zwischen Wasser und anderen<br />
Medien aufgrund der Inkompressibilität nicht so<br />
deutlich.<br />
Regeldifferenz und andere Feinheiten<br />
Empfehlenswert ist es, am flachsten bzw. horizontalsten<br />
Teil einer Durchflusskurve zu operieren. Die ideale<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
63
Messtechnik<br />
Auf dieser für einen<br />
Druckminderungsregler<br />
typischen Durchflusskurve<br />
sind mehrere<br />
Phänome zu sehen: der<br />
ideale Betriebsbereich,<br />
die Regeldifferenz, der<br />
gesperrte Durchflussbereich,<br />
Sitz-Lastabfall<br />
oder Lock-up und der<br />
Durchflusskoeffizient C v<br />
4<br />
Ausgangsdruck (bar)<br />
64 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Sitz-Lastabfall / Absperrdruck (Lock-Up)<br />
Idealer Betriebsbereich<br />
Durchfluss<br />
Durchflusskurve wäre in der Tat eine Gerade. Allerdings<br />
kann aufgrund der inneren Komponenten von Druckreglern<br />
kein Druckregler eine vollkommene Gerade für<br />
den gesamten Druckbereich erzeugen. Bei einem federbelasteten<br />
Druckregler führen längere Federn zu Durchflusskurven<br />
mit breiteren horizontalen Abschnitten.<br />
Dombelastete Druckregler, bei denen statt einer Feder<br />
ein eingeschlossenes Gasvolumen verwendet wird, erzeugen<br />
noch breitere horizontale Abschnitte. Elektrisch<br />
kontrollierte luftgesteuerte Druckregler sowie dombe-<br />
lastete Druckregler mit externer Rückmeldung erzeugen<br />
die breitesten horizontalen Abschnitte.<br />
Eine Durchflusskurve besteht in der Regel aus drei<br />
Teilen: ein relativ gerader Teil in der Mitte, ein steiler<br />
Abfall ganz links und ein steiler Abfall ganz rechts. Der<br />
flache Teil in der Mitte ist nicht vollkommen. Er neigt<br />
sich in der Regel nach unten und dies wird als Regeldifferenz<br />
(Drop) bezeichnet. Mit zunehmendem Durchfluss<br />
fällt der Druck je nach Druckreglerkonstruktion<br />
leicht oder stark ab. Während dieser Druckabfall am<br />
flachen Teil der Kurve unauffällig ist, ist er an den Enden<br />
der Kurve recht steil.<br />
Die rechte Seite zeigt den gedrosselten Durchfluss an.<br />
Im Flussbereich, der in Bild 4 zu sehen ist, beginnt der<br />
Druck bei 3.964 l/min im Normzustand steil abzufallen.<br />
Bei rund 4.247 l/min im Normzustand fällt der Druck<br />
letztendlich auf 0 ab. An dieser Stelle wurde die Druckregelungskapazität<br />
des Druckreglers von dem Durchflussbedarf<br />
übertroffen. Hier ist der Druckregler weit<br />
offen und regelt den Druck nicht mehr. Er wurde von<br />
einer Vorrichtung zur Druckregulierung zu einem offenen<br />
Durchlass. Bei einer Erhöhung des Durchflusses bis<br />
zu diesem Punkt oder darüber hinaus wird der Druckregler<br />
wirkungslos. Aufgrund des starken Druckabfalls<br />
Luftdurchfluss (l/min im Normzustand)<br />
„Zum Bestimmen der richtigen Kurve sind der Einstelldruck,<br />
der Eingangsdruck und der Durchflussbereich<br />
ausschlaggebend“<br />
Regeldifferenz<br />
Gesperrter<br />
Flussbereich<br />
Cv sollte ein Druckregler nicht im gedrosselten Durchflussbereich<br />
(Durchflussgrenzbereich) betrieben werden.<br />
Der Durchflusskoeffizient C v ist an dem Punkt gemessen,<br />
an dem der Durchfluss zum Druckregler ganz<br />
gedrosselt ist, sodass der Wert nicht besonders hilfreich<br />
ist. Es ist ein schlechter Indikator der Gesamtleistung<br />
des Druckreglers. An der linken Seite der Druckreglerkurve<br />
(Bild 4), wo anfänglich ein steiler Druckabfall zu<br />
sehen ist, kommt es zum Druckabfall bei der Öffnung<br />
(Seat load drop). Wird die Kurve von links nach rechts<br />
gelesen, muss der Betrachter sich vorstellen,<br />
dass sich das System in einem durchflusslosen<br />
Zustand befindet. Der Druckregler ist auf<br />
einen bestimmten Druck eingestellt, aber es<br />
ist kein Durchfluss vorhanden. Wird ein<br />
nachgelagertes Ventil langsam geöffnet, beginnt<br />
Gas zu strömen. Es kommt sofort zu<br />
einem starken Druckabfall, da der Druckregler den<br />
Druck an dieser Stelle nicht aufrecht erhalten kann. Falls<br />
der Druckregler an diesem steilen Abfall der Kurve betrieben<br />
wird, kommt es eventuell zu ratternden oder zischenden<br />
Geräuschen, wenn der Druckregler abwechselnd<br />
mit und ohne Durchfluss betrieben wird.<br />
Wird die Kurve von rechts nach links angesehen,<br />
bedeutet das, dass das System auf dem flachen Teil der<br />
Kurve betrieben wird. Wird ein nachgelagertes Ventil<br />
langsam geschlossen, sinkt der Durchfluss fast auf 0. Auf<br />
der Kurve nach oben wird ein Zustand ohne Durchfluss<br />
erreicht; der Druckregler hat Schwierigkeiten, den eingestellten<br />
Druck beizubehalten. Ab hier sind möglicherweise<br />
Rattergeräusche zu hören. Irgendwann schnappt<br />
der Druckregler zu, und der Durchfluss wird angehalten.<br />
Das wird Absperrdruck (Lock-up) genannt. ●<br />
Lesen Sie im zweiten Teil des Beitrages in der CHEMIE TECHNIK März-Ausgabe<br />
alles Wissenswerte über das Thema Hysterese und darüber, welche Schluss -<br />
folgerungen sich aus den Durchflusskurven ziehen lassen.<br />
Einen Link zur Technischen Regel VDI/VDE 2173<br />
zur Ermittlung des C v -Wertes sowie zu den Druckreglern<br />
des Herstellers gefällig? Klicken Sie sich<br />
rein auf www.chemietechnik.de/1301ct606 – oder<br />
QR-Code scannen!<br />
Bilder: Swagelok
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Seite: www.chemietechnik.de/1301ct906 oder<br />
QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
Leckanzeigegerät<br />
Tanküberwachung mit<br />
hoher Sicherheit<br />
• Kunststoffgehäuse<br />
• Gleichstrommotor<br />
• Betriebsdruck -400 mbar<br />
Der Leckanzeiger Hochvakuum Eurovac HV von<br />
Afriso ist ein Leckdetektor für Unterdruck nach EN<br />
13160 der Klasse I. Mit diesem Gerät können Havariefälle<br />
nahezu ausgeschlossen werden, wenn<br />
es ordnungsgemäß installiert, betrieben und gewartet<br />
wird. Das Gerät eignet sich zur Anzeige von<br />
Lecks an drucklos betriebenen Behältern zur ober-<br />
und unterirdischen Lagerung von wassergefährdenden<br />
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55<br />
°C (ehemals Gefahrklasse AIII), die nicht dickflüssig<br />
werden und keine Feststoffe abscheiden. Der<br />
Leckanzeiger enthält in einem kompakten Kunststoffgehäuse<br />
alle Anzeige- und Bedienelemente,<br />
Vakuumpumpe, Drucksensor, Filter sowie<br />
Schlauchanschlüsse für die Verbindung mit dem<br />
Tanküberwachungsraum, in dem ein Betriebsdruck<br />
Schutzhandschuh<br />
Qualitätsschwankungen ausgeschlossen<br />
• aus synthetischem Leder<br />
• atmungsaktives Funktionstextil<br />
• Sommer- und Wintervariante<br />
Der Arbeitshandschuh Secugrip CS<br />
der Eigenmarke Work von Kroschke<br />
wird aus synthetischem Leder hergestellt.<br />
Im Unterschied zu Schutzhandschuhen<br />
aus Echtleder wird bei diesem<br />
Produkt auf die schadstoffbelastende<br />
Chromgerbung verzichtet.<br />
Auch das atmungsaktive Funktionstextil<br />
auf dem Handrücken weist kei-<br />
von etwa -400 mbar gehalten<br />
wird. Bei der neuen<br />
Version wird die Vakuumpumpe<br />
durch einen sparsameren<br />
Gleichstrommotor<br />
mit hohem Anlaufmoment<br />
angetrieben (Energieeffizienzklasse<br />
A++). Im Gehäuseinnern<br />
befindet sich<br />
eine Anzeige der Pumpenlaufzeit;<br />
der Geräuschpegel wurde abgesenkt. Das<br />
Gerät verfügt über einen optischen und akustischen<br />
Alarm mit Quittiertaste, eine Prüftaste zur<br />
Funktionsprüfung der Anzeigen, eine Service-Anzeige<br />
für die jährliche Wartung und einen Schaltausgang<br />
für die Gebäudeleittechnik. Eine neue<br />
ne schadstoffbelasteten Farbpigmente<br />
auf. Die Variantenvielfalt des<br />
Handschuhs erlaubt den Einsatz als<br />
Multifunktionshandschuh: Neben der<br />
Auswahl zwischen diversen Größen<br />
ist er als Sommer- und Wintervariante<br />
erhältlich. Der Handschuh ist<br />
waschbar und wurde neben der PSA<br />
Kat II Prüfung auch auf Waschbarkeit<br />
geprüft. Er ist bis zur Verschleißgrenze<br />
nutzbar.<br />
chemietechnik.de/1302ct085<br />
Energieketten-Führung<br />
Hallenkrane am Band<br />
• schnell zu installieren<br />
• für seitliche Montage<br />
• verschiedene Ausführungen<br />
Die Führungsrinne Guidefast von<br />
Igus wurde für die seitliche Montage<br />
an gängigen Trägern von Industrie-<br />
und Hallenkranen entwickelt. Der<br />
Montageaufwand sinkt bis zu 80 %.<br />
Die günstige Führungsrinne gibt es<br />
in verschiedenen Werkstoffen.<br />
chemietechnik.de/1302ct087<br />
• konfiguriert Messumformer<br />
• für Android<br />
• frei verfügbar<br />
Produkte<br />
Schlauchverbindungstechnik sorgt für eine dauerhafte<br />
Dichtheit. Der Sinterkunststofffilter im Kondensatgefäß<br />
zeigt den Verschmutzungsgrad an.<br />
Powtech Halle 6 – 211<br />
chemietechnik.de/1302ct098<br />
Messumformer-App<br />
Handliche Übersicht<br />
Mit der App für Smartphones und<br />
Tablet-PCs von Wago können Messumformer<br />
der Serie 857 noch komfortabler<br />
konfiguriert werden. So<br />
leistungsfähig wie die Konfiguration<br />
via FDT/DTM: Die verfügare App<br />
Jumpflex-to-go bringt<br />
den gesamten<br />
Funktionsumfang<br />
einer PCbasiertenSoftware<br />
auf mobile<br />
Endgeräte mit Android-Betriebssystem.<br />
Mit der Anwendung,<br />
die ab Android-<br />
Version 2.3 erhältlich<br />
ist, lassen sich Ein- und Ausgangsparameter<br />
verändern sowie Einstellungen<br />
und Messwerte anzeigen.<br />
chemietechnik.de/1302ct022<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
65
Thermische Verahrenstechnik<br />
1<br />
Der Autor:<br />
Wolfgang Striewe,<br />
Technischer Vertrieb<br />
Industrial Solar<br />
Anteil der Industrie am gesamten<br />
Endenergieverbrauch in der EU: 28 %<br />
66 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Solare Prozesswärme in der chemischen Industrie<br />
Potenzial vorhanden<br />
PROFI-GUIDE<br />
Funktion Branche<br />
2<br />
Anlagenbau ● ●<br />
Chemie<br />
Pharma<br />
● ● ●<br />
Ausrüster ● ●<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer ●<br />
Manager ●<br />
ENTSCHEI<strong>DER</strong>-FACTS<br />
Für Betreiber<br />
Thermische Energie macht rund 70 % des Endenergieverbrauchs<br />
in der europäischen Industrie aus. In Folge<br />
von steigenden Energiepreisen ist diese industrielle Prozesswärme<br />
in den Fokus der Solarwirtschaft gelangt.<br />
Zum Einsatz kommen je nach Temperaturniveau verschiedene<br />
Kollektortechnologien. Mit thermischen Solarkollektoren<br />
kann thermische Energie von 50 bis<br />
550 °C erreicht werden. Flach- und Vakuumröhrenkollektoren<br />
können bis zu einer Temperatur von ~130 °C<br />
bei einem wirtschaftlich sinnvollen Wirkungsgrad betrieben<br />
werden. Für Temperaturen über 130 °C werden<br />
konzentrierende Kollektorsysteme wie Fresnel-Kollektoren<br />
und Parabolrinnen-Kollektoren eingesetzt. Aufgrund<br />
seines hohen Flächenwirkungsgrades, seiner besonders<br />
guten Eignung für eine Montage auf Flachdächern<br />
und den geringen Betriebskosten ist der Fresnel-<br />
Kollektor für Prozesswärme besonders geeignet.<br />
Davon Thermische<br />
Energie: 70,5 %<br />
Im Temperaturbereich<br />
thermischer<br />
Sonnenkollektoren:<br />
< 500 ˚C: 57 %<br />
● Für eine typische solare Prozesswärmeanlage mit dem Fresnel-Kollektor wird eine<br />
IRR von 5 bis 30 % erreicht.<br />
● Aufgrund des hohen Flächennutzungsgrads kann der Fresnel-Kollektor insbesondere<br />
bei begrenzter Flächenverfügbarkeit eingesetzt werden.<br />
● Die lange Einsatzdauer der Komponenten sowie auch die Integration in bestehende<br />
Systeme ermöglichen den wirtschaftlichen Einsatz solarer Prozesswärmeanlagen.<br />
Einsatz je nach Standort und Anwendung<br />
Die Hauptargumente für den Einsatz von thermischen<br />
Solarkollektoren für industrielle Anwendungen sind je<br />
nach Anwendung und Standort:<br />
● Energie und Kosten sparen. Die solar bereitgestellte<br />
Energie reduziert die Kosten für fossile Energieträger. Je<br />
nach Anwendung und Standort kann mit einer Solaranlage<br />
eine attraktive Rendite erzielt werden. Darüber hinaus<br />
macht sich das Unternehmen unabhängiger von<br />
steigenden Energiepreisen.<br />
● Umwelt schonen. Durch das Einsparen fossiler Energieträger<br />
werden CO 2 -Emissionen reduziert.<br />
● Saubere Luft. Wenn vor Ort weniger fossile Energieträger<br />
wie beispielsweise Heizöl verbrannt werden, gelangen<br />
weniger Schadstoffe in die Luft.<br />
Ein großer Anteil der anfallenden Prozesswärme befindet<br />
sich in einem Temperaturbereich, der mit thermi-
3<br />
Primärspiegel<br />
schen Solarkollektoren erreicht werden kann. Das theoretische<br />
Potenzial solarer Prozesswärme in der EU lässt<br />
sich mit konkreten Zahlen belegen. Dieses Energieeinsparpotenzial<br />
bedeutet gleichzeitig ein großes Kosteneinsparpotenzial.<br />
Die solarthermische Energieerzeugung<br />
kann in unterschiedlichsten Industriesektoren und<br />
Anwendungen wirtschaftlich eingesetzt werden.<br />
Die Voraussetzungen sind geschaffen<br />
Das Potenzial ist da, die technischen Voraussetzungen<br />
sind geschaffen, für die verschiedenen Temperaturniveaus<br />
gibt es etablierte Anbieter mit technisch ausgereif-<br />
Sekundärspiegel Absorberrohr<br />
fluxoph<br />
obEbEsc<br />
hichtung<br />
Wir machen komplexe Sachverhalte regelmäßig transpa-<br />
rent. Zuverlässig und mit höchster redaktioneller Qualität.<br />
Deshalb sind die Fachzeitschriften und Online-Portale von<br />
<strong>Hüthig</strong> in vielen Bereichen von Wirtschaft und<br />
Industrie absolut unverzichtbar für Fach- und Führungskräfte.<br />
Thermische Verahrenstechnik<br />
Sekundärspiegel<br />
ten Lösungen, und attraktive Renditen können erzielt<br />
werden. Trotzdem ist bisher keine starke Marktdurchdringung<br />
erreicht worden. Von den 245.1 GWth installierter<br />
Leistung solarthermischer Kollektoren weltweit<br />
sind weniger als 1 % in industrielle Prozesse integriert.<br />
Das liegt an den folgenden Herausforderungen, de-<br />
nen sich die Solarbranche stellen muss:<br />
●● Bewusstsein: In Privathaushalten ist die Installation<br />
von thermischen Solaranlagen zur Warmwasserbereitung<br />
und Heizungsunterstützung Standard. Für industrielle<br />
Anwendungen gibt es bisher wenige Beispielanlagen.<br />
Das Energieeinsparpotenzial wird zunächst in an-<br />
<strong>Hüthig</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Im Weiher 10<br />
D-69121 Heidelberg<br />
Tel. +49(0)6221/489-0<br />
Fax +49(0)6221/489-279<br />
www.huethig.de<br />
hue_image_woerter_86x126mm.indd 3 20.04.2011 15:58:58<br />
©BHT2012-054<br />
Innovation – Erfahrung – Perfektion<br />
1: Fresnel-Kollektorinstallation,<br />
mit der thermisch<br />
angetriebene<br />
Kälte für die Kühlung<br />
eines Fußballstadions<br />
bereitgestellt wird<br />
(Doha, Katar)<br />
Bild: Industrial Solar<br />
2: Anteiliger Endenergieverbrauch<br />
in der Industrie,<br />
Anteil thermischer<br />
Energie und Anteil<br />
im Temperaturbereich<br />
thermischer<br />
Kollektoren<br />
Bild: C.Lauterbach(2011),<br />
Vannoni(2008)<br />
3: Direkte Solarstrahlung<br />
wird über Spiegel<br />
auf ein Absorberrohr<br />
konzentriert<br />
Bild: Industrial Solar<br />
Flexible, präzise<br />
Gasdosierung für<br />
Ihren Prozess<br />
Bereiche von 0,05 mln/min bis 11.000 m 3 n/h<br />
Frei programmierbare Messbereiche und<br />
Gasarten (Multi-Gas / Multi-Range)<br />
Wartungsfrei und zuverlässig (fit&forget)<br />
D-Nord: www.bronkhorst-maettig.de<br />
D-Süd: www.wagner-msr.de - www.bronkhorst.com<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
67
Thermische Verahrenstechnik<br />
Die Grafik zeigt das<br />
Verhältnis der benötigten<br />
Fläche bei gleicher<br />
Leistung. Das VerhältnisParabolrinnen-Kollektorfläche<br />
zu Fresnel-Kollektor<br />
beträgt<br />
ca. 1,5<br />
68 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Bild: Industrial Solar<br />
deren Bereichen<br />
gesucht.<br />
Das Potenzial der<br />
thermischen Solarenergie<br />
zu nutzen, mit der in industriellen<br />
Anlagen Nutzungsgra-<br />
de von über 60 % erreicht werden können, wird häufig<br />
nicht erwogen.<br />
● Investitionskosten: Industrielle Betriebe entscheiden<br />
sich für Investitionen, bei denen es um das Kerngeschäft<br />
geht. Das Binden von Kapital über mehrere Jahre für<br />
periphere Investitionen wird gescheut. Eine naheliegende<br />
Lösung bietet hier das „Contracting“. Dieses bietet<br />
Investoren sichere und rentable Anlagemöglichkeiten<br />
und führt dazu, dass das Unternehmen ab Inbetriebnahme<br />
der Solaranlage Wärme für einen geringeren Preis<br />
beziehen kann.<br />
● Platzbedarf: Für die Nutzung von thermischer Solarenergie<br />
wird Fläche benötigt, um Kollektoren<br />
zur Sonne exponieren zu können. Solarthermische<br />
Energie und insbesondere Fresnel-<br />
Kollektorinstallationen sind zu favorisieren,<br />
da mit diesen Technologien im Vergleich eine<br />
hohe Flächennutzung erzielt wird.<br />
● Energiepreise: Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit<br />
der Anlage sind die Preise des verwendeten<br />
Energieträgers. In Gebieten, in denen fossile Energieträger<br />
weniger stark subventioniert werden, kann mit<br />
Solarenergie eine noch höhere Rendite erzielt werden.<br />
● Fokus auf Amortisation statt Rendite: Wenn die Rendite<br />
anstatt der Amortisationszeit für die Entscheidung<br />
zu einer Investition zugrunde gelegt wird, schneidet eine<br />
Solarthermieanlage aufgrund der langen Einsatzdauer<br />
von 20 Jahren in vielen Fällen besser ab als bei dem<br />
ersten Blick auf die Amortisationszeit.<br />
Potenzial für solare Prozesswärme<br />
in der chemischen Industrie<br />
Mit insgesamt 202 Mio. MWh/a werden in der chemischen<br />
Industrie rund 8 % des gesamten Energiebedarfs<br />
in Deutschlands aufgewendet. Ein großer Teil wird in<br />
Form von thermischer Energie benötigt.<br />
Knapp 43 % der thermischen Prozesse laufen im<br />
Bereich unter 500 °C ab und lassen sich also prinzipiell<br />
mit thermischen Solarkollektoren betreiben. Damit offenbart<br />
sich ein sehr großes Energieeinspar-Potenzial in<br />
der Chemiebranche.<br />
An vielen Standorten werden beispielsweise für Destillationsprozesse<br />
oder für die Herstellung von Polypropylen<br />
Dampfnetze betrieben. Aufgrund der Möglichkeit<br />
einer Direktverdampfung sind Fresnel-Kollektoren für<br />
die Integration in diese Prozesse besonders gut geeignet.<br />
Bei Fresnel-Kollektoren handelt es sich um linienkon-<br />
zentrierende Solarkollektoren, die thermische Energie<br />
im Bereich von 100 bis 400 °C erzeugen. Die Kollektorsysteme<br />
lassen sich modular über einen weiten Leistungsbereich<br />
einsetzen. So lassen sie sich flexibel an bestehende<br />
Dampfnetze ankoppeln.<br />
Eingesetzt werden die Kollektoren für sehr unterschiedliche<br />
Prozesse. Zuletzt wurde eine Anlage eingeweiht,<br />
mit der ein Trocknungsofen in einer Lackieranlage<br />
für die Autoindustrie beheizt wird. Solche Lackieranlagen<br />
bieten ein enormes Energieeinspar-Potenzial. Eine<br />
Anlage verbraucht in etwa so viel Energie wie eine<br />
Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern. Für eine Maximalleistung<br />
von beispielsweise. 10 MW wird eine Fläche von<br />
rund 20.000 m² benötigt, für Parabolrinnen-Kollektoren<br />
rund das Eineinhalbfache.<br />
Langfristige Investitionen wie die für Gebäude oder<br />
Energiesysteme weisen ein sehr geringes Risikoprofil<br />
auf. Gleichzeitig kann mit ihnen über einen sehr langen<br />
Zeitraum Geld eingespart bzw. gewonnen werden. Für<br />
eine sinnvolle Evaluation solcher Investitionen ist gleichzeitig<br />
die Betrachtung über einen langen Zeitraum notwendig.<br />
Für gewöhnlich wird die interne Verzinsung<br />
(IRR) als Kriterium für das Abschätzen der ökonomischen<br />
Machbarkeit einer Investition herangezogen.<br />
Für eine typische solare Prozesswärmeanlage mit<br />
dem Fresnel-Kollektor von Industrial Solar wird je nach<br />
angenommener Energiepreissteigerungsrate und Einsatzdauer<br />
der Anlage eine IRR von 5 bis 30 % erreicht.<br />
„Das Potenzial für die Nutzung thermischer Energie<br />
ist vorhanden, die technischen Möglichkeiten hierfür<br />
sind geschaffen“<br />
Die Amortisationszeit liegt zwischen vier und zehn Jahren.<br />
Danach weist die Anlage geringe Betriebskosten auf,<br />
und der solare Wärmepreis liegt je nach Anlagengröße<br />
unter 0,01 Euro/kWh. Je nach Leistungsumfang und der<br />
absoluten Anlagengröße wird der Fresnel-Kollektor ab<br />
500 Euro/kW angeboten. Um einen Marktanreiz zu<br />
schaffen, werden die Investitionskosten für solare Prozesswärmeanlagen<br />
in Deutschland seit August 2012 zu<br />
50 % von der Bundesregierung bezuschusst. Dadurch<br />
wird die Wirtschaftlichkeit stark erhöht.<br />
Fazit: Für das Potenzial in der chemischen Industrie<br />
ist hinsichtlich des Temperaturniveaus und der Möglichkeit<br />
der direkten Dampferzeugung die Fresnel-Kollektor-Technologie<br />
besonders geeignet. Aufgrund des hohen<br />
Flächennutzungsgrads kann der Kollektor insbesondere<br />
bei begrenzter Flächenverfügbarkeit eingesetzt<br />
werden. Durch die niedrige Windlast und das geringe<br />
Gewicht kann er nicht nur auf dem Boden, sondern<br />
auch auf Dächern sehr gut installiert werden. Auch die<br />
lange Lebensdauer der Komponenten und die einfache<br />
Integration in bestehende Systeme ermöglichen geringe<br />
Betriebskosten und den wirtschaftlichen Einsatz derartiger<br />
solarer Prozesswärmeanlagen. ●<br />
Weitere Bilder sowie nützliche Links zum Beitrag<br />
gefällig? Klicken Sie sich rein auf www.chemietechnik.de/1301ct607<br />
– oder QR-Code scannen!
Wir machen<br />
Fachinformationen mobil!<br />
Fakten für Entscheider – jetzt noch einfacher:<br />
Mehr Informationen, Links zu Autoren und Firmen erhalten<br />
Sie jetzt noch einfacher per Kurzlink am Ende der Beiträge<br />
oder aber per QR-Code-Scan. Probieren Sie’s aus!<br />
Einfach per Handy oder iPad zu mehr Informationen:<br />
QR-Scan-App* starten und QR-Code scannen.<br />
*Scan-Apps fi nden Sie im Apple App-Store, bei Google Play oder im Nokia-Store<br />
Bild:Ricktop/fotolia.com<br />
<strong>Hüthig</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Im Weiher 10<br />
69121 Heidelberg<br />
Tel. 0 62 21/489-0<br />
Fax: 0 62 21/489-279<br />
www.huethig.de
Dosiertechnik<br />
1<br />
Die Autorin:<br />
Tina Walsweer,<br />
Redaktion<br />
70 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Zentralversorgung für flüssige Chemikalien aus Behältern<br />
Auf den Punkt abgefüllt<br />
ProfI-GuIDe<br />
Funktion Branche<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie<br />
Pharma<br />
●<br />
Ausrüster ● ● ●<br />
Planer ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer ●<br />
Manager ● ● ●<br />
entscheIDer-fActs<br />
Im Alltag mehr Zeit für die wichtigen Dinge! Bei einem<br />
weltweit führenden Dienstleister für chemische und<br />
biologische Laboranalytik ist die manuelle Befüllung<br />
von Glasflaschen mit den Chemikalien, die für die Laboranlagen<br />
nötig sind, nicht mehr auf der Tagesordnung.<br />
Eine vollautomatische Zentralversorgung von<br />
Logitex Reinstmedientechnik hat den über mehrere<br />
Für Betreiber und Anlagenbauer<br />
● Die Chemikalien-Zentralversorgung ermöglicht die vollautomatische Verteilung<br />
von Chemikalien und bietet manuelle Abfüllanlagen.<br />
● Die Anlage überwacht den Füllstand in den Vorlage- und den Abfüllbehältern.<br />
● Der Betrieb der Versorgungsanlage ist in explosionsgefährdeten und anspruchsvollen<br />
Umgebungen möglich.<br />
● Die Inbetriebnahme lässt sich in den Betriebsablauf integrieren.<br />
Stockwerke laufenden Transport der Chemikalienbehälter,<br />
die händische Eindosierung in die Maschine sowie<br />
die Ausbreitung der Dämpfe im Raum ersetzt. Der Anlagenbauer<br />
und der Anwender haben in enger Zusammenarbeit<br />
die Versorgungsanlage für die produktionsspezifischen<br />
Anforderungen im Produktionsbetrieb und<br />
die Optimierung der bestehenden Prozesse ausgelegt.
2<br />
3<br />
Dabei erfüllt sie die aktuell geltenden Richtlinien<br />
hinsichtlich Sicherheit und Technik.<br />
Die komplette Versorgungsanlage besteht aus<br />
drei Hauptkomponenten: der Chemikalien-Zentralversorgung<br />
mit großen Vorlagebehältern (400<br />
bis 1.600 l) zur kontinuierlichen Bereitstellung von<br />
acht verschiedenen Chemikalien, der Maschinenversorgung<br />
mit sechs kleineren Vorlagebehältern<br />
(3 l) für die Versorgung der Produktionsanlagen<br />
im Labor sowie dem Abfall-Entsorgungssystem,<br />
das der Sammlung von flüssigen Chemikalienrückständen<br />
aus der Produktion und anschließender<br />
Förderung in Entsorgungsbehälter dient. Zusätzlich<br />
beliefert die Zentralversorgung zwei manuelle<br />
Abfüllstationen direkt mit dem spezifizierten<br />
Medium.<br />
Sicherer Betrieb durch<br />
geschlossenes System<br />
Die Chemikalien-Zentralversorgung und die Abfallbehälter<br />
zur Entsorgung befinden sich in einem<br />
klimatisierten Gefahrstoff-Container außerhalb<br />
des Betriebsgebäudes. Dieser kommt aufgrund<br />
der zum Teil leichtentzündlichen, gesundheitsschädlichen<br />
sowie umweltgefährdenden<br />
1: Die Chemikalienbehälter befinden sich in einem<br />
Container außerhalb des Betriebsgebäudes<br />
2: Die Abfüllung wird vollautomatisch gesteuert und<br />
erfolgt entweder direkt in den Prozess oder per Hand an<br />
einer Entnahmestation<br />
3: Der Chemikaliencontainer kann auch in explosions-<br />
gefährdeten Bereichen aufgestellt werden<br />
Chemikalien zum Einsatz, um einen sicheren<br />
Schutz von Personen und Umwelt zu ermöglichen.<br />
Die Chemikalien-Vorlagebehälter sind stationär<br />
installiert, der Füllstand eines jeden Behälters wird<br />
kontinuierlich überwacht. Die Versorgung mit<br />
den Chemikalien erfolgt mithilfe einer Membranpumpe,<br />
die auch zur Wiederbefüllung der Vorlagebehälter<br />
zum Einsatz kommt. Ist der minimale<br />
Füllstand in einem Behälter erreicht, erfolgt eine<br />
Meldung am Display und der Bediener kann die<br />
Behälter über wenige Tastendrücke aus einem<br />
entsprechenden Transportgebinde auffüllen. Das<br />
Freispülen der Anschlussleitungen erfolgt automatisch.<br />
Die Instrumentierung zur Steuerung der<br />
Versorgungsabläufe sowie die Versorgungsleitun-<br />
Bilder: Logitex<br />
... moving liquids<br />
PUMPENTECHNIK<br />
HYGIENISCHE<br />
BAUFORM<br />
SCHONENDE FÖR<strong>DER</strong>UNG<br />
CIP-SIP-FÄHIG<br />
Mit den selbstansaugenden, pulsationarmenExzenterschneckenund<br />
Impellerpumpen profitieren<br />
Sie von einer besonderes schonenden<br />
Förderung von empfindlichen,<br />
feststoffbeladenen, hochviskosen<br />
Produkten.<br />
Unsere Pumpen werden individuell<br />
nach den Bedürfnissen unserer<br />
Kunden ausgelegt.<br />
www.kiesel-online.de<br />
Wannenäckerstr. 20<br />
74078 Heilbronn<br />
T: 07131 / 28 25 0<br />
F: 07131 / 28 25 50<br />
info@kiesel-online.de
Dosiertechnik<br />
4<br />
5<br />
4: Der Prozess lässt<br />
sich digital steuern<br />
und gibt automatisch<br />
Meldungen an den<br />
Bediener ab<br />
5: Der Prozess lässt<br />
sich auch über gängige<br />
Browser kontrollieren<br />
72 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
gen sind überwiegend in hochwertigem, elektropoliertem<br />
Edelstahl ausgeführt. Die Instrumentierung und<br />
Rohrleitungen zweier Stationen bestehen kom-<br />
plett aus Kunststoff, da die Chemikalien eine erhöhte<br />
Aggressivität gegenüber Edelstahl aufweisen.<br />
Eine Innenbeschichtung mit Halar sorgt für<br />
die Korrosionsbeständigkeit dieser Vorlagebehälter.<br />
Um die Fördertemperatur der Chemikalien<br />
konstant zu halten, verlaufen die Rohrleitungen<br />
außerhalb des Gebäudes, in einem klimatisierten Versorgungsschacht.<br />
Die Rohrleitungen sind bis zum nächsten<br />
überwachten Raum (Verteilerbox oder Maschine) als<br />
Doppelrohr installiert, womit Leckagen umgehend<br />
durch permanente Drucküberwachung erkannt werden.<br />
Die Maschinenversorgung ist in einem Kabinett im<br />
Labor aufgestellt und sicherheitstechnisch zum Laborraum<br />
abgeschottet, da die Eigenschaften der Chemikalien<br />
den Innenraum des Kabinetts als Ex-Zone 2 klassifizieren.<br />
Kleine Vorlagebehälter ermöglichen eine direkte<br />
Entnahme der benötigten Chemikalie durch die Produktionsanlage<br />
vor Ort, die Nachfüllung der Vorlagebehälter<br />
erfolgt vollautomatisch durch die Zentralversorgung.<br />
Der bei der Produktion anfallende Chemikalienabfall<br />
wird in Sammelbehälter gefüllt und ab einem bestimm-<br />
ten Füllstand, ebenfalls automatisiert, in die Abfallbehälter<br />
im Gefahrstoff-Container befördert. Dies geschieht<br />
an technisch möglichen Positionen mittels Schwerkraft,<br />
bei Positionen, die ein Abfließen mittels Schwerkraft<br />
nicht ermöglichen, erfolgt der Abtransport mithilfe einer<br />
Pumpe.<br />
Kontrollierte und beherrschbare Parameter<br />
Durch den Einsatz der Zentralversorgungsanlage ergeben<br />
sich für den Betreiber Vorteile, die neben der Prozessautomatisierung<br />
auch die Prozessoptimierung betreffen.<br />
Die Betriebssoftware der Anlage ist eine hauseigene<br />
Entwicklung des Anlagenbauers, und dadurch besteht<br />
die Möglichkeit, dass der Hersteller die Software<br />
maßgeschneidert für kundenspezifische Anforderungen<br />
liefert. Für den Betreiber der Anlage ergeben sich neue<br />
Möglichkeiten, den Prozess zu beobachten und ihn zu<br />
optimieren, indem er ihn durch spezifische Parameteränderungen<br />
anpasst. Um wiederkehrende Aufgaben<br />
leichter zu erfüllen, stehen automatische Programme zur<br />
Verfügung – das führt zu erhöhter Sicherheit und Minderung<br />
des Zeitaufwandes des Bedienpersonals.<br />
Die unterbrechungs- und blasenfreie Versorgung an<br />
den Abnahmestellen erhöht die Betriebszeiten der Produktionsanlagen<br />
und die Qualität des Produktes. Der<br />
Einsatz stets aktueller Technik für die Anlagenkomponenten<br />
ermöglicht einen langfristigen, komplikationsfreien<br />
Betrieb der Anlage.<br />
Inbetriebnahme in den Betriebsablauf integriert<br />
Die Zentralversorgungsanlagen des Herstellers lassen<br />
sich in verschiedenen industriellen Bereichen einsetzen,<br />
auch die Aufstellung und der Betrieb in explosionsgefährdeten<br />
oder anspruchsvollen Umgebungen ist möglich.<br />
Neben der Versorgung mit Chemikalien lässt sich<br />
auch die Versorgung mit Lösemitteln und Batterieelektrolyten<br />
realisieren. Die Versorgungsanlagen werden<br />
vom Hersteller beim Kunden angeliefert, installiert und<br />
auf Dichtheit und Funktionalität geprüft. Die Erstinbetriebnahme<br />
sowie eine Schulung zur Anlagenbedienung<br />
„Die Chemikalien-Zentralversorgungsanlage kann<br />
verschiedene Aufgaben übernehmen und lässt sich<br />
auch in einer anspruchsvollen, sicherheitskritischen<br />
Umgebung installieren und betreiben“<br />
wird gemeinsam mit dem Kunden in den Betriebsablauf<br />
integriert, um eine zügige Integration der Anlage zu erreichen.<br />
Die Anlagen werden unter Berücksichtigung<br />
einer Risikoanalyse und nach Auswahl der einzuhaltenden<br />
harmonisierten Normen sowie weiteren technischen<br />
Spezifikationen konstruiert und gefertigt und erfüllen<br />
die Anforderungen der geltenden europäischen<br />
Richtlinien. ●<br />
Haben Sie Interesse an anderen Reinstmedienversorgungssystemen<br />
des Herstellers oder an den<br />
Atex-Leitlinien zur Anwendung der Richtlinie 94/9/<br />
EG? Klicken Sie sich rein auf www.chemietechnik.<br />
de/1301ct608 – oder QR-Code scannen!
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Seite: www.chemietechnik.de/1301ct905 oder<br />
QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
Sackentleer-Vorrichtung<br />
Geringer Kraftaufwand und<br />
weniger Gesundheitsrisiken<br />
• mindert Gesundheitsrisiken durch Einatmen schädlicher Stoffe<br />
• Kraftaufwand für Sackhandling vergleichsweise gering<br />
• selbstständige Entleerung<br />
Eine Sackentleer-Vorrichtung von APE Engineering<br />
vereinfacht die Entleerung von Säcken und vermindert<br />
Gesundheitsrisiken durch Einatmen oder<br />
Kontakt mit gesundheitsschädlichen Stoffen. Üblicherweise<br />
müssen die Mitarbeiter mit schlecht zu<br />
greifenden Gebinden hantieren, die Säcke mit<br />
scharfen Schneidwerkzeugen öffnen oder unter<br />
Umständen werden die Gesundheit gefährdende<br />
Stoffe eingeatmet. Diese Probleme werden mit der<br />
Sackentleer-Vorrichtung vermieden. Dazu wird eine<br />
mobile Sackkassette vor die Entleer-Öffnung<br />
gefahren und auf die erforderliche Höhe mittels<br />
Fußpumpe eingestellt. Der Sackstapel, meist auf<br />
Palette, wird mittels geeignetem Hubwagen hinter<br />
der Kassette positioniert. Durch die Höhenanpas-<br />
Anzeigegerät<br />
Viel Technik in kleinem Gehäuse<br />
• für Füllstandbereich<br />
• Messeingang konfigurierbar<br />
• Peiltabellen hinterlegt<br />
Die digitalen Anzeigegeräte DA 10,<br />
DA 12 und DA 14 von Afriso eignen<br />
sich zur Messwertanzeige, Auswer-<br />
sung kann der volle Sack einfach<br />
und ohne großen Kraftaufwand auf<br />
die Rutsche geschoben werden.<br />
Dann wird der Sack auf das Kreuzmesser<br />
gedrückt, geöffnet und<br />
selbstständig entleert. Der geschlossene<br />
Deckel verhindert wirksam<br />
den Staubaustritt. Optional kann<br />
eine Absaugeinrichtung angeschlossen<br />
werden. Der Leersack wird durch Öffnen des<br />
Deckels entfernt – die Sackentleer-Vorrichtung<br />
ist für den nächsten Vorgang<br />
bereit.<br />
tung und Regelung von Normsignalen<br />
(4...20 mA, 0...20 mA, 0 bis1 V, 0<br />
bis 10 V) elektronischer Messumformer<br />
speziell für Anwendungen im<br />
Füllstandbereich. Für alle handelsüblichen,<br />
zylindrisch liegenden Tanks<br />
und Kugeltanks sind die gängigen<br />
Peiltabellen fest hinterlegt. Für nichtlineare<br />
Behälter oder Sonderanfertigungen<br />
kann zur Volumenanzeige<br />
eine 24-Punkte-Linearisierung errechnet<br />
und zum Beispiel in Liter<br />
angezeigt werden.<br />
Powtech Halle 6 – 211<br />
chemietechnik.de/1302ct074<br />
chemietechnik.de/1302ct106<br />
Gefahrstofflager<br />
Schutz im Freien<br />
• aus witterungsbeständigem PE<br />
• mit abschließbarer Jalousie<br />
• begehbar<br />
Der Multistore von Denios ist eine<br />
Lösung für die Gefahrstofflagerung<br />
im Freien. Die begehbare Ausführung<br />
schützt auf oder in Auffangwannen,<br />
Bodenelementen, Abfüllstationen<br />
oder Gefahrstoffregalen gelagerte<br />
IBC, Fässer und Kleingebinde oder<br />
auch Großmüll-, Streugut- und Stapelbehälter.<br />
Der Behälter besteht aus<br />
witterungsbeständigem PE.<br />
chemietechnik.de/1302ct065<br />
Produkte<br />
Signalhupe<br />
Laut- und leuchtstark<br />
• verschiedene Leuchtbilder<br />
• unterschiedliche Lichtversionen<br />
• akustische Ergänzung möglich<br />
Kennzeichen des Signalgerät 43x<br />
von Werma sind seine Größe, Merkmale<br />
und das Design. Verschiedene<br />
Leuchtbilder sind bei der Signalgeräte-Serie<br />
möglich: Dabei stehen als<br />
optisches Signal ein leuchtstarkes<br />
LED-Dauerlicht, das intensive LED-<br />
Rundumlicht oder eine kombinierte<br />
Version mit LED-Dauer-/Blitz-/EVS-<br />
Licht zur Verfügung.<br />
chemietechnik.de/1302ct088<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
73
Dichtungen<br />
Hochleistungswerkstoffe gegen explosive Dekompression<br />
Die Herausforderung meistern<br />
Profi-GuiDE<br />
Funktion Branche<br />
Der Autor:<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie<br />
Pharma<br />
● ● ●<br />
Ausrüster ●<br />
Planer ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer<br />
Manager<br />
● ●<br />
Michael Krüger, Leiter<br />
Anwendungstechnik,<br />
C. Otto Gehrckens<br />
74 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
EntScHEiDEr-fActS<br />
Für Betreiber<br />
● Für die hohen Anforderungen an Dichtungen gegen explosive Dekompression können nur speziell für diesen<br />
Bereich konzipierte und getestete Elastomere zum Einsatz kommen.<br />
● Für sämtliche Anwendungen in der Erdgasförderung und hier insbesondere bei Industriearmaturen oder auch in<br />
Hochdruckanwendungen der chemischen Industrie konnten mit diesen Werkstoffen bereits erfolgreich Beschädigungen<br />
an Elastomerdichtungen durch explosive Dekompressionen verhindert und damit kostspielige Leckagen<br />
vermieden werden.<br />
Mit Schäden an Elastomerdichtungen durch explosive<br />
Dekompression haben immer mehr Unternehmen der<br />
Chemie-, Öl- und Gasindustrie sowie der Zulieferindustrie<br />
als auch im Kompressorenbau und in der Druckluftaufbereitung<br />
häufig zu tun. Herkömmliche Elastomerdichtungen<br />
können bei plötzlichem Druckabfall stark<br />
beschädigt und undicht werden. Die Folgen: Maschinenstillstandszeiten<br />
und hohe Instandhaltungskosten.<br />
Außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt<br />
Hochwertige Präzisions-Elastomerdichtungen kommen<br />
in unterschiedlichsten Bereichen der Industrie zum Einsatz<br />
und müssen zum Teil hohen Anforderungen genügen,<br />
um bestmögliche Dichtungsergebnisse zu erzielen.<br />
O-Ringe, die gegen explosive<br />
Dekompression eingesetzt werden<br />
können<br />
Bei vielen Anwendungen sind Elastomerdichtungen wie<br />
zum Beispiel O-Ringe allerdings außergewöhnlichen<br />
Belastungen ausgesetzt. Dementsprechend hoch sind<br />
auch die Anforderungen an alle verwendeten Materialien,<br />
die im Produktionsprozess zum Einsatz kommen.<br />
Viele Hersteller und Betreiber in der Chemie-, Öl- und<br />
Gasindustrie haben häufig Leckageprobleme mit Elastomerdichtungen,<br />
insbesondere bei starkem Druckabfall<br />
im Medium Gas. Hier müssen Dichtungen gasförmige<br />
Medien wie Kohlendioxid, Erdgas, Stickstoff, Helium<br />
und Wasserstoff bei Drücken von mehr als 30 PN/30 bar<br />
und bei plötzlichem Absinken (innerhalb weniger Sekunden)<br />
speziellen Anforderungen genügen, um diese<br />
Medien sicher abdichten zu können. Einige Anwendun-<br />
Bilder: COG
Zum Standard<br />
Anforderungen an die Beständigkeit<br />
Der Norsok M-710-Standard wurde von der norwegischen Öl- und Gasindustrie<br />
entwickelt; es handelt sich hierbei ein Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit von<br />
Dichtungswerkstoffen gegen explosive Dekompression.<br />
gen können die Drücke bis zu PN 400/400 bar<br />
erreichen. Nur speziell getestete Werkstoffe können<br />
in diesen Anwendungen zum Einsatz kommen.<br />
So schreibt beispielsweise die Norm DIN<br />
EN14141 für Erdgas-Leitungen vor, dass nichtmetallische<br />
Teile von Armaturen, wie etwa elastomere<br />
Dichtungen, gegenüber explosiver Dekompression<br />
beständig sein müssen.<br />
Solche Bedingungen herrschen in unterschiedlichen<br />
Bereichen, so beispielsweise auch<br />
in Molchschleusen an (Erd-) Gastransportleitungen<br />
und Leitungen in Chemiewerken. In<br />
diese Schleusen können verschiedene Molche<br />
die Rohre im laufenden Betrieb, also auch in<br />
Hochdruckleitungen, inspizieren und reinigen.<br />
Beim Öffnen und Schließen der Molchschleuse<br />
kommt es zu einem starken Druckaufbau und<br />
Druckabfall in sehr kurzer Zeit. Dieser Prozess<br />
kann die dort verbauten elastomeren Dichtungen<br />
beschädigen.<br />
Was ist explosive Dekompression?<br />
Davon sind in erster Linie Dichtungen betroffen,<br />
die gegenüber gasförmigen Medien abdichten<br />
müssen, wenn das Gas von einem hohen<br />
Druckniveau innerhalb von kurzer Zeit auf ein<br />
niedriges absinkt. Elastomere sind permeabel<br />
für Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten, so dass<br />
Gase unter Druck in das Dichtungsmaterial eindringen<br />
können. Bei einem starken Druckabfall<br />
kann das Medium nicht schnell genug aus dem<br />
Dichtungswerkstoff entweichen. Die Dichtung<br />
wird dadurch so stark beschädigt, dass sie nicht<br />
mehr abdichten kann. Der Druckabfall ist daher<br />
die Ursache für die Beschädigung der Elastomerdichtung,<br />
die beispielsweise durch Blasenbildung<br />
an der Oberfläche visuell leicht zu er-<br />
Ein durch explosive Dekompression<br />
beschädigter O-Ring<br />
kennen ist. Dieses Phänomen ist als „explosive<br />
Dekompression“ bekannt.<br />
Konventionelle Elastomerdichtungswerkstoffe<br />
sind für diese Anwendungen nicht geeignet<br />
werden, da ihr Widerstand gegenüber den<br />
hier auftretenden Kräften nicht ausreichend ist.<br />
Hier können nur speziell aufgebaute Elastomere<br />
zum Einsatz kommen, die sich insbesondere<br />
durch sehr gute physikalische Eigenschaften –<br />
zum Beispiel hoher Weiterreißwiderstand und<br />
Modul – auszeichnen. Diese beständigen Werkstoffe<br />
werden manchmal auch mit dem Kürzel<br />
AED (Anti-Explosive-Decompression) gekennzeichnet.<br />
Wie das Problem lösen?<br />
Speziell für Anwendungen gegen explosive Dekompression<br />
wurden verschiedene High-tech-<br />
Werkstoffe entwickelt und intensiv geprüft. Um<br />
den Anforderungen an die Dichtbeständigkeit<br />
gegen die individuellen Medien in den jeweiligen<br />
Anwendungen gerecht zu werden, genügt<br />
den Herstellern oder Betreibern eine Widerstandsfähigkeit<br />
gegenüber explosiver Dekompression<br />
alleine nicht. Deshalb wurden verschiedene<br />
Spezial-Compounds für unterschiedliche<br />
Anforderungen entwickelt: zwei FKM-, ein HN-<br />
BR- und zwei FFKM-Werkstoffe. Vier der fünf<br />
Compounds erfüllen dabei die NorsokStandard-<br />
M-710-Anforderungen zur Beständigkeit gegen<br />
explosive Dekompression.<br />
Alle fünf Dichtungswerkstoffe gewährleisten<br />
auch bei extremen und schnellen Druckwechseln<br />
eine dauerhafte Dichtleistung. Die Werkstoffe<br />
weisen – neben einer hohen chemischen<br />
und thermischen Beständigkeit – mit 90 Shore A<br />
eine hohe Härte auf, die insbesondere bei hohen<br />
Dokument 1 10.01.2007 12:57 U<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
75
Bild: © Thorsten Schier - Fotolia.com<br />
Dichtungen<br />
Dichtungen aus<br />
Hochleistungs-<br />
werkstoffen schützen<br />
in Anlagen<br />
vor explosiver<br />
Dekompression<br />
Ergebnis Tieftemperaturtest:<br />
Perlast ICE<br />
G90LT kann bei höheren<br />
Drücken bis -80 °C<br />
eingesetzt werden<br />
Temperatur in °C<br />
-40<br />
-45<br />
-50<br />
-55<br />
-60<br />
-65<br />
-70<br />
-75<br />
-80<br />
-85<br />
76 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Drücken einer möglichen Spaltextrusion entgegenwirkt<br />
und so eine explosive Dekompression vermeidet. Neben<br />
zwei chemisch sehr resistenten FKM-Werkstoffen – einer<br />
davon erfüllt die Norsok-M-710-Anforderungen zur<br />
Beständigkeit gegen explosive Dekompression – hat der<br />
Hersteller auch ein HNBR-Compound entwickelt. Der<br />
Dichtungswerkstoff HNBR 895 ist gekennzeichnet<br />
durch eine sehr gute chemische Beständigkeit, vor allem<br />
gegen Öle und Kraftstoffe. Neben einer sehr guten Hitze-<br />
und Witterungsbeständigkeit weist dieses Compound<br />
eine hohe mechanische Festigkeit auf. Dieser<br />
Spezial-HNBR erfüllt ebenfalls die Norsok-M-710-Anforderungen<br />
und eignet sich ideal für einen langfristigen,<br />
leckagefreien Einsatz in der Öl- und Gasindustrie.<br />
Für Tieftemperaturanwendungen ist das spezielle<br />
FFKM-Compound Perlast ICE G90LT geeignet. Dieser<br />
Werkstoff erfüllt den Norsok-Standard M-710 und entspricht<br />
weiterhin den Anforderungen nach API 6A &<br />
6D. In Abhängigkeit von dem auftretenden Druck des<br />
abzudichtenen Mediums kann dieser Dichtungswerkstoff<br />
sogar bis -80 °C eingesetzt werden. Der Perlast-<br />
Druck in bar<br />
100 200 300 400 500 600 700<br />
Forschungsabteilung ist es gelungen, durch das gezielte<br />
Verändern der molekularen Polymerstruktur bei diesem<br />
Werkstoff auch eine langanhaltende Tieftemperaturbeständigkeit<br />
zu erzielen und somit eine dauerhafte Dichtungsfunktion<br />
im Tieftemperatureinsatz überhaupt erst<br />
zu ermöglichen. Neben diesen Produktmerkmalen weist<br />
dieses Compound durch die geringe Durchlässigkeit<br />
(Permeabilität) ein äußerst geringes Quellungsverhalten<br />
auf und ermöglicht daher eine längere Einsatzdauer in<br />
Ventilen, Pumpen und Gleitringdichtungen.<br />
Fazit: Für die hohen Anforderungen an Dichtungen<br />
gegen explosive Dekompression können nur speziell für<br />
diesen Bereich konzipierte und getestete Elastomere<br />
zum Einsatz kommen. Für sämtliche Anwendungen in<br />
der Erdgasförderung und hier insbesondere bei Industriearmaturen<br />
oder in auch Hochdruckanwendungen der<br />
chemischen Industrie konnten mit diesen Werkstoffen<br />
bereits erfolgreich Beschädigungen an Elastomerdichtungen<br />
durch explosive Dekompressionen verhindert<br />
und damit kostspielige Leckagen vermieden werden.<br />
Das Problem der explosiven Dekompression darf allerdings<br />
nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss<br />
immer im Kontext mit den Anforderungen und der<br />
Resistenz des Dichtungswerkstoffes gegenüber dem abzudichtenden<br />
Medium gesetzt werden. Die Medienbeständigkeit<br />
ist deshalb bei der Auswahl des richtigen<br />
Dichtungswerkstoffes auch in diesen Einsatzgebieten<br />
unabdingbar. Deshalb ist es wichtig, mit erfahrenden<br />
Herstellern zusammenzuarbeiten, die auch über eine<br />
entsprechende Werkstoffauswahl und dem entsprechenden<br />
Know-how auf diesem Gebiet verfügen. Nur so<br />
kann der Konstrukteur und Anwender eine optimale<br />
Dichtungslösung für seine Anwendung erhalten. ●<br />
Einen Link zur DIN EN 14141, den Hochleistungswerkstoffen<br />
des Herstellers und den unabhängigen<br />
Experten der BHR Beratungsgruppe gefällig?<br />
Klicken Sie sich rein auf www.chemietechnik.<br />
de/1301ct609 – oder QR-Code scannen!
Der Autor:<br />
Armin Scheuermann<br />
ist Chefredakteur der<br />
CHEMIE TECHNIK<br />
Energieoptimierte Fördersysteme als Komplettlösung<br />
Aus einem Guss<br />
Profi-Guide<br />
Funktion Branche<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ● ●<br />
Ausrüster ●<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer<br />
Manager<br />
●<br />
entScheider-fActS<br />
Für Betreiber und Planer<br />
„Sicher ist sicher“, sagen sich Planer und packen bei der<br />
Auslegung von Pumpen, Ventilen und Rohrleitungssystemen<br />
ordentliche Reserven drauf. Wenn gleich mehrere<br />
Planer für die einzelnen Gewerke zugange sind, werden<br />
Anlagenteile meist überdimensioniert. Bei Regelstrecken<br />
mit Stellventil und drehzahlgeregelter Pumpe kommt<br />
heute noch ein weiteres Phänomen hinzu: Zwei Stellglieder<br />
in einem Regelkreis können entweder zu Latenzen<br />
führen oder gegeneinander arbeiten und aufschwingen.<br />
Samsomatic plant deshalb Fördersysteme, bestehend aus<br />
drehzahlgeregelter Pumpe, Stellventil und Regler aus einer<br />
Hand – und hat das Know-how in der kürzlich vor-<br />
Automatisierung, Messtechnik<br />
● Soll eine Anlage energetisch optimiert werden, reicht ein Blick auf die Einzelkomponenten<br />
nicht aus. Erst eine Optimierung des gesamten Systems führt zu einem<br />
energieoptimalen Betrieb.<br />
● Druck- und Durchflussregelungen, bestehend aus drehzahlgeregelter Pumpe, Stellventil<br />
und Regler, müssen gut aufeinander abgestimmt werden, um Latenzen und<br />
ein Überschwingen des Regelkreises zu vermeiden.<br />
gestellten Flow Unit zusammengeführt. Soll eine Anlage<br />
energetisch optimiert werden, reicht ein Blick auf die<br />
Einzelkomponenten nicht aus. Erst eine Optimierung<br />
des gesamten Systems führt zu einem energieoptimalen<br />
Betrieb.<br />
Um beispielsweise Druck und Durchfluss in einem<br />
Fördersystem optimal an den Bedarf anzupassen, werden<br />
heute immer häufiger drehzahlgeregelte Pumpen<br />
eingesetzt. Dadurch lässt sich der Energiebedarf gegenüber<br />
einfachen Pumpsystemen, bei denen die Pumpe mit<br />
konstanter Drehzahl läuft und der Durchfluss über ein<br />
Ventil geregelt wird, deutlich reduzieren. Mit der Kombi-<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
77<br />
Bild: © Photo-K - Fotolia.com
Automatisierung, Messtechnik<br />
1: Rohrleitungs- und Instrumentierungsschema<br />
der Fördereinheit.<br />
Der Industrieregler (2)<br />
wird von zwei Druckmessumformerngeführt<br />
und regelt die<br />
Drehzahl der Pumpe (3)<br />
sowie das Stellventil (1)<br />
2: Die energetische Optimierung<br />
von Fördereinrichtungen<br />
kann nur<br />
mit Blick auf das Gesamtsystem<br />
gelingen.<br />
Dieses anschlussfertige<br />
Komplettsystem wird<br />
aus einer Hand für eine<br />
konkrete Anwendung<br />
geplant<br />
2<br />
78 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
1<br />
nation aus Frequenzumrichter-Antrieb an der Pumpe<br />
und einem Stellventil in der Förderleitung können<br />
Druck und Durchfluss energetisch optimal an den Bedarf<br />
angepasst werden.<br />
Doch die Lösung hat ihre Tücken, weiß Stefan Unland,<br />
verantwortlich für den Bereich Prozessautomation,<br />
beim Regeltechnik-Spezialisten Samsomatic : „Für das<br />
System, bestehend aus Regelventil und drehzahlgeregel-<br />
ter Pumpe, gibt es unzählige Varianten. Dazu kommt,<br />
dass der Wirkungsgrad einer Pumpe je nach Arbeitspunkt<br />
unterschiedlich hoch ist. Das gilt auch für einen<br />
Elektromotor. Und auch der Druckverlust eines Ventils<br />
hängt von dessen Öffnungsgrad ab.“ Deshalb, so Unland,<br />
ist die Abstimmung der Komponenten sehr anspruchsvoll.<br />
Bei schnellen Änderungen im Prozess kann<br />
ein Regelkreis anfangen zu schwingen. Um dies zu vermeiden,<br />
kann man die Regelung zwar träge einstellen,<br />
doch dies führt dazu, dass Regelabweichungen über lange<br />
Zeit bestehen. „Ausgelegt werden solche Regelungen<br />
meistens nach den Angaben für den Nennbetrieb – im<br />
Teillastbetrieb sieht das ganz anders aus“, weiß Unland.<br />
Regelalgorithmus bringt drehzahlveränderliche<br />
Pumpe und Stellventil in Einklang<br />
Der Lösungsanbieter aus Frankfurt hat zur Lösung des<br />
Problems gemeinsam mit Samson ein Komplettsystem<br />
entwickelt und auf der Namur-Hauptsitzung im vergangenen<br />
November vorgestellt. In der Flow Unit kombiniert<br />
der Anbieter eine drehzahlgeregelte Kreiselpumpe<br />
mit einem Stellventil und einem speziell dafür entwickelten<br />
Industrieregler . Die Zusammenstellung wird<br />
vom Anbieter so ausgelegt, dass Kreiselpumpe, Stellventil<br />
und Regler nicht gegeneinander, sondern optimal<br />
miteinander arbeiten: Der Regelalgorithmus passt die<br />
Drehzahl der Pumpe den aktuellen Anforderungen der<br />
Anlage an und kann durch Regeln des Stellventils sowohl<br />
auf dynamische Laständerungen reagieren sowie<br />
beliebige Drücke und Durchflüsse einstellen. Dazu werden<br />
vom Regler zwei Druckmessungen am Ein- und<br />
Austritt des Stellventils ausgewertet. Soll der Durchfluss<br />
geregelt werden, dient als Stellgröße das Messsignal eines<br />
Durchfluss-Messgeräts, sodass sich damit der<br />
Durchfluss ermitteln und auch regeln läßt. „Wir passen<br />
die Regelstruktur der Flow Unit jeweils der geforderten<br />
Aufgabenstellung an“, erläutert Unland.<br />
Jährlich 8.760 Euro gespart<br />
In einem Beispiel hat sich bereits gezeigt, wie hoch das<br />
Potenzial einer solchen Systemregelung sein kann: In
3: Kennlinie einer Kühlwasserversorgung<br />
in<br />
einem Heizkraftwerk<br />
(elektrische Leistung<br />
PM gegen Förderleistung<br />
Q): Durch den<br />
Einsatz eines Flow-<br />
Unit-Reglers und eines<br />
Frequenzumrichters<br />
(orange Kennlinie) sind<br />
gegenüber dem bisherigen<br />
Betrieb (rote<br />
Linie) deutliche Einsparungen<br />
möglich<br />
P [kW]<br />
M<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
einem Heizkraftwerk wurde die Erneuerung einer Kühlwasserversorgung<br />
geplant. Aus den Betriebsdaten ging<br />
hervor, dass die Dampfumformung der dazu gehörenden<br />
Turbinen-Bypassstation nur selten benötigt wurde.<br />
Die daraus resultierende geringe Auslastung der Kühlwasserversorgung<br />
stand im Widerspruch zu den gemessenen<br />
hohen elektrischen Verbrauchswerten der Pumpe,<br />
denn diese waren über einen langen Zeitraum hinweg<br />
konstant hoch.<br />
Die Gesamtkapazität der Kühlwasserversorgung lag<br />
bei maximal 70 m 3 /h. Ferner musste der Druck auf mindestens<br />
7 bar gehalten werden, um den Höhenunterschied<br />
zwischen Kühlwasserversorgung und den Verbrauchern<br />
auszugleichen und um den Dampfdruck innerhalb<br />
der Turbinen-Bypassstation überwinden zu<br />
können. Bei einem Einsatz der Flow Unit beträgt das<br />
5<br />
0<br />
0<br />
10<br />
20<br />
30 40 50 60 70<br />
Q [m³/h]<br />
DREI FRAGEN an Stefan Unland, Samsomatic<br />
„Einzelelemente in einen Funktionszusammenhang stellen“<br />
CT: Dass Energieoptimierung beim Gesamtsystem und nicht bei Einzelkomponenten<br />
ansetzen muss, ist als Erkenntnis nicht neu. Worin besteht<br />
also der Ansatz Ihrer Flow-Unit-Lösung?<br />
Unland: Pumpen, Ventile, Rohrleitungen und Automatisierung einer Anlage<br />
werden heute meist in unterschiedlichen Schritten geplant und ausgelegt.<br />
Häufig sind diese schlecht aufeinander abgestimmt. Teil eins unserer Lösung<br />
ist die Zusammenlegung der bislang getrennten Auslegung einzelner Anlagenkomponenten.<br />
Der zweite Teil beruht auf einem neuartigen Zusammenwirken<br />
von Stellventilen und Pumpen. Hierdurch ist es möglich, sowohl die<br />
bewährte Regelperformance von Stellventilen als auch die Energieeinsparmöglichkeiten<br />
von drehzahlgeregelten Kreiselpumpen gemeinsam zu nutzen.<br />
Ein Industrieregler koordiniert das Zusammenwirken, welches im Rahmen<br />
der Inbetriebnahme letztendlich optimal an den Prozess angepasst wird.<br />
CT: Wie fügt sich dieses Angebot in den Planungs- und Engineeringprozess<br />
ein?<br />
Einsparpotential über einen weiten Lastbereich hinweg<br />
mehr als 10 kW (Bild 3). Bei einem Strompreis von<br />
0,10 Euro/kWh und einem 24/7-Betrieb können jährlich<br />
8.760 Euro Energiekosten eingespart werden. Die Investition<br />
in den Regler und in einen zum Pumpenmotor<br />
passenden Frequenzumrichter amortisiert sich in relativ<br />
kurzer Zeit. „Es gibt auch in der Chemie sehr viele Anlagen,<br />
die bislang nicht energetisch optimiert wurden“,<br />
weiß Unland. „Dazu gehören beispielsweise Mehrproduktanlagen<br />
und Batch-Prozesse.“ ●<br />
Für den schnellen Zugriff auf die Lösungen des<br />
Anbieters im Bereich Prozessautomation scannen<br />
Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein oder<br />
klicken Sie rein: www.chemietechnik.de/1301ct630<br />
Automatisierung, Messtechnik<br />
Unland: Natürlich erfordert dieses Angebot gegenüber der klassischen Vorgehensweise<br />
ein Umdenken. Aber sowohl Planungsbüros als auch Kunden sind<br />
froh, wenn wir die Planung der Fördereinrichtung übernehmen, zumal deren<br />
Personalkapazität, als auch die zeitlichen Vorgaben für solche Aufgaben immer<br />
knapper werden. Die von uns geplante Einheit kann von den Kunden wie<br />
ein Ventil in die Rohrleitung eingebaut werden.<br />
CT: Also ein Lösungspaket, aber kein Standardprodukt?<br />
Unland: Richtig, in Bezug auf die Anpassung des Paketes an die jeweilige<br />
Anwendung, denn erfahrungsgemäß gleicht keine Anlage der anderen. Andererseits<br />
verwenden wir sehr wohl Standardprodukte, die sich bei unseren<br />
Kunden bewährt haben. Am besten lässt sich das Paket mit einem Baukastensystem<br />
vergleichen, dessen Bestandteile aus bekannten MSR-Geräten<br />
bestehen, das aber auch flexibel genug ist, um es an unterschiedliche Erfordernisse<br />
anpassen zu können.<br />
Bilder: Samsomatic<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
79
Automatisierung, Messtechnik<br />
Der Autor:<br />
Kai Grabenauer,<br />
Produktmanagement<br />
Elektrische Temperatur,<br />
Wika<br />
1<br />
80 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Zerstörungsfreie Prüfverfahren bei Thermometer-Schutzrohren<br />
Kein Risiko eingehen<br />
PROFI-GUIDE<br />
Funktion Branche<br />
Anlagenbau ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ●<br />
Ausrüster ●<br />
Planer ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer<br />
Manager<br />
●<br />
ENTSCHEI<strong>DER</strong>-FACTS<br />
Für Betreiber<br />
Der Aufwand, bei Werkstoffprüfungen mögliche Materialfehler<br />
zu entdecken, ist groß. Er erstreckt sich<br />
nicht nur auf hochbelastete Komponenten wie beispielsweise<br />
die Turbinenschaufeln von Flugzeugtriebwerken.<br />
Selbst einfachere Industriebauteile werden<br />
mit unterschiedlichsten Methoden auf mögliche Fehlstellen<br />
„durchleuchtet“, um den Anwendern ein<br />
Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Zum Beispiel<br />
Thermometer-Schutzrohre: Insgesamt sechs Ver-<br />
● Die gängigste Prüfung bei Schutzrohren ist der hydrostatische Drucktest.<br />
● Bei Schutzrohren, die eine Schweißverbindung aufweisen, kann eine Eindringprüfung<br />
nach DIN EN 571-1 feine Oberflächenrisse oder Poren sichtbar machen.<br />
● Der PMI-Test dient zum Nachweis der vorhandenen Legierungsbestandteile.<br />
● Zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1779 (1999)/EN 13185 wird der Helium-<br />
Leckage-Test angewandt.<br />
fahren zur zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) können bei<br />
ihnen angewendet werden.<br />
Durchführung in Normen und Standards<br />
festgeschrieben<br />
Thermometer-Schutzrohre sind in vielen Bereichen der<br />
Temperaturmessung ein wichtiges Sicherheitsinstrument.<br />
Das Hauptaugenmerk der ZfP richtet sich vor allem<br />
auf die Kontrolle der Schweißverbindung zwischen<br />
dem eigentlichen Schutzrohr und dem Befestigungs-<br />
flansch. Jedoch Jedoch sind auch auch Prüfungen aller anderen Teile<br />
des des Schutzrohres durchführbar. durchführbar. Um eine Vergleichbarkeitkeit<br />
und Wiederholbarkeit der verschiedenen Untersuchungsmethoden<br />
zu gewährleisten, sind das das Durchführenren<br />
aller zerstörungsfreien Prüfungen Prüfungen und das Bewerten<br />
der der Ergebnisse in verschiedenen Normen und Standards<br />
festgeschrieben.<br />
Die gängigste Prüfung bei Schutzrohren ist der hydrostatische<br />
Drucktest. Er stellt eine Druck- und FestigFestigkeitsprüfung aller Bauteile in Anlehnung an AD2000<br />
Merkblatt HP30 dar. dar. Für den Test wird wird das Schutzrohr<br />
in eine Vorrichtung eingespannt eingespannt und bei bei RaumtemperaRaumtemperatur<br />
eine bestimmte Zeitspanne, zum zum Beispiel 3 3 min, mit<br />
einem definierten definierten Druck beaufschlagt. Wasser mit einem<br />
Chloridgehalt kleiner 15 15 ppm dient dient als als Prüfmittel. Prüfmittel.<br />
Generell unterscheidet man Außen- und Innendruckprüfung.<br />
Typisch sind der 1,5-fache Nenndruck<br />
des Flansches mit Außendruck oder beispielsweise 500<br />
bar mit Innendruck.<br />
Bei Schutzrohren, die eine Schweißverbindung<br />
aufweisen, kann eine Eindringprüfung nach<br />
DIN EN 571-1 feine Oberflächenrisse oder<br />
Poren sichtbar machen. Nach der Reinigung<br />
der betreffenden Oberfläche<br />
wird ein Kontrastmittel aufgesprüht,<br />
das rote oder fluoreszierende<br />
Partikel enthält. Durch die<br />
Kapillarwirkung dringt das Mittel<br />
in eventuell vorhandene Oberflächenfehler<br />
ein. Nach einer erneuten<br />
Reinigung der Oberfläche wird<br />
ein Entwickler (weiß) aufgesprüht, der<br />
das Kontrastmittel zum Beispiel aus Haarrissen<br />
herauszieht und durch einen Farbkontrast
2 3<br />
Bilder: Wika<br />
eine einfache Bewertung der Fehlstellen ermöglicht.<br />
Fluoreszierende Kontrastmittel werden für die Bewertung<br />
unter Laborbedingungen mittels UV-Licht genutzt.<br />
Exot ist heimisch geworden<br />
Noch vor etwa zehn Jahren galt der PMI-Test (Positive<br />
Material Identification) als Exot unter den ZfP-Methoden<br />
für Schutzrohre. Heute gehört die Werkstoffverwechslungsprüfung,<br />
so die deutsche Übersetzung, zum<br />
Standard. Der PMI-Test dient zum Nachweis der im<br />
Werkstoff vorhandenen Legierungsbestandteile. Dabei<br />
sind zwei verschiedene Testverfahren gebräuchlich:<br />
●● Bei der optischen Emissionsspektrometrie (OES) ge-<br />
„Abgeschlossen wird die Produktion eines Schutzrohres<br />
durch zerstörungsfreie Prüfungen, um einen<br />
reibungslosen Einsatz des Geräts sicherzustellen“<br />
mäß DIN 51008-1 und -2 wird zwischen Rohroberfläche<br />
und Testgerät ein Lichtbogen gezündet, über dessen<br />
Spektrum man qualitativ und quantitativ auf die Legierungselemente<br />
schließen kann. Charakteristisch für<br />
dieses Vorgehen ist die auf dem Werkstück verbleibende<br />
Brandmarke.<br />
●● Die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) nach DIN<br />
51001 hingegen arbeitet ohne Beschädigung der Oberfläche.<br />
Röntgenstrahlung regt die Atome des Schutzrohrwerkstoffs<br />
zur Eigenstrahlung an. Deren Wellenlänge<br />
und Intensität ist wiederum ein Maß für die enthaltenen<br />
Legierungselemente und ihre Konzentration.<br />
Der wesentliche Unterschied zwischen beiden PMI-<br />
Verfahren ist der Kohlenstoff-Nachweis: Nur die optische<br />
Emissionsspektrometrie ermöglicht eine Bestimmung<br />
des C-Gehalts.<br />
Alles dicht?<br />
Zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1779 (1999) / EN<br />
13185 wird der Helium-Leckage-Test angewandt, bei<br />
dem Helium 4.6 als Prüfgas fungiert. Dieser Test ist in<br />
der Lage, minimale Leckageraten zu detektieren, und<br />
gilt als empfindlichstes Verfahren für eine Dichtheitsprüfung.<br />
Dabei ist zwischen einer integralen und lokalen<br />
4<br />
Methode zu unterscheiden. Bei der integralen Prüfung<br />
können Leckageraten (zum Beispiel 1 x 10 -7 mbar * L/s)<br />
ermittelt werden, während die lokale Prüfung mittels<br />
Sprühsonde ein Lokalisieren der Leckage ermöglicht.<br />
Bei der Durchstrahlungsprüfung auf Röntgen-Basis<br />
nach EN 1435 (oder ASME Section V, Article 2, Edition<br />
2004) werden beispielsweise die Full-Penetration-<br />
Schweißnähte eines Schutzrohres auf Unregelmäßigkeiten<br />
wie Risse, Lunker und Bindefehler untersucht. Je<br />
nach Abmessung des Rohrs sind hierbei bis zu fünf<br />
Röntgenbilder notwendig, um in der Schweißnaht solche<br />
Fehler mit Abmessungen < 0,5 mm festzustellen.<br />
Eine Röntgenuntersuchung kann auch zur Dokumentation<br />
der Bohrungsmittigkeit eines Vollmate-<br />
rial-Schutzrohres angewendet werden. Dazu<br />
sind zwei um 90° gedrehte Aufnahmen der<br />
Rohrspitze erforderlich.<br />
Eine Alternative zur Röntgenuntersuchung<br />
ist die Ultraschallprüfung nach DIN<br />
EN ISO 17640. Zur Kontrolle der Schweißnaht<br />
werden die Reflektionen eines Ultraschall-Signals<br />
an den Grenzflächen von Unregelmäßigkeiten gemessen.<br />
Um deren Position zu ermitteln, wird das Ultraschallgerät<br />
zuvor per Referenzkörper justiert.<br />
Reibungslosen Einsatz sicherstellen<br />
Dass der Sicherheitsstandard selbst bei weniger komplexen<br />
Bauteilen in den vergangenen Jahren bedeutende<br />
Fortschritte gemacht hat, zeigt die Schutzrohr-Festigkeitsberechnung<br />
nach ASME PTC 19.3-TW2010. Sie hat<br />
sich beim Auslegen und Dimensionieren einer sicherheitsrelevanten<br />
Messstelle mittlerweile etabliert. Abgeschlossen<br />
wird die Produktion eines Schutzrohres durch<br />
zerstörungsfreie Prüfungen, um einen reibungslosen<br />
Einsatz des Geräts über Jahre sicherzustellen. Ohne<br />
höchste Sorgfalt oder die Anwendung des geeignetsten<br />
Verfahrens bleibt jedoch ein unkalkulierbares Risiko. ●<br />
Automatisierung, Messtechnik<br />
Powtech Halle 6 – 460<br />
Links zur DIN EN 571-1:1997-03, zum Hydrostatischen<br />
Druck oder zur Eindringprüfung gefällig? Klicken<br />
Sie sich rein auf www.chemietechnik.<br />
de/1301ct611 – oder QR-Code scannen!<br />
1: Verschiedene<br />
Ausführungen von<br />
Schutzrohren<br />
2: PMI-Test mittels<br />
RFA-Verfahren<br />
3: Helium-Leckagetest<br />
eines Tantal-Mantels<br />
4: Farbeindringprüfung<br />
– Aufsprühen des Entwicklers<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
81
Automatisierung, Messtechnik<br />
Software schlägt die Brücke zwischen PLT-Planung und SIL-Berechnung<br />
Weniger Handarbeit<br />
beim SIL-Nachweis<br />
ProfI-GuIde<br />
Funktion Branche<br />
Der Autor:<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma<br />
Ausrüster<br />
● ●<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber<br />
Einkäufer<br />
Manager<br />
● ● ●<br />
Arno Schmidt ist<br />
Produktmanager bei<br />
Planets Software<br />
82 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
eNTScHeIder-facTS<br />
Für Planer und Betreiber<br />
● Beim rechnerischen SIL-Nachweis werden PLT-Daten meist per Hand in separate Softwarewerkzeuge oder<br />
Excel-Berechnungstools eingetippt. Das bedeutet Aufwand und ist fehlerträchtig.<br />
● Das Engineering-System Planeds vereint mit seinem für Version 4.1 verfügbaren Add-on die PLT-Planung und<br />
die SIL-Berechung.<br />
● Da ein eigener Arbeitsbereich für die SIL-Berechnung genutzt werden kann, lässt sich diese komplett von der<br />
Modellierung der Automatisierungstechnik trennen.<br />
Beim SIL-Nachweis von PLT-Schutzeinrichtungen dominiert<br />
heute noch meist Handarbeit: In der Regel werden<br />
die für die SIL-Berechnung notwendigen Daten nicht<br />
nur im PLT-Planungswerkzeug, sondern auch in separater<br />
Software oder Excel-Tools zur SIL-Berechnung erfasst.<br />
Eine unnötige und fehlerträchtige Arbeit.<br />
Das Engineering-System Planeds für die Planung, Betriebsbetreuung<br />
und Instandhaltung der Automatisierungstechnik<br />
in verfahrenstechnischen Anlagen stellt ab<br />
Version 4.1 ein Add-on für die Durchführung von SIL-<br />
Berechnungen zur Verfügung. Der Clou: Sowohl PLT-<br />
Planung als auch SIL-Berechnung nutzen ein und dieselbe<br />
Datenbank. Durch Variieren der Parameter lassen sich<br />
damit sehr einfach Fragen beantworten, wie die, ob durch<br />
häufigere Prüfintervalle ein höherer SIL möglich ist.<br />
Im Modul Funktionswelt des Engineering-Systems<br />
ist die Logik der Prozessleittechnik in Form von PLT-<br />
1001<br />
Stellen, deren Gerätespezifikationen sowie Stellenplänen<br />
erfasst und wird dort gepflegt und administriert. Das<br />
Add-on stellt Hilfsmittel bereit, um in der Funktionswelt<br />
zusätzlich SIL-Kreise zu modellieren, die auf die Gerätespezifikationsdaten<br />
der PLT-Stellen zugreifen, die in<br />
SIL-Betrachtungen einbezogen werden.<br />
Während die PLT-Stellen sich in das Kennzeichnungssystem<br />
des Anlagenbetreibers eingliedern, liegen<br />
die SIL-Kreise im Engineering im Allgemeinen quer zur<br />
Hierarchie. Das heißt, die im Rahmen einer SIL-Berechnung<br />
gemeinsam zu berücksichtigenden PLT-Stellen<br />
können in unterschiedlichen Verfahrensabschnitten, ja<br />
sogar in unterschiedlichen Verfahren angesiedelt sein.<br />
Die hier beschriebene Lösung nutzt zwei Arbeitsbereiche.<br />
In dem einen Arbeitsbereich befinden sich die<br />
Modelldaten der PLT-Stellen gemäß Kennzeichnungssystem<br />
und in einem zweiten die SIL-Kreise. Hier wird<br />
1004<br />
1001
1002<br />
1001<br />
3003<br />
1001<br />
1001<br />
die Hierarchie (Bild 2) derart interpretiert, dass die<br />
Ebene 2 als Kategorie der SIL-Kreise verwendet wird,<br />
deren Sicherheitsfunktion (z.B. Drucküberschreitung)<br />
sinnstiftend ist. In Hierarchie-Ebene 3 wird die Anlage<br />
notiert. Die Zuordnung erfolgt insoweit, als normalerweise<br />
die Sicherheitsfunktion sich auf ein Anlagenteil<br />
bezieht, welches selbst wieder in dem Kennzeichnungssystem<br />
verortet ist. Dementsprechend zeigt die SIL-<br />
Kreisbezeichnung in einem Bestandteil auf ein Anlagenteil<br />
(z.B. „CA030“), das sich in der Anlage in Ebene 3<br />
befindet.<br />
Varianten rechnen<br />
Bild 3 zeigt das Feinmodell des in Bild 2 hervorgehobenen<br />
SIL-Kreises. In Ebene 5 der Hierarchie sehen wir das<br />
Blattsymbol der Zeichnung, in der der SIL-Kreis grafisch<br />
dargestellt und die Berechnung dokumentiert ist. Darunter<br />
folgen die Symbole der Architekturen, aus denen<br />
der SIL-Kreis besteht. Sie werden, wie in der Funktionswelt<br />
üblich, als Stellenelement angelegt.<br />
„-M001“ repräsentiert die oberste Ebene des SIL-<br />
Kreises und enthält die Resultate der Berechnung (Bild<br />
5). „-M002“ bis „-M011“ stehen für die elementaren<br />
Architekturen vom Typ „1oo1“. Sie enthalten die Definitionswerte<br />
der sicherheitsrelevanten Geräte, die in der<br />
SIL-Berechnung zu berücksichtigen sind. „-M012“ bis<br />
„-M015“ repräsentieren die nicht-elementaren Architekturen.<br />
Bild 1 gibt eine Überrsicht über die strukturellen<br />
Zusammenhänge des SIL-Kreises und zeigt den Weg der<br />
Berechnung von unten nach oben. Der grüne Zweig repräsentiert<br />
die Sensorik, der gelbe die Logik und der<br />
rote die Aktorik.<br />
Die nicht-elementaren Architekturen errechnen ihren<br />
eigenen PFD- und SIL-Wert der strukturellen Eignung<br />
aus den ihnen untergeordneten Architekturen. Die<br />
Berechnung wird konservativ durchgeführt, indem bei<br />
der Auswahl gleichartiger Werte immer der ungünstigere<br />
verwendet wird (in Bild 4 „Strukturelle Eignung“ ist<br />
SIL 2 und „Erreichter SIL“ ist SIL 1). Bei vereinfachter<br />
3003<br />
1002<br />
1001 1001 1001 1001<br />
1001<br />
1: Schematische Darstellung<br />
des SIL-Kreises<br />
Bild: ©alphaspirit - Fotolia.com<br />
Ihr Partner bei<br />
wirtschaftlichem<br />
Mischen...<br />
Mit uns gelangen Sie zur besten Lösung<br />
für Ihren Prozess und erhalten dadurch<br />
einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.<br />
Powtech 2013<br />
23. - 25. April 2013<br />
Nürnberg (Deutschland)<br />
Halle 5, Stand 5-356<br />
Gericke AG<br />
Althardstrasse 120<br />
CH - 8105 Regensdorf<br />
T +41 44 871 36 36<br />
F +41 44 871 36 00<br />
gericke.ch@gericke.net<br />
www.gericke.net<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
83
Automatisierung, Messtechnik<br />
2: Ablagestruktur für SIL-Kreise 3: Feinmodell von SIS-CA030.01<br />
Rechnung des PFD (Wahrscheinlichkeit des Ausfalls bei<br />
Anforderung) kann als Durchschnittswert der Maximalwert<br />
der untergeordneten Architekturen verwendet werden.<br />
Erreicht man damit den „SIL-soll“ (Bild 4), dann ist<br />
man auf der sicheren Seite. Eine korrekte Berechnung<br />
des PFD verwendet im Fall einer parallelen Struktur (M<br />
≠ N) das geometrische Mittel und im Fall einer seriellen<br />
Struktur (M = N) das arithmetische Mittel der untergeordneten<br />
Architekturen.<br />
Die Verknüpfung zwischen<br />
PLT-Planung und SIL-Berechnung<br />
Für die Realisierung der Funktionalität in Planeds spielt<br />
das freie Datenmodell eine zentrale Rolle. Alle Modellinformationen<br />
entstammen der Funktionswelt. Die Gerätespezifikationsdaten<br />
zur SIL-Berechnung und die<br />
Daten zur Verarbeitungsfunktion gibt es nur einmal.<br />
Das freie Datenmodell ist so konfiguriert, dass jeder<br />
dieser beiden Datensätze beliebig oft in einem SIL-Kreis<br />
zitiert werden kann. Dabei ist die Definition für „SIL-<br />
1oo1“ so vorgenommen, dass wenn immer im Arbeitsbereich<br />
„SIL-FW“ oder im Arbeitsbereich „SIL-Kreise“<br />
eine Änderung vorgenommen wird, diese überall wirksam<br />
ist. Die Verknüpfung beider Modelle geschieht dadurch,<br />
dass die Daten im Arbeitsbereich „SIL-FW“ kopiert<br />
und als Verweis im Arbeitsbereich „SIL-Kreise“<br />
eingefügt werden.<br />
Führt ein kürzeres Prüfintervall zu höherem SIL?<br />
Um diese Frage zu beantworten, muss der gesamte SIL-<br />
Kreis betrachtet werden. Die Frage, ob ein kürzeres<br />
Prüfintervall zu einem höheren SIL führt ist dann sinnvoll,<br />
wenn eine instrumentelle Änderung vermieden<br />
werden soll. Im hier dargestellten Beispiel liegt die Ursache<br />
für SIL1 in Herstellerangaben zu einem elektrischen<br />
Erhitzer. Er ist Bestandteil der „3oo3“-Architektur der<br />
Aktorik. Da die Berechnungsmethode das Prüfintervall<br />
als Parameter einbezieht, kann ein höherer SIL durch<br />
häufigere Prüfungen erreicht werden. Bild 4 zeigt oben<br />
den Zustand vor der Änderung des Prüfintervalls (jähr-<br />
84 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
lich) in der „3oo3“-Architektur und unten den Zustand<br />
nach Änderung des Prüfintervalls auf halbjährlich.<br />
Das Engineering-Werkzeug bietet den üblichen Benutzerkomfort<br />
bei der Erstellung eines SIL-Kreises.<br />
Modellieren aus dem Objektmanager oder auch aus der<br />
Grafik kann sich nach Belieben abwechseln und ergänzen.<br />
Allerdings werden die Resultate der Berechnung<br />
nur grafisch dargestellt. Die Darstellung der nicht-elementaren<br />
Hierarchie-Ebenen (N > 1) des SIL-Kreises<br />
lassen stets Korrekturen in den Angaben zum Durchschnittswert<br />
des PFD und der strukturellen Eignung zu.<br />
Besonders bei einer grenznahen Einstufung zwischen<br />
zwei SIL, kann es angeraten erscheinen, den niedrigeren<br />
SIL zu nehmen. Durch Eingabe von erläuternden Texten<br />
in die Zeichnung kann die Transparenz der Berechnung<br />
erhöht werden. Mit Hilfe der allgemeinen Report-Funktionalität<br />
der Software können weitere alphanumerische<br />
Dokumentationen erstellt werden. ●<br />
SIL-soll<br />
SIL-erreicht<br />
Strukturelle Eignung<br />
Sensorik<br />
PFD 0,0001168<br />
SE SIL 4<br />
SIL-soll<br />
SIL-erreicht<br />
Strukturelle Eignung<br />
Sensorik<br />
PFD 0,0001168<br />
SE SIL 4<br />
Link zum Anbieter oder mehr Artikel zum Thema<br />
SIL einfach QR-Code scannen oder reinklicken auf<br />
www.chemietechnik.de/1301ct612<br />
SIL 2<br />
SIL 1<br />
SIL 2<br />
Logik<br />
PFD 0,0000700<br />
SE SIL 3<br />
SIL 2<br />
SIL 2<br />
SIL 2<br />
Logik<br />
PFD 0,0000700<br />
SE SIL 3<br />
4: Darstellung der obersten SIL-Kreis-Ebene<br />
SIL-gesamt<br />
PFD-erreicht<br />
SIL-gesamt<br />
PFS-erreicht<br />
SIL 1<br />
0,0120368<br />
Aktorik<br />
PFD 0,0118500<br />
SE SIL 2<br />
SIL 2<br />
0,0061118<br />
Aktorik<br />
PFD 0,0059250<br />
SE SIL 2<br />
Bilder: Planets Software
Der Übergang von „Industrie 3.0“ zu „Industrie 4.0“ startet<br />
heute: Mit dem VDI Zukunftskongress 2013 „Industrie<br />
4.0“ wurden Ende Januar die Weichen für ein gigantisches<br />
deutsches Zukunftsprojekt gestellt, das uns alle in<br />
den nächsten Jahren und Jahrzehnten unausweichlich<br />
beschäftigen wird.<br />
Die Einladung erfolgte relativ kurzfristig. Trotzdem<br />
kamen über 200 Führungskräfte aus der Industrie, den<br />
Lehr- und Forschungseinrichtungen und den Verbänden<br />
nach Düsseldorf, um sich aktuell über die „Chancen<br />
und Herausforderungen für den Produktionsstandort<br />
Deutschland“ durch das sogenannte „Internet der Dinge“<br />
und „Industrie 4.0“ einen ganzen Tag lang informieren<br />
zu lassen. Was da geboten wurde, war ausgesprochen<br />
spannend und kompetent. In kurzer Taktfolge, unter der<br />
Automatisierung, Messtechnik<br />
VDI Zukunftskongress „Industrie 4.0“<br />
Gigantisches Zukunftsprojekt<br />
PRofi-Guide<br />
Funktion Branche<br />
Der Autor:<br />
Anlagenbau ●<br />
Chemie ●●●<br />
Pharma ●●●<br />
Ausrüster ●●●●●<br />
Planer ●<br />
Betreiber ●●●<br />
Einkäufer ●●●<br />
Manager ●●●●●<br />
Dieter Schaudel ist<br />
CT-Kolumnist und Inhaber<br />
des Beratungsunternehmens<br />
Schaudelconsult<br />
entScheideR-factS<br />
Für Manager<br />
●● Industrie 4.0 ist das Synonym für die sogenannte „Vierte industrielle Revolution“ – nach der Mechanisierung,<br />
der Industrialisierung und der Automatisierung nun also die Autonomik.<br />
●● Wegbereiter von Industrie 4.0 sollen die Cyber-Physikalischen Systeme (CPS) sein oder werden, die im „Internet<br />
der Dinge“ reale Produkte oder Produktionsverfahren mit der virtuellen Welt des Internet verbinden.<br />
●● Auf dem Kongress Industrie 4.0 wurde aus unterschiedlichsten Blickwinkeln darüber referiert, was wohl unausweichlich<br />
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf das produzierende Gewerbe zukommen wird.<br />
Moderation Prof. Dr. Birgit Vogel-Heuser, wurde aus<br />
unterschiedlichsten Blickwinkeln darüber referiert, was<br />
wohl unausweichlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten<br />
auf das produzierende Gewerbe in Deutschland<br />
und allen dort Beschäftigten zukommen wird und wie<br />
gut wir in Deutschland bereits darauf vorbereitet sind.<br />
Revolution in evolutionären Schritten<br />
Mindestens drei Gewissheiten konnte man getrost nach<br />
Hause tragen: Erstens wird „die Revolution in evolutionären<br />
Schritten“ ablaufen, wie Dr. Willi Fuchs, Direktor<br />
des Ingenieurvereins VDI, schon bei seinem Beitrag zur<br />
Eröffnung des Kongresses deutlich machte; zweitens<br />
haben wir in Deutschland im Weltvergleich eine sehr<br />
gute Ausgangsbasis mit dem Wissen und Können so-<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
85<br />
Bild: ©Kobes - Fotolia.com
Automatisierung, Messtechnik<br />
Die Teilnehmer der Podiumsdiskussionwaren:<br />
Dr. Frank Possel-<br />
Dölken, Dr. Peter Terwiesch,<br />
N. Fecht, Dr.<br />
Eberhard Veit, Harald<br />
Preiml, Dr. Kurt Bettenhausen<br />
86 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
wohl in den Ingenieur- und Informatikwissenschaften<br />
als auch in den produzierenden Industrien und dem<br />
Gewerbe; drittens aber gibt es noch einige technologische,<br />
viele normative und administrative und jede Menge<br />
kulturelle Aufgaben zu bewältigen, bis in fünf, zehn<br />
oder 20 Jahren das „Internet der Dinge“ in unserer Produktionswelt<br />
alltäglich geworden sein wird, wobei zwar<br />
die Fertigungsindustrien und die Logistik zeitlich vorauslaufen<br />
werden, die Prozessindustrien aber in kurzem<br />
Abstand folgen (müssen).<br />
Positiv ist, dass die deutsche Politik den Ruf der Wissenschaft<br />
und Wirtschaft gehört hat und den Wandel<br />
bereits kräftig finanziell und administrativ forciert und<br />
dies auch weiter tun wird.<br />
Um was es geht<br />
„Industrie 4.0“ und „Cyber Physical Systems (CPS)“<br />
heißen die Zauberworte, die uns allen eine „schöne neue<br />
Welt“ (Vogel-Heuser) versprechen. Industrie 4.0, laut<br />
Prof. Dr.-Ing. Dieter Wegener, Vice President Advanced<br />
Technologies and Standards bei Siemens , „eine deutsche<br />
Initiative“, ist das Synonym für die sogenannte „Vierte<br />
industrielle Revolution“ – nach der Mechanisierung<br />
(zum Ende des 18. Jahrhunderts), der Industrialisierung<br />
Dr. Willi Fuchs ist Direktor des VDI<br />
„Diese Revolution wird in evolutionären<br />
Schritten ablaufen“<br />
Prof. Dr.-Ing. Dieter Wegener ist Vice President Advanced<br />
Technologies and Standards bei Siemens<br />
„Der Übergang von ,Industrie 3.0‘ zu<br />
,Industrie 4.0‘ startet heute“<br />
(ab Beginn des 19. Jahrhunderts) und der Automatisierung<br />
(ab Mitte der 70-er Jahre des letzten Jahrhunderts)<br />
nun also die Autonomik. Wegbereiter von Industrie 4.0<br />
sollen die Cyber-Physikalischen Systeme (CPS) sein<br />
oder werden, die im „Internet der Dinge“ reale Produkte<br />
oder Produktionsverfahren mit der virtuellen Welt des<br />
Internet verbinden und dadurch auf völlig neue Weise<br />
mit Informationen anreichern und vernetzen. CPS umfassen<br />
typischerweise „Eingebettete Systeme“ (als Teile<br />
von Geräten, Gebäuden, Verkehrsmitteln, Verkehrswegen,<br />
Produktionsanlagen, Logistik- und Managementprozessen<br />
etc.), die<br />
● mittels Sensoren und Aktuatoren unmittelbar physikalische<br />
Daten erfassen und auf physikalische Vorgänge<br />
einwirken,<br />
● mit digitalen Netzen verbunden sind (drahtlos,<br />
drahtgebunden, lokal, global),<br />
● weltweit verfügbare Daten und Dienste nutzen und<br />
● über eine Reihe multimedialer Mensch-Maschine-<br />
Schnittstellen verfügen.<br />
„Smarte Komponenten, gewonnen durch Modellbildung<br />
von Objekten und Systemen, werden aggregiert zu<br />
smarten Maschinen und diese wiederum zur smarten<br />
Fabrik“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Detlef Zühlke vom Deutschen<br />
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz<br />
(DKFI). „Die virtuelle Welt und die reale werden zusammenwachsen“,<br />
ist Wegener überzeugt.<br />
Was wir brauchen<br />
Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, der Jahre, wenn<br />
nicht Jahrzehnte dauern wird und nur schrittweise gegangen<br />
werden kann, darin waren sich alle Referenten<br />
einig. Wenn man versucht, aus den 14 Beiträgen und der<br />
Abschlussdiskussion eine priorisierte „To-do-Liste“ aufzustellen,<br />
dann sieht die aus Sicht der Referenten ungefähr<br />
so aus:<br />
● Alle müssen am gleichen Strang ziehen – und bitteschön<br />
in dieselbe Richtung. „Alle“ meint Industrie,<br />
Wissenschaft und Politik und insbesondere die Verbände<br />
und Vereinigungen Bitkom , GMA , VDI , VDE , DKE ,<br />
DIN , VDMA und ZVEI . Der Schwung des Aufbruchs<br />
muss weitergehen.<br />
● Ohne Cloud wird es keine Industrie 4.0 geben und<br />
ohne Security keine Cloud. Da braucht es neue globale<br />
Standards.<br />
● Proprietäre Lösungen müssen von Anfang an verhin-
dert bzw. beseitigt werden. Offene durchgängige IT-<br />
Systeme und Logistik-Standards sind speditiv weltweit<br />
zu vereinbaren. Eine Technologie-Roadmap muss her.<br />
● Es geht primär um den Nutzen für die Menschen,<br />
nicht um Technologie. Sie, die Menschen, müssen von<br />
Beginn an mitgenommen werden, und zwar alle: Unternehmer,<br />
Manager, Ingenieure und Informatiker, Meister,<br />
Facharbeiter und Angelernte. Ihre Ausbildung, ihre<br />
Qualifikation ist erfolgsentscheidend. Dazu sind in den<br />
Unternehmen auch Kultur-Evolutionen unausweichlich.<br />
„Der Mensch steht im Mittelpunkt.“<br />
● Neue Geschäftsmodelle mit Technologie und den<br />
Nutzen mit der Architektur der Wertschöpfung zu verknüpfen<br />
(Vorbild Apple), darum geht es.<br />
● Und last but not least: „Von der Natur lernen“, wie<br />
Festo-Vorstand Dr.-Ing. Eberhard Veit an Beispielen aus<br />
seiner Firma eindrücklich belegte.<br />
Was wir erwarten können<br />
„Wir haben in der Produktionstechnik, in der Automatisierungstechnik<br />
und in der Informations- und Kommunikationstechnik<br />
mehr Wissen und Erfahrung als alle<br />
anderen. Dies müssen wir einsetzen, um Produktion in<br />
Deutschland und Europa zu halten und auszubauen“,<br />
beschreibt VDI-Chef Fuchs. Gleiches gilt für die Logistik,<br />
die sich als IT-Dienstleister ergänzen wird (muss).<br />
„Ohne die Methoden und Werkzeuge der Industrie 4.0<br />
werden wir in der Logistik die gestiegene und weiter<br />
steigende Komplexität nicht bewältigen können“, ist<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael ten Hompel, geschäftsführender<br />
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts Materialfluss und<br />
Logistik in Dortmund, überzeugt.<br />
„Fertigungen, Logistikketten, unser Arbeitsplatz als<br />
Autofahrer, unser Mobilitätsverhalten und nicht zuletzt<br />
die Rolle und Aufgaben aller Menschen, und besonders<br />
der Beschäftigten, werden sich enorm verändern“, verdeutlicht<br />
Dr. Ulrich Kienzle, Direktor der Konzernfor-<br />
„Die Informations- und Kommunikationstechnologie<br />
hat heute einen Reifegrad erreicht, der bestehende<br />
Paradigmen sprunghaft verändern könnte“<br />
schung bei Daimler. Eines der Endziele ist es, dass Produkte<br />
und Entscheidungsprozesse Wertschöpfungsnetzwerke<br />
in Echtzeit steuern, autonom und wenn notwendig<br />
auch global – das wird nicht ohne den qualifizierten<br />
Menschen gehen. Wir brauchen in unseren Fertigungen<br />
„die gesicherte maximale Ausbringung“ (Possel-Dölken).<br />
Denn „wir müssen um das besser sein, was wir<br />
teurer sind“ (Veit). „Die Welt wird elektrischer, Menschen<br />
und Roboter werden kooperieren“ (Terwiesch).<br />
Bei aller Aufbruchsstimmung und Entschlossenheit:<br />
„Die Informations- und Kommunikationstechnologie<br />
hat heute einen Reifegrad erreicht, der bestehende Paradigmen<br />
sprunghaft verändern könnte. ... Disruptive Innovationen,<br />
von woher auch immer, könnten technologische<br />
„Tipping-Points“ erreichen, die den evolutionären<br />
Prozess in einen revolutionären kippen ließen“. Diese<br />
Warnung von Prof. Dr.-Ing. Michael Weyrich vom Institut<br />
für Automatisierungs- und Softwaretechnik der Uni<br />
Stuttgart ist ernst zu nehmen! Deshalb ist keine Zeit zu<br />
verlieren. Allerdings: „Mit zunehmender Vernetzung<br />
und Standardisierung wird die Autonomie, die Wandlungsfähigkeit<br />
und die Flexibilität in den Fertigungen<br />
beschnitten“, gibt Dr.-Ing. Frank Possel-Dölken, Director<br />
Manufacturing Systems bei Phoenix Contact, zu bedenken.<br />
„Hier müssen balancierte neue Lösungen gefunden<br />
werden“, forderte er. Aber auch: „Wer<br />
sich nicht anpasst, der wird verlieren“ (Veit)<br />
– als Volkswirtschaft, als Unternehmer oder<br />
als Beschäftigter. Und: „Der Rest der Welt<br />
schläft nicht“, wie Dr. Kurt Bettenhausen,<br />
Vorsitzender der GMA, aus seinen Erfahrungen<br />
in China und USA berichtete; dort werde<br />
schon seit Jahren an großen, staatlich geförderten Vorhaben<br />
auf diesem Gebiet gearbeitet.<br />
Fazit: Die angeregten Diskussionen (leider nur in den<br />
Pausen) zeigten, dass das Thema heiß und das Interesse<br />
groß ist. „Machen! Nicht lang reden!“ war denn auch die<br />
Aufforderung von Prof. ten Hompel, der sich auch die<br />
Teilnehmer in der kurzen Abschlussdiskussion anschlossen.<br />
„Wir müssen die positive Grundstimmung nutzen“.<br />
Denn „der Übergang von Industrie 3.0 über Industrie<br />
3.x zu Industrie 4.0 startet heute“, wie Dr. Dieter Wegner<br />
treffend bemerkte. Tröstend aber die Feststellung von<br />
Prof. ten Hompel: „Es wird keine neue Weltordnung<br />
geben. Die Zukunft der Welt wird sich selbst ordnen.“ ●<br />
Automatisierung, Messtechnik<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael ten Hompel ist geschäftsführender<br />
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts Materialfluss und<br />
Logistik , Dortmund<br />
„Ohne Cloud keine vierte industrielle<br />
Revolution“<br />
Dr. Peter Terwiesch ist Vorstandsvorsitzender von ABB<br />
„Die Evolution von 3.0 zu 4.0 als Summe<br />
vieler S-Kurven“<br />
Dr.-Ing. Eberhard Veit ist Vorstandsvorsitzender von Festo<br />
„Organisation 4.0 als Chance: Wer sich nicht<br />
anpasst, wird verlieren“<br />
Weitere Bilder und Zitate sowie ein Link zum<br />
BMBF-Zukunftsprojekt Industrie 4.0 könnten für<br />
Sie interessant sein? Für den schnellen Zugriff<br />
surfen Sie zu www.chemietechnik.de/1301ct613<br />
oder scannen Sie den QR-Code ein!<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
87
Automatisierung, Messtechnik<br />
Multiparametermessgerät<br />
Weitbereichsnetzteil erlaubt Einsatz<br />
verschiedener Sensortypen<br />
• Highpower-Weitbereichsnetzteil<br />
• keine Verschleißkomponenten<br />
• für Ex-Zone 2<br />
Stratos Evo von Knick ist ein 4-Leiter-Multiparametergerät<br />
zur Messung von pH-Wert, Redox-Potenzial,<br />
Leitfähigkeit (konduktiv oder induktiv) oder<br />
Gelöstsauerstoff. Sein Weitbereichsnetzteil gestattet<br />
neben Analog- und Memosens-Sensoren auch<br />
die Verwendung optischer Sauerstoffsensoren. Im<br />
Vergleich zu herkömmlichen Sauerstoffsensoren<br />
sind die optischen Varianten störungsunempfindlich<br />
und verfügen über keine verschleißenden<br />
Komponenten wie mechanisch empfindliche Membrane<br />
oder alternde Elektrolyte. An das Multiparametergerät<br />
können auch externe 2-Leiter-Messumformer,<br />
beispielsweise Druck- oder Temperaturmessumformer,<br />
angeschlossen werden. Das<br />
jeweilige Signal kann über den 4...20-mA-Eingang<br />
durchgeschleift und angezeigt werden. Wie auch<br />
sein naher Verwandter Stratos Pro verfügt Stratos<br />
Evo über eine intuitive Bedienung mit farbgeleite-<br />
Infrarotthermometer<br />
Sichere Diagnose<br />
• optische Auflösung 12:1<br />
• Messbereich -60 bis 550 °C<br />
• Ansprechzeit unter 1 s<br />
Das Scantemp 430 von Dostmann ist<br />
ein tragbares, ergonomisch geformtes<br />
und vor Spritzwasser geschütztes<br />
Profi-Infrarotthermometer mit<br />
Doppellaser. Die Glasoptik erzielt eine<br />
optische Auflösung von 12:1. So<br />
sind auch kleine Objekte messbar.<br />
Der Emissionsgrad ist von 0,10 bis<br />
1,00 einstellbar. Es misst auf vielen<br />
Oberflächen.<br />
chemietechnik.de/1302ct096<br />
88 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
ter Benutzerführung. Das Widescreen-Display signalisiert<br />
in sechs verschiedenen Farbtönen die jeweiligen<br />
Betriebszustände: Der normale Messmodus<br />
ist weiß hinterleuchtet, Anzeigen im Informationsmodus<br />
leuchten grün. Außerdem sind das<br />
Diagnosemenü, der Wartungsbedarf und der Hold-<br />
Zustand an jeweils eigenen Farben ersichtlich. Der<br />
Regelsystem<br />
Intuitive Bedienung<br />
• skalierbar auf alle Anforderungen<br />
• keine mechanische Begrenzung<br />
• vereinfachtes Ersatzteilhandling<br />
Mit dem intelligenten Regelsystem<br />
Icon bietet EMG eine Baureihe für<br />
alle Anwendungen inklusive einer<br />
neuen graphischen Benutzerschnittstelle<br />
mit Touchscreen-Funktion<br />
(Icon VS). Das System ist skalierbar<br />
auf alle Anwenderanforderungen, da<br />
verschiedene Module individuell auf<br />
einer Hutschiene angeordnet und<br />
miteinander kombiniert werden<br />
können. Aufgrund der kompakten<br />
Bauweise unterliegt das System<br />
keinen mechanischen Begrenzungen<br />
und ist in der Nutzung äußerst<br />
flexibel. Die Verbindung der einzelnen<br />
Module erfolgt über Feldbus<br />
Canopen. Das Ersatzteilhandling ist<br />
durch die Kombination mehrerer<br />
kompakter Einzelmodule stark vereinfacht.<br />
chemietechnik.de/1302ct159<br />
Druckkalibrator<br />
Eigensichere Ausführung<br />
• 24 Messbereiche<br />
• bis 700 bar<br />
• für -40 bis 150 °C<br />
Mit einer Genauigkeit von 0,025 %<br />
der Spanne und diversen Zusatzfunktionen<br />
eignet sich der eigensichere<br />
Druckkalibrator Typ CPH65I0<br />
von Wika für ein breites Einsatzspektrum,<br />
aufgrund der Atex-Zulassung<br />
auch in explosionsgefährdeten Bereichen.<br />
Das neue Hand-Held ist<br />
wahlweise mit einem oder zwei<br />
integrierten Referenz-Drucksensoren<br />
lieferbar. Damit lassen sich 24<br />
unterschiedliche Messbereiche bis<br />
700 bar abdecken. Der Kalibrator<br />
nimmt außerdem Transmitter-Ausgangssignale<br />
(0 ... 24 mA) auf und<br />
misst über ein Widerstandsthermometer<br />
die Umgebungs- und Medientemperatur<br />
(-40 bis 150 °C). Eine<br />
Testfunktion für Druckschalter rundet<br />
die Ausstattung ab. Somit können<br />
Anwender mit dem Kalibrator<br />
Druckmessgeräte jeder Art kalibrie-<br />
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Seite: www.chemietechnik.de/1301ct911 oder<br />
QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
Alarmstatus zeigt sich in tiefem Rot und ein rotes<br />
Blinken des Displays weist auf unzulässige Eingaben<br />
oder falsche Passzahlen hin. Das Gerät kann in<br />
explosionsgefährdeten Umgebungen der Zone 2<br />
verwendet werden.<br />
chemietechnik.de/1302ct057<br />
ren. Trotz seiner Multifunktionalität<br />
ist das robuste Gerät über drei Tasten<br />
leicht zu bedienen. Das Display<br />
mit Hintergrundbeleuchtung kann<br />
drei Messparameter gleichzeitig anzeigen.<br />
Die Batterieversorgung ist für<br />
mindestens 35 Betriebsstunden ausgelegt.<br />
Powtech Halle 6 – 460<br />
chemietechnik.de/1302ct083
Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu<br />
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser<br />
Seite: www.chemietechnik.de/1301ct912 oder<br />
QR-Code mit Tablet oder Smartphone scannen!<br />
Punktschweißroboter<br />
Macht den Arm lang<br />
• niedriges Eigengewicht<br />
• geringer Platzbedarf<br />
• durchgängige sechste Achse<br />
Die BX-Roboter von Kawasaki sind<br />
platzsparend, leicht und haben eine<br />
geringe Stromaufnahme. Das Modell<br />
BX100N hat eine Reichweite von<br />
2.200 mm bei einer Traglast von<br />
100 kg und 740 kg Eigengewicht;<br />
bei dem BX200L beträgt die Reichweite<br />
2.597 mm, die Traglast 200 kg<br />
sowie das Eigengewicht 930 kg.<br />
chemietechnik.de/1302ct111<br />
Durchflussmessgerät<br />
Verbrauch exakt<br />
• punktgenaue Auswertung<br />
• für kleine Volumenströme<br />
• 16 bis 40 bar Betriebsdruck<br />
Die Durchflussmesser EE771, EE772<br />
und EE776 von E+E Elektronik ermöglichen<br />
eine genaue Auswertung<br />
im gesamten Leitungsnetz vom<br />
Kompressor bis zum Endverbraucher.<br />
Auch kleine Volumenströme<br />
werden genau erfasst. Gemessen<br />
werden kann dabei in Rohrleitungen<br />
von DN15 (½ ‘‘) bis DN300 (12 ‘‘) und<br />
einem Betriebsdruck bis 16 bzw. 40<br />
bar.<br />
chemietechnik.de/1302ct058<br />
Temperaturkalibrator<br />
Portabel kalibrieren<br />
• Prüflinge geschützt<br />
• Luftstömungssystem<br />
• hohe Genauigkeit<br />
Die portable Metallblock-Temperaturkalibrator<br />
LR-Cal Pyros-125 von<br />
Leitenberger wiegt weniger als 5 kg<br />
und bietet trotz seiner kompakten<br />
Abmessungen eine Eintauchtiefe von<br />
max. 104 mm. Das spezielle Luftströmungssystem<br />
im Gehäuseinneren<br />
schützt die Prüflinge und deren<br />
Anschlussverbindungen und ermöglicht<br />
schnelles Heizen und Kühlen.<br />
chemietechnik.de/1302ct040<br />
Barcodeleser<br />
Um die Ecke schauen<br />
• Schwenkwinkel ±20 °<br />
• Schwenkfrequenz bis 10 Hz<br />
• modularer Aufbau<br />
Die Baureihe modularer Barcodeleser<br />
BCL 300i hat Leuze um eine Gerätevariante<br />
mit Schwenkspiegel<br />
erweitert,was seine Anwendungsmöglichkeiten<br />
erweitert. Der<br />
Schwenkspiegel lenkt die Scanlinie<br />
nach beiden Seiten mit einer frei<br />
einstellbaren Schwenkfrequenz ab.<br />
Der Barcodeleser kann größere Flächen<br />
bzw. Raumbereiche nach Barcodes<br />
absuchen.<br />
chemietechnik.de/1302ct119<br />
Steuerungssystem<br />
Für sicheren Betrieb<br />
• temperaturbeständig bis 70 °C<br />
• offenes Kommunikationsprotokoll<br />
• digitale und analoge E/A-Module<br />
Die erweiterte Version der sicherheitsgerichteten<br />
Steuerung Prosafe-<br />
RS Version R3.02.00 von Yokogawa<br />
ist mit Eingangs-/Ausgangsmodulen<br />
ausgestattet, die einen zuverlässigen<br />
Anlagenbetrieb auch bei hohen Temperaturen<br />
ermöglichen. Sie unterstützt<br />
ein offenes Kommunikationsprotokoll,<br />
das die Kompatibilität mit<br />
Prozessleitsystemen anderer Anbieter<br />
verbessert. Da in der Öl- und<br />
Gasförderung ebenso wie in der Pet-<br />
Automatisierung, Messtechnik<br />
rochemie und der Chemie ein wachsender<br />
Bedarf an sicherheitsgerichteten<br />
Steuerungssystemen, die ungewöhnliche<br />
Betriebssituationen<br />
rechtzeitig erkennen und bei Bedarf<br />
eine Notabschaltung der Anlagen sicher<br />
einleiten, besteht, hat die Steuerung<br />
speziell entwickelte hochtemperaturbeständige<br />
digitale und analoge<br />
Eingangs- und Ausgangsmodule.<br />
Die Steuerung unterstützt<br />
Modbus-/TCP-Kommunikation mit<br />
anderen Systemen.<br />
Kommunikationssystem<br />
Anlagenprobleme aus der Ferne lösen<br />
• freihändige Sprachkommunikation<br />
• hochauflösend<br />
• Touch-Screen-Interface<br />
Emerson hat zusammen mit Audisoft<br />
ein Kommunikationssystem zur freihändigen<br />
Sprach- und Videokommunikation<br />
für Arbeiten in Anlagen entwickelt.<br />
Mobile Worker Voice and Video<br />
ermöglicht dem Bedienpersonal<br />
vor Ort die interaktive Problemlösung<br />
zusammen mit externen Experten,<br />
die fernab von der Anlage sind. Es<br />
hat eine hochauflösende Sprachund<br />
Videotechnologie. Diese kann<br />
vom Anlagenpersonal beispielsweise<br />
in abgelegenen Einsatzorten weltweit<br />
genutzt werden. Die Ingenieure<br />
im Feld können über Wi-Fi, Mobilfunkverbindung<br />
oder Satellit direkt<br />
und live mit räumlich entfernten Experten<br />
eine sichere Bild- und Tonverbindung<br />
aufbauen. Diese erkennen<br />
und diagnostizieren das Problem auf<br />
ihrem Laptop oder PC und geben<br />
dem Personal Instruktionen zu des-<br />
chemietechnik.de/1302ct049<br />
sen Lösung. Das mobile System beinhaltet<br />
eine Videokamera, ein Mikrofon<br />
und ein kleines Touch-Screen-<br />
Interface. Einsatz in Ex-Zone 2.<br />
chemietechnik.de/1302ct030<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
89
Markt<br />
Jährliche CID-Umfrage<br />
Chemie erreicht Höchstwerte<br />
ProfI-GuIde<br />
Funktion Branche<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ● ● ●<br />
Ausrüster ● ● ●<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer ● ● ●<br />
Manager ● ● ●<br />
Der Autor:<br />
Jörg-Olaf Jansen,<br />
Öffentlichkeitsarbeit,<br />
VCI<br />
Mit 74 Prozent verzeichnet<br />
die Industrie ihre bisher<br />
höchste Zustimmung<br />
90 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
entsCHeIder-faCts<br />
Umfragehoch für die chemische Industrie<br />
● Mit 74 Prozent Zustimmung innerhalb der Bevölkerung verzeichnete die Branche im Jahr 2012 ihren bisher<br />
besten Umfragewert.<br />
● 79 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die chemische Industrie unverzichtbare Produkte für ihren<br />
Alltag herstellt.<br />
● 97 Prozent sind der Auffassung, dass eine starke Industrie sehr wichtig oder wichtig für Deutschland ist. Allerdings<br />
mit einer Tendenz von „sehr wichtig“ zu „wichtig“<br />
Besser war es noch nie: Die chemische Industrie hat im<br />
Sommer 2012 ihre bisher höchsten Zustimmungswerte<br />
erreicht. 74 Prozent der Bevölkerung haben ein überwiegend<br />
positives Bild von der Branche. Unter den Entscheidern<br />
teilen sogar 81 Prozent dieses Urteil. In einem<br />
Vergleich von neun Branchen belegte die Chemieindustrie<br />
in der Gesamtbewertung hinter der Automobil- und<br />
Elektro(nik)-Industrie den dritten Platz. Das ist das Ergebnis<br />
der repräsentativen Umfrage, die das Institut<br />
Trend & Motives jährlich im Auftrag der Initiative Chemie<br />
im Dialog (CID) durchführt. Das Institut befragte<br />
dazu mehr als 1.500 Personen, unterteilt in Vertreter der<br />
Bevölkerung, Entscheider sowie sogenannte ‚Junge Gebildete‘.<br />
Spitzenwerte erreicht die Branche auch, wenn es<br />
um den Nutzen ihrer Produkte geht: 79 Prozent glauben,<br />
dass die chemische Industrie unverzichtbare Produkte<br />
für den Alltag herstellt. 77 Prozent meinen, die Branche<br />
leiste wichtige Beiträge zur Lebensqualität. Ein Gefälle<br />
gibt es bei den Fragen nach Akzeptanz und Vertrauen.<br />
Zwar akzeptieren 72 Prozent die Chemieindustrie, jedoch<br />
nur 56 Prozent vertrauen ihr auch. „Insgesamt haben<br />
wir bei der Frage zum Vertrauen aber in allen drei<br />
Teilgruppen einen leichten Zuwachs. Auch liegt der<br />
Wert seit 2010 stabil über 50 Prozent. Im Vergleich zu<br />
früheren Jahren ist das eine gute Entwicklung“, kommentiert<br />
Stefan Hilger, Geschäftsführer der CID.<br />
Infrastrukturprojekte:<br />
Zustimmung, jedoch unter Vorbehalt<br />
Veränderungen gibt es beim Meinungsklima zum Industriestandort<br />
Deutschland. Zwar meinen 97 Prozent, dass<br />
eine starke Industrie sehr wichtig oder wichtig für<br />
Bild: © VRD – Fotolia.com
Globalbeurteilung der Chemie im Branchenvergleich<br />
Gesamtbevölkerung (gewichteter Gesamtwert aus breite<br />
Gesamtbevölkerung Bevölkerung, (gewichteter Jünger Gesamtwert Gebildeten aus und Entscheidern)<br />
breite Bevölkerung, jünger Gebildeten und Entscheidern)<br />
Automobil-Industrie<br />
Elektro(nik)-Industrie<br />
Chemische Industrie<br />
Kunststoff-Industrie<br />
Pharma-Industrie<br />
Durchschnitt<br />
Versicherungs-Wirtschaft<br />
Elektrizitäts-Wirtschaft<br />
Banken- & Kreditgewerbe<br />
Mineralölwirtschaft<br />
Meinungsklima zum Industriestandort Deutschland<br />
Akzeptanz von industriellen Großprojekten: Wenn ein behördlich<br />
genehmigtes Großprojekt (Flughafenausbau, neuer Bahnhof) in Ihrer<br />
Wohngegend verwirklicht werden sollte, was würden Sie tun?:<br />
begrüßen/befürworten<br />
akzeptieren<br />
ablehnen<br />
dagegen angehen<br />
wäre mir gleichgültig<br />
kommt auf Details an<br />
Deutschland ist. Allerdings verschiebt sich die Einschätzung<br />
von „sehr wichtig“ zu „wichtig“. Nur noch 32 Prozent<br />
glauben ohne Einschränkung, dass die Industrie<br />
verlässlichere und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen<br />
braucht, ein Minus von 10 Prozentpunkten. Die<br />
CID-Umfrage erhob auch die Meinung zu großen Infrastrukturprojekten.<br />
Das Ergebnis: Infrastrukturprojekte<br />
treffen nicht von vorneherein auf mehrheitliche Akzeptanz,<br />
auch nicht bei Entscheidern. Eine Gruppe von 38<br />
Prozent sieht solche Projekte eher positiv, 31 Prozent<br />
machen ihre Zustimmung vom Detail abhängig und eine<br />
Gruppe von 27 Prozent lehnt sie ab oder würde sogar<br />
dagegen vorgehen. Als Hauptgründe für die Ablehnung<br />
werden „geringer Nutzen für die Allgemeinheit“, „Belastung<br />
der Anlieger“, „Umwelt geht vor“ und „mangelnde<br />
Bürgerbeteiligung und Transparenz“ genannt. Rückläu-<br />
4<br />
7<br />
10<br />
17<br />
31<br />
31<br />
38<br />
39<br />
47<br />
47<br />
52<br />
74<br />
71<br />
74<br />
73<br />
72<br />
66<br />
66<br />
64<br />
62<br />
57<br />
59<br />
85<br />
85<br />
85<br />
82<br />
2012 Juli<br />
2011 Juli<br />
Entscheider Junge Bevölkerung<br />
Gebildete<br />
12 4 7<br />
33 26 32<br />
14 12 20<br />
6 16 10<br />
1 3 6<br />
36 39 26<br />
fig ist die Zustimmung gegenüber der Energiewende, die<br />
mit 67 Prozent aber eine weiterhin deutliche absolute<br />
Mehrheit erzielt. Starke Verluste verzeichnet die Bereitschaft,<br />
höhere Strompreise für die Energiewende zu<br />
zahlen. Der Betrag, den die Bürger mehr zahlen würden,<br />
ist um ein Viertel gesunken. Hilger berichtet: „Die Kosten<br />
für die Energiewende rücken immer mehr in den<br />
Fokus. Und zum Zeitpunkt der Umfrage war der Öffentlichkeit<br />
noch nicht bekannt, um wie viel die EEG-Umlage<br />
2013 steigen wird.“ ●<br />
Weitere Meldungen des VCI, sowie einen direkten<br />
Link zum Internetauftritt des Industrieverbandes<br />
finden Sie unter www.chemietechnik.de/1301ct631<br />
– oder ganz bequem den QR-Code einscannen!<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Markt<br />
Im Branchenvergleich<br />
belegt die Chemieindustrie<br />
den dritten Platz<br />
Quelle: Trend & Motives<br />
Quelle: Trend & Motives<br />
Infrastrukturprojekte<br />
treffen nicht immer von<br />
vorneherein auf mehrheitliche<br />
Akzeptanz<br />
91
Markt & Kontakt<br />
Abfüllstationen<br />
BEER – Fördertechnik<br />
Am 64732 Kirchpfad Bad König 10<br />
D-64739 Höchst<br />
Tel. 0 61 63 / 93 03-30<br />
Telefon (0 61 63) 93 03 30<br />
Telefax Fax 0 61 (0 61 63 63) / 93 93 03-50 03 50<br />
www.beer-ft.de<br />
info@beer-ft.de<br />
Abfülltechnik<br />
Arbeitsschutz<br />
EINWEG- und ARBEITSSCHUTZ<br />
VON KOPF BIS FUSS<br />
Armaturen<br />
more than<br />
stainless steel<br />
Armaturen- und Tankgerätebau <strong>GmbH</strong> & Co. KG<br />
Konrad-Zuse-Straße 12<br />
D-65582 Diez a.d. Lahn<br />
www.arta-gmbh.de<br />
3M, Scott, Dräger,<br />
DuPont, EAR, Aearo,<br />
Bilsom, KCL,<br />
Ansell, Semper, Sievi,<br />
Abeba, Planam, Plum,<br />
Fristads<br />
ONLINE-SHOP<br />
www.finnimport.de<br />
Finnimport <strong>GmbH</strong><br />
Borsteler Chaussee 85-99 A<br />
22453 Hamburg · info@finnimport.de<br />
T. 040-6442309-0 · F. 040-6442309-90<br />
Tel. +49 (0) 6432-9147-40<br />
Fax +49 (0) 6432-9147-12<br />
e-mail: info@arta-gmbh.de<br />
Bleche & Stangen<br />
Der Lagerhalter für Hochleistungswerkstoffe!<br />
Nickellegierungen, Titan und Zirkonium<br />
Alloy 59/ Alloy 31/ Alloy 602ca/<br />
Inconel 625/ Hasteloy C-4<br />
Integriertes Anarbeitungscenter<br />
www.hempel-metals.com<br />
Tel.: 0208-62 04 0<br />
492 CHEMIE TECHNIK · · Januar/Februar<br />
2013<br />
Bodenablass-Kugelhahn<br />
Dampferzeuger<br />
CERTUSS Dampfautomaten<br />
<strong>GmbH</strong> & Co. KG<br />
Hafenstr. 65<br />
D-47809 Krefeld<br />
Tel.: +49 (0)2151 578-0<br />
Fax: +49 (0)2151 578-102<br />
E-Mail: krefeld@certuss.com<br />
www.certuss.com<br />
Dichtungen<br />
C. Otto Gehrckens · <strong>GmbH</strong> & Co. KG<br />
Dichtungstechnik<br />
Gehrstücken 9 · D-25421 Pinneberg<br />
Telefon: (0 41 01) 50 02 - 0<br />
Telefax: (0 41 01) 50 02 - 83<br />
Internet: www.cog.de · e-mail: info@cog.de<br />
Dichtungstechnik<br />
Dosieranlagen<br />
Wir machen Dampf<br />
Dichtungstechnik / O-Ringe<br />
- Dichtungstechnik<br />
- Dichtungstechnik<br />
Kunststofftechnik<br />
- Kunststofftechnik<br />
Gummiformteile<br />
- Gummiformteile<br />
Antriebsriemen<br />
- Antriebsriemen<br />
CIMAKA International <strong>GmbH</strong><br />
Auslieferungslager Deutschland<br />
CIMAKA Industriestraße International 4 <strong>GmbH</strong><br />
Auslieferungslager 79801 HohentengenDeutschland<br />
Industriestraße Tel.: 07742 8578-57 4<br />
79801 E sales1@cimaka.com<br />
Hohentengen<br />
Tel.: I www.cimaka.com<br />
07742 8578-57<br />
E Tel.: sales1@cimaka.com<br />
07742 8578 57<br />
I E www.cimaka.com<br />
sales1@cimaka.com<br />
I www.cimaka.com<br />
KTG ENGELHARDT <strong>GmbH</strong><br />
Reichelsdorfer Hauptstraße 161<br />
D - 90453 Nürnberg<br />
Tel.: 0911.96 44 936 · Fax 0911.96 44 938<br />
E-Mail: info@ktg-engelhardt.de<br />
www.ktg-engelhardt.de<br />
Dosiertechnik<br />
sera ProDos <strong>GmbH</strong><br />
sera-Strasse 1, 34376 Immenhausen<br />
Tel. (05673)-999-02<br />
Fax (05673)-99 9-03<br />
info-prodos@sera-web.com,<br />
www.sera-web.com<br />
Elektrostatische Erdung<br />
Entleerstation<br />
BEER – Fördertechnik<br />
Am 64732 Kirchpfad Bad König 10<br />
D-64739 Höchst<br />
Tel. 0 61 63 / 93 03-30<br />
Telefon (0 61 63) 93 03 30<br />
Telefax Fax 0 61 (0 61 63 63) / 93 93 03-50 03 50<br />
www.beer-ft.de<br />
info@beer-ft.de<br />
Diese Anzeige kostet nur<br />
€ 61,80 pro Ausgabe!<br />
Fest- Flüssig Trennung<br />
Fittings/Ventile<br />
Lohnherstellung<br />
LOOP GMBH<br />
Am Nordturm 5<br />
46562 Voerde<br />
Tel.: 0281/206 909-0 • Fax: 0281/831 37<br />
mail@loop-gmbh.de • www.loop-gmbh.de<br />
Pumpen<br />
Sterling SIHI <strong>GmbH</strong><br />
Lindenstraße 170<br />
25524 Itzehoe<br />
Telefon 0 48 21 / 771-01, Fax -274<br />
Rechtsanwälte<br />
Josten • Müggenborg • Weyers<br />
Rechtsanwälte<br />
Prof. Dr. Hans-Jürgen Müggenborg<br />
Rechtsanwalt und Fachanwalt für<br />
Verwaltungsrecht, Lehrbeauftragter für<br />
Umweltrecht Universität Kassel<br />
berät und vertritt Sie in folgenden<br />
Tätigkeitsschwerpunkten:<br />
Umwelt- und Technikrecht<br />
Behördenmanagement<br />
Gestaltung/Prüfung<br />
von (Chemiepark-)Verträgen<br />
Oppenhoffallee 2, D-52066 Aachen<br />
Telefon: (02 41) 94 947-0<br />
Telefax: (02 41) 94 947-47<br />
E-Mail: info@kanzlei-jmw.de<br />
Rohr- und<br />
Schlauchverbindungen<br />
Schnellkupplungssysteme<br />
Carl Kurt Walther <strong>GmbH</strong> & Co. KG<br />
Tel.: 02129/567-0<br />
www.walther-praezision.de<br />
Diese Anzeige kostet nur<br />
€ 61,80 pro Ausgabe!
Rohrbogen/Rohrverbinder<br />
DRUCKFLEX-KUCHENBROD <strong>GmbH</strong><br />
Karolinenstraße 3-5 - 63834 Sulzbach<br />
Tel. 06028/97 47-0 - Fax -47 - www.druckfl ex.de<br />
Schlauchkupplungen aller Art<br />
PTFE-Schläuche FDA-Qualität<br />
hs-Umformtechnik<br />
<strong>GmbH</strong><br />
Gewerbegebiet Paimar-Nord<br />
Gewerbestraße 1<br />
97947 Grünsfeld-Paimar<br />
Tel. 0 93 46 / 92 99-0, Fax -200<br />
www.hs-umformtechnik.de<br />
Diese Anzeige kostet nur<br />
€ 123,60 pro Ausgabe!<br />
Schlauch- und<br />
Kupplungstechnik<br />
marsoflex®<br />
Alfons Markert + Co. <strong>GmbH</strong><br />
Tel. +49 4321 8701-0<br />
Web: www.markert.de<br />
Schmierstoffe und<br />
chemotechnische Produkte<br />
OKS Spezialschmierstoffe <strong>GmbH</strong><br />
Triebstraße Ganghoferstraße 9 • 80993 47 • 82216 München Maisach<br />
Tel. Tel. 08142 (089) 14 3051 98 92-0 500 • Fax 08142 (089) 141 3051 92 599 19<br />
Internet: www.oks-germany.com<br />
Email: info@oks-germany.com<br />
Schüttguthandling<br />
BEER – Fördertechnik<br />
Am 64732 Kirchpfad Bad König 10<br />
D-64739 Höchst<br />
Tel. 0 61 63 / 93 03-30<br />
Telefon (0 61 63) 93 03 30<br />
Telefax Fax 0 61 (0 61 63 63) / 93 93 03-50 03 50<br />
www.beer-ft.de<br />
info@beer-ft.de<br />
Siebtechnik<br />
Taumelsiebe<br />
Felix-Wankel-Str. In den Erlen 11 9<br />
Vibrations-Taumelsiebe 76669 74915 Bad Schönborn Waibstadt<br />
Vibrations-Kontrollsiebe Tel. 07263-40972-0<br />
07253-88044-0<br />
Labor-Luftstrahlsiebe Fax Fax. 07263-40972-29<br />
07253-88044-9<br />
Siebspannservice Email: info@gkm-net.de<br />
Internet: www.gkm-net.de<br />
www.telsonic.com<br />
main@telsonic.com<br />
Diese Anzeige kostet nur<br />
€ 92,70 pro Ausgabe!<br />
Zentrifugen<br />
Ihr Zentrifugen-Lieferant<br />
~ Dekanter ~ Siebschnecken ~<br />
~ Teller–Separatoren ~<br />
PIERALISI Deutschland <strong>GmbH</strong><br />
Ochsenfurter Str. 2, 97246 Eibelstadt<br />
Tel.: 09303 / 9082-0, Fax: -20<br />
pieralisi@pieralisi.de, www.pieralisi.de<br />
Zerkleinerungstechnologie<br />
WALZENMAHLWERKE<br />
CHEMIE TECHNIK<br />
Anzeigenhotline<br />
Tel: 06221/489-243<br />
Fax 06221/489-481<br />
ingrid.erdmann@huethig.de<br />
Markt & Kontakt<br />
Noch schneller werden Sie übrigens<br />
im Internet gefunden.<br />
Wir bieten attraktive Kombi-Angebote<br />
für Ihren Firmeneintrag!<br />
Schauen Sie doch mal rein:<br />
www.chemietechnik.de<br />
CHEMIE TECHNIK · · Januar/Februar<br />
2013<br />
93 5
ManageMent<br />
Profi-GuiDe<br />
Funktion Branche<br />
Schlank im Schlaf? Wenn das so einfach wäre! Auch in<br />
Unternehmen bedeutet „Lean“ harte Arbeit. Dort dient<br />
Lean Management primär als Instrument, um top-down<br />
die Prozesse zu optimieren. Doch allein dadurch lassen<br />
sich lediglich kurzfristige, aber keine nachhaltigen Erfolge<br />
erzielen. Letztere setzen den grundlegenden Wandel<br />
der Unternehmenskultur und der Einstellungen der<br />
Mitarbeiter voraus, um Prozesse kontinuierlich und<br />
dauerhaft zu verbessern.<br />
Dr. Maier, der bei der Firma Müller für das Einführen<br />
eines Lean-management-Systems verantwortlich ist,<br />
versteht die Welt nicht mehr. Er besuchte zahlreiche<br />
Veranstaltungen zur Einführung von ‚Lean‘ und las alle<br />
Bücher zum Thema. Auch die Abteilungsleiter in den<br />
Bereichen Fertigung, Logistik, Einkauf und Entwicklung<br />
wurden intensiv geschult und können über ‚SMED, Poka<br />
Yoke, Kaikaku und Co.‘ im Schlaf referieren. Kurz gesagt:<br />
Das Unternehmen scheute keinen Aufwand, um<br />
die Mitarbeiter auf die Lean-Methoden und -Tools zu<br />
schulen. Es gibt sogar ein Team, das sich ausschließlich<br />
mit dem Einführen von Lean Management befasst.<br />
Trotzdem bleiben die erhofften Ergebnisse aus.<br />
Und das Management? Es sitzt Dr. Maier im Nacken.<br />
Es erwartet konkrete Resultate, die aber<br />
Die Autorin:<br />
Dominique Keith,<br />
Unternehmensberatung<br />
Dr. Kraus & Partner<br />
Anlagenbau ● ● ●<br />
Chemie ● ● ●<br />
Pharma ● ● ●<br />
Ausrüster ● ● ●<br />
Planer ● ● ●<br />
Betreiber ● ● ●<br />
Einkäufer ● ● ●<br />
Manager ● ● ●<br />
94 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
entScheiDer-factS<br />
Für Manager<br />
nicht so recht kommen wollen. Dabei<br />
war Dr. Maier so zuversichtlich. Eindrucksvoll<br />
sprach er beim Kick-off<br />
zum Auftakt des Projekts über die stärkere<br />
Kundenausrichtung, die stabilere<br />
Qualität und das alles bei niedrigeren<br />
Kosten als Folge der Einführung eines<br />
Lean-Programms. Und die kontinuier-<br />
● Lean Management kann nur funktionieren, wenn im Unternehmen ein Geist herrscht, der Fehler zulässt und<br />
Probleme sichtbar macht, statt sie zu verstecken.<br />
● Dauerhafte Erfolge bei der Einführung von Lean Management lassen sich nur durch eine grundlegende Änderung<br />
der Einstellung und des Verhaltens der Mitarbeiter erreichen.<br />
● Bei der Einführung von Lean Management ist „der Weg das Ziel“; es handelt sich nicht nur um ein weiteres<br />
Management-Projekt, das am Tag X abgeschlossen ist.<br />
Der Weg ist<br />
das Ziel<br />
liche Verbesserung als Erfolgsgarant,<br />
um sich schnell auf neue<br />
Marktgegebenheiten einzustellen zu<br />
können? Die wollte er sozusagen nebenbei<br />
mit einführen. Denn sein damaliges Credo<br />
lautete: So schwierig kann das Einführen von Lean<br />
nicht sein. Doch nun sitzt er sozusagen in der Patsche,<br />
weil er nicht wie versprochen liefert.<br />
Dr. Maier ist nicht der einzige Organisationsentwickler,<br />
der diese Erfahrungen beim Einführen<br />
eines Lean-Programms macht. Obwohl Lean Management<br />
seit Jahren ein feststehender Begriff in<br />
zahlreichen Managementbüchern und Unternehmensleitlinien<br />
ist, kapitulieren viele Firmen bei der<br />
Einführung und von der ‚Lean-Mode‘ ab, weil die<br />
erhofften Ergebnisse ausbleiben.<br />
Das Ziel: Verschwendung –<br />
aus Kundensicht – vermeiden<br />
Was steht eigentlich hinter Lean Production und<br />
Lean Management? Lean Production<br />
(schlanke Produktion) wird oft mit den<br />
Worten ‚weniger ist mehr‘ be-<br />
schrieben. Das heißt: Alle Akti-<br />
vitäten, die aus Kundensicht<br />
nicht wertschöpfend sind und<br />
für die der Kunde folglich auch<br />
nicht bereit ist, zu bezahlen, sollen<br />
aus der betrieblichen Tätigkeit<br />
eliminiert werden. Ziel ist es, jede<br />
Art von Verschwendung (japanisch:<br />
Muda) entlang der Wertschöp-
fungskette zu vermeiden. Mithilfe einer<br />
konsequenten Ausrichtung der Fertigung an<br />
den Bedürfnissen der Kunden sollen bei der<br />
Lean Production qualitativ hochwertige<br />
Produkte bei höchster Liefertreue zu geringsten<br />
Durchlaufzeiten und zu angemessenen<br />
Kosten hergestellt werden. Dabei<br />
steht die Arbeitsqualität der Mitarbeiter im Fokus. Denn<br />
nur gute Mitarbeiter können gute Produkte herstellen.<br />
„Die meisten Automobilisten bauen gute Autos. Wir<br />
‚bauen‘ gute Leute und die bauen gute Autos.“ So lautet<br />
ein Credo von Toyota. Der Autobauer ist mit seinem<br />
Toyota Production System, kurz TPS genannt, der<br />
Benchmark für Lean Production. Als Kernelemente des<br />
TPS gelten:<br />
●● Synchronisierung der Prozesse<br />
●● Standardisierung der Prozesse<br />
●● Vermeiden von Fehlern<br />
●● Verbessern der Produktionsanlagen<br />
●● systematische Qualifizierung der Mitarbeiter<br />
Dahinter steckt das Ziel einer kontinuierlichen<br />
Verbesserung (japanisch: Kaizen).<br />
Dieses wird in der Unternehmensphiloso<br />
Bild: ©Schlierner - Fotolia.com<br />
„Durch die Einstellung, kontinuierliche Verbesserung erreichen<br />
zu wollen, kann eine Stütze für Kundenorientierung,<br />
Flexibilisierung, Steigerung des Outputs und des<br />
andauernden Erfolgs eines Unternehmens entstehen“<br />
phie von Toyota formuliert: „Wir wollen langfristig als<br />
Unternehmen überleben, indem wir verbessern und<br />
weiterentwickeln, wie wir gute Produkte produzieren.“<br />
Lean Management: mehr als Tools und Methoden<br />
Lean Management bezeichnet laut Lehrbuch die Gesamtheit<br />
der Methoden, Denkprinzipien und Verfahrensweisen<br />
zur effizienten Gestaltung der gesamten<br />
Wertschöpfungskette industrieller Güter. Wird diese<br />
sehr nüchterne Beschreibung Lean Management gerecht?<br />
Ist es nicht vielmehr eine Philosophie und damit<br />
keine reine Anwendung von Tools und Methoden?<br />
Lean Management verfolgt das Ziel, unternehmensübergreifend<br />
sowie -intern<br />
starke Kundenorientierung<br />
bei<br />
konsequenter<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
95
ManageMent<br />
Bild: © Michael Shake –<br />
Fotolia.com<br />
Toyotas TPS (Toyota<br />
Production System)<br />
stellt den Benchmark<br />
für Lean Production<br />
dar. Es kommt für<br />
kontinuierliche Verbesserung<br />
des<br />
gesamten Unternehmens<br />
zum Einsatz<br />
96 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Kostensenkung zu erreichen. Die grundlegenden<br />
Gedanken sind hierbei,<br />
Probleme zu lösen – verbunden<br />
mit kontinuierlicherVerbesserung.<br />
Lean Management<br />
zielt<br />
deshalb darauf ab,<br />
Probleme an die<br />
Oberfläche zu holen<br />
und sichtbar zu<br />
machen, anstatt sie zu<br />
verstecken. Doch wo Probleme<br />
identifiziert und analysiert werden, werden Fehler<br />
benannt. Und wer gibt schon gerne Fehler zu? Welches<br />
Unternehmen ‚belohnt‘ Mitarbeiter, die Fehler machen<br />
beziehungsweise Probleme aufdecken? Dabei ist gerade<br />
das der Kern von Lean Management: eine (Unternehmens-)Kultur<br />
zu schaffen, die Fehler nicht verurteilt,<br />
sondern ebenso wie erkannte Probleme als Möglichkeit<br />
sieht, sich weiterzuentwickeln.<br />
Doch zurück zu Dr. Maier: Was wird er seinen Chefs<br />
im nächsten Vorstandsmeeting zum Fortschritt des<br />
Lean-Programms berichten können? Hat er sich täuschen<br />
lassen von den ‚Wundermitteln‘ aus Japan? Warum<br />
bleibt der erhoffte Durchbruch zu dauerhaft mehr Qualität<br />
und niedrigeren Kosten aus – trotz Kanban, Wertstromanalysen,<br />
Teamwork und Kennzahlen? Dabei waren<br />
er und sein Lean-Team so gut ins Lean-Programm<br />
gestartet. Nach einer Wertstromanalyse und dem Einsatz<br />
der passenden Lean-Methode wurde zum Beispiel die<br />
Durchlaufzeit in der Fertigung reduziert.<br />
Das Vermeiden von Verschwendung und damit die<br />
Steigerung der Wertschöpfung lässt sich, wie Praxisbeispiele<br />
zeigen, mittels der bekannten Lean-Methoden<br />
und -Tools managen. Schwierig wurde es dann, wenn<br />
Unternehmen versuchen, die Vorgehensweise der Lean-<br />
Methoden zum Arbeitsalltag werden zu lassen. Dann<br />
kommt es oft zu Widerständen bei den Mitarbeitern.<br />
Lean Management erfordert eine neue Einstellung<br />
Der US-Amerikaner Mike Rother, ein Guru der Lean-<br />
Szene und Autor unter anderem des Buchs „Die Kata des<br />
Weltmarktführers: Toyotas Erfolgsmethoden“, beschreibt<br />
den Zusammenhang zwischen Lean-Methoden und<br />
gut, besser aM besten<br />
Effizienz und Erfolg durch gutes Management steigern<br />
In der CHEMIE TECHNIK finden sich in jedem<br />
Heft auf den letzten Seiten Management-Beiträge,<br />
die ganz unterschiedliche<br />
Bereiche der Führungsarbeit betreffen. All<br />
diese Beiträge sind online zu finden, einfach<br />
den QR-Code am Ende des Beitrages scannen<br />
oder über den Link eine Sammlung der<br />
Beiträge auf chemietechnik.de besuchen.<br />
Dort Finden Sie, wie sich die Managementqualität<br />
mit System verbessern lässt, was<br />
es bedeutet, wenn das Lernziel „Unternehmerisch<br />
denken und handeln“ heißt, welche<br />
fünf magischen Buchstaben dabei helfen,<br />
Ziele gut zu formulieren und zu erreichen<br />
und wie sich der Grundkonflikt Projekt und<br />
Linie bereinigen lässt.<br />
Lean Management gerne mit der Eisberg-Analogie. Dabei<br />
stellen die Lean-Tools den sichtbaren Teil des Eisbergs<br />
dar und das Lean Management dessen größeren,<br />
unsichtbaren Teil unter der Wasseroberfläche. Viele<br />
Unternehmen lassen beim Einführen eines Lean-Programms<br />
den unsichtbaren Teil des Eisbergs völlig außer<br />
Acht oder verschieben seine Bearbeitung auf den Tag,<br />
wenn die ‚wirklichen Lean-Themen‘ angegangen werden.<br />
Sie vergessen, dass es bei der Lean-Philosophie vor<br />
allem um die Bereitschaft geht, Verhaltensweisen grundlegend<br />
zu überdenken und einen Kulturwandel im Unternehmen<br />
herbeizuführen: Ein Schraubenschlüssel allein<br />
reicht nicht; mindestens ebenso wichtig sind der<br />
Kopf, der ihn drehen möchte, und die Hand, die ihn<br />
dreht. Dem zufolge steht bei Lean der Mitarbeiter im<br />
Fokus. Er muss für ein Überprüfen und gegebenenfalls<br />
Revidieren seiner Einstellungen und Gewohnheiten gewonnen<br />
werden. Wie schwierig jedoch schon kleine<br />
Abweichungen von Gewohnheiten sind, kann jeder beurteilen,<br />
der als Rechtshänder mal versucht hat ‚mit<br />
links‘ seine Zähne zu putzen. Wie schwer mögen da erst<br />
grundlegende Verhaltensänderungen sein? Sicherlich zu<br />
schwer, um sie zu vernachlässigen oder im Nebenbei von<br />
Nicht-Fachmännern erledigen zu lassen.<br />
Lean als Gedanke beziehungsweise Philosophie mit<br />
Lean Production als Umsetzungsvehikel kann nur dauerhaft<br />
Erfolge bringen, wenn es dem Management und<br />
der Belegschaft gelingt, die harte Nuss ‚Mindset und<br />
Verhalten‘ anzugehen und neue, flexible, angepasste<br />
Verhaltensweisen im Unternehmen zu verankern.<br />
Ziel: Probleme sichtbar machen und lösen<br />
Wie hilft Dr. Maier diese Erkenntnis? Er sollte versuchen,<br />
dem Management seines Unternehmens darzulegen,<br />
dass der bereits praktizierte Einsatz von Lean-Methoden<br />
zwar ein wesentlicher, aber eben nur ein Schritt<br />
in Richtung ‚neue Arbeitsweise‘ ist; zudem sollte er ver-<br />
suchen, das Management davon zu überzeugen, dass<br />
●● Lean Management nur funktionieren kann, wenn im<br />
Unternehmen ein Geist herrscht, der Fehler zulässt und<br />
Probleme sichtbar macht, statt sie zu verstecken,<br />
●● eine grundlegende Änderung der Einstellung und<br />
des Verhaltens der Mitarbeiter nötig ist und<br />
●● der Weg das Ziel ist, da es kein ein weiteres Management-Projekt<br />
ist, das am Tag X abgeschlossen ist.<br />
So verstanden kann Lean Management eine wichtige<br />
Säule im Unternehmen sein, um sich auf ständig ändernde<br />
Marktanforderungen und immer neue interne<br />
und externe Herausforderungen flexibel, schnell und<br />
effektiv einstellen zu können. Denn jeder Mitarbeiter<br />
und das ganze Unternehmen lernen hierbei, aus Fehlern<br />
zu lernen sowie scheinbar Selbstverständliches und Unabänderliches<br />
zu hinterfragen und entwickeln eine Routine<br />
darin, sich ständig zu verbessern. ●<br />
Weitere Management-Beiträge könnten für Sie interessant<br />
sein? Für den schnellen Zugriff surfen Sie<br />
auf www.chemietechnik.de/1301ct632 oder scannen<br />
Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein!
Firmenverzeichnis / Inserenten<br />
ABB 85<br />
Aerzener 57<br />
Afriso 54, 65, 73<br />
Air Products 58<br />
Andocksysteme Untch 51<br />
APE Engineering 29, 73<br />
Asecos 51<br />
Audisoft 89<br />
Aveva 28<br />
Bartec 44, 50<br />
BASF 18<br />
Bitkom 85<br />
Bronkhorst 67<br />
Cashco 58<br />
Celanese 31<br />
CeoTronics 53<br />
COMSOL 41<br />
C. Otto Gehrckens 74<br />
Crompton Greaves 49<br />
Damen-Sicherheitsschuhe.de 44<br />
Danfoss 29<br />
Denios 73<br />
Deutsches Forschungszentrum<br />
für Künstliche Intelligenz 85<br />
Deutsche Messe 51<br />
Impressum<br />
DIN 85<br />
DKE 85<br />
Dostmann 88<br />
Dow 31<br />
Dr. Kraus & Partner 94<br />
Dürr Ecoclean 44<br />
Ebro 56<br />
E+E Elektronik 61, 89<br />
Emerson 29, 50, 89<br />
Emerson Process<br />
Management 100<br />
EMG 88<br />
Endress+Hauser 56<br />
Engelsmann 56<br />
Evonik 22<br />
Falkenhahn 49<br />
Festo 85<br />
Fiberpipe 46<br />
Fischer 49<br />
Fluor 18<br />
Foster Wheeler 18<br />
Fraunhofer-Institut für<br />
Materialfluss und Logistik 85<br />
Gather 13<br />
GEA Tuchenhagen 28<br />
www.chemietechnik.de<br />
Fachzeitschrift<br />
42. Jahrgang<br />
ISSN 0340 -9961<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. (FH) Armin Scheuermann (AS),<br />
Chefredakteur, v. i. S. d. P.,<br />
Tel.: 06221/489–388, Fax: 06221/489–490<br />
E-Mail: armin.scheuermann@huethig.de<br />
Dipl.-Ing. Birgit Lind (Li.), Tel.: DW –400<br />
E-Mail: birgit.lind@huethig.de<br />
Tina Walsweer (tw), Tel.: DW –208<br />
E-Mail: tina.walsweer@huethig.de<br />
Bianca Bechtel (Assistenz), Tel.: DW –244<br />
E-Mail: bianca.bechtel@huethig.de<br />
Susanne Berger (Assistenz), Tel.: DW –247<br />
E-Mail: susanne.berger@huethig.de<br />
Dr. Dieter Wirth (Online-Redakteur), Tel. DW –458<br />
E-Mail: onlineredaktion@huethig.de<br />
Anzeigen:<br />
Anzeigenleitung:<br />
Sabine Wegmann, Tel.: DW –207<br />
E-Mail: sabine.wegmann@huethig.de<br />
Mediaberatung:<br />
Andrea Lippmann, Tel.: DW –298<br />
E-Mail: andrea.lippmann@huethig.de<br />
Hagen Reichhoff, Tel.: DW –304,<br />
E-Mail: Hagen.Reichhoff@huethig.de<br />
Tanja Schott, Tel.: DW –600<br />
E-Mail: tanja.schott@huethig.de<br />
Anzeigendisposition:<br />
Martina Probst, Tel.: DW –248<br />
E-Mail: martina.probst@huethig.de<br />
Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 41 vom 01.10.2012<br />
Sonderdruckservice:<br />
Bianca Bechtel (Assistenz), Tel.: DW –244<br />
E-Mail: bianca.bechtel@huethig.de<br />
Susanne Berger (Assistenz), Tel.: DW –247<br />
E-Mail: susanne.berger@huethig.de<br />
Verlag<br />
<strong>Hüthig</strong> <strong>GmbH</strong>, Im Weiher 10, 69121 Heidelberg,<br />
Telefon 06221/489–0, Fax: 06221/489–490, www.huethig.de<br />
Handelsregister-Nr. / Amtsgericht Mannheim HRB 703044<br />
Geschäftsführung: Fabian Müller<br />
Verlagsleitung: Rainer Simon<br />
Gericke 83<br />
Gemü 54<br />
Getec 21<br />
GMA 85<br />
Igus 65<br />
Ika-Werke 52, 57<br />
Industrial Solar 66<br />
Jumo 44, 51<br />
Kawasaki 89<br />
Keller 50<br />
Kiesel 71<br />
Knick 88<br />
KROHNE 5<br />
Kroschke 65<br />
KSB 40<br />
LAR Process Analysers 45<br />
Leitenberger 89<br />
Leuze 89<br />
Linde 31<br />
Logitex Reinstmedientechnik 70<br />
Masterflex 49, 57<br />
MBA 61<br />
meister-boxx 99<br />
Messe Nürnberg 17<br />
Methanex 31<br />
IHRE KONTAKTE:<br />
Redaktion: Telefon: 0 62 21/ 489–388, Fax: –490<br />
Anzeigen: Telefon: 0 62 21/ 489–207, Fax: –481<br />
Abonnement- und Leser-Service:<br />
Telefon: 06123/9238-201, Fax: –244<br />
Produktmanager Online: Philip Fischer<br />
Vertrieb: Stefanie Ganser<br />
Leser-Service:<br />
E-Mail: leserservice@huethig.de<br />
Tel.: 06123/9238-201<br />
Fax: 06123/9238-244<br />
Leitung Herstellung: Horst Althammer<br />
Art Director: Jürgen Claus<br />
Layout: Cornelia Roth<br />
Druck: Westermann Druck <strong>GmbH</strong>,<br />
Georg-Westermann-Allee 66, 38104 Braunschweig<br />
Erscheinungsweise: CT erscheint 11 x im Jahr<br />
Bezugsbedingungen/Bezugspreise 2013:<br />
(unverbindliche Preisempfehlung)<br />
Jahresabonnement (inkl. Versandkosten) Inland € 176,40<br />
Ausland € 185,00, Einzelheft € 19.- zzgl. Versandkosten. Der<br />
Studentenrabatt beträgt 35%.<br />
Kündigungsfrist: jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum<br />
Monatsende. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.<br />
© Copyright <strong>Hüthig</strong> <strong>GmbH</strong> 2013 Heidelberg.<br />
Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann trotz<br />
sorgfältiger Prüfung durch die Redaktion, vom Verleger und<br />
Herausgeber nicht übernommen werden. Die Zeitschriften, alle<br />
in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen, sind<br />
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der<br />
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne<br />
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt<br />
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,<br />
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in<br />
elektronischen Systemen. Mit der Annahme des Manuskripts<br />
und seiner Veröffentlichung in dieser Zeitschrift geht das<br />
umfassende, ausschließliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich<br />
unbeschränkte Nutzungsrecht auf den Verlag über. Dies<br />
umfasst insbesondere das Printmediarecht zur Veröffentlichung<br />
in Printmedien aller Art sowie entsprechender<br />
Vervielfältigung und Verbreitung, das Recht zur Bearbeitung,<br />
Umgestaltung und Übersetzung, das Recht zur Nutzung für<br />
eigene Werbezwecke, das Recht zur elektronischen/digitalen<br />
Verwertung, z.B. Einspeicherung und Bearbeitung in<br />
elektronischen Systemen, zur Veröffentlichung in Datennetzen<br />
sowie Datenträger jedweder Art, wie z.B. die Darstellung im<br />
Rahmen von Internet- und Online-Dienstleistungen, CD-ROM,<br />
CD und DVD und der Datenbanknutzung und das Recht, die<br />
vorgenannten Nutzungsrechte auf Dritte zu übertragen, d.h.<br />
Nachdruckrechte einzuräumen. Die Wiedergabe von<br />
Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und<br />
dergleichen in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne<br />
Firmenverzeichnis/Impressum<br />
Mettler Toledo 61<br />
Michell 29<br />
Mitsubishi Electric 61<br />
Motan 57<br />
MPT 45<br />
Müller, 75<br />
Müller 45<br />
Netzsch 54<br />
Neutronics 58<br />
Nucor 31<br />
Planets Software 33, 82<br />
Pörner, 2<br />
Ponndorf 55<br />
R+B 55<br />
Retsch 55<br />
RWE Technology 18<br />
S+S 28<br />
Samsomatic 77<br />
Samsung 31<br />
Sasol 31<br />
Schaudelconsult 85<br />
Schulte 73<br />
Schwer Fittings 55<br />
Shell 31<br />
Smartgas Mikrosensorik 56<br />
SMS Siemag 18<br />
Siemens 18, 22, 85<br />
Siemens VAI Metals Technology<br />
22<br />
Swagelok 62<br />
Technip 31, 40<br />
ThyssenKrupp Uhde 18, 22, 27<br />
VCI 90<br />
VDE 85<br />
VDI 85<br />
VDMA 18, 85<br />
VEGA Grieshaber 15, 45<br />
VOLKMANN 25<br />
VTU Engineering 18<br />
Wago 65<br />
Werma 73<br />
Wika 80, 88<br />
Yokogawa 89<br />
Zeppelin Systems 22, 56<br />
Zürcher-Technik 61<br />
ZVEI 85<br />
Dieser Ausgabe liegen Prospekte<br />
folgender Firma bei:<br />
Haus der Technik, Essen<br />
besondere Kennzeichnung nicht zur Annahme, dass solche<br />
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung<br />
als frei zu betrachten wären und daher von jedermann<br />
benutzt werden dürfen. Für unverlangt eingesandte<br />
Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Mit Namen<br />
oder Zeichen des Verfassers gekennzeichnete Beiträge stellen<br />
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Es gelten die<br />
allgemeinen Geschäftsbedingungen für Autorenbeiträge.<br />
Auslandsvertretungen<br />
Großbritannien:<br />
Richard H. Thompson Ltd., 38 Addison Avenue,<br />
GB-London W11 4QP, Tel.: +44 20/7602 1065,<br />
Fax: +44 20/7602 2198,<br />
E-Mail: richardmedia@yahoo.com<br />
Belgien, Frankreich, Liechtenstein, Schweiz:<br />
interpress, Verena Loewenthal, Bahnhofstr. 20A,<br />
Postfach, CH-8272 Ermatingen,<br />
Tel.: +41 (0) 71-663 77 88, Fax: +41 (0) 71-7663 77 89,<br />
E-Mail: vl@interpress-media.ch<br />
USA, KANADA:<br />
Publimedia <strong>GmbH</strong>, Peter Wokurka, Leondingerstraße 27,<br />
A-4020 Linz,<br />
Tel.: +43-70-668876, Fax: +43-70-612783,<br />
E-Mail: peter@wokurka.at<br />
Inhaber und Beteiligungsverhältnisse: (Entsprechend der<br />
Bekanntgabepflicht nach dem Gesetz über die Presse vom<br />
03. Okt. 1949): Alleingesellschafter: Süddeutscher Verlag<br />
<strong>Hüthig</strong> Fachinformationen <strong>GmbH</strong>, München (100%).<br />
EDA<br />
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur<br />
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern<br />
(IVW), Printed in Germany<br />
Datenschutzhinweis: Ihre Angaben werden von uns für<br />
die Vertragsabwicklung und für interne Marktforschung<br />
gespeichert, verarbeitet und genutzt und um von uns und<br />
per Post von unseren Kooperationspartnern über Produkte<br />
und Dienstleistungen informiert zu werden. Wenn Sie dies<br />
nicht mehr wünschen, können Sie dem jederzeit mit<br />
Wirkung für die Zukunft unter leserservice@huethig.de<br />
widersprechen<br />
CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
97
SPOTLIGHT<br />
Buzzword des Monats<br />
98 CHEMIE TECHNIK · Januar/Februar 2013<br />
Industrie 4.0<br />
Alles nur gecloud<br />
Wir sind zwar nicht abergläubisch, aber warum bloß starten die VDI-Ingenieure die vierte<br />
Industrielle Revolution ausgerechnet im Jahr 13? Und dazu noch mit so dubiosen Werkzeugen<br />
wie der „Cloud“?<br />
So kurz nach dem Weltuntergang (Sie erinnern sich noch?<br />
Mayas? 21. Dezember 2012?) gleich die nächste Hiobsbotschaft:<br />
Der Verein Deutscher Ingenieure hat im Januar<br />
in Düsseldorf die vierte industrielle Revolution gestartet.<br />
Doch ohne Cloud wird es keine Industrie 4.0<br />
geben, menetekeln die Experten. Es ist deshalb höchste<br />
Zeit, dass wir uns dem Begriff „Cloud“ nähern.<br />
Physikalisch gesehen ist die Cloud eine Ansammlung<br />
sehr feiner Wassertröpfchen, die entsteht, wenn die relative<br />
Feuchtigkeit der Luft 100 % geringfügig übersteigt.<br />
Dies kann entweder durch Abkühlung der Luft beim<br />
Aufsteigen oder beim Mischen zweier Luftmengen geschehen<br />
(wir erinnern uns: Mollier, h,x-Diagramm...).<br />
Herausragendes Merkmal der Cloud: Sie ist nass.<br />
Idioten in der Firma<br />
Alarm am Stellventil: Was tun?<br />
Ich<br />
Ich<br />
alle anderen<br />
alle anderen<br />
Gerätediagnose im Asset<br />
Management - Tool durchführen<br />
Gerätediagnose im Asset<br />
Management - Tool durchführen<br />
Mit Vorschlaghammer und<br />
Gabelschlüssel vor Ort gehen<br />
Mit Vorschlaghammer und<br />
Alarm Gabelschlüssel einfach quittieren vor Ort gehen<br />
Schichtende abwarten<br />
Alarm einfach quittieren<br />
Schichtende abwarten<br />
Bilder: ©Ljupco Smokovski - Fotolia.com und CT-Team<br />
Aus Sicht der Informatiker dagegen ist die Cloud ein<br />
metaphysischer Raum der Sehnsucht. Die Wolke 7 der<br />
Bitverbieger soll künftig auch zum Wolkenkuckucksheim<br />
der Produktionsdaten verfahrenstechnischer Anlagen<br />
werden. Kombiniert man physikalische und informationstechnische<br />
Definition, dann bleibt als Schnittmenge,<br />
dass die Cloud eine ziemlich nebulöse Angelegenheit<br />
ist. Auf jeden Fall wird sie aber zu dem Ort, an<br />
dem die Informatiker uns Ingenieure nass machen.<br />
„Wolke 7 der Bitverbieger soll künftig auch<br />
zum Wolkenkuckucksheim der Produktionsdaten<br />
verfahrenstechnischer Anlagen werden“<br />
Ob den Protagonisten von Düsseldorf diese Konsequenzen<br />
klar sind? Die schleichende Entmachtung ist<br />
doch schon längst im Gang. Was werden wir in Zukunft<br />
tun, wenn das System hängt? Den Warmstart mit Strg–<br />
Alt–Entf hat uns Microsoft ja bereits mit Win XP gecloud,<br />
Soft-Schalter nahmen uns auch noch die Herrschaft<br />
über den Strom (Notebook-Tipp: Akku raus) und<br />
in der Cloud werden künftig ausschließlich Informatiker<br />
über einen System-Neustart wachen.<br />
Weh uns! Was passiert, wenn reale und virtuelle Welt<br />
aufein andertreffen, beschreibt eine kleine Anekdote:<br />
Ein Ingenieur, ein Chemiker und ein Informatiker<br />
fahren in einem Auto durch die Wüste. Plötzlich bleibt<br />
das Auto stehen, und die drei beginnen über die Ausfallursache<br />
zu streiten. Der Chemiker: Sicher ein nicht determinierter<br />
Entropiezuwachs im Motorraum! Der Ingenieur:<br />
Blödsinn, es ist einfach der Keilriemen gerissen,<br />
oder der Zündverteiler hat sich verabschiedet oder, oder,<br />
oder... Schließlich der Informatiker: Ist doch egal, wir<br />
schließen einfach alle Fenster, steigen aus und wieder<br />
ein, dann wird‘s schon wieder laufen. [AS]<br />
Weitere CT-Spotlights unter<br />
www.chemietechnik.de/1301ct620<br />
oder einfach QR-Code scannen.
JETZT<br />
ONLINE!<br />
Finden Sie ab sofort Angebote für Ihre<br />
berufl iche Weiterbildung online!<br />
Vergleichen Sie<br />
· Kursgebühren<br />
· Starttermine<br />
· Entfernung zum Schulungsort<br />
· uvm.<br />
Mit 3 Klicks zum Erfolg.<br />
FORTBILDUNG24 · Ein Produkt der meister-boxx <strong>GmbH</strong><br />
Justus-von-Liebig-Str. 12 · 86899 Landsberg · 08191 940 250 - 0
Unsicherheiten vermeiden, Risiken minimieren - mit DeltaV SIS. Emersons intelligentes<br />
sicherheitsgerichtetes System bietet integrierte, intuitive Engineering-Werkzeuge und eine Software, die es Ihrem<br />
Team ermöglicht, zu konfigurieren, Alarme zu definieren und den Gerätezustand zu überwachen – und hält dabei<br />
die Systemtrennung aufrecht, wie dies von IEC 61511 und 61508 gefordert wird. Das DeltaV SIS System reduziert<br />
Schulungs- und Lebenszyklus-Kosten, denn es erfordert kein komplexes Daten-Mapping oder multiple Datenbanken,<br />
und es hilft Ihnen, die Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Mehr über Sicherheitsprozesse und „Best Practices“ erfahren<br />
Sie, wenn Sie das Safety Lifecycle Workbook von www.DeltaVSIS.com/workbook herunterladen.<br />
Kontakt: info.de@Emerson.com<br />
Das Emerson Logo ist ein Warenzeichen der Emerson Electric Co. © 2013 Emerson Electric Co.<br />
Unsere Sicherheitsexperten reden über<br />
Sicherheit. Unsere Anlagenfahrer reden über<br />
Steuerung und Regelung. Aber wenn es darum<br />
geht, unsere Leute und unsere Anlage sicher<br />
durch den Tag zu bringen, sollten wir alle<br />
dieselbe Sprache sprechen.<br />
SIE SCHAFFEN <strong>DAS</strong>!