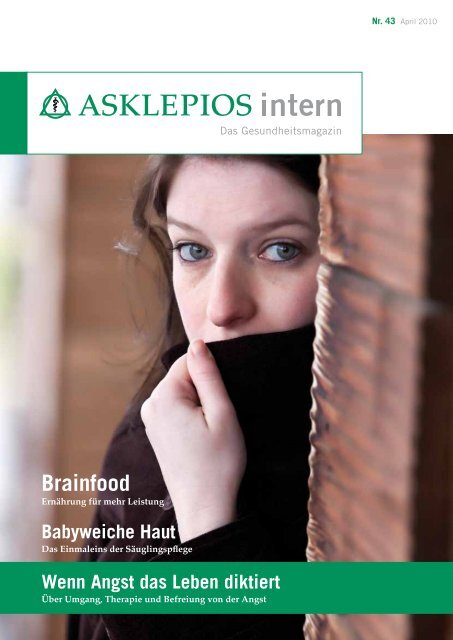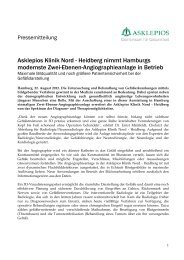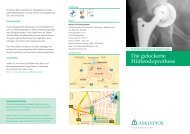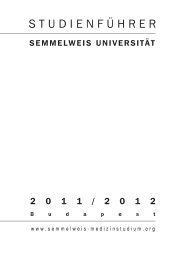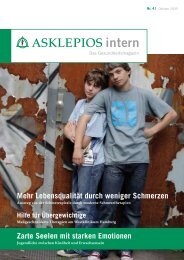Brainfood - Asklepios
Brainfood - Asklepios
Brainfood - Asklepios
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Brainfood</strong><br />
Ernährung für mehr Leistung<br />
Babyweiche Haut<br />
Das Einmaleins der Säuglingspflege<br />
Wenn Angst das Leben diktiert<br />
Über Umgang, Therapie und Befreiung von der Angst<br />
Nr. 43 April 2010<br />
<strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 1
Editorial<br />
Autonomie und<br />
Würde im Alter<br />
Quellennachweis<br />
Statistisches Bundesamt<br />
Deutschland - 2008<br />
Sehr geehrte Leserinnen,<br />
sehr geehrte Leser,<br />
Dr. Bernard gr. Broermann<br />
Neugeborene haben in Deutschland heute<br />
eine fast doppelt so hohe Lebenserwartung<br />
wie vor 100 Jahren: Jungen können<br />
durchschnittlich 76,9 Jahre und Mädchen<br />
82,3 Jahre leben.* Die Aussichten, in unserem<br />
Land gesund älter zu werden, stehen<br />
also besser denn je. Dies haben wir<br />
sowohl dem medizinischen Fortschritt als<br />
auch gesünderen Lebensbedingungen zu<br />
verdanken.<br />
Doch leider bleibt nicht jeder bis ins<br />
hohe Alter vital. Mit der Anzahl älterer<br />
Menschen nimmt auch der Anteil derjenigen<br />
zu, die durch Krankheit auf Hilfe<br />
angewiesen sind. Für die sehr unterschiedlichen<br />
Alterserkrankungen ist die<br />
Diagnose oft schwierig. Daher beschäftigt<br />
sich die Geriatrie ausschließlich mit<br />
den Erkrankungen älterer Menschen. Sie<br />
überschreitet dabei die organmedizinisch<br />
orientierte Medizin und ermöglicht so<br />
eine altersspezifische Behandlung.<br />
Die <strong>Asklepios</strong> Kliniken verfolgen die Entwicklung<br />
der Altersmedizin seit Jahren<br />
mit großem Interesse und Engagement.<br />
Bereits seit 1993 gibt es in der Paulinen<br />
Klinik Wiesbaden eine Fachabteilung<br />
Geriatrie. Sie wurde damals als Modellprojekt<br />
des Bundes eingerichtet. Heute<br />
setzten sich bundesweit die Erfahrungen<br />
aus diesem einzigartigen Projekt durch,<br />
geriatrische Einrichtungen sind keine<br />
Seltenheit mehr. Allein bei <strong>Asklepios</strong><br />
kümmern sich acht rein geriatrische Abteilungen<br />
um das Wohl ihrer Patienten –<br />
eine von ihnen wurde erst im Januar in<br />
Seligenstadt eröffnet.<br />
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
geriatrischer Einrichtungen haben ein<br />
gemeinsames Ziel: die Erhaltung eines<br />
eigenständigen und mobilen Lebens ihrer<br />
Patientinnen und Patienten bis ins<br />
hohe Lebensalter. Sie leisten damit einen<br />
wichtigen Beitrag zur Autonomie älterer<br />
Menschen und damit zur Erhaltung ihrer<br />
Würde.<br />
Ihr<br />
Bernard gr. Broermann<br />
<strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 3
Titelthema S. 6<br />
S. 20<br />
S. 50<br />
S. 65<br />
Titelthema<br />
▼Inhalt<br />
6 Wenn Angst das Leben diktiert<br />
Medizin & Wissenschaft<br />
10 Medizinticker<br />
12 Neuester Lebensretter für das schwache Herz<br />
13 Leberspezialisten in Lich<br />
14 Moderne chirurgische Konzepte für Kopf-Hals-Tumore<br />
16 Wenn der Fuß nicht mehr richtig in den Schuh passt:<br />
„Hallux valgus“- Sprechstunde in Bad Abbach<br />
18 Chronische Schmerzen erzählen eine persönliche Geschichte<br />
20 Klinik Altona eröffnet Emergency Room<br />
22 Transsexualität<br />
24 Gibt es den geborenen Kriminellen?<br />
26 Herzchirurgie heute<br />
28 ADHS bei Erwachsenen<br />
Gesundheit & Wirtschaft<br />
30 Kurz und Knapp<br />
32 Aus der Praxis – für die Praxis: Wunden versorgen,<br />
behandeln und heilen<br />
34 „Ein auf Dauer leistungsstarkes Unternehmen“<br />
36 Welche Laufbahn soll ich einschlagen?<br />
37 Mit „Leonardo da Vinci“ nach Spanien<br />
38 Villa Rothschild als „Ort der Freiheit und Demokratie” geehrt<br />
39 Aufklärung, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit<br />
40 Dem Zucker auf der Spur<br />
41 Elektronische Schließlösungen erhöhen Funktionalität<br />
und Komfort<br />
42 Felix Fit wird noch fitter!<br />
43 900 kleine rote Schleifen im Krankenhaus<br />
44 Two Thumbs Up for the AFH<br />
45 Weiterbildung Endoskopie<br />
46 Service-Schulung für Privatkliniken in Bad Griesbach<br />
47 Pflege ist Kopf-, Herz- und Handarbeit!<br />
48 Personalia<br />
Patientenforum<br />
50 Doktor Leo Löwenherz gibt Kraft und Hoffnung<br />
51 Ein Dementengarten im Pflegezentrum Ahrensburg<br />
52 Ist gesunder Spitzensport möglich?<br />
53 Impressum<br />
54 „Danke für mein neues Leben!“<br />
56 Mit Stethoskop und Stahlhelm<br />
58 Kleine Wunder, ganz groß<br />
59 Von Schülern für Schüler<br />
60 Theater als Therapie – das Theaterlabor 82<br />
62 Babyweiche Haut – das Einmaleins der Säuglingspflege<br />
64 Sind Sie schon freundlich, oder müssen Sie noch<br />
zu einem Seminar?<br />
65 Sponsoring für das Damenbob-Spitzenteam<br />
66 Gut zu wissen: <strong>Brainfood</strong>, Ernährung für mehr Leistung<br />
68 <strong>Asklepios</strong> Quiz<br />
69 Buchtipps<br />
70 Klinikübersicht<br />
Sehr geehrte Leserinnen,<br />
sehr geehrte Leser,<br />
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Euler<br />
Hermes Rating GmbH die Bonität und Zukunftsfähigkeit der<br />
<strong>Asklepios</strong> Kliniken Verwaltungs GmbH zum gegenwärtigen<br />
Zeitpunkt mit „BBB“ Outlook „stabil“ bewertet.<br />
Das Unternehmen wird ferner im Vergleich zur Gesamtwirtschaft<br />
als überdurchschnittlich und im Branchenvergleich als<br />
überdurchschnittlich gut beurteilt.<br />
Die neuerliche Bestätigung untermauert das nachhaltige und<br />
erfolgreiche Geschäftsmodell unseres Unternehmens.<br />
<strong>Asklepios</strong> wächst. Anfang Februar konnte für die drei Krankenhäuser<br />
Burglengenfeld, Nabburg und Oberviechtach aus dem<br />
Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz die Übertragungsvereinbarung<br />
unterzeichnet werden. Die drei Kliniken verfügen<br />
über insgesamt 361 Betten. Eine angeschlossene geriatrische<br />
Rehabilitation mit einer Kapazität von 50 Betten komplettiert<br />
das Angebot an der Grund- und Regelversorgung.<br />
Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für unsere<br />
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Sie beeinflusst unsere<br />
Fähigkeit zum Lernen und unsere mentale Wachsamkeit.<br />
Auch die Fähigkeit, Glück zu erleben, wird vom Hirn mitgesteuert.<br />
Bestimmte Lebensmittel wirken sich dabei besonders<br />
positiv aus. In diesem Magazin finden Sie Ernährungstipps,<br />
die Ihre mentale und körperliche Leistungsfähigkeit ganz entscheidend<br />
unterstützen können.<br />
Felix Fit aus Höxter ist in unserem Unternehmen seit Jahren<br />
ein guter Bekannter. Angesichts des wachsenden Bedarfs<br />
an gesundheitsfördernden Leistungen wurde in der Weserbergland<br />
Klinik ein Qualifizierungs- und Fortbildungszentrum<br />
gegründet. In der Startphase werden Gesundheitsprogramme<br />
für Kinder und Erwachsene sowie Weiterbildungen<br />
für Rückenschullehrer angeboten. Die Angebotspalette wird<br />
stetig erweitert. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen<br />
des Fortbildungsteams viel Erfolg und danke ihnen für ihr<br />
Engagement in einem Bereich, der uns allen am Herzen liegt.<br />
Ihr<br />
Dr. Tobias Kaltenbach<br />
Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung
Titelthema<br />
Wenn Angst das Leben diktiert<br />
Über Umgang, Therapie und Befreiung von der Angst<br />
Angst ist ein grundlegendes und normales Gefühl, das alle Menschen kennen und im Laufe ihres Lebens schon empfunden<br />
haben. Das Gefühl der Angst hat in den meisten Situationen eine elementare Warnfunktion – es weist uns auf<br />
Gefahren und Grenzen hin. Die mit Angst verbundenen körperlichen Signale wie erhöhter Herzschlag ermöglichen<br />
die schnelle Reaktion auf eine Bedrohung. Dann geht die Angst vorüber. Doch was geschieht, wenn sie den Alltag<br />
so dominiert, dass ein normales Leben nicht mehr möglich ist? <strong>Asklepios</strong> intern sprach mit Prof. Dr. Stefan Kropp,<br />
Chefarzt der Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Fachkliniken Teupitz und Lübben, über<br />
Therapiemöglichkeiten bei Angststörungen und den Weg zurück in angstfreies Leben.<br />
Was ist Angst und wie entsteht sie?<br />
Angst ist ein normalpsychologisches Phänomen. Als primärer<br />
Affekt setzt Angst wichtige Signale. Angst versetzt uns in die<br />
Lage, Gefährdungen und brenzlige Zustände zu erkennen, zu<br />
bewerten und zu differenzieren. Sie ist eine unsichtbare „Antenne“<br />
für bedrohliche Situationen. Ein Überleben der menschlichen<br />
Spezies wäre ohne Angst ausgesprochen schwierig gewesen.<br />
Erfolgen jedoch die falschen Reaktionen auf Umweltreize,<br />
werden also beispielsweise Gefahren zu hoch oder auch zu<br />
niedrig eingeschätzt, dann kann sich dies auf das Leben und<br />
die Weiterentwicklung des jeweiligen Menschen ungünstig<br />
auswirken. Eine angemessene und gut austarierte Angstbalance<br />
hat eine beschützende Wirkung. Denn grundsätzlich ist das<br />
menschliche Handeln darauf ausgerichtet, gefährliche Situationen<br />
zu vermeiden und durch Erfahrungen planvoll zu handeln.<br />
Zuviel Angst beeinträchtigt unser Leben, zu wenig allerdings<br />
auch. Oder würden Sie auf eine heiße Herdplatte fassen, über<br />
eine marode Brücke spazieren oder unangegurtet Auto fahren?<br />
Ganz sicher nicht.<br />
Durch welche klassischen körperlichen Symptome macht sich<br />
Angst bemerkbar?<br />
Betroffene berichten von starkem Herzklopfen, einem „Kloß<br />
im Hals“, Schmerzen in der Brust, Erstickungssymptomen,<br />
Schwindelattacken, Taubheitsgefühlen, Kurzatmigkeit, Benommenheit,<br />
Herzschmerzen, Gefühlen der Unwirklichkeit, von<br />
der Angst, verrückt zu werden, Angst vor dem Tod, Hitzewallungen<br />
und Kälteschauern.<br />
Wie häufig treten Angststörungen auf, und ab wann besteht Behandlungsbedürftigkeit?<br />
Angststörungen treten im Gegensatz zu anderen Erkrankungen<br />
relativ häufig auf. Wissenschaftliche Studien ergaben, dass etwa<br />
15 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens mindestens<br />
einmal mit Beschwerden einer Angsterkrankung konfrontiert<br />
werden. In den meisten Fällen handelt es sich um Frauen, wobei<br />
davon auszugehen ist, dass Frauen offener mit ihren Angstbeschwerden<br />
umgehen und sich eher behandeln lassen. Angstsymptome<br />
begleiten fast jede psychische Erkrankung. Es gibt jedoch<br />
auch die eigene Krankheitsgruppe der Angsterkrankung.<br />
Betroffene sollten sich in medizinische Behandlung begeben,<br />
wenn die natürliche Angst ihre sinnvolle Funktion verliert,<br />
wenn sie lähmt und dadurch die Gestaltung des eigenen Lebens<br />
massiv einschränkt. Angst macht einsam. Sie beeinträchtigt und<br />
verhindert den Kontakt zu anderen Menschen. Ängstliche Menschen<br />
ziehen sich immer mehr in ihr Schneckenhaus zurück. Sie<br />
geraten in eine soziale Isolation, weil sie Kontakte nach außen<br />
immer mehr einschränken – und irgendwann ganz aufgeben.<br />
Eine Angsterkrankung beginnt meist ganz harmlos. Zuerst werden<br />
beängstigende Situationen geschickt vermieden, später von<br />
vornherein ausgeschlossen. Ein typisches Beispiel dafür ist das<br />
Autofahren. Nachdem das Fahren auf der Autobahn nicht mehr<br />
in Frage kommt, werden später auch die gewohnten Strecken<br />
nicht mehr gefahren. Irgendwann wird das Auto gar nicht mehr<br />
benutzt. Die Angst hat gesiegt.<br />
Die meisten Betroffenen warten aus Scham leider zu lange, ehe<br />
sie Hilfe in Anspruch nehmen. Viele nehmen ihre Angst als Pro-<br />
6 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 7
Titelthema<br />
blem auch gar nicht richtig wahr. Wichtig ist es, sich der Angst<br />
zu stellen und sich nicht vor ihr zu verstecken.<br />
Angst kann aber auch positiv wirken, in einigen Fällen sogar<br />
Mut machen. Es gibt Menschen, die in bedrohlichen Situationen<br />
zu körperlichen Höchstleistungen fähig sind, einen unbedingten<br />
Überlebenswillen aktivieren und über sich hinauswachsen.<br />
Gibt es Menschen, die zu Ängsten neigen?<br />
Ja, die gibt es. Von Geburt an ist das Nervenkostüm der Menschen<br />
unterschiedlich ausgestattet. Jeder von uns bringt eine<br />
gewisse genetische und körperliche Ausstattung mit. Danach<br />
werden wir durch soziale Einflüsse und die Umwelt geprägt.<br />
Kinder, die bereits frühzeitig selbstbewusst heranwachsen und<br />
die Möglichkeit erhalten, Gefahren selbst zu erkennen, sich ihnen<br />
zu stellen oder ihnen angemessen zu begegnen, werden im<br />
späteren Leben weniger Ängste haben. Das vermittelte Urvertrauen<br />
macht sie stark.<br />
Versuchen dagegen Eltern, ihren Nachwuchs vor allen Schwierigkeiten<br />
zu bewahren, ihm alles abzunehmen und zu suggerieren<br />
„Du kannst das nicht!“, dann besteht die Gefahr, dass<br />
unsichere und ängstliche Kinder heranwachsen. Eine solche Erziehung<br />
wird das ganze nachfolgende Leben beeinflussen.<br />
Welche Ängste haben Menschen in der heutigen Zeit?<br />
Gesellschaftliches Oberthema ist die Furcht vor dem sozialen<br />
Abstieg. Viele Menschen, vor allem ältere, haben Angst vor der<br />
Einsamkeit. Andere fürchten sich vor dem Verlust des Vertrau-<br />
ten. Peinigten die Menschen vor 40 Jahren noch reale Ängste<br />
wie Hunger, Krieg und Tod, stehen heute eher andere Ängste<br />
im Vordergrund. Dazu gehören Angst vor Menschengruppen,<br />
Angst vor Nähe oder auch die Angst, verletzt oder abgelehnt<br />
zu werden.<br />
Hat sich der gesellschaftliche Umgang mit der Angst geändert?<br />
Angst wurde in den letzten Jahren als gesellschaftliches Thema<br />
entdeckt und akzeptiert: Die Menschen sprechen heute eher<br />
über ihre Ängste. Sie reagieren viel reflektierter. Ging es vor 50<br />
oder 60 Jahren im Alltag noch ums alltägliche Überleben, verfügen<br />
die Menschen heute über wesentlich mehr Zeit. In einigen<br />
Fällen wird diese mit Grübeln und Nachdenken über eigene<br />
Ängste verbracht.<br />
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei Angststörungen?<br />
Angst kann im Rahmen einer Psychotherapie oder medikamentös<br />
behandelt werden. Erfolg und Dauer beider Behandlungsmöglichkeiten<br />
richten sich auch danach, wie lange die<br />
Beschwerden schon bestehen. Je früher die Therapie beginnt,<br />
umso besser ist dies für den Behandlungsverlauf. Natürlich<br />
spielen auch persönliche Präferenzen jedes Einzelnen eine Rolle.<br />
Patienten mit Angsterkrankungen können sehr gut ambulant<br />
behandelt werden. Klinisch sehen wir überwiegend Patienten,<br />
die entweder an einer sehr schweren Form einer Angststörung<br />
leiden oder bei denen ihre psychische Grunderkrankung von<br />
einer Angsterkrankung begleitet wird.<br />
Immer wieder suchen Angstpatienten eine schnelle Lösung für<br />
ihr Problem. In Deutschland ist es nicht schwer, an angstlösende<br />
Mittel heranzukommen, die häufig bedenkenlos von Ärzten<br />
verschrieben werden. Oft handelt es sich dabei jedoch um Substanzen,<br />
die abhängig machen. Ich kann vor diesem scheinbar<br />
einfacheren Weg nur warnen, denn neben der ursprünglichen<br />
Angsterkrankung kommt nun auch eine Abhängigkeitserkrankung<br />
hinzu, die ebenfalls sorgfältig behandelt werden muss. In<br />
der Regel erfolgen der Medikamentenentzug und die weitere<br />
Behandlung dann stationär in einer psychiatrischen Einrichtung.<br />
Warum sollten sich Betroffene unbedingt Hilfe holen?<br />
Angst kann chronisch werden. Je länger sie andauert, umso<br />
schwieriger ist sie behandelbar. Eine Lähmung durch Angst<br />
kann eine dauerhafte Isolation verursachen. 10 bis 30 Prozent<br />
aller Angsterkrankten nehmen nicht mehr am sozialen Leben<br />
teil – eine alarmierende Zahl. Deshalb rate ich Betroffenen, so<br />
schnell wie möglich ihren Hausarzt aufzusuchen, um die weitere<br />
Vorgehensweise zu besprechen. Zahlreiche Beratungsstellen,<br />
kirchliche Einrichtungen und Selbsthilfegruppen geben ebenfalls<br />
Empfehlungen und Tipps zu Wegen aus der Angstspirale.<br />
Ist Angst heilbar?<br />
Angst ist kein Schicksal, das hingenommen werden muss. Die<br />
Erkrankung kann bei entsprechender Therapie einen sehr günstigen<br />
Verlauf nehmen, sich deutlich bessern und vollständig<br />
geheilt werden. Grundvoraussetzungen allerdings sind, dass<br />
sich die Betroffenen ihrer Angst stellen, nicht zu lange warten<br />
und sich frühzeitig in ärztliche Behandlung begeben.<br />
Das Gespräch führte Mandy Wolf<br />
8 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 9<br />
Kontakt<br />
Prof. Dr. Stefan Kropp<br />
Chefarzt<br />
<strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Teupitz<br />
<strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Lübben<br />
Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie<br />
und Psychosomatik<br />
Buchholzer Straße 21, 15755 Teupitz<br />
Tel. (033766) 66 276<br />
E-Mail: s.kropp@asklepios.com<br />
Prof. Dr. Stefan Kropp
Medizin & Wissenschaft<br />
+<br />
+++ Online-Überwachung von Risiko-<br />
Patienten<br />
Medizinticker<br />
In der Orthopädischen Klinik Lindenlohe kommt seit einigen Monaten<br />
Vigileo zum Einsatz, ein Monitoring-System der neuesten<br />
Generation, das als „Monitor zur Optimierung des Flüssigkeitsmanagements<br />
und der Sauerstoffversorgung des Gewebes“ beschrieben<br />
wird. Fast alle physiologischen Funktionen von Risikopatienten,<br />
die sich größeren orthopädischen Eingriffen unterziehen müssen,<br />
werden mit Vigileo exakt, kontinuierlich und zuverlässig erfasst. Mittels<br />
modernster Computertechnik können die erfassten Daten digitalisiert,<br />
gespeichert, analysiert und weiterverarbeitet werden. „Wir<br />
haben eine Online-Verbindung zum Patienten“, erklärt Dr. Martin<br />
Wallinger, Oberarzt der Abteilung für Anästhesiologie und Schmerztherapie<br />
in Lindenlohe. Um schnell und umfassend arbeiten zu können,<br />
wurde die komplette IMC-Mannschaft (Intermediate Care) auf<br />
das neue System geschult.<br />
+++ Schnellster CT der Welt in St. Georg<br />
In kürzester Zeit gestochen scharfe Bilder bei geringster Strahlenbelastung:<br />
Ein neuer Hochleistungs-Computertomograph scannt einen<br />
zwei Meter großen Menschen in weniger als fünf Sekunden komplett<br />
vom Scheitel bis zur Sohle – eine Brustkorbuntersuchung ist bereits<br />
in 0,6 Sekunden möglich. Dabei kann die Strahlenbelastung bei<br />
einzelnen Untersuchungen im Vergleich zur herkömmlichen Technik<br />
um bis zu 90 Prozent gesenkt werden! Ein weiterer Vorteil für ältere<br />
Menschen, Kinder, Notfall- oder Intensiv-Patienten: Sie müssen<br />
während der Aufnahme nicht mehr den Atem anhalten. Außerdem ist<br />
das neue Gerät auch für die wachsende Gruppe schwer übergewichtiger<br />
Patienten geeignet. Der CT ist direkt neben der Notaufnahme<br />
platziert und wird die Diagnostik auch bei Schlaganfall- und Notfallpatienten<br />
erheblich verbessern. Auch Eingriffe an Herzklappen,<br />
Herzgefäßen, peripheren Gefäßen und am Herzmuskel können jetzt<br />
noch besser geplant werden: Bei einer ersten Patientin konnten in<br />
dem neuen CT die Herzkranzgefäße so genau dargestellt werden,<br />
dass eine Katheteruntersuchung nicht notwendig war.<br />
Kontakt<br />
Dr. Franz Jürgen Unterburger,<br />
Chefarzt der Abteilung für Anästhesiologie und Schmerztherapie der<br />
<strong>Asklepios</strong> Orthopädischen Klinik Lindenlohe<br />
Tel. 09431/888-640, E-Mail: j.unterburger@asklepios.com<br />
+++ Neuer Notarztwagen/Intensivtransportwagen<br />
beim ASB-Hamburg<br />
Im Januar konnte die Rettungswache Osdorf das neue Fahrzeug in<br />
Dienst stellen. Es ist für alle Belange der modernen Notfallmedizin<br />
sowie mit umfangreichem Intensiv-Equipement ausgerüstet. Neben<br />
einem Intensiv-Beatmungsgerät, komplettem Monitoring, sechs<br />
Spritzenpumpen und zwei Absaugeinheiten ist der Wagen für die<br />
Aufnahme unterschiedlichster Medizingeräte (wie eine intraaortale<br />
Ballonpumpe oder ein ECMO zur künstlichen Beatmung) vorbereitet<br />
und ausgelegt. Drei hochwertige Sitze im Patientenraum ermöglichen<br />
die problemlose Begleitung durch zusätzliches Fachpersonal.<br />
Seitens des ASB wird die Besatzung weiterhin aus zwei Rettungsassistenten<br />
mit Intensiv-Weiterbildung und einem Notarzt bestehen.<br />
Platzangebot und Komfort (Luftfederung, Klimaanlage) ermöglichen<br />
es nun auch, übergewichtige – und speziell „überbreite“ – Patienten<br />
zu befördern.<br />
+++ Ergonomie am Arbeitsplatz<br />
Wer den Großteil seiner täglichen Arbeitszeit<br />
vor dem Computer verbringt, kennt die<br />
Symptome: Augen, Rücken und Schultern<br />
beginnen zu schmerzen. „Das sind eindeutige<br />
Zeichen für eine falsche Haltung am<br />
Arbeitsplatz“, erklärt Dr. Siegfried Marr,<br />
Chefarzt für Orthopädie am Rehabilitationszentrum<br />
für Rheumatologie und Orthopädie<br />
Dr. Siegfried Marr in Bad Abbach. Dynamisches Sitzen, also<br />
die häufige Änderung der Haltung auf dem<br />
Bürostuhl, ist daher von besonderer Bedeutung: Der Stuhl sollte<br />
höhenverstellbar sein, Rückenlehne, Sitzfläche und Polster müssen<br />
bestimmte Anforderungen erfüllen. Wichtig ist auch ein hochauflösender<br />
Monitor. Um Kopf- und Augenschmerzen vorzubeugen, ist<br />
eine zum Fenster parallele Blickrichtung günstig, und Lichtquellen<br />
sollten sich nicht im direkten Sichtbereich befinden. Doch die regelmäßige<br />
Bewegung kann auch ein ergonomischer Arbeitsplatz nicht<br />
ersetzen: Wer den ganzen Tag sitzt, sollte daher durch Sport nach<br />
der Arbeit einen Ausgleich zur einseitigen Körperhaltung schaffen.<br />
Service-Nummer für Rückfragen<br />
oder Arzt-Arzt-Gespräche: 0700-83398198<br />
Kontakt<br />
Frank Bäcker (Wachenleiter)<br />
ASB-Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH<br />
Rettungswache Osdorf/ASB-Intensivmobil<br />
Lupinenweg 12, 22549 Hamburg<br />
Tel.: 040/ 83398-198 Fax: -194<br />
Mobil: 0173/ 614 21 64<br />
+++ Brückenschlag zwischen Orthopädie und<br />
Physiotherapie<br />
Prof. Dr. Heiko Graichen (rechts) „assistierte“ beim endoprothetischen Eingriff<br />
am Kunstknie. Symposium-Organisator Dr. Peter Hopp (4. v. r.) stand für Fragen<br />
bereit.<br />
Das Knie war zentrales Thema des 2. Physiotherapie-Symposiums in<br />
Lindenlohe, zu dem 100 Teilnehmer kamen. Assistenzarzt und Physiotherapeut<br />
Dr. Peter Hopp referierte über die funktionelle Anatomie<br />
und Biomechanik des Kniegelenks. In weiteren Vorträgen wurden<br />
Möglichkeiten gelenkerhaltender und gelenkersetzender operativer<br />
Eingriffe erörtert. Besonderen Anklang fand der Workshop: Mit Original-Geräten<br />
konnten am Kunstknochen alle Schritte zur Einbringung<br />
eines Knie-Implantates nachvollzogen werden. Professor Dr. Heiko<br />
Graichen, Ärztlicher Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Symposiums,<br />
„assistierte“ den Kursteilnehmern mit seinem Ärzte-Team.<br />
Technisch aufwändig im doppelten Sinne wurde es dann bei einer in<br />
den Vortragssaal übertragenen und von Operateurin Dr. Isabel Winter<br />
kommentierten Live-OP. Die Leiterin der Abteilung Sportorthopädie<br />
und Unfallchirurgie stabilisierte in einem arthroskopischen Eingriff<br />
die Kniescheibe eines Patienten mit einer zuvor aus dem Unterschenkel<br />
entnommenen Sehne. Zum Schluss sprach Hannspeter<br />
Meier, Sportphysiotherapeut und Rehatrainer aus Nürnberg, über<br />
die Rehabilitationsmöglichkeiten nach einer Knie-OP.<br />
10 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 11
Medizin & Wissenschaft<br />
Neuester Lebensretter für<br />
das schwache Herz<br />
Herzinsuffizienz ist die häufigste Volkskrankheit in den wohlhabenden Ländern. Der Krankheitsverlauf entwickelt<br />
sich bei vielen Patienten dramatisch: Eine jahrelange Leidenszeit mit Luftnot, Kurzatmigkeit, Müdigkeit und fehlender<br />
Leistungsfähigkeit führt über immer wiederkehrende Kranken hauseinweisungen zum Herztod. Defibrillatoren<br />
normalisieren mittels Elektroschock den Herzrhythmus bei Kammerflimmern. Im Klinikum Schwalmstadt erhalten<br />
diese Patienten nun einen implantierbaren Defibrillator der allerneuesten Generation.<br />
Chefarzt Dr. Matthias Schulze (rechts)<br />
und Dr. Dieter Zenker von der Thorax-,<br />
Herz- und Gefäßchirurgie der UMG<br />
Göttingen mit dem neuen CRT-D<br />
„Wir sind sehr stolz darauf, im Rahmen<br />
eines weltweiten Zulassungsverfahrens<br />
zusammen mit einigen ganz großen Universitätskliniken<br />
in Europa diese neueste<br />
Gerätetechnologie einzuführen“, so Chefarzt<br />
Dr. med. Matthias Schulze.<br />
„Weltweit anerkannte Studien haben gezeigt,<br />
dass heute viele Leben gerettet werden<br />
können, wenn man diese Geräte viel<br />
früher implantiert, als es noch fünf oder<br />
zehn Jahren üblich war.“ Neben diesem<br />
positiven und lebensrettenden Effekt gibt<br />
es aber auch Nebenwirkungen. Vor allem<br />
falsche Therapien und Schocks des Defibrillators<br />
können zu psychischen Störungen,<br />
Ablehnung der Therapie und unnötigen<br />
Krankenhausaufenthalten führen. Die<br />
neueste Generation von Defibrillatoren verfügt<br />
darum neben sehr hohen technischen<br />
Leistungsmerkmalen und einer langen Lebensdauer<br />
auch über ein neues Paket von<br />
Sicherheitsfunktionen zur Vermeidung falscher<br />
Therapien bzw. Schockabgaben.<br />
„Neben dem außerordentlichen Engagement<br />
unserer Ärzte, die Herzleistungsschwäche<br />
in unserem Einzugsgebiet<br />
mit modernsten Therapiekonzepten zu<br />
behandeln, ist diese neueste Generation<br />
von Implantaten ein Gewinn für unsere<br />
Patienten“, so Dr. Dirk Fellermann, Geschäftsführer<br />
der Kliniken Schwalm-Eder.<br />
„Wir erwarten dadurch weniger Patientenbeschwerden<br />
und eine Reduktion von<br />
Krankenhauseinweisungen aufgrund falscher<br />
Therapien und Schockabgaben.“<br />
Die erste Patientin, die im Klinikum<br />
Schwalmstadt einen ICD mit zusätzlichem<br />
Herzschrittmacher zur kardialen<br />
Resynchronisation erhielt, ist eine typische<br />
Patientin für derartige Implantate.<br />
Die 72-Jährige konnte Arztbesuche zwar<br />
bislang auf ein Minimum reduzieren und<br />
war seit Jahrzehnten nicht mehr im Krankenhaus.<br />
Doch in den letzten Jahren wurden<br />
die Beschwerden stärker: „Es fehlte<br />
zunehmend an der Luft, Erkältungen<br />
dauerten länger als früher, dazu immer<br />
wieder Wasser in den Beinen – das Leben<br />
wurde Qual.“ Nach einer Schwindelattacke<br />
und extremer Luftnot wurde<br />
sie vom Notarzt ins Klinikum gebracht.<br />
Neben dem prophylaktischen Schutz<br />
vor dem plötzlichen Herztod, der in der<br />
Gruppe der Patienten mit ausgeprägter<br />
Herzleistungsschwäche der Killer Nummer<br />
1 ist, erhielt sie einen Herzschrittmacher<br />
zur kontinuierlichen synchronen<br />
Stimulation beider Herzhauptkammern.<br />
„Wir erwarten für die Patientin eine deutliche<br />
Leistungsverbesserung und noch<br />
viele gute Jahre. Natürlich werden wir<br />
sie in unser laufendes Telemedizinisches<br />
Konzept aufnehmen, um so eine maximale<br />
Sicherheit und optimale Betreuung<br />
zu garantieren“, so Dr. Schulze abschließend.<br />
Kontakt<br />
Dr. Matthias Schulze<br />
Allgemeine Innere Medizin und Kardiologie<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinikum Schwalmstadt<br />
Krankenhausstraße 27<br />
34613 Schwalmstadt<br />
Tel.: (06691)799-247<br />
Fax: (06691)799-321<br />
E-Mail: ma.schulze@asklepios.com<br />
Leberspezialisten in Lich<br />
Seit 10 Jahren gibt es in der Akutklinik eine spezielle Lebersprechstunde<br />
Die Leber ist das zentrale Organ des menschlichen Stoffwechsels. Sie dient unter anderem zur nahrungsabhängigen<br />
Speicherung, Umwandlung und Freisetzung von Zuckern und Fetten sowie zum Abbau und zurAusscheidung<br />
körpereigener und medikamentöser Giftstoffe. Auch die Bildung der meisten Bluteiweiße sowie der Gallenflüssigkeit<br />
gehört zu ihren Aufgaben. In jeder Minute wird die Leber von circa 1,5 Litern Blut durchströmt – das sind circa 25<br />
Prozent der Gesamtmenge unseres Blutes.<br />
Die besondere Bedeutung dieses Organs<br />
veranlasste im Jahre 2000 den damaligen<br />
Leiter der Inneren Abteilung der Klinik<br />
in Lich, Professor Dr. Gerhard Goubeaud,<br />
eine Lebersprechstunde ins Leben zu rufen.<br />
Seit 2005 wird diese Sprechstunde von<br />
Professor Dr. Dr. Friedrich Grimminger,<br />
Professor Dr. Jürgen Lohmeyer sowie den<br />
Oberärzten Dr. Karl-Heinz Hohmann und<br />
Dr. Jürgen Huber fortgeführt. Die Lebersprechstunde<br />
findet regelmäßig montags,<br />
mittwochs und donnerstags jeweils von 14<br />
bis 17 Uhr statt.<br />
In der Inneren Abteilung der Klinik werden<br />
alle Formen von Lebererkrankungen<br />
diagnostiziert und behandelt. Neben<br />
chronischen Viruserkrankungen und anderen<br />
infektiösen Lebererkrankungen<br />
betrifft dies insbesondere autoimmunologisch<br />
vermittelte Leberschäden, Schädigungen<br />
der Leber durch Medikamente<br />
sowie Erkrankungen von Leber und Gallenwegen<br />
als Folge von HIV- Infektionen.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt der Licher Internisten<br />
sind durch Alkohol hervorgerufene<br />
Lebererkrankungen. Dazu gehören<br />
Fettleberhepatitis, Leberzirrhose und deren<br />
Komplikationen, Magenerkrankungen<br />
sowie Erkrankungen der Magen- und<br />
Darmschleimhaut – einschließlich infektiöser<br />
Komplikationen.<br />
Auch die Folgen einer chronischen Lebererkrankung<br />
wie beispielsweise Funktionsstörungen<br />
des Gehirns durch unzureichende<br />
Entgiftungsfunktion der Leber<br />
(Hepatische Enzephalopathie) oder die<br />
Prof. Dr. Dr. Friedrich<br />
Grimminger<br />
Chefarzt<br />
Dr. Karl-Heinz Hohmann<br />
Leitender Oberarzt<br />
Abnahme der Nierenfunktion (Hepatorenales<br />
Syndrom) werden behandelt.<br />
Die Diagnostik von primären Tumoren<br />
der Leber sowie die Leberbeteiligung bei<br />
Erkrankungen, die nicht von der Leber<br />
ausgehen, gehört gleichfalls zum Spektrum<br />
der Lebersprechstunde. Und auch<br />
schwangerschaftsspezifische Lebererkrankungen<br />
werden hier diagnostiziert<br />
und therapiert.<br />
Darüber hinaus spielt die interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit in der Klinik eine<br />
große Rolle bei der bestmöglichen Versorgung<br />
der Patienten. Das betrifft in diesem<br />
Zusammenhang insbesondere Diagnose<br />
und Therapie von Erkrankungen der Gallenblase<br />
und der Gallenwege, bei der die<br />
Innere Abteilung und die Chirurgische<br />
Abteilung eng kooperieren.<br />
Prof. Dr. Jürgen Lohmeyer, Dr. Jürgen Huber<br />
Facharzt für Innere Medizin Oberarzt<br />
/ Hämato-Onkologie / Infektiologie<br />
12 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 13<br />
Kontakt<br />
Prof. Dr. Dr. Friedrich Grimminger<br />
Chefarzt der Inneren Abteilung<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Lich<br />
Goethestr. 4<br />
35423 Lich<br />
Telefon: 06404-81194<br />
E-Mail: lich@asklepios.com
Medizin & Wissenschaft<br />
Moderne chirurgische Konzepte<br />
für Kopf-Hals-Tumore<br />
Das Plattenepithelkarzinom ist der häufigste bösartige Tumor im Bereich der Schleimhäute der oberen Luft- und Speisewege.<br />
Hauptursache ist das Zusammenwirken von langjährigem Alkohol- und Tabakmissbrauch. Die entsprechenden<br />
Therapiekonzepte haben sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert: Die chirurgische Radikalität wird zugunsten<br />
organ- und funktionserhaltender Strategien verlassen, um bei vergleichbaren onkologischen Ergebnissen die<br />
operationsbedingten Funktionseinschränkungen zu reduzieren und so die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.<br />
Halssitus während der Neck dissection<br />
1. nach Präparation des Hautlappens<br />
2. mit teilweieser Entwicklung des Weichteilgewebes<br />
3. nach Ausräumung des Weichteilgewebes<br />
Die Behandlung bösartiger Tumoren der oberen Luft- und Speisewege<br />
ist auf Grund der komplexen Anatomie und Organfunktionen<br />
(Gesichtsästhetik, Schluckfunktion, Atmung, Sprache,<br />
Stimme) problematisch. Um funktionelle Einschränkungen<br />
zu reduzieren, wurde seit Mitte der 80er Jahre die transorale<br />
Lasermikrochirurgie mit dem CO -Laser entwickelt. Mit dieser<br />
2<br />
Operationstechnik kann auf einen ein Zugangsweg von außen<br />
verzichtet werden.<br />
Wesentlicher Vorteil der CO -Laserchirurgie ist das berührungs-<br />
2<br />
freie und im kapillären Bereich blutungsarme Schneiden des<br />
Gewebes, was während der Operation eine sehr gute Übersicht<br />
ermöglicht. Die transorale Laserchirurgie wird unter mikroskopischer<br />
Kontrolle durchgeführt. Der Fokus des Laserstrahls<br />
wird dabei stark reduziert, um die thermische Schädigung benachbarter<br />
Gewebe zu verringern.<br />
Das operative Ziel der Lasermikrochirurgie ist die vollständige<br />
Entfernung des Primärtumors. Im Gegensatz zur konventionellen<br />
Chirurgie werden dabei die Resektionsgrenzen durch Lage<br />
und Größe dieses Tumors bestimmt. Das Operationsmikroskop<br />
erlaubt eine gute Unterscheidung zwischen gesundem und tumorösem<br />
Gewebe, und die thermische Versiegelung kleinerer<br />
Blut- und Lymphgefäße ermöglicht eine gute Übersicht während<br />
der Operation. So lassen sich die Tumorgrenzen besser erkennen,<br />
der Operateur wird weitgehend von der Tumorausdehnung<br />
geleitet und kann viel gesundes Gewebe schonen. Dies<br />
ermöglicht den Organerhalt und damit die Aufrechterhaltung<br />
einer guten Schluck- und Stimmfunktion. Darüber hinaus kann<br />
in den meisten Fällen auf einen Luftröhrenschnitt verzichtet<br />
werden.<br />
Literatur und eigene Erfahrungen zeigen, dass die onkologischen<br />
Ergebnisse der Laserchirurgie den konventionell-chirurgischen<br />
Techniken oder der primären Strahlentherapie gleichwertig<br />
und zum Teil sogar überlegen sind. Die transorale, mikroskopisch<br />
kontrollierte CO -Laserchirurgie ist daher bei der<br />
2<br />
Behandlung von begrenzten und oberflächlich gewachsenen<br />
Karzinomen der oberen Luft- und Speisewege die Methode der<br />
Wahl. Auch ausgedehntere Karzinome lassen sich so komplett<br />
entfernen, dies ist aber in hohem Maße von Erfahrung und Expertise<br />
des Operateurs abhängig.<br />
Therapie bei Halslymphknoten-Metastasen<br />
Die Prognose von Patienten mit Plattenepithelkarzinomen im<br />
Kopf-Hals-Bereich wird maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit<br />
auch Halslymphknotenmetastasen vorhanden sind.<br />
Die Erhebung des Halslymphknotenstatus durch alleiniges<br />
Abtasten ist zur gesicherten Erfassung von Metastasen völlig<br />
unzureichend. Bildgebende Verfahren (CT, MRT) ermöglichen<br />
eine gute Beurteilung der Halslymphknoten. Zahlreiche Untersuchungen<br />
zeigten jedoch, dass eine spezielle Sonographie<br />
diesen Verfahren gleichwertig oder sogar überlegen ist. Mit der<br />
sonographisch kontrollierten Feinnadelpunktion (FNP) lassen<br />
sich insbesondere kleinere und in tieferen Halsschichten lokalisierte<br />
Raumforderungen sicher punktieren. Dadurch kann die<br />
Wahrscheinlichkeit einer Halslymphknotenmetastasierung bereits<br />
vor der Behandlung besser eingeschätzt werden.<br />
Die 1906 erstmals beschriebene „radikale Neck dissection“<br />
(RND) war viele Jahrzehnte das Standardverfahren zur Entfernung<br />
zervikaler Lymphknotenmetastasen. Analog zur neueren,<br />
weniger invasiven Chirurgie des Primärtumors wurde aber<br />
auch die Radikalität der Neck dissection schrittweise durch<br />
selektive Formen ersetzt. Die postoperativen funktionellen Einschränkungen<br />
können so bei gleichem onkologischem Ergebnis<br />
deutlich minimiert werden, was verbesserte Lebensqualität zur<br />
Folge hat.<br />
Die Behandlung von Plattenepithelkarzinomen der oberen Luftund<br />
Speisewege und des zervikalen Lymphabflusses hat sich<br />
also in den vergangenen Jahren zugunsten weniger radikaler,<br />
stärker organ- und funktionserhaltender Techniken verändert.<br />
Insbesondere bei Patienten mit weit fortgeschrittenen Primärtumoren<br />
und/oder Halslymphknotenmetastasierungen ist eine<br />
radikale chirurgische Sanierung aber weiterhin erforderlich.<br />
Doch auch hier verbessern neue Resektionstechniken und rekonstruktive<br />
Maßnahmen vielfach die postoperative Funktionalität<br />
(mikroanastomosierte Lappentechniken, Stimmprothesen<br />
nach Laryngektomie).<br />
In vielen Fällen ist nach erfolgter chirurgischer Sanierung des<br />
Primärtumors und der Lymphabflusswege eine ergänzende<br />
Radio- oder Radiochemotherapie erforderlich. In Abhängigkeit<br />
von Tumorlokalisation und -größe kann auch prä- oder postoperativ<br />
eine Chemo- oder Antikörpertherapie sinnvoll sein.<br />
Daher sollte nach Diagnose und Feststellung des Stadiums der<br />
Erkankung das individuelle Therapiekonzept im Rahmen einer<br />
interdisziplinären onkologischen Konferenz festgelegt werden.<br />
<strong>Asklepios</strong> Intern<br />
Chancen nutzen –<br />
berufsbegleitend<br />
studieren.<br />
Nutzen Sie die Vorteile eines Fernstudiums und<br />
informieren Sie sich über unsere Studiengänge<br />
mit anerkanntem Abschluss<br />
Gesundheits- und<br />
Sozialmanagement (B.A.)<br />
Health Care Studies (B.Sc.)<br />
Pflegemanagement (Diplom)<br />
Fordern Sie jetzt kostenlos Ihre Studienführer an.<br />
info@hamburger-fh.de<br />
Infoline: 040 / 350 94 360<br />
(mo.-do. 8-18 Uhr, fr. 8-17 Uhr) www.hamburger-fh.de<br />
1. Juli 2010 –<br />
letzter Studienstart<br />
mit Diplom-Abschluss<br />
14 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 06_085x125_3c_Askl.indd 1 <strong>Asklepios</strong> intern 11.02.2010 43/2010 11:10:21 15 Uhr<br />
Kontakt<br />
Dr. Christoph Külkens<br />
Abteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,<br />
Kopf- und Halschirurgie<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Nord – Heidberg<br />
Tangstedter Landstraße 400<br />
22417 Hamburg<br />
Tel.: (0 40) 18 18-87 34 64<br />
Fax: (0 40) 18 18-87 33 72<br />
Dr. Christoph Külkens<br />
E-Mail c.kuelkens@asklepios.com
Medizin & Wissenschaft<br />
Zeigt her Eure Füße<br />
„Hallux valgus“-Sprechstunde in Bad Abbach<br />
Eine Zivilisationskrankheit, die jeden achten Deutschen betrifft, sehen die meisten Menschen gar nicht – weil fast<br />
jeder Schuhe trägt. Doch gerade die Schuhe sind oft die Ursache. Sind sie zu eng oder hochhackig, können sie zur<br />
Ballen- oder Schiefzehe, dem Hallux valgus (hallux = Zehe, valgus = krumm, schief, gebogen), führen. Es gibt aber<br />
auch den angeborenen Hallux valgus. Genetische Komponenten, ein früherer Knochenbruch, eine entzündliche<br />
Erkrankung oder eine Muskellähmung können bei der Entstehung ebenfalls eine Rolle spielen. Die gute Nachricht: Es<br />
kann geholfen werden! Die Orthopädische Klinik für die Universität Regensburg im Klinikum Bad Abbach führt im<br />
Jahr rund 350 Vorfußoperationen durch, davon über 200 operative Korrekturen eines Hallux valgus.<br />
„Frauen sind häufiger betroffen als Männer“, erklärt Prof. Dr.<br />
Dr. Joachim Grifka. Denn am häufigsten tritt der erworbene<br />
Hallux valgus auf, der sich auf das Einwirken äußerer Faktoren<br />
zurückführen lässt. Viele Studien belegen, dass zu enges und<br />
hochhackiges Schuhwerk eine entscheidende Rolle bei der Entstehung<br />
der schiefen Großzehe spielt. Die Fehlstellung wird von<br />
den Betroffenen zunächst nur als kosmetisch störend empfunden.<br />
Im Laufe der Zeit aber können sich lokale Schmerzen und<br />
Entzündungen über dem Großzehengrundgelenk entwickeln,<br />
die Fehlstellung kann auch die zweite Zehe verdrängen, und<br />
durch ein verändertes Abrollverhalten treten häufig Schmerzen<br />
über den Mittelfußköpfchen auf. Letztlich kann das Krankheitsbild<br />
in eine Arthrose (Gelenkverschleiß) des Großzehengrundgelenks<br />
übergehen.<br />
Dem behandelnden Arzt und somit auch dem Kompetenzteam<br />
von Prof. Grifka steht eine Vielzahl von konservativen und<br />
operativen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Entscheidung<br />
für eine bestimmte Therapie erfolgt abhängig vom<br />
Befund und den beklagten Schmerzen. Zu den konservativen<br />
Möglichkeiten gehören eine angepasste Schuhversorgung, die<br />
im Bereich des Vorfußes entsprechend Platz bietet, und die<br />
Durchführung von Fußgymnastikübungen. Durch das Tragen<br />
spezieller Bandagen und Schienen sollen eine Stellungskorrektur<br />
bewirkt sowie ein weiteres Abweichen des Großzehs verhindert<br />
werden. Dem gesamten Spektrum der Fuß- und Sprunggelenkserkrankungen<br />
wird im Klinikum Bad Abbach eine so hohe<br />
Bedeutung beigemessen, dass hier jeden Dienstag eine spezielle<br />
Fußsprechstunde stattfindet.<br />
Ist der in der Sprechstunde erhobene Befund zu ausgeprägt<br />
oder führen konservative Maßnahmen nicht zur Linderung,<br />
ist eine Operation in Erwägung zu ziehen. Ob aber tatsächlich<br />
operiert wird oder nicht, richtet sich nach den Beschwerden des<br />
Patienten und sollte nie ausschließlich aufgrund kosmetischer<br />
Aspekte entschieden werden.<br />
Um aus über 100 möglichen Operationsverfahren das passende<br />
auszuwählen, ist es notwendig, Ursache und Ausprägung des<br />
Krankheitsbildes genau zu betrachten und zu bewerten. Neben<br />
der klinischen Untersuchung werden dazu Röntgenbilder des<br />
Fußes angefertigt. Ziel der Operation ist es, die ursprünglichen<br />
anatomischen Verhältnisse wiederherzustellen, sodass der Fuß<br />
beschwerdefrei voll beansprucht werden kann. Bei den meisten<br />
Operationsverfahren erfolgt eine Korrektur der knöchernen<br />
Achse, begleitend werden Weichteile gelöst oder gerafft. Weitere<br />
Beschwerden verursachende Fehlstellungen der anderen Zehen<br />
können bei der gleichen Operation korrigiert werden. Die<br />
Nachbehandlung beinhaltet (abhängig von der durchgeführten<br />
Operationstechnik) das etwa sechswöchige Tragen eines Spezialschuhs.<br />
Nach nochmaliger Röntgenkontrolle und stabilen<br />
Knochenverhältnissen erfolgt dann die vollständige Freigabe<br />
der Mobilisierung.<br />
16 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 17<br />
Völker AZ KPF10023AskI VaV.indd 1 15.02.2010 9:06:24 Uhr<br />
Kontakt<br />
Prof. Dr. Dr.<br />
Joachim Grifka<br />
Prof. Dr. Dr. Joachim Grifka<br />
Direktor der Klinik und Poliklinik für Orthopädie<br />
Orthopädische Klinik für die Universität Regensburg<br />
im <strong>Asklepios</strong> Klinikum Bad Abbach<br />
Kaiser-Karl-V.-Allee 3, 93077 Bad Abbach<br />
Tel. Sekretariat: (094 05) 18 - 2401<br />
E-Mail: c.haertel@asklepios.com<br />
Ask 03.10<br />
Erleichtert die Pflege: Das Völker Klinikbett Vis-a-Vis.<br />
Das Völker Vis-a-Vis ermöglicht das Sitzen mit festem Bodenkontakt<br />
und bietet die Aktivierung aus der Sitzposition nach<br />
vorn heraus. Das ist mehr Teilhabe am aktiven Leben, mo ti viert<br />
Patienten und bringt sie schneller wieder auf die Beine.<br />
Informieren und beteiligen Sie sich an unserem Forum:<br />
www.info-visavis.de<br />
Völker AG · Wullener Feld 79 · 58454 Witten<br />
Tel. +49 2302 96096-0 · Fax -16 · info@voelker.de
Medizin & Wissenschaft<br />
Chronische Schmerzen erzählen<br />
eine persönliche Geschichte<br />
Mithilfe moderner schmerztherapeutischer Ansätze sollen in Simbach am Inn Patienten wieder<br />
in einen normalen Alltag integriert werden.<br />
„Wenn wir Schmerz als vermeidbar betrachten und zudem mit den Mitteln zu seiner Vermeidung umzugehen wissen,<br />
zugleich aber die möglichen Grenzen ihrer Wirksamkeit akzeptieren, dann kennen wir zwar nicht die Kunst des ‚Lebens<br />
ohne Schmerz’ wohl aber die Kunst, weniger zu leiden, indem wir besser leiden.“ (Jeanne Russier, La souffrance)<br />
Schmerztherapeuten, die gute, effektive<br />
Schmerztherapie für chronische Schmerzpatienten<br />
anbieten, gehen immer aufmerksamer<br />
und achtvoller mit der Tatsache<br />
um, dass die Chronifizierung von<br />
Schmerz auf neuronalen Lernvorgängen<br />
beruht. Das Schmerzempfinden wird infolge<br />
wissenschaftlicher Erkenntnisse als<br />
dynamischer Prozess betrachtet, in den<br />
Auswirkungen früherer Erfahrungen<br />
und Erlebnisse einfließen. Somit muss<br />
jede chronische Schmerzerkrankung als<br />
jeweils sehr persönliche Geschichte gesehen<br />
und behandelt werden. Denn Befund<br />
und Befinden decken sich häufig<br />
nicht, und die erlebte Beeinträchtigung<br />
kann nicht wie üblich durch eine geeignete<br />
Diagnostik nachgewiesen und mit<br />
passenden Befunden dokumentiert werden.<br />
Wenn der Schmerz chronisch wird<br />
und der Betroffene keine Möglichkeiten<br />
mehr sieht, mit ihm umzugehen, wird<br />
der Schmerz zur eigenständigen Erkrankung.<br />
Lange haben Therapeuten ihre Patienten<br />
dabei unterstützt, dem Schmerz<br />
den Kampf anzusagen, heute geht es<br />
darum zu verstehen, welche persönliche<br />
Geschichte der Schmerz zu erzählen<br />
versucht. Oberstes Ziel der Behandlung<br />
bleibt, den Patienten in einen normalen<br />
Alltag zu integrieren.<br />
Neue Therapiekonzepte fördern daher<br />
die Befähigung der Patienten, ihr erlerntes,<br />
individuelles Schmerzprogramm zu<br />
erkennen und vorerst zu akzeptieren. Am<br />
allerbesten lernt der Mensch, wenn Gefühle<br />
im Spiel sind. Er entwickelt Überzeugungen,<br />
um das zu bewerten, was<br />
ihm widerfährt und diesem einen Sinn zu<br />
geben. So wird auch Schmerz am allerbesten<br />
„gelernt“, wenn lebhafte Gefühle<br />
beteiligt sind. Das eigene Belohnungssystem<br />
verfestigt die im Zentralnervensystem<br />
entstehenden Lernspuren noch<br />
zusätzlich. Es ist daher keine einfache<br />
Aufgabe, Erlerntes wieder zu verlernen,<br />
aber sie kann durch das Zusammenspiel<br />
verschiedener medizinischer, psychotherapeutischer,<br />
physiotherapeutischer,<br />
körperorientierter und Kreativtherapieverfahren<br />
erleichtert werden. Hierfür<br />
eigenen sich psychosomatische Kliniken<br />
und Fachabteilungen besonders gut, da<br />
dort Mitarbeiter aus all diesen Disziplinen<br />
gemeinsam mit dem Pflegepersonal<br />
einen Rahmen schaffen, in dem Patienten<br />
in diesem Erkenntnisprozess unterstützt<br />
werden.<br />
Das stationäre Angebot der psychosomatischen<br />
Abteilung in Simbach am Inn<br />
umfasst tägliche Pflegevisiten, regelmäßige<br />
medizinische und schmerztherapeutische<br />
Behandlung, wöchentlich je<br />
90 Minuten Einzelpsychotherapie und<br />
180 Minuten Gesprächsgruppentherapie<br />
sowie Körper- und Gestaltungstherapie<br />
in der Gruppe und gegebenenfalls auch<br />
im Einzelsetting. Eine physiotherapeutische<br />
Begleitung kann, muss aber nicht<br />
von Vorteil sein. Wir bemühen uns, jedem<br />
Patienten das Erlernen eines Entspannungsverfahrens<br />
zu ermöglichen, da<br />
Schmerz erwiesenermaßen mit dysfunktionaler<br />
Stressverarbeitung verknüpft ist:<br />
Anspannung und Schmerz potenzieren<br />
einander. Ein geeignetes Entspannungsverfahren<br />
kann dem Patienten das Tor zu<br />
der wichtigen, neuen Erfahrung öffnen:<br />
Ich kann selbst etwas tun! Ich kann meinen<br />
Schmerz verringern!<br />
All diese unterschiedlichen Anregungen<br />
lassen das „Schmerzprogramm“ langsam<br />
in den Hintergrund treten, dabei kommt<br />
den Gefühlen wieder eine wichtige Rolle<br />
zu: Jede Bewegung, jede Begegnung, die<br />
spielerisch und leicht, neugierig und achtsam<br />
erlebt wird, lässt die Patienten erneut<br />
lernen – nur werden sie diesmal durch ein<br />
größeres Bewegungsausmaß, eine freundliche<br />
Aufnahme in der Patientengemeinschaft<br />
oder den Erfolg beim Erproben<br />
einer veränderten Verhaltensweise belohnt.<br />
Auch tiefe Trauer hat Raum in unseren<br />
Therapien, um Abschied von alten<br />
Verletzungen vorzubreiten und für das<br />
Wagnis eines Neubeginns gerüstet zu sein.<br />
In einer speziellen Schmerzgruppe, die<br />
aus sieben Modulen zusammengesetzt<br />
ist, vermitteln wir Information über den<br />
Weg der Chronifizierung, über Schmerzverstärker<br />
und Ablenkungstechniken.<br />
Wir regen an, alte Überzeugungen (alles<br />
Schreckliche bleibt an mir hängen,<br />
mir kann sowieso keiner helfen etc.) zu<br />
entdecken und aufzugeben. Wir versuchen,<br />
die Verstrickung von sozialen Bedingungen,<br />
Vermeidungsverhalten und<br />
Gestimmtheit aufzuzeigen und besprechen<br />
die drei wichtigsten Denkfallen:<br />
„der Schmerz ist rein psychisch bedingt“,<br />
„der Schmerz ist rein organisch bedingt“<br />
und „der Schmerz muss weg – für immer“,<br />
um auf mögliche Hindernisse bei<br />
der Aufgabe des erlernten „Schmerzprogramms“<br />
hinzuweisen.<br />
In Fragebögen geben die meisten unserer<br />
Patienten nach dem stationären<br />
Aufenthalt eine Verbesserung der Lebensqualität,<br />
eine Verringerung der<br />
Beeinträchtigung durch den Schmerz,<br />
größeres Wohlbefinden sowie eine Reduktion<br />
der Schmerzintensität an. In den<br />
Abschlussgesprächen im Rahmen der<br />
Einzelpsychotherapie berichten viele von<br />
ihnen über einen vergrößerten Handlungsspielraum,<br />
der es ihnen ermöglicht,<br />
besser mit ihrer Erkrankung im Alltag zurechtzukommen.<br />
18 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 19<br />
Kontakt<br />
Dr. Martina Wittels<br />
Funktionsoberärztin im Bereich Schmerztherapie,<br />
Fachärztin für Anästhesie,<br />
Schmerztherapeutin, Psychotherapeutin<br />
Abteilung für Psychosomatik<br />
Kreiskrankenhaus Simbach am Inn<br />
Plinganserstraße 10, 84359 Simbach<br />
Tel.: (8571) 980 - 281<br />
Dr. Martina Wittels<br />
E-Mail: wittels.martina@khsim.de<br />
wittelsm@a1.net
Medizin & Wissenschaft<br />
Klinik Altona eröffnet<br />
Emergency Room<br />
Die im November 2009 feierlich eröffnete Zentrale Notaufnahme (ZNA) setzt neue Maßstäbe für Deutschland. Der<br />
18-Millionen-Bau wurde mit 13,84 Millionen Euro von der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
gefördert. In vielen Aspekten ist die neue ZNA vergleichbar mit den Notaufnahmen der Fernsehserien<br />
Emergency Room, Chicago Hope oder Dr. House.<br />
Schon vor der Eröffnung der neuen ZNA hatte die Klinik mit ihrem<br />
First-View-Konzept eine Vorreiterrolle inne. Dieses strukturiert<br />
die Abläufe der Notaufnahme so, dass die Wartezeiten der<br />
Patientinnen und Patienten auf ein Minimum reduziert werden.<br />
Mit dem Neubau der ZNA ist es gelungen, dieses Konzept auch<br />
auf baulicher und technischer Seite optimal umzusetzen. Zu den<br />
weiteren Highlights gehört ein Schockraum mit eingebautem<br />
Computertomografen, der Diagnostik und Behandlung Schwerverletzter<br />
und anderer Notfälle deutlich beschleunigen wird.<br />
„Für uns steht die bestmögliche Versorgung von Patienten an<br />
erster Stelle“, so Senatsdirektor Norbert Lettau, Amtsleiter<br />
Gesundheit und Verbraucherschutz der Behörde für Soziales,<br />
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz. „Sie sollen unabhängig<br />
von ihrer Grunderkrankung über einen zentralen interdisziplinären<br />
Aufnahmedienst aufgenommen und behandelt<br />
werden, damit gegebenenfalls die notwendigen lebensrettenden<br />
Sofortmaßnahmen sofort eingeleitet werden können. Des-<br />
halb haben wir seitens der Gesundheitsbehörde auch die Einrichtung<br />
dieser Zentralen Notaufnahme mit fast 14 Millionen<br />
Euro unterstützt.“<br />
Mit jährlich rund 17.000 durch den Rettungsdienst eingelieferten<br />
Notfällen sei die ZNA in der Klinik Altona jene Einheit,<br />
die in Hamburg am häufigsten angefahren werde, betonte Ingo<br />
Breitmeier, Geschäftsführender Direktor der <strong>Asklepios</strong> Klinik<br />
Altona: „Dieser Bedeutung tragen wir mit der baulichen<br />
Erneuerung und Erweiterung Rechnung.“ Die insgesamt 18<br />
Millionen Euro wurden in neue Technik, die Platzierung eines<br />
Computertomografen in einem der Schockräume sowie in einen<br />
prozessorientierten Bau investiert. Alles ist auf die reibungslose<br />
und höchst effektive Versorgung von Notfällen eingerichtet.<br />
Mit speziellen Schrank-Farben wird zum Beispiel die Orientierung<br />
in allen Räumen erleichtert, ausgeklügelte Wartezonenkonzepte<br />
und organisatorische Vorkehrungen berücksichtigen<br />
einen möglichen Massenanfall von Patienten.<br />
Die Zentrale Notaufnahme Altona in Zahlen<br />
30 Ärztinnen/Ärzte und 57 Pflegekräfte<br />
mehr als 45.000 Notfallpatienten pro Jahr (30 Prozent stationär und 70<br />
Prozent ambulant), darunter:<br />
ein Drittel aller 150 Polytraumata Hamburgs<br />
(über das Traumazentrum)<br />
rund 900 Schlaganfälle (auf der überregionalen Stroke Unit)<br />
400 Herzinfarkte<br />
mehr als 3.000 weitere Herz-Notfälle<br />
mehr als 5.000 knöcherne Unfall- oder Sportverletzungen<br />
rund 1.500 Vergiftungen<br />
Die komplizierte und zeitkritische Arbeit in der neuen ZNA werde<br />
durch ein interdisziplinäres Team von Ärzten und Pflegekräften<br />
geleistet, die auf die Behandlung von Notfällen spezialisiert<br />
seien, erklärte Dr. Barbara Hogan, Chefärztin der ZNA und Präsidentin<br />
der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Notfallaufnahme<br />
DGINA e. V.: „Hinsichtlich der Prozesse nimmt die<br />
ZNA der Klinik Altona bereits heute eine europaweite Vorreiterrolle<br />
ein.“ Hogan hatte bereits in der alten ZNA das First-View-<br />
Konzept eingeführt, das die Wartezeit bis zum ersten Facharztkontakt<br />
auf 15 Minuten reduzierte, sowie das Casemanagement<br />
mit Sonografie implementiert. Die ersten Stunden des Krankenhausaufenthaltes<br />
seien bei vielen medizinischen Notfällen für<br />
den Krankheitsverlauf entscheidend, und eine optimal strukturierte<br />
Versorgung zahle sich medizinisch und ökonomisch aus,<br />
so Hogan: „Die neue ZNA wird jetzt noch mehr Leben retten,<br />
noch mehr kranke Menschen noch besser und schneller versorgen,<br />
Leiden lindern und Wartezeiten weiter verkürzen.“<br />
Der Schockraum, in dem die Erstversorgung Schwerstverletzter<br />
stattfindet, sei nach modernsten Maßstäben eingerichtet worden,<br />
betonte Prof. Dr. Volker Wening, Chefarzt der als übergeordnetes<br />
Traumazentrum zertifizierten Unfallchirurgie. „Uns<br />
geht es nicht nur um eine schnelle Behandlung, sondern um<br />
eine Verbesserung der Behandlungsqualität zusammen mit einer<br />
zügigen Behandlung dieser Patienten. Fast alle Menschen<br />
gehen davon aus, dass sie am Abend genauso wieder zu Hause<br />
ankommen, wie sie morgens weggefahren sind. Unfälle geschehen<br />
ohne Vorankündigung, und mancher wacht mit einem<br />
schweren Schädelhirntrauma oder Mehrfachverletzungen in<br />
einem Krankenhaus wieder auf. Diese Menschen optimal zu<br />
versorgen, haben wir uns seit Jahren zum Ziel gesetzt und hoffen,<br />
dieses durch die neue bauliche und technische Ausrüstung<br />
noch besser realisieren zu können.“<br />
20 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 21<br />
Jens Bonnet
Medizin & Wissenschaft<br />
Transsexualität<br />
Hinweise auf transsexuelle Menschen finden sich seit dem Altertum in vielen Kulturen und Gesellschaften.<br />
Transsexualität ist eine Erkrankung, bei der sich die Betroffenen – meist schon seit der Kindheit – im falschen<br />
Körper wähnen und dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Transsexualität kann als leiblich-seelische<br />
Geschlechtsunterschiedlichkeit aufgefasst werden. Sie kommt bei beiden Geschlechtern vor, wobei ein transsexueller<br />
Mann chromosomal weiblich und eine transsexuelle Frau chromosomal männlich ist.<br />
Die 10 Aufgaben des „Gender-Spezialisten“<br />
(nach Dr. Wilhelm F. Preuss)<br />
1. Genaue Diagnosestellung der individuellen<br />
Geschlechtsidentitätsstörung<br />
2. Diagnostik anderer psychiatrischer Begleiterkrankungen und<br />
Veranlassung einer adäquaten Behandlung<br />
3. Beratung über alle Behandlungsoptionen und ihre<br />
Konsequenzen<br />
4. Ernsthafte Bemühung um Psychotherapie – „to engage in<br />
psychotherapy“<br />
5. Überprüfung der Voraussetzungen für die Indikation<br />
somatischer Behandlungsschritte<br />
6. Verbindliche Überweisungen an medizinische Kollegen und<br />
Operateure mit begründeter Indikation<br />
7. Dokumentation der Vorgeschichte des Patienten im Arztbrief<br />
(Indikationsschreiben)<br />
8. Mitarbeit in einem professionellen Team, das sich mit<br />
Geschlechtsidentitätsstörungen befasst<br />
9. Beratung und Aufklärung von Angehörigen, Arbeitgebern und<br />
Institutionen<br />
10. Bereitschaft, für behandelte Patienten später zur Verfügung zu<br />
stehen, unter Umständen lebenslang<br />
Die Häufigkeit der Transsexualität ist regional sehr unterschiedlich,<br />
und das Verhältnis von 3:1 zwischen Männern und Frauen<br />
findet sich in vielen, aber nicht allen Ländern. Bis heute gibt es<br />
für diese Unterschiede keine ausreichende Erklärung. Harry<br />
Benjamin begründete in den 1960er Jahren das Verständnis der<br />
Transsexualität als behandlungswürdige Krankheit. Wurde die<br />
Transsexualität lange Zeit als rein psychologisches Phänomen<br />
gesehen, so weiß man heute, dass organische Veränderungen<br />
im Zentralnervensystem zugrunde liegen. So zeigten Untersuchungen<br />
an Gehirnen verstorbener transsexueller Frauen in<br />
bestimmten Arealen typisch weibliche Strukturen. Die sexuelle<br />
Differenzierung des Gehirns stimmt also nicht mit dem chro-<br />
mosomalen und gonadalen Geschlecht (Eierstock bzw. Hoden)<br />
überein.<br />
Die in der Kindheit gefestigte Geschlechtsidentität ist irreversibel.<br />
Eine psychotherapeutische Anpassung an einen (äußerlich)<br />
männlichen oder weiblichen Körper ist bei echten Transsexuellen<br />
nicht möglich und mit unabsehbaren Folgen für die Patienten<br />
verbunden. Viele Patienten leiden erheblich unter ihrer<br />
Transsexualität. Insbesondere transsexuelle Männer fügen sich<br />
Ritzverletzungen an den Armen zu. (Dieses Verhalten muss<br />
unbedingt von Borderline-Störungen abgegrenzt werden.) Die<br />
Patienten entwickeln verschiedene Anpassungsstrategien: Verheimlichung,<br />
Perfektionierung des Cross-Dressings (Tragen<br />
der spezifischen Bekleidung des anderen Geschlechts), sozialen<br />
Rückzug, Rückzug in Phantasiewelten, Manipulationen an den<br />
Genitalien bis zu Selbstverletzungen, körperliche Vernachlässigung,<br />
Verleugnung, Erlernen und „Spielen“ der nicht passenden<br />
Geschlechtsrolle, Hoffnung auf „Selbstheilung“ durch Berufswahl/Eheschließung/Familiengründung<br />
sowie Überkompensationen<br />
(Machogehabe bei männlichen Transsexuellen).<br />
Die Diagnose des Transsexualismus muss durch eine mindestens<br />
einjährige Betreuung durch einen Psychiater, am besten<br />
einen „Gender-Spezialisten“, gutachterlich gesichert werden.<br />
Die Therapie erfolgt in drei Schritten:<br />
Im Alltagstest lebt der Patient – betreut durch einen Psychiater<br />
– einen Rollenwechsel und outet sich seiner Umwelt.<br />
Voraussetzung für den Beginn einer Hormonbehandlung ist<br />
ein psychiatrisches Gutachten. Die Hormonbehandlung transsexueller<br />
Männer besteht in der Gabe von Testosteronpräparaten.<br />
Ziel ist das Erreichen einer männlichen Haarverteilung,<br />
Zunahme der Muskelmasse, Stimmbruch und Ausbleiben der<br />
Menstruation. Die Verweiblichung transsexueller Frauen lässt<br />
sich unter anderem durch hormonelle Injektionen oder tägliche<br />
orale Östrogentherapie erreichen. Zur Reduktion der männlichen<br />
Behaarung wird ein synthetisches Testosteron-Derivat<br />
angewendet. Ziel der Therapie sind das Erreichen einer weiblichen<br />
Fettverteilung, einer weichen Haut, einer Vergrößerung<br />
der Brustdrüse, das Schrumpfen des Hodens und der Potenzverlust.<br />
Die operative Therapie sollte frühestens sechs Monate nach Beginn<br />
der Hormontherapie erfolgen. Voraussetzungen sind zwei<br />
psychiatrische Gutachten und die Kostenübernahme durch<br />
die Krankenkasse. Aus unserer Sicht ist in dieser besonderen<br />
Situation der Operateur lediglich ausführender Dienstleister.<br />
Die Indikation zur Operation stellt der Psychiater. Neben der<br />
Konstruktion des Zielgeschlechtes dient die Operation auch der<br />
sicheren und irreversiblen Sterilisation – Voraussetzung für die<br />
Personenstandsänderung. Die Operation transsexueller Männer<br />
beinhaltet die Entfernung der Gebärmutter und/oder der<br />
Eierstöcke, des Drüsenkörpers sowie die Formung eines männlichen<br />
Oberkörpers. Die genitale Geschlechtsangleichung wird<br />
aufgrund ihrer Komplexität und möglicher Komplikationen nur<br />
von einigen Patienten angestrebt. Die Operation transsexueller<br />
Frauen besteht aus der Entfernung von Penis und Hoden, der<br />
Konstruktion einer Neovagina aus Penishaut oder Darm, dem<br />
Aufbau weiblicher Brüste durch Implantation von Silikonprothesen<br />
sowie der Enthaarung.<br />
In der Klinik Nord-Heidberg bieten wir vor allem die operative<br />
Therapie bei transsexuellen Männern an. Im ausführlichen Be-<br />
ratungsgespräch werden Art und zeitlicher Ablauf der Therapie<br />
festgelegt. Die Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcken<br />
erfolgt minimal-invasiv. Die Entfernung der Brustdrüse erfolgt<br />
mithilfe verschiedener Operationstechniken in Abhängigkeit<br />
von der Größe und Form der Brust. Ziel ist immer die Konstruktion<br />
eines männlichen Oberkörpers mit kleinen Brustwarzen<br />
und Darstellung des Brustmuskels. Den Patienten wird eine simultane<br />
Operation von Brust und Unterleib angeboten, so dass<br />
nur ein Krankenhausaufenthalt notwendig ist. Bei transsexuellen<br />
Frauen bieten wir den Brustaufbau durch Implantation von<br />
Silikonprothesen an. Alle Patienten werden in Einzelzimmern<br />
untergebracht. Aufgrund der Erfahrung des pflegerischen und<br />
ärztlichen Personals mit transsexuellen Patienten ist ein sehr<br />
freundlicher und respektvoller Umgang selbstverständlich.<br />
22 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 23<br />
Kontakt<br />
PD Dr. Jörg Schwarz<br />
Klinik für Gynäkologie, Onkologie und Brustzentrum<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Nord – Heidberg<br />
Tangstedter Landstraße 400<br />
22417 Hamburg<br />
Tel.: (0 40) 18 18-87 31 26<br />
Fax: (0 40) 18 18-87 31 27<br />
E-Mail: joe.schwarz@asklepios.com<br />
vorher nachher<br />
Behandlungsstufen für transsexuelle Patienten<br />
1. Stufe Diagnostik<br />
2. Stufe Behandlung während der Alltagserfahrung /<br />
Psychotherapie<br />
Vornamensänderung nach § 1 TSG<br />
3. Stufe Hormonbehandlung nach Alltagserfahrung<br />
über mind. 1 1/2 Jahre<br />
4. Stufe geschlechtsangleichende Operation<br />
5. Stufe Nachbehandlung / Weiterbetreuung
Medizin & Wissenschaft<br />
Gibt es den geborenen Kriminellen?<br />
„Je sorgfältiger der Kranke hinter festen Mauern und Gittern eingesperrt war, umso sicherer konnte sich der Gesunde<br />
fühlen“, war noch 1912 die Auffassung von Dr. Gustav Aschaffenburg, deutscher Psychiater und Pionier der forensischen<br />
Psychiatrie. Seitdem hat sich die forensische Psychiatrie enorm entwickelt. <strong>Asklepios</strong> intern sprach mit Prof. Dr. Jürgen<br />
Müller, Professor für forensische Psychiatrie und Psychotherapie an der Georg August Universität Göttingen und zugleich<br />
Chefarzt der Forensischen Psychiatrie am Fachklinikum Göttingen, über die Möglichkeiten der Besserung von psychisch<br />
kranken Straftätern und über die wissenschaftlichen Fortschritte in der modernen forensisch-psychiatrischen Medizin.<br />
Was versteht man unter forensischer<br />
Psychiatrie?<br />
In der forensischen Psychiatrie geht es<br />
um die Bedeutung von Persönlichkeit<br />
und psychischer Krankheit für das Verhalten<br />
des Einzelnen in der Begegnung<br />
mit den anderen – beispielsweise um<br />
das krankheitsbedingte Unvermögen,<br />
soziale Anforderungen zu erfüllen oder<br />
das krankheitsbedingte Nicht-befolgen-<br />
Können von Regeln. Die Aufgaben der<br />
forensischen Psychiatrie und Psychotherapie<br />
umfassen aber nicht nur den<br />
Bereich des Strafrechts, sondern alle Fragen,<br />
die Juristen an Psychiater stellen<br />
können: Erwerbs- und Berufsunfähigkeit,<br />
Testierfähigkeit, Fahrtauglichkeit oder<br />
Erziehungsfähigkeit der Eltern aufgrund<br />
psychiatrischer Erkrankungen und mehr.<br />
Die Behandlung psychiatrischer Erkrankungen<br />
und die Beurteilung der Prognose<br />
gehören ebenfalls zum Tätigkeitsfeld<br />
der forensischen Psychiatrie.<br />
Gibt es den geborenen Kriminellen?<br />
Nein, den gibt es nicht. Allerdings kann<br />
die genetische Disposition – insbesondere<br />
im Zusammenwirken mit anderen<br />
Faktoren wie einem Missbrauchserlebnis<br />
im Kindesalter – erheblichen Einfluss auf<br />
gewalttätiges und antisoziales Verhalten<br />
im Erwachsenenalter haben. Genetische<br />
Faktoren beeinflussen auch die Funktionsweise<br />
des Gehirns, zum Beispiel die<br />
Impuls- und Verhaltenskontrolle.<br />
Verschiedene Studien zeigten, dass genetische<br />
Faktoren in Verbindung mit ungünstigen<br />
Umwelteinflüssen während<br />
der individuellen Entwicklung das Risiko<br />
späterer Gewaltanwendung und dissozialen<br />
Verhaltens deutlich erhöhen. Positive<br />
soziale Einflüsse dagegen können eine<br />
durchaus protektive Wirkung entfalten<br />
und das Risiko deutlich reduzieren.<br />
Wann wird von Schuldunfähigkeit und<br />
erheblich verminderter Schuldfähigkeit<br />
gesprochen?<br />
Es handelt sich dabei um zwei juristische<br />
Begriffe aus dem Strafgesetzbuch. Für<br />
die Schuldunfähigkeit werden da vier<br />
Merkmale benannt, auf die eine psychiatrische<br />
Störung bezogen werden muss,<br />
um eine Krankheit im Sinne des Gesetzes<br />
annehmen zu können: die krankhafte seelische<br />
Störung an sich, die tief greifende<br />
Bewusstseinsstörung, den Schwachsinn<br />
sowie schwere andere seelische Abartigkeit.<br />
Die Hürden, die zur Schuldunfähigkeit<br />
führen können, sind dabei sehr hoch.<br />
Erst wenn beispielsweise die krankhafte<br />
seelische Störung zum Tatzeitpunkt so<br />
erheblich gewesen war, dass der Täter<br />
das Unrecht in der Tat nicht einsehen<br />
konnte oder nicht mehr in der Lage war,<br />
nach seiner Einsicht zu handeln, kann<br />
von einer so erheblichen Störung ausgegangen<br />
werden, dass Schuldunfähigkeit<br />
anzunehmen ist. In den meisten Fällen<br />
handelt es sich dabei um psychotische<br />
Täter, die durch ihre Erkrankung den<br />
Bezug zur Wirklichkeit verloren haben,<br />
zum Beispiel aufgrund von Wahnvorstellungen.<br />
Der Betroffene handelt dann<br />
auf dem Boden seines Wahnerlebens, das<br />
er nicht mehr hinterfragen kann. Dieser<br />
Verlust des Realitätsbezugs bedingt dann<br />
Schuldunfähigkeit.<br />
Bei der erheblich verminderten Schuldfähigkeit<br />
geht das Strafgesetzbuch ebenfalls<br />
von diesen vier Merkmalen aus, wobei<br />
die Ausprägung der Störung immer<br />
erheblich sein muss, wenngleich noch ein<br />
Bezug zur Wirklichkeit erhalten bleibt.<br />
Die Anforderungen an die Annahme einer<br />
erheblich verminderten Schuldfähigkeit<br />
sind recht hoch. Die störungsbedingte<br />
Beeinträchtigung muss erheblich sein.<br />
Was für Maßregeln der Besserung und Sicherung<br />
gibt es im Strafgesetzbuch?<br />
Die Unterbringung in einem psychiatrischen<br />
Krankenhaus infolge einer psychiatrischen<br />
Erkrankung, durch die weitere<br />
erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten<br />
sind, ist gesetzlich geregelt. Diese<br />
Maßregel zielt auf die Behandlung und<br />
damit die Besserung des Patienten. Doch<br />
selbst bei einer erfolglosen Behandlung<br />
kann die Maßregel nicht abgebrochen<br />
werden, da ein weiterer Zweck dieser<br />
Maßregel die Sicherung krankheitsbedingt<br />
gefährlicher Patienten ist.<br />
Ein weiterer Paragraf behandelt die Unterbringung<br />
in einer Entziehungsanstalt<br />
aufgrund einer Suchterkrankung. Der<br />
Täter soll durch die Entziehungsbehandlung<br />
geheilt oder erhebliche Zeit vor dem<br />
Rückfall bewahrt werden. Die Behandlung<br />
kann jedoch bei Aussichtslosigkeit<br />
abgebrochen werden.<br />
Besteht die Möglichkeit, psychisch kranke<br />
Straftäter zu heilen? Wie erfolgt ihre<br />
Integration in die Gesellschaft?<br />
Grundsätzlich besteht diese Möglichkeit<br />
oder zumindest die einer deutlichen Besserung.<br />
Inwieweit die Reintegration letztlich<br />
gelingt, hängt maßgeblich von der<br />
psychiatrischen Störung, aber auch von<br />
dem Delikt ab. Taten wie Kindesmissbrauch<br />
haben eine sehr starke öffentliche<br />
Wahrnehmung. Dies erschwert es natürlich,<br />
wenn diese Patienten Kontakt zu<br />
ihrem früheren persönlichen Umfeld aufnehmen,<br />
um wieder in der Gesellschaft<br />
Fuß zu fassen.<br />
Dagegen sind Suchterkrankungen recht<br />
gut behandelbar. Auch psychotische Störungen,<br />
deren Symptome abgeklungen<br />
sind, haben häufig eine recht gute Prognose.<br />
Die Patienten lernen während der<br />
Therapie, ihre Symptome zu erkennen<br />
und Risikosituationen zu kontrollieren.<br />
Sie erfahren, welche Medikamente ihnen<br />
helfen, wo sie bei persönlichen Krisen<br />
Hilfe finden können und welche weiteren<br />
Risiko- und Belastungsfaktoren sie<br />
beachten müssen.<br />
Wenn die Behandlung fortgeschritten<br />
ist, werden die Patienten wieder in die<br />
Gesellschaft eingegliedert – allmählich<br />
und über verschiedene Lockerungsstufen.<br />
Und nach der Entlassung ist durch<br />
ambulante Weiterbehandlung über Jahre<br />
hinweg eine engmaschige Anbindung an<br />
die Klinik gewährleistet.<br />
Welche Fortschritte wurden in den letzten<br />
beiden Jahrzehnten in der forensischpsychiatrischen<br />
Forschung gemacht?<br />
Die 90er Jahre standen ganz im Zeichen<br />
der Prognoseforschung. Hier können<br />
wir auf deutliche Fortschritte verweisen.<br />
Heute wird hingegen mehr nach den neurobiologischen<br />
Grundlagen der Erkrankungen<br />
und den Behandlungsmöglichkeiten<br />
von Maßregelpatienten geforscht.<br />
Insofern rückt die Maßregeltherapie wieder<br />
etwas näher an die wissenschaftlich<br />
orientierte Allgemeinspsychiatrie. Einen<br />
großen Beitrag dazu leisten empirische<br />
Forschungen. Aktuell treten Behandlungsstudien<br />
und die Suche nach diagnostischen<br />
Methoden in den Vordergrund,<br />
was ich sehr begrüße.<br />
Wie sieht für Sie das ideale forensische<br />
Krankenhaus aus?<br />
Mit dem Einzug in den Maßregelvollzug<br />
werden viele Rechte der Patienten beeinträchtigt.<br />
So verlieren die Patienten das<br />
Recht, ihren Arzt frei zu wählen oder eine<br />
Behandlung zu beenden. Selbst die ärztliche<br />
Schweigepflicht wird eingeschränkt.<br />
Literaturhinweis<br />
Neurobiologie forensisch relevanter<br />
Störungen – Jürgen Müller (Hrsg.),<br />
Verlag Kohlhammer, 89,90 €<br />
Diesen Beschränkungen muss durch externe<br />
Kontrolle, Sorgfalt, Engagement<br />
und die therapeutische Atmosphäre<br />
entgegengewirkt werden. Ein patientenorientiertes<br />
freundliches Ambiente und<br />
die Berücksichtigung von Patientenbedürfnissen<br />
sind auch in der forensischen<br />
Psychiatrie selbstverständlich.<br />
Das Gespräch führte Mandy Wolf<br />
24 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 25<br />
Kontakt<br />
Prof. Dr. Jürgen Müller<br />
Chefarzt der Klinik für Forensischen<br />
Psychiatrie und Psychotherapie<br />
<strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Göttingen<br />
Rosdorfer Weg 70, 37081 Göttingen<br />
Tel.: (0551) 402 - 2100<br />
E-Mail: ju.mueller@asklepios.com
Medizin & Wissenschaft<br />
Herzchirurgie heute<br />
Technische und apparative Innovationen haben die Herzchirurgie in den letzten Jahren stark verändert. An der<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg ermöglicht die enge Kooperation mit den Nachbardisziplinen Kardiologie, Angiologie (Gefäßerkrankungen)<br />
und Diabetologie, aber auch mit den operativen Partnern in der Anästhesiologie und Gefäßchirurgie,<br />
die optimale Betreuung der Herz- und Gefäßpatienten in einem spezialisierten Zentrum.<br />
Koronarchirurgie<br />
Vergleichende Studien belegen, dass die<br />
Koronarbypass-Operation die Standardtherapie<br />
für Patienten mit koronarer<br />
Dreigefäßerkrankung oder Verengung im<br />
Abgangsbereich der linken Herzkranzarterie<br />
ist. Darüber hinaus zeigen große<br />
US-amerikanische Register, dass bei koronarer<br />
Mehrgefäßerkrankung die Bypass-<br />
Operation zu weniger Sterbefällen führt<br />
als die Behandlung mit medikamentenbeschichteten<br />
Stents (DES=Drug Eluting<br />
Stents). Außerdem kommt es im weiteren<br />
postoperativen Verlauf seltener zu Herzinfarkten<br />
oder der Notwendigkeit einer<br />
erneuten Revaskularisierung (d. h. nochmalige<br />
Bypass-Operation oder Implantation<br />
eines Koronar-Stents).<br />
Allerdings ist ein koronarchirurgischer<br />
Eingriff insbesondere bei Patienten, die<br />
von vielen Erkrankungen betroffen sind,<br />
nicht ohne Risiken: Das mit 2,2 Prozent<br />
(im Vergleich zu 0,6 Prozent bei Einpflan-<br />
zen eines Koronar-Stents) signifikant<br />
häufigere Auftreten von Schlaganfällen<br />
erfordert besonders schonende Operationsverfahren.<br />
Hier hat sich die Operationstechnik<br />
am schlagenden Herzen als<br />
fester Bestandteil des herzchirurgischen<br />
Spektrums etabliert. Bundesweit liegt der<br />
Anteil dieser Eingriffe mittlerweile bei<br />
zehn Prozent, besonders Frauen scheinen<br />
von dem Verfahren zu profitieren, wie<br />
eine Auswertung der Ergebnisse aus den<br />
Jahren 2004–2008 ergab. Daher wird dieses<br />
Operationsverfahren in der Herzchirurgischen<br />
Abteilung der <strong>Asklepios</strong> Klinik<br />
St. Georg insbesondere bei Patientinnen<br />
und Risiko-Konstellationen (schwere<br />
allgemeine Arteriosklerose, Voroperationen,<br />
Dialysepatienten) eingesetzt. Um<br />
die überlegenen Langzeitergebnisse der<br />
Bypass-Chirurgie auch tatsächlich zu realisieren,<br />
werden gerade bei jüngeren Patientinnen<br />
und Patienten keine Beinvenen,<br />
sondern Arterien für den Bypass verwendet,<br />
in der Regel die beiden Brustwandarterien,<br />
ggf. auch die Unterarm-Arterie.<br />
Klappenchirurgie<br />
Die Behandlung verengter Aortenklappen<br />
bei Risikopatienten erfährt derzeit<br />
eine Revolution. Durch die Entwicklung<br />
kathetergestützter Verfahren kann in bestimmten<br />
Fällen auch der Aortenklappenersatz<br />
am schlagenden Herzen durchgeführt<br />
werden. Nach der Aufdehnung<br />
der verengten Herzklappe durch einen<br />
Ballon wird unter Röntgen-Durchleuchtung<br />
eine selbstexpandierende biologische<br />
Klappe freigesetzt. Alternativ kann<br />
eine auf einem zusammengefalteten Ballon<br />
befindliche Klappe in die natürliche<br />
Aortenklappe „gestentet“ werden.<br />
Die bislang mit diesem Verfahren beobachtete<br />
Sterblichkeit im Vergleich zur<br />
Gesamtsumme der so behandelten Patienten<br />
liegt jedoch bei etwa zehn Prozent.<br />
Daher ist nach europäischen und deutschen<br />
Richtlinien ein Einsatz derzeit nur<br />
bei Hochrisikopatienten gerechtfertigt.<br />
Allerdings unterliegt auch hier mit zu-<br />
nehmender Erfahrung das Indikationsspektrum<br />
einem kontinuierlichen Wandlungsprozess.<br />
Rhythmuschirurgie<br />
Insbesondere in Zusammenhang mit der<br />
operativen Korrektur der Mitralklappe<br />
bei Insuffizienz, aber auch bei koronarchirurgischen<br />
oder Aortenklappen-Ein-<br />
Off Pump Coronary Artery Bypass<br />
(OPCAB): Koronarchirurgie am schlagenden<br />
Herzen mit Stabilisator und<br />
Saugglocke (mit freundlicher Genehmigung<br />
der Fa. Medtronic)<br />
griffen gewinnt die chirurgische Ablation<br />
des Vorhofflimmerns (elektrische Isolation<br />
der Lungenvenen durch Verödung im<br />
Bereich der Vorhöfe) an Bedeutung. Bei<br />
den von uns behandelten Patienten liegt<br />
die Erfolgsrate bei 74 Prozent (3 Monate<br />
nach OP) und 78 Prozent (knapp 3 Jahre<br />
nach OP), und das sogar bei chronischem<br />
Vorhofflimmern!<br />
Aortenchirurgie<br />
Die akute Aortendissektion (Zerschichtung<br />
der Hauptschlagader durch Einriss<br />
der Innenwand) bleibt ein chirurgischer<br />
Notfalleingriff mit hohem Risiko. Meist<br />
wird lediglich ein Teil der Aorta mit oder<br />
ohne Aortenklappe durch eine Gefäßprothese<br />
oder eine klappentragende Rohrprothese<br />
ersetzt. Bei Ersatz des gesamten<br />
Aortenbogens mit Herz-Lungen-Maschine<br />
im hypothermen Kreislaufstillstand<br />
(die Körpertemperatur beträgt dabei<br />
18º C) ist bei einer Dauer des Kreislaufstillstandes<br />
von über 45 Minuten mit<br />
einer Sterblichkeit von jedem dritten Patienten<br />
und mit einem Schlaganfall bei jedem<br />
fünften Patienten zu rechnen. Daher<br />
setzt sich in jüngerer Zeit die so genannte<br />
antegrade Hirnperfusion durch, bei der<br />
das Gehirn während des systemischen<br />
Kreislaufstillstands über Kanülen in der<br />
rechten Armarterie (und ggf. der linken<br />
Halsschlagader) permanent weiter mit<br />
Blut versorgt wird. Dadurch lassen sich<br />
Katheter-gestützte Aortenklappe vom Typ Edwards Sapien ® : Die<br />
auf einen Ballon aufgezogene Herzklappe wird zusammengefaltet<br />
in die native Aortenklappe vorgeschoben und dort durch Inflation<br />
des Ballons entfaltet (mit freundlicher Genehmigung der Fa.<br />
Edwards)<br />
Sterblichkeit und neurologische Komplikationen<br />
deutlich verringern – auf jeweils<br />
sechs Prozent. Darüber hinaus lassen<br />
sich im Rahmen von Hybridverfahren<br />
endovaskuläre Stents mit offener chirurgischer<br />
Versorgung kombinieren, was das<br />
Operationsrisiko weiter senkt. Besondere<br />
Möglichkeiten eröffnen sich dabei in der<br />
Kooperation von Herzchirurgie, Gefäßchirurgie<br />
und Angiologie.<br />
26 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 27<br />
Kontakt<br />
Prof. Dr. Michael Schmoeckel<br />
Herzchirurgische Abteilung<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg<br />
Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg<br />
Tel. (0 40) 18 18-85 41 50<br />
Fax (0 40) 18 18-85 41 84<br />
E-Mail: m.schmoeckel@asklepios.com<br />
Antegrade Hirnperfusion im systemischen hypothermen<br />
Kreislaufstillstand durch Anschluss der Herz-<br />
Lungen-Maschine über die rechte Arteria axillaris<br />
Trotz zunehmender Überalterung der Patienten,<br />
die häufig auch noch von vielen<br />
Erkrankungen betroffen sind, konnten<br />
die operativen Ergebnisse der Herzchirurgie<br />
in den vergangenen Jahren kontinuierlich<br />
verbessert werden. Eine enge Kooperation<br />
mit allen an der Herzmedizin<br />
beteiligten Disziplinen wird zukünftig in<br />
der klinischen Praxis noch schonendere<br />
Therapieverfahren für unsere oft schwer<br />
kranken Patienten ermöglichen. Schema [9] der Ablationslinien im linken Vorhof<br />
unter Verwendung des Atricure ® -Systems:<br />
1 = Ablation der rechten Lungenvenen-Einmündung<br />
2 = Ablation der linken Lungenvenen-Einmündung<br />
3 = Ziehen der Verbindungslinie
Medizin & Wissenschaft<br />
ADHS bei Erwachsenen<br />
Spezialsprechstunde für den erwachsenen Zappelphillip<br />
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung) gilt vorrangig als Erkrankung von Kindern. Für Erwachsene,<br />
die daran leiden, gibt es daher kaum diagnostische und therapeutische Angebote. Nun können Betroffene<br />
in der Psychiatrischen Institutsambulanz am Fachklinikum Stadtroda Hilfe bekommen: Unter der Leitung von<br />
Oberarzt Thomas Frisch wurde dort eine Spezialsprechstunde eingerichtet.<br />
ADHS ist die am häufigsten diagnosti-<br />
zierte psychiatrische Störung im Kindesalter.<br />
Während lange Zeit angenommen<br />
wurde, dass sich diese Erkrankung bis<br />
zum Erwachsenenalter „auswächst“,<br />
weiß man heute: Bei bis zu 70 Prozent<br />
der betroffenen Kinder besteht die ADHS<br />
auch im Erwachsenenalter fort. Und<br />
eine Studie in den USA ergab, dass zwei<br />
bis sechs Prozent aller Erwachsenen an<br />
ADHS erkranken.<br />
Wesentliche Merkmale der ADHS sind<br />
innere Unruhe, situationsübergreifende<br />
Störungen der Impulskontrolle, motorische<br />
Überaktivität, Störungen der Aufmerksamkeit,<br />
Desorganisiertheit sowie<br />
starke Stimmungsschwankungen bei geringer<br />
Frustrationstoleranz. Wenn diese<br />
Symptome im Erwachsenenalter auftreten,<br />
bedeutet dies Funktionseinschränkungen<br />
in unterschiedlichen Lebensbereichen<br />
– vor allem aber bei Schul- und<br />
Ausbildungsabschluss, Berufstätigkeit,<br />
Partnerschaft, Elternschaft und Verkehrstüchtigkeit.<br />
Bis zu 30 Prozent der Erwach-<br />
senen mit ADHS leiden außerdem an<br />
Depressionen und bis zu 40 Prozent an<br />
Angsterkrankungen. Zusätzlicher Alkohol-<br />
und Drogenmissbrauch besteht bei<br />
bis zu 36 Prozent der Erkrankten.<br />
Die Diagnose der ADHS im Erwachsenenalter<br />
ist schwierig, da es häufig<br />
Überschneidungen der Symptomatik mit<br />
anderen psychiatrischen Erkrankungen<br />
gibt. In Stadtroda erfolgt die Diagnostik<br />
daher in einem mehrstufigen Prozess.<br />
Neben der Erhebung und Beurteilung<br />
der aktuellen Symptome werden rückwirkend<br />
auch Symptome im Kindesalter<br />
erfasst (z. B. durch Schulzeugnisse),<br />
bisherige Diagnosekriterien überprüft<br />
und etwaige andere psychiatrische Erkrankungen<br />
festgestellt. Nach gesicherter<br />
ADHS-Diagnose geben die Spezialisten<br />
dann individuelle Empfehlungen zu den<br />
Behandlungsmöglichkeiten. Neben einer<br />
medikamentösen Behandlung können<br />
dies Psychotherapie, soziale Beratung<br />
und Ergotherapie sein.<br />
Mit KiK-TV aufschwingen!<br />
Ihr Wohlfühlfernsehen mit<br />
dem Gesundheitsplus.<br />
www.kik-tv.de<br />
Sie erreichen die Institutsambulanz<br />
Montag bis Donnerstag:<br />
08:00–12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr<br />
Freitag:<br />
08:00–12:00 Uhr.<br />
28 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 29<br />
Kontakt<br />
OA Thomas Frisch<br />
Leiter Psychiatrische Institutsambulanz<br />
<strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Stadtroda<br />
Bahnhofstraße 1a, 07646 Stadtroda<br />
Tel.: (036428) 56 13 19<br />
E-Mail: t.frisch@asklepios.com<br />
Schon seit über zehn Jahren verleihen wir mit unserem Wohlfühl-<br />
Programm vielen Patienten Flügel und sind ein wichtiger und zuverlässiger<br />
Partner für optimale Heilungsverläufe. Mit einem wohltuenden Mix<br />
aus Dokumentationen und Reportagen (Gesundheit, Gesellschaft,<br />
Natur u.a.), brandaktuellen und preisgekrönten Hollywood-Spielfilmen,<br />
humorvollen Beiträgen und Informationen über die Region unterhält,<br />
bewegt und motiviert das KiK-Programm seine Zuschauer. Darüber<br />
hinaus können Kliniken ihre Patienten mit der KiK-Technik auch immer<br />
ganz frisch informieren, beispielsweise über Speisepläne, Besuchszeiten<br />
oder Freizeitangebote. Für viele Patienten sind wir in Kliniken der<br />
beliebteste und meist gesehene TV-Sender auf dem Sendeplatz 1 und<br />
tragen dazu bei, dass sie nach ihren Klinikaufenthalten erfrischt<br />
aufschwingen und gesund in den Alltag zurückkehren können.<br />
KiK-TV. Die Nummer 1 in den <strong>Asklepios</strong>-Kliniken.
Gesundheit & Wirtschaft<br />
»Kurz und Knapp<br />
» Erweiterung der Orthopädie Bad Abbach<br />
Im Herbst 2010 sollen die ersten Patienten ihre Betten beziehen:<br />
Durch die Baumaßnahmen werden Arbeitsabläufe optimiert,<br />
und es entstehen „Einsparungseffekte, die nicht auf<br />
Kosten der Patientenversorgung gehen“, betont Raimund Rauscher,<br />
Verwaltungsdirektor des Klinikums. Der Neubau des Zentrums<br />
für orthopädische und rheumatologische Rehabilitation<br />
ist bereits abgeschlossen, auch Röntgenabteilung, Funktionsdiagnostik,<br />
Hochschulambulanzen der Rheumatologischen und<br />
Orthopädischen Kliniken, Patientenzimmer und Haupteingang<br />
wurden renoviert bzw. neu gebaut. Vor zwei Jahren konnte die<br />
Fertigstellung eines Gebäudetrakts im Fachkrankenhaus mit<br />
hochmodernem OP-, Intensiv- und Aufwachbereich sowie Sterilisation<br />
und Zentrallabor gefeiert werden. Die Generalsanierung<br />
soll 2013 mit dem Neu- und Erweiterungsbau des bisherigen<br />
Gebäudes der Orthopädischen Klinik abgeschlossen werden.<br />
» Fördergelder für Klinikneubau in Bad König<br />
Im November konnte Geschäftsführer Ulrich Schultz vom hessischen<br />
Gesundheitsminister Jürgen Banzer einen Förderbescheid<br />
in Höhe von 17,5 Millionen Euro entgegennehmen. Weitere<br />
4,5 Millionen Euro investiert <strong>Asklepios</strong> in den Klinikneubau.<br />
Die neurologische Fachklinik<br />
in Bad König gilt als eine der<br />
größten in Deutschland für<br />
die Behandlung von schwerst<br />
schädel-hirnverletzten Patienten.<br />
Zusammen mit dem Ambulanten<br />
Therapiezentrum im<br />
Altbau wird die neurologische<br />
v.l.n.r. Hessischer Minister für Ar- Behandlungskette über die<br />
beit, Familie und Gesundheit Jürgen<br />
Akut- und stationäre Rehabi-<br />
Banzer und Geschäftsführer Ulrich<br />
Schultz<br />
litationsphase hinaus ergänzt.<br />
Chefarzt Dr. Michael Hartwich<br />
betonte, die neurologische Rehabilitation sei „ein ganz junges<br />
Fach, das es in vielen Ländern noch gar nicht gibt“.<br />
Info-Telefon zum Neu- und Umbau: 0800- 3003345<br />
» Geriatrie in Seligenstadt eröffnet<br />
Am 22. Januar 2010 wurde die Geriatrie an der Klinik Seligenstadt<br />
mit einem Tag der offenen Tür feierlich eingeweiht. Mit der<br />
Inbetriebnahme sei ein „weißer Fleck der geriatrischen Betreuung<br />
im Kreis Offenbach bunt gefärbt“, so Dr. Nikos Stergiou,<br />
Ärztlicher Direktor der Klinik. Das neue Angebot trägt zur Standortsicherung<br />
bei und verbessert die medizinische Versorgung im<br />
Umkreis. Zu den Gastrednern beim Tag der offenen Tür gehörte<br />
auch Dr. Bernard gr. Broermann.<br />
» Bischof steht sicher auf beiden Beinen<br />
Biodex Balance<br />
heißt das Gerät,<br />
das Bischof<br />
Gerhard Ludwig<br />
Müller bei seinem<br />
Besuch im<br />
Zentrum für orthopädische<br />
und<br />
rheumatologische Rehabilitation am Klinikum Bad Abbach<br />
ausprobierte. „Sie haben eine ausgezeichnete Balance“, stellte<br />
Chefarzt Dr. Siegfried Marr fest. Nach zwei informativen Stunden<br />
und einer Führung lobte der Regensburger Oberhirte insbesondere<br />
den ganzheitlichen Ansatz der modernen Klinik. Chefarzt Dr.<br />
Josef Seidl hob die Zusammenarbeit mit den Seelsorgern beider<br />
Konfessionen hervor. Klinikleiter Raimund Rauscher hatte im<br />
Bereich katholischer Seelsorge eine eigene Stelle für Anne-Marie<br />
Mitterhofer geschaffen, und sie war es denn auch, die den Besuch<br />
des Bischofs anregte.<br />
30 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 31<br />
» Klinik Lindenlohe fördert Freiwillige<br />
Feuerwehr<br />
Die historische<br />
Feuerwehrspritze<br />
im Eingangsbereich<br />
der Orthopädischen<br />
Klinik<br />
Lindenlohe ist<br />
Zeugnis der engen<br />
Verbundenheit zwi-<br />
Der 1. Vorsitzende der FFW Anton Zweck (rechts) schen dem Kran-<br />
und Klinik-Geschäftsführer Matthias Meier<br />
kenhaus und der<br />
Freiwilligen Feuerwehr<br />
Freihöls e. V., die in diesem Jahr ihr 110-jähriges Jubiläum<br />
feiert. Seit Kurzem ist die Klinik nun offiziell förderndes Mitglied<br />
der 34-Mann-Wehr, der aber auch vier aktive Frauen angehören.<br />
Die Partnerschaft wurde zwischen dem 1. Vorsitzenden Anton<br />
Zweck und Klinik-Geschäftsführer Matthias Meier per Handschlag<br />
besiegelt.<br />
» Qualitätssiegel für Wiesbadener<br />
Krankenhäuser<br />
Im November wurden die <strong>Asklepios</strong> Paulinen Klinik, das St. Josefs-Hospital<br />
Wiesbaden und die Stiftung Deutsche Klinik für<br />
Diagnostik mit dem Qualitätssiegel der Techniker Krankenkasse<br />
(TK) ausgezeichnet. Im Rahmen der aktuellen Patientenbefragung<br />
punkteten die Krankenhäuser in allen fünf Qualitätsdimensionen.<br />
Patienten der Paulinen Klinik schätzen vor allem<br />
die lange Zeit, die sich Ärzte und Pflegekräfte für ihre Patienten<br />
nehmen. Die Patienten des St. Josefs-Hospitals sind besonders<br />
zufrieden mit den medizinischen Leistungen der Ärzte und loben<br />
die verständlichen Erklärungen ihrer Fragen – insbesondere die<br />
gute Aufklärung über die Narkose. In der Deutschen Klinik für<br />
Diagnostik bewerten die Befragten insbesondere die gute Organisation<br />
der Aufnahme sehr positiv.<br />
Mehr Informationen: www.tk-online.de/klinikfuehrer<br />
» Klinikum Uckermark: erstes vernetztes<br />
KTQ-Zertifikat in Deutschland<br />
Erstmals stellten sich ein Krankenhaus und ein MVZ gleichzeitig<br />
der Prüfkommission. Nach zweijähriger Vorbereitung sowie einer<br />
einwöchigen Prüfung und Begehung durch Visitoren der KTQ-<br />
GmbH wurde das umfassende Qualitätsmanagement im Schwedter<br />
Klinikum jetzt besiegelt. Das Qualitätsmanagementsystem<br />
wurde in Schwedt von Anfang an mit übergreifenden Strukturen<br />
aufgebaut. „Wir werden alle gemeinsam das bisher Erreichte als<br />
Basis für die weitere Entwicklung des Hauses nutzen“, bekräftigt<br />
der Qualitätsbeauftragte des Klinikums, Gunnar Feil.
Gesundheit & Wirtschaft<br />
Aus der Praxis – für die Praxis:<br />
Wunden versorgen, behandeln, heilen<br />
Die effektive Versorgung von Wunden gewährleistet eine deutlich verbesserte Lebensqualität und im günstigsten Fall<br />
eine raschere Ausheilung. Auch unter gesundheitsökonomischen Gesichtspunkten ist die moderne Wundversorgung<br />
ein wichtiges Thema, denn die Behandlung chronischer Wunden erfordert häufig den Einsatz großer Ressourcen. <strong>Asklepios</strong><br />
intern sprach mit Anke Bültemann, Werner Sellmer und Dr. Wolfgang Tigges, die als Autorenteam aktuelle<br />
Therapieempfehlungen in einer „<strong>Asklepios</strong> Wundfibel“ zusammengetragen haben.<br />
Die effektive Versorgung von Wunden gewährleistet Patientinnen und Patienten<br />
eine deutlich verbesserte Lebensqualität und im günstigsten Fall eine raschere<br />
Ausheilung. Auch unter gesundheitsökonomischen Gesichtspunkten ist die moderne<br />
Wundversorgung ein bedeutendes Thema. Häufi g sind diese komplexen Störungen<br />
mit dem Einsatz erheblicher Ressourcen verbunden.<br />
Aus der Praxis für die Praxis haben drei Wund-Experten aus den <strong>Asklepios</strong> Kliniken<br />
aktuelle Therapieempfehlungen zur Behandlung chronischer Wunden zusammengetragen.<br />
Ihre Handlungsempfehlungen weisen den Weg zu einer qualitativ<br />
hochwertigen und ökonomisch effi zienten Behandlung von Patienten mit chronischen<br />
Wundheilungsstörungen.<br />
9 7 8 3 9 3 9 0 6 9 7 8 2<br />
ISBN 978-3-939069-78-2 www.mwv-berlin.de<br />
Aus welchem Grund wurde die Entscheidung<br />
zur Herausgabe einer eigenen „<strong>Asklepios</strong><br />
Wundfibel“ getroffen?<br />
Die Versorgung von Problemwunden ist<br />
aufwendig, teuer und belastend. Durch<br />
eine Standardisierung ergeben sich Vereinfachungen,<br />
Einsparungen und höhere<br />
Zufriedenheit bei den Kolleginnen aus<br />
der Pflege sowie dem ärztlichen Bereich.<br />
Mit unserer Wundfibel wollen wir diese<br />
Standardisierung zum Thema machen.<br />
Denn unsere jahrelangen Erfahrungen<br />
im Umgang mit Patienten, die an chronischen<br />
Wunden leiden, können Behandlungspfade<br />
aufzeigen, Optimierungen<br />
anregen und Hilfestellung sein.<br />
Bültemann | Sellmer | Tigges<br />
Wundfibel<br />
A.Bültemann<br />
W.Sellmer | W.Tigges<br />
Wundfibel<br />
Wunden versorgen,<br />
behandeln, heilen<br />
2. aktualisierte<br />
und erweiterte Aufl age<br />
Was unterscheidet die „<strong>Asklepios</strong> Wundfibel“<br />
von anderen Publikationen zu diesem<br />
Thema?<br />
Zu Fragen wie „Wunden und Produkte“<br />
gibt es natürlich kaum etwas zu schreiben,<br />
was die anderen, bundesweit bekannten<br />
Wundfibeln und die einschlägigen<br />
Fachbücher nicht schon geschrieben<br />
hätten. Daher haben wir eine große Anzahl<br />
neuer Kapitel zu wichtigen Einzelaspekten<br />
hinzugefügt. Das betrifft zum<br />
Beispiel Wunden mit dermatologischem<br />
Hintergrund, die Wirtschaftlichkeit,<br />
den Umgang mit Medizinprodukten<br />
und Arzneimitteln, die Kompressionstherapie<br />
und die Patientenüberleitung.<br />
Ebenso aufschlussreich sind auch unsere<br />
Anhänge mit einem Überblick über das<br />
bundesweite Angebot an Wundverbänden,<br />
Kompressionsbindensystemen und<br />
Strumpfsystemen.<br />
Erstmals wird die Wundfibel über einen<br />
medizinischen Verlag herausgegeben<br />
und ist damit auch im Buchhandel erhältlich.<br />
Was gab den Ausschlag für diesen<br />
neuen Weg der Darstellung?<br />
Obwohl ein wichtiger Aspekt der Wundfibelerstellung<br />
für uns die Verwendung<br />
und Nutzung im eigenen Unternehmen<br />
ist, darf jetzt schon von sehr großem Interesse<br />
der Fachöffentlichkeit ausgegangen<br />
werden. Damit sich Lieferengpässe und<br />
Zeitverzögerungen, die bei der Auslieferung<br />
der ersten Ausgabe auftraten, nicht<br />
wiederholen, wurde ein Verlag als Partner<br />
aufgenommen. Nun steht die Wundfibel<br />
jedem Interessierten auch außerhalb<br />
des Unternehmens zur Verfügung, was<br />
unsere Absicht einer umfassenden Verbesserung<br />
der Wundversorgung optimal<br />
unterstützt.<br />
Welche Ziele können durch die Nutzung<br />
dieser Wundfibel erreicht werden?<br />
Da gibt es sehr viele Aspekte. Die Wundfibel<br />
soll helfen, vorhandene Strukturen zu<br />
überprüfen und kritisch zu hinterfragen.<br />
Neue Arbeitsmodelle sollen die Wundversorgung<br />
vereinfachen und optimie-<br />
A-CT10003 <strong>Asklepios</strong>.qxd:A-CT10003 19.02.2010 14:57 Uhr Seite 1<br />
MonoMax ®<br />
Die neue Nahtmaterial-Generation.<br />
In diesem Material steckt Sicherheit.<br />
ultralangfristig reißfest<br />
hochelastisch<br />
Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland<br />
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | www.aesculap.de<br />
ren. Insbesondere Zuständigkeiten sollen<br />
besser erkennbar und Produktsortimente<br />
überschaubarer gestaltet werden. Eine<br />
verbesserte Wunddokumentation schafft<br />
juristische Sicherheit. Klare Behandlungspfade<br />
fördern Zufriedenheit in der pflegerischen<br />
und ärztlichen Arbeit. Nicht<br />
unerwähnt bleiben sollten mögliche Einsparpotenziale,<br />
beispielsweise durch die<br />
Spezialisierung und den gezielten Einsatz<br />
ausgebildeter Mitarbeiter wie Wundberater<br />
oder Vakuummanager. Durch die<br />
enge Verzahnung von Patientenversorgung<br />
und Materiallieferung (Sortimentstraffung,<br />
Preistransparenz, schnelle Materialverfügbarkeit)<br />
lassen sich ebenfalls<br />
beachtliche Summen einsparen.<br />
Welche Empfehlungen können Sie den Kliniken<br />
zum Einsatz der Wundfibel geben?<br />
Die neue Wundfibel bietet allen Kliniken<br />
die Chance zum Neuanfang oder Neustart.<br />
Gute Wundversorgung fördert die<br />
Zufriedenheit und ist ökonomisch sinnvoll.<br />
Unvermeidbare Wundversorgung<br />
kann effektiver und günstiger werden.<br />
Wenn eine Klinik beschließt, die Wundfibel<br />
einzuführen und umzusetzen ist zu-<br />
nächst eine Bestandsaufnahme sinnvoll:<br />
Wer macht derzeit was? Welche Spezialisierungen<br />
und Qualifizierungen (Fachabteilungen,<br />
Wundexpertenschulung) sind<br />
vorhanden? Angepasst an die Bedürfnisse<br />
der jeweiligen Einrichtung sollte dann<br />
eine interdisziplinäre ärztlich-pflegerische<br />
Arbeitsgruppe unter Beteiligung des<br />
Einkaufes, der Hygiene, der Apotheke,<br />
der Krankenpflegeschule, gegebenenfalls<br />
auch der Physikalischen Therapie<br />
und des Controllings neue Strukturen<br />
festlegen (Beratung, Dokumentation, Sortiment<br />
…). Der nächste Schritt ist dann<br />
die Einführungsphase, in der jeder Arzt,<br />
jede Station, jede Schule, jede Apotheke<br />
oder jedes Labor über eine angemessene<br />
Stückzahl an Wundfibeln verfügt.<br />
Innerhalb eines Jahres sollte die neue<br />
Struktur bereits reibungslos funktionieren<br />
und Patienten und Haus gleichermaßen<br />
Nutzen bringen.<br />
Wie und wo kann das Buch erworben<br />
werden?<br />
Mitarbeiter von <strong>Asklepios</strong> erhalten die<br />
Wundfibel über ihr Haus beziehungsweise<br />
ihre Einrichtung. Andere Interessierte<br />
bekommen es im Buchhandel oder über<br />
das Internet. Und die Teilnehmer unserer<br />
Wundexpertenkurse in Hamburg werden<br />
zu Beginn des Kurses diese Wundfibel als<br />
wichtiges Instrument für die Ausbildung<br />
erhalten.<br />
Die Fragen stellte Mandy Wolf<br />
32 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 33<br />
Kontakt<br />
Werner Sellmer<br />
Fachapotheker für klinische Pharmazie<br />
Wilstedter Weg 22a, 22851 Norderstedt<br />
Tel.: (0171) 5618984<br />
E-Mail: w.sellmer@asklepios.com
Gesundheit & Wirtschaft<br />
„Ein auf Dauer leistungsstarkes<br />
Unternehmen“<br />
Durch ihre verschiedenen fachlichen Schwerpunkte decken die drei Konzerngeschäftsführer der <strong>Asklepios</strong> Kliniken<br />
sämtliche im Top-Management eines Krankenhausunternehmens erforderlichen Fähigkeiten ab. Einer von ihnen ist<br />
Dr. h.c. Peter Coy. Der 46-jährige Diplom-Betriebswirt gehört der Konzerngeschäftsführung seit 2007 an. <strong>Asklepios</strong><br />
intern sprach mit ihm über seine Aufgabenschwerpunkte und die Perspektiven des Unternehmens.<br />
Dr. h.c. Peter Coy<br />
Seit wann sind Sie bei den <strong>Asklepios</strong> Kliniken<br />
beschäftigt?<br />
Mittlerweile sind es fast 21 Jahre. Als <strong>Asklepios</strong><br />
im Jahre 1989 das Management<br />
des Wiebadener Paulinenstifts übernahm,<br />
arbeitete ich dort schon projektbezogen<br />
als Student. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre<br />
übernahm ich die<br />
Geschäftsführung der Paulinen Klinik,<br />
wurde danach Regionalgeschäftsführer<br />
für den Raum Hessen/Rheinland-Pfalz.<br />
2007 wurde ich zum Konzerngeschäftsführer<br />
berufen.<br />
Welche Funktionen hatten Sie vor dieser<br />
Tätigkeit?<br />
Meine Aufgabenschwerpunkte lagen damals<br />
vor allem im operativen Geschäft.<br />
Da Wiesbaden eine Modellklinik ist, gingen<br />
von dort immer viele Signale aus –<br />
die gesetzlichen Regelungen dazu wurden<br />
häufig erst Jahre später verabschiedet.<br />
Wir waren schon früh Vorreiter für<br />
innovative Versorgungsstrukturen wie<br />
zum Beispiel die Einführung integrierter<br />
Versorgungsformen, das ambulante Operieren,<br />
die Etablierung von Notdienstzentralen<br />
gemeinsam mit der Kassenärztlichen<br />
Vereinigung oder die Einführung<br />
eines Privatklinik-Konzeptes. Als Regionalgeschäftsführer<br />
lag mein Fokus dann<br />
auf der Sanierung von Kliniken.<br />
Seit Januar 2010 sind die Aufgaben innerhalb<br />
der Konzerngeschäftsführung neu<br />
aufgeteilt. Können Sie kurz darstellen,<br />
welche Bereiche Ihr Aufgabengebiet jetzt<br />
umfasst?<br />
Zu meinem Zuständigkeitsbereich gehören<br />
jetzt auch die Kliniken im Nordosten,<br />
wobei die psychiatrischen Einrichtungen<br />
und das INI Hannover an Dr. Tobias Kaltenbach<br />
berichten. Außerdem verantworte<br />
ich den Bereich des Zentralen Einkaufs.<br />
Hier sehe ich die größten Entwicklungspotenziale<br />
und Wirtschaftlichkeitsreserven.<br />
Für den Schwerpunkt Medical Partner suche<br />
ich in Sekundärleistungsbereichen wie<br />
Labor, Röntgen und der Pathologie gezielt<br />
nach Schlüsselpartnern. Und als Arbeitsdirektor<br />
strebe ich auf einer soliden vertrauensvollen<br />
und kommunikativen Basis<br />
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit<br />
mit dem Konzernbetriebsrat der <strong>Asklepios</strong><br />
Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH an.<br />
So entwickeln wir im Bereich Tarifrecht<br />
faire und umsetzbare Vergütungsstrukturen<br />
für unsere Kliniken.<br />
Welche Ideen und Vorstellungen möchten<br />
Sie umsetzen?<br />
Unsere Kliniken verfügen bereits heute<br />
über ein qualitativ hochwertiges medizinisches<br />
und pflegerisches Angebot. Wichtigstes<br />
Ziel ist es, das klinische Angebot<br />
im Einklang mit den ökonomischen Erfordernissen<br />
eines privaten Klinikträgers<br />
weiterzuentwickeln und zu optimieren.<br />
Dabei sind mir die Etablierung nachhaltiger<br />
zukunftsorientierter Strukturen und<br />
die Untermauerung der Werte des Familienunternehmens<br />
<strong>Asklepios</strong> besonders<br />
wichtig.<br />
Wo sehen Sie das Unternehmen <strong>Asklepios</strong><br />
in zehn Jahren?<br />
Unser Ziel ist ein dauerhaft leistungsstarkes<br />
Unternehmen auf der Basis eines soliden<br />
Wachstums. Durch Zuverlässigkeit,<br />
Seriosität und Transparenz möchten wir<br />
auch in den nächsten zehn Jahren das<br />
führende deutsche Krankenhausunternehmen<br />
bleiben.<br />
Das Gespräch führte Mandy Wolf<br />
Lösungen für den<br />
Klinikalltag<br />
Funktionale Ideen<br />
mit Beschlaglösungen<br />
von Häfele für mehr<br />
Effizienz und Komfort<br />
im Klinikalltag<br />
www.hafele.com<br />
Anz_asklepiosintern_hoch.indd 1 15.02.10 22:40<br />
34 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 35
Gesundheit & Wirtschaft<br />
Welche Laufbahn soll ich einschlagen?<br />
Julius Iskra berichtet von seinem Schülerpraktikum in der Abteilung Kultur & Marketing der Klinik Birkenwerder<br />
In einem Schaukasten<br />
der Schule wurden die<br />
Stellenausschreibungen<br />
ausgehangen – vom<br />
Maler bis zur Ärztin in<br />
der Abteilung Plastische-ÄsthetischeChirurgie.<br />
Wir hatten uns<br />
im Unterricht darauf<br />
vorbereitet, wie und<br />
in welcher Form man<br />
Bewerbungen schreibt,<br />
nun stand uns eine harte<br />
Zeit des stundenlangen<br />
Sitzens am Computer<br />
bevor. Doch dies<br />
war nur ein Teil des<br />
Ganzen. Beim mündlichenBewerbungsgespräch<br />
ging es für<br />
einige ziemlich real zu.<br />
Ich muss leider auch<br />
beichten, dass ich mich<br />
um eine Journalisten-<br />
Schülerpraktikantinnen: Jamie Schackert (links) und Dinah Sommer (Mitte),<br />
Stelle bewarb, jedoch nicht<br />
Leitung Rezeption – Patientenservice: Diana Krierke (rechts)<br />
genommen wurde. Im<br />
Nachhinein bin ich aber<br />
Ich bin 15 Jahre und besuche die Regine- für diese Entscheidung sehr dankbar,<br />
Hildebrandt-Schule in Birkenwerder. Im denn so bekam ich die Stelle als „Marke-<br />
November war ich im Rahmen der Schul- tingassistent“.<br />
GmbH Praktikant in der <strong>Asklepios</strong> Kli- An unserem ersten Arbeitstag wurden<br />
nik. Der pädagogische Hintergrund be- wir (14 Schüler, die sich wacker durch die<br />
steht darin, dass wir kurz vor dem wirk- harten Prüfungen geschlagen hatten) über<br />
lichen Einstieg ins knallharte Berufsleben alle Daten-, Brand- und Unfallschutzbe-<br />
noch einmal die Möglichkeit bekommen, stimmungen in der Klinik informiert und<br />
zu lernen, wie man sich bewirbt, was für in unsere Abteilungen gebracht. Geleitet<br />
Anforderungen man bestehen muss und wurden wir von Schwester Edeltraut und<br />
wie man sich bei einem Bewerbungsge- Frau Klemp, mit der mir noch eine sehr<br />
spräch verhält.<br />
interessante Woche bevorstand.<br />
Als ich dann an meinem Arbeitsplatz ankam,<br />
begann meine eigentliche Arbeit.<br />
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals<br />
für die freundliche und aufgeschlossene<br />
Art meiner Vorarbeiterin (was für<br />
ein schönes Wort) bedanken. Die Arbeit<br />
machte mir wirklich Spaß. Gut, Mappen<br />
zu basteln und zu befüllen, wäre nun<br />
nicht meine Traumbeschäftigung gewesen,<br />
gehört aber eben dazu. Zahlreiche<br />
Meetings wurden abgehalten, die Presse<br />
wurde eingeladen, wir organisierten Veranstaltungen,<br />
ich durchforstete morgens<br />
Zeitungen nach Artikeln über die Klinik<br />
und archivierte diese. Zu meinen Aufgaben<br />
gehörte auch die Anfertigung von<br />
Wegbeschilderungen sowie das Kopieren<br />
und Wegordnen von Rechnungen. Ich<br />
durfte an einer Datenschutzfortbildung<br />
und an einer Klinikkonferenz teilnehmen.<br />
Für meinen späteren beruflichen Weg<br />
– Gott weiß, welche Laufbahn ich nun<br />
wirklich einschlagen sollte, im Moment<br />
erscheint mir aber die Arbeit im medizinischen<br />
Bereich gar nicht so abwegig – ist<br />
nun der Bereich Marketing präsent und<br />
unverzichtbar. Danke für die tolle Woche!<br />
Julius Iskra<br />
Julius Iskra<br />
Mit „Leonardo da Vinci“ nach Spanien<br />
„Leonardo da Vinci“ ist der Name eines Programms, mit der die Europäische Union Auslandsaufenthalte in der beruflichen<br />
Bildung fördert. Im vergangenen September fuhren im Rahmen dieses Programms neun Radiologieschüler/<br />
innen der MTA-Schule Hamburg nach Ciudad Real. Die Teilnehmer des Examenskurses 110 berichten darüber.<br />
Wir hatten vorab per E-Mail mit den<br />
spanischen Schüler/innen Kontakt aufgenommen<br />
und wurden sehr gastfreundlich<br />
und herzlich in deren Familien aufgenommen.<br />
Trotz einiger Spanischstunden<br />
an unserer MTA-Schule war es anfangs<br />
natürlich schwierig, die Sprache zu verstehen,<br />
geschweige zu sprechen. Doch<br />
Offenheit und Warmherzigkeit machten<br />
uns die Verständigung leicht – sie klappte<br />
mit einer Mischung aus Englisch und<br />
lexikalischem Wissen sowie mit Händen<br />
und Füßen. Von den Familien wurden<br />
wir versorgt, verwöhnt und bekocht.<br />
In Ciudad Real befindet sich das größte<br />
Krankenhaus Spaniens. Er wurde erst<br />
vor drei Jahren eröffnet, die Röntgenausstattung<br />
entspricht neuesten Standards.<br />
Sie ist voll digitalisiert, vorwiegend wird<br />
mit Flat Panels gearbeitet. Geräte und<br />
Arbeitsplätze waren uns von den Krankenhäusern<br />
in Hamburg vertraut. In den<br />
drei Wochen wurden wir abwechselnd in<br />
der Röntgendiagnostik und der Nuklearmedizin<br />
eingesetzt. Es entstand zwischen<br />
dem MTA-Personal und uns sehr schnell<br />
eine gute Vertrauensbasis, so dass wir<br />
nach kurzer Zeit weitgehend selbstständig<br />
arbeiten durften. Auch die Ärztinnen<br />
und Ärzte hatten immer ein offenes Ohr<br />
für uns. Durch die Aneignung einiger<br />
spanischer Fachtermini wurde die Kommunikation<br />
mit den Patienten möglich.<br />
Im Vergleich zu unseren Erfahrungen in<br />
Hamburg erschien uns das Arbeiten „lockerer“,<br />
der Krankenhausablauf war auch<br />
ohne detaillierte Organisation und strikte<br />
Regeln wunderbar zu bewältigen, Patienten<br />
und Personal waren mit den Arbeits-<br />
abläufen sehr zufrieden. Hinsichtlich des<br />
Strahlenschutzes, der Aufnahmetechnik<br />
und der Patientenlagerung wurde anders<br />
gearbeitet als bei uns. Das regte uns an,<br />
über unsere Ausbildungsstandards zu reflektieren.<br />
Unsere Arbeitszeit begann um 8 Uhr, um<br />
11 Uhr gab es Frühstück, und um 15 Uhr<br />
gingen wir zum Mittagessen, das von<br />
der Klinik bezahlt wurde. Danach konnten<br />
wir zu Hause zwei Stunden Siesta<br />
machen, bevor unser tägliches Kulturprogramm<br />
begann: Stadt- und Schlossbesichtigungen,<br />
ein Besuch beim Winzer,<br />
eine Flamencoaufführung, Stierkampf<br />
und abendliche Treffen mit unseren spanischen<br />
Freunden bei Tapas und Bier. An<br />
den Wochenenden besuchten wir Sevilla,<br />
Toledo und Madrid. Nach den drei Wochen<br />
und der offiziellen Abschiedsfeier in<br />
der spanischen MTA-Schule verabschiedeten<br />
wir uns unter Tränen (auf beiden<br />
Seiten) von unseren Gastfamilien.<br />
Wir danken Frau Winkel ganz herzlich,<br />
die sich mit großem Engagement dafür<br />
einsetzte, den strengen EU-Richtlinien<br />
für diesen Austausch gerecht zu werden!<br />
36 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 37<br />
Kontakt<br />
Barbara Winkel<br />
Leiterin der MTA-Schule für Radiologie<br />
Bildungsberufe für Gesundheitsberufe<br />
c/o <strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg<br />
Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg<br />
Tel.: (040) 18 18 85 34 97<br />
E-Mail: bwinkel@gmx.de
Gesundheit & Wirtschaft<br />
Villa Rothschild als „Ort der Freiheit<br />
und Demokratie” geehrt<br />
Anlässlich des 50. Jahrestages des Grundgesetzes und des 20. Jahrestages des Mauerfalls stellte die Konrad-Adenauer-<br />
Stiftung im Jahr 2009 Orte vor, die an herausragende Ereignisse in der Bundesrepublik erinnern. Die Geschichten<br />
dieser Orte werden in einem begleitenden Buch erzählt.<br />
Die Villa Rothschild gilt in Deutschland als „Wiege der Demokratie“. Die Villa Rothschild heute<br />
1887 beauftragte der Bankier Wilhelm Carl<br />
von Rothschild den Bau der Villa als Sommerresidenz.<br />
Heute wird sie als Luxushotel<br />
genutzt und befindet sich seit einigen<br />
Jahren im Besitz von Dr. Bernard gr. Broermann,<br />
dem Alleingesellschafter der <strong>Asklepios</strong><br />
Gruppe. Seit der Gründung von<br />
<strong>Asklepios</strong> vor 25 Jahren verzichtet Dr. Broermann<br />
auf jegliche Gewinnausschüttung<br />
sowie auf Arbeitsentgelt: Alle Erlöse können<br />
im Unternehmen bleiben. Er bestreitet<br />
seinen Lebensunterhalt mit der Vermietung<br />
von Gewerbeimmobilien. Die Villa<br />
Rothschild zählt zu diesen Immobilien.<br />
Ein Rückblick: Im besetzten Nachkriegsdeutschland<br />
erhielten die westdeutschen<br />
Ministerpräsidenten 1948 den Auftrag, ei-<br />
Kontakt<br />
Villa Rothschild<br />
Im Rothschildpark 1<br />
61462 Königstein im Taunus<br />
Tel.: (0 61 74) 29 08-0<br />
E-Mail: villa@villa-rothschild.com<br />
www.villa-rothschild.com<br />
nen westdeutschen Teilstaat zu gründen.<br />
Um der Gründung dieses neuen Staates<br />
nur vorübergehenden Charakter zu geben,<br />
beriefen die Ministerpräsidenten<br />
keine verfassunggebende Versammlung<br />
ein, sondern einen „Parlamentarischen<br />
Rat”, der ein „Grundgesetz” erarbeitete.<br />
Erste Treffen des Parlamentarischen<br />
Rates fanden 1948 in Bonn und Herrenchiemsee<br />
statt, dann wurde nach einem<br />
ständigen Verhandlungsort gesucht.<br />
Die Wahl fiel auf die Villa Rothschild in<br />
Königstein. Nicht weit von Frankfurt entfernt,<br />
bot dieser Ort optimale Bedingungen<br />
– sowohl in Bezug auf Erreichbarkeit<br />
als auch auf Abgeschiedenheit. Fortan<br />
trafen sich hier Politiker wie Theodor<br />
Heuss, Ludwig Erhard und Ernst Reuter<br />
mit Diplomaten und anderen Persönlichkeiten<br />
aus Politik und Wirtschaft. In<br />
diesen Gründungsjahren wurde die Villa<br />
Empfehlenswerte Links<br />
http://www.villa-rothschild.com<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Villa_Rothschild<br />
http://www.kas.de/wf/de/33.16887<br />
Rothschild als „Haus der Länder“ bezeichnet.<br />
Am 24. März 1949 beschlossen die Ministerpräsidenten<br />
dann in der Villa die<br />
Einführung eines bundeseinheitlichen<br />
Wahlrechts, das Konrad Adenauer zuvor<br />
als „von entscheidender Bedeutung für<br />
die politische Zukunft Deutschlands” bezeichnete.<br />
Aufgrund dieser Vergangenheit wurde<br />
die Villa Rothschild nun im vergangenen<br />
Jahr – gemeinsam mit dem Brandenburger<br />
Tor und der Nikolaikirche in Leipzig – mit<br />
dem Titel „Ort der Freiheit und der Demokratie<br />
in Deutschland” ausgezeichnet.<br />
Birgit Gugath<br />
Buchtipps<br />
Andreas Augustin: Villa Rothschild<br />
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.:<br />
Orte der Freiheit und der Demokratie in<br />
Deutschland<br />
(Zur Bestellung eines kostenfreien Exemplars<br />
E-Mail an: bestellung@kas.de.<br />
Jedes weitere Exemplar kostet drei Euro)<br />
Aufklärung, Prävention und<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Aktionen der Harzkliniken zum 1. Internationalen Brustkrebstag<br />
Das psychoonkologische Beratungsteam der Harzkliniken<br />
Die rosa Schleife, Pink Ribbon genannt,<br />
soll alljährlich im Oktober die Menschen<br />
für das Thema Brustkrebs, dessen Früherkennung<br />
und Behandlung sensibilisieren.<br />
„Wissen gegen Angst“ hieß eine<br />
gemeinsame Aktion des Psychoonkologischen<br />
Beratungsteams der Harzkliniken,<br />
der „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ und<br />
einer neu gegründeten Gruppe junger<br />
Frauen mit Brustkrebs, den „Pink Ladys“.<br />
Die Veranstaltung in der Goslarer<br />
Fußgängerzone, an der sich auch viele<br />
ortsansässige Firmen beteiligten, fand am<br />
1. Oktober, dem Internationalen Brustkrebstag,<br />
statt. Ein rosa gestalteter Stand<br />
lud zum Schauen und zum Gespräch ein.<br />
Neben Informationen gab es auch etwas<br />
zum buchstäblichen „Begreifen“: Interessierte<br />
konnten in gefüllten Luftballons<br />
und in einer Prothese Fremdkörper ertasten<br />
– Motivation zum eigenen Abtasten.<br />
Dazu wurden auch spezielle Anleitungen<br />
mitgegeben. Die Sozialarbeiterin Angela<br />
Frost beantwortete Fragen zu Krankenkassenleistungen<br />
und Hilfsangeboten.<br />
Vielen Passanten wurde so die Scheu genommen,<br />
sich mit der Krebs-Thematik<br />
auseinanderzusetzen.<br />
Nach einer Brustentfernung oder auch<br />
bei einer einseitig verkleinerten Brust<br />
findet die Erstversorgung mit Brustprothetik<br />
und passendem BH noch im Krankenhaus<br />
statt, also ehe die Patientin nach<br />
Hause entlassen wird. Dies trägt dazu<br />
bei, die Psyche der brustoperierten Frau<br />
und ihren Wunsch nach Weiblichkeit zu<br />
stabilisieren, den Heilungsprozess zu fördern<br />
und die Wiedereingliederung in den<br />
normalen Alltag zu beschleunigen.<br />
Der Moment, in dem die Frauen ihre operierte<br />
Brust das erste Mal sehen, ist häufig<br />
gefürchtet – Breast Nurse Schwester Rita<br />
Prinz und die Pflegekräfte der Station unterstützen<br />
die Frauen bei dieser Konfrontation.<br />
Als Psychologin arbeitet Carola<br />
Thiele-Seidel mit den betroffenen Frauen<br />
am neuen Körperbild und den Auswirkungen<br />
auf das Selbstwertempfinden<br />
nach Brust-OP oder auch nach Haarverlust<br />
bei Chemotherapie. Der Umgang<br />
mit dem neuen Körperbild ist auch in<br />
Partnerschaft und Sexualität von großer<br />
Bedeutung.<br />
Sanitätshäuser spielen eine wichtige Rolle<br />
in der Versorgung der Patientinnen, denn<br />
die Angestellten der Sanitätshäuser sind<br />
gut geschult und sensibilisiert für die<br />
Empfindungen der Frauen. Darum starteten<br />
an diesem Tag Rita Prinz und Carola<br />
Thiele-Seidel im Sanitätshaus Färber<br />
eine weitere Aktion: Viele, auch langjährige<br />
Patientinnen des Goslarer Brustzentrums,<br />
wurden über die neuen Entwicklungen<br />
des Brustzentrums informiert –<br />
insbesondere über die neuen Gruppenangebote<br />
– und konnten allgemeine Fragen<br />
zur Krankheitsbewältigung stellen.<br />
Carola Thiele-Seidel<br />
38 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 39
Gesundheit & Wirtschaft<br />
Dem Zucker auf der Spur<br />
Zum 14. November 2009, dem Weltdiabetestag, wurde vom Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe<br />
in Deutschland e. V. (VDBD) ein Präventionsprogramm für Vorschulkinder und Grundschulkinder herausgebracht.<br />
Aus gutem Grund: Immer mehr Menschen – und vor allem immer jüngere Menschen – sind „zuckerkrank“, leiden<br />
also an Typ-2-Diabetes. Was früher als „Alterszucker“ galt, trifft heute viele Jugendliche und zunehmend auch Kinder.<br />
Die Ursachen sind unter anderem falsches Essverhalten, Bewegungsmangel und Übergewicht.<br />
Seit einigen Monaten beschäftigen sich<br />
darum die Kinder und Mitarbeiterinnen<br />
des Betriebskindergartens der Klinik Birkenwerder,<br />
der Kita „Morgenstern“, verstärkt<br />
mit dem Thema gesunde Ernährung.<br />
Im Rahmen des Projektes „Zucker<br />
– die süße Versuchung“ waren im<br />
vergangenen November Christa Lorenz<br />
und Birgitt Sojkowski, beide Diabetesberaterinnen<br />
DDG der Klinik Birkenwerder,<br />
mit dem Präventionsprogramm vor Ort.<br />
Die Kinder hatten zuvor eine Woche lang<br />
schon viel über Zucker in Erfahrung gebracht.<br />
Sie wussten bereits, dass Zucker<br />
unter anderem aus Zuckerrüben gewonnen<br />
wird, dass es verschiedene Zuckerarten<br />
gibt und vor allem, dass zu viel Zucker<br />
dem Körper schaden kann.<br />
Die Diabetesberaterinnen erzählten den<br />
neugierigen, aufmerksamen Kindern die<br />
Geschichte der Fee OlgaLora und ihrer<br />
Freunde. OlgaLora kann mit Hilfe ihres<br />
Feenstabes und eines Zauberspruches<br />
den Zucker in Lebensmitteln sichtbar machen.<br />
Auf diese Weise erfuhren nicht nur<br />
die Kinder, sondern auch der von Bauchschmerzen<br />
geplagte Zauberer NullKommaNix,<br />
wie viel Zucker beispielsweise<br />
ein Liter Limonade enthält (99 g!) und<br />
wie viel weniger das in einer Apfelsaftschorle<br />
ist.<br />
Anschließend stellten die Kinder mit Unterstützung<br />
der Kita-Mitarbeiterinnen<br />
und Diabetesberaterinnen Feentaler her –<br />
die enthalten nur wenig Zucker und sind<br />
trotzdem super lecker. Natürlich gehört<br />
auch Bewegung in den Alltag von Kindern,<br />
und darum endete der Vormittag<br />
Rezept für „Feentaler“ (4 Stück)<br />
1 EL Vollkornhaferflocken<br />
1 TL gehackte Haselnüsse<br />
1 TL gehackte Sonnenblumenkerne<br />
1 TL fester Honig<br />
ggf. 1 Tropfen flüssiger Honig<br />
1 TL Kakao<br />
8 runde Backoblaten<br />
Verrühre die Zutaten, bis eine feste<br />
Masse entsteht.<br />
Verteile die Masse mit 2 Löffeln<br />
oder einem Messer auf 4 Oblaten.<br />
Legen Sie auf jeden Taler eine weitere<br />
Oblate.<br />
mit einem Feentanz, an dem Erzieherinnen<br />
und Kinder gleichermaßen viel Freude<br />
hatten. Die Klinik Birkenwerder plant,<br />
dieses Präventionsprojekt auszubauen<br />
und damit auch in die umliegenden<br />
Grundschulen zu gehen. Der erste Besuch<br />
fand im November 2009 in der Flex<br />
B–Klasse der Beetzer Grundschule statt.<br />
Christa Lorenz, Diabetesberaterin DDG<br />
Elektronische Schließlösungen erhöhen<br />
Funktionalität und Komfort<br />
Der <strong>Asklepios</strong>-eigene Anspruch an Qualität und Effizienz zeigt sich nicht nur in der medizinischen Behandlung, sondern<br />
auch in der technischen Ausstattung der Klinikgebäude. So ersetzen elektronische Schließlösungen zunehmend<br />
den mechanischen Schlüssel. Rund zwei Dutzend der Kliniken zwischen Parchim und Bad Tölz setzen bereits das<br />
System Dialock von Häfele ein – mit entscheidenden Vorteilen für Funktionalität und Komfort.<br />
Krankenhäuser sind<br />
höchst komplexe Gebäude<br />
– auch und<br />
gerade unter dem Aspekt<br />
von Schließplänen:<br />
Unterschiedliche<br />
Personengruppen wie<br />
Ärzte, Pflegepersonal,<br />
Patienten, Servicekräfte<br />
und externe Dienstleister<br />
benötigen teilweise<br />
sehr kurzfristig<br />
ganz individuelle, oft<br />
auch zeitlich begrenzte<br />
Zutrittsprofile. Zudem<br />
gibt es in einer Klinik<br />
sensible Bereiche wie<br />
Arzneimittelschränke,<br />
Operationssäle oder<br />
die Intensivstation, wo<br />
unberechtigter Zutritt<br />
im wahrsten Sinne des<br />
Wortes „ausgeschlossen”<br />
werden muss. Und<br />
nicht zuletzt verlangen<br />
Abläufe im Klinikalltag<br />
häufig nach besonderen<br />
Lösungen, die den<br />
Komfort, die Flexibili-<br />
Elektronische Schließtechnik in der Klinik Parchim (Quelle: Häfele)<br />
tät, aber auch die Sicherheit sowohl für sogar Kosten. Denn anders als mechani-<br />
Patienten als auch für Klinikbetreiber sche Schlüssel lassen sich elektronische<br />
erhöhen. Im Gegensatz zu mechanischen Schlüssel bei Verlust einfach im System<br />
Anlagen kann elektronische Schließtech- sperren und günstig ersetzen.<br />
nik nicht nur einige, sondern alle diese Das elektronische Schließsystem Dialock<br />
Anforderungen erfüllen und spart dabei von Häfele verfügt über eine Vielzahl<br />
unterschiedlicher Komponenten<br />
für Außen-,<br />
Innen- und sogar Möbeltüren.<br />
Auch die Bedienung<br />
von Parkplatzschranken<br />
und andere<br />
Funktionen lassen sich<br />
integrieren. Sämtliche<br />
Schließpunkte im Gebäude<br />
können so mit einem<br />
einzigen Schlüssel<br />
gesteuert und einheitlich<br />
verwaltet werden.<br />
Als Transpondersystem<br />
funktioniert Dialock außerdem<br />
berührungslos,<br />
was die Bedienung im<br />
Alltag sehr erleichtert.<br />
Über elektronische Möbelschlösser<br />
lassen sich<br />
auch Wertfächer in den<br />
Patientenzimmern oder<br />
Personalspinde in eine<br />
umfassende Schließlösung<br />
integrieren. Ein<br />
zweites Beispiel: Pflegekräfte<br />
und Ärzte im<br />
akuten Einsatz können<br />
mit ihrem elektronischen<br />
Schlüssel die Aufzugsteuerung auf<br />
Vorrang schalten. Kurz: Mit dem elektronischen<br />
Schließsystem Dialock profitieren<br />
die <strong>Asklepios</strong> Kliniken von einem<br />
höheren Sicherheitsniveau und mehr<br />
Komfort – vor und hinter den Kulissen.<br />
40 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 41
Gesundheit & Wirtschaft<br />
Felix Fit wird noch fitter!<br />
Neues aus dem Qualifizierungs- und Kompetenzzentrum Prävention<br />
an der Weserbergland-Klinik Höxter<br />
Bei <strong>Asklepios</strong> ist Felix Fit seit Jahren ein guter Bekannter. Das bewegungsorientierte Präventionsprogramm für<br />
Kinder im Vor- und Grundschulalter wurde in der Weserbergland-Klinik Höxter entwickelt. „Mach mit bei Felix Fit<br />
– Bewegte Kinder“ findet bundesweit in Kindergärten und Grundschulen statt, wird durch Krankenkassen finanziert<br />
und ist markenrechtlich geschützt. Kursleiter mit entsprechenden Grundberufen (beispielsweise Physiotherapeuten,<br />
Sportpädagogen, Ergotherapeuten) werden seit Jahren vom Felix-Fit-Team geschult.<br />
Sport & Bewegung<br />
Sport & Bewegung im<br />
Kontext von Krankheitsbildern<br />
und Beschwerden<br />
Bewegungsbezogene<br />
Gesundheitsförderung<br />
Evidenzbasierte<br />
Gesundheitssportprogramme<br />
Angesichts der dynamischen Entwicklung<br />
auf nahezu allen Gebieten der Gesundheitsförderung<br />
und Prävention<br />
wächst der Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen,<br />
die noch über dieses eingeführte<br />
Präventionsprogramm hinausgehen.<br />
Darum wurde im September 2009<br />
vom Felix-Fit-Team ein Fortbildungszentrum<br />
gegründet. Ziel dieses Zentrums ist<br />
es, Seminare und Lehrgänge auf hohem<br />
wissenschaftlichen und zugleich anwenderorientierten<br />
Niveau anzubieten. So<br />
wird ein weiterer Beitrag zur Verbesserung<br />
der Gesundheitsvorsorge sowie zur<br />
Förderung der Prävention in Deutschland<br />
geleistet. Inhaltliche Schwerpunkte<br />
des Qualifizierungsprogramms sind<br />
Sport, Bewegung, Ernährung, Psyche<br />
und Persönlichkeit.<br />
Ernährung<br />
Ernährungsbezogene<br />
Gesundheitsförderung<br />
Psyche & Persönlichkeit<br />
Personal leadership<br />
Motivation und<br />
Verhaltensmodifikation<br />
Teamentwicklung und<br />
-führung<br />
Stressmanagement<br />
Mit Bezug zu spezifischen medizinischen und nicht-medizinischen Gesundheitsberufen<br />
Organisationale und Management-Kompetenzen<br />
Gesundheitsförderung nach Setting-Ansatz<br />
Betriebliche Gesundheitsförderung<br />
Gesundheitsförderung in pädagogischen Settings<br />
In der Startphase werden im Bereich<br />
Bewegungsförderung mehrere evaluierte<br />
Programme angeboten. Dazu gehören<br />
neben „Mach mit bei Felix Fit – Bewegte<br />
Kinder“ sowie „Gesund und fit<br />
– Gesundheitssportprogramme für Erwachsene“<br />
auch Weiterbildungen zum<br />
Rückenschullehrer nach Richtlinien der<br />
KddR (Konförderation der deutschen<br />
Rückenschulen). Schwerpunkt ist hierbei<br />
die Schulung zum Programm „Sanftes<br />
Rückentraining“. Hinzu kommen Weiterbildungsangebote<br />
zur betrieblichen Gesundheitsförderung.<br />
Die Angebotspalette<br />
wird stetig erweitert. Um eine fachlich<br />
fundierte Qualifizierung von Angehörigen<br />
medizinischer und nichtmedizinischer<br />
Gesundheitsberufe zu gewährleisten,<br />
ist das Expertenteam des Qua-<br />
lifizierungs- und Kompetenzzentrums<br />
Prävention interdisziplinär besetzt, unter<br />
anderem mit Fachärzten, Psychologen,<br />
Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern<br />
und Gesundheitswissenschaftlern.<br />
Dr. Harald Stübs, Dr. Hartmut Heinze<br />
Kontakt<br />
Dr. Harald Stübs<br />
Dipl.-Psychologe<br />
<strong>Asklepios</strong> Weserbergland-Klinik GmbH<br />
Grüne Mühle 90<br />
37671 Höxter<br />
Tel.: (05271) 98 2337<br />
Fax: (05271) 98 2319<br />
E-Mail: h.stuebs@asklepios.com<br />
900 kleine rote Schleifen im<br />
Krankenhaus<br />
Zum Weltaidstag setzte das Klinikum Uckermark ein Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit.<br />
Assistenzarzt Bülent Yozgat klärt die Schüler auf.<br />
Auch die Mitarbeiterinnen der Rezeption<br />
trugen rote Schleifen.<br />
Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
des Klinikums Uckermark trugen<br />
am 1. Dezember die rote Aids-Schleife.<br />
Gleichzeitig startete das Klinikum unter<br />
dem Motto „Gegen das Vergessen<br />
– gemeinsam gegen Aids“ eine Präventionskampagne<br />
für Jugendliche. Fast<br />
100 Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-<br />
Gymnasiums kamen zu einem Vortrag,<br />
stellten Fragen, füllten Fragebögen aus.<br />
„Die Aufklärung der jungen Menschen<br />
ist heute wichtiger denn je“, betonte<br />
Rektor Rüdiger Ober-Blöbaum. „Weil in<br />
der Öffentlichkeit nicht mehr viel über<br />
das Thema geredet wird, sind vor allem<br />
junge Heranwachsende eher unwissend,<br />
unbesonnen und deshalb leichtsinnig.“<br />
Die Referenten Bülent Yozgat und Dr.<br />
Franziska Hub sind erst seit November<br />
als Assistenzärzte im <strong>Asklepios</strong> Klinikum<br />
tätig. Für die Auftaktveranstaltung<br />
der Kampagne wurden bewusst junge<br />
Ärzte ausgewählt: Sie sprechen die<br />
Sprache der Jugendlichen und können<br />
sich auf sie einlassen.<br />
Derartige Veranstaltungen werden jetzt<br />
vom Klinikum für alle 7. Klassen der Region<br />
angeboten. Und die Nachfrage ist<br />
groß. „Egal, ob Sex schon ein Thema ist<br />
– mit Aufklärung kann nicht früh genug<br />
begonnen werden“, bekräftigt Dr. Hub.<br />
42 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 43<br />
Sandra Kobelt
Gesundheit & Wirtschaft<br />
Two Thumbs Up for the AFH<br />
Dass es so schnell gehen würde, hätte wohl niemand erwartet. Anfang Juli 2009 sprach Dr. Tobias Kaltenbach anlässlich<br />
der Vorstellung des gemeinsamen Projektes „Green Hospital“ in München die Einladung aus, und bereits Ende<br />
Oktober kam Jeffrey R. Immelt dieser Einladung nach: Der besondere Gast ist Chairman & CEO von General Electric.<br />
Mit einer 8-köpfigen Delegation besuchte er die Klinik in Barmbek.<br />
Dr. Tobias Kaltenbach begrüsst seinen Gast Jeffrey Immelt in der Interessiert lässt Jeffrey Immelt von Dr. Kaltenbach das AFH-Programm erklären.<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Barmbek.<br />
Jeffrey Immelt kam, um das <strong>Asklepios</strong><br />
Future Hospital-Programm kennenzulernen<br />
und um zu sehen, welche Leistungen<br />
und Innovationen die größte europäische<br />
Health Care Allianz mit seinen 23 Partnerunternehmen<br />
im Referenzzentrum<br />
des AFH umgesetzt hat. Und er war<br />
beeindruckt: „Two Thumbs Up“ signalisierte<br />
der Chef von GE gegenüber Dr.<br />
Kaltenbach und dem verantwortlichen<br />
Programmchef des AFH, Uwe Pöttgen,<br />
Leiter Konzernbereich IT der <strong>Asklepios</strong><br />
Kliniken.<br />
Das AFH-Programm mit seiner sicherlich<br />
einmaligen nationalen und internationalen<br />
Partner-Community soll als konzeptionelles<br />
und strategisches Modell für das<br />
Green Hospital Projekt in Hamburg-Harburg<br />
dienen. Und so wollte sich Jeffrey<br />
Immelt persönlich überzeugen, wie eine<br />
solche Allianz unterschiedlicher Unternehmen<br />
und Interessen so gut und vor<br />
allem so lösungsorientiert arbeiten und<br />
funktionieren kann. Uwe Pöttgen brachte<br />
es in seinem Vortrag auf den Punkt: „Collaboration<br />
und Communication, das sind<br />
die Eckpfeiler des Erfolges im AFH.“<br />
Auch im gemeinsamen „Green Hospital<br />
Projekt“ mit dem Partner GE soll eine gut<br />
funktionierende Partnergemeinschaft integraler<br />
Bestandteil sein. Denn die „grüne<br />
Klinik“ in Hamburg-Harburg, die<br />
2013 fertig gestellt sein wird, basiert auf<br />
der Verbindung von Ökologie, Ökonomie<br />
und dem Wohlbefinden der Menschen in<br />
einem Krankenhaus. Sie ist als integratives<br />
Konzept, das sich die Synergien zwischen<br />
Innovation, technologischem Fortschritt<br />
und dem verantwortlichen Umgang<br />
mit natürlichen Ressourcen zunutze<br />
macht, in dieser Ausprägung sicherlich<br />
einzigartig in Europa.<br />
Während des Rundgangs im Klinikum<br />
Barmbek konnte sich die GE-Delegation<br />
von innovativen Projekten wie z. B. der<br />
Dashboardlösung in der Notaufnahme<br />
oder der „Virtual Hospital Collaboration“<br />
am Beispiel einer Tumorkonferenz<br />
einen Eindruck verschaffen.<br />
Höhepunkt des Rundgangs war das Treffen<br />
mit Dr. Carsten Pohlmann, Ltd. OA<br />
der Neurologie und Leiter der zertifizierten<br />
Stroke Unit. Dr. Pohlmann zeigte<br />
und erklärte dem Gast den praktischen<br />
Nutzen der AFH-Projekte für den klinischen<br />
Arbeitsalltag. Der GE-Chef zeigte<br />
sich vor allem von der Effizienz und dem<br />
Nutzen für die Ärzte und Schwestern<br />
beeindruckt. Das Konzept der Partner-<br />
Community des AFH werde sicherlich<br />
auch im Green Hospital Projekt umgesetzt<br />
werden, versprach er und signalisierte<br />
bei der Verabschiedung: Ich komme<br />
wieder nach Hamburg.<br />
Weiterbildung Endoskopie<br />
In Hamburg erarbeiteten Fachmediziner und Fachpflegekräfte ein neues Weiterbildungskonzept.<br />
Die Aufgaben der Fachkraft für Endoskopie<br />
sind vielseitig und stellen hohe<br />
Anforderungen an die psychische, physische<br />
und soziale Belastbarkeit. Damit<br />
die Fachkraft für Endoskopie dem breiten<br />
Aufgabenspektrum optimal gerecht<br />
werden kann, wurde nun gemeinsam<br />
von Fachmedizinern und Fachpflegekräften<br />
ein neues Konzept zur Weiterbildung<br />
erarbeitet. In dem zwei- bis vierjährigen<br />
berufsbegleitenden Lehrgang werden<br />
fachliche, methodische, soziale und persönliche<br />
Kompetenzen im Fachbereich<br />
der Endoskopie vermittelt.<br />
Die Fachkraft arbeitet eng mit Ärzten der<br />
verschiedenen Fachdisziplinen zusammen,<br />
Pflege und Betreuung der Patienten<br />
sind hingegen ihre eigenständigen<br />
Bereiche. Es gehört zu ihren Aufgaben,<br />
eine vertrauensvolle Beziehung zu den<br />
Patienten und deren Angehörigen zu<br />
schaffen – unabhängig Altersgruppe und<br />
soziokultureller Herkunft der Patienten.<br />
Ein Schwerpunkt liegt dabei in der<br />
Begleitung und kompetenten Unterstützung<br />
in Krisensituationen.<br />
Für die Betreuung und Überwachung von<br />
Patienten mit gefährdeten oder gestörten<br />
Vitalfunktionen übernimmt die Fachkraft<br />
für Endoskopie die Verantwortung – sie<br />
muss also lebensbedrohliche Situationen<br />
erkennen, sofort entsprechende Maßnahmen<br />
einleiten und auch durchführen. Sie<br />
bereitet endoskopische und chirurgische<br />
Eingriffe vor und assistiert dabei, überwacht<br />
die Patienten vor und nach endoskopischen<br />
Untersuchungen und dokumentiert<br />
alle Tätigkeiten im Bereich der Pflege.<br />
Darüber hinaus ist die Fachkraft für den<br />
Unterhalt, die Bereitstellung und Handhabung<br />
diverser Geräte und Materialien<br />
verantwortlich. Sie führt Hygienekon-<br />
trollen zur Qualitätssicherung durch, erarbeitet<br />
entsprechende fachlich korrekte<br />
Arbeits- und Aufbereitungsanweisungen,<br />
plant und organisiert die Arbeitsabläufe,<br />
hält diese ein und überwacht die<br />
Unfallverhütungs- sowie andere technische<br />
Vorschriften.<br />
Die Weiterbildung zu Fachschwestern,<br />
-pflegern, Fachkinderkrankenschwestern<br />
und -pflegern in der Endoskopie gliedert<br />
sich in einen theoretischen und einen<br />
praktischen Teil. Der theoretische Unterricht<br />
umfasst mindestens 720 Stunden<br />
und findet in modularer Form statt. Die<br />
Auszüge aus dem Modulplan des<br />
theoretischen Unterrichts<br />
Basismodule<br />
Pflege als Wissenschaft<br />
Angewandte Pflegetheorien<br />
Schmerzlinderung und -therapie<br />
Hygiene in Funktionseinheiten<br />
Kommunikation<br />
Cardio- und Pulmonale Reanimation<br />
Aufbaumodule<br />
EKG-Grundlagen<br />
Grundlagen der Beatmung<br />
Sedierung und Analgosedierung in der<br />
Endoskopie (Gabe von Beruhigungsbzw.<br />
Schmerzmitteln)<br />
Ethische Grenzsituationen<br />
Lagerung in der Funktionsabteilung<br />
Fachmodule<br />
Gastroenterologie<br />
Pneumonologie<br />
Grundlagen der endoskopischen Chirurgie<br />
Grundlagen der endoskopischen<br />
Thoraxchirurgie<br />
Umgang mit technischen Geräten in der<br />
Endoskopie<br />
Aufbereitung von Endoskopen u. Zubehör<br />
Weiterbildung schließt mit einer praktischen,<br />
einer schriftlichen und einer<br />
mündlichen Prüfung ab. Die Lehrgangskosten<br />
betragen 6.790 Euro plus Prüfungsgebühr.<br />
Die praktische Weiterbildung umfasst<br />
mindestens 1.580 Stunden unter fachkundiger<br />
Anleitung in Fachgebieten: Gastroenterologie<br />
(700 Stunden), Pneumonologie<br />
(500 Stunden), Urologie oder Gynäkologie<br />
(200 Stunden), Anästhesie (80 Stunden)<br />
und Sterilgutabteilung (40 Stunden).<br />
Dazu kommen noch 40 Stunden an einem<br />
Einsatzort nach Wunsch.<br />
Zur Bewerbung sind folgende Unterlagen<br />
einzureichen<br />
Urkunde zur Krankenschwester/zum<br />
Krankenpfleger oder Gesundheits- und<br />
Krankenschwester/ Krankenpfleger<br />
Tabellarischer Lebenslauf<br />
Zwischenzeugnis des Arbeitgebers über<br />
eine mindestens sechsmonatige Tätigkeit<br />
in der Endoskopie<br />
Die staatliche Anerkennung wird angestrebt.<br />
Die Weiterbildung beginnt am<br />
01. 04. 2010, der Einstieg ist aber jederzeit<br />
möglich.<br />
44 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 45<br />
Kontakt<br />
Silke Johns<br />
Bildungszentrum für Gesundheitsberufe<br />
<strong>Asklepios</strong> Kliniken Hamburg GmbH<br />
Bereich Weiterbildung<br />
Eiffestraße 585, 20537 Hamburg<br />
Tel.: (040) 1818 84 26 20<br />
E-Mail: s.johns@asklepios.com
Gesundheit & Wirtschaft<br />
Service-Schulung für<br />
Privatkliniken in Bad Griesbach<br />
Im November trafen sich erstmalig leitende Pflege- und Servicekräfte aus ganz Deutschland zu einer Service-Schulung<br />
in Klinik und Hotel St. Wolfgang in Bad Griesbach.<br />
Für eine hohe Patientenzufriedenheit bedarf<br />
es neben herausragender medizinischer<br />
und pflegerischer Leistungen auch<br />
einer erstklassigen Unterkunft und eines<br />
exzellenten Service. Um den Patienten<br />
ein Service- und Komfortniveau der gehobenen<br />
Hotelkategorie zu bieten, wurde<br />
daher im Rahmen des Privatklinikkonzeptes<br />
durch den Konzernbereich DRG-,<br />
Medizin- und Qualitätsmanagement sowie<br />
Klinik und Hotel St. Wolfgang ein<br />
umfassendes Schulungskonzept erarbeitet.<br />
Anfang November konnten die Teilnehmer<br />
einer ersten Schulung Umgangs-<br />
formen, Abläufe und Verhaltensweisen<br />
erlernen, die für den Betrieb einer Privatklinik<br />
beziehungsweise einer interdisziplinären<br />
Komfortstation mit Hotelcharakter<br />
notwendig sind.<br />
Die viertägige Schulung wurde unter der<br />
Leitung von Christian Schauberger in<br />
Bad Griesbach durchgeführt. Insgesamt<br />
sechs Teilnehmer aus unterschiedlichen<br />
<strong>Asklepios</strong> Einrichtungen hospitierten dabei<br />
in verschiedenen Bereichen des Hotels<br />
und der Klinik und wurden in einer<br />
theoretischen und praktischen Schulung<br />
für das Thema Kundenorientierung sen-<br />
Kontakt<br />
Johannes Brack<br />
KB DRG-, Medizin- u. Qualitätsmanagement<br />
Tel.: (06404) 658 111<br />
E-Mail: j.brack@asklepios.com<br />
Christian Schauberger<br />
Verkaufsleiter<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik und Hotel St. Wolfgang<br />
Tel.: (08532) 980 609<br />
E-Mail: c.schauberger@asklepios.com<br />
sibilisiert. Aufgrund der sehr positiven<br />
Resonanz sollen in diesem Jahr weitere<br />
Service-Schulungen angeboten werden.<br />
Dabei ist geplant, das bestehende Programm<br />
auch um externe Referenten zu<br />
erweitern, die sich unter anderem dem<br />
Thema „Umgang mit Reklamationen“<br />
widmen werden.<br />
Pflege ist Kopf-, Herz- und Handarbeit!<br />
Neues aus der Gesundheits- und Krankenpflegeschule an den Kliniken Schildautal<br />
„Die Ausbildung in der Gesundheits- und<br />
Krankenpflege ist darauf gerichtet, dass<br />
die Pflegenden befähigt werden, Menschen<br />
aller Altersgruppen in den verschiedenen<br />
Versorgungssystemen in ihrer Gesundheit<br />
zu fördern sowie bei der Bewältigung<br />
von krankheits- und altersbedingten<br />
Belastungen zu unterstützen.“ Unter dieser<br />
Maxime fand an der Gesundheits- und<br />
Krankenpflegeschule in Seesen in der Lerneinheit<br />
„Pflege von Menschen in besonderen<br />
Lebenssituationen und Problemlagen<br />
– Menschen mit Erkrankungen des<br />
Atemsystems pflegen“ ein Unterrichtseinstieg<br />
der besonderen Art statt.<br />
Die Schülerinnen und Schüler des Examenskurses<br />
2010, bekannt für ihr Engagement<br />
und ihre Kreativität, nutzten die<br />
Möglichkeit, sich handwerklich und praktisch<br />
Zugang zu einem zentralen Thema<br />
der Pflege zu verschaffen. In einigen Unterrichtsstunden,<br />
darüber hinaus auch in<br />
der Freizeit, fertigten die Auszubildenden<br />
in Kleingruppen zum Thema „Organe<br />
des Respirationstraktes“ verschiedene<br />
Modelle (Nase/Rachen, Trachea, Lungen,<br />
Alveolen) an. Nicht nur Material aus dem<br />
Baumarkt, auch viel Herzblut und Freude<br />
steckten die Schüler/-innen in die Anfertigung<br />
dieser Modelle.<br />
Die Ergebnisse waren beeindruckend<br />
und anschaulich zugleich. Neben dem<br />
handwerklichen Geschick wurde auch<br />
theoretisches Wissen abverlangt. So hatte<br />
jede Gruppe den Auftrag, zu dem von ihr<br />
angefertigten Modell ein Handout für die<br />
Mitschüler zu präsentieren, aus dem Aufbau<br />
und Funktion des Organs ersichtlich<br />
wurden.<br />
In den nun folgenden Unterrichtsstunden<br />
wird auf der Grundlage dieser intensiven<br />
Vorarbeit die Auseinandersetzung mit<br />
pflegerischen Aufgaben bei Atemwegserkrankungen,<br />
beispielsweise die Beratung<br />
der Patienten und ihrer Angehörigen,<br />
fortgeführt und um zahlreiche Aspekte<br />
erweitert.<br />
46 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 47<br />
Elke Döge<br />
Kontakt<br />
Gesundheits- und Krankenpflegeschule<br />
<strong>Asklepios</strong> Kliniken Schildautal<br />
Lautenthalerstr. 101, 38723 Seesen<br />
Tel.: (053 81) 78 23 47
Gesundheit & Wirtschaft<br />
°Personalia<br />
° Führungswechsel in der Chirurgie der<br />
° Chefarzt der Kinderkardiologie zum<br />
° Neuer Chefarzt an der Klinik Sankt Augustin<br />
Klinik Lindau<br />
Dr. Bertram Wagner leitet seit Januar den<br />
Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie,<br />
wo er neben der Fortführung einer<br />
modernen Viszeralchirurgie auch eine thoraxchirurgische<br />
Grundversorgung aufbauen<br />
will.<br />
Seit Februar ist PD Dr. Elmar Lindhorst<br />
Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie.<br />
Seine Aufgaben sind die Weiterentwicklung<br />
der Endoprothetik/Gelenkchirurgie und<br />
der Aufbau einer Alterstraumatologie. Als<br />
neue Behandlungsindikation soll die Wirbelsäulenchirurgie<br />
etabliert werden.<br />
Professor ernannt<br />
Professor Dr. Martin Schneider lehrt seit Dezember<br />
an der medizinischen Fakultät der<br />
Universität Essen. Neben diversen Lehrtätigkeiten<br />
ist Dr. Schneider ein weltweit gefragter<br />
Referent und Gutachter zu Themen<br />
der interventionellen Kinderkardiologie. Als<br />
Chef der Kinderkardiologie steht er wie bisher<br />
der Klinik Sankt Augustin zur Verfügung.<br />
Dr. Michael Ehlen, seit zehn Jahren an der<br />
Abteilung für Neonatologie und Pädiatrische<br />
Intensivmedizin tätig, wurde dort im<br />
Februar 2010 zum Chefarzt ernannt. In der<br />
Abteilung werden jährlich über 500 Frühgeborene<br />
und erkrankte Neugeborene sowie<br />
250 Kinder aller Altersgruppen überwacht<br />
und behandelt.<br />
° Neue Chefärzte in Höxter<br />
° Neuer Chefarzt im Klinikum Uckermark<br />
Dr. Klaus Dechant ist seit November als<br />
Chefarzt der Abteilung für Neurologie in der<br />
Weserbergland Klinik Höxter tätig. Bereits<br />
von 2000 bis 2002 arbeitete er hier als<br />
Oberarzt für Neurologie.<br />
Chefarzt der im Januar neu eröffneten Abteilung<br />
für Geriatrie wurde Prof. Dr. Ulrich<br />
Gärtner. Er war bislang bei der Paracelsus<br />
Klinik am See in Bad Gandersheim beschäftigt.<br />
Seit Jahresbeginn leitet Dr. Thomas Benter<br />
an der Klinik für Innere Medizin II die Bereiche<br />
Gastroenterologie, Nephrologie und<br />
Hämato-Onkologie.<br />
Schwerpunkte der Tätigkeit von Dr. Benter,<br />
der in Schwedt ein Onkologisches Zentrum<br />
etablieren möchte, sind die diagnostische<br />
Abklärung und die Therapiemöglichkeiten auf dem Gebiet der<br />
Endoskopie und Sonographie.<br />
° Außerplanmäßige Professur für Innere<br />
Medizin<br />
PD Dr. Jan R. Ortlepp, Chefarzt<br />
der Klinik für Innere<br />
Medizin und Intensivmedizin<br />
in den Kliniken Schildautal,<br />
wurde im November der Titel<br />
außerplanmäßiger Professor<br />
an der Medizinischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen<br />
Technischen Hochschule Aachen verliehen. Seine Tätigkeit als<br />
Chefarzt führt Professor Ortlepp fort.<br />
48 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 49<br />
° Neue Regionalgeschäftsführer<br />
Axel Werntges Volkmar Bölke Stefan Härtel<br />
Die Konzerngeschäftsführung hat im Januar in Abstimmung<br />
mit dem Gesellschafter folgende im Konzern tätige und verdiente<br />
Geschäftsführer zu Regionalgeschäftsführern bestellt:<br />
Axel Werntges für die Kliniken in Lich, St. Augustin, Bad Salzhausen,<br />
Falkenstein und Bad Sobernheim,<br />
Volkmar Bölke für die Einrichtungen in Wiesbaden, Langen,<br />
Langen-Psychiatrie und Seligenstadt,<br />
Stefan Härtel für die sächsischen Kliniken in Hohwald, Sebnitz,<br />
Oschatz und Radeberg.<br />
° Neue Klinikmanager<br />
Im Januar nahm Sybille Merk ihre Tätigkeit als Klinikmanagerin<br />
in der Klinik für Psychische Gesundheit Langen auf. Sie war<br />
zuvor als Referentin des Vorstandsvorsitzenden und Leitenden<br />
Ärztlichen Direktors des Universitätsklinikums Heidelberg tätig.<br />
André Meiser ist seit Februar im Klinikmanagement der Klinik<br />
Altona tätig. Er war bisher Verwaltungsleiter des St.-Josef-<br />
Krankenhauses in Wipperfürth.<br />
° Personaländerungen im Konzern-<br />
bereich Finanzen<br />
Hafid Rifi, Konzernbereichsleiter Konzernrechnungswesen und<br />
Steuern, verantwortet Projekte mit hoher konzernpolitischer<br />
Tragweite. Er ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und hat<br />
große Erfahrung auch in der Prüfung und Beratung von börsennotierten<br />
Krankenhauskonzernen.<br />
Die beiden Leiter Konzernrechnungswesen AKV, Janine Krohe,<br />
und AKHH, Jens Egert, berichten wie bisher direkt an Herrn<br />
Rifi. Sie bleiben neben ihm Ansprechpartner in Bezug auf Jahresabschlüsse<br />
und Quartalsberichte.<br />
Dr. Kai Gregor Klinger, Konzernbereichsleiter Finanzierung und<br />
Investor Relations, verantwortet die Projekte Zinssicherung,<br />
Finanzierungen und Rating für den Gesamtkonzern AKG am<br />
Kapitalmarkt.<br />
Freddy Bergmann, Konzernbereichsleiter Controlling und Risikomanagement,<br />
verantwortet weiterhin schwerpunktmäßig das<br />
Konzerncontrolling und wird für <strong>Asklepios</strong> das geplante SAP-<br />
Projekt aufsetzen und leiten.<br />
Dr. Cornelia Süfke, Konzernbereichsleiterin Versicherungen, verantwortet<br />
das konzernweite Versicherungswesen. Sie ist zurzeit<br />
mit der Ausschreibung und Überprüfung aller Versicherungsverträge<br />
der <strong>Asklepios</strong> Gruppe betraut.<br />
° Sankt<br />
° Change Management für Führungskräfte<br />
Augustin: Pflegedienstleitung geht<br />
in den Ruhestand<br />
Im November wurde Maria Günther offiziell<br />
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.<br />
Sie war 18 Jahre für den gesamten<br />
Pflege- und Funktionsdienst verantwortlich<br />
und unter anderem maßgeblich an der<br />
Einführung der OTA-Ausbildung (Operationstechnischer<br />
Assistent) beteiligt.<br />
der Pflege<br />
Die Pflegedirektion der Klinik Altona unter der Leitung von Sabine<br />
Rex führte im November ein zweitägiges Führungskräfte-<br />
Seminar für alle pflegerischen Stations- und Funktionsleitungen<br />
durch. Schwerpunkt war das Thema: „Führen in turbulenten<br />
Zeiten – Veränderungsprozesse erfolgreich (mit-)gestalten“.
Patientenforum<br />
Doktor Leo Löwenherz gibt<br />
Kraft und Hoffnung<br />
Im Dezember bekamen die kleinen Patienten im Deutschen Kinderherzzentrum (DKHZ) an der Klinik Sankt Augustin<br />
aufmunternden Besuch: Leo Löwenherz mit seinen beiden Freunden Marie und Hannes waren zu Gast.<br />
Schwer kranke Kinder sind ganz besondere<br />
Patienten: Viele medizinische Notwendigkeiten<br />
sind für sie völlig unverständlich.<br />
So leiden sie nicht nur an ihrer<br />
Krankheit, sondern auch an den psychischen<br />
Belastungen. Doch ein kleines Staunen<br />
oder ein gemeinsames Lachen können<br />
Wunder wirken – und von Ängsten<br />
ablenken. Das Puppentheater „Doktor<br />
Leo Löwenherz“ ist ein psychotherapeutisches<br />
Projekt, das Vertrauen schaffen,<br />
Ängste mindern und die Selbstheilungskräfte<br />
der Kinder mobilisieren soll.<br />
Spielerisch und unterhaltsam hilft das<br />
Theaterstück, die Furcht der kleinen Patienten<br />
vor Untersuchungen und Eingriffen<br />
zu mindern. Es trägt auf diese Weise direkt<br />
dazu bei, den Alltagsstress des Klinikaufenthaltes<br />
zu reduzieren. Dargestellt<br />
und vorgespielt werden die Abenteuer<br />
des Leo Löwenherz hoch professionell<br />
Weitere Infos zum Puppentheater<br />
www.doktorleoloewenherz.de<br />
von Diplompuppenspielern. „Die Kinder<br />
kleben direkt an Leo dran und vergessen,<br />
was sie haben“, beschreibt Puppenspieler<br />
Marius Kob seine Erfahrungen.<br />
Zu Beginn des Stückes wickelt Johanna<br />
Pätzold alias Ärztin Marie langsam ein<br />
Bündel aus. Etwas Gelbes blitzt hervor,<br />
Marie wickelt weiter, und dann liegt Leo<br />
Löwenherz auf dem Bett. Reglos. „Ist er<br />
tot?“, fragt ein Junge im Publikum erschrocken.<br />
Aber nein! Rasch wird klar,<br />
dass Leo geheilt, gesund und munter ist.<br />
Er will sogar selbst Arzt werden und legt<br />
gleich los – unterstützt von seinen neuen<br />
Freunden, den Ärzten Hannes (Marius<br />
Kob) und Marie (Johanna Pätzold). Eine<br />
Stunde dauert die Aufführung, und alle<br />
Kinder fiebern mit, wenn es drüber und<br />
drunter geht, weil Leo versucht, Hannes'<br />
schlechte Laune mit einem riesigen<br />
Schlauch aus dessen Körper zu saugen.<br />
Rollstuhl, Spritzen und Tropf werden dabei<br />
vergessen oder einfach ganz unwichtig.<br />
„Ich bin Leo Löwenherz, kenne selber<br />
keinen Schmerz“, singen die Puppenspieler<br />
zum Schluss mit den Kindern. Damit<br />
der letzte Applaus nicht das Ende ist,<br />
bekommen die kleinen Zuschauer Leo-<br />
Löwenherz-Malbücher geschenkt und<br />
können Fragen stellen. Sie wollen alles,<br />
alles, alles über Löwenherz wissen, und<br />
die beiden „Ärzte“ können sich vor dem<br />
Ansturm kaum retten.<br />
Seit September ist Doktor Leo Löwenherz<br />
auf Tournee in verschiedenen Kliniken.<br />
Die Dezember-Vorstellung in Sankt Augustin<br />
war zugleich ein Dankeschön des<br />
Deutschen Kinderzentrums Münster an<br />
Prof. Boulos Asfour, Direktor des DKHZ,<br />
und an seinen Kollegen, den Oberarzt<br />
und Kardiologen Dr. Peter Zartner: Die<br />
beiden Ärzte wurden so für ihr ehrenamtliches<br />
Engagement im medizinischen<br />
Beirat „Herz“ des Deutschen Kinderzentrums<br />
Münster geehrt.<br />
Ein Dementengarten im<br />
Pflegezentrum Ahrensburg<br />
Mit umfangreichen Gartenarbeiten wurde ein Teil des Außenbereiches im Pflegezentrum Ahrensburg zu einem Dementengarten<br />
umgestaltet. Im vergangenen Herbst waren die Bewohnerinnen und Bewohner in Begleitung der therapeutischen<br />
Mitarbeiterinnen erstmals in diesem Garten tätig, um Blumenzwiebeln zu setzen und kleine Sträucher<br />
zu pflanzen.<br />
Jeder Mensch trägt in sich die Erinnerung<br />
an (s)einen Garten. Der Aufenthalt an der<br />
frischen Luft, die Freude am Beobachten<br />
und Einfühlen in lebende Zusammenhänge<br />
bewirken einen inneren Frieden,<br />
den jeder schon erlebt hat, der im Garten<br />
gearbeitet oder sich dort der Muße hingegeben<br />
hat.<br />
Ein Garten ist ein Ort des natürlichen<br />
Lichts. Durch das Sonnenlicht wird im<br />
menschlichen Körper das lebenswichtige<br />
Vitamin D gebildet. Ein Garten ist aber<br />
auch ein Ort, an dem körperliche Aktivitäten<br />
– Unkrautzupfen, Wäscheaufhängen<br />
oder Umtopfen – durchgeführt<br />
werden. Menschen, die sich viel bewegen<br />
möchten, finden im Garten Raum dazu.<br />
Ein Garten kann aber auch Ruhe und<br />
Besinnlichkeit ausstrahlen. Insbesondere<br />
für Menschen mit Demenz muss der<br />
Garten ein sicherer und geschützter Ort<br />
sein und zugleich ein Ort, an dem sie sich<br />
nicht eingeschlossen fühlen. Bei der Gestaltung<br />
eines Dementengartens müssen<br />
auch die sensorischen Schwierigkeiten<br />
sowie Mobilitätsprobleme der Gartennutzer<br />
in Betracht gezogen werden.<br />
Die verschiedenen Farben und Gerüche<br />
der einzelnen Pflanzen bewirken unterschiedliche<br />
Reize. Für den Kräutergarten<br />
wurde ein Hochbeet angelegt. Selbstverständlich<br />
sollen sich die Heimbewohner<br />
aktiv im Garten betätigen, wenn sie Lust<br />
dazu haben – ein Teil des Dementengartens<br />
ist dafür vorgesehen.<br />
Frau Przybilla, Ergotherapeutin im Pflegezentrum,<br />
erklärt dazu: „Viele Demenzkranke<br />
sind recht mobil und halten sich<br />
vorwiegend außerhalb ihrer Zimmer auf.<br />
Sie sind in der Lage, selbständig in einen<br />
Garten oder auf eine Terrasse zu gehen,<br />
wenn diese Bereiche demenzfreundlich<br />
gestaltet und leicht erreichbar sind. Unser<br />
Garten bietet die Chance, im Rahmen unseres<br />
milieutherapeutischen Ansatzes die<br />
Lebensqualität zu erhöhen, also das Befinden<br />
und Verhalten sowie die Begleiterscheinungen<br />
der Demenz wie Angst, Unsicherheit,<br />
Apathie, Aggressivität positiv<br />
zu beeinflussen.“<br />
50 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 51<br />
Kontakt<br />
Dietmar Wollenschläger<br />
<strong>Asklepios</strong> Pflegezentrum Ahrensburg<br />
Heimleitung<br />
Reeshoop 38, 22926 Ahrensburg<br />
Tel.: (04102) 66 65 7 333<br />
Fax: (04102) 66 65 7 19<br />
E-Mail: d.wollenschlaeger@asklepios.com
Patientenforum<br />
Ist gesunder Spitzensport möglich?<br />
Deutscher Spitzensport ist ein weltweites Markenzeichen. Eine der Voraussetzungen dafür war und ist die optimale<br />
Betreuung der Top-Athleten. Der Olympiastützpunkt Berlin bietet allen Bundeskaderathleten in der Hauptstadt ein<br />
ganzheitliches sportmedizinisches, physiotherapeutisches, trainingswissenschaftliches, sportpsychologisches und soziales<br />
Betreuungsangebot. Kooperationspartner ist seit Jahren die Klinik Birkenwerder. <strong>Asklepios</strong> intern sprach mit PD Dr.<br />
Karsten Labs, Chefarzt der Abteilung Orthopädie und selbst aktiver Sportler, über den Trend zum gesunden Spitzensport.<br />
Ein leistungsstarkes Team: Kugelstoßer Ralf Bartels, PD Dr. Karsten Labs, Diskuswerfer Robert Harting (v.l.n.r.)<br />
Unter welchen Voraussetzungen kann ein<br />
Krankenhaus Kooperationspartner eines<br />
Olympiastützpunktes werden?<br />
Man muss den Sport lieben, um sich<br />
so stark zu engagieren. Als ehemaliger<br />
Zehnkämpfer habe ich noch während<br />
meines Medizinstudiums die notwendige<br />
sportmedizinische Qualifikation erworben,<br />
um dem Leistungssport verbunden<br />
zu bleiben. Die Klinik Birkenwerder<br />
bietet hervorragende logistische Voraussetzungen<br />
für die medizinische Betreuung<br />
von Top-Athleten. Wir sind über einen<br />
24-Stunden-Service jederzeit für die<br />
Sportler erreichbar. Dank kurzer Wege<br />
und moderner Behandlungsmöglichkei-<br />
ten konnten wir sehr schnell gegenseitiges<br />
Vertrauen aufbauen. Außerdem stehe<br />
ich den Sportlern in meiner wöchentlichen<br />
Sprechstunde am Olympiastützpunkt<br />
Berlin gerne bei allen Fragen und<br />
Problemen zur Verfügung.<br />
Welche Sportlerinnen und Sportler betreuen<br />
Sie in Birkenwerder?<br />
Grundsätzlich können wir alle Kadersportler<br />
der Junioren- und Seniorennationalmannschaften<br />
des Olympiastützpunktes<br />
Berlin medizinisch versorgen. Im<br />
WM-Jahr 2009 haben wir überwiegend<br />
Leichtathleten der Wurf- und Stoßdisziplinen<br />
aus der deutschen Leichtathletik-<br />
Nationalmannschaft betreut, unter anderem<br />
den späteren Weltmeister im Diskuswurf,<br />
Robert Harting, und Ralf Bartels,<br />
den WM-Bronzemedaillengewinner im<br />
Kugelstoßen. Daneben betreuen wir auch<br />
Volleyballer, Beachvolleyballer, Turnerinnen<br />
und Turner, Rugbyspieler, Boxer,<br />
Gewichtheber, Wasserspringer, Athleten<br />
sämtlicher Eissportarten sowie Sportlerinnen<br />
und Sportler, die an den Paralympics<br />
teilnehmen.<br />
Spitzenathleten verlangen ihrem Körper<br />
einiges ab. Welche Verletzungsarten sind<br />
am häufigsten?<br />
Grundsätzlich muss zwischen Überlas-<br />
tungsschäden und tatsächlichen Verletzungen<br />
unterschieden werden. Während<br />
Volleyballer meist von Verletzungen<br />
der Oberschenkel, der Kniegelenke und<br />
Schultern betroffen sind, haben Leichtathleten<br />
eher Kniegelenksprobleme und<br />
Muskelfaserrisse. Turner und Wasserspringer<br />
neigen zu Wirbelsäulenverletzungen,<br />
Rugbyspieler können sich Schultern<br />
und Kniegelenke ramponieren.<br />
Auch die mentalen Belastungen im Hochleistungssport<br />
sind enorm. Welche Tipps<br />
geben Sie Ihren Sportlern, um damit couragiert<br />
umzugehen?<br />
Am Olympiastützpunkt stehen Sportpsychologen<br />
zur Verfügung. Um im<br />
Hochleistungssport Spitzenergebnisse zu<br />
erzielen, durchlaufen die Sportler einen<br />
außerordentlichen Reifungsprozess. Sie<br />
begreifen, dass viele Abläufe in ihrem<br />
Kopf leistungslimitierenden Einfluss haben<br />
können. Ich beobachte immer wieder<br />
Athleten, die im Training hervorragende<br />
Leistungen erbringen und dann im Wettkampf<br />
den mentalen Belastungen und<br />
dem öffentlichen Druck nicht mehr gewachsen<br />
sind. Der Sportler muss sich im<br />
Selbsttraining Entspannungstechniken<br />
beibringen, um der Wettkampfsituation<br />
gelassener und unverkrampfter entgegenzutreten.<br />
Manchmal können auch kleine<br />
Rituale bei Wettkämpfen eine starke seelische<br />
Unterstützung sein: immer dasselbe<br />
Handtuch, ein Glücksstein, der letzte Blick<br />
zum Trainer oder eine besondere Trinkflasche.<br />
Ein ganz entscheidender Punkt<br />
ist jedoch ein gesundes soziales Umfeld,<br />
geprägt von Familie, Freunden, Trainern<br />
und nicht zuletzt auch von fairen Beratern.<br />
Wie sieht Ihrer Meinung nach gesunder<br />
Spitzensport aus?<br />
Der Leistungsdruck ist unglaublich hoch.<br />
Der menschliche Körper ist auf eine so<br />
dauerhaft starke körperliche Belastung<br />
nicht ausgerichtet. Darum müssen Sportler<br />
und Trainer auf eine ausgewogene<br />
Bilanz zwischen Hochleistungssport und<br />
Regeneration achten. Viele Sportler erlernen<br />
durch zu frühes spezielles Training<br />
falsche Bewegungsmuster. Manchmal<br />
treten Probleme auch erst Jahre nach der<br />
aktiven Zeit auf. Ich rate daher zu einer<br />
gleichmäßigen Belastung aller Muskel-<br />
gruppen und einer langfristigen muskulären<br />
Stabilisierung. Im Vordergrund sollte<br />
eine allgemeine und ganzheitliche athletische<br />
Ausbildung stehen, um Fehlbelastungen<br />
von Anfang an zu vermeiden.<br />
Die Sportler sollten sich in regelmäßigen<br />
Intervallen und schon so früh wie möglich<br />
bei uns Sportmedizinern vorstellen,<br />
damit wir rechtzeitig etwaigen Problemen<br />
entgegenwirken können. Optimale<br />
Techniken, gezielte Trainingsmethoden,<br />
ausreichende Erholungsphasen, Vermeidung<br />
von Überlastungsschäden sowie<br />
der Verzicht auf Doping und andere stimulierende<br />
Substanzen sind die beste<br />
Prophylaxe.<br />
Doping ist also keine Lösung?<br />
Nein, ganz sicher nicht, denn noch immer<br />
sind viele Früh- und Spätfolgen von Doping<br />
nicht bekannt. Leider wird es immer<br />
auch schlechte Berater sowie pharmakologische<br />
und medizinische Bereiche geben,<br />
die beim Leistungssport intervenieren.<br />
Es gibt Sportler, Trainer und Sponsoren,<br />
denen schneller Ruhm und Erfolg<br />
wichtiger sind als die Gesundheit.<br />
Ich distanziere mich ganz entschieden<br />
von leistungsfördernden Substanzen, bin<br />
mir jedoch sicher, dass es auch in Zukunft<br />
keinen dopingfreien Sport geben wird.<br />
Ungleiche Kontrollmethoden ermöglichen<br />
immer neue Möglichkeiten der<br />
Manipulation, die Nachweisgrenzen und<br />
Analysemöglichkeiten laufen den Entwicklungen<br />
der Pharmakologie um Jahre<br />
hinterher. Manche Substanzen, die heute<br />
schon im Doping verwendet werden,<br />
sind erst in sieben oder acht Jahren nachweisbar.<br />
Dann müssten einigen Sportlern<br />
rückwirkend ihre Medaillen aberkannt<br />
werden. Wie soll das gehen?<br />
Das Gespräch führte Mandy Wolf<br />
52 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 53<br />
Kontakt<br />
PD Dr. Karsten Labs<br />
Chefarzt der Abteilung Orthopädie<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Birkenwerder<br />
Hubertusstr. 12-22<br />
16547 Birkenwerder<br />
Tel.: (03303) 522 131<br />
Fax: (03303) 522 183<br />
E-Mail: k.labs@asklepios.com<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
<strong>Asklepios</strong> Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH<br />
Hubertusstraße 12-22, 16547 Birkenwerder,<br />
www.asklepios.com<br />
Chefredaktion:<br />
Mandy Wolf (V. i. S. d. P.)<br />
Redaktionelle Mitarbeit:<br />
Jens Bonnet, Mathias Eberenz, Birgit Gugath<br />
Satz und Gestaltung:<br />
Raketik Content GmbH,<br />
Daniela Birk, daniela.birk@raketik.com<br />
Redaktion:<br />
Nora Döring, Hohen Neuendorf<br />
E-Mail: info@doering-bildart.de<br />
www.doering-bildart.de<br />
Redaktionsanschrift:<br />
Konzernbereich Unternehmenskommunikation<br />
& Marketing<br />
Hubertusstraße 12-22, 16547 Birkenwerder<br />
Tel. (0 33 03) 52 24 04<br />
Fax (0 33 03) 52 24 20<br />
mandy.wolf@asklepios.com<br />
Fotos:<br />
Andrea Weitze Titelbild, S.4, S.6, 16, 28, 59, 66<br />
Peter Hamel, S.8, S.9, S.19, S.25, S.26, S. 46,<br />
S.54, S.62<br />
Hans-Christian Wagner S. 10, S.11, S. 56-57<br />
Bertram Solcher S. 20, 21, 44<br />
Yvonne Klemp S.36<br />
Sandra Kobelt S.43, 63<br />
Holger Peters 5, 34<br />
Mathias Eberenz S. 55, 59<br />
Baby Smile S. 58<br />
mediaConcepta S.65<br />
Schlussredaktion:<br />
Katja Eckert<br />
Druck:<br />
Möller Druck, Berlin<br />
Erscheinungsweise:<br />
4 x jährlich bundesweit<br />
Auflage:<br />
24.000 Exemplare<br />
Anzeigen:<br />
Sabine Malsch DTP Grafik & Layoutgestaltung,<br />
Zellerodaer Weg 18, 36433 Bad Salzungen<br />
Tel. (0 36 95) 62 86 20,<br />
sabine.malsch@t-online.de<br />
Nächster Anzeigenschluss: 14.05.2010<br />
Nächster Redaktionsschluss: 16.04.2010<br />
Die nächste Ausgabe des Magazins erscheint am<br />
30.06.2010.<br />
Copyright:<br />
Alle Rechte sind dem Herausgeber vorbehalten.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit dem Einverständnis<br />
der Redaktion. Namentlich gekennzeichnete<br />
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des<br />
Herausgebers oder der Redaktion wieder.
Patientenforum<br />
„Danke für mein neues Leben!“<br />
Diagnostik und Therapie der Skoliose<br />
Das junge Mädchen ruft diese Worte am Entlassungstag glücklich über den Klinikflur. Es verdankt sein „neues<br />
Leben“ dem Team des Wirbelsäulen-Zentrums/Abteilung Wirbelsäulen- und Skoliosechirurgie der Klinik St. Georg<br />
in Hamburg. Vor der Behandlung litt die junge Patientin nicht nur an den großen körperlichen, sondern auch an<br />
schweren seelischen Belastungen. Dankesworte dieser Art hören PD Dr. Thomas Niemeyer, Leiter des Zentrums,<br />
und seine Mitarbeiter häufig. „Manche schicken Postkarten, E-Mails oder stellen sogar Tagebuchauszüge über ihren<br />
Klinikaufenthalt ins Internet“, sagt er – und ist sichtlich stolz. Im Gespräch erläutert der Wirbelsäulenspezialist das<br />
Krankheitsbild sowie die modernen Verfahren zu Diagnostik und Therapie.<br />
Herr Dr. Niemeyer, die Skoliose ist als Krankheitsbild schon seit<br />
der Antike bekannt, ihre Therapie gilt als Ursprung der Orthopädie.<br />
Was versteht man eigentlich unter einer Skoliose?<br />
Skoliose kommt aus dem Griechischen und bedeutet „krumm“.<br />
Wir verstehen darunter eine dauerhafte seitliche Verbiegung<br />
der Wirbelsäule mit gleichzeitiger Verdrehung der einzelnen<br />
Wirbelkörper. Gut zu erkennen am seitlichen Rumpfüberhang,<br />
am Schulterschiefstand und an der asymmetrischen Taille. Anders<br />
ausgedrückt: Die Hüften sind nicht gleich hoch, sie stehen<br />
heraus. Genau wie das Schulterblatt. Und die Kopfhaltung kann<br />
leicht schräg sein.<br />
Wie sieht die Diagnostik aus?<br />
Es gibt neben diesen Anzeichen einen Test bei der körperlichen<br />
Untersuchung durch den Facharzt. Der Patient beugt sich mit<br />
durchgestreckten Knien und locker hängenden Armen nach<br />
vorne. Wenn sich im Bereich des Rückens ausgeprägte Niveauunterschiede<br />
wie ein Rippenbuckel oder Lendenwulst zeigen,<br />
handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um eine Skoliose. Leider<br />
muss bei einem derartigen Befund noch geröntgt werden,<br />
um das genaue Ausmaß der Skoliose festzulegen. Aber immer<br />
häufiger kommen auch strahlungsfreie Kernspintomografie,<br />
fotometrische Oberflächenvermessung mit Computerunterstützung<br />
oder digitales strahlungsarmes Röntgen zum Einsatz.<br />
Wie verbreitet ist die Skoliose?<br />
Die idiopathische Skoliose wird bei Kindern und Jugendlichen<br />
oft in der Wachstumsphase auffällig. Mädchen sind etwa vierbis<br />
fünfmal häufiger betroffen als Jungen. Warum, ist leider<br />
nach wie vor unbekannt. In Deutschland gibt es schätzungswei-<br />
se 400.000 Skoliose-Patienten. Die Krankheit kann fortschreiten,<br />
sich verschlechtern und sich unbehandelt durch die schleichende<br />
Zunahme zu einem lebenslangen Problem entwickeln. Deshalb<br />
zählt Skoliose zu den chronischen Erkrankungen.<br />
Wie kommt es zu dieser Erkrankung?<br />
Die Ursachen reichen von angeborenen Fehlbildungen bis zu<br />
unfall- oder krankheitsbedingten Muskel- oder Nervenschädigungen.<br />
Bei idiopathischen Skoliosen, das sind etwa 80 Prozent,<br />
bleibt die Ursache unbekannt. Vorbeugende Maßnahmen können<br />
daher kaum empfohlen werden. Aber: Je früher eine Fehlstellung<br />
erkannt wird, desto weniger aufwändig und belastend<br />
ist die notwendige Behandlung – und desto größer sind die Erfolgsaussichten.<br />
Unter welchen Beschwerden leiden die Patienten?<br />
Das ist abhängig vom Grad der Skoliose. Für jüngere, bewegliche<br />
Patienten ist die Skoliose vor allem ein kosmetisches Problem,<br />
das aber zu ernsthaften seelischen Problemen führen kann. Sie<br />
fühlen sich „schief“ und der Rippenbuckel wird als entstellend<br />
empfunden. Bei älteren oder degenerativen Skoliosen steht der<br />
Schmerz im Vordergrund. Im Extremfall kann es auch zu einer<br />
Einengung der Organe kommen. Durch die Verkrümmung der<br />
Wirbelsäule wird die Lungenfunktion messbar beeinträchtigt,<br />
auch das Herz muss gegen einen höheren Lungenwiderstand<br />
pumpen. Dies kann zu Herzschäden führen.<br />
Wann muss eine Skoliose behandelt werden, und welche Methoden<br />
gibt es?<br />
Bei einer leichten Krümmung zwischen 10 und 20 Grad wird<br />
man in der Regel eine ambulante oder stationäre skoliosespezifische<br />
Physiotherapie mit täglichem Übungsprogramm durchführen,<br />
zwischen 20 und 40 Grad empfiehlt sich eine zusätzli-<br />
che Korsettbehandlung. In der Wachstumsphase kommt neben<br />
sportlichen Aktivitäten zur Stärkung der Haltungsmuskulatur<br />
insbesondere der skoliosespezifischen Krankengymnastik nach<br />
Schroth eine wichtige Rolle zu. Dadurch wird die Wirbelsäule<br />
aufgerichtet und das Fortschreiten der Erkrankung gestoppt. Je<br />
früher die Skoliose auftritt und je jünger der Patient, desto größer<br />
ist auch die Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung. Deshalb<br />
ist die Gefahr einer schnell zunehmenden Verkrümmung in<br />
der Zeit der Pubertät am größten. Und deshalb sind auch viele<br />
unserer Patienten im jugendlichen Alter.<br />
Wann muss man eine Skoliose operieren?<br />
Zum Glück müssen heutzutage nur noch wenige Patienten operiert<br />
werden, oft gelingt es mit konservativen Behandlungsmethoden,<br />
die Zunahme aufzuhalten. Aber wenn sich die Skoliose<br />
nicht aufhalten lässt und der Rücken immer krummer wird,<br />
müssen wir operieren. Die Korrekturen führen wir mit Hilfe von<br />
Implantaten durch: Kleine Titanstäbe werden entlang der Wirbelsäule<br />
eingeschraubt. Damit können wir die Skoliose in aller<br />
Regel vollständig begradigen.<br />
Wie geht es dann weiter?<br />
Diese Implantate bleiben in der Regel ein Leben lang im Körper<br />
und erlauben den Patienten eine sofortige Belastbarkeit am<br />
ersten Tag nach der Operation. Nach einem Jahr sind fast alle<br />
Sportarten wieder möglich, sogar Reiten, Golf oder Skifahren<br />
– Risikosportarten wie Bungee- oder Fallschirmspringen natürlich<br />
nicht. Typischerweise sind die Patienten zwischen 10 und 20<br />
Jahre alt, wenn wir sie operieren, und damit in einem sportlich<br />
sehr aktiven Alter. Deshalb ist nach der OP die tägliche Stärkung<br />
der Muskulatur so wichtig. Das gelingt nur durch regelmäßigen<br />
Sport. Aus unserer Sicht trägt die schnelle Wiedereingliederung<br />
in den schulischen und beruflichen Alltag sehr zum Behandlungserfolg<br />
bei. Dies in Kombination mit sportlichen Freizeitaktivitäten<br />
bringt dann unsere Patienten voll ins Leben zurück.<br />
Aus Langzeituntersuchungen wissen wir, dass über 80 Prozent<br />
der Patienten nach einer Skoliose-OP im Kindes- oder Jugendalter<br />
mit den Ergebnissen zufrieden sind. Über 90 Prozent von<br />
ihnen sind auch arbeitsfähig – und verheiratet!<br />
54 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 55<br />
Tipp<br />
Mehr zur modernen Skoliosetherapie berichtet PD Dr. Niemeyer<br />
im Rahmen der Video-Reihe „Nachtvorlesung nachgefragt“:<br />
www.asklepios.com/nachtvorlesungen<br />
Info zur <strong>Asklepios</strong> Katharina-Schroth-Klinik in Bad Sobernheim:<br />
www.asklepios.com/BadSobernheim<br />
Mathias Eberenz<br />
Kontakt<br />
Priv.-Doz. Dr. Thomas Niemeyer<br />
Chefarzt Abteilung Wirbelsäulen- und<br />
Skoliosechirurgie<br />
Interdisziplinäres Wirbelsäulen-Zentrum<br />
Hamburg<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg<br />
Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg<br />
Tel.: (040) 1818 85-2111<br />
Fax.: (040) 1818 85-3079<br />
E-Mail: t.niemeyer@asklepios.com<br />
Dr. Thomas Niemeyer
Patientenforum<br />
Mit Stethoskop und Stahlhelm<br />
Lindenlohe-Chefanästhesist Dr. Franz Jürgen Unterburger bei der Wehrübung<br />
Als Oberstabsarzt der Reserve im Einsatz: Dr. Franz Jürgen Unterburger (ganz rechts)<br />
Der Außenbordmotor des Schlauchbootes<br />
brummt vor sich hin. Die Augen der<br />
Bootsinsassen sind gespannt auf das<br />
Brückengeländer der Staustufe bei Lechbruck<br />
gerichtet: Von dort stürzen sich<br />
Männer in schwarzen Neoprenanzügen<br />
in den kalten Lech. Diese „Mutprobe“<br />
zählt zur Einzelkämpferausbildung, die<br />
Soldaten der nahe gelegenen Luftlandeund<br />
Transportschule Altenstadt absolvieren<br />
müssen. Und der Chefarzt der Abteilung<br />
für Anästhesie und Schmerztherapie<br />
in der Orthopädischen Klinik Lindenlohe,<br />
Dr. Franz Jürgen Unterburger, sitzt im<br />
wahrsten Sinne des Wortes mit im Boot<br />
– im Tarnanzug und mit Schwimmweste.<br />
Das Kreiswehrersatzamt Kempten hatte<br />
Dr. Unterburger, Oberstabsarzt der Reserve,<br />
per Einberufungsbescheid zu einer<br />
einwöchigen Wehrübung nach Altenstadt<br />
beordert. Statt des weißen Kittels gehören<br />
nun Tarnanzug und Stahlhelm zur Uniform<br />
des Mediziners. Nach zweitägigem<br />
Kennenlernen der Kaserne, des angegliederten<br />
Flugplatzes und des von den Einzelkämpfern<br />
in Ausbildung gefürchteten<br />
„Sauwaldes“ unterstützt der Anästhesist<br />
und aktive Notarzt das Team der Sanitäter<br />
in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne<br />
fachkundig.<br />
Vor Beginn eines kurzen Empfanges bei<br />
Oberst Ferdinand Baur in der Komman-<br />
dozentrale des historischen Bundeswehrstandortes<br />
wurden eilig die Unterlagen<br />
vom Besprechungstisch weggeräumt.<br />
„Geheim“, erklärte der Chef des Standortes.<br />
Eine Vielzahl von Soldatinnen und<br />
Soldaten wird hier auf Auslandseinsätze<br />
vorbereitet. Baur selbst kämpft jeden Tag<br />
– um die Solidarität der Bevölkerung für<br />
die Bundeswehr und für die „moralische<br />
Unterstützung bei der Auftragserfüllung<br />
im In- und Ausland“. Oberstabsarzt Unterburger<br />
kann selbst einige Auslandserfahrung<br />
vorweisen. Er war mit der Bundeswehr<br />
in Kambodscha, in Westindien,<br />
in Singapur und in Nord-Norwegen: dort<br />
vier Wochen im Manöver bei fast minus<br />
40 Grad. Und als Zivilist war er mit Interplast<br />
e. V., einem gemeinnützigen Verein<br />
für kostenlose plastische Chirurgie, im<br />
Iran. Diese Erfahrungen verschaffen ihm<br />
bei der Bundeswehr viel Respekt.<br />
Das Geräusch der zweimotorigen Transportmaschine<br />
ist längst nicht mehr zu<br />
hören, wenn die „Freifaller“ lautlos zu<br />
Boden gleiten. Im Gegensatz zu den „Automatenspringern“<br />
lösen sie das Öffnen<br />
ihres Fallschirmes selbst aus. Zwei Fluglotsen<br />
in Uniform regeln vom Kasernentower<br />
aus den Flugverkehr und beobach-<br />
ten die Geschehnisse auf dem Flugfeld<br />
und in der Landezone. Eine große Flughafenfeuerwehr<br />
und ein Sanitäts-Unimog<br />
mit zwei Sanitätern stehen immer bereit,<br />
wenn Flugbetrieb ist.<br />
Im Sanitätsgebäude in der Kaserne, der<br />
Dienststelle von Dr. Unterburger, zählt<br />
die Versorgung Schwerstverletzter aus<br />
dem Flugbetrieb zum Glück nicht zu den<br />
alltäglichen Aufgaben: Die Sicherheitsvorkehrungen<br />
der Springer haben höchstes<br />
Niveau. Vielmehr sind es grundlegende<br />
Untersuchungen der Soldaten,<br />
Betriebliche Altersvorsorge<br />
zu Sonderkonditionen<br />
Denn als Arbeitnehmer haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf eine betriebliche<br />
Altersversorgung. Dabei können Sie eine Menge Steuern und Sozialabgaben sparen. Die<br />
Zurich Gruppe gewährleistet, dass Sie die staatlichen Vorteile voll ausschöpfen. Ihre Vorteile<br />
als <strong>Asklepios</strong>-Mitarbeiter auf einen Blick:<br />
• Sie profitieren von einem günstigen Gruppentarif<br />
• Sie können auf Wunsch einen Berufsunfähigkeitsschutz integrieren<br />
Wenn Sie mehr wissen möchten, wenden Sie sich einfach an die betreuende Bezirksdirektion.<br />
Sie steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.<br />
die Behandlung von Zerrungen oder<br />
Schnittwunden sowie von Verletzungen,<br />
die aus Be- und Überbelastung beim<br />
Sprungbetrieb und bei der Einzelkämpferausbildung<br />
resultieren. Normaler medizinischer<br />
Alltag also. Und wer glaubt,<br />
bei der Bundeswehr gingen die Uhren anders,<br />
der wird beim Meteorologen-Team<br />
am Standort fündig: Hier gilt die NATOeinheitliche<br />
„Zulu-Zeit“, die der Mitteleuropäischen<br />
Zeit minus einer Stunde<br />
entspricht ...<br />
Hans-Christian Wagner<br />
10-27-999-01_4111 1 27.10.2009 11:34:01 Uhr<br />
56 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 57<br />
Kontakt<br />
Dr. Franz Jürgen Unterburger<br />
Chefarzt der Abteilung für Anästhesiologie und<br />
Schmerztherapie<br />
<strong>Asklepios</strong> Orthopädische Klinik Lindenlohe<br />
Tel.: (09431) 888-640<br />
E-Mail j.unterburger@asklepios.com<br />
Ihr Ansprechpartner:<br />
Bezirksdirektion<br />
Peter Elsner<br />
06122 7072-0<br />
info@ga-elsner.com
Patientenforum<br />
Kleine Wunder, ganz groß<br />
Die Geburt eines Kindes ist einer der schönsten Momente im Leben junger Eltern. Baby Smile Fotografie hält diese<br />
ganz besondere Zeit direkt nach der Geburt für immer fest: Seit über 15 Jahren fangen die Profi-Fotografinnen noch<br />
während des Klinikaufenthaltes unvergessliche Augenblicke ein – kostenlos und ganz ohne Stress für das Baby.<br />
Kaum hat ein Neugeborenes das Licht<br />
der Welt erblickt, wünschen sich Familien<br />
und Freunde nichts sehnlicher, als<br />
das kleine Wunder mit eigenen Augen zu<br />
sehen. Diesen Wunsch erfüllt Baby Smile<br />
Fotografie gern. Schließlich fotografiert<br />
das Unternehmen jährlich über 60.000<br />
dieser kleinen Wunder – innerhalb kürzester<br />
Zeit kann sich die ganze Familie<br />
dann über wunderschöne, professionelle<br />
Bilder freuen.<br />
Das Konzept kommt bei den Eltern super<br />
an. Kein Wunder: „Das Fotografieren ist<br />
für die Eltern völlig kostenfrei und unverbindlich“,<br />
erklärt Klinikberaterin Diana<br />
Kröner. „Die Fotografin bringt etwa<br />
zwei Tage nach dem Fototermin die fertig<br />
entwickelten Bilder und Produkte mit.<br />
Was gefällt, kann gekauft werden. Muss<br />
aber nicht. Auf jeden Fall erhalten die Eltern<br />
eine kostenlose Glückwunschkarte<br />
mit dem schönsten Foto ihres Kindes.“<br />
Zugegeben: Nichts kaufen – das ist leichter<br />
gesagt als getan. Denn wer die hochwertigen<br />
Fotobücher, Leinwandbilder,<br />
Fotogalerien und Geburtskarten mit den<br />
süßen Bildern seines Babys erst einmal in<br />
der Hand hält, kann schwer widerstehen.<br />
Zumal der Preis im Vergleich zu den meisten<br />
anderen Profi-Fotostudios durchaus<br />
bezahlbar bleibt.<br />
Doch auch für die Klinik lohnt sich der<br />
Service. Baby Smile Fotografie stellt gratis<br />
eine individuelle Neugeborenen-Glückwunschkarte<br />
zur Verfügung, mit Foto,<br />
Geburtsdaten sowie den Unterschriften<br />
von Arzt und Hebamme. Die tagesaktuelle<br />
Baby-Galerie auf der Klinikwebsite<br />
kann die Besucherzahl um bis zu 200.000<br />
jährlich wachsen lassen – allesamt stolze<br />
Großeltern, Verwandte und Bekannte<br />
des kleinen Sprösslings. Erstellung,<br />
Pflege und Aktualisierung der Website<br />
übernimmt Baby Smile Fotografie. Außerdem<br />
unterstützt das Unternehmen die<br />
Kliniken auf Wunsch bei der liebevollen<br />
Ausgestaltung der Geburtenstation oder<br />
wenn Fotografien des Personals benötigt<br />
werden, bei Kooperationen mit lokalen<br />
Tageszeitungen sowie bei Veranstaltun-<br />
gen. Und nicht zuletzt gibt es zusätzliche<br />
Angebote wie beispielsweise die Schwangeren-Fotografie.<br />
Bundesweit arbeiten bereits mehr als 150<br />
Kliniken erfolgreich mit Baby Smile Fotografie<br />
zusammen. Darunter auch <strong>Asklepios</strong><br />
Häuser in Hamburg, Wiesbaden,<br />
Langen, Germersheim und Kandel. „Der<br />
Service ist für die Kliniken 100 Prozent<br />
kostenfrei, völlig ohne Aufwand für das<br />
Personal und: eine wirksame, sympathische<br />
Marketingergänzung“, weiß Diana<br />
Kröner.<br />
Kontakt<br />
Diana Kröner<br />
Klinikberaterin Baby Smile Fotografie<br />
Tel.: (0800) 0006953 (kostenfrei)<br />
Mobil: (0177) 8784190<br />
E-Mail: d.kroener@babysmile24.de<br />
www.babysmile24.de<br />
Von Schülern für Schüler<br />
Präventionsunterricht zum Thema Rauchen<br />
Beim Thema Prävention muss man so<br />
früh wie möglich ansetzen, am besten<br />
schon in der Grundschule. Das sagten<br />
sich auch 15 Schülerinnen und Schüler<br />
des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe<br />
(BZG) in Hamburg – und entwickelten<br />
unter Leitung ihrer Lehrerin<br />
Susanne Walter das Konzept für eine Präventionsveranstaltung<br />
zum Thema Rauchen.<br />
Im November 2009 wurde es dann<br />
in die Tat umgesetzt: Zwei Tage lang<br />
unterrichtete der Kurs 2008/02C in den<br />
vierten Klassen der Hamburger Grundschule<br />
„An der Isebek“. Für jede der drei<br />
Klassen war ein Fünferteam zuständig.<br />
Zu Beginn standen die Raucher unter den<br />
BZG-Schülern den Viertklässlern Rede<br />
und Antwort. Warum habt ihr mit dem<br />
Rauchen angefangen? Wie schwer ist es,<br />
wieder aufzuhören? An den folgenden<br />
zwei Unterrichtstagen fanden selbst erarbeitete<br />
Rollenspiele und Experimente<br />
statt.<br />
Ein kleinen Eindruck, was die Grundschüler<br />
an den beiden Tagen erleben<br />
konnten, gibt dieser Bericht der BZG-<br />
Schüler:<br />
„Das wesentliche Ziel unserer Arbeit lag<br />
darin, die neun- und zehnjährigen Kinder<br />
aufzuklären und sie somit in ihrer<br />
Einstellung gegen das Rauchen zu stärken.<br />
Beispielsweise haben wir die Kinder<br />
in Rollenspielen darin geschult, wie sie<br />
in schwierigen Situationen zu ihrer Meinung<br />
stehen können und keinem Gruppenzwang<br />
verfallen müssen. Des Weiteren<br />
beschäftigten wir uns besonders mit<br />
den Folgen und Risiken des Rauchens<br />
anhand eines Memory-Spiels, das unter<br />
anderem aus Bildern einer Raucherlunge<br />
und einer gesunden Lunge bestand. Die<br />
Bilder stellten die abschreckenden Folgen<br />
des Rauchens sehr gut dar. Besonders eindrucksvoll<br />
war für die Kinder, wie viele<br />
Rückstände sich beim Zigarettenkonsum<br />
in der Lunge absetzen. Zur Veranschaulichung<br />
haben wir eine Zigarette in einem<br />
Reagenzglas erhitzt. Der aufsteigende<br />
Rauch mit seinen Schadstoffen wurde von<br />
einem Wattebausch aufgefangen. Schon<br />
nach kurzer Zeit verfärbte sich die Watte,<br />
und ein unangenehmer Geruch stieg auf.<br />
‚Das stinkt ekelhaft!’, mahnten die Kinder<br />
in Einigkeit.<br />
Alles in allem kann man sagen, dass wie,<br />
als angehende Gesundheits- und Krankenpfleger/innen<br />
in Bezug auf Beratung<br />
und Aufklärung ein immenses Wissen<br />
hinzugewonnen haben. Dies vermittelt<br />
uns Sicherheit für die Zukunft. Nicht nur<br />
Schüler und Lehrer, sondern auch wir waren<br />
von dem Projekt begeistert. Wir halten<br />
es für sinnvoll, auch weiterhin aktiv präventiv<br />
in den Schulen tätig zu werden.“<br />
Deutliches Lob für das Engagement der<br />
BZG-Schüler kam von Rosemarie Binz, einer<br />
Lehrerin der Grundschule: „Ich finde<br />
es toll, wenn junge Leute sich für eine gesellschaftlich<br />
wichtige Sache so einsetzen.“<br />
58 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 59<br />
Mathias Eberenz
Patientenforum<br />
Theater als Therapie –<br />
das Theaterlabor 82<br />
Theater- und Heilkunst sind seit frühester Menschheitsgeschichte miteinander verbunden. In kultischen Riten, Zeremonien<br />
oder im Maskenspiel setzten sich Menschen mit den Themen ihres Daseins auseinander, oft gekoppelt an den<br />
Wunsch nach einer Verwandlung. Im Tempel des griechischen Gottes <strong>Asklepios</strong> wurden dramatische Initiationen zu<br />
Heilzwecken durchgeführt. Und auch Aristoteles betonte die kathartische Wirkung des Theaters auf das Publikum.<br />
Um die dem Theater innewohnenden<br />
Möglichkeiten zu nutzen, bietet die Klinik<br />
Nord Ochsenzoll seit mehr als acht<br />
Jahren eine spezifische Form der Theatertherapie<br />
als festen Bestandteil ihres<br />
psychotherapeutischen, psychiatrischen<br />
Behandlungskonzeptes an.<br />
Für viele Patienten ist dieses Therapieangebot<br />
zu einem festen Bestandteil ihrer<br />
Behandlung geworden. Das Theaterlabor<br />
entwickelte sich für viele auch zu einer<br />
wichtigen Schnittstelle zwischen stationärer<br />
und ambulanter Behandlung. Gerade<br />
in Krisenzeiten suchen ehemalige<br />
Patienten die Theatergruppe auf. Hinter<br />
der Fassade, „nur mal vorbeischauen<br />
zu wollen“, verbirgt sich da manchmal<br />
der Wunsch nach einem beratenden Gespräch.<br />
Wenn nötig, kann es in einer solchen<br />
Situation gelingen, diese Patienten<br />
zu einer rechtzeitigen und freiwilligen<br />
Behandlung in der Klinik zu motivieren.<br />
Kontakt<br />
Horst Thalmaier<br />
Theaterlabor<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Nord/ Campus Ochsenzoll<br />
Langenhorner Chaussee 560<br />
22419 Hamburg<br />
Tel.: (040) 1818872884<br />
E-Mail: h.thalmaier@asklepios.com<br />
Die inhaltliche Arbeit besteht aus drei Bereichen:<br />
1. Das freie Spiel und Improvisationstheater eröffnen ein Experimentierfeld. Die Übungen<br />
sind niederschwellig angelegt. Das Übungsrepertoire besteht unter anderem aus spezifischen<br />
Übungen zur Stimmentwicklung, zur Gebärdensprache und Mimik (Nonsensdialoge,<br />
Fratzen schneiden), Übungen zur Förderung des Körperbewusstseins (Atemwahrnehmung,<br />
Bewegungsspiele), kurzen, von den Teilnehmern selbst entwickelten, szenischen<br />
Improvisationen und pantomimischen Darstellungen von Alltagstätigkeiten (zum Beispiel<br />
Zähneputzen). Sämtliche Übungsangebote fördern Humor, Experimentierlust und<br />
Freude am Spiel, was wir per se schon als heilsam erleben.<br />
2. Ein zweiter Bereich ist die Auseinandersetzung mit konkreten Theaterstücken aus der<br />
Literatur, zumeist Komödien. Diese stellen alltägliche Lebenszusammenhänge und Konflikte<br />
in humorvoller Weise dar und zeigen eine nachvollziehbare Lösung auf. Die Struktur<br />
einer Theaterrolle und eines Handlungsablaufs begrenzt den wesentlichen Anteil<br />
emotionalen Ausdrucks auf die Szene. Gleichzeitig kann man lernen, Gefühle sinnhaft<br />
eingebunden zu erleben und zielgerichtet auszudrücken. Die anschließende Reflexion<br />
der Rolle ermöglicht auch die Integration eigener Lebenserfahrungen und trägt mittelfristig<br />
zu einer Verringerung krankheitsfördernder Konfliktspannung bei.<br />
Zunächst werden einzelne Szenen mehrfach mit verteilten Rollen in der Gruppe gelesen<br />
und mit verschiedenen Gefühlshintergründen (beispielsweise Schüchternheit, Ärger,<br />
Misstrauen, Freude) auf der Bühne improvisiert. Allmählich formen sich die Charaktere<br />
und ihnen wird ein Erlebnishintergrund angedichtet. In diesem kreativ-schöpferischen<br />
Prozess kristallisieren sich meist die ersten Rollenpräferenzen heraus. Hier eröffnet sich<br />
auch der Raum, in dem die unterschiedlichsten Identifikationen mit der Figur auf bewusster<br />
und insbesondere unbewusster Ebene stattfinden.<br />
3. Die Entscheidung, das jeweilige Theaterstück dann öffentlich vor fremdem Publikum<br />
aufzuführen, erhöht den Leistungsanspruch und trägt zu einer enormen Bündelung der<br />
bis dahin entwickelten Fähigkeiten bei. Das Verantwortungsgefühl für das Gelingen<br />
wächst und motiviert die Teilnehmenden zu neuen Erfahrungen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit,<br />
Durchhaltevermögen. Dass es gelingt, etwas so Anspruchsvolles wie eine<br />
Theateraufführung zusammen zu gestalten, bedeutet für Patienten häufig eine tief greifende<br />
Lernerfahrung.<br />
Das Theaterlabor 82 bietet eine umfassende<br />
Lern- und Therapiesituation, die auch<br />
über den Krankenhausaufenthalt hinaus<br />
wirkt: kognitives Training, emotionales<br />
Lernen, Förderung sozialer Kompetenzen.<br />
Es konnte bereits erfolgreich mehrere<br />
Premieren an unterschiedlichen Orten<br />
feiern: „Der Diener zweier Herren“ von C.<br />
Goldoni, „Der Floh im Ohr“ von Georges<br />
Feydeau oder auch „Pension Schöller“<br />
von C. Laufs & W. Jacoby wurden aufgeführt.<br />
Improvisationstheater zu unterschiedlichen<br />
Themenreihen und Anlässen<br />
rundet das Repertoire ab: „Das Spiel<br />
mit der eigenen Komik“, „Mehr Schein<br />
als Sein“ und „Irren bleibt menschlich“.<br />
Die Patienten lernen, eigene Ideen themenzentriert<br />
zu entwickeln, sie kreativ<br />
zu gestalten. Sie erkennen, dass sie über<br />
ein breit gefächertes, wertvolles Handlungspotenzial<br />
verfügen, sie erleben<br />
Kompetenzen und persönliche Erfolge<br />
sehr direkt. Selbstheilungskräfte werden<br />
aktiviert. Die Stigmata von „verrückt“<br />
und „normal“ verlieren im gemeinsamen<br />
kulturellen Schaffen an Bedeutung.<br />
Das Theaterlabor 82 ist nicht zuletzt auch<br />
öffentlicher Raum. Psychisch kranke<br />
Menschen sind noch immer über negative<br />
gesellschaftliche Stigmatisierungen<br />
definiert, die sie selbst größtenteils verinnerlicht<br />
haben. Auf der Bühne zu stehen<br />
und dafür Zuspruch und Anerkennung<br />
zu erfahren, bedeutet aber auch, wieder<br />
ein Stück in die gesellschaftliche Normalität<br />
zurückzukehren und sich selbst als<br />
dazugehörig zu erleben.<br />
60 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 61
Patientenforum<br />
Babyweiche Haut –<br />
das Einmaleins der Säuglingspflege<br />
Frischgebackene Eltern sind bei der Pflege ihres Nachwuchses oft etwas unsicher. Viel Puder, dicke Schichten von<br />
Cremes auf Gesicht und Po: Diese Tipps von Eltern und Großeltern sind längst veraltet. Doch wie viel Pflege benötigt<br />
ein Säugling tatsächlich? <strong>Asklepios</strong> intern sprach mit Andrea Büttner, Stationsschwester in der Klinik für Gynäkologie<br />
und Geburtshilfe im Klinikum Uckermark in Schwedt.<br />
Auf was muss bei der Babypflege besonders geachtet werden?<br />
Absolut wichtig bei der Pflege von babyweicher Haut ist das<br />
Trocken- und Geschmeidighalten der Hautfalten am Hals, unter<br />
den Armen und in der Leistengegend. Feuchte Stellen verursachen<br />
schnell Rötungen und Reizungen. Durch sorgfältiges Abtrocknen<br />
des Babys können sie aber verhindert werden.<br />
Grundsätzlich reicht es aus, die Babyhaut mit klarem Wasser<br />
zu reinigen. Zusätzlich kann das Baby mit einem pflanzlichen<br />
Öl eingerieben werden. Die Industrie bietet sehr viele verschiedene<br />
Pflegeprodukte an. Dadurch sollte sich die Mutter jedoch<br />
nicht irritieren lassen, sondern lieber auf ihr Bauchgefühl hören.<br />
Wenn Pflegeprodukte benutzt werden, ist unbedingt darauf zu<br />
achten, dass keine Konservierungsstoffe enthalten sind. Bei der<br />
Auswahl der richtigen Produkte sind auch Auswertungen der<br />
Stiftung Warentest und Ökotest sehr hilfreich.<br />
Wie sollte ein Baby gebadet werden?<br />
Obwohl die Kleinen das Baden sehr mögen, sollten es die Eltern<br />
damit nicht übertreiben. Wir empfehlen daher, ein Baby höchstens<br />
ein- bis zweimal in der Woche zu baden. An den anderen<br />
Tagen reicht es, den Körper von Kopf bis Fuß zu waschen. Heizen<br />
Sie das Badezimmer gut vor. Die optimale Wassertemperatur<br />
beträgt 37 Grad. Bitte nutzen Sie zur Überprüfung ein im<br />
Handel erhältliches Thermometer. Um eine Unterkühlung zu<br />
vermeiden, reicht es aus, das Baby fünf Minuten zu baden. Für<br />
gesunde Babyhaut sind Badezusätze nicht notwendig, klares<br />
Wasser genügt völlig. Seife und Schaumbadzusätze trocknen<br />
die Haut nur unnötig aus. Wir empfehlen Müttern, die viel Muttermilch<br />
haben, diese als Badezusatz zu nehmen. Das Wasser<br />
kann auch mit pflanzlichem Öl angereichert werden.<br />
Wie pflegt man einen wunden Po?<br />
Auch hier plädieren wir für klares Wasser. Reinigen Sie den<br />
Windelbereich gründlich und lassen Sie ihn an der Luft trock-<br />
Das Gespräch führte Mandy Wolf<br />
62 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 63<br />
Kontakt<br />
Andrea Büttner<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinikum Uckermark<br />
Auguststraße 23, 16303 Schwedt/Oder<br />
Tel.: (03332) 53-2894<br />
E-Mail: a.buettner@asklepios.com<br />
nen. Lassen Sie Ihr Baby in dieser Zeit so oft wie möglich mit<br />
nacktem Po auf einer Unterlage liegen. Die Kleinen finden das<br />
toll, allerdings neigen sie dann auch oft zum Pullern. Aus diesem<br />
Grund raten wir von der Nutzung eines Föns ab. Erwärmen<br />
Sie die Umgebung lieber mit einer kleinen Heizlampe oder mit<br />
Rotlicht. Verzichten Sie auf die Nutzung von Feuchttüchern. Für<br />
unterwegs sind sie gut geeignet, für den häuslichen Gebrauch<br />
können Sie dünne Waschlappen oder Einmalwaschlappen verwenden.<br />
Falls dennoch Wundschutzcreme verwendet wird,<br />
sollte diese nur hauchdünn aufgetragen werden. Auch ein paar<br />
Tropfen Muttermilch auf den Po haben eine heilende Wirkung.<br />
Kein Baby mag es, aber wie schneidet man Finger- und Fußnägel?<br />
In den ersten vier Lebenswochen sind die Nägel des Babys noch<br />
so weich, dass sie sich von ganz allein abschilfern, das heißt, sie<br />
schälen sich ab. Um eine Nagelbettentzündung zu vermeiden,<br />
raten wir davon ab, bereits im ersten Lebensmonat die Nägel<br />
zu schneiden. Nach dieser Zeit sollte für die Finger- und Fußnägel<br />
eine Babynagelschere verwendet werden. Und um unnötigen<br />
Stress zu vermeiden: Schneiden Sie die Nägel Ihres Kindes,<br />
wenn es schläft.<br />
Welche Tipps können Sie jungen Eltern für die ersten Tage zu<br />
Hause geben?<br />
Bewahren Sie Ruhe! Ein Baby wirbelt das ganze Leben durcheinander.<br />
Versuchen Sie, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden.<br />
Schlafen Sie, wenn Ihr Baby schläft. Auch wenn alle anderen<br />
noch so neugierig sind: Verzichten Sie in den ersten Wochen<br />
auf Besuch. Und falls sich doch Gäste ankündigen, sollten diese<br />
Kaffee und Kuchen selbst mitbringen. Nehmen Sie die Hilfe von<br />
Ihrer Familie, von Ihren Freunden und der Hebamme an. Legen<br />
Sie Ihre Prioritäten neu fest. Niemand erwartet von Ihnen, dass<br />
Sie perfekt sind. Akzeptieren Sie die neue Situation und freuen<br />
Sie sich gemeinsam über Ihr Baby.
Patientenforum<br />
Sind Sie schon freundlich, oder müssen<br />
Sie noch zu einem Seminar?<br />
Als Freundlichkeit bezeichnen Umgangssprache und Sozialpsychologie das anerkennende und liebenswürdige Verhalten<br />
eines Menschen, aber auch die innere wohlwollende Geneigtheit gegenüber seiner sozialen Umgebung. In der<br />
personalwirtschaftlichen Bewertung wird die Freundlichkeit zum Bereich der sozialen Kompetenzen gezählt und als<br />
Teil der Schlüsselqualifikationen im Rahmen der Eignungsdiagnostik bewertet.<br />
Sowohl in innerbetrieblichen Austauschprozessen,<br />
in der Zusammenarbeit mit anderen<br />
im Team oder als Führungskraft als auch im<br />
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit oder im Zusammenhang<br />
mit dem Mahnwesen und Kunden<br />
in Zahlungsschwierigkeiten, im Bereich der<br />
Reklamationsbearbeitung und nicht zuletzt im<br />
Krankenhaus wird der Freundlichkeit im Umgang<br />
mit dem jeweiligen Gegenüber ein enormer<br />
Stellenwert zur Konfliktvermeidung und<br />
Deeskalation beigemessen. Aktuelle Rückmeldungen<br />
zeigen:<br />
Freundliches Verhalten gegenüber einem unfreundlichen<br />
Menschen verlangt Selbstbeherrschung<br />
und ist daher auch immer anstrengend. Zahlreiche Berater<br />
und verschiedene Institute bieten mittlerweile Hunderte von<br />
Fortbildungen an, um Mitarbeiter speziell in Freundlichkeit zu<br />
schulen. Es geht aber auch alles viel einfacher und kostengünstiger.<br />
Verfahren Sie, wie meine Mutter zu sagen pflegte: „Wie<br />
man in den Wald ruft, so schallt es heraus“, oder anders gesagt:<br />
Besinnen Sie sich einfach auf die drei nachfolgenden Kleinigkeiten<br />
mit großer Wirkung ...<br />
1. Höflichkeit<br />
Die Höflichkeit ist eine Tugend, deren Folge eine rücksichtsvolle<br />
Verhaltensweise ist, die den Respekt vor dem Gegenüber zum<br />
Ausdruck bringen soll.<br />
2. Wertschätzung<br />
Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung einer anderen<br />
Person. Sie gründet auf einer inneren allgemeinen Haltung<br />
anderen Menschen gegenüber.<br />
3. Lachen<br />
Im menschlichen Miteinander wird das Lachen als Ausdruck<br />
für Sympathie und gegenseitiges Einverständnis verstanden<br />
und entfaltet dadurch eine besänftigende, konfliktbegrenzende<br />
Wirkung, die dem Zusammenleben<br />
in Gruppen förderlich ist.<br />
Insbesondere Punkt 3 ist in der Außenwirkung<br />
nicht zu unterschätzen und auch gesundheitsfördernd.<br />
Das Lachen (Risus) ist eine besondere<br />
Atmungsbewegung, bei der die Ausatmung in<br />
mehreren schnell hintereinander folgenden Stößen<br />
mit mehr oder weniger starkem Schall ausgeführt<br />
wird. Die Einatmung geschieht dagegen<br />
meist in einem kontinuierlichen, etwas beschleunigten<br />
und tiefen Zug. Wenn ein Mensch<br />
lacht, werden innerhalb der Gesichtsregion 17<br />
und am ganzen Körper sogar 80 Muskeln betätigt.<br />
Die Augenbrauen heben sich, die Nasenlöcher weiten<br />
sich, der Jochbeinmuskel zieht die Mundwinkel nach oben, die<br />
Augen verengen sich zu Schlitzen, der Atem geht schneller, die<br />
Luft schießt mit bis zu 100 km/h durch die Lungen, die Stimmbänder<br />
werden in Schwingung versetzt. Der Schall männlichen<br />
Gelächters hat mindestens 280 Schwingungen pro Sekunde, der<br />
des weiblichen sogar 500.<br />
Das Zwerchfell bewegt sich rhythmisch. Sollte es mit dem Lachen<br />
noch nicht funktionieren, fangen Sie mit kleinen Schritten<br />
an – ein kleines Lächeln kann auch schon Wunder bewirken!<br />
Anette Elwert<br />
Kontakt<br />
Anette Elwert<br />
Leitung<br />
Krankenhauskommunikation & Service<br />
<strong>Asklepios</strong> Klinik Harburg<br />
Eißendorfer Pferdeweg 52, 21075 Hamburg<br />
Tel.: (040) 18 18 86 2136<br />
E-Mail: a.elwert@asklepios.com<br />
Sponsoring für das<br />
Damenbob-Spitzenteam<br />
Die 27-jährige Cathleen Martini gewann mit ihrer Anschieberin Romy Logsch in dieser Saison bei Weltcups bereits<br />
fünfmal Gold (zweimal mit Bahnenrekord) und zweimal Silber. Doch dieses Jahr ist auch das Jahr der Olympischen<br />
Winterspiele im kanadischen Vancouver! Darum unterstützt die Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz das junge Team<br />
aus Sachsen – und das Sponsoren-Logo der <strong>Asklepios</strong> Sächsischen Schweiz Klinik Sebnitz prangt auf dem sachsengrünen<br />
Bob des Teams Martini-Logsch.<br />
Gesundheit ist das höchste Gut – und steht auch unabhängig<br />
von der medizinischen Behandlung im Mittelpunkt aller Bestrebungen<br />
der Klinik-Mitarbeiter. In diesem Zusammenhang wird<br />
die Förderung des Sports als ein wichtiger Beitrag zur Prävention<br />
und Bekämpfung gesundheitlicher Probleme gesehen. Denn<br />
bei vielen Volkskrankheiten und Beschwerden wie Rückenschmerzen,<br />
Bluthochdruck, Osteoporose, Diabetes II oder Herz-<br />
Kreislauf-Erkrankungen hat regelmäßige körperliche Aktivität<br />
einen beträchtlichen Schutzeffekt und unterstützt die körperliche<br />
und die seelische Gesundheit.<br />
Aber Sport erzeugt auch Emotionen, Leidenschaft und Begeisterung.<br />
Sportler (und gerade Spitzensportler!) tragen so dazu<br />
bei, Jugendliche für den Sport und eine gesunde Lebensweise<br />
zu begeistern. Cathleen Martini und Romy Logsch sind zwei<br />
Modellathletinnen, die in ihrem Sport herausragende Leistungen<br />
zeigen und mit ihrer Einstellung daher für Jugendliche eine<br />
außerordentliche Vorbildfunktion haben.<br />
Weltweit gibt es derzeitig zwölf Bahnen, die abwechselnd für<br />
Weltcups genutzt werden. In Deutschland sind es die Kunsteisbahnen<br />
in Winterberg, Altenberg und in Berchtesgaden am<br />
Königssee. Je nach Kurvenprofil und Gefälle werden mit den<br />
Schlitten hier Geschwindigkeiten bis zu 135 Stundenkilometern<br />
erreicht. In den Druckkurven ist die körperliche Belastung für<br />
die Athleten besonders hoch: Die dort wirkenden Fliehkräfte<br />
drücken mit dem vier- bis fünffachen Gewicht auf Skelett und<br />
Muskulatur der Bobsportler. Damit sie beim Start genügend<br />
Schub für den Bob erreichen, trainieren Topathleten überwiegend<br />
im Kraft- und Schnellkraft-Bereich. Um der körperlichen<br />
Belastung während der Abfahrt, der maximalen Konzentration<br />
auch beim explosionsartigen Start gewachsen zu sein, absolvieren<br />
die Sportlerinnen vor der Saison tagtäglich bis zu zwei Trainingseinheiten.<br />
Cathleen Martini aus Zwickau begann vor über 20 Jahren mit<br />
dem Rodeln. Im Jahr 2000 wechselte sie zum Bobsport. Seither<br />
konnte sie insgesamt 13 Weltcups gewinnen, ist dreimalige Europameisterin,<br />
mehrfache Vize-Gesamtweltcup-Siegerin und Vize-<br />
Weltmeisterin. Die Teilnahme an den Winterspielen 2010 gilt als<br />
vorläufiger Höhepunkt ihrer Karriere: Cathleen Martini wurde<br />
als eine der aussichtreichsten Anwärterinnen auf olympisches<br />
Edelmetall gehandelt. Die Beamtin der Bundespolizei gibt sich<br />
indes gewohnt zurückhaltend. „Na klar ist Olympia etwas<br />
Außergewöhnliches. Aber bei Romy und mir ist es auch wichtig,<br />
dass wir einfach Spaß haben an unserem Sport. Da kommen die<br />
Erfolge fast von ganz alleine. Wir trainieren jeden Tag hart, aber<br />
lassen auch den Spaß nicht zu kurz kommen. Wichtig ist, dass<br />
wir gesund bleiben und die Spannung halten können.“<br />
64 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 65<br />
Jörg Scharfenberg<br />
Eilmeldung<br />
Leider wurde auch unseren leistungsstarken Athletinnen die anspruchsvollste<br />
und schnellste Bahn zum Verhängnis. Durch einen<br />
tragischen, glücklicherweise glimpflich verlaufenden Sturz<br />
im letzten Durchgang konnten sie keine Medaille erringen. Wir<br />
drücken nun fest die Daumen für die im kommenden Jahr in<br />
Deutschland stattfindenden Europa- und Weltmeisterschaften.<br />
www.bobteam-martini.de Quelle: mediaConcepta
Patientenforum<br />
<br />
Kontakt<br />
66 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010<br />
Gut zu wissen<br />
Prof. Dr. Dr.<br />
Stephan Ahrens<br />
Prof. Dr. Dr. Stephan Ahrens<br />
Psychosomatisches Fachzentrum<br />
Falkenried<br />
E-Mail: s.ahrens@asklepios.com<br />
www.starkimjob.de<br />
<strong>Brainfood</strong> – Ernährung für mehr<br />
Leistung<br />
Unser Gehirn reagiert darauf, was wir essen<br />
und trinken. Es arbeitet deutlich besser, wenn<br />
es optimal mit Nährstoffen versorgt wird.<br />
Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für<br />
unsere Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit,<br />
unsere Lernfähigkeit und unsere mentale<br />
Wachsamkeit. Auch die Fähigkeit, Glück<br />
zu erleben, wird vom Hirn mitgesteuert. Bestimmte<br />
Lebensmittel – <strong>Brainfood</strong> genannt<br />
– wirken sich dabei besonders positiv aus.<br />
Manche tragen dazu bei, gute Laune zu empfinden,<br />
andere helfen in stressigen Situationen.<br />
Was kaum jemand weiß: Das Gehirn ist<br />
zwar nur ein kleines Organ, doch 20 Prozent<br />
des Sauerstoff- und Energiebedarfs im Körper<br />
gehen auf sein Konto. Schon ein kurzzeitiger<br />
Mangel in der Energieversorgung führt<br />
deshalb zu körperlichen Symptomen.<br />
Ernährungstipps<br />
Viel Sauerstoff tanken! Unser Gehirn benötigt<br />
täglich 75 Liter davon. Deshalb heißt<br />
die Devise: Regelmäßig lüften und möglichst<br />
viel Zeit an der frischen Luft verbringen. Das<br />
schützt vor Kopfschmerzen und steigert die<br />
Leistung.<br />
Blutzuckerspiegel konstant halten. Zucker<br />
kann im Gehirn nicht gespeichert werden.<br />
Wer regelmäßig und über den Tag verteilt<br />
Nahrung aufnimmt, hält den Blutzuckerspiegel<br />
konstant und verhindert Leistungstiefs.<br />
Besonders gut sind komplexe Kohlenhydrate<br />
wie beispielsweise Vollkorngetreide (Reis,<br />
Nudeln, Brot) und Eiweiße (Nüsse, Hülsenfrüchte,<br />
Fleisch, Fisch).<br />
Aminosäuren aus Fisch, Fleisch und Milchprodukten<br />
sind für die Produktion von Neurotransmittern<br />
notwendig. Die sorgen dann<br />
für die schnelle Informationsweiterleitung im<br />
Gehirn und ein verbessertes Denkvermögen.<br />
Gesunde, ungesättigte Fettsäuren wie<br />
Omega 3 und Omega 6 zu sich zu nehmen,<br />
ist wichtig für die Produktion und Freisetzung<br />
der „Glückshormone“ Dopamin und<br />
Serotonin. Lachs, Thunfisch, Walnüsse und<br />
Leinsamen sind da gute Lieferanten.<br />
Vitamine, insbesondere B-Vitamine, sind<br />
für eine optimale Hirnleistung im Alltag unersetzlich.<br />
Zu finden in Vollkorngetreiden,<br />
Nüssen und Hülsenfrüchten.<br />
Eisen ist bedeutsam für die Produktion des<br />
roten Blutfarbstoffs Hämoglobin, der den<br />
Sauerstoff ins Gehirn transportiert. So unterstützt<br />
Eisen die Lernfähigkeit und schützt<br />
vor Müdigkeit. Den lebenswichtigen Mineralstoff<br />
gibt es reichlich in rotem Fleisch, aber<br />
auch in Petersilie und im Honig.<br />
Ausreichend trinken – möglichst zwei bis<br />
drei Liter täglich. Wasser, Saftschorlen oder<br />
Früchtetee sind gute Quellen. Flüssigkeitsmangel<br />
schränkt die intellektuellen Fähigkeiten<br />
ein.<br />
<strong>Asklepios</strong> intern 42/2010 67
Patientenforum<br />
? <strong>Asklepios</strong><br />
Im nächsten Heft<br />
Quiz<br />
Sie haben die aktuelle Ausgabe der „<strong>Asklepios</strong> intern“<br />
aufmerksam gelesen? Dann rätseln Sie mit und gewinnen Sie!<br />
Wie das geht? Ganz einfach! Beantworten Sie die nebenstehenden<br />
Fragen und teilen Sie uns die richtige Zahlenkombination mit!<br />
Als Preis winkt das neue Buch Benjamin v. Stuckrad-Barres<br />
„Auch Deutsche unter den Opfern“.<br />
Bitte senden Sie Ihre Lösung bis zum 16. April 2010 an:<br />
<strong>Asklepios</strong> Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH<br />
KB Unternehmenskommunikation & Marketing<br />
Mandy Wolf<br />
Hubertusstraße 12 - 22<br />
16547 Birkenwerder<br />
E-Mail: mandy.wolf@asklepios.com<br />
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.<br />
Gewonnen!<br />
Wir gratulieren der Preisträgerin unseres Rätsels aus<br />
der „<strong>Asklepios</strong> intern“ Nr. 42. Gewonnen hat Brunhild<br />
Kühlke aus 21244 Buchholz.<br />
Mama – mein Kopf tut weh!<br />
Zehn Millionen Deutsche leiden an<br />
einer Migräne. Doch es trifft nicht nur<br />
die Erwachsenen: Jedes zwanzigste<br />
Kind wird von chronischen Kopfschmerzen<br />
oder Migräne gepeinigt<br />
– Tendenz steigend. Kinderärzte aus<br />
Weißenfels erläutern Therapiemöglichkeiten<br />
und zeigen Wege aus der<br />
Schmerzspirale.<br />
Frage A<br />
<br />
<br />
<br />
Lösung:<br />
Medizinische Versorgung im ewigen Eis<br />
Das als Eisbrecher<br />
ausgelegte Forschungs- und<br />
Versorgungsschiff „Polarstern“<br />
ist eines der leistungsfähigsten<br />
Polarforschungsschiffe der Welt. Wie die<br />
medizinische Versorgung auf diesem<br />
Schiff gewährleistet wird, berichtet Dr.<br />
Felix Meuschke aus Schwalmstadt, der<br />
von Januar bis April 2010 als Arzt eine<br />
Expedition begleitete.<br />
Was versteht man unter einem Hallux valgus?<br />
1 Ballen- oder Schiefzehen<br />
2 Hühneraugen<br />
3 Senk- und Spreizfüße<br />
Frage B<br />
Was bewirkt ein Defibrillator?<br />
1<br />
Normalisierung des Herzrhythmus bei<br />
Kammerflimmern mittels Elektroschock<br />
2<br />
Normalisierung der Lungenfunktion bei Atemstillstand<br />
3 Normalisierung einer Schilddrüsenüberfunktion<br />
<br />
Frage C<br />
Seit wann ist der Konzerngeschäftsführer Dr. h.c. Peter Coy<br />
bei <strong>Asklepios</strong> beschäftigt?<br />
1<br />
seit 1993<br />
2<br />
seit 1989<br />
3 seit 2007<br />
<br />
<br />
Behandlung psychisch erkrankter<br />
Menschen aus anderen Kulturen<br />
Die Therapie psychisch kranker<br />
Migranten erfordert besondere<br />
Kenntnis des kulturellen<br />
Krankheitskonzepts sowie Respekt<br />
gegenüber der fremden Kultur.<br />
Spezialisten aus dem Fachklinikum<br />
Göttingen berichten über ihre<br />
Erfahrungen mit einem speziellen<br />
Konzept für diese Patienten.<br />
Die nächste <strong>Asklepios</strong> intern<br />
erscheint am 30.06.2010<br />
! Buchtipps<br />
Gewinnen Sie<br />
dieses Buch!<br />
Rebecca Gablé: Hiobs Brüder<br />
England 1147: Eingesperrt in einer verfallenen Inselfestung, fristen fünf Männer ihr Dasein.<br />
Als eine Laune der Natur ihnen den Weg in die Freiheit öffnet, bringt Losian, der<br />
sein Gedächtnis verloren hat, die kleine Schar zurück in die „wirkliche“ Welt. Dabei gelangt<br />
er zu erschreckenden Erkenntnissen über seine Vergangenheit. Als dann endlich<br />
Liebe und ein Neuanfang möglich scheinen, beginnt Losian zu ahnen, dass er die Schuld<br />
an dem furchtbaren Krieg trägt, der England zugrunde zu richten droht.<br />
Rebecca Gable, Hiobs Brüder, Ehrenwirth Verlag, 24,99 €<br />
Anne Weber: Luft und Liebe<br />
Eine mitreißende Geschichte von Liebe und Verrat: Anfang Vierzig und in Herzensdingen<br />
längst an das normale Glück oder Unglück gewöhnt, begegnet die Heldin einem<br />
nicht mehr ganz jungen Mann, nach dem sich niemand umdrehen würde. Doch er ist<br />
zärtlich, aufmerksam, charmant und verspricht ihr den Himmel auf Erden. Ein Märchenprinz<br />
mit einem Schloss. Doch dann zerplatzen alle Träume wie Seifenblasen, und die<br />
mit großer Leichtigkeit und funkelnder Ironie erzählte Geschichte nimmt ein Ende mit<br />
Schrecken ...<br />
Anne Weber, Luft und Liebe, Fischer S. Verlag, 17,95 €<br />
Benjamin v. Stuckrad-Barre: Auch Deutsche unter den Opfern<br />
Erstaunlich, wo überall dieser Chronist unserer Gegenwart auftaucht. Beeindruckend,<br />
wie nah er rankommt. Erhellend, was er zutage fördert. Er begleitet Politiker beim Wahlkampf,<br />
besucht das Callcenter eines Umfrageinstituts, versucht mit Günter Grass zu diskutieren,<br />
wartet am roten Teppich auf Tom Cruise, ist bei der Grundsteinlegung der BND-<br />
Zentrale dabei … So entsteht aus vielen Einzelbeobachtungen ein deutscher Klappaltar,<br />
aus vielen Texten eine Großerzählung über die Zeit, in der wir leben.<br />
Benjamin v. Stuckrad-Barre, Auch Deutsche unter den Opfern, Kiepenheuer & Witsch,<br />
12,95 €<br />
68 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 69
Klinikübersicht<br />
Kliniken in Deutschland Betten/Plätze<br />
1 <strong>Asklepios</strong> Klinikum Bad Abbach (Krankenhaus) Fachkrankenhaus für Orthopädie und Rheumatologie 225<br />
2 <strong>Asklepios</strong> Klinikum Bad Abbach (Rehabilitation) Zentrum für Orthopädische und Rheumatologische Rehabilitation 269<br />
3 <strong>Asklepios</strong> Hirschpark Klinik Alsbach-Hähnlein Fachklinik für Innere Medizin und Orthopädie 120<br />
4 <strong>Asklepios</strong> Klinik und Hotel St. Wolfgang, Bad Griesbach Spezialklinik für Orthopädie, Sportmedizin, Innere Medizin, Kardiologie und Urologie 278<br />
5 <strong>Asklepios</strong> Harzklinik Bad Harzburg Fachkrankenhaus für Orthopädie 90<br />
6 <strong>Asklepios</strong> Schlossberg Klinik Bad König Fachklinik für Neurologische Frührehabilitation 70<br />
7 <strong>Asklepios</strong> Klinik Bad Oldesloe Krankenhaus der Regelversorgung 198<br />
8 <strong>Asklepios</strong> Neurologische Klinik Bad Salzhausen Fachkrankenhaus für Neurologie und neurologische Rehabilitation 190<br />
9 <strong>Asklepios</strong> Burgseekliniken Bad Salzungen Fachklinik für Onkologie, Pneumologie und Orthopädie 270<br />
10 <strong>Asklepios</strong> Klinik Am Kurpark Bad Schwartau Fachklinik für Orthopädie und Gynäkologie 265<br />
11 <strong>Asklepios</strong> Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim Fachklinik für Orthopädie, Skoliosezentrum 173<br />
12 <strong>Asklepios</strong> Stadtklinik Bad Tölz Krankenhaus der Regelversorgung 270<br />
13 <strong>Asklepios</strong> Stadtklinik Bad Wildungen Krankenhaus der Regelversorgung 180<br />
14 <strong>Asklepios</strong> Helenenklinik Bad Wildungen Fachklinik für Innere Medizin, Orthopädie, Urologie und Nephrologie 140<br />
15 <strong>Asklepios</strong> Fachklinik Fürstenhof Bad Wildungen Fachklinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Neurologie 228<br />
16 M Salus Fachkrankenhaus Bernburg Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, Forensische Psychiatrie 413<br />
17 <strong>Asklepios</strong> Klinik Birkenwerder Fachkrankenhaus für Orthopädie, Gefäßchirurgie, Plastische Chirurgie, Diabetologie 175<br />
18 <strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Brandenburg Zentrum für Neurologie, Psychiatrie und KJP, Forensische Psychiatrie 475<br />
19 <strong>Asklepios</strong> Harzklinik Clausthal-Zellerfeld Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung 44<br />
20 <strong>Asklepios</strong> Neurologische Klinik Falkenstein Fachklinik für Neurologische Rehabilitation 160<br />
21 <strong>Asklepios</strong> Südpfalzklinik Germersheim Krankenhaus der Regelversorgung 132<br />
22 <strong>Asklepios</strong> Harzklinik Goslar Krankenhaus der Regelversorgung 333<br />
23 <strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Göttingen Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, Forensische Psychiatrie 458<br />
24 <strong>Asklepios</strong> Klinik Altona, Hamburg Krankenhaus der Maximalversorgung 922<br />
25 <strong>Asklepios</strong> Klinik Barmbek, Hamburg Krankenhaus der Schwerpunktversorgung 716<br />
26 <strong>Asklepios</strong> Klinik Harburg, Hamburg Krankenhaus der Schwerpunktversorgung 741<br />
27 <strong>Asklepios</strong> Klinik Nord, Hamburg Krankenhaus der Schwerpunktversorgung 1.618<br />
28 <strong>Asklepios</strong> Klinik St. Georg, Hamburg Krankenhaus der Maximalversorgung 758<br />
29 <strong>Asklepios</strong> Klinik Wandsbek, Hamburg Krankenhaus der Schwerpunktversorgung 605<br />
30 <strong>Asklepios</strong> Westklinikum Hamburg Krankenhaus der Schwerpunktversorgung 540<br />
31 Cardio CliniC Hamburg Fachklinik für Kardiochirurgie 25<br />
32 Fachklinik Helmsweg, Hamburg Fachklinik für Gynäkologie und Chirurgie 20<br />
33 MB International Neuroscience Institute Hannover Spezialklinik für Neurochirurgie, stereotaktische Neurochirurgie und Neuroradiologie 108<br />
34 <strong>Asklepios</strong> Orthopädische Klinik Hohwald Fachkrankenhaus für Orthopädie und Rheumaorthopädie 110<br />
35 <strong>Asklepios</strong> Schwalm-Eder Klinikum Homberg Krankenhaus der Regelversorgung 102<br />
36 <strong>Asklepios</strong> Weserberglandklinik Höxter Fachklinik für Neurologische u. Orthopädische Rehabilitation, Neuromuskuläres Therapiezentrum 250<br />
37 <strong>Asklepios</strong> Südpfalzklinik Kandel Krankenhaus der Regelversorgung 188<br />
38 <strong>Asklepios</strong> Klinik Langen Krankenhaus der Regelversorgung 273<br />
39 <strong>Asklepios</strong> Klinik Lich Krankenhaus der Regelversorgung 242<br />
40 <strong>Asklepios</strong> Klinik Lindau Krankenhaus der Regelversorgung 115<br />
41 <strong>Asklepios</strong> Orthopädische Klinik Lindenlohe Fachkrankenhaus für Orthopädie 132<br />
42 <strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Lübben Zentrum für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie 215<br />
43 <strong>Asklepios</strong> Schwalm-Eder Klinikum Melsungen Krankenhaus der Grund-und Regelversorgung 76<br />
44 <strong>Asklepios</strong> Fachkliniken München-Gauting Fachkrankenhaus für Pneumologie und Thoraxchirurgie 300<br />
45 MB Collm Klinik Oschatz Krankenhaus der Regelversorgung 240<br />
46 <strong>Asklepios</strong> Klinik Parchim Krankenhaus der Regelversorgung 140<br />
47 <strong>Asklepios</strong> Klinik Pasewalk Krankenhaus der Regelversorgung 325<br />
48 <strong>Asklepios</strong>-ASB Klinik Radeberg Krankenhaus der Regelversorgung 143<br />
49 <strong>Asklepios</strong> Klinik Sankt Augustin Krankenhaus der Maximalversorgung in der Kinder- und Jugendmedizin 210<br />
50 <strong>Asklepios</strong> Klinik Schaufling Rehabilitationszentrum für Neurologie, Orthopädie, Kardiologie und Geriatrie 350<br />
51 <strong>Asklepios</strong> Schwalm-Eder Klinikum Schwalmstadt Krankenhaus der Regelversorgung 192<br />
52 Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz Krankenhaus der Regelversorgung 200<br />
53 <strong>Asklepios</strong> Klinik Schildautal Seesen (Krankenhaus) Fachkrankenhaus für Neurochirurgie, Neurologie und Gefäßchirurgie 375<br />
54 <strong>Asklepios</strong> Kliniken Schildautal Seesen (Rehabilitation) Fachklinik für Neurologische Rehabilitation und Frührehabilitation 160<br />
55 <strong>Asklepios</strong> Klinik Seligenstadt Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung 133<br />
56 <strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Stadtroda Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Neurologie und KJP, Forensische Psychiatrie 466<br />
57 <strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Teupitz Zentrum für Neurologie und Psychiatrie, Forensische Psychiatrie 216<br />
58 <strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Tiefenbrunn Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin 176<br />
59 <strong>Asklepios</strong> Klinik Triberg Fachklinik für Onkologie 140<br />
60 <strong>Asklepios</strong> Klinikum Uckermark, Schwedt Krankenhaus der Schwerpunktversorgung 507<br />
61 M Salus Fachkrankenhaus Uchtspringe Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie, Forensische Psychiatrie 640<br />
62 <strong>Asklepios</strong> Klinik Weißenfels Krankenhaus der Regelversorgung 355<br />
63 <strong>Asklepios</strong> Nordseeklinik Westerland/Sylt (Krankenhaus) Krankenhaus der Regelversorgung 128<br />
64 <strong>Asklepios</strong> Nordseeklinik Westerland/Sylt (Rehabilitation) Fachklinik für Pneumologie, Dermatologie und Onkologie 290<br />
65 <strong>Asklepios</strong> Paulinen Klinik Wiesbaden Krankenhaus der Regelversorgung 331<br />
66 <strong>Asklepios</strong> Fachklinikum Wiesen Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie 173<br />
Weitere soziale Einrichtungen in Deutschland Betten/Plätze<br />
67 <strong>Asklepios</strong> Pflegeheim Ahrensburg 83<br />
68 <strong>Asklepios</strong> Kurstift Bad Kreuznach 82<br />
69 M Salus Heim Gardelegen 39<br />
70 M Salus Intensiv Betreutes Wohnen Gardelegen 34<br />
71 <strong>Asklepios</strong> Pflegeheim Weserblick Höxter 34<br />
72 M Salus Pflegeheim St. Georgii I, Magdeburg 109<br />
73 M Salus Pflegeheim St. Georgii II, Magdeburg 48<br />
74 M Salus Kinder- und Jugendheim Schloss Pretzsch 121<br />
75 <strong>Asklepios</strong> Pflegeheim Reinfeld 87<br />
76 M Salus Heim zur U-Haftvermeidung Torgau 14<br />
77 M Salus Altenpflegeheim Uchtspringe 50<br />
78 M Salus Heim Uchtspringe 117<br />
79 M Salus Soziotherapeutische Wohngemeinschaft Uchtspringe 11<br />
80 M Salus Kinder- und Jugend-Landhof Woltersdorf 6<br />
81 Drogenambulanz I Altona<br />
82 Drogenambulanz II Wandsbek<br />
83 Drogenambulanz III Harburg<br />
84 Drogenambulanz IV Högerdamm<br />
835<br />
Forensische Psychiatrie Betten/Plätze<br />
85 <strong>Asklepios</strong> Klinikum Brandenburg 101<br />
86 <strong>Asklepios</strong> Forensische Psychiatrie Göttingen 63<br />
87 <strong>Asklepios</strong> Klinik für Forensische Psychiatrie Stadtroda 80<br />
88 <strong>Asklepios</strong> Klinik Teupitz 20<br />
89 <strong>Asklepios</strong> Klinik für Forensische Psychiatrie Hamburg Campus Ochsenzoll 178<br />
90 M Salus Klinik für Forensische Psychiatrie Bernburg 137<br />
91 M Salus Klinik für Forensische Psychiatrie Uchtspringe 290<br />
869<br />
92 B<br />
Kliniken im Ausland<br />
Athens Medical Center Athens Medical Group, Griechenland<br />
93 B Interbalkan European Medical Center, Athen, Athens Medical Group, Griechenland<br />
94 B Athens Pediatric Center Athens Medical Group, Griechenland<br />
95 B Psycho Clinic, Athen, Athens Medical Group, Griechenland<br />
96 B P. Faliro Clinic, Athen, Athens Medical Group, Griechenland<br />
97 B Dafni Klinik, Athen, Athens Medical Group, Griechenland<br />
98 B Iasis Piraeus, Athen, Athens Medical Group, Griechenland<br />
99 B Peristeri Clinic, Athen, Athens Medical Group, Griechenland<br />
Die hier genannten Einrichtungen werden ergänzt durch Tageskliniken, Ambulanzen und Pflegedienste.<br />
70 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 <strong>Asklepios</strong> intern 43/2010 71<br />
Legende<br />
Akutkliniken<br />
Rehakliniken<br />
Soziale Einrichtung<br />
Trägerschaft bzw. Mehrheitsbeteiligung<br />
M Managementvertrag<br />
B Minderheitsbeteiligung<br />
MB Minderheitsbeteiligung mit Managementvertrag<br />
19.014<br />
1.130
weil 3D-Bilder vom<br />
schlagenden Herzen die<br />
bessere Perspektive sind.<br />
Je mehr Informationen der Ultraschall liefert, desto vielseitiger werden seine Einsatzmöglichkeiten.<br />
Deshalb haben wir die Technologie Live 3D TEE entwickelt. Mit ihr kann das Ultraschallsystem iE33 transösophageale<br />
Live-3D-Bilder vom schlagenden Herzen liefern.<br />
Ganz neue Perspektiven entstehen. Mehr Informationen unter<br />
www.philips.de/healthcare<br />
222093_AZ_<strong>Asklepios</strong>210x148.indd 1 12.02.10 13:56<br />
Adresse<br />
<strong>Asklepios</strong> Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH<br />
Hubertusstraße 12-22<br />
16547 Birkenwerder<br />
www.asklepios.com<br />
Gemeinsam für Gesundheit