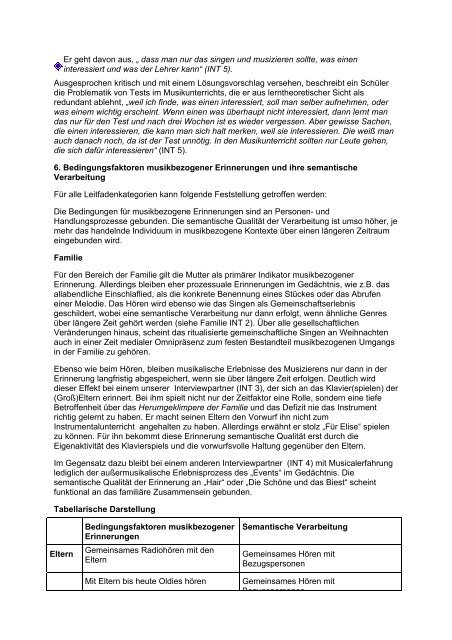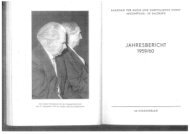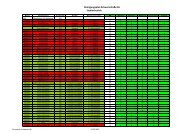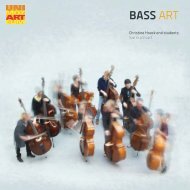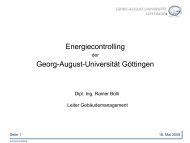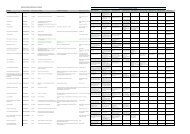Systematische Musikpädagogik - Mozarteum
Systematische Musikpädagogik - Mozarteum
Systematische Musikpädagogik - Mozarteum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Er geht davon aus, „ dass man nur das singen und musizieren sollte, was einen<br />
interessiert und was der Lehrer kann“ (INT 5).<br />
Ausgesprochen kritisch und mit einem Lösungsvorschlag versehen, beschreibt ein Schüler<br />
die Problematik von Tests im Musikunterrichts, die er aus lerntheoretischer Sicht als<br />
redundant ablehnt, „weil ich finde, was einen interessiert, soll man selber aufnehmen, oder<br />
was einem wichtig erscheint. Wenn einen was überhaupt nicht interessiert, dann lernt man<br />
das nur für den Test und nach drei Wochen ist es wieder vergessen. Aber gewisse Sachen,<br />
die einen interessieren, die kann man sich halt merken, weil sie interessieren. Die weiß man<br />
auch danach noch, da ist der Test unnötig. In den Musikunterricht sollten nur Leute gehen,<br />
die sich dafür interessieren“ (INT 5).<br />
6. Bedingungsfaktoren musikbezogener Erinnerungen und ihre semantische<br />
Verarbeitung<br />
Für alle Leitfadenkategorien kann folgende Feststellung getroffen werden:<br />
Die Bedingungen für musikbezogene Erinnerungen sind an Personen- und<br />
Handlungsprozesse gebunden. Die semantische Qualität der Verarbeitung ist umso höher, je<br />
mehr das handelnde Individuum in musikbezogene Kontexte über einen längeren Zeitraum<br />
eingebunden wird.<br />
Familie<br />
Für den Bereich der Familie gilt die Mutter als primärer Indikator musikbezogener<br />
Erinnerung. Allerdings bleiben eher prozessuale Erinnerungen im Gedächtnis, wie z.B. das<br />
allabendliche Einschlaflied, als die konkrete Benennung eines Stückes oder das Abrufen<br />
einer Melodie. Das Hören wird ebenso wie das Singen als Gemeinschaftserlebnis<br />
geschildert, wobei eine semantische Verarbeitung nur dann erfolgt, wenn ähnliche Genres<br />
über längere Zeit gehört werden (siehe Familie INT 2). Über alle gesellschaftlichen<br />
Veränderungen hinaus, scheint das ritualisierte gemeinschaftliche Singen an Weihnachten<br />
auch in einer Zeit medialer Omnipräsenz zum festen Bestandteil musikbezogenen Umgangs<br />
in der Familie zu gehören.<br />
Ebenso wie beim Hören, bleiben musikalische Erlebnisse des Musizierens nur dann in der<br />
Erinnerung langfristig abgespeichert, wenn sie über längere Zeit erfolgen. Deutlich wird<br />
dieser Effekt bei einem unserer Interviewpartner (INT 3), der sich an das Klavier(spielen) der<br />
(Groß)Eltern erinnert. Bei ihm spielt nicht nur der Zeitfaktor eine Rolle, sondern eine tiefe<br />
Betroffenheit über das Herumgeklimpere der Familie und das Defizit nie das Instrument<br />
richtig gelernt zu haben. Er macht seinen Eltern den Vorwurf ihn nicht zum<br />
Instrumentalunterricht angehalten zu haben. Allerdings erwähnt er stolz „Für Elise“ spielen<br />
zu können. Für ihn bekommt diese Erinnerung semantische Qualität erst durch die<br />
Eigenaktivität des Klavierspiels und die vorwurfsvolle Haltung gegenüber den Eltern.<br />
Im Gegensatz dazu bleibt bei einem anderen Interviewpartner (INT 4) mit Musicalerfahrung<br />
lediglich der außermusikalische Erlebnisprozess des „Events“ im Gedächtnis. Die<br />
semantische Qualität der Erinnerung an „Hair“ oder „Die Schöne und das Biest“ scheint<br />
funktional an das familiäre Zusammensein gebunden.<br />
Tabellarische Darstellung<br />
Eltern<br />
Bedingungsfaktoren musikbezogener<br />
Erinnerungen<br />
Gemeinsames Radiohören mit den<br />
Eltern<br />
Semantische Verarbeitung<br />
Gemeinsames Hören mit<br />
Bezugspersonen<br />
Mit Eltern bis heute Oldies hören Gemeinsames Hören mit<br />
Bezugspersonen