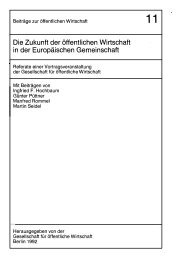Download - Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen
Download - Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen
Download - Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kontrolle öffentlicher Unternehmen dienen. Soweit dies unstrittig ist, stellt<br />
sich doch die Frage, wer Steuerungssubjekt und -objekt ist, wer also wen<br />
steuert. Soll der PCGK die Steuerung der Geschäftsführung durch den<br />
Aufsichtsrat stützen, oder die Steuerung des Aufsichtsrates durch die<br />
Verwaltung und Politik, oder gar den öffentlichen Gesamtkonzern durch<br />
den Bürger? Daraus ergeben sich die weiteren Inhalte des PCGK wie<br />
Pflichten der Akteure, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sowie<br />
deren Ausgleich. Es zeigt sich an dieser Stelle die Komplexität multipler<br />
Verantwortungsverhältnisse und mehrfacher Prinzipal-Agenten-Probleme<br />
im öffentlichen Sektor. 21 Explizites Ziel eines PCGK sollte es sein,<br />
die Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen und möglicher<br />
Spannungsfelder adäquat zu berücksichtigen und auf einen Ausgleich<br />
abzuzielen.<br />
Die Frage des Zwecks eines PCGK ist vom bereits angesprochenen<br />
Zweck des Unternehmens zu unterscheiden. Relevant ist hier vielmehr,<br />
was die öffentliche Hand mit dem PCGK erreichen will, wo also das zu<br />
lösende Problem in der Beteiligungssteuerung liegt. Das können z.B.<br />
typische Probleme wie Steuerungsdefizite in Hinblick auf den politischen<br />
Auftrag, fehlende Transparenz, Besetzung der Aufsichtsorgane oder<br />
auch jüngst verstärkt in den Fokus gerückte Fragen der Risikokontrolle<br />
sein. Erst wenn dieser Zweck bestimmt ist, können weitere Fragen nach<br />
Inhalten, Formalisierung und Einführungsprozess beantwortet werden.<br />
PCGK versuchen, Steuerungsbeziehungen zu formalisieren. Dabei besteht<br />
die Gefahr, die meist bereits bestehenden Beteiligungsrichtlinien<br />
lediglich zu wiederholen. Wichtiger noch als die bloße Wiedergabe von<br />
Rechten und Pflichten der Akteure sind dabei jedoch die Bestimmung<br />
des öffentlichen Zwecks der Beteiligung sowie Fragen der Operationalisierbarkeit<br />
und strategischen Steuerung. Interessenkonflikte und der<br />
Umgang damit sollten neben Verhaltensstandards der Akteure ebenfalls<br />
aufgenommen werden. Gerade entscheidende Punkte wie die erforderlichen<br />
fachlichen und sozialen Kompetenzen sowie die Integrität der<br />
Akteure wurden in der Vergangenheit häufig nicht ausreichend angesprochen<br />
bzw. als gegeben vorausgesetzt.<br />
Schließlich bemisst sich die Qualität der PCGK auch nach der Prozessdimension.<br />
Hierunter sind sowohl der Prozess der Erarbeitung, der Umsetzung<br />
sowie einer kontinuierlichen kritischen Evaluation in Hinblick auf<br />
Implementationsdefizite und Verbesserungsmöglichkeiten zu verstehen.<br />
In der klassischen Praxis wurden Beteiligungsrichtlinien top down durch<br />
21 Vgl. Henke u.a. (2005), S. 32.<br />
11