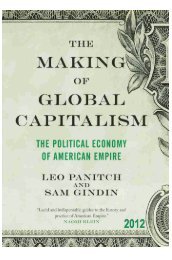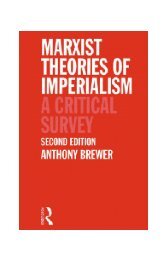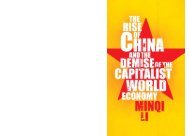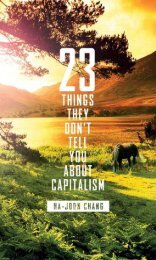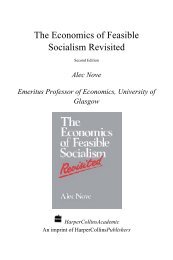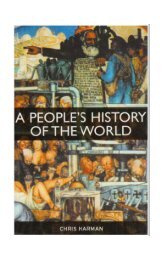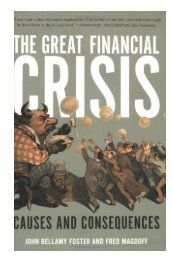Demokratie- theorien
Demokratie- theorien
Demokratie- theorien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
58<br />
Bändigung staatlicher Gewalten durch Recht, Gesetz und Legitimationspflicht<br />
Zwei Werke ragen in demokratietheoretischer Hinsicht heraus: die Staatstheorie<br />
von John Locke (1632-1704), insbesondere die Two Treatises of Government (1690),<br />
die Zwei Abhartdlungen zur Regierung, und die Gewaltenteilungslehre Montesquieus<br />
(1689-1755), von der das nächste Kapitel handelt.<br />
Mit Zwei Abhandlungen zur Regierung legt Locke das Fundament einer weltlich<br />
legitimierten, antiabsolutistischen Staatsverfassung. Die dort entfaltete Lehre<br />
von der rechtmäßigen, nicht-absolutistischen Staatsverfassung kleidet er in die<br />
Sprache der naturrechtlich, eigentumsrechtlich und konstitutionalistisch begründeten<br />
Lehre der legitimen Herrschaft über grundsätzlich freie, gleiche Staatsbürger.<br />
Locke kritisiert die absolutistische Monarchie radikal im Unterschied zu<br />
Hobbes. In diese Kritik und Lockes Lehre von der rechten Herrschaft gehen nicht<br />
nur politische Überzeugungen ein, sondern auch religiös tief verankerte. Sie wurzeln<br />
in der Auffassung, die Menschen seien Geschöpfe Gottes (Cranston 1985:<br />
210). Nicht minder einflussreich ist Lockes konfessionelle Bindung. Er gehört zu<br />
einer Partei, die in England einen katholischen Thronfolger, obendrein einen mit<br />
absolutistischen Neigungen, mit allen Mitteln zu verhindern sucht. Das ist angesichts<br />
der anstehenden Thronfolge des zum Katholizismus konvertierten Bruders<br />
von König Karl Il. eine reale Gefahr. Auch sie gehört zum Kontext der Zwei Abhandlungen<br />
zur Regierung. Diese sind nicht nur eine "systematische Absage an den<br />
Absolutismus", sondern auch eine "politische Streitschrift" (Schwaabe 2007a:<br />
152). Sie richtet sich gegen den drohenden Absolutismus des Königshauses der<br />
Stuarts und soll, so die Hoffnung ihres Auftraggebers, des Grafen von Shaftesbury,<br />
zur Abwehr einer katholischen Thronfolge in England dienen.<br />
Von der Kritik der absoluten Monarchie und vom Entwurf einer freieren<br />
Staatsverfassung handelt ein Großteil der Zwei Abhandlungen zur Regierung. Die<br />
erste Abhandlung hinterfragt die Rechtfertigung der absoluten Monarchie. Ihr<br />
Objekt der Kritik ist allerdings nicht Hobbes, sondern vielmehr Robert Filmers<br />
Patriarcha, or the Natural Power of Kings (1680), das "Flaggschiff des Royalismus im<br />
17. Jahrhundert" (Goldie 1985: 313). Filmers patriarchalische Staatslehre hatte das<br />
Königtum aus der Herrschaftsgewalt abgeleitet, die Gott Adam gegeben habe,<br />
und in der absoluten Monarchie die einzig legitime Herrschaftsordnung gesehen.<br />
Filmers Patriarcha spiegelte den PatriarchaUsmus der damaligen Agrargesellschaft<br />
wider, deckte sich mit der staatskirchlichen Orthodoxie, sprach aus, was<br />
das Volk gerne hörte, und wurde vom Hof und von den Königstreuen hoch geschätzt.<br />
Die Konstruktion des Naturzustandes aber, mit der Denker wie Thomas<br />
Hobbes und nun auch John Locke argumentierten, war für den PatriarchaUsmus<br />
Filmers Teufelszeug.<br />
Von Hobbes' De1YWkratiekritik zu<br />
Filmers Lehre kam auch der anglikanischen Staatskirche gelegen. Zudem<br />
war sie politisch einflussreich. Wer sie kritisierte, riskierte einiges. Die Königstreuen<br />
zu Lockes Zeiten beriefen sich weitgehend auf Filmers Begründung monarchischer<br />
Herrschaft aus dem "divine right of kings", dem göttlichen Recht der<br />
Könige. Locke aber verwarf Filmers Ableitung politischer Prinzipien aus der<br />
Heiligen Schrift. Insoweit folgte er Hobbes' Spuren. Der Lehrmeinun& wonach<br />
der Herrscher von Gott legitimiert sei, versagte er ebenso seine Zustimmung wie<br />
der Auffassung, die patriarchalische Familie sei ein auch für die Politik geeignetes<br />
Muster.<br />
Das bereitet den Boden für die Zweite Abhandlung über die Regierung. Sie wird<br />
die "Hauptschrift des Anti-Absolutismus" (Brandt 2008: 312). In ihr entwirft<br />
Locke, weit über den Auftrag einer Kampfschrift gegen die katholische Thronfolge<br />
hinausgehend, eine naturrechtlich fundierte Gesellschafts- und Staatstheorie,<br />
die viele jener Grundsätze des späteren Liberalismus andenkt, die in der Geschichte<br />
der <strong>Demokratie</strong> und der <strong>Demokratie</strong>theorie einflussreich werden sollten,<br />
die natürliche Freiheit und Gleichheit des Menschen beispielsweise und das<br />
Recht jedes Einzelnen auf Eigentum. Darunter versteht Locke im engeren Sinne<br />
Besitz an materiellen Gütern und im weiteren Sinn "Lives, Liberties, and Estates"<br />
(Two Treatises of Government li, § 123), also Leben, Freiheit und Vermögen (Schochet<br />
2000). Hinzu kommen die religiöse Toleranz, die Suprematie der Gesellschaft<br />
über das Politische, sodann die Herrschaft des Rechts, ferner die Gewaltentrennung<br />
zwischen Legislative und Exekutive, weiterhin das Widerstandsrecht<br />
der Bürger gegen jede unrechtmäßige Regierung und überdies das Regieren mit<br />
eng begrenztem Staatszweck und begrenzten Machtmitteln der öffentlichen Gewalt,<br />
und zwar auf der Basis der Zustimmung des Staatsvolkes ("government by<br />
consent"). Dadurch wird Locke "einer der Väter der Gewaltenteilungslehre"<br />
(Ottmann 2006: 361) und ein Vorkämpfer der Lehre von der Volkssouveränität<br />
(Euchner 2004), obwohl er diese Begriffe nicht gebraucht.<br />
Locke zufolge besitzt der Mensch im Naturzustand das Recht auf Leben, Freiheit<br />
und Besitz und ist berechtigt, dieses mit Gewalt zu verteidigen. Dementsprechend<br />
ist der eigentliche Zweck des Gemeinwesens, das die freien Bürger per Gesellschaftsvertrag<br />
gründen, vorrangig der Schutz des Eigentums im oben erwähnten<br />
dreifachen Sinne von Leben, Freiheit und Besitz. Ein radikaler Bruch in der<br />
Lehre legitimer Herrschaft und in der Bestimmung der Zwecke des Gemeinwesens!<br />
Nicht mehr um Verbesserung oder Erlösung der Seelen geht es in Lockes Staatstheorie.<br />
Nicht auf Bestrafung von Laster oder Sünde zielt sie oder darauf, Wahrheiten<br />
zu propagieren oder die Herrschaftsgewalt durch göttlichen Auftrag zu legitimieren.<br />
Vielmehr rückt Lockes Staatstheorie den Rechtsanspruch der Bürger auf Schutz