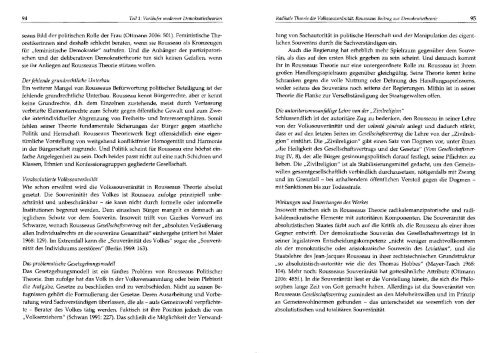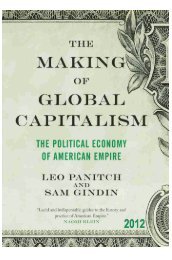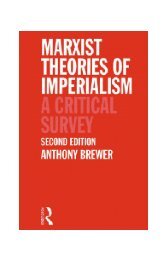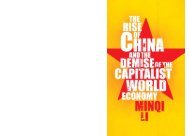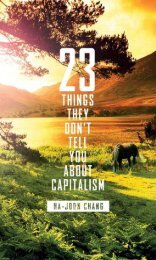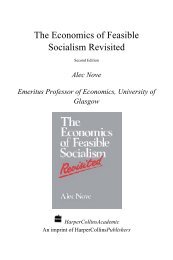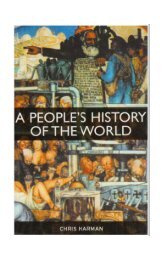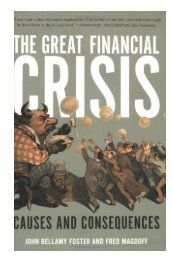Demokratie- theorien
Demokratie- theorien
Demokratie- theorien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
94<br />
seaus Bild der politischen Rolle der Frau (Ottmann 2006: 501). Feministische Theoretikerinnen<br />
sind deshalb schlecht beraten, wenn sie Rousseau als Kronzeugen<br />
für "feministische <strong>Demokratie</strong>" aufrufen. Und die Anhänger der partizipatorischen<br />
und der deliberativen <strong>Demokratie</strong>theorie tun sich keinen Gefallen, wenn<br />
sie ihr Anliegen auf Rousseaus Theorie stützen wollen.<br />
Der fehlende grundrechtliche Unterbau<br />
Ein weiterer Mangel von Rousseaus Befürwortung politischer Beteiligung ist der<br />
fehlende grundrechtliche Unterbau. Rousseau kennt Bürgerrechte, aber er kennt<br />
keine Grundrechte, d.h. dem Einzelnen zustehende, meist durch Verfassung<br />
verbriefte Elementarrechte zum Schutz gegen öffentliche Gewalt und zum Zwecke<br />
interindividueller Abgrenzung von Freiheits- und Interessensphären. Somit<br />
fehlen seiner Theorie fundamentale Sicherungen der Bürger gegen staatliche<br />
Politik und Herrschaft. Rousseaus Theoriewerk liegt offensichtlich eine eigentümliche<br />
Vorstellung von weitgehend konfliktfreier Homogenität und Harmonie<br />
in der Bürgerschaft zugrunde. Und Politik scheint für Rousseau eine höchst einfache<br />
Angelegenheit zu sein. Doch beides passt nicht auf eine nach Schichten und<br />
Klassen, Ethnien und Konfessionsgruppen gegliederte Gesellschaft.<br />
Verabsolutierte Volkssouveränität<br />
Wie schon erwähnt wird die Volkssouveränität in Rousseaus Theorie absolut<br />
gesetzt. Die Souveränität des Volkes ist Rousseau zufolge prinzipiell unbeschränkt<br />
und unbeschränkbar - sie kann nicht durch formelle oder informelle<br />
Institutionen begrenzt werden. Dem einzelnen Bürger mangelt es demnach an<br />
jeglichem Schutz vor dem Souverän. Insoweit trifft von Gierkes Vorwurf ins<br />
Schwarze, wonach Rousseaus Gesellschaftsvertrag mit der "absoluten Veräußerung<br />
allen Individualrechts an die souveräne Gesamtheit" einhergehe (zitiert bei Maier<br />
1968: 129). Im Extremfall kann die "Souveränität des Volkes" sogar die "Souveränität<br />
des Individuums zerstören" (Berlin 1969: 163).<br />
Das problematische Gesetzgebungsmodell<br />
Das Gesetzgebungsmodell ist ein fünftes Problem von Rousseaus Politischer<br />
Theorie. Ihm zufolge hat das Volk in der Volksversammlung oder beim Plebiszit<br />
die Aufgabe, Gesetze zu beschließen und zu verabschieden. Nicht zu seinen Befugnissen<br />
gehört die Formulierung der Gesetze. Deren Ausarbeitung und Vorberatung<br />
wird Sachverständigen überlassen, die als- aufs Gemeinwohl verpflichtete<br />
Berater des Volkes tätig werden. Faktisch ist ihre Position jedoch die von<br />
"Volkserziehem" (Schwan 1991: 227). Das schließt die Möglichkeit der Verwand-<br />
Radikale Theorie der Volkssouveränität: Rousseaus zur <strong>Demokratie</strong>theorie 95<br />
lung von Sachautorität in politische Herrschaft und der Manipulation des eigentlichen<br />
Souveräns durch die Sachverständigen ein.<br />
Auch die Regierung hat erheblich mehr Spielraum gegenüber dem Souverän,<br />
als dies auf den ersten Blick gegeben zu sein scheint. Und dennoch kommt<br />
ihr in Rousseaus Theorie nur eine untergeordnete Rolle zu. Rousseau ist ihrem<br />
großen Handlungsspielraum gegenüber gleichgültig. Seine Theorie kennt keine<br />
Schranken gegen die volle Nutzung oder Dehnung des Handlungsspielraums,<br />
weder seitens des Souveräns noch seitens der Regierungen. Mithin ist in seiner<br />
Theorie die Flanke zur Verselbständigung der Staatsgewalten offen.<br />
Die autoritarismusanfällige Lehre von der" Zivilreligion"<br />
Schlussendlich ist der autoritäre Zug zu bedenken, den Rousseau in seiner Lehre<br />
von der Volkssouveränität und der volonte generale anlegt und dadurch stärkt,<br />
dass er auf den letzten Seiten im Gesellschaftsvertrag die Lehre von der "Zivilreligion"<br />
einführt. Die "Zivilreligion" gibt einen Satz von Dogmen vor, unter ihnen<br />
"die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrags und der Gesetze" (Vom Gesellschaftsvertrag<br />
IV, 8), der alle Bürger gesinnungspolitisch darauf festlegt, seine Pflichten zu<br />
lieben. Die "Zivilreligion" ist als Stabilisierungsmittel gedacht, um den Gemeinwillen<br />
gesamtgesellschaftlich verbindlich durchzusetzen, nötigenfalls mit Zwang<br />
und im Grenzfall -bei anhaltendem öffentlichen Verstoß gegen die Dogmen<br />
mit Sanktionen bis zur Todesstrafe.<br />
Wirkungen und Bewertungen des Werkes<br />
Insoweit mischen sich in Rousseaus Theorie radikalemanzipatorische und radikaldemokratische<br />
Elemente mit autoritären Komponenten. Die Souveränität des<br />
absolutistischen Staates färbt auch auf die Kritik ab, die Rousseau als einer ihrer<br />
Gegner entwirft. Der demokratische Souverän des Gesellschaftsvertrags ist in<br />
seiner legislativen Entscheidungskompetenz "nicht weniger machtvollkommen<br />
als der monokratische oder aristokratische Souverän des Leviathan", und die<br />
Staatslehre des Jean-Jacques Rousseau in ihrer rechtstechnischen Grundstruktur<br />
"so absolutistisch-autoritär wie die des Thomas Hobbes" (Mayer-Tasch 1968:<br />
104). Mehr noch: Rousseaus Souveränität hat gottesähnliche Attribute (Ottmann<br />
2006: 485f.). In die Souveränität liest er die Vorstellung hinein, die sich die Philosophen<br />
lange Zeit von Gott gemacht haben. Allerdings ist die Souveränität von<br />
Rousseaus Gesellschaftsvertrag zumindest an den Mehrheitswillen und im Prinzip<br />
an Gemeinwohlnormen gebunden - das unterscheidet sie wesentlich von der<br />
absolutistischen und totalitären Souveränität.