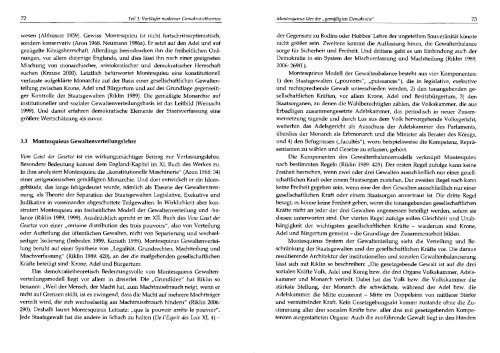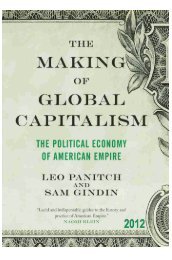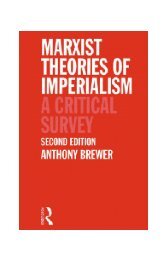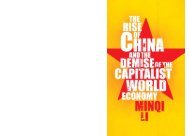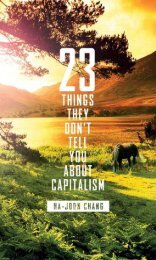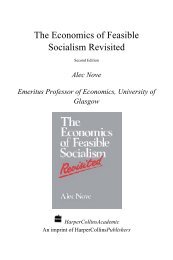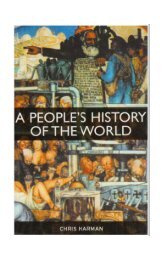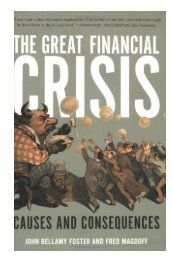Demokratie- theorien
Demokratie- theorien
Demokratie- theorien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
72 Teil1: moderner <strong>Demokratie</strong><strong>theorien</strong><br />
wesen (Althusser 1959). Gewiss: Montesquieu ist nicht fortschrittsoptimistisch,<br />
sondern konservativ (Aron 1968, Neumann 1986a). Er setzt auf den Adel und auf<br />
gezügelte Königsherrschaft Allerdings beeindrucken ihn die freiheitlichen Ordnungen,<br />
vor allem diejenige Englands, und dies lässt ihn nach einer geeigneten<br />
Mischung von monarchischer, aristokratischer und demokratischer Herrschaft<br />
suchen (Krause 2000). Letztlich befürwortet Montesquieu eine konstitutionell<br />
verfasste aufgeklärte Monarchie auf der Basis einer gesellschaftlichen Gewaltenteilung<br />
zwischen Krone, Adel und Bürgertum und auf der Grundlage gegenseitiger<br />
Kontrolle der Staatsgewalten (Riklin 1989). Die gemäßigte Monarchie auf<br />
institutioneller und sozialer Gewaltenverteilungsbasis ist das Leitbild (Weinacht<br />
1999). Und damit erfahren demokratische Elemente der Staatsverfassung eine<br />
größere Wertschätzung als zuvor.<br />
3.3 Montesquieus Gewaltenverteilungslehre<br />
Vom Geist der Gesetze ist ein wirkungsmächtiger Beitrag zur Verfassungslehre.<br />
Besondere Bedeutung kommt dem England-Kapitel im XI. Buch des Werkes zu.<br />
In ihm analysiert Montesquieu die "konstitutionelle Maschinerie" (Aron 1968: 34)<br />
einer zeitgenössischen gemäßigten Monarchie. Und dort entwickelt er ein Ideengebäude,<br />
das lange fehlgedeutet wurde, nämlich als Theorie der Gewaltentrennung,<br />
als Theorie der Separation der Staatsgewalten Legislative, Exekutive und<br />
Judikative in voneinander abgeschottete Teilgewalten. In Wirklichkeit aber konstruiert<br />
Montesquieu ein freiheitliches Modell der Gewaltenverteilung und -balance<br />
(Riklin 1989, 1999). Ausdrücklich spricht er im XII. Buch des Vom Geist der<br />
Gesetze von einer "certaine distributiondes trois pouvoirs", also von Verteilung<br />
oder Aufteilung der öffentlichen Gewalten, nicht von Separierung und wechsel<br />
seitiger Isolierung (Imboden 1959, Korioth 1998). Montesquieus Gewaltenverteilung<br />
beruht auf einer Synthese von "Legalität, Grundrechten, Machtteilung und<br />
Mischverfassung" (Riklin 1989: 420), an der die maßgebenden gesellschaftlichen<br />
Kräfte beteiligt sind: Krone, Adel und Bürgertum.<br />
Das demokratietheoretisch Bedeutungsvolle von Montesquieus Gewaltenverteilungsmodell<br />
liegt vor allem in dreierlei. Die "Grundidee" hat Riklin so<br />
benannt: "Weil der Mensch, der Macht hat, zum Machtmissbrauch neigt, wenn er<br />
nicht auf Grenzen stößt, ist es zwingend, dass die Macht auf mehrere Machtträger<br />
verteilt wird, die sich wechselseitig am Machtmissbrauch hindern" (Riklin 2006:<br />
290). Deshalb lautet Montesquieus Leitsatz: "que le pouvoir arrete le pouvoir".<br />
Jede Staatsgewalt hat die andere in Schach zu halten (De l'Esprit des Loix XI, 4)<br />
Idee der <strong>Demokratie</strong>" 73<br />
der Gegensatz zu Bodins oder Hobbes' Lehre der ungeteilten Souveränität könnte<br />
nicht größer sein. Zweitens kommt die Auffassung hinzu, die Gewaltenbalance<br />
sorge für Sicherheit und Freiheit. Und drittens geht es um Einbindung auch der<br />
<strong>Demokratie</strong> in ein System der Mischverfassung und Machtteilung (Riklin 1989,<br />
2006: 269ff.).<br />
Montesquieus Modell der Gewaltenbalance besteht aus vier Komponenten:<br />
1) den Staatsgewalten ("pouvoirs", "puissances"), die in legislative, exekutive<br />
und rechtsprechende Gewalt unterschieden werden, 2) den tonangebenden ge<br />
sellschaftlichen Kräften, vor allem Krone, Adel und Besitzbürgertum, 3) den<br />
Staatsorganen, zu denen die Wahlberechtigten zählen, die Volkskammer, die aus<br />
Erbadligen zusammengesetzte Adelskammer, das periodisch in neuer Zusammensetzung<br />
tagende und durch Los aus dem Volk hervorgehende Volksgericht,<br />
weiterhin das Adelsgericht als Ausschuss der Adelskammer des Parlaments,<br />
überdies der Monarch als Erbmonarch und die Minister als Berater des Königs,<br />
und 4) den Befugnissen ("facultes"), wozu beispielsweise die Kompetenz, Reprä<br />
sentanten zu wählen und Gesetze zu erlassen, gehört.<br />
Die Komponenten des Gewaltenbalancemodells verknüpft Montesquieu<br />
nach bestimmten Regeln (Riklin 1989: 429). Der ersten Regel zufolge kann keine<br />
Freiheit herrschen, wenn zwei oder drei Gewalten ausschließlich nur einer gesellschaftlichen<br />
Kraft oder einem Staatsorgan zustehen. Der zweiten Regel nach kann<br />
keine Freiheit gegeben sein, wenn eine der drei Gewalten ausschließlich nur einer<br />
gesellschaftlichen Kraft oder einem Staatsorgan anvertraut ist. Die dritte Regel<br />
besagt, es könne keine Freiheit geben, wenn die tonangebenden gesellschaftlichen<br />
Kräfte nicht an jeder der drei Gewalten angemessen beteiligt werden, sofern sie<br />
diesen unterworfen sind. Der vierten Regel zufolge sollen Gleichheit und Unabhängigkeit<br />
der wichtigsten gesellschaftlichen Kräfte - wiederum sind Krone,<br />
Adel und Bürgertum gemeint- die Grundlage der Zusammenarbeit bilden.<br />
Montesquieus System der Gewaltenteilung sieht die Verteilung und Beschränkung<br />
der Staatsgewalten und der gesellschaftlichen Kräfte vor. Die daraus<br />
resultierende Architektur der institutionellen und sozialen Gewaltenbalancierung<br />
lässt sich mit Riklin so beschreiben: "Die gesetzgebende Gewalt ist auf die drei<br />
sozialen Kräfte Volk, Adel und König bzw. die drei Organe Volkskammer, Adelskammer<br />
und Monarch verteilt. Dabei hat das Volk bzw. die Volkskammer die<br />
stärkste Stellung, der Monarch die schwächste, während der Adel bzw. die<br />
Adelskammer die Mitte einnimmt - Mitte im Doppelsinn von mittlerer Stärke<br />
und vermittelnder Kraft. Kein Gesetzgebungsakt kommt zustande ohne die Zu<br />
stimmung aller drei sozialen Kräfte bzw. aller drei mit gesetzgebenden Kompetenzen<br />
ausgestatteten Organe. Auch die ausführende Gewalt liegt in den Händen