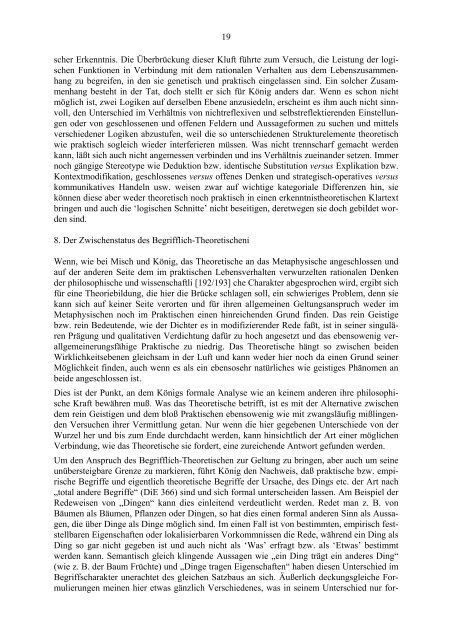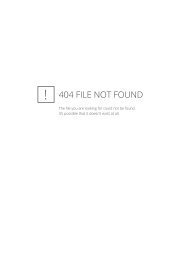Friedrich Kümmel Josef König. Versuch einer Würdigung seines ...
Friedrich Kümmel Josef König. Versuch einer Würdigung seines ...
Friedrich Kümmel Josef König. Versuch einer Würdigung seines ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
19<br />
scher Erkenntnis. Die Überbrückung dieser Kluft führte zum <strong>Versuch</strong>, die Leistung der logischen<br />
Funktionen in Verbindung mit dem rationalen Verhalten aus dem Lebenszusammenhang<br />
zu begreifen, in den sie genetisch und praktisch eingelassen sind. Ein solcher Zusammenhang<br />
besteht in der Tat, doch stellt er sich für <strong>König</strong> anders dar. Wenn es schon nicht<br />
möglich ist, zwei Logiken auf derselben Ebene anzusiedeln, erscheint es ihm auch nicht sinnvoll,<br />
den Unterschied im Verhältnis von nichtreflexiven und selbstreflektierenden Einstellungen<br />
oder von geschlossenen und offenen Feldern und Aussageformen zu suchen und mittels<br />
verschiedener Logiken abzustufen, weil die so unterschiedenen Strukturelemente theoretisch<br />
wie praktisch sogleich wieder interferieren müssen. Was nicht trennscharf gemacht werden<br />
kann, läßt sich auch nicht angemessen verbinden und ins Verhältnis zueinander setzen. Immer<br />
noch gängige Stereotype wie Deduktion bzw. identische Substitution versus Explikation bzw.<br />
Kontextmodifikation, geschlossenes versus offenes Denken und strategisch-operatives versus<br />
kommunikatives Handeln usw. weisen zwar auf wichtige kategoriale Differenzen hin, sie<br />
können diese aber weder theoretisch noch praktisch in einen erkenntnistheoretischen Klartext<br />
bringen und auch die ‘logischen Schnitte’ nicht beseitigen, deretwegen sie doch gebildet worden<br />
sind.<br />
8. Der Zwischenstatus des Begrifflich-Theoretischeni<br />
Wenn, wie bei Misch und <strong>König</strong>, das Theoretische an das Metaphysische angeschlossen und<br />
auf der anderen Seite dem im praktischen Lebensverhalten verwurzelten rationalen Denken<br />
der philosophische und wissenschaftli [192/193] che Charakter abgesprochen wird, ergibt sich<br />
für eine Theoriebildung, die hier die Brücke schlagen soll, ein schwieriges Problem, denn sie<br />
kann sich auf k<strong>einer</strong> Seite verorten und für ihren allgemeinen Geltungsanspruch weder im<br />
Metaphysischen noch im Praktischen einen hinreichenden Grund finden. Das rein Geistige<br />
bzw. rein Bedeutende, wie der Dichter es in modifizierender Rede faßt, ist in s<strong>einer</strong> singulären<br />
Prägung und qualitativen Verdichtung dafür zu hoch angesetzt und das ebensowenig verallgem<strong>einer</strong>ungsfähige<br />
Praktische zu niedrig. Das Theoretische hängt so zwischen beiden<br />
Wirklichkeitsebenen gleichsam in der Luft und kann weder hier noch da einen Grund s<strong>einer</strong><br />
Möglichkeit finden, auch wenn es als ein ebensosehr natürliches wie geistiges Phänomen an<br />
beide angeschlossen ist.<br />
Dies ist der Punkt, an dem <strong>König</strong>s formale Analyse wie an keinem anderen ihre philosophische<br />
Kraft bewähren muß. Was das Theoretische betrifft, ist es mit der Alternative zwischen<br />
dem rein Geistigen und dem bloß Praktischen ebensowenig wie mit zwangsläufig mißlingenden<br />
<strong>Versuch</strong>en ihrer Vermittlung getan. Nur wenn die hier gegebenen Unterschiede von der<br />
Wurzel her und bis zum Ende durchdacht werden, kann hinsichtlich der Art <strong>einer</strong> möglichen<br />
Verbindung, wie das Theoretische sie fordert, eine zureichende Antwort gefunden werden.<br />
Um den Anspruch des Begrifflich-Theoretischen zur Geltung zu bringen, aber auch um seine<br />
unübersteigbare Grenze zu markieren, führt <strong>König</strong> den Nachweis, daß praktische bzw. empirische<br />
Begriffe und eigentlich theoretische Begriffe der Ursache, des Dings etc. der Art nach<br />
„total andere Begriffe“ (DiE 366) sind und sich formal unterscheiden lassen. Am Beispiel der<br />
Redeweisen von „Dingen“ kann dies einleitend verdeutlicht werden. Redet man z. B. von<br />
Bäumen als Bäumen, Pflanzen oder Dingen, so hat dies einen formal anderen Sinn als Aussagen,<br />
die über Dinge als Dinge möglich sind. Im einen Fall ist von bestimmten, empirisch feststellbaren<br />
Eigenschaften oder lokalisierbaren Vorkommnissen die Rede, während ein Ding als<br />
Ding so gar nicht gegeben ist und auch nicht als ‘Was’ erfragt bzw. als ‘Etwas’ bestimmt<br />
werden kann. Semantisch gleich klingende Aussagen wie „ein Ding trägt ein anderes Ding“<br />
(wie z. B. der Baum Früchte) und „Dinge tragen Eigenschaften“ haben diesen Unterschied im<br />
Begriffscharakter unerachtet des gleichen Satzbaus an sich. Äußerlich deckungsgleiche Formulierungen<br />
meinen hier etwas gänzlich Verschiedenes, was in seinem Unterschied nur for-