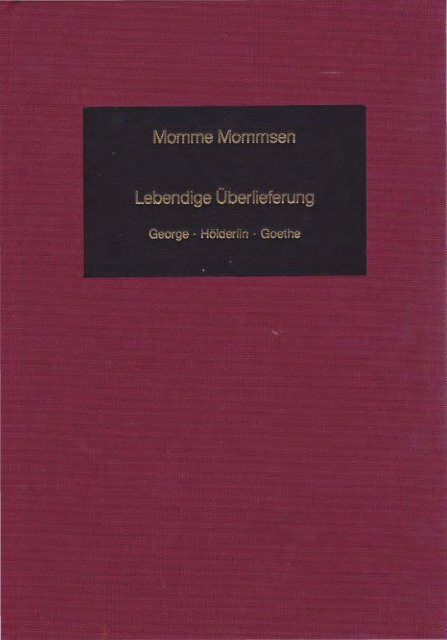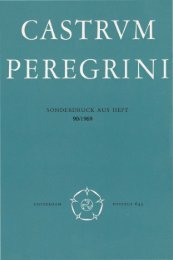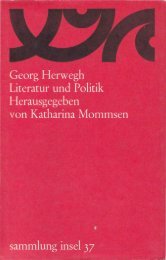Ihr kennt eure Bibel nicht! - von Katharina Mommsen
Ihr kennt eure Bibel nicht! - von Katharina Mommsen
Ihr kennt eure Bibel nicht! - von Katharina Mommsen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Germanie Studi i MOMME MOMMSEN<br />
(Supersedes German Studi i· A )<br />
Founded by Heinrich M y ..<br />
Edited by <strong>Katharina</strong> <strong>Mommsen</strong>, Stanf r I rnia LEBENDIGE UBERLIEFERUNG<br />
No. 69<br />
GEORGE . HÖLDERLIN . GOETHE<br />
PETERLANG<br />
Bem· Berlin· Frankfurt am Main· New York· P rl . Wi n PEIER LANG
Inhalt<br />
Vorwort ...... . ............................. . ........... V<br />
Inhalt .................... . ............................ VII<br />
Abkürzungsverzeichnis ..... . . . ....... . ... . ............. . IX<br />
"<strong>Ihr</strong> <strong>kennt</strong> <strong>eure</strong> <strong>Bibel</strong> <strong>nicht</strong>!" <strong>Bibel</strong>- und Horazanklänge<br />
in Stefan Georges Gedicht DER KRIEG • 1 • ••• •• •• • ••• • ••••• • 1<br />
Der Rhein und das Rheinland<br />
in der Dichtung Stefan Georges ........ . ... . ........... 27<br />
Nostradamus-Anklänge in Stefan Georges TAFELN • • •• .. . . • . .40<br />
Hölderlins Lösung <strong>von</strong> Schiller. Zu Hölderlins Gedichten<br />
AN HERKULES und DIE EICHBÄUME und den Übersetzungen<br />
aus Ovid, Vergil und EUripides . . . . . . . . ... . . . ...... . .... 53<br />
Die Problematik des Priestertums bei Hölderlin .. . ..... . ... 107<br />
Dionysos in der Dichtung Hölderlins<br />
mit besonderer Berücksichtigung der FRIEDENSFEIER • • •• •. • 135<br />
Traditionsbezüge als Geheimschicht in Hölderlins Lyrik.<br />
Zu den Gedichten DIE WEISHEIT DES TRAURERS,<br />
DER WANDERER, FRIEDENSFEIER, BROD UND WEIN • .•. •• .. • ...• 185<br />
Spinoza und die Deutsche Klassik ................. . . . . . . . 217<br />
Goethes Verhältnis zu Christus und Spinoza.<br />
Blick auf die WERTHER-Zeit . . ................... . ...... 275<br />
Goethe als Selbstdarsteller . . . ... . . . ... . . . . . . . . . .. .. . .... 307<br />
"Schwänchen" und "Schwan" im S CHENKENBUCH<br />
des WEST-ÖSTLICHEN DIVAN . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . 343<br />
VII
Goethe und Zelter ...................................... 353<br />
Goethe und Eckermann<br />
................................. 363<br />
Zur ENTSTEHUNG VON GOETHES WERKEN IN DOKUMENTEN ........ 369<br />
Internationales Echo auf DIE ENTSTEHUNG VON<br />
GOETHES WERKEN IN DoKUMENTEN ..................... . . 385<br />
Nachweise der ersten Veröffentlichung ................... 391<br />
Register<br />
VIII<br />
........................................... . .. . 393<br />
EGW<br />
Eis .<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
= Momme <strong>Mommsen</strong> unter Mitwirkung <strong>von</strong> <strong>Katharina</strong> <strong>Mommsen</strong>,<br />
Die Entstehung <strong>von</strong> Goethes Werken in Dokumenten. Bd. I:<br />
Abaldemus bis Byron. Hg. vom Institut für deutsche Sprache und<br />
Literatur der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.<br />
Berlin: Akademie Verlag. 1958. XLIX, 572 S.; Bd. II: Cäcilia bis Dichtung<br />
und Wahrheit. Berlin: Akademie Verlag. 1958. xv, 529 S.<br />
= Winckelmanns sämtliche Werke. Hg. <strong>von</strong> Joseph Eiselein. Bd. 1-12.<br />
Donaueschingen, 1825-1829.<br />
Ethic. = Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. In: Spinoza Opera / Werke<br />
Lateinisch und Deutsch Vier Bände. Hg. <strong>von</strong> Konrad Blumenstock.<br />
Bd. II: Ethica - Ethik [dt. <strong>von</strong> Berthold Auerbachl. Darmstadt 1967.<br />
Grimms Wörterbuch = Deutsches Wörterbuch <strong>von</strong> Jacob Grimm und Wilhelm<br />
Grimm. Bd. 1-16. Leipzig: Verlag <strong>von</strong> S. Hirze!. 1854-1954.<br />
HA = Goethes Werke. HamburgerAusgabein 14 Bänden. Textkritisch durchgesehen<br />
und mit Anmerkungen versehen <strong>von</strong> Erich Trunz. 7. Auf!.<br />
1964.<br />
HFA = Johann Gottfried Herder, Werke in zehn Bänden. Bd. 2 (1993) hg. <strong>von</strong><br />
Gunter E. Grimm und Bd. 4 (1994) hg. <strong>von</strong> Jürgen Brummack und<br />
Martin Bollacher. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag.<br />
1985 ff.<br />
HHA = Heinrich Heine Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke. In<br />
Verbindung mit dem Heinrich-Heine-Institut hg. <strong>von</strong> Manfred Windfuhr<br />
im Auftrage der Landeshauptstadt Düsseldorf. Bde I/I, 1/2, 2,<br />
8/1,8/2. Hamburg: Hoffmannn und Campe Verlag. 1975 ff.<br />
Houben = Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren<br />
seines Lebens. Hg. <strong>von</strong> H. H. Houben. 23. Auf!. Leipzig 1948.<br />
JA = Goethe Sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe in 40 Bdn. In B = Verbindung<br />
mit Konrad Burdach u. a. hg. <strong>von</strong> Eduard <strong>von</strong> der Hellen.<br />
Stuttgart und Berlin: Cotta 1902-1912.<br />
SchrGG = Schriften der Goethe-Gesellschaft. Im Auftrage des Vorstandes hg.<br />
Weimar 1885 ff.<br />
NA<br />
= Schillers Werke. Nationalausgabe. Im Auftrag des Goethe- und Schiller-Archivs,<br />
des Schiller-Nationalmuseums und der Deutschen Akademie<br />
hg. Bd . 1-42. Weimar 1943-1995.<br />
IX
StA = Hölderlin, Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe. Bd. 1-7.<br />
Stuttgart. 1943-1972.<br />
Str. = Strophe<br />
SWS = Johann Gottfried Herder, Sämtliche Werke. Hg. <strong>von</strong> Bernhard Suphan.<br />
Bd.1-33. Berlin.1877-1913.<br />
v. = Vers<br />
WA I = Goethes Werke. Hg. im Auftrage der Großherzogin Sophie <strong>von</strong> Sachsen.<br />
Abth.1. Werke. 55 Bde (in 63). Weimar 1887-1918.<br />
WA 11 = -. Abth. 11. Naturwissenschaftliche Schriften. 13 Bde. Weimar 1890-<br />
1904.<br />
WA III = - . Abth. III. Tagebücher. 15 Bde (in 16). Weimar 1887-1919.<br />
WAIV = -. Abth. IV. Briefe. 53 Bde. Weimar 1887-1990.<br />
Z. = Zeile<br />
x<br />
"<strong>Ihr</strong> <strong>kennt</strong> <strong>eure</strong> <strong>Bibel</strong> <strong>nicht</strong>!"<br />
<strong>Bibel</strong>- und Horazanklänge<br />
in Stefan Georges Gedicht DER KRIEG<br />
Anspielungen auf die <strong>Bibel</strong> häufen sich bei George, seit er um 1907<br />
begann, als Dichter zum politischen Zeitgeschehen zu sprechen.<br />
Wie er allein in einer Welt, die sich für die fortgeschrittenste hielt,<br />
Symptome des Verfalls bemerkte, wie er das unvermeidliche Nahen<br />
<strong>von</strong> Katastrophen sah und die bedrohte Zukunft der Deutchen<br />
- all das rief Erinnerungen an die jüdische Geschichte in ihm<br />
wach, wo so oft die Stimmen einsamer Warner bevorstehendes<br />
politisches Unheil ankündigten. Mit Worten und Wendungen der<br />
<strong>Bibel</strong>, besonders der Propheten des Alten Testaments, verlieh<br />
George dem, was er jetzt zu sagen hattte, verstärkten Nachdruck.<br />
Assoziationen an eine große Menschheitsepoche, absichts voll erweckt,<br />
veranschaulichten Art und Ausmaß der aktuellen Gefahr.<br />
Für die Leser <strong>von</strong> Georges vielfach dunklen politischen Gedichten<br />
ergab sich dadurch eine zusätzliche Schwierigkeit. Bei dem<br />
Rückgang der <strong>Bibel</strong><strong>kennt</strong>nis in neuerer Zeit wurde es immer schwerer,<br />
seine Anspielungen zu bemerken. Im ganzen blieb aber der<br />
Sinn des Textes auch für den <strong>nicht</strong> mit der <strong>Bibel</strong> Vertrauten weitgehend<br />
verständlich. Ein Wahrnehmen der Anspielung bereichert die<br />
Deutung, bedingt sie jedoch <strong>nicht</strong>. Wenn DER KRIEG 1 mit dem Bild<br />
des Waldbrandes auf eindrucksvolle Weise beginnt, so schließt<br />
George sich damit der Einleitung des berühmten Hesekiel-Abschnitts<br />
Kap. 21 und 22 an (auf den wir noch zurückkommen). Das<br />
Waldbrandgleichnis gewinnt durch die Anspielung an Gewicht,<br />
doch ist es auch aus sich selbst zur Genüge verständlich. Wenn<br />
George den Deutschen Untreue gegenüber ihren geistigen Ursprüngen<br />
vorwirft mit der Wendung »die jeweils trünnigen erben« (DER<br />
Stefan George, DAS NEUE REICH. Gesamt-Ausgabe der Werke. Endgültige Fassung.<br />
18 Bde. Berlin: Georg Bondi. 1927-1934. Bd. 9. S. 28-34.<br />
1
schmach« mit inhaltlich ähnlichen Wend ungen der <strong>Bibel</strong> zusammenzubringen,<br />
obwohl sich Möglichkeiten hierfür geradezu<br />
aufdrängen. Naheliegen mußte es denn doch, zu fragen, ob George<br />
mit »Blut-schmach« <strong>nicht</strong> 'Blutschuld' im Sinne hatte. Im<br />
Wesen der Blutschuld liegt es, dass sie selbstverständlich Schmach,<br />
Schande, Befleckung zur Folge hat. Sehr wohl könnte das Wort<br />
»Blut-schmach« eine symbolistische Prägung sein, die diesen inneren<br />
Zusammenhang gedrängt kurz zum Ausdruck bringt. Die<br />
<strong>Bibel</strong> hätte daraufhin befragt werden müssen, ob <strong>nicht</strong> vom Begriff<br />
der Blutschuld her ein Verständnis des Worts »Blutschmach« sich<br />
ergibt und ob Georges Erwähnung der <strong>Bibel</strong> möglicherweise darauf<br />
abzielte. Dies zu unternehmen, wies Morwitz ausdrücklich ab.<br />
Nicht stichhaltig ist wiederum, was er als Begründung anführt:<br />
man dürfe das Wort Blutschuld, das in Psalm 51, v. 14 [richtig v. 16]<br />
vorkomme, <strong>nicht</strong> mit Blutschmach verwechseln. Die Nennung der<br />
einen Stelle führt irre. Das Wort "Blutschuld" erscheint in der <strong>Bibel</strong><br />
<strong>nicht</strong> nur einmal in jenem Psalm, es gehört zu den besonders<br />
häufig vorkommenden Wendungen. 9 Wesentlich ist, dass dabei<br />
wiederholt - wie nur natürlich - der Zusammenhang <strong>von</strong> Blutschuld<br />
mit Schmach zur Sprache kommt. Es heißt dann etwa: Blutschuld<br />
schändet, befleckt, besudelt, verunreinigt, in mannigfachen<br />
Variationen. (Dieser charakteristische Zusammenhang fehlt in dem<br />
<strong>von</strong> Morwitz benannten Psalm 51.)<br />
Unsere Aufgabe ist damit vorgezeichnet. An typischen Beispielen<br />
wird zu zeigen sein, welche Rolle in der <strong>Bibel</strong> Blutschuld spielt,<br />
wie ihre Bewertung und Charakteristik ist. Blutschuld belastet im<br />
Alten Testament oft ein einzelnes Individuum, öfter ein ganzes Volk.<br />
Fälle der zweiten, in den staatlichen Bereich gehörenden Art interessieren<br />
uns im Zusammenhang mit Georges politischem Gedicht<br />
am meisten. Als Vergehen wiegen sie besonders schwer und werden<br />
<strong>von</strong> Jahwe aufs grimmigste bestraft. In der Geschichte <strong>von</strong><br />
Naboths Weinberg (1. Könige 21) hat König Ahab "totgeschlagen,<br />
9 Nur vereinzelt taucht das Wort "Blutschande" auf, an das man auch denken könnte.<br />
Es bedeutet dann aber lediglich Inzest, was in unserm Zusammenhang <strong>nicht</strong><br />
zur Debatte steht. (3. Mos. 20, 17: "das ist eine Blutschande. Die sollen ausgerottet<br />
werden <strong>von</strong> den Leuten des Volks.")<br />
8<br />
I \Zu auch in Besitz genommen"; daher wird der Herr" <strong>von</strong> Ahab<br />
1I r tten, was männlich ist". "Geschlachtet" werden dessen sieb<br />
'" , "hne, "seine Großen, seine Verwandten und seine Priester, bis<br />
ß • uch <strong>nicht</strong> einer übrigblieb" (2. Könige 10). Gott wollte mit<br />
\ r Bestrafung das vergoßene "Blut" rächen. Sollte <strong>nicht</strong> auf<br />
'r/i ferung dieser Art angespielt sein, wenn George <strong>von</strong> 'wahlu<br />
zurottenden Stämmen', wenn er <strong>von</strong> Blutschmach als der<br />
r t n« spricht? Das wäre dem Geist des Alten Testaments grund-<br />
1. 11 h gemäß, während in Vermischung ein Schlimmstes zu se<br />
Il k in swegs biblischen Bluts-Wertungen entspricht.<br />
Wl Befleckung durch Blutschuld ein ärgstes Delikt ist, das<br />
lIun r wieder zur Darstellung gelangt, sollen einige Beispiele ver<br />
,I 1111 h n. Ein Volk wird in jedem Falle durch Blutschuld "geschän<br />
I. ll/, ueh wenn nur einzelne unrecht Blut vergossen:JO<br />
.' hltlldet das Land <strong>nicht</strong>, darin ihr wohnet; denn wer blutschuldig ist, der<br />
h nde! das Land, und das Land kann vom Blut <strong>nicht</strong> versöhnt [enthnl]<br />
werden, das darin vergossen wird, außer durch das Blut des, der<br />
I v 'rgossen hat. Verunreinigt das Land <strong>nicht</strong>, darin ihr wohnet, darin ich<br />
I h wohne.<br />
ht Jahwe im Zusammenhang <strong>von</strong> Weisungen über Behand<br />
Totschlagdelikts (4. Mos. 35, 33). Ähnlich 5. Mos. 19, 10:<br />
I", I luf daß <strong>nicht</strong> unschuldig Blut in deinem Lande vergossen werde, das<br />
11 1 'r H rr, dein Gott, zum Erbe gibt, und Blutschulden auf dich kommen.<br />
I III'm ind es aber die Mordtaten <strong>von</strong> vielen oder der Obrigkeit,<br />
111111 huld über ein Land bringen, es schänden und beflecken:<br />
1 'nn ('ur' Hände si nd mit Blut befleckt und <strong>eure</strong> Finger mit Untugend [ ... ]<br />
<strong>Ihr</strong> · f'UH' 1 ... 1 sind schnell, unschuldig Blut zu vergießen . (Jes. 59, 3-7)<br />
INII h Einno hme Jerusalems ... ] Es ist aber geschehen um der Sünden<br />
wlllt'fl <strong>Ihr</strong> 'r Propheten und um der Missetaten willen ihrer Priester, die<br />
d ill 11\ da ,('rechi eIl Blut vergossen. Sie gingen hin und her auf den Gassen<br />
Wh' dll' Bl inden und wa ren mit Blut besudelt [ ... ] Des Herrn Zorn hat sie<br />
I Ift'III , (Klog·1. J r. 4,13-16)<br />
111 I 11 loIH('nden Ilcrvorh 'bungen durch Kursivdruck <strong>von</strong> M. M.<br />
9
Und sei [ ... ] vergossen unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter<br />
[ ... ] daß das Land mit Blutschulden befleckt ward. (Psalm 106, 38.)<br />
Wenn ihr schon [ ... ] viel betet, höre ich euch doch <strong>nicht</strong>; denn <strong>eure</strong> Hände<br />
sind voll Blut. Waschet, reiniget euch [ ... ] Wie geht das zu, daß die fromme<br />
Stadt zur Hure geworden ist? Sie war voll Rechts. Gerechtigkeit wohnte darin,<br />
nun aber - Mörder [ ... ] Deine Fürsten sind Abtrünnige [ ... ] Mein Volk,<br />
deine Leiter verführen dich [ ... ] Und der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten<br />
seines Volks und mit seinen Fürsten [ ... ] der Raub <strong>von</strong> den Armen ist in<br />
<strong>eure</strong>m Hause [ ... ] Dann wird der Herr den Unflat der Töchter Zions waschen<br />
und die Blutschulden Jerusalems vertreiben <strong>von</strong> ihr durch den Geist, der<br />
richten und ein Feuer anzünden wird. (Jes. Kap. 1-4.)<br />
Gewöhnlich wird die Wehr- und Schuldlosigkeit der Opfer beklagt<br />
bei solchen Mordtaten, dazu die Korruption der Justiz:<br />
Bessert euer Leben und Wesen, daß ihr recht tut einer gegen den andern und<br />
den Fremdlingen, Waisen und Witwen keine Gewalt tut und <strong>nicht</strong> unschuldiges<br />
Blut vergießt. (Jer. 7, 5 f. ähnlich 22, 3.)<br />
Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und töten die Waisen [ ... ] Sie rüsten sich wider<br />
die Seele des Gerechten und verdammenunschuldig Blut. (Psalm 94, 6, 21.)<br />
Die frommen Leute sind weg in diesem Lande, und die Gerechten sind <strong>nicht</strong><br />
mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut; ein jeglicher jagt den andern,<br />
daß er ihn verderbe, und meinen, sie tun wohl daran, wenn sie Böses tun.<br />
Was der Fürst will, das spricht der Richter [ ... ] Die Gewaltigen raten nach ihrem<br />
Mutwillen, Schaden zu tun, und drehen's, wie sie es wollen. (Micha 7, 2 ff.)<br />
Im Evangelium zum Stephans-Tag (Neues Testament) heißt es:<br />
Auf daß über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden<br />
[ ... ] Wahrlich, ich sage euch, daß solches alles wird über dies Geschlecht kommen.<br />
(Matth. 23, 35. Apostelgesch. 6, 8 ff.)<br />
Meist fehlt <strong>nicht</strong> der Hinweis, daß göttliche Bestrafung das mit<br />
Blutschuld behaftete Volk heimsuchen wird.<br />
10<br />
Es ist noch um eine kleine Zeit, so will ich die Blutschulden in Israel heimsuchen<br />
. (Hos. 1, 4.)<br />
Erwürget alles tot [ ... ] Es ist eitel Blutschuld im Lande und Unrecht in der<br />
Stadt [ ... ] Darum soll mein Auge auch <strong>nicht</strong> schonen, ich will auch <strong>nicht</strong><br />
gnädig sein, sondern will ihr Tun auf ihren Kopf werfen. (Hes. 9, 6-9.)<br />
Mord n, St hl n und Eh brechen hat überhandgenommen, und eine Blutschuld<br />
kommt nach der andern . Darum wird das Land jämmerlich stehen, und<br />
allen Einwohnern wird's übel gehen [ ... ] Mein Volk ist dahin, darum daß es<br />
<strong>nicht</strong> lernen will. (Hos. 4, 2-6.)<br />
Vergießt <strong>nicht</strong> unschuldig Blut [ ... ] Werdet ihr solchem <strong>nicht</strong> gehorchen, so<br />
habe ich bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dies Haus soll verstört<br />
werden. (Jer. 22, 3-5.)<br />
Das Land ist voll Blutschulden und die Stadt voll Frevels [ ... ] Der Ausrotter<br />
kommt. (Hes. 7, 25.)<br />
Das Wort "ausrotten" erscheint in ähnlichem Zusammenhang zahllose<br />
Male, wo das Alte Testament <strong>von</strong> göttlichem Strafgericht über<br />
Mörder, Gottlose, Ungerechte, Verfluchte usw. handelt. So entspricht<br />
auch in Georges Versen die Warnung, Blutschmach werde durch<br />
Ausrottung bestraft, biblischem Wortgebrauch. Eine Hauptstelle,<br />
die Ahndung <strong>von</strong> Blutschuld betreffend, ist Hesekiel Kap. 21 und<br />
22. In diesem besonders ausgedehnten Bericht erscheinen alle<br />
Motive, die wir bisher fanden, dazu auch weitere, die ihrer Ähnlichkeit<br />
wegen mit Stellen in Georges KRIEG beachtet werden mögen.<br />
Im Auszug lassen wir die charakteristischen Themen - hier in der<br />
Übersetzung <strong>von</strong> Menge 11 - erscheinen. Befleckung durch Blutschuld:<br />
Willst du <strong>nicht</strong> der blutbefleckten Stadt das Urteil sprechen? [ .. . ] Wehe der<br />
Stadt, die Blut in ihrer Mitte vergossen hat [ ... ] Durch dein Blut, das du vergossen,<br />
hast du dich mit Schuld beladen, und durch deine Götzen [ ... ] bist<br />
[ ... ] du unrein geworden; du hast die Tage deines Gerichts nahe herangebracht<br />
[ ... ] Darum mache ich dich zum Hohn für die Völker [ ... ] sie werden<br />
dich verspotten, weil dein Ruf befleckt ist.<br />
Ungerechtigkeit herrscht, die Opfer sind wehrlose Bürger:<br />
Die Fürsten Israels [ ... ] sind [ ... ] beflissen gewesen, Blut zu vergießen. Vater<br />
und Mutter verachtet man in dir, den Fremdling behandelt man gewalttätig<br />
[ ... ] Waisen und Witwen bedrückt man [ ... ] Verleumder weilen in dir, die auf<br />
Blutvergießen ausgehen. [Aufzählung fernerer Vergehen wie Unzucht, Ehebruch,<br />
Inzest .. . ] Bestechungsgeschenke nimmt man in dir an, um Blut zu<br />
vergießen [ ... ] Ich schlage meine Hände zusammen [ ... ] über deine Bluttaten.<br />
11 Die Heilige Schrift übersetzt und neu bearbeitet <strong>von</strong> Hermann Menge. Zitate nach<br />
dem Neudruck der 12. Aufl.: Evangelische Haupt-<strong>Bibel</strong>gesellschaft zu Berlin, 1960.<br />
Von der Menge-<strong>Bibel</strong> erschien das N. T. 1909, das A. T. 1926.<br />
11
<strong>Ihr</strong>e Fürsten sind [ ... ] beutegierige Wölfe: sie gehen darauf aus, Blut zu vergießen<br />
und Menschenleben zu ver<strong>nicht</strong>en, um Gewinn zu erraffen [ ... ] Das Volk<br />
im Lande verübt Gewalttätigkeit und begeht Raub, bedrückt die Armen und<br />
Elenden und übervorteilt die Fremdlinge gegen alles Recht.<br />
Ausrottung mit Feuer und Schwert, Vertreibung werden die <strong>von</strong><br />
Gott verhängten Strafen sein:<br />
Ich will ein Feuer in dir anzünden, das soll alle saftreichen und alle dürren<br />
Bäume in dir verzehren; die lodernde Flamme soll <strong>nicht</strong> erlöschen, und alle<br />
[ ... ] sollen durch sie versengt werden! [Vgl. in DER KRIEG die Metaphern <strong>von</strong><br />
Waldbrand und "Flammenzeichen".] [ ... ] Ich will mein Schwert aus der Scheide<br />
ziehen und Gerechte wie Gottlose in dir ausrotten! Weil ich beide, Gerechte<br />
wie Gottlose, in dir ausrotten will, darum soll mein Schwert aus der Scheide<br />
fahren gegen alles Fleisch [ ... ] Ich werde dich unter die Völker zerstreuen<br />
und dich in die Länder versprengen und deine Unreinheit gänzlich aus dir<br />
wegschaffen, damit du durch eigene Schuld entehrt vor denAugen der Heidevölker<br />
dastehst.<br />
Wie Jahwes Racheschwert solchen Blutschuld-Frevel bedroht, schildert<br />
Hesekiel ausführlich in zehn Versen (dem "Schwertlied"), zu<br />
Beginn der ganzen Partie. Das läßt daran denken, wie die Blutschmach-Stelle<br />
bei George eingeleitet ist durch den Abruf: »Die ihr<br />
die fuchtel schwingt auf leichenschwaden«. (Fuchtel: breiter Degen<br />
als Symbol ausgeübter Zucht.) Innerhalb dieses "Schwertliedes"<br />
heißt es:<br />
Das Schwert, ja, das Schwert ist geschärft [ ... ] daß man's dem Totschläger in<br />
die Hand gebe. Schreie und heule, du Menschenkind; denn es geht über mein<br />
Volk und über alle Regenten in Israel, die dem Schwert samt meinem Volk<br />
verfallen sind [ ... ] denn das Schwert wird zweifach, ja dreifach kommen, ein<br />
Würgeschwert, ein Schwert großer Schlacht, das sie auch treffen wird in den<br />
Kammern, dahin sie fliehen. Ich will das Schwert lassen klingen, daß die<br />
Herzen verzagen und viele fallen sollen an allen ihren Toren. Ach, wie glänzt<br />
es und haut daher zur Schlacht! Haue drein, zur Rechten und zur Linken,<br />
was vor dir ist!<br />
Das bisher Betrachtete lehrt uns soviel: Während die <strong>von</strong> Morwitz<br />
angeführte Geschichte vom Einfluß fremdländischer Frauen einen<br />
besonderen Fall darstellt, das Wort »Blutschmach« darin <strong>nicht</strong> vorkommt,<br />
gibt es eine überwältigende Fülle <strong>von</strong> <strong>Bibel</strong>stellen, die <strong>von</strong><br />
12<br />
Befleckung durch Blutschuld expressis verbis sprechen. Durch Blutschuld<br />
befleckt und deswegen gestraft wird ein Volk, wenn es<br />
Mordtaten im eigenen Lande, Gewalttätigkeit an wehrlosen Mitbürgern<br />
verübt, wie dies Tyrannei, innerer Zwist, Bürgerkriege und<br />
dergleichen mit sich bringen können. Geht man Georges Verweis<br />
auf die <strong>Bibel</strong> ernstlich nach, so wird sich für sein Wort <strong>von</strong> der<br />
»Blut-schmach« dieser Bedeutungsbereich eröffnen.<br />
Ungefähre Übereinstimmung mit biblischen Vorstellungen zeigen<br />
Georges Verse noch insofern, als sie innerhalb der verschuldeten<br />
Gesamtheit eine Gruppe der Besseren unterscheiden, bezeichnet<br />
als deren »bestes gut«. Im Alten Testament wird oft, wo <strong>von</strong><br />
göttlicher Vergeltung die Rede ist, die Unterscheidung <strong>von</strong> Guten<br />
und Schlechten, Gerechten und Ungerechten, Gottgetreuen und<br />
Gottlosen in Betracht gezogen:<br />
Und soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, daß zwei Teile<br />
darin sollenausgerottet werden und untergehen, und der dritte Teil soll darin<br />
übrigbleiben. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer führen und läutern,<br />
wie man Silber läutert, und prüfen, wie man Gold prüft. (Sach. 13,8 f.)<br />
Ich will in dir ausrotten beide, Gerechte und Ungerechte. (Hes. 21, 8.)<br />
Denn seine Gesegneten erben das Land; aber seine Verfluchten werden ausgerottet.<br />
(Psalm 37, 22.)<br />
Du hast totgeschlagen, dazu in Besitz genommen [ ... ] ich will [ .. . ] <strong>von</strong>Ahab<br />
ausrotten, was männlich ist. (1. Kön. 21,19 ff.)<br />
Es kommt vor, dass Gott einen Engel beauftragt, die Frommen zu<br />
kennzeichnen, damit sie bei der allgemeinen Ver<strong>nicht</strong>ung verschont<br />
bleiben:<br />
Erwürget Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Weiber, alles tot; aber die<br />
das Zeichen an sich haben, derer sollt ihr keinen anrühren [ ... ] es ist eitel Blutschuld<br />
im Lande und Unrecht in der Stadt [ .. . ] ich will keine Schonung mehr<br />
üben. (Hes. 9, 6-10)<br />
Mehrfach erscheint auch die Gestalt eines großen Fürbitters, der<br />
dil' Begnadigung eines Teils erfleht. Sprichwörtlich geworden ist<br />
Abrahams Eintreten für die fünzig Gerechten, seine Fürbitte für<br />
Sodom:<br />
13
Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es möchten<br />
vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein [ ... ] Das sei ferne <strong>von</strong> dir, daß du<br />
das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen. (1. Mos. 18, 23 ff.)<br />
Wiederholt wird Moses zum Fürbitter. In Psalm 106, wo <strong>von</strong> der<br />
"Befleckung" des Landes durch "Blutschulden" gesprochen wird,<br />
heißt es (v. 23, Menge):<br />
Da gedachte er sie zu vertilgen, wenn <strong>nicht</strong> Mose, seinAuserwählter, mit Fürbitte<br />
vor ihn hingetreten wäre, um seinen Grimm vorn Ver<strong>nicht</strong>en abzuwenden.<br />
An die großen Fürbitter des Alten Testaments erinnert in der <strong>von</strong><br />
»Blutschmach« handelnden Strophe Georges die Wendung: »Wollt<br />
uns bewahren«, deren Form übrigens in der <strong>Bibel</strong>, besonders in<br />
den Psalmen, sprachliche Parallelen hat; z.B. Psalm 12, 8: "Du, Herr,<br />
wollest sie bewahren und uns behüten."<br />
Insofern in den betreffenden <strong>Bibel</strong>berichten die Ungerechten<br />
gewöhnlich die breite Masse bilden, der Gerechten Zahl begrenzt<br />
ist, besteht wirklich eine Übereinstimmung mit Georges Vorstellungen.<br />
Auch das »beste gut« ist offenbar nur ein kleiner Teil des<br />
ganzen verschuldeten Volkes. In der <strong>Bibel</strong> finden sich jedoch keine<br />
Parallelen bezüglich des 5 chi c k s als des kleineren Teils bei George.<br />
In DER KRIEG wird der schuldbeladenen Gesamtheit mit Ausrottung<br />
gedroht, »wenn <strong>nicht</strong> ihr bestes gut zum banne geht.« So<br />
dunkel uns die letzte Wendung vorläufig noch bleibt, so wird doch<br />
als gewiß gelten dürfen, dass die für den kleineren Teil als möglich<br />
gesehene Alternative ebenfalls ist, ein schweres Schicksal auf sich<br />
zu nehmen, vielleicht ein besonders schweres. Der <strong>Bibel</strong> gemäß<br />
wäre dagegen: die kleinere Zahl erwartet das bessere Los.<br />
Die Frage, der wir uns damit nähern, wie Georges Wort vom<br />
'Zum-Banne-gehn des besten Guts' zu verstehen sei, wurde auch<br />
bisher <strong>von</strong> denAuslegern in dieser Richtung beantwortet: der Dichter<br />
deril
Angesichts solch bevorstehender Schmach und Ver<strong>nicht</strong>ung -<br />
welchen Ausweg kann es für Römer noch geben? Horaz richtet<br />
diese sein Gedicht beherrschende Frage an zwei Hörergruppen:<br />
an die Gesamtheit des Volks sowie an dessen etwaigen "besseren<br />
Teil" (melior pars). Der Dichter selbst antwortet mit der ihm<br />
recht dünkenden Weisung. Man folge dem berühmten Vorbild, das<br />
vor alters die Griechen <strong>von</strong> Phokaia gaben, (die Einwohner einer<br />
ionischen Seestadt in Kleinasien). Die Phokäer, um Schimpf und<br />
Ver<strong>nicht</strong>ung durch persische Zwingherrschaft zu entgehen, faßten<br />
den Beschluß, allesamt freiwillig auszuwandern. (500 Jahre vor<br />
Horaz; der Zufluchtsort war Korsika.) Sie verfluchten die zurückgelassene<br />
Heimat, belegten aber mit feierlichem Bannfluch auch<br />
sich selbst, die Auswandernden. Sie schworen, niemals zurückzukehren,<br />
verflucht solle jeder sein, der den Eid breche. Als "Phokäischer<br />
Fluch" ist diese doppelte Verwünschung im Altertum<br />
sprichwörtlich geworden. Horaz deutet auf ihn hin mittels der Ausdruckskraft<br />
der lateinischen Sprache. Sein Lobpreis der griechischen<br />
Auswanderer als "Phocaeorum exsecrata civitas" drückt mit<br />
dem mehrdeutigen Wort exsecrata das Wesen des Phokäischen Fluches<br />
aus: wo Freiheitsliebende Heimat und Auswanderung zugleich<br />
verwünschen.<br />
Einen gleichen Doppelschwur fordert Horaz nun <strong>von</strong> seinen<br />
Römern mit kräftigen Akzenten. Kein Eidbruch solle verziehen<br />
werden. Die Unmöglichkeit jedes Heimkehrgedankens versinnlicht<br />
er mit drastischen Bildern einer Utopie: nur wenn die Natur ihre<br />
Gesetze umkehrt, wenn Felsen zu schwimmen anfangen, Flüsse<br />
bergaufwärts steigen usw., nur dann wäre das Brechen des Schwures<br />
kein Verbrechen. "Säumen wir also <strong>nicht</strong>. Die Schiffe bestiegen,<br />
sie werden uns zu den Inseln der Seligen bringen!"<br />
Zur dichterischen Rhetorik des Horaz gehört das Hervorheben<br />
bedeutungsvoller Wendungen durch Wiederholung. so wird der<br />
Appell an die beiden Gruppen der Römer, an die melior pars, den<br />
"besseren Teil", sowie an die Gesamtheit (omnis) wiederholt. Nur<br />
der "bessere Teil", so sieht er voraus, wird das schwere Los der<br />
Verbannung wählen. Ihm allein eignet die nötige Standhaftigkeit,<br />
Tapferkeit (virtus). Der "unbelehrbaren Masse" fehlt aus Feigheit<br />
18<br />
der Mut zur Voraussicht. Bequemlichkeit vorziehend, bleiben sie<br />
auf fluchbeladenem Faulbett liegen und dämmern ihrem Unheil<br />
entgegen. Bei diesem nochmaligen Appell an die Römer wiederholt<br />
Horaz auch die Wendung "exsecrata civitas" ein zweites Mal,<br />
was ihr größten Nachdruck verleiht. Das Wort, das vorher die Haltung<br />
der Phokäer charakterisierte, dient jetzt, die Römer dazu aufzufordern,<br />
selbst eine solche exsecrata civitas zu werden, mit doppeltem,<br />
Phokäischem Fluch ihr Land zu verlassen (v. 36 f.):<br />
eamusomnis exsecrata civitas<br />
[Wandern wir aus allesamt mit (dem) Phokäischem Fluch,l<br />
aut pars indocili melior grege.<br />
[oder des unbelehrbaren Haufens besserer Teil.l<br />
Die erste dieser Zeilen nahm Platen zum Titel seines Polenlieds:<br />
"Eamus omnis exsecrata civitas" (1831) - eine Bestätigung, wie<br />
populär die 16. Epode noch im 19. Jahrhundert war. Horaz beschließt<br />
sein Gedicht, indem er auf Schwere und Problematik des<br />
Auswanderungsschicksals hinweist. Wieder geht er über zur Form<br />
der Utopie. Von den seligen Inseln, dem verheißenen Ziel der Flucht<br />
wird erzählt: Jupiter hat diese Inseln aufgespart, als er die goldene<br />
Zeit in eine eiserne verwandelte, aufgespart für die Frommen - als<br />
"Fromme" (pia gens) bezeichnet Horaz hier den landflüchtigen<br />
"besseren Teil", der sich <strong>von</strong> dem "unfrommen Geschlecht" lossagte.<br />
Die paradiesischen Zustände auf den Inseln schildert Horaz mit<br />
wunderhaften Details - 20 Verse lang -, <strong>von</strong> denen jede Einzelheit<br />
vor Augen führt, wie unrealisierbar seine politische Weisung war,<br />
wenn er sie auch für die bestmögliche ansah. Sowenig es je ein<br />
goldenes Zeitalter gab, sowenig existieren übriggebliebene selige<br />
Inseln. Unerbittliche Wirklichkeit ist für die Auswanderer nur die<br />
s lbstgewählte Verbannung, Fluch und Flucht. Glückslösungen gibt<br />
('S für sie <strong>nicht</strong>. Exil bleibt Exil, ein Unglück. Mit einer nochmali<br />
M('n Bezeichnung d es " besseren Teils" als die "Frommen" wird im<br />
S hl ußvers deren Schicksal ironisch zweideutig verkündet: "Den<br />
I,'rom men wi rd, so weiß der Seher, zuteil: die glückl iche Flucht. "<br />
pi is sccunda valc mc d atur fu ga.<br />
19
Das Schlußwort 'fuga' bedeutet Landesflucht, Exil und - Verbannung!<br />
Wie Horaz den "besseren Teil" bei drohender Ver<strong>nicht</strong>ung eines<br />
schuldbeladenen Staatsganzen zu retten sucht, darin zeigen sich<br />
beachtenswerte Entsprechungen zu dem Ausspruch über das »beste<br />
gut« bei George. Die Errettung der "frommen", der "pia gens"<br />
kommt <strong>nicht</strong> als göttlicher Gnadenakt wie die Schonung der 50<br />
Gerechten in der <strong>Bibel</strong>. Der" bessere Teil" vermag sie selbst zu erwirken,<br />
wenn er den harten Weg der Verbannung, der Auswanderung<br />
geht. Faßt man in der Wendung Georges: »wenn <strong>nicht</strong> ihr bestes gut<br />
zum banne geht«, das Wort Ban n als gleichbedeutend mit<br />
Ver ban n u ng auf - was dichterischem Wortgebrauch nach durchaus<br />
möglich ist 17 -, so ergibt sich ein ähnlicher Sinn wie bei Horaz.<br />
In die Verbannung gehn setzt eigenen Entschluß voraus. (Anders<br />
als verbannt werden, wo Beschlüsse anderer befolgt werden.) Gedacht<br />
ist also - alles deutet darauf hin - an eine Verbannung ähnlicher<br />
Art, wie sie das berühmte horazische Gedicht zeigt: die Selbstverbannung,<br />
das freiwillige Auswandern einer exsecrata civitas.<br />
Die Formulierung »wenn <strong>nicht</strong> ihr bestes gut zum banne geht«<br />
bekundet eine spürbare Ungewißheit: es wird eine schwer zu hoffende<br />
Lösung aufgezeigt. Besteht das 'zum Banne gehn' in freiwilliger<br />
Auswanderung nach Weise der 16. Epode, so finden sich bei<br />
Horaz die Gründe, die solcher Lösung entgegenstehen. Exil bedeutet<br />
seit alters ein zu schweres Los, als dass es freiwillig auf sich<br />
genommen wird. Vor allem aber: es gibt kein Ziel, wohin die Auswanderung<br />
gehen könnte. Mit aller Eindringlichkeit zeigt Horaz,<br />
wie aus dem fluchbeladenen Römerreich kein Entkommen möglich<br />
war. Es hätte schon seliger Inseln bedurft, - und die gibt es<br />
<strong>nicht</strong>.<br />
So wußte aber auch George, dass in der Weltlage, die sein Gedicht<br />
schildert, kein Ort denkbar wäre, wohin man hätte »zum<br />
17 Goethe braucht mehrmals "Bann" für "Verbannung" (z.B. DIE NATÜ RLICHE TOCHTER,<br />
V. 2277). So auch George selbst in DER LETZTE DER GETREUEN (DAS NEUE REICH, Gesamt<br />
Ausgabe Bd. 9, S. 133); in der Danteübertragung, Gesamt-Ausgabe Bd. 10/ 11,<br />
S. 109, FEGEFEUER Gesang 21 (in Bezug auf die Verbannung Dantes, ital. bando,<br />
v.102).<br />
20<br />
banne gehn« können. Im selben Jahre 1917, da DER KRIEG erschien,<br />
schrieb der Dichter einem Freund, der an Auswanderung dachte:<br />
"Ein entrinnen gibt es jetzt <strong>nicht</strong> [ ... ] Es gibt keine 'stillen Inseln'<br />
mehr und selbst wenn man hinflüchten könnte so ist keine bürgschaft<br />
ob das lang so bleibt. Allmählich wird alles in das gewirr<br />
hineingerissen und es muss so sein. Ich weiss das genau. "18 Viel<br />
spricht dafür, dass George auf das Bild <strong>von</strong> den stillen Inseln zu<br />
damaliger Zeit geführt wurde durch Beschäftigung mit dem horazischen<br />
Gedicht, worin das Fehlen <strong>von</strong> seligen Inseln alle Selbstverbannungsideen<br />
utopisch macht.<br />
Die 16. Epode behandelt das Auswanderungsthema - darauf<br />
beruht ihr Ruhm als politisches Gedicht - in vorsätzlich irrealer<br />
Weise. Auswanderung der Besseren ist kein reales Geschehen, das<br />
erzählerisch dargestellt wird. Von ihr spricht der Dichter nur in<br />
Form eines Rats. Er setzt sie als Idee, Wunschbild, Hypothese der<br />
politischen Wirklichkeit entgegen. Da einem fluchbeladenen Staat<br />
der Untergang droht, wäre Auswanderung die einzig richtige Tat<br />
und Antwort. Wie Horaz auf die Unrealisierbarkeit seines Ratschlags<br />
hinweist, daraus ergibt sich die Hauptbotschaft seines Gedichts.<br />
Es charakterisiert recht eigentlich eine völlig verzweifelte<br />
politische Situation. An diese Botschaft erinnerte Platen, als er die<br />
Gesamtheit der Polen zur Auswanderung aufforderte. Für ein ganzes<br />
Land war das ein undurchführbarer Ratschlag. Als Idee kennzeichnete<br />
er aber drastisch die verzweifelte Lage Polens nach der<br />
Einnahme Warschaus.<br />
So läßt aber auch Georges Wort »wenn <strong>nicht</strong> ihr bestes gut zum<br />
banne geht« die Deutung zu: eine Möglichkeit des zum Banne<br />
Gehens, des Auswanderns mag schon gar <strong>nicht</strong> mehr bestehn; auf<br />
jeden Fall charakterisiert aber die bloße Idee, dass es aus innerer<br />
Notwendigkeit erforderlich wäre, eine völlig verzweifelt geword<br />
ne politische Situation nach Weise des Horaz-Gedichts. In DER<br />
KR ICG tritt diese Möglichkeit als Eventualität ein, wenn begangene<br />
»Blut-schmach« die Ausrottung aller nach sich zöge. Hier fallen<br />
III Rob rt Bo hringer, Mein Bild <strong>von</strong> Stefan George, 2. AufL München und Düsseldorf<br />
I 68, S. 158.<br />
21
Dort waren die Deutschen <strong>nicht</strong> genannt, aber auch <strong>nicht</strong> ausgenommen.<br />
Wenn in DER KRIEG die künftige Betitelung der Deutschen<br />
als odium generis humani, »hass und abscheu menschlichen geschlechts«,<br />
vorausgesagt wird (Str. 10), so traute er ihnen damit<br />
offenbar Schlimmstes zu. Blutschuld durch Bürgerkrieg - wie es<br />
im einzelnen dazu kommen würde, konnte der Dichter <strong>nicht</strong> wissen,<br />
aber dass prinzipiell die Zukunft dergleichen bringen würde,<br />
sah er vorher und sprach es aus.<br />
George hatte eine besondere Hochschätzung für die politischen<br />
Sichten Heinrich Heines. Dieser läßt sich als Vorgänger sogar nachweisen<br />
bei Georges Wortsprägung »Geheimes Deutschland«28.<br />
Möglicherweise hat Heine ihn auch bestärkt in der visionärenAnnahme,<br />
dass Bürgerkrieg und Revolution in Deutschland <strong>nicht</strong> auszudenkende<br />
Formen annehmen könnten. In derselben Schrift, in der<br />
Heine vom geheimnisvollen, anonymen, unterirdischen Deutschland<br />
spricht, prophezeit er auch Untaten der wirklichen Deutschen,<br />
wie es sie in der Geschichte der Menschheit nie zuvor gegeben habe:<br />
" ... wenn <strong>Ihr</strong> es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte<br />
gekracht hat, so wißt: der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bei<br />
diesem Geräusche werden die Adler aus der Luft tot niederfallen, und die<br />
Löwen in der fernsten Wüste Afrikas werden die Schwänze einkneifen und<br />
sich in ihren königlichen Höhlen verkriechen. Es wird ein Stück aufgeführt<br />
werden in Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine<br />
harmlose Idylle erscheinen wird. "29<br />
28 Vgl. Heines Vorrede zur 2. Auf!. des >SalonDas verstümmelte<br />
Buchiner großen Umwandlung befindet, da die Menschheit einer gefä<br />
hrlichen Krise zutreibt, ist es der Dichter, der ausersehen wurde,<br />
den Sinn dieses Geschehens zu deuten, den Willen des Geistes zu<br />
v rkünden. Diesem höheren Auftrag ordnete sich bei George alles<br />
unter. Durch ihn erhielt das gesamte Leben und Schaffen sein be<br />
/'ltimmtes Gepräge. Das trifft auch zu für das Verhältnis des Dicht<br />
rs zu seiner rheinischen Heimat. Der Rhein mit seiner Landschaft,<br />
)i n n Städten, seiner Vergangenheit erschien George mehr und<br />
m ' hr im Lichte jener Weltwende. Bei dem Untergang eines alten<br />
und dem Heraufdämmern eines neuen Äons würde - so schien es<br />
27
ihm - gerade der Rhein eine entscheidende Rolle spielen. Nicht<br />
nur sah er die Rheinlandschaft als Schauplatz künftiger Katastrophen,<br />
er sah sie zugleich als den eigentlichen Ursprungsort neuer<br />
geistiger Impulses. Dadurch veränderte sich das Bild: für George<br />
war der Rhein <strong>nicht</strong> mehr eine romantische, sondern eine heroische<br />
Landschaft.<br />
Eine heroische Landschaft - versuchen wir, uns klarzumachen,<br />
was das für den Dichter bedeutete. Die rheinische Heimat war für<br />
George kein leichtes Erbe mehr, kein selbstverständlich zufallendes<br />
Eigentum. Der Dichter war vielmehr, wie er selbst sagt, sein<br />
ganzes Leben lang auf der Suche nach dem Rhein. Ein Lied aus<br />
dem SIEBENTEN RING, das den Titel RHEIN trägt, redet in diesem Sinne<br />
den Strom an (VI-VII 169):<br />
Warst es du <strong>nicht</strong> mein gefährte<br />
Den ich suche seit ich lebe?<br />
Dasselbe Lied spricht des weiteren da<strong>von</strong>, dass der Dichter ein<br />
Leben des Opfers und der Entsagung führte im Dienste der 'fernen<br />
Hoffnung', die sich für ihn mit dem Rhein verband:<br />
) Dich zu ehren dir zu dienen<br />
Seid geopfert frühere prächte<br />
Seid vergessen tag und nächte!<<br />
So hat es auch eine tiefe Bedeutung, wenn das Gedicht mit dem<br />
Blick auf einen Märtyrer schließt - den Heiligen Rochus, der auf<br />
seine Wunde zeigt:<br />
Weite runde wo sich mische<br />
Ferne hoffnung glück der stunde!<br />
Nur noch droben in der nische<br />
Zeigt der Heilige alte wunde ...<br />
In diesem Sinne hat Georges Verhältnis zum Rhein eine lange Entwicklung<br />
durchlaufen, eine Entwicklung voller Wechsel und Spannungen.<br />
In seiner frühsten Jugend war der Rhein für ihn vor allem<br />
der Ort der musischen Begeisterung. Nicht zufällig beginnt schon<br />
28<br />
d<br />
r t G di ht, drAuf takt zu Georges eigentlichem Werk, das<br />
i ht W eIIIE aus den H YMNEN <strong>von</strong> 1890 mit einer Beschwörung<br />
Flusses der Heimat (11. 12):<br />
Hinaus zum strom! wo stolz die hohen rohre<br />
Jm linden winde ihre fahnen schwingen.<br />
Hier am Stromufer trifft den jungen Dichter die Herrin des Gesanges,<br />
die Muse. Wirklich ist der Rhein, was für Hesiod der Helikon<br />
war: Schauplatz der Musenbegegnung. Die AUFSCHRIFT der HYM<br />
NEN deutet auf dasselbe, wenn es darin heißt, dass »im uferried«<br />
die erste Dichtung Georges »begann«. Noch im SIEBENTEN RING aber<br />
erinnert das Gedicht URSPRÜNGE an die Rolle, die der Rhein bereits<br />
gespielt hatte, als der Knabe Stefan George sich an einer eigenen<br />
dichterischen Sprache begeisterte, die nur ihm verständlich war -<br />
auch dies geschah »an dem flusse im schilfpalaste«.<br />
Es folgt dann aber eine ganze Reihe <strong>von</strong> Werken, in denen der<br />
junge George des Rheines so gut wie gar <strong>nicht</strong> gedenkt. Das hat<br />
sehr bestimmte Gründe. Damals war der Dichter Deutschland für<br />
lange Zeit innerlich entfremdet. Immer wieder zog es ihn ins Ausland,<br />
vor allem nach Frankreich, Spanien und Belgien. Erstmals<br />
beginnt Das JAHR DER SEELE <strong>von</strong> 1897 die heimatliche Landschaft in<br />
grandiosen Versen zu besingen. Hier zeigt sich vor allem die Kunst<br />
Georges, die Natur sinnenhaft wahrzunehmen, das Allernächste<br />
- '<br />
Elementare, Essentielle,schöner Wirklichkeit zu erfassen im Spracherlebnis,<br />
es wiederzugeben in Sprachmelodien <strong>von</strong> bis dahin <strong>nicht</strong><br />
gekannter Schönheit und Einprägsamkeit. Auf dieser Fähigkeit<br />
beruht es, wenn George überhaupt Landschaften in so unvergleichlicher<br />
Weise darstellen konnte. Auch das Meer, auch das Hochgebirge<br />
oder der Zauber des Südens sind niemals zuvor - jedenfalls<br />
<strong>nicht</strong> im deutschen Bereich - mit solch magischer Wortkunst besungen<br />
worden wie <strong>von</strong> George. Hier lauschte Dichtung der Natur<br />
ihre eigentlichsten Geheimnisse ab. Innerhalb <strong>von</strong> Georges<br />
Rheingesängen gibt es eine ganze Schicht, die <strong>von</strong> solch virtuoser<br />
Landschaftsdarstellung zeugt. Ein besonders eindringliches Beispiel<br />
sei angeführt: das Spruchgedicht BRÜCKE aus dem SIEBENTEN<br />
29
RING, das Robert Boehringer gewidmet war. Hier wird nämlich eine<br />
Hauptphase vom Lauf des Rheins, der Übergang vom reissenden<br />
Dahinschnellen des Gebirgsflusses zu breitem, ruhigem Strömen<br />
dargestellt in ganzen vier Versen (VI-VII. 194):<br />
Unterm nächtigen holz der brückenfirst<br />
Brause woge wild im felsigen strudel!<br />
Nicht mehr lang dass du zum sanften sprudel<br />
Meines königlichen stromes wirst.<br />
Einen durchaus neuen Akzent bringt in Georges Rheingesänge das<br />
VORSPIEL zu DER TEPPICH DES LEBENS <strong>von</strong> 1899. Hier verbindet der<br />
Dichter erstmals deutlich mit der Rheinlandschaft und gerade mit<br />
ihr das, was er später 'die hoffnung verwandelten lebens' nannte.<br />
Der Engel, der ihm göttliche Weisungen bringt, fordert ihn auf,<br />
sich der eigentlichen Bedeutung der Rheinlandschaft bewußt zu<br />
werden, in ihr das »geheimnis ewiger runen« zu finden. Hierauf<br />
antwortet der Dichter, er entsage gern dem Zauber des Südens,<br />
Venedigs und Roms, um jenes Geheimnis des Rheins zu ergründen<br />
(v. 16):<br />
>Schon lockt <strong>nicht</strong> mehr das Wunder der lagunen<br />
Das allumworbene trümmergrosse Rom<br />
Wie herber eichen duft und rebenblüten<br />
Wie sie die Deines volkes hort behüten-<br />
Wie Deine wogen -lebengrüner Strom! (<br />
Entscheidend sind die letzten Worte. Am Rhein sieht Stefan George<br />
Zeichen eines neuerwachenden menschlichen Lebens. Der Beginn<br />
einer geistigen Revolution wirft auch auf den Rhein ein neues Licht:<br />
darum - »lebengrüner strom«. Von diesem Leben wußte George<br />
bis dahin <strong>nicht</strong> mit Sicherheit, wo in der Welt, wenn überhaupt, es<br />
sich manifestieren könnte. Jetzt zweifelt er <strong>nicht</strong> mehr, dass es in<br />
Deutschland zu suchen ist - genauer gesagt aber: in einem Deutschland,<br />
dessen geistige Mitte der Rhein ist. Hier am Rhein entdeckt<br />
der Dichter nun sogar in der Natur Formen, die auf die Beschaffenheit<br />
eines künftigen höheren Menschentums hinzuweisen vermögen.<br />
Damit nimmt Georges Rheinverherrlichung die Wendung<br />
30<br />
ins ganz Einzigartige. Wo wäre eine Landschaft, <strong>von</strong> der große<br />
Dichtung jemals ähnliches gesungen hätte?<br />
An diesem Punkt unserer Betrachtungen wird es nötig sein, einen<br />
Augenblick zu verweilen, um zu fragen, was es auf sich hat<br />
mit jener Erneuerung, jener geistigen Revolution, die nun immer<br />
entschiedener Georges Dichten und Trachten beherrscht. Allzuoft<br />
wird diese Seite seines Schaffens mißverstanden, allzugern glaubt<br />
man sie abtun zu können mit bequemem Darüberhinwegsehen.<br />
Diese geistige Revolution stammt in ihren Ursprüngen <strong>nicht</strong> <strong>von</strong><br />
George selbst. Es handelt sich vielmehr um eine Bewegung, die<br />
erstmals in den Jahren nach dem großen französischen Umsturz<br />
auf den Plan trat, zu Ende des 18. Jahrhunderts also. Diese Revolution<br />
ist folglich ebenso alt wie die große andere Revolutionsbewegung,<br />
mit der wir alle vertraut sind: die politische, gesellschaftliche<br />
Revolution, die noch bis in die sozialistischen Strebungen<br />
unserer Tage hineinwirkt, unser Leben mehr oder weniger<br />
beherrscht, die auch in der Literatur aller Länder sich stärker geltend<br />
machte als irgendeine andere Denkrichtung.<br />
Während nun aber diese letztgenannte breite revolutionäre Bewegung<br />
aus der Notwendigkeit entsprang, die Menschenrechte<br />
neu zu konstituieren, während sie Verhältnisse, Zustände, Einrichtungen<br />
des menschlichen Lebens zu bessern suchte, richtete sich<br />
j ne geistige Revolution - die Revolution einer kleinen Schar, die<br />
I die Ahnen Georges anzusehen sind - auf etwas ganz anderes:<br />
nämlich auf die Neukonstituierung des Menschen selbst. Weit mehr<br />
I Zustände und Einrichtungen schien ihr der Mensch als solcher<br />
)in r Erneuerung bedürftig, der gesamte seelische Status und Haltu<br />
des Wesens, das sich Mensch nennt. Hier rückte die Frage ins<br />
ntrum: ist der Mensch der neueren Zeit überhaupt noch Mensch,<br />
In d m Sinne, wie er es jahrtausendelang gewesen war. Ein großes<br />
Er hr cken trat da ein. Denn mit dem Erwachen des historischen<br />
WI s ns und Denkens war erstmals die Vergleichsmöglichkeit ge<br />
I n - man konnte den modernen Menschen bemessen an dem<br />
rü h 'r r großer Blütezeiten: der Antike, des Mittelalters, der Reinl<br />
n ,d s Orients. Und hier entdeckte man, dass der moderne<br />
M '1'\ h m hr und mehr wichtigste Eigenschaften zu verlieren im<br />
31
Begriff war, die eigentlich erst wahrhaft den Menschen zum Menschen<br />
machen und die dem Menschen früherer Zeiten selbstverständlicher<br />
Besitz waren.<br />
Derjenige, der zuerst aufs tiefste <strong>von</strong> solcher Einsicht erschüttert<br />
wurde, war Hölderlin. Andere sahen ähnliches, <strong>von</strong> Goethe,<br />
Jean Paul, Schiller angefangen bis zu Nietzsehe. Doch wurden sehr<br />
bald weit über Deutschlands Grenzen hinaus die besten Geister<br />
<strong>von</strong> dieser Er<strong>kennt</strong>nis ergriffen. Im 19. Jahrhundert wurde es vor<br />
allem den Künstlern deutlich, welcher Umbruch sich im menschlich-seelischen<br />
Bereich vollzog. Die bis ins Unglaubliche gehende<br />
Verhäßlichung des Lebens, die in der Welt zutage trat - kennbar<br />
an jedem Gerät, das der Mensch schuf, jedem Kleid, das er anzog,<br />
jedem Haus, das er baute - war für diese Künstler ein alarmierendes<br />
Zeichen. Hand in Hand hiermit ging das, was Baudelaire mit<br />
einer berühmt gewordenen Formel das "avilissement des cceurs"<br />
nannte - das Häßlich-, das Niedrigwerden auch der Herzen, der<br />
Seelen.<br />
Heute läßt es sich sagen: was hier an Symptomen, an Phänomenen<br />
gesehen wurde - es resultierte letzten Endes aus der Hinwendung<br />
des Menschen zu völlig neuen Aufgaben: zur Ausschöpfung<br />
der Natur durch die Kräfte des menschlichen Verstandes, durch<br />
Rechnen und Kombination. Das beginnende Zeitalter der Technik<br />
verlangte vom Menschen Ungeh<strong>eure</strong>s. Es forderte aber damit die<br />
einseitigeAusbildung <strong>von</strong> intellektuellen Kräften, die jahrtausendelang<br />
vorher, ja solange die Menschheit bisher bestand, kaum oder<br />
doch nur ganz nebenher in Anspruch genommen waren. Dabei<br />
konnte es gar <strong>nicht</strong> ausbleiben, dass andere geistige Fähigkeiten,<br />
die der Mensch bisher vorzugsweise betätigt hatte, verkümmern<br />
mußten. Denn niemals - das lehrt die Geschichte - vermag der<br />
Mensch alles auf einmal, alles zugleich. So begann aber jetzt zu<br />
schwinden: der große Glaube, der große Gedanke, das große Herz,<br />
der Sinn fürs echt Erhabene und Schöne, der Sinn für hohe Kunst<br />
und für menschliche Größe überhaupt, soweit diese sich <strong>nicht</strong> im<br />
stofflichen Bereich manifestiert.<br />
Wenn es vor allem die Künstler waren, die <strong>von</strong> diesem Verkümmern,<br />
Hinschwinden menschlicher Kräfte erschreckt wurden, so<br />
32<br />
i t das k in Zufall. <strong>Ihr</strong>e Welt war es ja vor allem, die damit in Trümmer<br />
ging. Sie, die Künstler, setzten sich denn auch am entschiedensten<br />
zur Wehr. Sie bildeten nun ihre, die geheime zweite Revolution,<br />
eine Bewegung, die der großen sozialen Revolution an Macht<br />
und Geltung <strong>nicht</strong> vergleichbar war, die aber ihr eigenes Gewicht<br />
erhielt durch die Bedeutung der ihr verpflichteten Geister. Es war<br />
die geistige Elite Europas, die in dieser Bewegung zusammentrat.<br />
Stefan George kam mit dieser anderen Revolution in persönliche<br />
Berührung, als er in seiner Jugend den französischen Dichtem,<br />
besonders Mallarme und seinem Kreis, nähertrat. Hier wurden<br />
Wege gesucht, durch eine Erneuerung der Sprache, insbesondere<br />
des Verses, die geistige Dekadenz aufzuhalten, die man ringsum<br />
wahrnahm. Mallarme glaubte an eine Errettung der Welt durch<br />
die Veredelung der Dichtung. Das wurde für George wegweisend.<br />
Auch er begann mit einer Erneuerung der Dichtersprache <strong>von</strong><br />
Grund auf. Zugleich aber hielt er Ausschau nach Menschen, die<br />
<strong>von</strong> dem neuen Leben, das in seiner Dichtung pulsierte, berührt,<br />
geleitet, geformt wurden. Diese Menschen sollten - das war seine<br />
Hoffnung - den Kern einer geistigen Erneuerung überhaupt bilden,<br />
und so der allgemeinen Aushöhlung und Verstofflichung des<br />
Lebens entgegenwirken.<br />
Alles dies spiegelt sich in Georges Rheingesängen. Als George<br />
jene Wendung vom »lebengrünen Strom« in DER TEPPICH DES LEBENS<br />
niedergeschrieben hatte, konnte er bereits auf Folgendes zurückblicken:<br />
entgegen seinem eigenen Erwarten war es die deutsche<br />
Sprache gewesen, die in größerem Maaß als jede andere heutige<br />
die Fähigkeit bewies, das Pulsieren neuen geistigen Lebens spürbar<br />
zu machen. Diese Erfahrung, und nur sie, führte den Dichter<br />
jetzt zurück nach Deutschland, zurück aus den schöneren romanischen<br />
Ländern. Dabei gab den Ausschlag die Hoffnung, dort wo<br />
diese deutsche Sprache beheimatet war, auch Menschen zu finden,<br />
die ihre geistigen Impulse aufnehmen konnten. Endgültig befestigte<br />
sich bei George solche Hoffnung erst, nachdem ihm in Deutschland<br />
der Mensch begegnet war, an dem er ganz das Gepräge jenes<br />
Geistes wahrnahm, dem er sich verpflichtet fühlte, und der dies<br />
gleichfalls in dichterischem Wort bekundete - Maximin.<br />
33
In den Jahren nach dem TEPPICH DES LEBENS ging George mit dem<br />
Gedanken um, den Rhein überhaupt in einem größeren Gedicht<br />
oder Gedichtzyklus zu feiern. Dieses Projekt wurde <strong>nicht</strong> ausgeführt.<br />
Das nächstfolgende Werk aber, DER SIEBENTE RING, veröffentlicht<br />
1907, nahm Bruchstücke des geplanten Werks in sich auf. Jedenfalls<br />
enthält DER SIEBENTE RING die wichtigsten Rheingedichte<br />
Georges. Für sämtliche gilt, dass sie im Zeichen der Wende, der<br />
geistigen Revolution stehen, deren Verkündung George nun mehr<br />
und mehr als sein Amt betrachtete. Die sechs Spruchgedichte, die<br />
hier in den TAFELN unter der Überschrift RHEIN stehen, sprechen <strong>von</strong><br />
gar <strong>nicht</strong>s anderem als <strong>von</strong> dieser Revolution. <strong>Ihr</strong>e Auslegung ist<br />
z.T. schwierig. Das dichterische Vorbild für'Georges TAFELN sind -<br />
was man bisher <strong>nicht</strong> beachtet hat - die gereimten Vierzeiler des<br />
Nostradamus, des 1566 gestorbenen französischen Propheten, auf<br />
den auch Goethe im FAUST Bezug nimmt. Nicht so sehr der Inhalt<br />
der Nostradamischen Weissagungen, wohl aber ihre sprachliche<br />
Form hat George inspiriert, als er selbst erstmals in seinen TAFELN<br />
prophetische Dichtung schuf. Und so beruht vielfach die Dunkelheit<br />
prophetischen Sprechens, die gerade in den RHEIN-TAFELN besonders<br />
groß ist, darauf, dass George beispielsweise nach Art des<br />
Nostradamus Antonomasien, Decknamen, Umschreibungen verwendet,<br />
deren Deutung manchmal <strong>nicht</strong> leicht ist.<br />
Soviel indessen steht fest: in Georges Dichtung sprechen erstmals<br />
die RHEIN-TAFELN mit aller Bestimmtheit die Erwartung aus,<br />
dass eine künftige Weltveränderung <strong>von</strong> Deutschland, vom Rhein<br />
ausgehen soll. Der Hort des Rheins, das Rheingold wird zum Sinnbild<br />
für die Hoffnungen, die der Dichter hegt in Bezug auf das<br />
Wiedererwachen eines neuen Lebens. Mit Anspielung auf die bei<br />
Nostradamus wiederholt vorkommende Erwähnung des Meergottes,<br />
des "großen Neptun" und seines Attributs, des Tridentes, deutet<br />
George auf die Wirkungen, die <strong>von</strong> seinem dichterischen Wort<br />
ausgehen werden (VI-VII. 198):<br />
34<br />
Einer steht auf und schlägt mit mächtiger gabel<br />
Und sprizt die wasser güldenrot vom horte ..<br />
Aus ödem tag erwachen fels und borte<br />
Und pracht die lebt wird aus der toten fabel.<br />
»pracht die lebt« - mit diesen Worten ist auf das nämliche gedeutet<br />
wie mit der früheren Wendung vom »lebengrünen strom« in<br />
DER TEPPICH DES LEBENS. Sehr bezeichnend aber ist etwas anderes:<br />
gemäß der Prophezeihung des Dichters wird unmittelbar folgen<br />
auf die Freilegung des Hortes im Rhein <strong>nicht</strong> etwa sogleich der<br />
Beginn eines schöneren Zeitalters. Es folgen vielmehr zunächst:<br />
Umsturz, Zusammenbruch, Untergang der bestehenden Welt. Da<strong>von</strong><br />
handelt die nächste TAFEL (VI-VII. 198):<br />
Dann fährt der wirbel aus den tiefsten höllen<br />
Worin du donnerst bis zur Ersten Stadt<br />
Drängt <strong>von</strong> der Silberstadt zur Goldnen Stadt<br />
Soweit die türme schaun vom heiligen Köllen.<br />
Wieder ist, wie in dem Spruchgedicht Brücke, der ganze Lauf des<br />
Rheines in wenigen Worten versinnlicht - hier ist es die Nennung<br />
der Städte Basel, Straßburg, Mainz, Köln, die die Anschauung<br />
schafft. Allerdings dient nun das Gesamtbild des Stroms als Hintergrund<br />
für düstere Prophetie. Wenn George die Städte bezeichnet<br />
als Erste Stadt, Silberstadt, Goldne Stadt, so beruht das, wie<br />
man weiß, auf historischen Benennungen. Zugleich sind es aber<br />
Antonomasien bzw. Metonomasien im Stile des Nostradamus.Auch<br />
Nostradamus spricht etwa <strong>von</strong> Rom als der 'Sonnenstadt' oder <strong>von</strong><br />
Paris als der 'Großen Stadt'.<br />
Die folgende TAFEL (VI-VII. 199) setzt die Prophezeiung des<br />
Umsturzes fort, der hier ein "furchtbares gereut" genannt wird.<br />
Das bedeutet: ein radikales Roden, Ausmerzen alles Bestehenden -<br />
Nun fragt nur bei dem furchtbaren gereut<br />
Ob sich das land vor solchem dung <strong>nicht</strong> scheut!<br />
Den eklen schutt <strong>von</strong> rötel kalk und teer<br />
Spei ich hinaus ins reinigende meer.<br />
Aus den Worten »rötel kalk und teer« klingt leidenschaftliche Verachtung.<br />
Sie bezeichnen die Hässlichkeit alles dessen, was <strong>von</strong> der<br />
n ueren Menschheit gebaut wurde, gebaut auch in übertragenem<br />
Sinne. Man hat diesen Worten aber noch eine spezielle Auslegung<br />
g ben. In »rötel kalk und teer« sah man Hinweise auf die Far-<br />
35
en der Reichsfahne Schwarz-Weiß-Rot. Diese Auslegung stieß auf<br />
Widerspruch, wie zu erwarten war, obgleich sie vom Dichter bestätigt<br />
wurde. Es läßt sich aber auch noch auf andere Weise zeigen,<br />
dass sie ihre Richtigkeit hat. Ganz ohne Zweifel lehnt sich George<br />
nämlich gerade hier an die Sprache des Nostradamus an. Nostradamus<br />
bezeichnet sehr oft politische Parteien durch Nennung und<br />
Aufzählung verschiedener Farben, wobei die Farben auch umschrieben<br />
werden können, Z.B.: weiße und schwarze Kohle, oder<br />
Asche und Kalk (für grau und weiß). Daraus ergibt sich, dass aus<br />
der Wendung »rötel kalk und teer« bei George tatsächlich ein politischer<br />
Beiklang <strong>nicht</strong> wegzuleugnen ist. Der Dichter war, das ist<br />
bekannt, ein Gegner Preussens und des Bismarckschen Reichs. Er<br />
hatte also etwas gegen die Fahne Schwarz-Weiß-Rot. Man darf allerdings<br />
im allgemeineren Sinne deuten: nach Georges Auffassung<br />
mußten vor allem verschwinden, bevor ein neues Leben beginnen<br />
könnte: die Götzen der nationalen Eitelkeit, die jeder höheren Kultur<br />
feindlich waren. George war ja auch, wie viele seiner Dichtungen<br />
bezeugen, ein dezidierter Gegner des modernen Krieges. Schon<br />
im Jahre 1896 hatte er in den BLÄTTERN FÜR DIE KUNST polemisiert<br />
gegen die "ausschließliche erziehung eines geschlechtes zu wechselseitigem<br />
hartem kampfe", gegen den Militarismus also. Dadurch<br />
ginge Wichtigstes verloren, ja, die Menschheit liefe damit "einer<br />
allmählichen verflachung und vertrocknung entgegen". Es hat also<br />
seine tiefe Bedeutung, wenn der Rhein auch mit diesem Übel, dem<br />
übersteigerten Nationalgefühl der modernen Menschheit, aufräumt.<br />
Der Sinn der <strong>von</strong> George prophezeiten Katastrophen wäre im<br />
übrigen <strong>nicht</strong> damit erschöpfend gedeutet, dass man etwa an die<br />
Ereignisse der letzten beiden Kriege denkt. Es sind Untergänge noch<br />
ganz anderer Art, die dem Dichter vor Augen stehen.<br />
Über das, was nach dem »furchtbaren gereut« noch zählt, noch<br />
Geltung hat, deuten die beiden letzten RHEIN: V und RHEIN: VI überschriebenen<br />
TAFELN nur soviel an: vor allem die Schönheit der rheinischen<br />
Landschaft wird noch wesenhaft und fruchtbar sein, sowie<br />
das Erbe großer geschichtlicher Vergangenheit - die Reste romanischer<br />
und gotischer Bauten am Rhein und das, was George<br />
36<br />
den römischen Hauch des Rheines nennt. Vom »neuen wein im<br />
neuen schlauch« dürfe erst dann gesprochen werden, so ruft hier<br />
der Rhein den Deutschen zu (VI-VII. 199):<br />
Sprecht <strong>von</strong> des Festes <strong>von</strong> des Reiches nähe<br />
Sprecht erst vom neuen wein im neuen schlauch:<br />
Wenn ganz durch <strong>eure</strong> seelen dumpf und zähe<br />
Mein feurig blut sich regt, mein römischer hauch!<br />
Was hiermit gemeint ist, verdeutlicht sich aus anderen Gedichten<br />
des SIEBENTEN RINGES. Die Zeit, als die Römer im Rhein- und<br />
Moselland lebten, gilt George als die glanzvollste Epoche seiner<br />
Heimat. Damals war das Land einbezogen in das geist- und gottrfüllte<br />
Leben der Antike, <strong>von</strong> dem das Gedicht URSPRÜNGE sagt<br />
(VI-VII. 127):<br />
Nie lag die welt so bezwungen<br />
Eines geistes durchdrungen<br />
Wie im jugend-traum.<br />
er Rhein hat <strong>von</strong> diesem antiken Leben ein Erbe bewahrt, das<br />
noch für künftige Zeiten fruchtbar werden kann. Darin liegt auch<br />
as letzte Geheimnis des Hortes und der Freilegung des Rhein<br />
Ids durch die Macht der Dichtung.<br />
Die spätesten Werke Georges, DER STERN DES BUNDES und DAS<br />
NRUE REICH sprechen <strong>von</strong> der Zeit nach den grossen Weltkatastroph<br />
n positiver, mit mehr seherischer Hoffnung. Hier bildet der<br />
Rh in geographisch und geistig die Mitte des Wandlungsgescheh<br />
ns (VIII. 82):<br />
Verändert sieht der alten berge form<br />
Und wie im kindheit-garten schaukeln blüten ..<br />
Der strom besprengt die ufer und es schlang<br />
Sein zi tternd silber allen staub der jahre<br />
Die schöpfung schauert wie im stand der gnade.<br />
, ) wird im STERN DES BUND ES der Beginn der neuen Weltzeit ange<br />
I 'ut t. Ganz besonders die Binger Landschaft, den Rheingau sieht<br />
I 'r ht r jetzt im Lichte intensiver Verklärung. Diese Landschaft<br />
37
N ostradamus-Anklänge<br />
in Stefan Georges TAFELN<br />
Dem in Vorstehendem gegebenen Hinweis auf Nostradamus-Anklänge<br />
in Georges TAFELN sei einiges Erläuternde hinzugefügt. Der<br />
1503 in der Provence geborene französische Prophet, der einer ehemals<br />
jüdischen Familie entstammte, hinterließ in seinen CENTURI ES<br />
ein höchst seltsames Werk. Es handelt sich um eine Sammlung prophetischer<br />
Spruchgedichte, vergleichbar den vielen Orakelsammlungen,<br />
welche die Antike besaß. Durch seinen abstrus dunklen<br />
Gehalt gehört das Werk in den Bereich jenes mystischen-astrologischen<br />
Schrifttums, das gewöhnlich mehr die Okkultisten interessierte<br />
als die wahrhaft Gebildeten. Wenn trotzdem Dichter wie<br />
Goethe und George durch Nostradamus beeindruckt wurden, so<br />
liegt das an der sprachlichen Höhe, an der Eigenart des Tons der<br />
Nostradamischen Verse. Wirklich eignet den Quatrains, den Vierzeilern<br />
des Nostradamus ein dichterisches Element, das sie<br />
literargeschichtlich wertvoll macht.<br />
Dass George durch sie inspiriert wurde, zeigt zunächst schon<br />
die formale Übereinstimmung seiner TAFELN mit den N ostradamus<br />
Sprüchen. 1 Die überwiegende Mehrzahl der TAFELN besteht aus gereimten<br />
Vierzeilern mit fünf jambischen Hebungen. Das aber ist<br />
auch die den Quatrains des Nostradamus zugrunde liegende Form.<br />
Die bei Nostradamus übliche Reimstellung (ab ab) findet sich in<br />
den TAFELN <strong>nicht</strong> durchweg, aber doch sehr häufig. Innerhalb die-<br />
40<br />
Nostradamus wird im Folgenden zitiert nach derAusgabe <strong>von</strong>Anatole le Pelletier:<br />
LES ORACLES OE MICHEL OE NOSTREOAMEAstrologue, Medecin et Conseiller Ordinaire<br />
des Rois Henri H, Franr;:ois H et Carles IX, Edition ne varietur comprenant: 1° Le<br />
Texte-type de Pierre Rigaud (Lyon, 1558-1566), d' apres I' edition-princeps conservee<br />
a la Bibliotheque de Paris, Avec les Variantes de Benoist Rigaud (Lyon, 1568) et les<br />
Supplements de la reooition de M. DCV; 2°Un Glossaire de la languede Nostredame,<br />
avec Clef des Noms enigmatiques; 3° Une Scholie historique des principaux Quatrains.<br />
Tome H. Reimpression de I' edition de Paris, 1867. Geneve: Slatkine Reprints,<br />
1969. - Kursivdruck-Hervorhebungen innerhalb der Zitate stammen <strong>von</strong> M. M.<br />
r äuß r n Üb r in timmun n z igt i h nun in Y, rw ndthaft<br />
d Ton hö hst auffällig da, wo di TAFELN b inn n, üb rp<br />
r önlich Inhalte au zusprechen, wo si zu Orak I prü h n<br />
w · rden. Dieser Ton setzt bei den RHEIN-Gedicht n in und i t d< nl1<br />
durchgehalten bis zu den Versen ZUM ABSCHWSS DES Vll. RlNc. i ·<br />
vor den RHEIN-Sprüchen stehende Gruppe <strong>von</strong> 27 G dicht n bild t<br />
- so sieht es auch Morwitz als Kommentator - eine besond<br />
P rsonen gerichtete Abteilung. Der Ton ist hier um viel<br />
schmeidiger. Es tritt hier noch <strong>nicht</strong> die volle Wucht, der h rn<br />
Klang auf, der für die eigentlichen Orakel sprüche so charakt ritisch<br />
ist. Wo dies aber einsetzt, mit den RHEIN-TAFELN, wird di<br />
Ähnlichkeit mit dem Ton des Nostradamus so groß, dass man<br />
gen darf: es ließe sich schwerlich in der Weltliteratur ein dicht risches<br />
CEuvre finden, das mit der Besonderheit dieser Georg h n<br />
TAFELN soviel Gemeinsames hat. Von den sechs RHEIN überschri -<br />
benen TAFELN an - <strong>nicht</strong> vorher - zeigen sich denn auch vi Ifa h<br />
inhaltlich Wendungen, die an Nostradamus erinnern.<br />
Was George an Nostradamus anzog, läßt sich unschwer erk nnen.<br />
Als es dem Dichter darum ging, Prophetien auszusprech n,<br />
eine Art Orakelsammlung zu schaffen, mochte natürlicherw i<br />
das Bedürfnis entstehen, eine durch Tradition schon gültig gewordene<br />
Form zu finden, so wie die Antike sie besaß. Aber der H xameter<br />
- im Altertum der herkömmliche Orakelvers - kam für<br />
George <strong>nicht</strong> in Betracht. Noch Goethe mochte für seine W EISS A<br />
GUNGEN DES BAKIS Hexameter und Pentameter (Distichen) verwenden.<br />
Für klassizistisches Empfinden waren es reizvolle Maaß .<br />
Dabei ist aber bezeichnend, dass sämtliche Bakis-Sprüche Vierz iler<br />
sind - hier wirkte sich vermutlich auch bei Goethe die Kenntni<br />
des Nostradamus aus. Auch er suchte offenbar für seine Orak 1sammlung<br />
Anlehnung an das Traditionsvorbild der C ENTURI E .<br />
Jedenfalls tritt mit den WEISSAGUNGEN DES BAKIS in Goethes Spruchdichtung<br />
der Vierzeiler als Form einer ganzen Sammlung auf -<br />
dies Phänomen erklärt sich am ehesten durch die imitatio d<br />
Nostradamus.<br />
Für George war der Hexameter wie jedes andere antike M -<br />
trum unbrauchbar geworden, da sich in ihm neues Fühlen <strong>nicht</strong><br />
41
Endlich kann die Farbe - wie bei George - gegenständlich angedeutet<br />
werden (Cent. IV 85; p. 93):<br />
Le charbon blanc du noir sera chasse,<br />
Prisonnier faict mene au tombereau,<br />
More Chameau sur pieds entrelassez,<br />
Lors le puisne sillera l' aubereau.<br />
Besonders nahe Georges TAFEL RHEIN: IV steht der folgende Vierzeiler,<br />
in dem es heißt, dass "Asche, Kalk und Staub" vom Nordwind<br />
"über die Mauem geworfen" werden (Cent. IX 99; p. 200):<br />
Vent Aquilon fera parir le siege,<br />
Par meurs ietter cendres, chauls, & poussiere:<br />
Par pluye apres, qui leur fera bien piege,<br />
Dernier secours encontre leur fron tiere.<br />
Wenn in Georges vierter RHEIN-TAFEL der »ekle schutt <strong>von</strong> rötel kalk<br />
und teer« hinaus ins Meer geworfen wird, so stimmt damit merkwürdig<br />
zusammen ein gleichfalls vom Rhein handelnder Vierzeiler<br />
des Nostradamus. Dort wird "der große Verband" (?) in den<br />
Rhein geworfen (Cent. VI 40; p. 123):<br />
Grand de Magonce pour grande soif esteindre,<br />
Sera priue de sa grande dignite:<br />
Ceux de Cologne si fort le viendront plaindre,<br />
Que la grand groppe5 au Rhin sera iette.<br />
Was die Umschreibungen <strong>von</strong> Städtenamen betrifft, die in der<br />
TAFEL RHEIN: III anzutreffen sind, so bietet Nostradamus dergleichen<br />
die Fülle. Da lesen wir <strong>von</strong> 'eite solaire', 'ville rouge', 'ei te<br />
franche', 'cite neuve', 'cite antique' (auch 'vieille' ), 'grande eite',<br />
Port Selyn etc. Die Ausleger haben zu tun, diese Umschreibungen<br />
zu deuten, ihre Ergebnisse differieren. Indem George, weniger<br />
dunkel, aus der Geschichte genommene Bezeichnungen der rheinischen<br />
Städte heranzieht, trifft er doch zugleich den Ton der<br />
Nostradamischen Orakelsammlung.<br />
5 Pelletier merkt hierzu an: Lisez: groupe.<br />
44<br />
In dem TAFEL-Spruch RHEIN: II steht das Bild <strong>von</strong> dem Einen, der<br />
mit mächtiger Gabel schlägt und die Wasser vom Horte spritzt, in<br />
Korrespondenz mit den vielen Erwähnungen Neptuns bei Nostradamus,<br />
wobei auch des Tridents wiederholt gedacht ist. Eine dieser<br />
Stellen sei näher betrachtet, weil sich darin eine auffällige Übereinstimmung<br />
mit Georges Text findet. Es ist der Spruch (Cent. IV<br />
33; p. 84):<br />
Iupiter ioinct plus Venus qu'a la Lune,<br />
Apparoissant de plenitude blanche :<br />
Venus cachee sous la blancheur Neptune<br />
De Mars trappe par la grauee branche.<br />
Hier ist es der Meergott, der <strong>von</strong> einem "schweren Zweig" getroffen<br />
wird, als schlüge ihn sein eigener Trident. Wieder können wir<br />
absehen <strong>von</strong> einer Deutung des Spruchs. Wie so oft ist die Sprache<br />
ist die der Astrologie; dabei fällt jedoch die Erwähnung des damals<br />
noch unentdeckten Planeten Neptun auf. Uns muß interessieren,<br />
dass die Wendung "frappe par la gravee branche" durch<br />
Sinn und Klang an Georges Wendung: »schlägt mit mächtiger<br />
gabel« erinnert. Durch den Umstand, dass sowohl bei Nostradamus<br />
als auch bei George die betreffenden Worte am Versende stehen,<br />
intensiviert sich der Eindruck einer <strong>nicht</strong> auf Zufall beruhenden<br />
Übereinstimmung. Es eröffnet sich nun eine Möglichkeit,<br />
Georges Wendung <strong>von</strong> der 'mächtigen Gabel' genauer zu versteh<br />
n, wenn wir einen weiteren Spruch des Nostradamus hinzuzieh<br />
n, in dem uns das Bild vom schlagenden Zweig anders gefaßt<br />
b gegnet. Das Werk des Nostradamus beginnt mit zwei Vierzei<br />
I rn, die eine Selbstdarstellung enthalten. Einsam sitzt der Prophet<br />
d s Nachts bei geheimen Studien, so heißt es in der Einleitungs<br />
Hlrophe (worauf Goethe zu Anfang des FAUST anspielt). Der zweite<br />
Vi rz iler zeigt dann die Attitüde des Sehers und das Nahen der<br />
göltli hen Inspiration (Cent. I 2; p. 21):<br />
La verge en mai" mise au milieu de Branches,<br />
, /' onde il moulle & le timbe & le pied:<br />
Vn p ' ur & voix fr mi sent par les manches:<br />
pi nd ur dluin . L diuin pr s 'a sied.<br />
45
Der Seher bewegt die 'Rute' in der Hand, er 'modelliert' damit die<br />
Welle, ihren 'Saum' und 'Fuß'. 6 Betont ist, dass die Szene sich gleichsam<br />
in mystischem Bereich abspielt, im 'Milieu' des Branchus, jenes<br />
berühmten Sohns desApollon, dem der Gott die Gabe der Weissagung<br />
verlieh. Die Rute, verge, ist hier virga, virgula divina, die<br />
Wünschelrute. Goethe sagt: das »magische Reis«; er nämlich spielt<br />
bereits auf diesen Vierzeiler des Nostradamus an in seinen WEISSA<br />
GUNGEN DES BAKIS (v. 9 ff.):<br />
Nicht Zukünftiges nur verkündet Bakis; auch jetzt noch<br />
Still Verborgenes zeigt er, als ein Kundiger, an.<br />
Wünschelruten sind hier, sie zeigen am Stamm <strong>nicht</strong> die Schätze;<br />
Nur in der fühlenden Hand regt sich das magische Reis.<br />
Die Verse stehen - wie bei Nostradamus - in der Exposition der<br />
Goetheschen Orakelsammlung. Mit der Wendung: "in der fühlenden<br />
Hand regt sich das magische Reis" wird offensichtlich Nostradamus<br />
zitiert: "La verge en main[ ... ] il moulle[ ... ]" Hier erscheint<br />
nun die Übereinstimmung mit Georges RHEIN: 11 höchst<br />
merkwürdig: Der Vers »Einer steht auf und schlägt mit mächtiger<br />
gabel« steht auch innerhalb des Orakelteils der TAFELN am Anfang,<br />
er hat sogar genau denselben Platz wie bei Nostradamus: im ersten<br />
Vers des zweiten Vierzeilers! Somit deutet die »mächtige Gabel«<br />
doch wohl auf die 'verge', die Wünschelrute des Sehers. Der<br />
mit prophetischer Kraft begabte Dichter vermag mittels seines 'magischen<br />
Reises' dem Wasser Formen zu entlocken. Bei Nostradamus<br />
ist nur allgemein <strong>von</strong> 'onde' die Rede. George spricht konkret<br />
<strong>von</strong> den 'Wassern' des Rheins, die seine mächtige Gabel trifft. Dabei<br />
klingt in dem Vers: »Einer steht auf und schlägt. mit mächtiger<br />
gabel« noch jene andere Nostradamuszeile mit: "frappe par la<br />
gravee branche", möglicherweise in Erinnerung gebracht durch<br />
den Namen 'Branches' am Versende in I 2.7 Ein weiterer seltsamer<br />
6 So der Sinn' wenn man 'moulle' liest, was noch moderne Interpreten beibehielten.<br />
Ändert man mit Le Pelletier (1867) 'moulle' in 'mouille", so ergibt sich eine wohl<br />
richtigere Deutung.<br />
7 Pelletier p. 21 vermerkt zu BRANCHES: Variante Branches (en lettres capitales). -<br />
Allusion a Branchus, celebre orade de l'antiquite paienne.<br />
46<br />
Anklang: wenn George sagt, es »erwachen fels und borte« des <strong>von</strong><br />
der Gabel getroffenen Rheins, so entspricht »borte« dem Wort<br />
'limbe' bei Nostradamus. Limbe ist der Saum, die Borte eines Kleides;<br />
und auch Nostradamus sagt ja: "limbe & pied" - Borte und<br />
Fuß der Welle werden vom Wünschelrute-haltenden Seher geformt.<br />
- Wir sehen: auf beide, Goethe und George, hat das kurze PROÖMIUM<br />
der CENTURIES stark gewirkt. Beiden erschienen dessen Metaphern<br />
geeignet, den Charakter ihrer eigenen Orakelsammlung am Eingang<br />
anzudeuten.<br />
Auch für den Spruch RHEIN: I lassen sich Anregungen durch Nostradamus<br />
feststellen (VI-VIII. 198):<br />
Ein fürstlich paar geschwister hielt in frone<br />
Bisher des weiten Innenreiches mitte.<br />
Bald wacht aus dem jahrhundertschlaf das dritte<br />
Auch echte kind und habt im Rhein die krone.<br />
Wie sehr das Einsetzen dieses Spruches Nostradamischen Tonfall<br />
aufgreift, zeigen Strophenanfänge wie (Cent. III 98; p. 76):<br />
Deux royals freres si fort guerroyeront[ ... ]<br />
(Cent. IV 94; p. 95):<br />
Deux grands [reres seront chassez d'Espaignel .. . ]<br />
In einem anderen Vierzeiler wird <strong>von</strong> drei Brüdern gesprochen<br />
(Cent. VIII 17; p. 166):<br />
Par les trais [reres le monde mis en troublel ... ]<br />
Da bei prophezeit N ostradamus aber auch dasAuftreten dreier Ri va<br />
I n, <strong>von</strong> deneneiner zu Ruhm und Ansehn gelangt (Cent. 150; p. 30):<br />
De ]' aquatique tripliciti naistra,<br />
D' Un qui fera le Ieudy pour sa feste:<br />
Son brui t, loz, regne, sa puissance croistra,<br />
Pa r terre & mer aux Oriens tempeste.<br />
47
(PRESAGES LXX; p. 264):<br />
De LoIN viendra susciter pour mouvoir.<br />
Immer wieder stößt man in den Versen des Nostradamus auf Stellen,<br />
die mit Worten der Georgeschen TAFELN auffallende Ähnlichkeit<br />
haben. So gibt es für die Wendung <strong>von</strong> der kleinen Schar im<br />
viertenJAHRHUNDERTSPRUCH Parallelen. »Ich sah die kleine schar ums<br />
banner stehn ... «, so heißt es bei George. Nostradamus prophezeit,<br />
dass die "schwache Schar" den Erdkreis beherrschen wird: "La<br />
bande foible le terre occupera" (VIII 56). An anderer Stelle ähnlich:<br />
"La partie foible tiendra par bon augure" (I 34). Zu dem anschließenden<br />
Vers bei George »Und alle andren haben <strong>nicht</strong>s gesehn«<br />
wäre zu vergleichen PRESAGES 70: "Oe nul cognu le mal pour devoir".<br />
Selbst eine so charakteristisch Georgesche Wendung wie »wahre<br />
gluten« im fünften JAHRHUNDERTSPRUCH hat bei Nostradamus eine<br />
Entsprechung: "La vraye flamme engloutira la dame", heißt es dort<br />
(Cent. VI 19). In einem andern Fall erinnert die Nostradamische<br />
Wendung "payer le vray disme" (den wahren Zehnten bezahlen)<br />
durch den gedanklichen Zusammenhang an den »zins«, den EINER<br />
DER 3 KOENIGE in den TAFELN dem neuen »Heiland« bringt. Das betreffende<br />
Nostradamus-Gedicht lautet (III 76):<br />
En Germanie naistront diverses sectes,<br />
Sapprochant fort de l'h<strong>eure</strong>ux paganisme,<br />
Le creur captif & petites receptes,<br />
Feront retour cl payer le vray disme. 1O<br />
Bei Nostradamus ist der Gedankengang: in Germanien werden verschiedene<br />
Sekten entstehen, die sich dem "glücklichen Heidentum"<br />
weit annähern; doch wird man schließlich zurückkehren und Christus<br />
den" wahren Zehnten" zahlen. In Georges Bild: EIN ER DER 3<br />
KOENIGE erscheinen ähnliche Gedanken in anmutig umgekehrter<br />
10 Übersetzungsversuch <strong>von</strong> M . M : 'In Germanien werden verschiedene Ketzersekten<br />
entstehen'/Sich stark annähern dem glücklichen Heidentum, I Gefangenes Herz<br />
und schmale Einnahmen,/Werden bewirken Rückkehr zum wahren "Zehnten"<br />
(Christentum).'<br />
50<br />
Reihenfolge: dem 'neuen Heiland' wird erst der Zins gebracht, dann<br />
kehrt der morgenländische König zurück in die Heimat seines frohen<br />
Glaubens (VI-VII. 200):<br />
Dir neuer Heiland! bracht ich meinen zins.<br />
Nun lass mich wieder nach dem heimatplatze!<br />
Noch bin ich jung und lebe frohen sinns<br />
Der süssen krone und dem schönen schatze.<br />
Bezüglich der Tafel ZUM ABSCHLUSS DES VII. RINGS wäre nur anzumerken,<br />
dass das zugrunde liegende Thema der Sintflut bei Nostradamus<br />
nach Weise eines Topos häufig wiederkehrt. Dagegen<br />
sei als letztes noch genauer betrachtet, wie die Georgesche Wendung<br />
vom »reinen Haus« in der ABSCHLUSS-TAFEL KEHRAUS bei Nostradamus<br />
ein merkwürdiges Vorbild hat.<br />
Die hexen und beschwörer die noch spuken<br />
Hinaus! Die dämmrung bricht durch alle luken.<br />
Dass der nur rück ins reine haus sich wage<br />
Der hüllenlos sich zeigen darf im tage!<br />
Auch bei Nostradamus findet sich das Bild <strong>von</strong> einem Spukhaus<br />
mit ganz ähnlichem Kontur und Sinnzusamrnenhang (Cent.VII 41;<br />
p. 142):<br />
Les os des pieds & des mains enserrez,<br />
Par bruit maison lang temps inhabitee,<br />
Seront par songes concauant deterrez,<br />
Maisan salubre & sans bruit habitee. 1I<br />
Gebeine <strong>von</strong> Toten sind in dem Haus eingeschlossen, wegen<br />
espensterspuks (bruit) steht das Haus für lange unbewohnt. Durch<br />
Träume werden die Totengebeine ausgegraben: nun ist es ein "gesu<br />
ndes Haus" (maison salubre) und es wird wieder ohne Spuk bewohnt.<br />
Bei allen Unterschieden fällt doch auf, wie das Grundbild<br />
11 Übersetzu ngsversuch <strong>von</strong> M . M.: 'Die Gebeine <strong>von</strong> Füßen & Händen sind eingeschlossen,/(in<br />
dem nächste Zeile genannten Haus) I Wegen Spuks (bruit) steht das<br />
Haus lange unbewohnt, IDurch Trä ume, tiefgrabend I höhlend, werden die Gebeine<br />
ausgegraben,/Das Haus ist jetzt "gesund", wird ohne Spuk bewohnt:<br />
51
in Georges TAFEL gleich ist und vor allem auch das nämliche bezeichnet.<br />
Sowohl Nostradamus wie George veranschaulichen mit<br />
der Metapher <strong>von</strong> dem zu reinigenden Spukhaus ihre Prophetie:<br />
den Wechsel <strong>von</strong> schlimmer zu besserer Zeit. Durch das Übereinstimmende<br />
der Wendung vom »maison salubre« mit »ins reine<br />
haus« wird der Zusammenhang evident. Dass es bei Nostradamus<br />
'Träume' (songes) sind, die das Reinigungswerk vollbringen, steht<br />
Georges Denkart ganz nahe. Nach Georges Überzeugung sind es<br />
ja die Träume des Dichters, die eine Reinigung der Welt bewirken<br />
und damit - GEHEIMES DEUTSCHLAND v. 26 - »Neuen raum in den<br />
raum« schaffen, eine Heimstatt für die Wiederkehr des Menschlichen,<br />
der Seele.<br />
In dem verwirrenden Labyrinth der Nostradamischen CENTURIES<br />
- das zeigen die besprochenen Anklänge zur Genüge - findet sich<br />
manche mit Georges Vorstellungen zusammenstimmende gedankliche<br />
Wendung. Auch dies mag es erklären, dass in DER SIEBENTE<br />
RING soviel <strong>von</strong> Form und Ton des Nostradamus in die TAFELN eingehen<br />
konnte. Als George im STERN DES BUNDES sein prophetisches<br />
Dichten fortsetzte, verzichtete er auf die Nostradamische Form des<br />
Quatrains. Es darf aber gesagt werden, dass zumindest ein formales<br />
Merkmal doch auch hier an Nostradamus erinnert. Der STERN<br />
DES BUNDES besteht aus insgesamt hundert Gedichten. Die Hundertzahl<br />
aber ist kennzeichnend für das Nostradamische Werk, wie<br />
schon der Titel erkennen läßt. Die 10 Bücher der CENTURIES bestehen<br />
aus je 100 Quatrains mit Ausnahme eines unvollendeten, des<br />
7. Buches. Bekanntlich liebte auch George, den Aufbau seiner Werke<br />
nach bestimmten Zahlenverhältnissen zu gestalten. In jener<br />
Regelmäßigkeit bei Nostradamus mußte ihm somit wiederum ein<br />
verwandtes Element entgegentreten. Wenn für den STERN DES BUN<br />
DES nun die Hundertzahl maßgeblich wurde, so mag man dies noch<br />
als eine Hindeutung ansehen darauf, wie sehr auch dies Werk im<br />
Zeichen der prophetischen Sprache steht. Bestimmte doch die Zahl<br />
Hundert dasjenige Buch der Weltliteratur, das als dichterische<br />
Orakelsammlung eine Art kanonischer Geltung beanspruchen<br />
konnte: die <strong>von</strong> Goethe und George gleich geschätzte Sammlung<br />
der CENTURIES des Nostradamus.<br />
52<br />
Hölderlins Lösung <strong>von</strong> Schiller<br />
Zu Hölderlins Gedichten AN HERKULES und<br />
DIE EICHBÄUME und den Übersetzungen aus Ovid,<br />
Vergil und Euripides<br />
Die Gründe, die Hölderlin veranlaßt haben könnnen, seinen Jenaer<br />
Aufenthalt Ende Mai 1795 plötzlich abzubrechen und in die<br />
Heimatstadt Nürtingen zurückzukehren, sind oft diskutiert worden.<br />
Viele Anzeichen schienen darauf hinzuweisen, dass auf jeden<br />
Fall eine krisenhafte Zuspitzung in dem persönlichen Verhältnis<br />
zu Schiller hierbei eine große Rolle spielte. Es schien dies, wenn<br />
auch <strong>nicht</strong> das einzige, so doch ein besonders gewichtiges Motiv<br />
gewesen zu sein für das, was man die "Flucht aus Jena" genannt<br />
hat. Jene Krise, so nahm man an, sei entstanden aus einem bei<br />
Hölderlin immer stärker werdenden Gefühl der Unterlegenheit,<br />
der Minderwertigkeit im Umgang mit Schiller. Grundsätzliche<br />
Meinungsdifferenzen zwischen beiden Dichtern ließen sich gleichfalls<br />
leicht aufzeigen. Man weiß, mit welcher Leidenschaft Hölderlin<br />
sich dagegen auflehnte, wenn im Zusammenhang mit Kunst,<br />
mit Dichtung <strong>von</strong> "Spiel" gesprochen wurde, wie Schiller das getan<br />
hatte in seinen BRIEFEN ÜJlER DIE ÄSTHETISCHE ERZIEHUNG DES MEN<br />
SCHEN (1795). Doch glaubte man vor allem aus vielen Hölderlinschen<br />
Äußerungen - brieflichen und auch dichterischen - schließen<br />
zu können, dass eben jenes intensive Gefühl des Größenunterschiedes<br />
zwischen dem älteren berühmten Mann und dem jüngeren,<br />
noch ruhmlosen, die Lage für Hölderlin unerträglich gemacht hat. 1<br />
Eine ganz andere Auffassung indessen vertritt einer der besten<br />
Kenner Hölderlinscher Lebensverhältnisse, Adolf Beck. Ihm zufolge<br />
wäre in einem frühen Hervortreten der Krankheit, einem "er-<br />
Vgl. Hans Heinrich Borcherdt, Schiller und die Romantiker, Stuttgart 1948, 5.114 H.<br />
Pau l Raabe, Die Briefe HölderIins. Stuttgart 1963. S. 112 f.<br />
53
sten pathologischen Schub" die wesentliche Ursache zu sehen, dass<br />
es bei Hölderlin zu einem "Zusammenbruch seines ursprünglich<br />
guten und anregenden Verhältnisses zu seiner Umwelt in Jena"<br />
kam, zum "schizothymen Gefühl der Isolierung, und schließlich<br />
zu der überstürzten Flucht ... in die Geborgenheit des mütterlichen<br />
Hauses". Beck verweist dabei vor allem auf die Berichte über<br />
Hölderlins Erziehertätigkeit in Waltershausen, die Charlotte v. Kalb<br />
an Schiller sandte, und in denen sich ein Passus wie folgender findet:<br />
"mann meynt würklich das eine Verworrenheit des Verstandes<br />
diesen Betragen [Hölderlins, des Lehrers] zu grunde liegt".<br />
Hiernach wären also etwaige Spannungen in dem Verhältnis<br />
zwischen Hölderlin und Schiller zu Erscheinungen <strong>von</strong> sekundärer<br />
Bedeutung geworden. Was das Bestehen solcher Spannungen betrifft,<br />
so leugnet Beck diese <strong>nicht</strong>, gibt aber auch ihnen einen anderen<br />
ursächlichen Hintergrund. Entscheidend sei <strong>nicht</strong> das "Gefühl<br />
eines ver<strong>nicht</strong>enden Größenunterschiedes" gewesen, sondern vielmehr<br />
ein anderes: in seiner Eigenschaft als "gescheiterter Erzieher"<br />
im Hause Kalb sei Hölderlin gegenüber Schiller in einer unangenehmen<br />
Lage gewesen. Gerade die Tatsache, dass Schiller über<br />
jenes Scheitern, über die "peinliche Sache", bestens informiert war,<br />
habe sich bei Hölderlins "argwöhnischer Empfindlichkeit" unheilvoll<br />
ausgewirkt. Ob zwischen beiden Männern darüber gesprochen<br />
wurde oder <strong>nicht</strong>-Hölderlin mußte nach BecksAnsicht "doch<br />
das Gefühl haben, dass er letztlich auch Schiller enttäuscht und<br />
sich durchaus <strong>nicht</strong> als der 'Mann' bewährt habe, der zu werden<br />
er in seinem ersten Brief an diesen so sehnlich gewünscht hatte".2<br />
Es erhebt sich die Frage; ob diese Umdeutung der Spannungen<br />
mit Schiller noch mit dem urkundlichen Material in Einklang zu<br />
bringen ist. Aus Hölderlins Briefen an Schiller ist doch mit aller<br />
Klarheit zu ersehen, dass der Weggang <strong>von</strong> Jena wesentlich eine<br />
Lösung <strong>von</strong> Schiller bedeutete, und dass hierbei das Gefühl des<br />
drückenden Größenunterschiedes ein ausschlaggebendes Moment<br />
darstellte. Es geht aus den Briefen aber des weiteren etwas hervor,<br />
das man nie genügend in Rechnung gestellt hat: nämlich dass Höl-<br />
2 Hölderlin-Jahrbuch, 1950, 5.154-162.<br />
54<br />
derlin vor allem sein Schaffen, sein Dichtertum durch Schillers Nähe<br />
und Gegenwart gefährdet sah. In Gefahr war sein Werk - und darum<br />
mußte er vor Schiller fliehen.<br />
Die Flucht aus Jena gehört zu den wichtigsten Wendungen in<br />
Hölderlins Leben, und ihre Erklärung kann uns <strong>nicht</strong> gleichgültig<br />
sein. Es sei darum hier nochmals auf diejenigen Sätze in Hölderlins<br />
Briefen an Schiller aus den Jahren 1795 bis 1798 hingewiesen,<br />
die am klarsten bezeugen, dass es Spannungen mit Schiller waren,<br />
die den Hauptgrund für das Scheiden aus Jena bildeten, und dass<br />
es sich hierbei um Spannungen im Bereich des Geistigen handelte,<br />
<strong>nicht</strong> des Persönlichen, Privaten. Des weiteren werden wir gewisse<br />
Spiegelungen jener geistigen Spannungen in Hölderlins damaligem<br />
Schaffen zu betrachten haben, und zwar besonders innerhalb<br />
eines dichterischen Komplexes, den man bisher noch <strong>nicht</strong> in<br />
solchem Zusammenhang gesehen hat.<br />
I.<br />
Bereits im ersten Brief, den Hölderlin aus Nürtingen am 23. Juli<br />
1795 an Schiller richtet, gibt er, wie er ausdrücklich betont, geradezu<br />
eine "Apologie" seines plötzlichen Weggangs aus Jena. Am Anfang<br />
steht die Klage - die sich in den späteren Briefen so oft wiederholt<br />
-, dass Hölderlin nun <strong>nicht</strong> mehr Schillers persönlichen<br />
Umgang, <strong>nicht</strong> mehr seIne "Nähe" genieße, verbunden mit dem<br />
Eingeständnis, wieviel er damit entbehre. Der dann folgende Passus<br />
ist aber bereits geeignet, jegliche Zweifel zu beheben, dass es<br />
sich in erster Linie um eine Flucht vor Schiller gehandelt habe. "Ich<br />
hätt' es auch schwerlich mit all' meinen Motiven über mich gewonnen,<br />
zu gehen, wenn <strong>nicht</strong> eben diese Nähe mich <strong>von</strong> der andern<br />
Seite so oft beunruhiget hätte." Klar und deutlich wird hier ausgesprochen:<br />
die" Beunruhigung" durch Schillers "Nähe" gab denAusschlag<br />
bei dem Fluchtentschluß. Andere "Motive" - die es also gegeben<br />
haben mag - spielten demgegenüber eine zweitrangige Rolle.<br />
Bezeichnend ist aber weiter die Art und Weise, wie Hölderlin<br />
es erklärt, dass Schillers Nähe ihn so "beunruhigte". Er habe dar-<br />
55
unter gelitten, spüren zu müssen, dass er ihm, dem "grossen Mann",<br />
so wenig bedeutete. "Ich [ ... ] sah Sie immer nur, um zu fühlen,<br />
dass ich Ihnen <strong>nicht</strong>s seyn konnte." Hier erscheint in aller wünschbaren<br />
Deutlichkeit das Motiv <strong>von</strong> dem schmerzlich empfundenen<br />
Größenunterschied, und dieses Motiv wird nun in aller Ausführlichkeit<br />
beleuchtet. Auf der einen Seite waren es "stolze Forderungen",<br />
mit denen Hölderlin sich dem "grossen Mann" näherte -<br />
Forderungen, die er dann "nothwendiger weise [. .. ] büsste". Andererseits<br />
quälte das unüberwindliche Gefühl der "eignen Armseeligkeit":<br />
"weil ich Ihnen so viel seyn wollte, musst' ich mir sagen,<br />
dass ich Ihnen <strong>nicht</strong>s wäre".<br />
Wir erhalten hier genauen Einblick in die innere Situation Hölderlins<br />
zur damaligen Zeit. Ein bestimmtes Gefühl der Armseligkeit<br />
resultierte natürlicherweise aus den bisherigen Mißerfolgen<br />
im Dichten und im Beruf. Insbesondere war es der Fehlschlag der<br />
ersten großen Anstrengung, die Hölderlin als Schaffender mit der<br />
langen Folge der Tübinger Reimhymnen unternommen hatte, der<br />
sich hier auswirkte. Während es sonst die Regel zu sein pflegt, dass<br />
große Dichter sich mit einem ersten grandiosen Wurf und Gelingen<br />
die Welt auf einen Schlag erobern, war Hölderlin, wie in so<br />
vielem anderen, auch darin glücklos, dass ihm gerade dieser Erfolg<br />
versagt blieb. Jene Hymnen hatten allzuwenig Anklang gefunden,<br />
Hölderlin selbst betrachtete sie sehr bald als verfehlt und<br />
sah sich zu einem totalen Neuanfang genötigt: dieser ist bezeichnet<br />
durch die Arbeit am HYPERION. Andererseits war in Hölderlin<br />
genau zu der Zeit, in der wir uns befinden, gerade durch die Hy<br />
PERlON-Arbeit ein unbezweifelbares Ahnen seines eigentlichen Wertes<br />
und Ranges erwacht: der einzigartige Zauber einer halbrhythmischen<br />
Prosa hatte ihm dasjenige beschert, was ihm bislang in<br />
seinem lyrischen Schaffen versagt geblieben war - den Durchbruch<br />
zur eigenen, originellen Sageweise, den eigenen Ton. So hatte Hölderlin<br />
in Jena bereits durchaus ein Bewußtsein seiner eigenen Größe,<br />
nur dass dies <strong>von</strong> außen noch kaum bestätigt worden war. Gerade<br />
das aber machte ihm das Zusammensein mit Schiller so<br />
unerträglich. Zwar stand das Phänomen des Größenunterschiedes<br />
immer wieder unabweisbar vor seinen Augen, doch protestierte<br />
56<br />
dagegen in Wahrheit längst das innere Empfinden. Die "eigneArmseeligkeit"<br />
wurde aufs intensivste gespürt, da sie der äußern, realen<br />
Situation entsprach. Aus dem Innern aber erwuchsen bereits<br />
jene "stolzen Forderungen", die der Dichter an die Umwelt, die er<br />
an Schiller stellen, dabei nach Lage der Dinge "büssen" mußte.<br />
Diese zwiespältige Situation gilt es zu berücksichtigen, wenn man<br />
Hölderlins damaliges Verhalten wie auch die Spiegelungen in der<br />
gleichzeitigen Dichtung begreifen will. Den Minderwertigkeitsgefühlen,<br />
die aus so vielen brieflichen und dichterischen Äußerungen<br />
erkennbar werden, steht im Geheimen bereits ein starkes Wertbewußtsein<br />
zur Seite.<br />
Es liegt im übrigen in der zutiefst bescheidenen Natur Hölderlins<br />
begründet, dass er in der privaten Äußerung der Korrespondenz<br />
eher die negative als die positive Seite seiner inneren Verfassung<br />
mitteilt. So findet sich auch in dem zweiten Brief, der aus<br />
Nürtingen am 4. September 1795 an Schiller gerichtet ist, wiederum<br />
eine charakteristische Wendung, wenn es heißt, er sei eben <strong>nicht</strong><br />
wie Schiller ein "seltner Mensch".3 Auch damit ist auf das Minderwertigkeitsgefühl<br />
im Zusammenhang mit dem des Größenunterschieds<br />
hingedeutet, auf die Hauptursachen also, die Hölderlin <strong>von</strong><br />
Schiller wegtrieben. Weiter fällt in diesem Brief das gewichtige Wort,<br />
es sei ihm jetzt oft" wie einem Exulanten" zumute. Der Gedanke,<br />
ins Exil gehen zu müssen oder sich im Exil zu befinden, kehrt damals<br />
vielfach in Hölderlins Dichtungen und Briefen wieder. Im Exil<br />
Lebende, ins Exil Flüchtende sind Hyperion und Empedokles, aber<br />
auch die meisten anderen Hauptgestalten in diesen Werken; das<br />
3 Im Vorhergehenden hieß es (StA VI 181: "Ich glaube, daß diß das Eigentum der<br />
seltnen Menschen ist, daß sie geben können, ohne zu empfangen, daß sie sich auch<br />
>am Eise wärmen< können." Adolf Beck wies im Kommentar (StA VI 757) darauf<br />
hin, dass Hölderlin hier Worte Philines aus WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE, Buch 2,<br />
Kap. 4, zitiert. Aber auch der Passus vom uneigennützigen "Gebenkönnen, ohne<br />
zu empfangen" ist im Sinne Philines gedacht. Er erinnert an jenes Philine-Wort aus<br />
Buch 4, Kap. 9, das Goethe in DICHTUNG UND WAHRHEIT als Ausdruck spinozistischer<br />
" Uneigennützigkeit" und darum als "ihm recht aus dem Herzen gesprochen" bez<br />
ichnete:" Wenn ich dich lieb habe, was geht's dich an?" War Hölderlin, der noch<br />
in Waltershausen Spi noza studiert hatte, hier ein tiefverstehender Goetheleser?<br />
57
so vertraut wird, dass er ihr Übergewicht vergißt. Und fühlt er diß,<br />
so muß er eigensinnig oder unterwürfig werden."<br />
Aus all diesen Be<strong>kennt</strong>nissen geht eindeutig hervor: wenn für<br />
Hölderlin das Gefühl des Größenunterschieds zwischen Schiller<br />
und ihm so unerträglich wurde, so liegen die Gründe <strong>nicht</strong> in der<br />
Sphäre des Privaten, Persönlichen. Ein Kampf der Geister spielt<br />
sich ab, als solcher beispielhaft instruktiv und erregend. In der<br />
scheinbaren Überlegenheit des andern sah Hölderlin Gefahr für<br />
sein Werk, Gefahr für seine dichterische Entwicklung. Die "Ängstigkeit",<br />
die "Befangenheit", <strong>von</strong> der Hölderlin spricht, resultieren<br />
in Wahrheit aus einer Scheu vor dem "Unterjocht"-werden -<br />
darum bedeuten sie den "Tod der Kunst", den Tod auch für Hölderlins<br />
Kunst, für sein Dichten. Hölderlin konnte mit Schiller <strong>nicht</strong><br />
"vertraut" werden, weil ihm der eigene Genius verbot, hier, wo es<br />
um sein Schaffen ging, "unterwürfig" zu sein. So blieb nur der<br />
Ausweg des "Eigensinns": die Loslösung, die Flucht. Auf sich selbst<br />
gestellt, fand Hölderlin nun die ihm so nötige" Unabhängigkeit"<br />
<strong>von</strong> "andern Kunstrichtern und Meistern", deren Vorbild ihm auf<br />
seinem "Gang" nimmer nützlich sein konnte.<br />
Letzten Endes war also doch das Entweichen aus Jena ein Schritt<br />
<strong>von</strong> tiefster innerer Notwendigkeit. Hölderlins Weg als Dichter<br />
nahm eine Richtung, die Schiller <strong>nicht</strong> verständlich und akzeptabel<br />
sein konnte. Die Endfassung des HYPERION war bereits der Beweis<br />
hierfür, und Hölderlin befand sich damals auf dem schwierigen<br />
Weg hin zu dieser Endfassung, die etwas vollständig Neuartiges<br />
bringen sollte. Nicht zufällig tauchen alle jene Formulierungen der<br />
Abwehr gerade in dem Brief auf, der die Sendung des ersten Bandes<br />
des HYPERION an Schiller begleitete. In dieser Stunde war sich<br />
Hölderlin bewußt geworden, wie notwendig für ihn die Befreiung<br />
<strong>von</strong> Schiller und seinen Einflüssen war, mochte auch in anderem,<br />
in menschlichem Bereich die alte "Anhänglichkeit" fortbestehen.<br />
Denn man darf hier daran erinnern: gerade auf die Arbeit am Hy<br />
PERlON hatte Schiller in Jena mit voller Absichtlichkeit einzuwirken<br />
versucht. Das ist bezeugt durch sein Empfehlungsschreiben an<br />
Cotta, in dem Schiller ausdrücklich erklärt, er hoffe auf Hölderlins<br />
Roman "noch einigen Einfluß zu haben" (9. März 1795). Man wird<br />
60<br />
<strong>nicht</strong> fehlgehen in der Annahme, dass es wesentlich diese Entwicklung<br />
war, der Hölderlin schließlich gewaltsam entwich. Bezeichnend<br />
ist es im übrigen, dass Hölderlin nach dem Erscheinen des<br />
HYPER ION-Bandes zwei volle Monate verstreichen ließ, bis er das<br />
Buch, auf das er doch stolz war, an Schiller sandte!<br />
Schillers Ratschläge waren also für Hölderlin mehr irritierend<br />
als nützlich. Dies wird auch ersichtlich aus folgender Briefäußerung<br />
vom August 1797: "Sie sagen, ich sollte Ihnen näher seyn, so<br />
würden Sie mir sich ganz verständlich machen können." (Das bedeutet:<br />
Schiller hatte - in einem <strong>nicht</strong> erhaltenen Schreiben - den<br />
Wunsch ausgesprochen, Hölderlin wieder in literarischen Dingen<br />
zu beraten.) "Aber glauben Sie", so fährt Hölderlin fort, "daß ich<br />
denn doch mir sagen muß, daß <strong>Ihr</strong>e Nähe mir <strong>nicht</strong> erlaubt ist?<br />
Wirklich, Sie beleben mich zu sehr, wenn ich um Sie bin. Ich weiß<br />
es noch ganz gut, wie <strong>Ihr</strong>e Gegenwart mich immer entzündet,<br />
daß ich den ganzen andern Tag zu keinem Gedanken kommen<br />
konnte. So lang ich vor Ihnen war, war mir das Herz fast zu klein,<br />
und wenn ich weg war, konnt' ich es gar <strong>nicht</strong> mehr zusammenhalten.<br />
Ich bin vor Ihnen, wie eine Pflanze, die man erst in den<br />
Boden gesetzt hat. Man muß sie zudeken um Mittag. Sie mögen<br />
über mich lachen; aber ich spreche Wahrheit."<br />
Hier haben wir nun in aller Schlichtheit das Be<strong>kennt</strong>nis: Hö]derlin<br />
sieht es als <strong>nicht</strong> erlaubt an, in Schillers Nähe zu verw ilen,<br />
er verbietet sich diese Nähe. Die höfliche Formulierung d r<br />
Begründung läßt doch genau erkennen, worum es sich hand It.<br />
Hölderlin kann, sobald Schiller unmittelbar auf ihn einwirkt, "zu<br />
keinem Gedanken kommen" - gemeint ist natürlich: er wird in<br />
seinem schöpferischen Denken und Arbeiten gehemmt, irriti rt.<br />
Das Wachstum seines Werkes ist gefährdet. Darauf deutet auch da<br />
Gleichnis <strong>von</strong> der jungen Pflanze, die man zudecken müss : di<br />
grelle Einstrahlung einer zu hoch stehenden Sonne hemmt ihr<br />
E n tfa I tung.<br />
Eine womöglich noch deutlichere Geste der Abwehr enthält da<br />
nächste Schreiben vom 30. Juni 1798. Hier gesteht Höld rlin, da<br />
hillers "Macht" ihm "längst vieleicht den Muth g nomm n h··tt<br />
, w nn es <strong>nicht</strong> eben so große Lust wäre, als es Schm rz i t, Si<br />
61
zu kennen". Im folgenden heißt es: "Sie wissen es selbst, dass jeder<br />
große Mann den andern, die es <strong>nicht</strong> sind, die Ruhe nimmt, und<br />
dass nur unter Menschen, die sich gleichen, Gleichgewicht und<br />
Unbefangenheit besteht. Deßwegen darf ich Ihnen wohl gestehen,<br />
dass ich zuweilen in geheimem Kampfe mit <strong>Ihr</strong>em Genius bin, um<br />
meine Freiheit gegen ihn zu retten, und dass die Furcht, <strong>von</strong> Ihnen<br />
durch und durch beherrscht zu werden, mich schon oft verhindert<br />
hat, mit Heiterkeit mich Ihnen zu nähern. Aber nie kann ich mich<br />
ganz aus <strong>Ihr</strong>er Sphäre entfernen; ich würde mir solch einen Abfall<br />
schwerlich vergeben." Wieder einmal wird hier der Ton demütiger<br />
Ängstlichkeit, den Hölderlin sonst in den Briefen an Schiller<br />
möglichst zu bewahren strebt, unwillkürlich durchbrochen - durch<br />
die bedeutungsschwere Wendung, dass der Hölderlinsche und der<br />
Schillersche Genius "in geheimem Kampf" stehen. Es ist klar, dass<br />
es bei diesem Kampf <strong>nicht</strong> sowohl um Persönliches geht, als um<br />
das Größte und Letzte: das Werk.<br />
Wie distanziert Hölderlins Verhältnis zu Schiller in dieser Zeit<br />
eigentlich war, das verrät noch besser als die an Schiller adressierten<br />
Briefe, die immer mit kunstvoller Rücksicht formuliert sind,<br />
eine ganz nüchterne Stelle in einem Schreiben an den Freund<br />
Neuffer vom März 1796. Hier sagt Hölderlin: "Übrigens ist es<br />
ziemlich unbedeutend, ob ein Gedicht mehr oder weniger <strong>von</strong> uns<br />
in Schillers Allmanache steht. Wir werden doch, was wir werden<br />
sollen." Der Passus spielt darauf an, dass Schiller Hölderlins Gedicht<br />
AN DIE NATUR zu drucken abgelehnt hatte. Ähnliche Zurückweisungen<br />
erfolgten später noch öfter, und zwar gerade, als Hölderlin<br />
in seiner dichterischen Eigenart sich wirklich befestigt, als<br />
er auch auf dem Gebiet der Lyrik seinen eigenen Ton gefunden<br />
hatte. Auf dem Wege hin zu dieser Eigenart aber, so sehen wir,<br />
will Hölderlin sich schon jetzt durch Schiller <strong>nicht</strong> mehr stören lassen.<br />
Das bedeutet ja der kurze Satz: "Wir werden doch, was wir<br />
werden sollen."<br />
Es scheint nach all diesem gar kein Zweifel mehr möglich zu<br />
sein, dass die Flucht aus Jena tatsächlich eine Flucht vor Schiller<br />
war. Ein echtes und enges Zusammengehen mit Schiller war Hölderlin<br />
<strong>nicht</strong> möglich, es war, mit seinen eigenen Worten zu reden,<br />
62<br />
ihm "<strong>nicht</strong> erlaubt". Trennungen dieser Art sind unvermeidlich und<br />
haben in der Geistesgeschichte manche Parallele. Aus ähnlicher<br />
innerer Notwendigkeit haben sich z. B. Nietzsche und Wagner oder<br />
George und Hofmannsthai getrennt. Hier wird man sich der Worte<br />
aus Hölderlins Spätdichtung erinnern dürfen (DER EINZIGE):<br />
Oft aber scheint<br />
Ein Großer <strong>nicht</strong> zusammenzutaugen<br />
Zu Großem. Alle Tage stehn die aber, als an einem Abgrund einer<br />
Neben dem andern ...<br />
Nicht <strong>von</strong> ungefähr finden sich diese Worte in der Dichtung eines<br />
Großen, der selbst mit dem Genius eines andern Großen in "geheimen<br />
Kampf" geraten war, einen Kampf, dem nur völlige Trennung<br />
ein Ende setzen konnte. In derartigen Fällen bleiben die Getrennten<br />
nur noch in einer Abhängigkeit ganz anderer Art verbunden,<br />
es entsteht nun eine Freundschaft aus der Feme. Bekanntlich fand<br />
Nietzsche für sein Verhältnis zu Wagner nach der Trennung das<br />
schöne Wort: "Sternenfreundschaft". In gleicher Sternenfreundschaft<br />
blieb Hölderlin auch Schiller zeitlebens verbunden.<br />
II.<br />
Es ist <strong>nicht</strong> zu verwundern, dass das schmerzliche Erlebnis der<br />
Loslösung <strong>von</strong> Schiller in Hölderlins Dichtung der Jahre 1795 und<br />
1796 vielfach Ausdruck fand. In der Hölderlinforschung ist auch<br />
das viel erörtert worden. Nicht immer läßt sich dabei die Bezugnahme<br />
auf das Verhältnis zu Schiller wirklich nachweisen. Man<br />
hat z. B. <strong>von</strong> den Gestalten des Adamas und des Alabanda im Hy<br />
PERlON behauptet, dass sie auf die Schiller-Begegnung hindeuten.<br />
Auch die Gestalt des gereiften Hyperion, der einem jungen Besucher<br />
Rat erteilt (Metrische Fassung, HYPERIONS JUGEND), wurde mit<br />
Schiller in Zusammenhang gebracht. Das kann aber nur in ein m<br />
sehr begrenzten Maß als möglich gelten. Allenfalls kommen hi r<br />
in Betracht die Situationen als solche: Freundschaft und pädag -<br />
gisches Verhältnis, vielleicht noch der Umstand, dass regelmäßig<br />
63
äußerlich einen Zusammenhang aufweisen: nämlich durch die gemeinsame<br />
handschriftliche Überlieferung. Gerade das Wesen dieses<br />
Zusammenhangs bemerklich zu machen, ist eine Hauptabsicht<br />
unserer Ausführungen. Das Gedicht, das erst 1893 gedruckt wurde,<br />
lautet mit seinem <strong>von</strong> den Herausgebern geprägten Titel:<br />
66<br />
AN HERKULES<br />
In der Kindheit Schlaf begraben<br />
Lag ich, wie das Erz im Schacht;<br />
Dank, mein Herkules! den Knaben<br />
Hast zum Manne du gemacht,<br />
Reif bin ich zum Königssitze<br />
Und mir brechen stark und groß<br />
Thaten, wie Kronions Blize,<br />
Aus der Jugend Wolke los.<br />
Wie der Adler seine Jungen,<br />
Wenn der Funk' im Auge klimmt,<br />
Auf die kühnen Wanderungen<br />
In den frohen Aether nimmt,<br />
Nimmst du aus der Kinderwiege,<br />
Von der Mutter TIsch' und Haus<br />
In die Flamme deiner Kriege,<br />
Hoher Halbgott mich hinaus.<br />
Wähntest du, dein Kämpferwagen<br />
Rolle mir umsonst ins Ohr?<br />
Jede Last, die du getragen,<br />
Hub die Seele mir empor,<br />
Zwar der Schüler mußte zahlen;<br />
Schmerzlich brannten, stolzes Licht<br />
Mir im Busen deine Strahlen,<br />
Aber sie verzehrten <strong>nicht</strong>.<br />
Wenn für deines Schiksaals Woogen<br />
Hohe Götterkräfte dich,<br />
Kühner Schwimmer! auferzogen,<br />
Was erzog dem Siege mich?<br />
Was berief den Vaterlosen,<br />
Der in dunkler Halle saß,<br />
Zu dem Göttlichen und Großen,<br />
Daß er kühn an dir sich maß?<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
Was ergriff und zog vom Schwarme<br />
Der Gespielen mich hervor?<br />
Was bewog des Bäumchens Arme<br />
Nach des Aethers Tag empor?<br />
Freundlich nahm des jungen Lebens<br />
Keines Gärtners Hand sich an,<br />
Aber kraft des eignen Strebens<br />
Blikt und wuchs ich himmelan.<br />
Sohn Kronions! an die Seite<br />
Tref ich nun erröthend dir,<br />
Der Olymp ist deine Beute;<br />
Komm und theile sie mit mir!<br />
Sterblich bin ich zwar geboren,<br />
Dennoch hat Unsterblichkeit<br />
Meine Seele sich geschworen,<br />
Und sie hält, was sie gebeut.<br />
Das Gedicht ist, wie man annimmt, am 24. Juli 1796 an Schiller<br />
gesandt worden, der jedoch Hölderlins Bitte, es zu drucken, <strong>nicht</strong><br />
erfüllte. Was seine Form betrifft, so gehört AN HERKULES zu den<br />
wenigen Nachzüglern der Tübinger Reimhymnen, die eine dichterische<br />
Schönheit besonderer Art aufweisen. Es ist geschrieben im<br />
Versmaß <strong>von</strong> Schillers LIED AN DIE FREUDE, das auch einer Reihe anderer<br />
Reimhymnen zugrunde lag.<br />
Wilhelm Böhm sah das Gedicht vor allem als Ausdruck eines<br />
neuen gesteigerten Selbstgefühls an, gerade im Hinblick auf das<br />
Verhältnis zu Schiller. Gewiß ist das richtig. Was jedoch ebenfalls<br />
darin, und zwar in allen Teilen des Gedichts, zur Darstellung<br />
kommt, das scheint doch jenes intensive Erlebnis des Größenunterschieds<br />
zu sein - des vermeintlichen Größenunterschieds -, <strong>von</strong><br />
dem wir in den Briefen an Schiller so viele Spuren fanden. Auf<br />
diesen Größenunterschied spielt hier natürlich die mythologische<br />
inkleidung an, allerdings mit Betonung eines stolzen Gefühls des<br />
ignen Werts. Herkules ist der Sohn des Zeus und einer Sterblih<br />
n, der Dichter dagegen sieht sich als »vaterlos«, als <strong>nicht</strong> gött-<br />
Ii h geboren. Aber zu den »Kriegern«, die Herkules führt, nahm er<br />
n Dichter »mit hinaus«, wie der Adler seine Jungen zum Höhen-<br />
35<br />
40<br />
45<br />
67
flug. Das hat ihn, den Dichter, aus dem Schlaf der Kindheit geweckt<br />
und »zum Manne gemacht«, er fühlt sich nun seinerseits<br />
»reif zum Königssize«. Bei dem Bild der gemeinsam unternommenen<br />
Kriege dürfen wir uns daran erinnern, dass gegen Ende des<br />
Jahres 1794 ein Heft der Schillerschen THALlA erschienen war, in<br />
welchem einzig Hölderlin und Schiller als Autoren auftraten, und<br />
zwar Hölderlin mit dem umfangreichen Fragment aus Hyperion<br />
und dem Gedicht DAS SCHICKSAL. Eine Bundes-, eine Kampfgenossenschaft<br />
dieser Art mit Schiller hatte Hölderlin sich weiterhin erträumt.<br />
Sie war <strong>nicht</strong> möglich gewesen.<br />
Der Dichter be<strong>kennt</strong>, durch Herkules »zum Manne« gemacht<br />
worden zu sein. Er betont aber zugleich, dass er <strong>von</strong> niemandem -<br />
also auch <strong>nicht</strong> <strong>von</strong> Herkules - »erzogen« ward. Kein »Gärtner«<br />
hat sich seines jungen Lebens angenommen. Auf diese Pointe leiten<br />
die rhetorischen Fragen der Verse 28 bis 36 sehr wirkungsvoll<br />
hin. Ein Vorwurf gegen Schiller ist hier wohl <strong>nicht</strong> zu verkennen.<br />
Dessen Pflege und Erziehung ward also <strong>von</strong> Hölderlin <strong>nicht</strong> als<br />
entscheidend und eigentlich fruchtbar angesehen. Gerade darin<br />
aber: dass den einen »Götterkräfte« auferzogen, der andre aber<br />
einzig und allein aufs »eigne Streben« angewiesen war, gerade<br />
darin wird jetzt der Größenunterschied in neuer Weise empfunden.<br />
In der Schlußstrophe äußert sich dann ein geradezu promethischer<br />
Trotz. Der Dichter zeigt sich willens, den begonnenen Kampf<br />
auch ohne Hilfe des Bundesgenossen allein weiterzuführen. Er fühlt<br />
die Kraft in sich, mit dem Sohn des Zeus zu wetteifern und die<br />
»Unsterblichkeit«, die ihm die Geburt versagte, auf eigne Weise zu<br />
erringen. Eine deutlich agonale Haltung tritt damit zutage: der<br />
unbedingte Wille zum Wettstreit mit dem Größeren. Der Göttersohn<br />
soll die Beute mit ihm teilen.<br />
Alles das sind wirklich Bekundungen einer neuen Selbstsicherheit.<br />
Die Empfindung des Größenunterschieds verleiht jetzt<br />
Schwung und Kraft zum eigenen Wagen. Es erscheint so, als ob<br />
das bisherige Leiden an diesem Größenunterschied als etwas Überwundenes,<br />
auch als eine überstandene Gefahr hinter dem Dichter<br />
liegt. Hierauf weist besonders der Schluß der 3. Strophe, den schon<br />
68<br />
Wilhelm Böhm als "durchaus erlebt" empfand, erlebt im Zusammenhang<br />
mit Schiller:<br />
Zwar der Schüler mußte zahlen;<br />
Schmerzlich brannten, stolzes Licht<br />
Mir im Busen deine Strahlen,<br />
Aber sie verzehrten <strong>nicht</strong>.<br />
Es verdient Beachtung, dass diese Verse auf die Mythen <strong>von</strong> Phaethon<br />
und Ikarus anspielen. In beiden Mythen gibt ja dies den Ausschlag,<br />
dass die Strahlen der Sonne <strong>nicht</strong> nur schmerzlich brennen,<br />
sondern unheilbringend verzehren: Phaethon, der in stolzem<br />
Leichtsinn den Sonnenwagen seines Vaters Helios lenkt, verursacht<br />
dadurch einen Weltbrand, bis ihn der Blitz des Zeus trifft; Ikarus,<br />
der mit den <strong>von</strong> seinem Vater Dädalus gefertigten Flügeln ehrgeizig<br />
allzu hoch stieg, ging dadurch unter, dass die Sonne ("rapidus<br />
sol" bei Ovid) das Wachs, das die Federn zusammenhielt, schmelzen<br />
machte. Wenn Hölderlin diese Mythen heranzieht, so ist das<br />
<strong>nicht</strong> Zufall. Schiller hatte ihm noch in der letzten Jenaer Zeit den<br />
Auftrag gegeben, die Phaethon-Episode aus Ovids Metamorphosen<br />
zu übersetzen für seinen MUSENALMANACH. Hölderlin hatte den<br />
Auftrag ausgeführt, Schiller aber nalun dann die Übersetzung doch<br />
<strong>nicht</strong> auf. So liegt also auch in dieser Partie der HERKuLEs-Hymne<br />
eine direkte Schiller-Anspielung vor.<br />
Zweifellos verband Schiller mit seinem Auftrag einen pädagogisch<br />
wohlgemeinten Gedanken. Mit dem Hinweis auf den Phaethon-Mythos<br />
wurde Hölderlin veranlaßt, über die Gefahren eines<br />
das Maß übersteigenden geistigen Höhenflugs zu reflektieren. Diese<br />
Gefahren mag Schiller in Hölderlins Persönlichkeit gesehen haben<br />
wie auch in seinem Di
"In seinen Höhn den Geist emporzuhalten, im stillen Reiche der<br />
Unvergänglichkeit, und heiter doch hinab in's wechselnde Leben<br />
der Menschen ... zu bliken, ... Diß ist das Beste!" (1. Kapitel); oder:<br />
"Siehe das Licht des Himmels an! Bedarf es fremden Feuers, um<br />
zu leuchten und zu wärmen? ... So sei auch du!" (3. Kapitel). Schiller<br />
kannte diese Stellen, und eine Strophe aus DIE IDEALE (erschienen<br />
Januar 1796 im Musenalmanach für das Jahr 1796) weist auf<br />
dieses Motiv des Höhenflugs hin, wiederum mit einem Anklang<br />
an den Ikarus-Mythos:<br />
So sprang, <strong>von</strong> kühnem Muth beflügelt,<br />
Ein reißend bergab rollend Rad,<br />
Von keiner Sorge noch gezügelt,<br />
Der Jüngling in des Lebens Pfad.<br />
Bis an des Äthers bleichste Sterne<br />
Erhub ihn der Entwürfe Flug,<br />
Nichts war so hoch, und <strong>nicht</strong>s so ferne,<br />
Wohin ihr Flügel ihn <strong>nicht</strong> trug.<br />
Die ersten beiden Verse dieser Strophe klingen wie ein Nachhall<br />
einer Charakteristik Hölderlins, die Charlotte v. Kalb in ihrem Brief<br />
an Schiller vom 14. Januar 1795 gab: "Er [Hölderlin] ist ein Rad<br />
welches schnell läuft!!"7 Die Anspielung auf den Ikarus-Mythos<br />
in DIE IDEALE scheint Hölderlin übrigens als auch einen Bezug auf<br />
sich selbst einschließend empfunden zu haben. Denn sein Hymnus<br />
AN HERKULES enthält gleichfalls eine Reminiszenz an diesen<br />
Mythos, und zwar unmittelbar an die Hauptquelle, die Ikarus<br />
Episode in Ovids METAMORPHOSEN. Wenn Herkules den »Knaben«<br />
in die »Flamme seiner Kriege« mitnimmt, so wird das illustriert<br />
durch dasselbe Gleichnis, das bei Ovid schildert, wie Dädalus den<br />
Sohn Ikarus zum Begleiter seines Höhenflugs macht. Bei Hölderlin<br />
heißt es (v. 9 ff.):<br />
7 Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 12 (1926), S. 139. Hölderlin-Jahrbuch 1950, S. 158.<br />
70<br />
Wie der Adler seine Jungen,<br />
Wenn der Funk' im Auge klimmt,<br />
Auf die kühnen Wanderungen<br />
In den frohen Aether nimmt ...<br />
(Es folgt dann die Stelle <strong>von</strong> den brennenden, aber <strong>nicht</strong> verzehrenden<br />
Strahlen.) Bei Ovid lesen wir über Dädalus:<br />
pennisque levatus<br />
Ante volat comitique timet, v e 1 u tal es, ab alto<br />
Quae teneram prolern prod uxit in aera nid o.<br />
und hoch <strong>von</strong> den Schwingen getragen<br />
Fliegt er voraus, besorgt um seinen Gefährten, dem Vogel<br />
Ähnlich, der hoch vom Nest in die Luft die Jungen hinausführt.8<br />
Die wörtlichen Übereinstimmungen zwischen Ovids und Hölderlins<br />
Text liegen offen am Tage. Bemerkt sei noch, dass Hölderlin<br />
bei der ersten Konzeption dieser Verse zunächst geschrieben hatte:<br />
"Wie der Adler seine Jungen ... aus dem Neste jagt."9 So findet<br />
also auch das flab alto ... nido" Ovids seine Entsprechung. Das<br />
Wort Adler begann Hölderlin zuerst versehentlich "Ale" zu schreiben:<br />
hier klang das Ovidsche "ales" dem Dichter noch lebhaft<br />
nach. lO Dass Hölderlin sich bei der Arbeit an der HERKuLEs-Hymne<br />
so intensiv mit Ovids Ikarus-Erzählung befaßte, wird erklärlich,<br />
wenn man berücksichtigt, welche Rolle das Motiv des Höhenflugs<br />
im Gespräch zwischen Schiller und ihm spielte; in dem Gespräch,<br />
<strong>von</strong> dem uns Kunde ward durch den Auftrag der Phaeton-Übersetzung<br />
und durch die Ikarus-Stelle der Ideale. Mit Bestimmtheit<br />
konnte Hölderlin damit rechnen, dass Schiller beim Lesen der HER<br />
KULEs-Hymne erkannte, wie hier insgeheim angespielt war auf sei-<br />
8 Ovid met., VII 212 H. Deutsch: Thassilo v. Scheffer.<br />
9 StA 1498.<br />
10 In der römischen Dichtung bedeutet ales in gewissen Zusammensetzungen auch<br />
ovi I wie Schwan = Sänger. (Vgl. Horaz carm. I 6; 11 20.) Diese Vorstellung wirkte<br />
b i Höld din mit, wenn auch nur während der Konzeption.<br />
71
ne eigenen Verse, die er nur wenige Monate zuvor veröffentlicht<br />
hatte. Wir werden sehen, dass auch weitere Anklänge an neueste<br />
Schillersehe Gedichte in der HERKuLEs-Hymne den genauen Bezug<br />
der letzteren auf Schiller verdeutlichen.<br />
Bereits Wilhelm Böhm sprach die Vermutung aus, dass Hölderlin<br />
zu der Behandlung des Herkules-Mythos überhaupt angeregt<br />
worden sei durch die beiden Schlußstrophen <strong>von</strong> Schillers Gedicht<br />
DAS REICH DER SCHATTEN, in denen Leben, Tod und Apotheose des<br />
Heros gefeiert werden. (Das Reich der Schatten lag Oktober 1795<br />
in den Horen gedruckt vor.) Eine Bestätigung für Böhms Annahme<br />
mag man noch darin erkennen, dass auch das Wort »Kämpferwagen«<br />
in Hölderlins HERKuLEs-Hymne einen Anklang an das Schi 1lersche<br />
Gedicht darstellt (v. 17 f.):<br />
Wähntest du, dein Kämpferwagen<br />
Rolle mir umsonst ins Ohr?<br />
In Schillers DAS REICH DER SCHArrEN heißt es (v. 81 ff.):<br />
Wenn es gilt, zu herrschen und zu schirmen,<br />
Kämpfer gegen Kämpfer stürmen<br />
Auf des Glückes, auf des Ruhmes Bahn,<br />
Da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen,<br />
Und mit krachendem Getös die Wagen<br />
Sich vermengen auf bestäubtem Plan.<br />
Muth allein kann hier den Dank erringen,<br />
Der am Ziel des Hippodromes winkt,<br />
Nur der Starke wird das Schicksal zwingen,<br />
Wenn der Schwächling untersinkt.<br />
Von dem Wort »Kämpferwagen« bietet diese Strophe die Bestandteile,<br />
nur gleichsam durch Tmesis geschieden. Die Strophe war im<br />
übrigen besonders geeignet, HölderlinsAufmerksamkeit zu erwekken,<br />
weil in ihr die Worte »Kühnheit« und »das Schicksal« die Erinnerung<br />
hervorriefen an zwei Hölderlinsche Hymnen, die Schiller<br />
kurz zuvor beide in seiner THALlA zum Druck gebracht hatte:<br />
DEM GENIUS DER KÜHNHEIT und DAS SCHICKSAL (erschienen Anfang 1795<br />
und November 1794). Beide Gedichte stehen inhaltlich - was auch<br />
immer beachtet worden ist - der HERKuLEs-Hymne besonders nahe;<br />
72<br />
DEM GENIUS DER KÜHNHEIT enthält bereits eine Erwähnung der Herkules-Gestalt.<br />
Die seltsam auffällige Wendung in der HERKULES<br />
Hymne, dass der »Kämpferwagen« dem Dichter <strong>nicht</strong> »umsonst<br />
ins Ohr« »rolle«, mag hervorgerufen sein durch das Auftreten eines<br />
fast gewaltsam akustischen Elements in Schillers Strophe aus<br />
dem REICH DER SCHATTEN.<br />
Wenn da<strong>von</strong> die Rede ist, dass Hölderlin durch Schillersch<br />
Dichtung zu seinemHERKuLEs-Hymnus angeregt wurde, so darf ein<br />
weiterer Zusammenhang <strong>nicht</strong> übersehen werden. Im MUSENAL<br />
MANACH für das Jahr 1796 (erschienen Januar 1796) findet sich fol <br />
gendes Epigramm Schillers:<br />
ZEU S z u HERKULE S<br />
Nicht aus meinem Nektar hast du dir Gottheit getrunken.<br />
Deine G ö tt e r k r a f t wars, die dir den Nektar errang.<br />
Es erscheinen hier zwei Gedankengänge, die uns sogleich an H ölderlins<br />
Gedicht erinnern: 1. Ins Blickfeld gerückt wird das Verhältnis<br />
des Herkules zu seinem göttlichen Vater. Durch dies Verhältnis<br />
ist er grundsätzlich bevorzugt. 2. Die Unsterblichkeit fällt ihm de -<br />
wegen jedoch <strong>nicht</strong> als Geschenk - durch die Gunst des Vaters _<br />
zu, er muß sie sich vielmehr erringen auf Grund der ihm innewohnenden<br />
»Götterkraft«. (Das Trinken des Nektars bedeutet hi r<br />
soviel wie Erlangung der Unsterblichkeit. Die Teilnahme am Göttermahl,<br />
die Bewirtung durch Hebe ist Teil der Apotheosis des H rkules,<br />
wie es auch am Schluß vom REICH DER SCHATTEN geschild rt<br />
wird.)l1 Es sind diese Gedankengänge, die auch bei Hölderlin di<br />
Basis für die Darstellung des Größenunterschieds geben. Von d n<br />
»Götterkräften« des Herkules spricht Hölderlins Gedicht v. 25 ff.:<br />
Wenn für deines Schicksaals Woogen<br />
HoheGötterkräfte dich,<br />
Kühner Schwimmer! auferzogen ...<br />
11 Ent pr h 'ndc Darstellung bei Horaz, cnrm . 111 3 und IV 8.<br />
7
Im weiteren Verlauf handelt das Gedicht da<strong>von</strong>, welches Äquivalent<br />
der mit Herkules Wetteifernde, aber <strong>nicht</strong> Göttlichgeborene<br />
für die »Götterkräfte« des Herkules finden kann, so dass er sich<br />
die »Unsterblichkeit« erringt, die er sich »geschworen« hat. Die<br />
Frage wird am Schluß mit selbstbewußt großartigem Akzent beantwortet.<br />
Gerade darin besteht der Fortschritt in der Auseinandersetzung<br />
mit Schiller - der Ausgleich des Größenunterschieds.<br />
Es kann hiernach <strong>nicht</strong> mehr zweifelhaft sein, dass vor allem Schillers<br />
Verse - <strong>nicht</strong> nur die im Reich der Schatten, sondern auch das<br />
zitierte Epigramm - Hölderlin zu dem Herkules-Stoff führten.<br />
Ein Satz aus HYPER/ONS JUGEND sei hier angeführt, in welchem<br />
gleichfalls <strong>von</strong> der »Götterkraft« gesprochen wird: "Wohl dem, der<br />
das Gefühl seines Mangels versteht! wer in ihm den Beruf zu unendlichem<br />
Fortschritt er<strong>kennt</strong>, zu unsterblicher (!) Wirksamkeit,<br />
wer im Schmerze der Erniedrigung den kleinen Trost verachten<br />
kann, unter den Kleinen groß zu seyn, ohne an sich zu verzweifeln,<br />
und den Glauben an die Götterkraft des Geistes aufzugeben<br />
... " (Kapitel 4). Die Gedanken sind ganz ähnlich wie diejenigen,<br />
die in der HERKuLEs-Hymne Ausdruck fanden. Nur ist in<br />
HYPERIONS JUGEND der Gesamtton noch schmerzlicher, während sich<br />
in dem späteren Gedicht die Wendung ins Positive zeigt. Schiller<br />
kannte HYPER/ONS JUGEND. War auch sein <strong>von</strong> den »Götterkräften«<br />
sprechendes Epigramm durch Hölderlin angeregt?<br />
Von Interesse in unserm Zusammenhang ist endlich noch eine<br />
Entwurffassung <strong>von</strong> Vers 17 bis 24 der HERKuLEs-Hymne, die sich<br />
in der Handschrift findet. Die Verse, mit den ursprünglich der<br />
erste Entwurf endete, lauten:<br />
74<br />
Höre was ich nun beginne<br />
Wie der Pfeil im Köcher liegt<br />
Mir ein stolzer Rath im Sinne,<br />
Der mich tödtet oder siegt,<br />
Was du, glücklicher geschaffen,<br />
Als der Göttersohn vollbracht,<br />
Führ' ich aus mit eignen Waffen,<br />
[Mit des Menschen Muthl<br />
Mit des Herzens Lust und Macht.<br />
Bin ich gleich, wie du, in Freude<br />
Nicht <strong>von</strong> Jupiter erzeugt,<br />
Dennoch krönt ein Sinn uns heide,<br />
[Den der Himmel selbst <strong>nicht</strong> beugt]<br />
Den kein Atlas niederbeugt. 12<br />
In diesen Entwurfsversen erscheint besonders deutlich gefaßt der<br />
Grundgedanke, der das Gedicht beherrscht: Herkules-Schilller ist<br />
der glückhaft begnadete Halbgott, der Dichter dagegen ist Mensch,<br />
»<strong>nicht</strong> <strong>von</strong> Jupiter erzeugt«. Doch damit verbindet sich der Entschluß<br />
zum Wettstreit, zum Agon, der Wille, mit »eignen Waffen«<br />
Gleiches zu vollbringen wie der andre, der nun <strong>nicht</strong> mehr als ein<br />
völlig Überlegener gesehen wird: das Gefühl des Größenunterschieds<br />
weicht damit einer stolz prometheischen Gesinnung,<br />
wird zum Trotz dessen, den »der Himmel selbst <strong>nicht</strong> beugt«. Da<br />
kommt hier im Entwurf noch unvermittelter zum Ausdruck als in<br />
der Endfassung. (So stehen auch diese Entwurfsverse - schon durch<br />
die Betonung der Jupiter-Sohnschaft - dem Schillerschen Epigramm<br />
Zws AN HERKULES besonders nahe.)<br />
Beherrschend wird also jetzt das Wissen um die eigene Kraft,<br />
die der »Götterkraft« des anderen ebenbürtig ist. Die HERKULES<br />
Hymne läßt erkennen - in den Entwurfsversen ganz besonders - ,<br />
dass Hölderlin Wille und Macht in sich verspürt, auch ohne ein<br />
Kampfgenossenschaft, wenn es sein muß, allein seinen Weg zur<br />
Höhe zu gehen. Darin liegt das Titanenhafte, das Prometheisch<br />
des Gedichts. Auch ohne Hilfe des großen Freundes wird Höld rlin<br />
seinen Kampf zu Ende kämpfen »kraft des eignen Strebens«. r<br />
wird die Kelter allein treten. Dieser nämlichen Gesinnung entspricht<br />
es, wenn Hölderlin in Briefen <strong>von</strong> Anfang des Jahres 1796 s t:<br />
"Ich werde mich auch ... daran gewöhnen ... mein Herz mehr darauf<br />
zu richten, dass ich der ewigen Schönheit mehr durch eign<br />
Streben (!) und Wirken mich zu nähern suche, als dass ich etw ,<br />
was ihr gliche, vorn Schiksaal erwartete." Oder: "Übrigens ist<br />
12 Das Bild des niederbeugenden Berges begegnet bei Qvid, met. IX 56 (Kampf cl<br />
H rkules und Achelous).<br />
7
ziemlich unbedeutend, ob ein Gedicht mehr oder weniger <strong>von</strong> uns<br />
in Schillers Allmanache steht. Wir werden doch, was wir werden<br />
sollen." Die gleiche prometheische Gesinnung spricht aus jener<br />
Partie in HYPERIONS JUGEND, wo es heißt - wir zitierten es schon -:<br />
"Sagen würd ich [ ... ] in brüderlichem Zusammenwirken bestehe<br />
das Beste, doch sei es auch herrlich, allein zu stehn, und sich hindurchzuarbeiten<br />
durch die Nacht, wenn es an Kampfgenossen gebreche."<br />
IV.<br />
"Allein zu stehn", das ist die Situation, die Hölderlin jetzt als Problem<br />
und Aufgabe auf sich zukommen sieht, nachdem eine<br />
"Kampfgenossenschaft", ein heroisches Freundschaftsbündnis mit<br />
Schiller, so wie er es sich erträumt hatte, unmöglich geworden war.<br />
Das Motiv des Alleinstehens nun hat Hölderlin noch einmal gesondert<br />
behandelt in einem Gedicht, das der handschriftlichen<br />
Überlieferung nach aufs engste mit dem HERKuLEs-Hymnus zusammengehört.<br />
Es ist das Gedicht DIE EICHBÄUME. Eine erste Fassung<br />
diese Gedichts, der noch die abschließenden fünfeinhalb Hexameter<br />
fehlen - Hölderlin schreibt erstmals nach längerer Pause wieder<br />
Hexameter -, schließt in der Handschrift unmittelbar an die<br />
letzte Strophe des HERKuLEs-Hymnus an. Erst geraume Zeit später<br />
verfaßte Hölderlin die ergänzenden Schlußverse. Das gesamte<br />
Gedicht erschien dann Februar 1798 in Schillers HOREN (Jahrgang<br />
1797). Es lautet (die später entstandene Schlußpartie ist hier in<br />
Klammem gesetzt):<br />
76<br />
DIE EICHBÄUME<br />
Aus den Gärten komm' ich zu euch, ihr Söhne des Berges!<br />
Aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich,<br />
Pflegend und wieder gepflegt mit dem fleißigen Menschen zusammen.<br />
Aber ihr, ihr Herrlichen! steht, wie ein Volk <strong>von</strong> Titanen<br />
In der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel,<br />
Der euch nährt' und erzog und der Erde, die euch geboren.<br />
Keiner <strong>von</strong> euch ist noch in die Schule der Menschen gegangen,<br />
Und ihr drängt euch fröhlich und frei, aus der kräftigen Wurzel,<br />
Unter einander herauf und ergreift, wie der Adler die Beute,<br />
Mit gewaltigem Arme den Raum, und gegen die Wolken<br />
Ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet.<br />
Eine Welt ist jeder <strong>von</strong> euch, (wie die Sterne des Himmels<br />
Lebt ihr, jeder ein Gott, in freiem Bunde zusammen.<br />
Könnt' ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer<br />
Diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben.<br />
Fesselte nur <strong>nicht</strong> mehr ans gesellige Leben das Herz mich,<br />
Das <strong>von</strong> Liebe <strong>nicht</strong> läßt, wie gern würd' ich unter euch wohnen!)<br />
In diesem Gedicht werden nun die Eichen, das »Volk <strong>von</strong> Titanen«,<br />
zum Symbol des prometheischen Trotzes, des titanenhaften Alleinstehens.<br />
Den Gegensatz zu dieser heroischen WeIt bildet die der<br />
Gärten, in der die Natur <strong>von</strong> Menschen gepflegt wird, wo sie mit<br />
dem Menschen zusammen, dadurch aber auch in Abhängigkeit<br />
<strong>von</strong> ihm lebt. Motivisch steht das der HERKULEs-Hymne ganz nahe.<br />
Im titanenhaften Alleinstehen wird ja auch dort die Konsequenz<br />
gezogen aus der Lebenssituation:<br />
Freundlich nahm des jungen Lebens<br />
Keines Gärtners Hand sich an,<br />
Aber kraft des eignen Strebens<br />
Blikt und wuchs ich himmelan.<br />
Das Motiv der Gärten, der Pflege durch den Gärtner, klang schon<br />
dort auf, in DIE EICHBÄUME wird es nun modifiziert weitergeführt.<br />
Auch jetzt aber bezieht sich das Motiv vor allem auf das Verhältnis<br />
zu Schiller. Der Eichbaum wächst aus eigener Kraft, selbständig,<br />
ohne Pflege der Menschen. Nahrung, Erziehung verdankt er einzig<br />
der Natur. All das deutet auf die neugewonnene Unabhängigkeit<br />
Hölderlins: in dem zu Anfang des Jahres 1796 geschriebenen<br />
Hauptteil des Gedichts kommt noch durchweg die Stimmung zum<br />
Ausdruck, die den Dichter nach der Lösung <strong>von</strong> Schiller beherrschte.<br />
Die erst ein Jahr später hinzugefügten Schlußverse spiegeln<br />
andere Erlebnisse, bringen mit ihrer pointierten Gedankenfolge ein<br />
neues Element in das Gedicht. Dies bedarf einer besonderen Betrachtung.<br />
Wir kommen später darauf zu sprechen.<br />
77
Seitens der Forschung ist der in DIE EICHBÄUME zutage tretende<br />
Bezug auf Schiller ebensowenig allgemein anerkannt worden wie<br />
im Falle des HERKuLEs-Gedichts. Das mag sich erklären durch die<br />
Veränderung des Tenors, die der nachträglich hinzugefügte Schluß<br />
in das Gedicht bringt. Es muß aber doch auf den Zusammenhang<br />
mit Schiller in den Hauptpartien geachtet werden - ohne das wären<br />
DIE EICHBÄUME in ihrem Eigentlichen <strong>nicht</strong> genügend verstanden.<br />
Hinzu kommen aber auch unmittelbare Zusammenhänge zwischen<br />
Hölderlins und Schillers Texten. Wiederum hat Wilhelm<br />
Böhm gerade im Falle der EICHBÄUME nachgewiesen, dass darin ein<br />
ganz spezieller Anklang an ein Schillersches Gedicht auftaucht,<br />
und zwar an die berühmte ELEGIE (später betitelt: DER SPAZIERGANG),<br />
die im November 1795 in den HOREN erschienen war - zeitlich also<br />
durchaus in Nähe der Konzeption DER EICHBÄUMEY Im Erstentwurf<br />
schrieb Hölderlin nämlich die Verse 9 und 10 zunächst so nieder:14<br />
und des Gärtners Linie scheidet<br />
Und gesellet euch <strong>nicht</strong> in [den] allzufriedlichen Reihen.<br />
Böhm erkannte, dass hier ein Anklang vorliegt an Schillers ELEGIE<br />
(v. 41):<br />
Jene Linien, die des Landmanns Eigenthum scheiden ...<br />
Böhm wies auch darauf hin, dass in Hölderlins DIE EICHBÄUME und<br />
in Schillers ELEGIE die Hauptsituation die gleiche ist. Der Dichter<br />
steigt hinauf aus dem Tal ins Gebirge und erlebt so den Unterschied<br />
zwischen der gezähmten, kultivierten und der ursprünglichen,<br />
freien Natur - bei Hölderlin wird nur der "Akzent gelegt<br />
auf den Gegensatz: Zusammenleben in Abhängigkeit und Alleinstehen<br />
in titanenhafter Freiheit.<br />
Motivische Zusammenhänge zwischen Schillers Elegie und<br />
Hölderlins Die Eichbäume ließen sich noch mehr zeigen. Zunächst<br />
13 Böhm (1928) 1, 218.<br />
14 StA I 501.<br />
78<br />
sei aber die Aufmerksamkeit noch auf etwas anderes gelenkt. Es<br />
gibt weitere Anspielungen auf ein Schillersches Gedicht aus jener<br />
Zeit, und zwar in beiden Gedichten Hölderlins, sowohl in dem<br />
Hymnus AN HERKULES als auch in DIE EICHBÄUME. In den HOREN erschien<br />
Oktober 1795 das Schillers ehe Gedicht DER PHILOSOPHISCHE<br />
EGOIST. Auch dieses Gedicht handelt vom Thema des Alleinstehns,<br />
der selbstbewußten Isolierung. An sich wird das Thema allgemein<br />
gefaßt: der Weisheitsliebende wird gemahnt, sich <strong>nicht</strong> <strong>von</strong> der<br />
Natur zu trennen. Aber dies bereits ist ein Gedanke, den gerade<br />
Hölderlin in den zu Jena geschriebenen Fassungen des HYPERION,<br />
der sogenannten Metrischen Fassung und HYPERIONS JUGEND, mit<br />
starken Akzenten ausgesprochen hat. Wie man weiß, wandte Hölderlin<br />
sich damit gegen Fichte. Es scheint nun, dass Schiller diesen<br />
Gedanken Hölderlins, den er ja kannte, benutzt hat, um, <strong>von</strong> ihm<br />
ausgehend und Hölderlin dadurch anredend, diesem einen deutlich<br />
vernehmbaren Rat zu erteilen, eine Warnung an den abtrünnigen<br />
Schützling zu richten. Die letzten Verse <strong>von</strong> DER PHILOSOPHISCHE<br />
EGOIST treffen nämlich in höchst merkwürdiger Weise auf Hölder<br />
!ins damalige Situation zu, nachdem er sich <strong>von</strong> Schiller entfernt<br />
hatte. Dies ist so auffällig, dass Hölderlin hierin sehr wohl eine<br />
Anspielung auf sich selbst sehen konnte, ja sehen mußte. Schillers<br />
Gedicht lautet:<br />
DER PHILOSOPHISCHE EGOIST<br />
Hast du den Säugling gesehn, der, unbewußt noch der Liebe,<br />
Die ihn wärmet und wiegt, schlafend <strong>von</strong> Arme zu Arm<br />
Wandert, biß bey der Leidenschaft Ruf der Jüngling erwachet,<br />
Und des Bewußtseyns Blitz dämmernd die Welt ihm erhellt?<br />
Hast du eine Mutter gesehn, wenn sie Schlummer dem Kinde 5<br />
Kauft mit dem eigenen Schlaf, und für das Sorglose sorgt,<br />
Nährt mit ihrem eigenen Leben die zitternde Flamme,<br />
Und mit der Sorge selbst sich für die Sorge belohnt?<br />
Und du lästerst die grosse Natur, die bald Kind und bald Mutter<br />
Jetzt empfänget, jetzt giebt, nur durch Bedürfniß besteht? 10<br />
Selbstgenügsam willst du dem schönen Ring dich entziehen,<br />
Der Geschöpf an Geschöpf reyht in vertraulichem Bund,<br />
Willst, du Armer, stehen all ein und allein durch dich selber,<br />
Wenn durch der Kräfte Tausch selbst das Unendliche steht?<br />
79
Mir scheint, dass besonders der Passus: »Willst, du Armer, stehen<br />
allein und allein durch dich selber« - mit der durch Schiller veranlaßten<br />
Betonung des Wortes »allein« durch Sperrdruck - Hölderlins<br />
Lage <strong>von</strong> damals seltsam genau bezeichnet. Über sein AIleinstehn<br />
und seine "Armseligkeit" hatte Hölderlin ja auch gerade<br />
geklagt in dem ersten Brief an Schiller aus Nürtingen, der seinen<br />
Weggang aus Jena entschuldigen, als "Apologie" begründen sollte.<br />
Wobei er allerdings zugleich bekannte: "Ich lebe sehr einsam<br />
und glaube, dass es mir gut ist."<br />
Offenbar besteht doch nun auch ein Zusammenhang zwischen<br />
diesen Schillerschen Versen und den sehr bald nach ihrem Erscheinen<br />
verfaßten Hölderlinschen Gedichten, die das Thema der titanischen<br />
Selbstisolierung behandelten. Eine ganze Reihe <strong>von</strong> Anklängen<br />
tritt hier zutage:<br />
1. Sowohl bei Schillers DER PHILOSOPHISCHE EGOIST als auch bei<br />
Hölderlins HERKuLEs-Hymnus steht am Anfang das Bild des schlafenden<br />
Kindes, des Kindes, das dann gepflegt und aufgezogen wird.<br />
Bei Schiller ist es die Natur, die das Kind aufzieht, bei Hölderlin ist<br />
es der Halbgott Herkules:<br />
In der Kindheit Schlaf begraben<br />
Lag ich, wie das Erz im Schacht;<br />
Dank, mein Herkules! den Knaben<br />
Hast zum Manne du gemacht [ ... ]<br />
Von der »Kindheit Schlaf« spricht das Hölderlinsche, vom schlafenden<br />
Säugling das Schillersche Gedicht. In letzterem wiederholen<br />
sich sogar die Wendungen, die auf Schlummer und Schlaf deuten,<br />
in den Versen 5 f.:<br />
Hast du eine Mutter gesehn, wenn sie Schlummer dem Kinde<br />
Kauft mit dem eigenen Schlaf [ ... ]?<br />
Der für eine HERKuLEs-Hymne merkwürdige Beginn würde sich<br />
erklären, wenn man ihn als Replik auf Schillers DER PHILOSOPHISCHE<br />
EGOIST auffaßt, mit besonderem Bezug auf dessen Eingangsverse.<br />
2. Im zweiten Vers <strong>von</strong> Schillers DER PHILOSOPHISCHE EGOIST heißt<br />
es, dass die Mutter das Kind »wiegt«: »Die ihn wärmet und wiegt«.<br />
80<br />
Das Bild <strong>von</strong> der Wiege taucht auch, seltsam genug, in Hölderlins<br />
HERKULEs-Hymne auf (v. 13 ff.):<br />
[ ... ]<br />
Nimmst du aus der Kinderwiege,<br />
Von der Mutter Tisch' und Haus<br />
In die Flamme deiner Kriege,<br />
Hoher Halbgott mich hinaus.<br />
Bei Schiller wird das Bild der wiegenden Mutter weiterhin in<br />
Parallele gesetzt zu der »großen Natur«, als »Mutter«. Hier ist daran<br />
zu erinnern, dass Hölderlin bereits früher, in dem Gedicht DAS<br />
SCHICKSAL, erschienen in Schillers THALlA 1794, ein entsprechendes<br />
Bild gebracht hatte. Hier ist gleichfalls <strong>von</strong> der »Wiege« der »Mutter«<br />
Natur die Rede, die als »heilige Natur« bezeichnet wird:<br />
Da sprang er aus der Mutter Wiege,<br />
Da fand er sie, die schöne Spur<br />
Zu seiner Tugend schwerem Siege,<br />
Der Sohn der heiligen Natur;<br />
Der hohen Geister höchste Gaabe,<br />
Der Tugend Löwenkraft begann<br />
Im Siege, den ein Götterknabe<br />
Den Ungeheuern abgewann.<br />
Der »Sohn«, der hier aus der Wiege der Mutter Natur hervorgeht,<br />
ist natürlich Herkules. Hatte Schiller diese Hölderlinschen Verse im<br />
Sinne, als er das Gedicht DER PHILOSOPHISCHE EGOIST schrieb? Für<br />
Hölderlin selbst mußte dieser Zusammenhang als wahrscheinlich<br />
gelten. Eine Einwirkung der Herkules-Partie aus Hölderlins DAS<br />
SCHICKSAL auf Schiller hat die Forschung auch sonst feststellen zu<br />
können geglaubt. Man rechnet mit der Möglichkeit, dass die auf<br />
Herkules bezüglichen Schlußstrophen <strong>von</strong> DAS REICH DER SCHATTEN<br />
angeregt wurden durch die soeben zitierte Strophe der HERKULES<br />
Hymne.15 Alles das waren jedenfalls weitere Anlässe für Hölderlin,<br />
15 Vgl. Ulrich Hötzer, Die Gestalt des Herakles in Hälderlins Dichtung, Stuttgart 1956,<br />
S. 150.<br />
81
das Herkules-Thema als Dichter ins Auge zu fassen - wir erinnern<br />
uns, dass wir schon in andern Schillerschen Gedichten Anregungen<br />
zur Abfassung der Hymne AN HERKULES sehen konnten.<br />
3. Ein Anklang an Schillers DER PHILOSOPHISCHE EGOIST findet sich<br />
aber auch in Hölderlins Gedicht DIE EICHBÄUME. Von der Mutter,<br />
und zwar der Mutter Natur, wird bei Schiller gesagt, dass sie das<br />
Kind »nährt mit ihrem eigenen Leben« (v. 7). Nun findet sich aber<br />
auch im Entwurf zu Hölderlins DIE EICHBÄUME die Wendung, und<br />
zwar gleichfalls auf die Natur bezüglich: »nährend und wieder<br />
genährt«.<br />
Aus den Gärten komm ich herauf, ihr Söhne des Berges<br />
Aus den Gärten, da lebt die Natur gefällig und häuslich<br />
Nährend und wieder genährt, mit den fleißigen Menschen<br />
[zusammen.<br />
So schrieb Hölderlin den Gedichtanfang zunächst nieder. In beiden<br />
Gedichten also das Bild <strong>von</strong> der 'nährenden' Mutter Natur.<br />
Offenbar stand Hölderlin das Bild durch Schillers Vers, den er frisch<br />
im Gedächtnis hatte, vor Augen. Später änderte er den Passus ab<br />
in: »pflegend und wieder gepflegt«, was dem Klang wie dem Inhalt<br />
nach ähnlich ist der Wendung »und für das Sorglose sorgt« in<br />
Schillers Gedicht. In beiden Fassungen: »nährend und wieder genährt«<br />
sowie »pflegend und wieder gepflegt« findet sich ferner<br />
auch der Schillersche Gedanke wieder, dass die Natur »jetzt empfänget,<br />
jetzt giebt«. Dem »jetzt - jetzt« bei Schiller entspricht das<br />
»und wieder« bei Hölderlin: es ist das der Gedanke <strong>von</strong> »der Kräfte<br />
Tausch«, der Schillers Gedicht auch beschließt.16 Das Wort »nährt«<br />
16 »Der Kräfte Tausch« (DER PHILOSOPHISCHE EGOIST v. 14) erinnert an die schöne Wendung<br />
vom »heiligen Tausch«, die sich im THALlA-Fragment des HYPERION wie auch<br />
in HYPERIONS JUGEND findet (StA III 164; 211). Gemeint ist beidemal der heilige Tausch<br />
der Freundschaft, »wo einer des andern Gott seynsollte«-dasfreundschaftliche<br />
Zusammenstehn bei der »Verbrüderung mit Menschen«, die Hyperion sucht,<br />
dann aber enttäuscht aufgibt um eines würdigeren Alleinstehens willen! Bezeichnend<br />
ist es, dass nun andererseits jenes All ei ns te hn in DIE EICHBÄUME gekennzeichnet<br />
wird durch die Worte: »Lebt ihr, j ed e r ein Go t t , in freiem Bunde zusammen.«<br />
82<br />
taucht dann in Hölderlins Gedicht nochmals auf. In v. 6 heißt es<br />
<strong>von</strong> den Eichbäumen, dass sie <strong>von</strong> der Erde geboren, vom Himmel<br />
»genährt und erzogen« worden seien. Gerade hier knüpft die<br />
Replik auf Schillers Gedicht an. Die titanischen Eichen gehören einzig<br />
»nur« jenen Naturrnächten: Himmel, Erde - und sich selbst<br />
(»nur euch«). Mit der Natur also sind sie verbunden, sofern diese<br />
göttlich lebenspendend ist. Sie trennen sich aber <strong>von</strong> dem Bereich,<br />
wo die Natur »geduldig und häuslich« lebt (v. 2), <strong>von</strong> dem Bereich<br />
der Gärten, der »Schule der Menschen«. Auf den Dichter selbst<br />
bezogen bedeutet das: <strong>von</strong> den Menschen wurde er weder genährt,<br />
noch gepflegt, noch erzogen. Darum darf, darum muß er sich, wie<br />
die titanenhaften Eichen, ihrem Bereich entziehen, muß alleinstehn.<br />
Jedenfalls zeigen nun beide Gedichte, sowohl Schillers DER PHILO<br />
SOPHISCHE EGOIST als auch Hölderlins DIE EICHBÄUME - deutlich in ihrem<br />
Urbestandteil bis v. 12 - den gleichen inhaltlichen Verlauf: auf<br />
das Bild <strong>von</strong> der nährenden Mutter Natur folgt das der titanischnen<br />
Isolierung. Nur ist die Isolierung bei Schiller negativ warnend<br />
dargestellt, bei Hölderlin schicksalsfreudig bejahend. Auf diese<br />
Weise endigt die ursprüngliche Partie der EICHBÄUME derart, dass<br />
in dem angedeuteten Sinne eine Replik auf Schillers Gedicht vorliegt.<br />
4. Ein weiterer Anklang: bei Schiller heißt es <strong>von</strong> dem 'Philosophischen<br />
Egoisten' (v. 11 f.), er entziehe sich dem »vertraulichen<br />
Bund«, dem »schönen Ring«, der »Geschöpf an Geschöpf reyht« -<br />
mit, wie mir scheint, deutlichem Vorwurf auf Hölderlin bezüglich.<br />
Hölderlin sagt nun in v. 13, dass die Eichbäume 'in freiem Bunde<br />
zusammenleben', jeder »eine Welt«, jeder »ein Gott«. Auch hier<br />
wird - sogar noch in der nachträglich verfaßten Ergänzung der<br />
EICHBÄUME - der replizierende Charakter durch den Wortlaut erkennbar.<br />
Wenn Schiller ferner sagt, dass »in vertraulichem Bund«<br />
sich »Geschöpf an Geschöpf reyht«, so liegt in den letzten Worten<br />
schon jenes Bild vom »geselligen Leben« beschlossen, wie es Hölderlin<br />
entwickelt. In diesem Zusammenhang sei jedoch auch noch<br />
auf einige Verse aus Schillers Elegie hingewiesen, die zusätzlich<br />
zu der <strong>von</strong> Wilhelm Böhm schon gezeigten Übereinstimmung in<br />
pürbarer Parallele stehen zu Hölderlins Bild <strong>von</strong> den »Gärten«.<br />
83
»Und das gleiche nur ist's, was an das Gleiche sich reyht.« So charakterisiert<br />
Schiller die Welt des zivilisierten Lebens im Tal, in der<br />
Ebene, im Gegensatz zur Welt der Berge, der freien Natur. Auf das<br />
Nämliche deutet bei Schiller das Bild: »der Pappeln stolze Geschlechter<br />
I Ziehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig<br />
daher«. Oder: »Näher gerückt ist der Mensch an den Menschen.<br />
Enger wird um ihn ... die Welt.« Mit diesen letzten Worten<br />
stimmt auffällig überein ein Vers Hölderlins, der sich im Entwurf<br />
zu der nachgetragenen Schluß partie der EICHBÄUME findet: »E n ger<br />
vereint ist unten im ThaI das gesellige Leben.«17 So bestätigt es sich,<br />
wie sehr Wilhelm Böhm im Recht war, als er auf einen Zusammenhang<br />
der EICHBÄUME mit der ELEGIE hinwies. Übrigens wird in Schillers<br />
Gedicht der Übergang <strong>von</strong> der Welt des Tals zu der der freien<br />
Berge gekennzeichnet durch die Worte: »Hinter mir blieb der Gärten<br />
.. . vertraute Begleitung«. An diese Wendung scheint das Einleitungsbild<br />
<strong>von</strong> den Gärten in Hölderlins DIE EICHBÄUME unmittelbar<br />
anzuknüpfen.<br />
Das Gedicht DIE EICHBÄUME ist nun aber noch in anderer Weise<br />
bemerkenswert. In ihm nämlich vollzieht sich eine hochbedeutsame<br />
Wende in Hölderlins gesamtem lyrischem Schaffen, eine der<br />
wichtigsten überhaupt. Wie schon erwähnt, bediente sich Hölderlin,<br />
als er 1796 die Hauptpartie des Gedichts niederschrieb, erstmals<br />
nach längerer Pause wieder des Hexameters. Jetzt aber bedeutet<br />
der Gebrauch dieses Versmaßes, dass der Dichter endlich<br />
beginnt, sich loszulösen <strong>von</strong> der problematischen Form der Reimhymne,<br />
der Form, in der es ihm nie gelang, seine dichterische Eigenart<br />
voll zur Geltung zu bringen, die ihm infolgedessen niemals<br />
Glück gebracht hat. Von jetzt ab geht Hölderlin generell dazu über,<br />
wieder die antiken, reimlosen Versmaße zu benutzen, zunächst<br />
weiter Hexameter und Distichen, späterhin dann auch die komplizierteren<br />
Versmaße der griechisch-römischen Dichtung. Von diesem<br />
Augenblick aber datiert der Beginn derjenigen lyrischen Dichtung,<br />
die wir eigentlich meinen, wenn wir <strong>von</strong> Hölderlin sprechen.<br />
17 StA I 501.<br />
84<br />
Von diesem Augenblick an weisen Hölderlins Gedichte wirklich<br />
und unverkennbar seine Eigenart auf. Von diesem Augenblick ist<br />
zu sagen, dass nach der Wende, die sich in ihm vollzieht, Hölderlin<br />
überhaupt keinen schwachen Vers mehr geschaffen hat. In DIE<br />
EICHBÄUME hören wir somit - und hörte auch Hölderlin selbst zweifellos<br />
- zum erstenmal seinen eigenen, so nur ihm möglichen Ton<br />
als Lyriker. In den Reimhymnen konnte noch immer, auch in den<br />
späteren, reiferen, sein Ton mit dem anderer Dichter verglichen<br />
werden. Der eigentlich Hölderlinsche Sprachklang, Sprachgriff<br />
wird unvergleichbar, unverwechselbar bemerklich nach jener gekennzeichneten<br />
Wende.<br />
Zieht man dies in Betracht, so darf es als ein besonderes merkwürdiges<br />
Zusammentreffen gelten, dass es gerade das Gedicht DIE<br />
EICHBÄUME WAR , in welchem Hölderlin auch <strong>von</strong> dem ersten Erwachen<br />
seiner Selbständigkeit Kunde gibt, <strong>von</strong> der Er<strong>kennt</strong>nis der<br />
Notwendigkeit, alleinzustehen, auch ohne Schiller "zu werden, was<br />
er werden soll". Wie man annimmt, war Hölderlin ja gerade durch<br />
zwei Gedichte Schillers - DIE KÜNSTLER und DIE GÖTTER GRIECHEN<br />
LANDS - zu der Form der Reimhymne verführt worden. Als die innere<br />
Lösung sich vollzog, ging diese also zusammen mit einer Befreiung<br />
<strong>von</strong> der Form seines bisherigen Vorbilds - auch darin liegt<br />
etwas seltsam Symbolisches. Aus all diesen Gründen ist das Gedicht<br />
DIE EICHBÄUME so wichtig. In seiner wahren und umfänglichen<br />
Bedeutung ist es bisher <strong>von</strong> der Forschung noch zu wenig<br />
gewürdigt worden.<br />
Was die Einwirkung <strong>von</strong> Schillers DER PHILOSOPHISCHE EGOIST auf<br />
Hölderlin betrifft, so ist noch etwas anderes bemerkenswert. Anderthalb<br />
Monate nach der Veröffentlichung dieses Gedichts erscheint<br />
in einem Brief Hölderlins merkwürdigerweise einmal das<br />
Wort 'Egoist' - das sonst <strong>nicht</strong> zu des Dichters Sprachschatz gehört.<br />
Und zwar ist es gebraucht in einem Sinne, der wieder an Schillers<br />
Gedicht denken läßt, diesmal an seinen Titel. Hölderlin schreibt<br />
an Hegel (25. November 1795): "Wenn ich <strong>nicht</strong> bald eine gelegene<br />
HofmeistersteIle finde, so mache ich wieder den Egoisten, suche<br />
für jezt keine öffentliche Beschäftigung, und lege mich aufs Hung<br />
rleiden." Dass Hölderlin <strong>von</strong> sich selbst sagt, er mache den Egoi-<br />
85
sten, mache wieder den Egoisten, ist etwas ziemlich Ungewöhnliches.<br />
Der Egoismus liegt nun ganz offensichtlich darin, dass er eben<br />
allein leben, allein stehen möchte - <strong>nicht</strong> in einer menschlichen<br />
Gemeinschaft, die für ihn unangemessen, die nur drückend und<br />
einschränkend ist. Es sieht doch aber ganz so aus, als ob diese Wendung<br />
vom Egoisten dem Dichter in die Feder geflossen ist, weil er<br />
sich zu dieser Zeit gerade mit Schillers Gedicht DER PHILOSOPHISCHE<br />
EGOIST auseinandersetzte und mit dem stillen Vorwurf, der darin<br />
gegen ihn erhoben wurde. Wenig später entstanden dann die Gedichte<br />
AN HERKULES und DIE EICHBÄUME.<br />
Mit den letzten fünfeinhalb Versen der EICHBÄUME hat es - wir deuteten<br />
schon darauf hin - eine eigene Bewandnis. Sie wurden erst<br />
etwa ein Jahr nach der Entstehung des Vorhergehenden verfaßt.<br />
In dieser ergänzenden Partie finden sich Gedanken, die mit den<br />
Urbestandteilen des Gedichts inhaltlich <strong>nicht</strong> ganz in Harmonie<br />
stehen. (Zu der Ergänzung benutzte Hölderlin auch <strong>nicht</strong> mehr<br />
die ursprüngliche Handschrift, sondern eine neue.) Der nachgetragene<br />
Schluß läßt erkennen, dass die Spannung, unter der Hölderlin<br />
lebte unmittelbar nach der Trennung <strong>von</strong> Schiller, jetzt gewichen<br />
ist und andere Stimmungen herandrängen. Zunächst wird<br />
- in Vers 12 und 13 - noch der letzte Satz der ursprünglichen Partie<br />
ergänzt:<br />
wie die Sterne des Himmels<br />
Lebt ihr, jeder ein Gott, in freiem Bunde zusammen.<br />
Dies ist noch ganz im Sinne des Vorhergehenden konzipiert. Ein<br />
Bezug auf das Verhältnis zu Schiller ist noch deutlich spürbar, wie<br />
denn auch dieser Passus - vgl. oben - auf Schillers DER PHILOSOPHI<br />
SCHE EGOIST im replizierenden Sinne anzuspielen scheint. Angeredet<br />
sind immer noch die Eichbäume. Wenn sie untereinander in<br />
Gemeinschaft stehen, so ist diese Gemeinschaft ein »freier Bund«<br />
der in ihrer Höhenwelt einzeln Stehenden und Entfernten. »Wie<br />
die Sterne .. . jeder ein Gott« - die Bildsprache weist hier hin auf<br />
86<br />
das "Götterpaar Kastor und Pollux"18, auf die Dioskuren also, für<br />
deren Freundschaft das Sternbild der Zwillinge ewiges Symbol ist<br />
seit der Antike. Die Dioskuren hat Hölderlin schon in den Tübinger<br />
Hymnen und auch später vielfach besungen. Hier dient der<br />
Mythos, um zu versinnbildlichen, was Hölderlin nach der Trennung<br />
weiter mit Schiller verbindet: Verehrung und Freundschaft<br />
auch aus der Ferne. Das Nietzschesche Bild <strong>von</strong> der "Sternenfreundschaft",<br />
das natürlich gleichfalls den Dioskuren-Mythos zum Hintergrund<br />
hat, findet sich also tatsächlich - seltsame Fügung - schon<br />
bei Hölderlin. Gleiches Erleben führt auf die gleiche Metapher: das<br />
Auseinandergehen zweier Großen, bei dem Liebe und Verehrung<br />
auf anderer, höherer Ebene fortbestehen.<br />
Im weiteren bringt der nachgetragene Schluß der EICHBÄUME eine<br />
neue motivische Wendung. Wie schon früher angedeutet, spiegeln<br />
sich darin andere, neue Erlebnisse. Um diese Verse recht zu verstehen,<br />
muß man sich ins Bewußtsein rufen, dass Hölderlin mit ihnen<br />
auch einem bestimmten Formprinzip Rechnung tragen will, das<br />
ihm inzwischen bedeutungsvoll wurde. Die Zeit ist nämlich gekommen,<br />
wo er beginnt, seinen Gedichten jenen bekannten dreitaktigen<br />
Rhythmus zu geben: These - Antithese - Synthese. In der<br />
nachträglichen Ergänzung der EICHBÄUME zeigt sich ein frühes Beispiel<br />
für die Anwendung dieser Form: offensichtlich gestaltet Hölderlin<br />
diese Ergänzung derart, dass sie wie die Synthese zu dem<br />
Vorhergehenden wirkt, das nun als These und Antithese betrachtet<br />
wird. So ergibt sich folgender Aufbau: Welt der Gärten, des Tals<br />
(These) - Welt des Berges, der Eichen (Antithese) - pointierte Deutung<br />
beider Welten, bzw. des Verhältnisses zu ihnen (Synthese). In<br />
der handschriftlichen Überlieferung findet sich ein Versuch, diese<br />
Synthese zunächst so zu gestalten (Entwurf der Verse 14 ff.):19<br />
Enger vereint ist unten im ThaI das gesellige Leben,<br />
[Stolzer steht es und]<br />
Vester bestehet es hier und sorgenfreier und stolzer,<br />
Denn so will es der ewige Geist.<br />
18 HölderJin an Neuffer, 28. November 1791. (StA VI 71.)<br />
19 StA 1501 f.<br />
87
Nochmals sind die beiden Sphären gegenübergestellt: Welt des<br />
Tales, der Gärten (»unten«) und Welt des Berges, der Eichbäume<br />
(»hier«). Bei der Charakterisierung ihrer jeweiligen Vorzüge wird<br />
der Höhensphäre mit Emphase der Vorrang gegeben - hier ist die<br />
Welt heroischer Existenz großer Einzelner, eine Welt, die darum<br />
»stolzer« ist als die des Tals mit ihren geselligen Freuden. Das bekräftigt<br />
der schöne Satz: »Denn so will es der ewige Geist« - ein<br />
Amen gleichsam, wie es Hölderlins tiefster Seelenartung entspricht.<br />
Diese Verse hat der Dichter <strong>nicht</strong> bestehen lassen. Die endgültige<br />
Fassung erhielt den Wortlaut:<br />
Könnt' ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer<br />
Diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben.<br />
Fesselte nur <strong>nicht</strong> mehr ans gesellige Leben das Herz mich,<br />
Das <strong>von</strong> Liebe <strong>nicht</strong> läßt, wie gern würd' ich unter euch wohnen!<br />
In seiner Struktur zeigt dieser Abschluß noch Verwandschaft mit<br />
den Entwurfsversen. Auch hier werden die beiden Sphären<br />
»Wald« (der Eichbäume) und »geselliges Leben« (Tal, Gärten) konfrontiert.<br />
Merklich entfernt sich aber der Inhalt des endgültigen<br />
Schlusses sowohl <strong>von</strong> den Entwurfsversen wie auch <strong>von</strong> den ursprünglichen<br />
Bestandteilen des Gedichts. Während Hölderlin früher<br />
keinen Zweifel ließ, welcher Welt er zugehört: der der heroischen,<br />
titanenhaften Existenz/ erscheint jetzt neu die Aussage: dem<br />
»geselligen Leben« sich »anzuschmiegen«, daran hindert den<br />
Dichter sein Freiheitsbedürfnis; in der Welt der freien Eichbäume<br />
zu »wohnen«, verbietet ihm in ähnlicher Weise ein anderes Gefühl:<br />
das der Liebe. So steht er jetzt sehnend zwischen beiden Welten.<br />
Zweifellos entspricht dieser Schluß jetzt mehr dem Begriff der<br />
Synthese in einem dreitaktig gebauten Gedicht. In geistvoller Pointierung<br />
zwei voraufgegangene Aussagen zusammenzufassen, darin<br />
sah Hölderlin damals das Wesen solcher Synthese, wie die Frankfurter<br />
epigrammatischen Oden zeigen. Andererseits ist stets in<br />
Betracht zu ziehen die Aufrichtigkeit, die Gewissenhaftigkeit, die<br />
Hölderlin bei jeglicher Aussage leitet. Was er spricht, ist nie ohne<br />
Wahrheit. Und so spiegelt sich Realität auch in dem Schluß der<br />
88<br />
EICHBÄUME: es spiegelt sich darin die Situation des liebenden Hölderlin<br />
der späteren Frankfurter Zeit. Niemals wieder lebte der Dichter<br />
so lange und so intensiv im Bereich des 'geselligen Lebens' wie<br />
in jener Epoche. Darüber findet sich mancher Seufzer auch in seinen<br />
Briefen. 20 Was ihn an diese Welt fesselte, war die Liebe zu Diotima.<br />
Aus dieser völlig veränderten Situation resultiert es, wenn<br />
der Dichter am Schluß der EICHBÄUME als ein zwischen den Welten<br />
Stehender erscheint, wenn hier, fast im Sinne der Palinodie, ein<br />
Schwanken sichtbar wird, wo ehemals im selben Gedicht eine feste,<br />
ausgeprägte Position bezogen ward.<br />
Die Schlußverse <strong>von</strong> DIE EICHBÄUME und die in ihnen enthaltene<br />
Pointe sind somit in gewisser Hinsicht als ein Komplex für sich zu<br />
betrachten. Sie entstanden aus veränderter Sicht und Zeit. Nicht<br />
mehr die Lösung <strong>von</strong> Schiller, sondern die Begegnung mit Diotima<br />
bestimmt hier Hölderlins Fühlen und Denken. Das darf uns<br />
aber <strong>nicht</strong> zu der Auffassung verleiten, dass jenes Preisen der heroischen<br />
Existenz, <strong>von</strong> dem die Hauptbestandteile des Gedichts<br />
erfüllt sind, durch den Abschluß grundsätzlich und endgültig widerrufen<br />
wird. Auch die Schlußverse enthalten, wenn man mit<br />
genügender Aufmerksamkeit liest, gleichsam zwischen den Zeilen<br />
die Andeutung, welcher <strong>von</strong> den beiden Welten Hölderlin sich<br />
eigentlich zugehörig weiß, wenn es sich darum handelt, die Lebenssphäre<br />
zu bestimmen. Letzten Endes war die heroische Existenz<br />
für ihn die einzig gemäße. Zu ihr hin führte sein Weg, als das<br />
Schicksal eingriff und ihn <strong>von</strong> Frankfurt entfernte.<br />
20 Vgl. Hölderlin an seine Mutter, November 1797: "Dieses ganze Jahr haben wir fast<br />
beständig Besuche, Feste und Gott weiß! was alles gehabt" etc. (StA VI 257).<br />
89
folgen. Viel richtiger scheint mir der Hinweis Wilhelm Böhms zu<br />
sein, <strong>von</strong> dem wir schon sprachen: dass der Anstoß, den Herkules<br />
Mythos in einem Hymnus zu behandeln, <strong>von</strong> Schillers DAS RE/CH<br />
DER SCHArrEN ausging. Wir konnten noch andere ähnliche Anregungen<br />
durch Schillersche Gedichte zusätzlich aufweisen, und stets<br />
handelte es sich dabei um Gedichte, deren Veröffentlichung nur<br />
kurze Zeit der Abfassung des HERKuLEs-Gedichts vorauslag. Hölderlin<br />
hatte sie folglich soeben gelesen.<br />
Allerdings dürfte der Verlauf dann so gewesen sein: aufmerksam<br />
geworden auf den Herkules-Mythos durch Schiller, faßte Hölderlin<br />
den Entschluß, eben diesen Mythos zur Grundlage zu<br />
nehmen für ein Gedicht, das seine Situation gegenüber Schiller<br />
zur Darstellung brachte. Dabei lag es freilich nahe, sich über<br />
diesen Mythos noch weiter zu informieren und antike Bearbeitungen<br />
desselben zu betrachten. Hölderlin war ein guter Kenner<br />
des Ovid, und er liebte ihn, wie das die meisten großen Dichter<br />
tun. (Das Abwerten Ovids ist mehr Sache der Theoretiker gewesen,<br />
nach dem Beispiel Herders.) Aus Ovids HEROIDEN hatte Hölderlin<br />
schon in seiner Maulbronner Zeit eine Partie bearbeitet in<br />
dem melodramatischen Gedicht HERO. So mag er sich auch des<br />
Briefgedichts DE/AN/RA AN HERKULES in Ovids HEROIDEN erinnert<br />
haben, wo gerade das ihn so sehr beschäftigende Thema des<br />
Größenunterschiedes dichterisch behandelt worden war. Er übersetzte<br />
die betreffende Stelle aus dem Ovid-Gedicht und schrieb<br />
dann weiter - inspiriert auch durch die Übersetzung und immer<br />
im Hinblick auf Schiller - die HERKuLEs-Hymne nieder, die sich ja<br />
in der Handschrift unmittelbar in Nähe der HEROIDEN-Übersetzung<br />
findet.<br />
Wenn wir annehmen möchten, dass die ganze Beschäftigung<br />
mit dem Thema Herkules damals durch Schiller angeregt wurde,<br />
und dass diese Beschäftigung schließlich insgesamt dem Gedicht<br />
AN HERKULES zugute kam und der Darstellung des Verhältnisses zu<br />
Schiller, so wird diese Annahme durch ein weiteres Indiz bestätigt.<br />
Es läßt sich nämlich erkennen, dass Hölderlin zumindest noch<br />
ein anderes Werk aus der antiken Literatur, das den Herkules<br />
Mythos behandelt, studiert hat, und zwar eine griechische Tragö-<br />
92<br />
die. An zwei Stellen des Hymnus AN HERKULES finden sich Anklänge<br />
an diese Tragödie. Beide Stellen sind enthalten in der 4. Strophe<br />
des Hölderlinschen Gedichts. Hier heißt es, mit Bezug auf<br />
Herkules:<br />
Wenn für deines Schiksaals W oogen<br />
Hohe Götterkräfte dich,<br />
Kühner Schwimmer! auferzogen,<br />
Was erzog dem Siege mich?<br />
Was berief den Va terlosen,<br />
Der in dunkler Halle saß,<br />
Zu dem Göttlichen und Großen,<br />
Daß er kühn an dir sich maß?<br />
Auffällig sind in dieser Strophe zwei Bilder. Erstens ist es merkwürdig,<br />
dass Herkules hier als »Schwimmer« im Kampf mit den<br />
Wogen, mit des »Schicksaals Woogen«, gesehen wird. Das Bild<br />
würde ohne weiteres passen etwa zu Odysseus. Wo gäbe es aber in<br />
den Herkules-Mythen eine entsprechende Situation? Zweitens ist<br />
auffällig das Bild <strong>von</strong> dem »Vaterlosen«. Auf sich selbst bezieht<br />
Hölderlin das Bild. Und so dient es, den Gegensatz auszudrücken:<br />
Herkules ist <strong>von</strong> göttlicher Geburt, er ist Sohn Kronions, der Dichter<br />
dagegen sieht sich selbst - wie es wörtlich an anderer Stelle<br />
heißt - als sterblich geboren an. So weit ist alles verständlich. Dennoch<br />
bleibt es merkwürdig, dass der Dichter sich in diesem Sinnzusammenhang<br />
geradezu als »Vaterlosen« bezeichnet, und zwar<br />
als Vaterlosen in »dunkler Halle«. Derartig prägnante, spezifische,<br />
zunächst auch befremdende Wendungen legen die Vermutung<br />
nahe, dass hier Anspielungen, Zitate vorliegen. Und so ist es auch.<br />
Die beiden Bilder finden sich nämlich in derjenigen Tragödie des<br />
ophokles, die ebenfalls den Herkules-Mythos behandelt, und zwar<br />
n Tod des Herkules: in des Sophokles TRACHINIERINNEN. Gleich<br />
im ersten Chorlied, das den Herkules feiert, wird hier in aller Breit<br />
ausgeführt, wie der Heros sich durch sein mühevolles Leben<br />
hindurchgearbeitet habe, nämlich so wie durch die wild aufgeregt<br />
'11 Wogen des Meeres.<br />
93
Allerdings ist hier noch ein anderer Aspekt zu berücksichtigen.<br />
Wenn Hölderlin sich damals der Übersetzung römischer Dichtung<br />
zuwandte, so könnte das noch einen weiteren Grund gehabt haben.<br />
Wir sprachen <strong>von</strong> der Übersetzung der PHAETHoN-Erzählung<br />
aus Ovid, die, im Frühjahr 1795 auf Wunsch Schillers angefertigt,<br />
mißglückte. Nicht nur, dass Schiller den Druck ablehnte, Hölderlin<br />
selbst betrachtete seine Übersetzung sehr bald als verfehlt. Die<br />
Ursache dieses Fehlschlagens lag aber hierin: Schiller hatte verlangt,<br />
Hölderlin solle die Hexameter des Ovid in Stanzen umgießen.<br />
Die Vorstellung, man könne antike Verse in solchen modernen<br />
Formen wiedergeben, ist grundsätzlich verfehlt. Goethe sprach<br />
in derartigen Fällen <strong>von</strong>" parodistischen" Übersetzungen. Das<br />
Unmögliche in Schillers AufgabensteIlung wurde Hölderlin hinterdrein<br />
klar. In einem Brief an Neuffer vom März 1796 spricht er<br />
in diesem Zusammenhang <strong>von</strong> einern "albernen Problem", mit dem<br />
Schiller ihn besser "nie geplagt hätte". Da mag es ihn gereizt haben,<br />
nun einmal lateinische Dichtung so zu übersetzen, wie es einzig<br />
richtig und angängig ist: in den originalen Silbenmaßen. Der<br />
Wunsch, auch Schiller zu zeigen, dass er durchaus imstande war,<br />
gut zu übersetzen, wenn in der Form <strong>nicht</strong>s Unmögliches verlangt<br />
wurde, mag daher sehr wesentlich mitgespielt haben. Freilich wählte<br />
er sich dann Vorlagen, die ihn auch innerlich etwas angingen.<br />
Dies also wäre noch zu berücksichtigen bei den Übersetzungen<br />
aus Ovid und Vergil.<br />
VI.<br />
Die Handschrift, <strong>von</strong> der wir sprachen, weist nun am Schluß noch,<br />
wie erwähnt, die Übersetzung einer Partie aus der HEKABE des Euripides<br />
auf. Da diese Partie anscheinend später als das Übrige eingetreten<br />
ist - Hölderlin schrieb sie in das Heft <strong>von</strong> hinten nach<br />
vorn, sie steht also auf den Blättern 17 bis 14 -, so wäre es an sich<br />
denkbar, dass diese Übersetzung keinen inneren Zusammenhang<br />
hat mit dem sonstigen Inhalt der Handschrift. Dennoch liegt m .<br />
E. ein solcher Zusammenhang vor. Auch in diesem Fall dürfte die<br />
98<br />
herkömmliche, <strong>von</strong> der Hölderlinforschung gegebene Deutung<br />
sich als ungenügend erweisen: man behauptet, die Übersetzung<br />
aus der Hekabe sei erfolgt "im Hinblick auf das frühere Kolleg<br />
über Euripides, das der Dichter bei Conz in Tübingen gehört"<br />
habe. 24 Damit ist <strong>nicht</strong> viel erklärt. Jenes Kolleg lag viele Jahre zurück,<br />
und Hölderlin war dem StadÜlm des Schülers längst entwachsen.<br />
Grundsätzlich wird man sich zu der Einsicht bequem n<br />
müssen, dass, wenn ein Dichter vom Range Hölderlins sich mit<br />
irgend etwas befaßt, er sehr wahrscheinlich auch durch inn r<br />
Gründe zu der betreffenden Tätigkeit getrieben wird. Im Falle d r<br />
Hekabe-Übersetzung aber lassen sich solche Gründe durchaus r·<br />
kennen.<br />
Blicken wir noch einmal zurück. In den bei den Übersetzung n<br />
aus dem Lateinischen waren bemerklich geworden die Them n:<br />
tragischer Größenunterschied zwischen Nächstverbundenen und<br />
heroische Freundschaft. Beide Themen stimmen mit den zw I<br />
Hölderlinschen Gedichten überein, die sich in der Handschrift finden,<br />
<strong>von</strong> der wir sprechen. Ein Thema fehlt bisher noch in d n<br />
Übersetzungen, das wir in den Gedichten ebenfalls gefunden h tten:<br />
das des tragischen Alleinstehens. Wir erinnern uns, wi d<br />
Thema besonders in dem Gedicht DIE EICHBÄUME eine groß R 11<br />
spielte. Gerade dieses Thema zeigt sich nun auch in der Parti d r<br />
HEKABE, die Hölderlin übersetzte, und der Dichter hätte sehw rlieh<br />
eine andere anfike Dichtung finden können, die dieses Th m<br />
mit größerer Eindrücklichkeit behandelte.<br />
In folgendem nämlich besteht der Inhalt der <strong>von</strong> HölderHn tlb rtragenen<br />
Szene der Euripideischen Tragödie: Hekabe, die Köni In<br />
<strong>von</strong> Troja, Gattin des Priamos, ist nach der Eroberung Troja un<br />
dem Tode des Priamos Sklavin geworden im Heere der Gri eh n.<br />
Sie bittet nun Agamemnon, als den griechischen Oberfeldh rrn, r<br />
möge ein ihr angetanes schweres Leid rächen, ein Verbrech n hn·<br />
den: nämlich den Mörder ihres Sohnes Polydoros bestraf n. Ag •<br />
memnon sieht zwar ein, dass er durchaus eigentlich die Y, rpfll h·<br />
24 Böhm (1 928) 1, 106.
Übersetzungen darstellt. So stammt der Gedanke, DIE EICHBÄUME<br />
als Proömium einer Sammlung zu verwenden, wahrscheinlich noch<br />
aus der Zeit der Entstehung des Gedichts.<br />
Was die Frage der Entstehungszeit des Heftes mit den besprochenen<br />
Gedichten und Übersetzungen betrifft, so stimmen die Ergebnisse<br />
unserer Betrachtungen überein mit der bisherigen Ansicht<br />
der Forschung, dass die Handschrift ins Jahr 1796 gehöre. Genauer<br />
würde man jetzt dahingehend datieren können, dass der Inhalt<br />
der Handschrift zu Anfang des Jahres 1796, etwa Januar und Februar,<br />
entstanden sein wird. Den Ausschlag gibt, dass Hölderlin<br />
hier mit unverkennbarer Spontaneität auf eine ganze Reihe <strong>von</strong><br />
Schillerschen Gedichten reagiert, die soeben erschienen waren: DAS<br />
REICH DER SCHATTEN und DER PHILOSOPHISCHE EGOIST im Oktober 1795,<br />
die ELEGIE im November 1795, Zws zu HERKULES und DIE IDEALE im<br />
Januar 1796. Als Terminus a quo mag daher der Januar 1796 zu<br />
betrachten sein. Zu dieser Zeit war Hölderlin soeben nach Frankfurt<br />
übergesiedelt. Die Arbeit am HYPER ION war unterbrochen, nachdem<br />
das Manuskript der sogenannten "Vorletzten Fassung", wie<br />
man annimmt, im Dezember noch <strong>von</strong> Nürtingen aus an Cotta<br />
gesandt ward. Der Dichter hatte also die Möglichkeit, andere Arbeiten<br />
in Angriff zu nehmen, während er auf Rückäußerung <strong>von</strong><br />
Cotta wartete (die ihn im Mai 1796 wieder an die HYPERION-Arbeit<br />
zurückführte). Durch einen Brief des Dichters an Niethammer ist<br />
bezeugt, dass Hölderlin im Februar 1796 mit philosophischen Aufsätzen<br />
beschäftigt war, denen er den Titel NEUE BRIEFE ÜBER DIE ÄS<br />
THETISCHE ERZIEHUNG DES MENSCHEN geben wollte. Auch darin drückt<br />
sich seine damalige Beschäftigung mit Schiller aus, spielt der doch<br />
auf den der Schillerschen ästhetischen Briefe an. Zu dieser Zeit, so<br />
darf man annehmen, sind auch die Dichtungen, die uns beschäftigten,<br />
entstanden. Das in ihnen zu verspürende neue Selbstgefühl<br />
stimmt zusammen mit der allgemeinen Verfassung Hölderlins um<br />
diese Zeit. Die positiven Eindrücke der neuen Umgebung im Hause<br />
Gontard dürften jene ruhig feste Stimmung vermittelt haben,<br />
die aus der HERKULEs-Hymne und dem Gedicht DIE EICHBÄUME<br />
spricht. Zusammenfassend ist zu sagen; in jenen ersten Frankfurter<br />
Monaten des Jahres 1796 kam Hölderlins Jugend recht eigent-<br />
102<br />
lich zum Abschluß. Von da ab haben wir es mit einem andern, mit<br />
dem gereiften Hölderlin zu tun. Man sollte im Auge behalten, wie<br />
die Dichtungen jener Tage, insbesondere das Gedicht DIE EICHBÄU<br />
ME, diese Wende bezeichnen. Damit käme es zu einer Verdeutlichung<br />
des Hölderlin-Bilds.<br />
VII.<br />
Vielleicht mag es in mancher Hinsicht überraschen und verwundern,<br />
dass Hölderlin aus Schillerschen Gedichten so vielfach Anspielungen<br />
auf sich selbst heraushörte. Hier mag aber eine briefliche<br />
Äußerung des Dichters klärend wirken. Als Hölderlin den<br />
ersten HYPERION-Band an Schiller sandte (20. Juni 1797), sprach er<br />
in dem Begleitschreiben die Bitte aus, Schiller möge das Buch durchlesen<br />
und ihn dann "durch irgendein Vehikel sein Urteil wissen<br />
lassen". "Irgend ein Vehikel" - das bedeutet also: es mußte <strong>nicht</strong><br />
notwendig eine briefliche Rückäußerung sein, Hölderlin war auch<br />
gefaßt auf eine andere Form. Da mündliche Benachrichtigung durch<br />
Dritte <strong>nicht</strong> in Frage kommt - das Wort" Vehikel" schließt das wohl<br />
aus -, so bleibt kaum eine andere Möglichkeit, als an eine Rückäußerung<br />
in dichterischer Form zu denken. Offenbar waren Hölderlin<br />
dann aber bereits Äußerungen Schillers in solcher Form zu Gesicht<br />
gekommen: im IJ Vehikel" der Dichtung, in der Form des<br />
dichterischen Gesprächs. Teil eines solchen dichterischen Gesprächs<br />
ist auch der Komplex <strong>von</strong> Gedichten und Übersetzungen, der uns<br />
beschäftigte.<br />
Es sei hier wenigstens noch auf zwei Fälle hingewiesen, wo Schiller<br />
damals vermutlich Gedichte zu 'Vehikeln' der Mitteilung an<br />
Hölderlin gemacht hat. DAS VERSCHLEIERTE BILD ZU SAIS, erschienen<br />
Oktober 1795 in den HOREN erinnert in auffälliger Weise an Beginn<br />
und Schluß des THALIA-Fragments vom HYPERION. Ein Jüngling nähert<br />
sich dem verschleierten Bild der Wahrheit und sucht leidenschaftlich<br />
dessen Geheimnis zu ergründen. Hölderlins HYPERION<br />
Fragment aber beginnt mit den Worten: "umsonst hab' ich [ ... ]<br />
W a hrheit gesucht. [Im Original gesperrt.] [. .. ] Worte fand' ich<br />
103
überall; Wolken, und keine Juno." Zum Schluß der Dichtung wiederholt<br />
sich das Motiv mit ähnlicher Betonung: "Ich verlies mein<br />
Vaterland, um jenseits des Meeres Wahrheit zu finden." Hier gegen<br />
Ende des Fragments kommt es zu einer entscheidenden Wendung<br />
dadurch, dass die "unergründliche Natur" den Jüngling<br />
Hyperion auffordert, sie zu lieben, und hier wird die Natur bezeichnet<br />
- als die" verschleierte Geliebte"! " ... es sind heilige seelige<br />
Thränen, die ich weine vor der verschleierten Geliebten." Hyperion<br />
aber be<strong>kennt</strong>, dass er <strong>nicht</strong> ablassen könne <strong>von</strong> der" verwegenen<br />
Neugier", <strong>von</strong> dem Fragen nach dem "großen Geheimniß, das<br />
mir das Leben giebt oder den Tod". Damit endet das Fragment.<br />
Es gibt mehr Übereinstimmungen. In Schillers Gedicht ruft der<br />
Jüngling vor dem verschleierten Bild aus:<br />
Was hab ich<br />
Wenn ich <strong>nicht</strong> Alles habe ...<br />
Giebtsetwahierein Weniger und Mehr? ...<br />
Und alles was dir bleibt ist Nichts, solang<br />
Das schöne All der Töne fehlt und Farben.<br />
In Hölderlins THALIA-Fragment lesen wir zu Anfang, im Zusammenhang<br />
mit dem Thema der Suche nach Wahrheit: "Ich hasse sie,<br />
wie den Tod, alle die armseeligen Mitteldinge <strong>von</strong> E t was und<br />
Ni c h t s. Meine ganze Seele sträubt sich gegen das Wesenlose. Was<br />
mir <strong>nicht</strong> Alles, und ewig Alles ist, ist mir Nichts." Ähnlich<br />
heißt es, wiederum gegen Ende der Dichtung: "Wir sind <strong>nicht</strong>s;<br />
was wir suchen, ist alles."<br />
Es würde <strong>nicht</strong> wundernehmen, wenn Hölderlin in DAS VER<br />
SCHLEIERTE BILD zu SAIS eine Äußerung Schillers i,iber seine Hyperion-Dichtung<br />
gesehen hätte, eine Äußerung damit auch zu den ihn<br />
selbst bedrängenden Problemen. Gewiß sah Schiller in Hölderlin<br />
den typischen Fall eines jungen Dichters, der durch übermäßige<br />
Hingabe an die Philosophie gefährdet war. "Sein Zustand ist gefährlich"<br />
- dieser Satz in der bekannten Charakteristik Hölderlins<br />
im Brief an Goethe vom 30. Juni 1797 bezieht sich hierauf. Schiller<br />
suchte Hölderlin zurückzuführen <strong>von</strong> einem - wie ihm schien -<br />
übermäßigen Hang zur Abstraktion. In diesem Sinn mag in DAS<br />
104<br />
VERSCHLEIERTE BILD ZU SAIS eine Warnung ausgesprochen sein. In der<br />
"Vorletzten Fassung" des HYPERION steht ein recht schwer zu deutender<br />
Satz, der in diesem Zusammenhang vielleicht seine Erklärung<br />
findet: "Die Fabel sagt <strong>von</strong> Menschen, sie hätte die gegenwärtige<br />
Gottheit getödtet."25 Als »gegenwärtiger Gott« aber wird<br />
in DAS VERSCHLEIERTE BILD ZU SAIS die Gestalt der Wahrheit geschildert:<br />
Und furchtbar wie ein ge gen w ä rt iger Go tt<br />
Erglänzt durch des Gewölbes Finsternisse<br />
In ihrem langen Schleier die Gestalt.<br />
In ähnlicher Weise wie DAS VERSCHLEIERTE BILD ZU SAIS warnt auch<br />
das Gedicht EINEM JUNGEN FREUND, ALS ER SICH DER WELTWEISSHEIT WID<br />
METE. Hier lassen die Schlußzeilen wieder an das THALIA-Fragment<br />
des HYPERION denken:<br />
Manche giengen nach Licht, und stürzten in tiefere Nacht nur;<br />
Sicher im D ä m m e r s ehe i n wandelt die Kindheit dahin.<br />
Wie hier das durch Sperrdruck ungewöhnlich betonte Wort »Dämmerschein«<br />
in Verbindung mit dem Bild der Kindheit auftritt, das<br />
erweckt den Eindruck, als sei damit an den Lobgesang auf die<br />
» Dämmerung« erinnert, der den letzten Brief im THALIA-Fragment<br />
erfüllt: "Meinem Herzen ist oft wohl in dieser Dämmerung. Ich<br />
weis <strong>nicht</strong>, wie mir geschieht, wenn ich sie ansehe, diese unergründliche<br />
Natur; aber es sind heilige seelige Thränen, die ich<br />
weine vor der verschleierten Geliebten [. .. ] Meinem Herzen ist<br />
wohl in dieser Dämmerung. Ist sie unser Element, diese Dämmerung?<br />
Warum kann ich <strong>nicht</strong> ruhen darinnen?" Es folgt dann die<br />
Erzählung <strong>von</strong> dem "Knaben am Wege", den die Mutter zugedeckt<br />
hat, damit ihn "die Sonne <strong>nicht</strong> blende". Der Knabe reißt<br />
aber die Decke weg und versucht immer wieder, "das freundliche<br />
Licht anzusehn", solange, "bis ihm das Auge schmerzte und<br />
er weinend sein Gesicht zur Erde kehrte". Das THALIA-Fragment<br />
25 StA III 249.<br />
105
schließt dann mit der Erwägung Hyperions, das Beispiel des Knaben<br />
als Mahnung zu nehmen und "<strong>von</strong> dieser verwegnen Neugier"<br />
abzulassen. Es ist die Neugier nach dem Wahrheitslicht, vor<br />
welcher beide Gedichte Schillers, DAS VERSCHLEIERTE BILD ZU SAIS und<br />
EINEM JUNGEN FREUND, DER SICH DER WELTWEISSHEIT WIDMETE, warnen. In<br />
dem letztgenannten Gedicht wird diese Warnung übrigens wiederum<br />
in Verbindung mit dem Herkules-Mythos ausgesprochen:<br />
Der Jüngling wird gefragt, ob er Mut genug habe, »der Kämpfe<br />
schwersten zu kämpfen« und mit des »Zweifels unsterblicher Hydra<br />
zu ringen«.<br />
Auch dies Schillersehe Gedicht erschien unmittelbar vor der<br />
Entstehung <strong>von</strong> Hölderlins AN HERKULES, im Dezember 1795. Immer<br />
wieder bestätigt sich der Zusammenhang des HERKULEs-Hymnus<br />
mit Schiller, mit dem "geheimen Kampf", den hier ein Genius<br />
mit dem andern führt. Noch lebendiger wird uns jetzt der<br />
Gehalt der Phaethon-Ikarus-Verse in Hölderlins Gedicht erscheinen,<br />
wo die Gefahren des Weges zum Licht souverän verachtet<br />
werden:<br />
Zwar der Schüler mußte zahlen;<br />
Schmerzlich brannten, stolzes Licht<br />
Mir im Busen deine Strahlen,<br />
Aber sie verzehrten <strong>nicht</strong>.<br />
Die Problematik des Priestertums<br />
bei Hölderlin<br />
Die Verbindung <strong>von</strong> Dichter- und Priestertum ist so alt wie die<br />
Poesie selbst. Im magischen Wort, im Zauberspruch werden die<br />
Mächte beschworen. Das gilt, wie man heute annimmt, seit der<br />
jüngeren Steinzeit 1 • Bei Novalis heißt es: "Eine magische Gewalt<br />
üben die Sprüche des Dichters aus"; die ältesten Dichter seien<br />
"Wahrsager und Priester, Gesetzgeber und Ärzte gewesen", so<br />
dass "selbst die höheren Wesen durch ihre zauberische Kunst herabgezogen<br />
worden sind"2. Die griechische Kultur, Grundlage der<br />
abendländischen, beruht auf solcher Vereinigung <strong>von</strong> Dichter- und<br />
Priestertum. Der Dichter - Homer voran - schuf den Griechen ihre<br />
Götter, deren Feste das Leben bestimmten, deren Gestalten der<br />
Bildhauer meißelte, für die der Architekt Tempel baute. Pindar<br />
zeigt beispielhaft, wie der Dichter fortfährt, Künder der Götter zu<br />
sein. Für die Römer bedeutet das Wort 'vates' dasselbe wie Dichter,<br />
sofern dieser gottbegeisterter Seher ist: eine Steigerung <strong>von</strong><br />
'poeta'. Horaz fühlt sich als 'vates', als Priester der Musen (Musarum<br />
sacerdos). Vergil wird als 'maximus vates' bezeichnet. So gelten<br />
den Römern aber auch Homer und die großen griechischen<br />
Lyriker als 'vates'. Sogar Sappho wird 'vates', 'vates Lesbia' genannt<br />
(Ovid).<br />
Von griechischen Weisen, Platon und Demokrit, stammen die<br />
Definitionen, die das Wesen des Dichter-Priestertums für die<br />
abendländische Menschheit bestimmten. In Platons PHAIDROS und<br />
ION vor allem finden sich die maßgeblichen Sätze. Da wird aus-<br />
Vgl. Arnold Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. München 1967. S. 56;<br />
Werner Krauss, Grundprobleme der Literatunvissenschaft. Hamburg 1968. S. 42.<br />
2 Novalis, HEINRICH VON OFTERDINGEN. in: Das dichterische Werk. Hg. <strong>von</strong> P. Kluckhohn<br />
u. R. Samuel. 3. Auf!. unter Mitarb. <strong>von</strong> Heinz Ritter u. Gerhard Schulz. Bel. 1. Stuttgart<br />
]977. S. 210 f.<br />
106 107
gesprochen, dass die Dichter "Künder" ('hermeneis') der Götter<br />
sind, dass ihre Schöpfungen "<strong>nicht</strong>s Menschliches und <strong>von</strong> den<br />
Menschen sind, sondern Göttliches und <strong>von</strong> den Göttern". Durch<br />
die Dichter "spricht der Gott zu uns". So sind denn auch die Dichter<br />
"<strong>von</strong> Gott Begeisterte" ('entheoi'). Nicht sowohl durch "Techne"<br />
werden ihre Werke möglich, als durch "göttliche Schickung",<br />
"göttliche Kraft" ('theia miora', 'theia dynamis'). Dichtung entsteht<br />
durch "gottgesandten Wahn", Mania, "Wahnsinn der Musen"'. Im<br />
ION sagt Platon: "Nicht bei vernünftigem Bewußtsein" schaffen die<br />
Dichter, sondern: "wenn sie <strong>von</strong> Harmonie und vom Rhythmus<br />
erfüllt sind, dann werden sie den Bakchen ähnlich und begeistert<br />
wie sie". Hier wird bei Platon - durch die Worte "Bakchen" und<br />
"bakcheuein" - auf den Bereich des Dionysos hingewiesen, der<br />
dann noch für Horaz wie für Hölderlin der Gott der Dichter ist.<br />
(»Aber sie sind [ ... ] wie des Weingotts heilige Priester« - so heißt<br />
es <strong>von</strong> den Dichtern in BROD UND WEIN.) Im PHAIDROS spricht Platon<br />
aus: "Wer aber ohne den Wahnsinn der Musen sich den Pforten<br />
der Dichtkunst naht, in der Überzeugung, schon durch gute<br />
Technik ein fähiger Dichter zu werden, der bleibt selbst erfolglos<br />
und die Dichtung des Vernünftlers verschwindet vor der Dichtung<br />
der in Wahn Verzückten ins Nichts."<br />
Wie in diesen beiden platonischen Dialogen der Dichter als<br />
gottbegeisterter Priester geschildert wird, das bestimmte - zusammen<br />
mit berühmten Worten Demokrits - weiterhin die Auffassung<br />
<strong>von</strong> Dichtung im Altertum. Noch die Renaissance orientierte sich<br />
hieran 3 • Als der junge Goethe einer Art Spätrenaissance in Deutschland<br />
zum Durchbruch verhalf, sah er der Kunst - und mit ihr der<br />
Dichtung - wiederum als Aufgabenbereich zufallen: das Vermitteln<br />
des Göttlichen. Seine Schrift über das Straßburger Münster<br />
enthält hierüber bündige Aussagen, beruhend auf uralter Tradition.<br />
Da ist der Künstler der "gottgleiche Genius", in dem "selige<br />
Melodien" erklingen, er wird als der "Gesalbte Gottes" bezeich-<br />
3 Vgl. Jean Bollak in: Platon. Phaidros. Deutsch <strong>von</strong> Edgar Salin. Mit Erläuterungen<br />
<strong>von</strong> Jean Bollack, Frankfurt und Hamburg 1963. 5.123.<br />
108<br />
net, vor dem wir "tiefgebeugt dastehen". Wie Prometheus leitet<br />
der Künstler "die Seligkeit der Götter auf die Erde". Die "himmlische<br />
Schönheit" der Kunst gilt nun als "Mittlerin zwischen Göttern<br />
und Menschen".<br />
Grundsätzlich blieb Goethe dieser Auffassung treu. Der Abschnitt<br />
über die Dichter im 2. Buch <strong>von</strong> WILHELM MEISTERS LEHR<br />
JAHRE (Kap. 2) enthält Äußerungen wie diese: "Und so ist der Dichter<br />
zugleich Lehrer, Wahrsager, Freund der Götter und der<br />
Menschen." Der Dichter, "vom Himmel innerlich auf das köstlichste<br />
begabt", hat die "Götter gebildet, uns zu ihnen erhoben, sie<br />
zu uns herniedergebracht". Auch für Goethe steht fest, dass Dichtung<br />
aus Rausch, dionysischer Begeisterung geboren wird. Der<br />
Dichter gilt ihm als einer, "der sich ganz den Göttern, der Begeist'rung<br />
übergab" (CLAUDINE VON VILLA BELLA v. 800). Das Schenkenbuch<br />
des WEST-ÖSTLICHEN DIVAN spricht <strong>von</strong> "göttlichster Betrunkenheit"<br />
des Dichters, <strong>von</strong> der" Trunkenheit der Lieder" usw. Im<br />
16. Buch <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT äußert sich Goethe über den<br />
Zusammenhang seines dichterischen Schaffens mit dem Unbewußten<br />
in besonders aufschlußreicher Weise. Unmittelbar nachdem er<br />
dort sein Be<strong>kennt</strong>nis zu den Anschauungen Spinozas ablegt, folgen<br />
Geständnisse über die Eigenart seines Dichtens. Hier wird gesagt,<br />
das ihm "inwohnende dichterische Talent" habe Goethe<br />
"ganz als Natur" betrachtet. "Unwillkürlich, ja wider Willen" seien<br />
ihm seine Gedichte geboren. Goethe nennt es geradezu: "mein<br />
nachtwandlerisches Dichten". Entscheidend ist, dass diese Auffassung<br />
vom "Dichtertalent als Natur" (wie es in den Entwürfen<br />
heißt) durch den vorhergehenden Spinoza-Abschnitt ihren Hintergrund<br />
bekommt. Dort wird Spinozas Formel "deus sive natura"<br />
interpretiert und der Satz geprägt: "Die Natur wirkt nach ewigen,<br />
notwendigen, dergestalt göttlichen Gesetzen, dass die Gottheit<br />
selbst daran <strong>nicht</strong>s ändern könnte." Im Zusammenhang hiermit<br />
rhalten Goethes Worte über sein Dichten den Sinn: wenn sein produktives<br />
Talent "ganz als Natur" betrachtet wird, so bedeutet das<br />
ein und dasselbe, als wenn gesagt würde: es ist ganz göttliche<br />
Gabe. Gerade das Rätsel der Unwillkürlichkeit, des Unbewußten,<br />
Nachtwandlerischen erklärt sich als Wirkung der "ewigen, not-<br />
109
wendigen, göttlichen Gesetze", die unabänderlich sind und in ihrer<br />
Unbegreiflichkeit hingenommen werden müssen. Mit den Gedankengängen<br />
seines Lieblingsphilosophen drückt Goethe hier das<br />
nämliche aus, was Platon sagt, wenn er den Dichter "entheos"<br />
nennt, ihn als Künder der Götter bezeichnet.<br />
Ein Goethescher Aphorismus aus dem Jahre 1826 bringt dies<br />
alles allgemeiner auf die Formel: "Die Kunst ist eine Vermittlerin<br />
des Unaussprechlichen." Diese Anschauung liegt dem Shaffen unserer<br />
großen Dichter zugrunde, insbesondere dem des bedeutsamen<br />
Dreigestirns: Goethe, Klopstock, Hölderlin. Allerdings zeigen<br />
sich dabei Unterschiede, insofern als die Dichter - um mit Hölderlin<br />
zu sprechen - teils mehr "weltlich", teils mehr "geistlich"<br />
waren. Bei Goethe, der in diesem Sinne q.ls der" weltlichste" gelten<br />
darf, wird an das Unaussprechliche nur mit großer Zurückhaltung,<br />
mehr mittelbar, selten direkt gerührt. Goethes Blick ist<br />
auf die Realität, die Natur gerichtet, in ihnen wird das Göttliche<br />
erkannt. Hölderlin, der ganz geistig ist, steht vor allem in seiner<br />
Reifezeit eigentlich immer dem Unaussprechlichen gegenüber, mit<br />
unheimlicher Direktheit. Die Wirklichkeit - das glaubte ja Goethe<br />
bemängeln zu müssen - ist ihm verhältnismäßig fern. Er hat es<br />
stets mit dem Geist zu tun und sieht auch die Welt vor allem vom<br />
Geist her. Das Wort Hyperions: "Nichts, auch das kleinste, das alltäglichste<br />
<strong>nicht</strong> ohne den Geist und die Götter!" - dies Wort gilt<br />
auch für das Dichten Hölderlins. So ist es denn kein Zufall, dass<br />
<strong>nicht</strong> Goethe, sondern Hölderlin die Aufgabe des Dichters: Künder,<br />
Vermittler des Unaussprechlichen zu sein, immer wieder mit<br />
dem Wort 'Priester' bezeichnet hat. Diesem Priestertum Hölderlins<br />
sollen unsere Betrachtungen gelten.<br />
Neben dem häufigen Vorkommen des Worts 'Priester' - das<br />
<strong>nicht</strong> einmal bei Klopstock seinesgleichen hat - gibt es die Fülle<br />
der Äußerungen in Werken und Briefen, die inhaltlich dasselbe<br />
bezeichnen. Um nur an einige Briefstellen zu erinnern: Dichtung<br />
ist für Hölderlin "ein heiterer Gottesdienst", er betrachtet seine<br />
"Poesie" als eine "Panacee", die "die Deutschen wohl brauchen<br />
[könnten], auch nach der politisch philosophischen Kur". So ist<br />
aber auch Hölderlins Leben ein stetes Wandeln "zwischen Him-<br />
110<br />
mel und Erde"; er atmet in jener reinen Bergesluft, "wo man zum<br />
Gefühle der Gottheit sich erhoben hat, und aus diesem alles betrachtet,<br />
was da war und ist und seyn wird". In der Zeit der späten<br />
Hymnendichtung heißt es: "Aber so wahrhaft und vom Himmel<br />
herab verbunden, sieht man auch mit Augen eines Höhern<br />
und handelt in dem klaren Elemente, das der Geist empfängt und<br />
schaffet [ ... ] und die noch ungeboren sind, die fühlen es künftig<br />
auch!"4<br />
Im Hinblick auf die sich in solchen Äußerungen bekundende<br />
Wesensart galt es uns bisher als etwas Selbstverständliches, dass<br />
vor allem Hölderlin als Schaffender eine Haltung einnahm, die<br />
man als priesterlich bezeichnen darf. Es war dies eine uns seit langem<br />
vertraute Vorstellung, die für alles Begreifen des Dichters die<br />
Basis bildete. In neuerer Zeit aber zeichnet sich in der Hölderlin<br />
Forschung ein Wandel der Auffassung ab. Hölderlins Priestertum,<br />
es wird auch angezweifelt. Eine weitverbreitete Skepsis gegenüber<br />
allem Irrationalen, in vielfacher Hinsicht nützlich und heilsam,<br />
möchte nun generell auch jenen ganzen Bereich in Frage stellen,<br />
wo die Kunst es mit dem "Vermitteln des Unaussprechlichen" zu<br />
tun hat. Mit Begriffen wie Priestertum, Mittlertum weiß solche<br />
Skepsis wenig anzufangen. Dass im Spätwerk Hölderlins Metaphysisches<br />
rätselhaft durchbricht, dass seine Hymnen "das Ertönen<br />
anhaltender Weihe, beständigen Verkehrs mit den Göttern"<br />
sind - wie einst Friedrich Gundolf sagte 5 -, derartiges wird vielfach<br />
<strong>nicht</strong> mehr empfunden, <strong>nicht</strong> mehr zugestanden. Man wäre<br />
gern der Verpflichtung überhoben, Hölderlins Dichten in dieser<br />
Hinsicht ernst nehmen zu müssen.<br />
Wenn dabei nach Möglichkeiten gesucht wurde, die Position<br />
Hölderlins anzuzweifeln, so fand sich hierfür ein scheinbar ergiebiger<br />
Ansatz. Man ward mehr und mehr aufmerksam auf betimmte<br />
Äußerungen in Hölderlins Werk, die bekunden, wie der<br />
Dichter selbst gerade sein Priestertum in gewisser Weise auch als<br />
4 Aus Briefen der Jahre 1798 bis 1801. Vgl. StA VI 297, 306, 382, 408, 420 f.<br />
S Friedrich Gundolf, George. 3. Auf!. Berlin 1930. S. 62.<br />
111
Um dies zu erkennen: wie das Verantwortungsgefühl Hölderlins<br />
in den Schlußstrophen der Hymne WIE WENN AM FEIERTAGE,<br />
nun sein Priesteramt prüfend einbezieht, müssen wir die Stelle genauer<br />
betrachten. Die betreffenden Verse, ganz fragmentarisch und<br />
schon deshalb schwierig zu erklären, lauten: »Doch weh mir! wenn<br />
<strong>von</strong> [ ... ] « Nach großem Zwischenraum folgt in der Handschrift<br />
(neue Seite): »Weh mir!« Dann abermals nach beträchtlichem<br />
Spatium:<br />
Und sag ich gleich,<br />
Ich sei genaht, die Himmlischen zu schauen,<br />
Sie selbst, sie werfen mich tief unter die Lebenden<br />
Den falschen Priester, ins Dunkel, daß ich<br />
Das warnende Lied den Gelehrigen singe.<br />
Wesentlich ist zunächst, dass man beachtet: Hölderlin sagt <strong>nicht</strong><br />
ohne weiteres, er sei ein falscher Priester. Das konditionale »wenn«<br />
(»Doch weh mir! wenn [ ... ] «) beherrscht die gesamte Aussage.<br />
Und weiter - es heißt <strong>nicht</strong>: "Ich sage, ich sei genaht, die Himmlischen<br />
zu schauen", sondern: »Und sag ich gleich, ich sei genaht«.<br />
Das Wort »gleich« deutet hier auf einen hypothetischen Fall, der<br />
eintreten könnte, aber <strong>nicht</strong> eintreten möge. Bestätigt wird das Hypothetische<br />
der Aussage durch die Entwurfsfassung dieser Stelle.<br />
Da heißt es zunächst: »weh mir! 0 daß ich dann <strong>nicht</strong> sage,« - Hölderlin<br />
streicht das und fährt fort: »und sag ich gleich, ich wäre genaht,<br />
die himmlischen zu schauen«. Nur <strong>von</strong> einer Gefahr, einer<br />
Möglichkeit ist die Rede. Die Gefahr besteht darin, dass der Dichter-Priester,<br />
der <strong>von</strong> den Göttern die »himmlische Gaabe« empfängt,<br />
der also Göttervertrauen mehr als gewöhnliche Sterbliche<br />
genießt, in dieser bevorzugten Situation <strong>nicht</strong> maßlos wird. Die<br />
»himmlische Gaabe« muß »reinen Herzens«, mit »schuldlosen<br />
Händen« entgegengenommen werden, so heißt es im Vorhergehenden.<br />
Damit er rein und schuldlos bleibe, muß der Dichter sich<br />
jedoch hüten, <strong>nicht</strong> in Hybris zu verfallen, <strong>nicht</strong> mehr <strong>von</strong> den<br />
Göttern zu verlangen, als sie ihm freiwillig geben. Er darf sie <strong>nicht</strong><br />
auch noch »schauen« wollen.<br />
116<br />
Von dem Begehren, die Götter zu sehen und damit verbundener<br />
Hybris handeln viele griechische Mythen. Hölderlin denkt<br />
wohl vor allem an des Euripides Bakchen-Tragödie, das Werk, dem<br />
er die Hauptanregung zur Hymne WIE WENN AM FEIERTAGE verdankt.<br />
SemeIe begehrt Zeus zu schauen, das führte zu ihrem Untergang.<br />
Pentheus will die Feiern der Bakchen neugierig anschauen, darum<br />
wird er auf Geheiß des Dionysos getötet, <strong>von</strong> den Mänaden<br />
in Stücke zerrissen. Auch andere bekannte Gestalten des griechischen<br />
Mythos wurden gestraft, wenn sie unerlaubt die Götter sahen.<br />
So Aktäon, so aber auch der Seher Teiresias, dem Athene das<br />
Augenlicht nahm aus entsprechendem Anlaß.<br />
Das Begehren, die Götter schauen zu wollen, stellt also ein<br />
Gleichnis dar für unfrommes, hybrides Verhalten, besonders eines<br />
Götterlieblings. Hölderlin verbindet nun - immer im Hinblick auf<br />
eine mögliche Gefahr für den Dichter - dies Gleichnis in den<br />
Schlußversen der Hymne WIE WENN AM FEIERTAGE mit dem Mythos<br />
<strong>von</strong> Tantalos, wie man längst gesehen hatB. Wenn es in der 9. Strophe<br />
heißt, die Himmlischen »werfen mich tief unter die Lebenden«,<br />
so ist hiermit auf das Schicksal des Tantalos gewiesen, der<br />
<strong>von</strong> den Göttern in die Unterwelt gestoßen wurde. Deswegen nämlich,<br />
weil er erst zur Tafel der Götter zugelassen worden war, dann<br />
aber gewisse Freveltaten beging, Akte der Hybris, die Götterzorn<br />
hervorriefen. Vollkommen deutlich wird die Beziehung auf den<br />
Tantalos-Mythos durch die Entwurfsfassung, wo die Anspielung<br />
ausführlicher ist. Mit Recht hat man verwiesen auf den Satz eines<br />
späten Hölderlinschen Briefes, in dem der Dichter sich selbst<br />
mit Tantalos vergleicht: ,,Jetzt fürcht' ich, daß es mir <strong>nicht</strong> geh' am<br />
Ende, wie dem alten Tantalus, dem mehr <strong>von</strong> Göttern ward, als<br />
er verdauen konnte."9<br />
Soweit hat die Forschung alles richtig erkannt. Es bleibt aber<br />
zu fragen, warum gerade der Tantalos-Mythos <strong>von</strong> Hölderlin in<br />
H Vgl. Wolfgil ng Schadewaldt, Hellas und Hesperien. Zürich und Stuttgart 1960. S. 677.<br />
'I An Böh lend orff 4. Dezember 1801. StA VI 427.<br />
117
der Hymne herangezogen wurde. Tantalos war ja <strong>nicht</strong> einer, der<br />
die Götter neugierig und unerlaubt zu 'schauen' begehrte, ihm<br />
wurde vielmehr <strong>von</strong> den Göttern selbst der Platz an ihrer Tafel<br />
freiwillig eingeräumt. Von ausschlaggebender Bedeutung ist, wie<br />
ich glaube, dass man sich vergegenwärtigt, welcher Art die Vergehen<br />
waren, die zum Sturz des Tantalos in die Unterwelt führten.<br />
Von den verschiedenen Versionen der Sage, die sämtlich auf<br />
hybriden Mißbrauch der Götterfreundschaft deuten, kann die eine<br />
als für Hölderlin <strong>nicht</strong> relevant beiseite gelassen werden. Hiernach<br />
habe Tantalos den Göttern seinen Sohn Pelops zerstückelt als Speise<br />
vorgesetzt, um mutwillig die göttliche Allwissenheit auf die<br />
Probe zu stellen. Wichtiger sind die anderen Formen des Mythos:<br />
Tantalos entwendete <strong>von</strong> den Mahlen der Götter Nektar und Ambrosia,<br />
um sie den Menschen zu bringen. Hierüber berichtet Pindar<br />
10 • Dann aber die wichtigste Version, die der vorigen sehr ähnlich<br />
ist: Tantalos verriet den Menschen die Geheimnisse der Götter;<br />
was Zeus ihm anvertraut hatte, schwatz te er aus. Wir haben hier<br />
die Form der Sage, die Hölderlin vor allem beeindruckte. Dass sie<br />
ihm bekannt war aus Euripides, Ovid, Lukian usw., steht außer<br />
Zweifepi. Der Tantalos-Mythos nimmt in dieser Version die ganze<br />
Problematik des religiösen Geheimnisverrats in sich auf. Diese<br />
Problematik aber war für Hölderlin immer bedeutungsvoller geworden,<br />
je mehr seine Dichtung in das Gebiet religiöser Prophetie<br />
vorstieß. Schon im HYPERION, dies mußte der Dichter gespürt<br />
haben, berührte seine Sprache gelegentlich die Grenze des im religiösen<br />
Bereich Sagbaren. So ist es denn kein Zufall, dass auch<br />
innerhalb der HYPER ION-Dichtung der Ausspruch sich findet, der,<br />
wie mir scheint, richtungweisend ist für Hölderlins gesamte Einstellung<br />
zum Problem des Bewahrens religiöser Geheimnisse. Die<br />
Vorstufe der endgültigen Fassung des Romans enthält folgenden<br />
Satz: "Ich möcht' es an den Himmel schreiben, als des Lebens er-<br />
10 Pindar Olymp. I 65.<br />
11 VgJ. Euripides' ORESTES v. 10; Ovid Am . II 2, 44; Lukian Oe sacr. 533; Oiodor IV<br />
74, 2.<br />
118<br />
stes Gesetz: Das Heilige muß Geheimniß seyn, und wer es offenbaret,<br />
er töd tet es. "12<br />
In diesem Satz ist ein Thema fixiert, das <strong>von</strong> nun ab den Dichter<br />
wieder und wieder beschäftigt bis hin zu seinen spätesten Gesängen.<br />
Bereits in der Empedokles-Tragödie gelangt das Thema<br />
zu zentraler Bedeutung. Besonders in der zweiten Fassung, wo ja<br />
der Verrat religiöser Geheimnisse das eigentliche Sakrileg ist, das<br />
dem Empedokles zur Last gelegt wird. Zahlreich sind hier die<br />
Stellen, die auf solchen Verrat hinweisen; es sei nur einiges in Erinnerung<br />
gebracht. Empedokles »verrieth / Der Götter Gunst gutmüthig<br />
den Gemeinen«, so lautet die Anklage des Priesters Hermokrates<br />
(v. 74). Das wird dann weiter konkretisiert (v. 167 ff.):<br />
Verderblicher denn Schwerd und Feuer ist<br />
Der Menschengeist, der götterähnliche,<br />
Wenn er <strong>nicht</strong> schweigen kan, und sein Geheimniß<br />
Unaufgedekt bewahren .. .<br />
Hinweg mit ihm, der seine Seele blos<br />
Und ihre Götter giebt, verwegen<br />
Aussprechen will Unauszusprechendes ...<br />
[Vergehen soll wie er] in Weh und Thorheit jeder,<br />
Der Göttliches verräth, und allverkehrend<br />
Verborgenherrschendes<br />
In Menschenhände liefert!<br />
Er muß hinab!<br />
Von Empedokles wird dann geradezu gesagt, er habe »den Gott<br />
aus sich hinweggeschwätzt«; darum solle er verflucht und ausgestoßen<br />
werden in die Wildnis (v. 226 ff.):<br />
Und nimmer wiederkehrend soll er dort<br />
Mirs büßen, daß er mehr, wie sich gebührt,<br />
Verkündiget den Sterblichen.<br />
12 StA 1Il 276 f.<br />
119
licher: »eingehüllet und gemildert im Liede«. Der gesamte Gedankengang<br />
ist für Hölderlin höchst charakteristisch. Gemeint ist nämlich:<br />
nur wenn des Dichters Lied die himmlische Gabe in behutsamer<br />
Weise einhüllt, deren Geheimnisse <strong>nicht</strong> zu sehr preisgibt,<br />
sie damit zugleich 'mildert', nur dann entgeht er der mit dem 'Fassen'<br />
des Göttlichen verbundenen Gefahr. Dann wird ihn des Vaters<br />
Strahl <strong>nicht</strong> versengen, sein Herz wird rein, seine Hände<br />
schuldlos bleiben (Entwurf: »gereinigt <strong>von</strong> Freveln«). Anders jedoch,<br />
wenn er zuviel verrät, wenn das Lied <strong>nicht</strong> genügend einhüllt<br />
und verbirgt: dann begeht er den Frevel des Tantalos, dann<br />
droht ihm ein entsprechend verderbliches Schicksal.<br />
Die Einbeziehung der Tantalos-Sage überhaupt, so zeigt sich<br />
jetzt, erklärt sich erst in der rechten Weise, wenn man den Bezug<br />
auf das Vorhergehende beachtet. Der Mythos vom Verräter göttlicher<br />
Geheimnisse steht im Gegensatz zum Bild des geheimnisbewahrenden<br />
Dichters. Alles zusammen läuft hinaus auf die Forderung<br />
nach Maß, nach Beachtung der <strong>von</strong> den Göttern bestimmten<br />
Grenzen. Damit erklärt sich die gesamte Überleitung. Was mit den<br />
gewichtigen Worten: »Weh mir! wenn [. .. ] « beginnt, deutet auf<br />
die Folgen etwaigen Nicht-Maßhaltens. Läßt sich der Dichter dazu<br />
hinreißen, das Göttliche zu sehr zu enthüllen, so wird er zum »falschen<br />
Priester«.<br />
Der große Prosaentwurf zur Hymne WIE WENN AM FEIERTAGE bietet<br />
die Aussage der Schlußstrophen in ähnlich fragmentarischer<br />
Form wie die metrische Fassung. Dabei tritt <strong>nicht</strong> nur der Tantalos-Mythos<br />
in noch deutlicheren Konturen hervor. Es findet sich<br />
hier außerdem ein wertvolles gedankliches Zwischenglied, das in<br />
die metrische Fassung <strong>nicht</strong> aufgenommen wurde. Wir erfahren,<br />
dass ganz bestimmt benannte Ursachen den Dichter an jene bedenkliche<br />
Grenze hinzutreiben drohen, wo er - Tantalos ähnlich<br />
- zuviel <strong>von</strong> den Göttern schauen und verraten könnte. Zwischen<br />
die Worte: »Aber [weh mir!] wenn <strong>von</strong>[ ... ] « und den Satz: »Und<br />
sag ich gleich, ich wäre genaht, die Himmlischen zu schauen« ist<br />
hier eingeschoben: »Aber wenn <strong>von</strong> selbgeschlagener Wunde das<br />
Herz mir blutet, und tiefverloren der Frieden ist, u. freibescheidenes<br />
Genügen, Und die Unruh, und der Mangel mich treibt zum<br />
122<br />
Überflusse des Göttertisches [ ... ] « Danach folgt der Passus vom<br />
falschen Priester: »0 daß ich dann <strong>nicht</strong> sage« usw.<br />
Das Entscheidende innerhalb des hier Eingeschobenen ist ausgesprochen<br />
durch die Worte: Unruh und Mangel. Damit tritt ein<br />
weiterer Aspekt zutage. Die Empfindung <strong>von</strong> Unruh und Mangel<br />
ist ja in besonderer Weise charakteristisch für das schwierige<br />
Leben des Dichters in dürftiger, götterloser Zeit; für den Zustand,<br />
den Hölderlins Dichtung viele Male darstellt als bezeichnend für<br />
eine persönliche Situation. Denken wh: an das Elend Hyperions<br />
oder die Not des Empedokles, an das Schicksal des »armen Sehers«<br />
Rousseau oder an das der in dürftiger Zeitnacht trauernden<br />
Dichter in BROD UND WEIN - alle Schichten des Werks enthalten Klag<br />
n über jenes eigentlich Hölderlinsche Leiden am Zeitalter.<br />
Dabei müssen wir uns stets vergegenwärtigen, worin ganz<br />
konkret der Mangel, die Dürftigkeit und Gottferne der Zeit beteht.<br />
Gemeint ist damit der den Dichter als Realität umgebende<br />
Menschheitszustand. In den heute Lebenden erscheint das Gött<br />
Ii he <strong>nicht</strong> mehr so, wie es in begnadeteren Zeiten - besonders der<br />
Antike - der Fall war. Dem Manne ist <strong>nicht</strong> der Stempel der Gotthitaufgedrückt,<br />
wie es in BROD UND WEIN heißt. Zwar sieht der<br />
ichter schon einen Umschwung voraus, aber die Wiederkunft ein<br />
r anderen, <strong>von</strong> der Gottheit gezeichneten Menschheit steht erst<br />
. vor. Noch sind sie <strong>nicht</strong> da, die Hölderlin in der Spätdichtung<br />
I die »Künftigen«, die »Neuen«, die »Verheißenen« bezeichnet,<br />
I die »Göttlichgeborenen«, die »Göttermenschen«, die »heilige<br />
haar«. Solange aber diese Ankunft sich noch <strong>nicht</strong> vollzogen hat,<br />
I nur als bevorstehend geahnt wird, empfindet der Dichter den<br />
harakteristischen Zustand des Mangels. Ihm fehlt die adäquate<br />
m nschliche Umwelt. Womit er es de facto zu tun hat, ist die morne<br />
Welt derer, die er die »Rastlosen«, »Unsteten« nennt, die<br />
)) Wi lden«, »Irrenden«, »Götterlosen«. Wie Hölderlin mit solchen<br />
W ndungen immer wieder die Menschen der neueren Zeit be-<br />
7. i hnet, das erklärt es, wenn zur Empfindung des Mangels die<br />
gl i hfalls typische der »Unruh« tritt, <strong>von</strong> der im Prosaentwurf der<br />
Iymn gesprochen wird, sowie auch der dort beklagte Verlust des<br />
Fr! d ns, des freibescheidenen Genügens.<br />
123
Wir dürfen nun dies nie außer acht lassen: jene tragische Einsamkeit<br />
des nach adäquater Umwelt dürstenden Hölderlin mit ihren<br />
Kennzeichen Mangel und Unruh, Friedensverlust, sie bildet<br />
bei dem Dichter die unbedingte Lebenskonstante. Bis in späteste<br />
Zeit bleibt für den Menschen wie auch für den Dichter und Priester<br />
Hölderlin diese Lebenskonstante eine Realität. Es ist aber zu<br />
wenig beachtet worden: <strong>von</strong> ebendieser tragischen Lebenskonstante<br />
her wirken zweierlei entgegengesetzte Impulse, durchaus <strong>nicht</strong><br />
nur negative, sondern auch positive. Die nega tiven Impulse wirken<br />
in gefährlicher Weise hemmend. Aus Mangel und Unruh resultiert<br />
die Fülle menschlicher Leiden, die dann sogar das Schaffen<br />
ernstlich bedrohen können. Die <strong>von</strong> der tragischen Einsamkeit<br />
herrührenden pos i t i v e n Impulse beflügeln den Dichter. Der<br />
Dichter Hölderlin wird gerade durch das Erlebnis des Mangels in<br />
dürftiger Zeit auch aktiviert, es führt ihn <strong>nicht</strong> zuletzt dies zu seinen<br />
beglückenden Empfindungen der Gottnähe, zu den Visionen<br />
des Kommenden, der Wiederkunft <strong>von</strong> »Göttermenschen« und<br />
damit der »Einkehr der Götter« selbst. Beides aber findet Ausdruck<br />
in seinem Werk: das Leid des Menschen mit der Gefahr des dichterischen<br />
Verstummens, das Glück des Priesters und Sehers mit<br />
der Freude schöpferischer Inspiration. Wenn, wie es in BROD UND<br />
WEIN heißt, frohlockender Wahnsinn »in heiliger Nacht [. .. ] die<br />
Sänger ergreift« (v. 48), so ist auf diesen Zusammenhang hingedeutet.<br />
Gerade die Menschheitsnacht, Mangel und Unruh dieser<br />
Nacht, inspirieren den Sänger zu freudigem Ahnen und Verkünden<br />
des »kommenden Gottes«. Das Werden wird im Vergehen gespürt.<br />
Im Prosa entwurf zur Hymne WIE WENN AM FEIERTAGE, der uns<br />
jetzt beschäftigt, ist nun der ZusaI?menhang zwischen priesterlicher<br />
Aufgabe und der tragischen Lebenskonstante Gegenstand der<br />
Gewissenserforschung, des Verantwortlichkeitsgefühls. Wenn<br />
Mangel und Unruh, Erlebnis der Zeitnot Hölderlin weitgehende,<br />
so nur ihm gewährte Annäherungen an den Bereich des Transzendenten<br />
vermitteln, so besteht die Gefahr, dass in dieser Ausnahmeposition<br />
das Maß des Schauens und Verkündens überschritten<br />
wird. Dann droht mit dem Geheimnisverrat das Tantalos-Schick-<br />
124<br />
sal. Damit erklärt sich der Sinn des Satzes: »Weh mir! Aber wenn<br />
<strong>von</strong> selbgeschlagenerWunde das Herz mir blutet, und tiefverloren<br />
der Frieden ist, u. freibescheidenes Genügen, Und die Unruh,<br />
und der Mangel mich treibt zum Überflusse des Göttertisches« -<br />
woran sich dann anschließt - alles hypothetisch - der Gedanke<br />
vom unerlaubten Schauen der Himmlischen und vom gefürchteten<br />
Abgleiten in falsches Priestertum.<br />
Zu Mißverständnissen hat hier der Passus geführt: »wenn <strong>von</strong><br />
selbgeschlagener Wunde das Herz mir blutet«. Man sah darin -<br />
was zunächst naheliegt - das Be<strong>kennt</strong>nis einer realen Versündigung:<br />
Hölderlin betrachte es als Vergehen, dass eigener Mangel,<br />
Ungenügen des Menschen ihn zum Überflusse des Göttertisches<br />
treiben 14 • Verkannt ist dabei: Mangel, Unruh, Friedensverlust, all<br />
das, was zur Lebenskonstante des Dichters gehört, erleidet Hölderlin<br />
<strong>nicht</strong> als privates Schicksal, sondern als überpersönliches<br />
Verhängnis. Die Not der Zeit, die solches Leiden hervorruft, hat<br />
er <strong>nicht</strong> geschaffen, sondern die göttliche Natur. Folglich kann<br />
weder dieses Leiden Gegenstand der Selbstbezichtigung, eines<br />
Sündenbe<strong>kennt</strong>nisses sein, noch die Fügung, dass gerade Mangel<br />
und Unruh ihm speziell die Erfahrung des Transzendenten vermitteln.<br />
Wohl aber fühlt Hölderlins Gewissenhaftigkeit sich verantwortlich<br />
gegenüber einem Zuviel an Gotteserfahrung. Immer<br />
besteht die Möglichkeit der Maßüberschreitung, auch und gerade<br />
dann, wenn die aus, dem Mangelerlebnis resultierenden positiven<br />
Impulse den Dichter mehr beglücken als erlaubt, ihn mehr<br />
<strong>von</strong> göttlichen Geheimnissen schauen und sagen lassen, als dem<br />
Sterblichen gestattet ist. Träte diese Maßüberschreitung ein, so hätte<br />
der Dichter sich selbst die Wunde geschlagen, an der sein Herz<br />
blutet. Dann würde er zum geheimnisverratenden Tantalos, zum<br />
falschen Priester. Der Gedanke der Selbstverwundung, er ist auf<br />
diesen Gesamtzusammenhang zu beziehen, wobei aber zu beachten<br />
bleibt, dass auch dieser Gedanke nur als bedrohliche Möglichkeit<br />
gegenübergestellt ist dem positiven Bild, das sich im Text un-<br />
14 Vgl. Szondi (1967) S. 50.<br />
125
handschriftlichen Entwurf eher als die zweite in der Reihenfolge,<br />
sie ist auf jeden Fall später entstanden. Wenn Hölderlin schließlich<br />
bei der Zusammenfügung der Skizzen zu einem Gedicht die<br />
Winterstrophe an den zweiten Platz stellte, so geschah das <strong>nicht</strong><br />
zuletzt auch deshalb, weil er durch den Titel HÄLFTE DES LEBENS den<br />
Versen eine Möglichkeit exoterischen Verständnisses sichern wollte<br />
bei einem Publikum, das den esoterischen Sinn doch <strong>nicht</strong> hätte<br />
erfassen können.<br />
Durchweg finden wir in den besprochenen Partien des' Ausgangs<br />
der Hymne diese Situation - und damit kommen wir auf<br />
das Wesentliche -: es stehen sich Gegenbilder kontrastierend und<br />
bedeutungsvoll gegenüber: Winter und Sommer, Mangel und Fülle,<br />
Götternähe und Götterferne, festes und blutendes Herz des<br />
Priesters. Es hebt aber <strong>nicht</strong> ein Bild das andere auf, das negative<br />
etwa das positive. Sondern im Nebeneinander der Bilder selbst<br />
liegt der Sinn, ist die Klärung und Lösung gegeben. Extreme Möglichkeiten,<br />
resultierend aus den bei den konträren Lebensimpulsen,<br />
werden erwogen - damit aber zugleich der rechte Weg. Der rechte<br />
Weg besteht im Vermeiden möglichen Übermaßes. Er ist ein<br />
Drittes, das sich als Synthese aus These und Antithese der Gegenbilder<br />
ergibt. Die Synthese bleibt unausgesprochen, sie deutet sich<br />
nur an. Gerade das beweist gereiftes Wissen um das Wesen des<br />
Dichterischen.<br />
Der echte Dichter stellt Gebilde hin, Symbole, Gleichnisse. Solche<br />
Gebilde liebt er zu konfrontieren, damit sie sich - wie Goethe sagt<br />
"gleichsam ineinander abspiegeln" und so "den geheimeren Sinn<br />
dem Aufmerkenden offenbaren"17. Ein Gedicht ist aber kein wissenschaftlicher<br />
Aufsatz, der Gedanken in streng logischer Folge<br />
abhandelt und zur Konklusion führt. Dies besonders wird in unserer<br />
<strong>von</strong> mathematisch-philosophischem Denken beherrschten<br />
Zeit allzuleicht verkannt. Somit gibt also auch die Reihenfolge, in<br />
der die sich abspiegelnden Gebilde des Dichters auftreten, keine<br />
17 Goethe an earl Jakob Ludwig Iken 27. Sept. 1827 (WA IV 43,83)<br />
128<br />
schlüssigen Anhalte für die Deutung. Späteres hebt <strong>nicht</strong> notwendig<br />
das Vorhergegangene auf. Eins wie das andere hält Erfahrenes,<br />
Durchlittenes als Spracherlebnis fest. Wenn in der Hymne WIE<br />
WENN AM FEIERTAGE und in HÄLFTE DES LEBENS die dunkleren Bilder<br />
den helleren nachgestellt sind, so liegt darin <strong>nicht</strong> eine Negation<br />
der helleren. In anderen Gesängen findet sich die nämliche Thematik<br />
auch in umgekehrter Reihenfolge. Wirklich sprechen ja noch<br />
viele Gedichte in Hölderlins Spätwerk <strong>von</strong> der Gefahr des Erstarrens,<br />
des dichterischen Verstummens. Das geschieht jedoch zumeist<br />
so, dass das positive Gegenbild: Neuerwachen des götterbeschwörenden<br />
Lieds, daneben erscheint; wobei dieses in vielen<br />
Fällen auch durch Aufbau und Reihenfolge der Bilder als das bevorzugte<br />
gekennzeichnet ist. So enden positiv Gedichte wie<br />
ROUSSEAU, DIE LIEBE, ERMUNTERUNG, eHIRON, GERMANIEN usw. Die Reihenfolge<br />
<strong>von</strong> positiv und negativ ist also wechselnd. Das bestätigt<br />
aufs neue: es gibt bei Hölderlin, wenn er über sein Seher- und<br />
Priestertum spricht, keine Aufhebung der positiven Sicht, nirgends<br />
und niemals. Auch im Tod des Empedokles vermag alles Negative,<br />
jede Beschuldigung, jeder Selbstvorwurf dem Helden letztlich<br />
seine Hoheit und Integrität <strong>nicht</strong> zu nehmen. Mit ganz anderem<br />
haben wir es zu tun: mit steter gewissenhafter Selbstprüfung,<br />
mit der Suche nach dem rechten Weg, der die Klippen des Übermaßes<br />
vermeiden läßt.<br />
Wir könnten das auch anders definieren: der Dichter, nie wird er<br />
müde, sich der Gefahren des Priestertums, seines Mittleramts bewußt<br />
zu bleiben. Besonders eindringlich zeigt sich das in der Hymne<br />
WIE WENN AM FEIERTAGE, wo ja die vier letzten Strophen mit<br />
ihren Anspielungen auf den Semele- und Tantalos-Mythos <strong>von</strong><br />
<strong>nicht</strong>s anderem handeln als <strong>von</strong> der Gefährlichkeit des Mittleramts.<br />
Hier wird auch im Zusammenhang mit dem Mythos <strong>von</strong><br />
der blitzgetroffenen Semeie das Wort Gefahr selbst prägnant ausgesprochen.<br />
Das himmlische Feuer trinken die Erdensöhne nur<br />
d shalb »ohne Gefahr«, weil es der Dichter ihnen im Lied darr<br />
icht. Dem Dichter andererseits - wir sprachen da<strong>von</strong> - droht<br />
ur h das 'Fassen' des göttlichen 'Strahls' Verderben, sofern sein<br />
129
Lied <strong>nicht</strong> die himmlische Gabe in der gebotenen Weise einhüllen<br />
und mildern würde.<br />
Auf die Notwendigkeit, einzuhüllen, zu verschweigen, vom Göttlichen<br />
<strong>nicht</strong> zuviel schauen und mitteilen zu wollen, auf diese<br />
Notwendigkeit kommt Hölderlin immer wieder zurück. Seine gesamte<br />
Spätdichtung steht im Zeichen des Verhüllens, Bewahrens.<br />
Nicht zuletzt das macht diese Dichtung so dunkel. Eine der großartigen<br />
Hindeutungen auf dies Schweigegebot stellt die PATMOS<br />
Hymne in ihrer Gesamtheit dar. Schon die Exposition lenkt auf das<br />
Hauptthema hin, indem sie bezeichnenderweise mit den nämlichen<br />
Worten wie die Hymne WIE WENN AM FEIERTAGE wieder <strong>von</strong> der<br />
Gefahr spricht, die mit dem schwierigen Fassen verbunden ist,<br />
dem Fassen der vom Dichter als übernah empfundenen Gottheit.<br />
Zugleich wird das Gegenbild aufgezeigt: es gibt aus dieser Gefahr<br />
eine mögliche Rettung. Dies ist der Sinn der Verse:<br />
Nah ist<br />
Und schwer zu fassen der Gott.<br />
Wo aber Gefahr ist, wächst<br />
Das Rettende auch.<br />
Den Dichter führt nun seine Imagination über Zeiten und Länder<br />
hinweg in noch immer größere Nähe zum Göttlichen, hier zu dem<br />
in antiker Sphäre gesehenen Christus. Kurz vor dem Höhepunkt<br />
des Gedichts, am Ende der vierten Trias, kommt es dann wieder<br />
zu einer eindrucksvollen Selbstwarnung, einer Mahnung an die<br />
Problematik des Priestertums. Hölderlin spricht aus: er hätte den<br />
»Reichtum, / Ein Bild zu bilden, und ähnlich / Zu schaun, wie<br />
er gewesen, den Christ«. Aber gerade das ist <strong>nicht</strong> erlaubt, es wäre<br />
nefas, gottverhaßter Frevel. Die Unsterblichen wollen <strong>nicht</strong> unmittelbar<br />
'geschaut' und im zuviel verratenden Bild 'nachgeahmt'<br />
werden, schon gar <strong>nicht</strong> heut und jetzt. Noch ist es <strong>nicht</strong> so weit,<br />
dass »Starke«18, göttlichgeborene Menschen kommen, die <strong>von</strong> den<br />
18 Vers 181. VgJ. BROD UND W EIN v. 135, dazu Friedrich Beißner StA 11 619 Z. 10 f.<br />
130<br />
Himmlischen mehr wissen und sagen dürfen, denen Christus<br />
gleich dem Sonnengott gelten wird. Für den jetzigen Dichter aber,<br />
der noch vor dieser Wende lebt, lautet das Gebot: schweigen, einer<br />
unvorbereiteten Menschheit <strong>nicht</strong>s mitteilen, was sie <strong>nicht</strong> aufnehmen<br />
kann. In diesem Sinn heißt es da, wo die PATMos-Hymne<br />
ihren Höhepunkt erreicht: »und hier ist der Stab / Des Gesanges,<br />
niederwinkend, / Denn <strong>nicht</strong>s ist gemein«. »Nichts ist gemein«,<br />
anspielend auf das Paulinische ouötv XOlVOV bedeutet: der Allgemeinheit<br />
ist heute vom wahren Wesen der Götter <strong>nicht</strong> alles mitteilbar,<br />
darum muß der Gesang es verhüllen.<br />
Die letzte Trias der Hymne läuft nun aus in ein breites Lob des<br />
schonenden Bewahrens. Die Himmlischen fordern vom Dichter<br />
»Ehre« und »Opfer«, priesterlichen Dienst; sie müssen ihm aber,<br />
unsicher wie er ist, »fast die Finger führen«. So wird er sein Mitteilen<br />
maßvoll beschränken auf das Erlaubte, Gesicherte, auf den<br />
»festen Buchstab«, auf das, was die Griechen den f3tf3moc;; A6yoC;;<br />
nennen. In solchem MaßhaIten besteht nämlich das »Rettende«,<br />
das den Dichter schützt vor der mit dem 'Fassen' der Gottheit verbundenen<br />
»Gefahr«.<br />
In ihrem Aufbau zeigt die PATMos-Hymne beispielhaft, dass auch,<br />
wenn Hölderlins Spätdichtung das Thema vom Geheimnisbewahren<br />
wiederaufgreift, durchaus <strong>nicht</strong> notwendig wie in der Hymne<br />
WIE WENN AM FEIERTAGE am Ende warnend der düstere Ausblick<br />
auf die Gefahr des Tantalos-Schicksals, des falschen Priestertums<br />
stehen muß. Das Gedicht endet positiv, die Warnungen sind vorher<br />
ausgesprochen. Wir sehen also auch hier wieder einen Wechsel<br />
der Reihenfolge, wie er uns bei den Gesängen begegnete, die<br />
das Thema vom dohenden Verstummen variieren.<br />
Mit dem Beispiel <strong>von</strong> PATMOS sind wir in recht später Zeit. Zum<br />
Abschluß, gleichsam als Epilog, sei noch eine Hölderlinische Nied<br />
rschrift zur Sprache gebracht, die zeigt, dass der Dichter sich<br />
bis in allerspäteste Zeit mit der Problematik seines Priestertums<br />
ilu seina ndersetzte. Im Homburger Folioheft findet sich, mitten<br />
unt r G dichtfragmenten, die kurz vor der Umnachtung entstan-<br />
131
den sein mögen, eine seltsame Aufzeichnung. Sie wird in der Stuttgarter<br />
Ausgabe als Bruchstück Nr. 68 bezeichnet und hat folgenden<br />
Wortlaut:<br />
Das soll er alles<br />
Hinausführen<br />
Außer den Langen<br />
An eine reine Stätte<br />
Da man die Asche<br />
Hinschüttet, und solls<br />
Verbrennen auf dem Holz mit Feuer.<br />
Diese sieben Zeilen würde man, wie sie hier und ähnlich in der<br />
Hellingrathschen Ausgabe abgedruckt sind, als etwas schwierigen<br />
Entwurf einer Gedichtstrophe ansehen, vergleichbar anderen dichterischen<br />
Fragmenten auf derselben Handschriftseite. In Wahrheit<br />
aber stellen die Zeilen ein <strong>Bibel</strong>zitat dar. Hölderlin schrieb sich<br />
aus dem PENTATEUCH, und zwar aus dem 3. Buch Mosis, Kapitel 4,<br />
den 12. Vers heraus, der so lautet: "Das soll er alles hinaus führen<br />
außer dem Lager, an eine reine Stätte, da man die Asche hinschüttet<br />
und soll's verbrennen auf dem Holz mit Feuer." Hiernach wäre<br />
zunächst der Wortlaut in der Stuttgarter Ausgabe zu berichtigen,<br />
wobei aber bemerkt sei, dass dort die Entzifferung genaustens die<br />
Schriftzüge Hölderlins wiedergibt. Erst der Vergleich mit der Vorlage,<br />
dem <strong>Bibel</strong>text, läßt aus gewissen Flüchtigkeiten der Handschrift<br />
das Gemeinte erkennen.<br />
Das Wissen um die Quelle vermittelt uns indessen noch Wichtigeres.<br />
Es läßt uns einigermaßen verstehen, in welchen gedanklichen<br />
Zusammenhang die Hölderlinsche Niederschrift gehört.<br />
Schon dass der Dichter sich gerade mit dem dritten Buch des PEN<br />
TATEUCH beschäftigte, ist aufschlußreich genug. Denn dieses Buch,<br />
der sogenannte Leviticus, handelt ja in seiner Gesamtheit vom<br />
Priestertum. Es enthält <strong>nicht</strong>s anderes als Gesetze, Verordnungen,<br />
Bußvorschriften für jüdische Priester. Das vierte Kapitel aber, aus<br />
dem Hölderlin zitiert, handelt vom Priester in sehr spezieller Weise,<br />
nämlich da<strong>von</strong>, wie ein Priester, der gesündigt hat, <strong>von</strong> seiner<br />
Sünde gereinigt werden könne. Wir sehen: das steht thematisch<br />
132<br />
nahe all jenen Partien in Hölderlins Dichtung, die <strong>von</strong> möglichen<br />
Verfehlungen des Priesters sprechen.<br />
Aus dem Textzusammenhang ergibt sich nun für den <strong>von</strong> Hölderlin<br />
abgeschriebenen Vers jenes Kapitels folgender Sinn: es ist di<br />
Rede <strong>von</strong> dem "Sündopfer", das der Priester zu seiner Reinigung<br />
vollbringen muß. Das Sündopfer aber besteht in der Verbrennun<br />
eines Farrens, eines jungen Stiers. Dabei gilt für diese Verbrennun<br />
des Farrens u. a. die Vorschrift, die Hölderlin exzerpiert: Hinau -<br />
führen aus dem Lager an eine reine Stätte, Verbrennung auf inem<br />
Holzfeuer usw.<br />
Im einzelnen würde es immer noch schwierig sein, zu sagen, W 1che<br />
Gedanken Hölderlin bei der Abschrift jener Stelle bewegt n.<br />
Allgemein aber ist zu erkennen: das Problem der möglichen Y, rfehlung<br />
des Priesters, des Sichbewahrens davor und der Reinigung,<br />
es beschäftigt den Dichter noch jetzt, noch in spätester Z It.<br />
Offenbar hat das stets rege Verantwortlichkeitsgefühl Hölderlin<br />
diese Bedenken nie schwinden lassen: womöglich auf dem schmc -<br />
len Pfade des dichterischen Priestertums Schritte zu tun, die zum<br />
nefas, zur Verschuldung führen könnten.<br />
Von den beiden Möglichkeiten der Verfehlung: zuviel oder zuwenig<br />
sagen, hat die erste den Dichter am meisten beschäftigt.<br />
Dies vor allem gab seinem Spätwerk das eigentliche Gepräge. B -<br />
trachtet man Hölderlins Dichtung mit einiger Objektivität, so wird<br />
man zugeben müssen: allzuviel Aufhebens ist gemacht word n<br />
<strong>von</strong> ihrem positiven Gehalt an religiöser Aussage. Jenes Künd n,<br />
agen, Nennen des Göttlichen, jenes Offenbaren, Stiften des 5 in<br />
usw., wie begrenzt ist es letztlich in seinem Ausmaß! Wie sehr wird<br />
s eingeschränkt durch Tendenzen ganz entgegengesetzter Art -<br />
durch die überall vorherrschende Neigung zum Verhüllen, B w hr<br />
n, Schweigen! Das gewichtige Diktum Stefan Georg s: »K in r<br />
d r wahre weisheit sah verriet«19, es gilt für Hölderlin wi für j -<br />
!9 t (an orge, DER SrnRN DES ßUNDr:sS. l03.<br />
1
den der großen religiösen Dichter. Und so liegt <strong>nicht</strong> im Aussprechen,<br />
sondern im Bewahren des Geheimnisses das Eigentliche <strong>von</strong><br />
Hölderlins Werk. Mit der Ehrfurcht gegenüber dem Nichtauszusprechenden<br />
wahrt Hölderlin zugleich die Integrität, die Echtheit<br />
seines Priestertums. Eingangs führte ich Friedrich Gundolfs Wort<br />
an: das Spätwerk dieses Dichters sei das Ertönen beständigen Verkehrs<br />
mit den Göttern. Diese Definition mag gelten. Zum Abschluß<br />
sei aber noch der schöne Satz angefügt, mit dem Gundolf seine<br />
Charakteristik weise ergänzt: Hölderlins Hymnen "sind nur die<br />
dichterische Stimme eines dichterischen Schweigens".<br />
134<br />
Dionysos in der Dichtung Hölderlins<br />
mit besonderer Berücksichtigung der FRIEDENSFEIER<br />
I.<br />
In der Dichtung Hölderlins spielt Dionysos eine außerordentliche<br />
Rolle. Von den Göttern des Altertums, zu denen Hölderlin in einem<br />
innigeren Verhältnis stand als irgend ein Dichter neuerer Zeit,<br />
ist Dionysos derjenige Gott, den er weitaus am meisten besungen<br />
hat. Dennoch fehlt bis heute in der Hölderlinliteratur eine umfassende<br />
Untersuchung über das Verhältnis des Dichters zu dieser<br />
Gottheit. Die folgenden Betrachtungen wollen <strong>nicht</strong> den Anspruch<br />
erheben, diesen Mangel zu ersetzen. Sie haben ein begrenzteres<br />
Ziel. Ich möchte lediglich einige der wichtigsten Züge in Erinnerung<br />
bringen, die an Hölderlins Dionysosbild zutage treten, um<br />
mich dann einem Gedicht zuzuwenden, in dem, wie mir scheint,<br />
Dionysos gleichfalls eine entscheidende Rolle spielt, ohne dass man<br />
dies jedoch bisher erkannt hat. Was ich also recht summarisch zunächst<br />
über Hölderlins Verhältnis zu Dionysos überhaupt vorzubringen<br />
gedenke, soll im wesentlichen dienen als Grundlage zur<br />
Interpretation jenes Gedichts.<br />
Wenn Hölderlin <strong>von</strong> Göttern sprach, so stellte er sich in bewußten<br />
Gegensatz zu Gepflogenheiten seiner Zeit. Er sprach <strong>von</strong> den<br />
Göttern nur mit heiligstem Ernst, er rief eine Gottheit nur an, wenn<br />
ihn inneres Erleben in ihren eigensten Wirkungsbereich geführt<br />
hatte. Den Dichtern seiner Zeit dagegen warf er vor, sie trieben mit<br />
ihren freigebigen, aber unverpflichteten Bezugnahmen auf die antiken<br />
Götter nur ein frevles, ein, wie er sagte, »scheinheiliges« Spiel. 1<br />
Eine zutiefst in seinem Wesen begründete Gewissenhaftigkeit bestimmte<br />
Hölderlin auch auf diesem Gebiet. Es ist jene Gewissen-<br />
Vgl. DIE SCHEINHEILIGEN DICHTER; DICHTER BERUF v. 39.<br />
135
haftigkeit, die uns noch in seinen Briefen, seinen philosophischen<br />
Schriften mit ihren oft quälend skrupelhaften Wendungen entgegentritt.<br />
Wirklich sprach Hölderlin <strong>von</strong> und mit den Göttern erstmals<br />
wieder nach der Antike mit einer ähnlichen inneren Anteilnahme<br />
wie die Antike. Was bei andern Spiel gewesen, bei ihm<br />
wurde es feierlicher Ernst.<br />
Es konnte nun sehr leicht geschehen, dass Hölderlin sich in den<br />
Wirkungsbereich einer Gottheit versetzt sah. Er lebte nach dem<br />
ganz griechischer Frömmigkeit gemäßen Wahlspruch: "Nichts,<br />
auch das kleinste, das alltäglichste <strong>nicht</strong> ohne den Geist und die<br />
Götter!" Dieser Satz - er steht im HYPERION 2 - erklärt es, dass für<br />
Hölderlin unzählige Momente und Situationen eintraten, in denen<br />
er sich den Göttern zu huldigen gedrängt sah. Besonders erweckt<br />
fast jedes Erlebnis, das irgendwie den Charakter einer Feier<br />
hat, in ihm das Bedürfnis, eine Gottheit anzurufen, die der Feier<br />
rechte Heiligung und Weihe gibt.<br />
Die allernächstliegende Situation, in der ihm Dionysos zu dem<br />
Gott wird, den es zu feiern, dem es zu opfern gilt, ist natürlicherweise<br />
das Symposion. In diesem Fall ist Dionysos ganz einfach der<br />
Gott der Freude und des Weins. Er ist zugegen und er wird geehrt,<br />
wenn Freunde in festlicher Stunde zusammenkommen und den<br />
Becher leeren. Besonders in dieser Situation hat ihn auch das Altertum<br />
gefeiert - die antike Dichtung bietet zahllose Beispiele für<br />
solche Ehrungen des Dionysos.<br />
Wir kennen eine ganze Anzahl <strong>von</strong> Gedichten Hölderlins, die<br />
derartige Freundschaftsfeiern besingen. Aus ihnen ist zu ersehen,<br />
wie er es liebte, diese Feiern mit reichem Zeremoniell auszustatten.<br />
Eine »Halle« wird dann festlich geschmückt, die Tische werden<br />
»mit Rosen bestreut«3, Weihrauch »dampft am Fenster«, Musik<br />
erklingt, Chöre verschönern das Fest - so zu lesen beispielsweise<br />
in dem Jugendgedicht AM T ACE DER FREUNDSCHAFTSFEIER.<br />
2 StA III 111.<br />
3 Die Rose war bei den Griechen dem Dionysos ebenso heilig wie der Aphrodite.<br />
136<br />
Aus den Berichten über die Aldermannstage der Tübinger Zeit<br />
erfahren wir, welchen Wert der Dichter auf die Einhaltung feierlicher<br />
Handlungen, eines der Antike abgesehenen Rituals bei solchen<br />
Symposien legte. Er drang vor Absingung einer Götterhymne<br />
auf entsühnende Waschung am Kastalischen Quell, er rief mit<br />
Worten des Schillerschen Lieds AN DIE FREUDE den Agathos Daimon,<br />
den Guten Geist an. Wer der Agathos Daimon war, den die Griechen<br />
zu Beginn des Symposions anzurufen pflegten, darüber gibt<br />
es verschiedene Auslegungen. Eine Auffa.ssung geht dahin, dass er<br />
identisch sei mit Dionysos. Hier<strong>von</strong> berichtet Athenaios. 4<br />
Charakteristisch für viele Gedichte, in denen Hölderlin die Symposion-Situation<br />
besingt, ist es, dass er den Namen des gefeierten<br />
Gottes <strong>nicht</strong> gern nennt. Dies hängt überhaupt mit seiner Scheu<br />
zusammen, in die Bahnen der Konvention zu geraten und die Götternamen<br />
phrasenhaft zu gebrauchen. Gerade für Trinklieder, für<br />
Verherrlichungen der Symposion-Situation machte die damalige<br />
Poesie ausgiebig Gebrauch <strong>von</strong> Zitationen des Dionysos, des Bacchus,<br />
wie es gewöhnlich hieß. Die Tage der Anakreontik lagen ja<br />
<strong>nicht</strong> weit zurück. Hölderlin sucht in solchen Fällen oft andere<br />
Wege, den Gott zu feiern. Er erinnert an ihn etwa durch andeutend<br />
umschreibende Wendungen wie: »heilige Rebe«, »heiliger Trank«,<br />
»heiliges Laub«, »bacchantisches Laub«, »heiliger Wein«, »Göttertrank«,<br />
»des Gottes freundliche Gaben«. Die gern gebrauchte Wendung<br />
»heilige Rebe« stammt natürlich <strong>von</strong> Horaz. »Nullam, Vare,<br />
sacra vi te prius« - so beginnt eins der großen Bacchus-Gedichte in<br />
den Oden des Horaz. Bevorzugtes Mittel der Beschwörung des<br />
Dionysos ist aber für Hölderlin stets die charakteristische Schilderung<br />
des Zeremoniells beim Symposion. Besonders eben die festliche<br />
Ausschmückung des Raumes wird in so feierlich religiösen<br />
Tönen besungen, dass die Gegenwart und Ehrung des Weingotts<br />
allein dadurch zum Faktum wird.<br />
4 Philonides bei Athen. XV 675 b. c. Vgl. Philochoros bei Athen. II 38 d; Diodor BibI.<br />
IV 3, 4. - Dass Hölderlin Athenaios kannte, ist durch seine Übersetzungen bezeugt.<br />
Vgl. StA V 31. 359.<br />
137
Dionysos galt nun im Altertum zugleich als Gott der Dichter,<br />
neben Apollo.5 Wahre Dichtung erwächst nach antiker Auffassung<br />
nur aus Begeisterung, Mania, göttlichem Wahnsinn. Dionysos aber<br />
ist der Gott, der in Begeisterung versetzt, <strong>nicht</strong> nur in die des Weins,<br />
sondern auch in die musische. Diese Eigenschaft des Dionysos ließ<br />
ihn eigentlich zum Lieblingsgott Hölderlins werden.<br />
Als Gott der Dichter wurde Dionysos im Altertum besonders<br />
eindrucksvoll <strong>von</strong> Horaz gefeiert. Seine Oden enthalten hierüber<br />
berühmte Zeugnisse,6 aber auch die Episteln, wo der Dichter ausdrücklich<br />
als »cliens Bacchi« gekennzeichnet wird. 7 Es ist daher<br />
gewiß kein Zufall, dass in einer Handschrift, auf der Hölderlin<br />
Übersetzungsversuche zu Horazischen Oden niedergeschrieben<br />
hatte, zugleich der Entwurf zu seinem ersten bedeutenden Dionysos-Gedicht<br />
zu lesen ist. Die kurze Ode AN UNSRE GROSSEN DICHTER<br />
<strong>von</strong> 1797/98, um die es sich hier handelts, besingt Bacchus wirklich<br />
als den Gott der Dichter:<br />
5 Bei den Griechen wurden Dionysos und Apollo oft nebeneinander verehrt. Beide<br />
Götter hatten vielfach gemeinsame Heiligtümer. In Athen war die Verbindung zu<br />
Dionysos durch Tragödie und Komödie gegeben. Hier hatte auch Dionysos<br />
Melpomenos als Gott der Schauspielvereine ein Heiligtum: Pausanias I 2, 5; 31, 6.<br />
Dionysos als Führer der Musen: Sophokles Antigone 965. Diodor IV 5, 4 (Begründer<br />
des Theaters etc.). Der Beiname Musagetes für Dionysos ist vielfach<br />
inschriftlich bezeugt. Die römische Dichtung nennt oft Apollo und Bacchus nebeneinander<br />
als Götter der Dichtung: TIbull (Lygdamis) III 4, 44. Properz III 2, 7. Ovid<br />
am. l. 3, 11 und öfter.<br />
6 Horaz carm. II 19. III 25. IV 8.<br />
7 Horaz epist. II 2, 78. VgJ. auch epist. I 19,4. Besonders Ovid trist. V 3 über die als<br />
Kultgemeinschaft des Liber gegründete sodalitas poetarum, der auch Horaz angehörte.<br />
VgJ. Ovid am. III 15, 17. Als cJiens Bacchi trägt der römische Dichter Kränze<br />
<strong>von</strong> Efeu oder Weinlaub (statt <strong>von</strong> Lorbeer): vgJ. Vergil ecJ. 7, 25. 8, 13. Horaz<br />
carm. I 1,29. III 25, 20. Properz II 5, 26. IV 1, 62. Ovid trist. I 7, 2.<br />
8 StA I 261. 575. 559. Das Gedicht gehört zu einer Gruppe <strong>von</strong> epigrammatischen<br />
Oden, die doch wohl das formale Kennzeichen der Kürze jenem Rat verdanken,<br />
den Goethe am 22. Aug. 1797 gelegentlich eines Zusammentreffens mit Hölderlin<br />
in Frankfurt erteilte; "kleine Gedichte zu machen". (Goethe an Schiller 23. Aug.<br />
1797.) Am 30. Juni 1798 wurde das Druckmanuskript an Schiller gesandt.<br />
138<br />
Des Ganges Ufer hörten des Freudengotts<br />
Triumph, als allerobernd vom Indus her<br />
Der junge Bacchus kam, mit heilgern<br />
Weine vom Schlafe die Völker wekend.<br />
o wekt, ihr Dichter! wekt sie vom Schlummer auch,<br />
Die jetzt noch schlafen, gebt die Geseze, gebt<br />
Uns Leben, siegt, Heroen! ihr nur<br />
Habt der Eroberung Recht, wie Bacchus.<br />
Das Gedicht enthält, so kurz wie es ist, im Grunde nahezu alle<br />
Elemente, die <strong>von</strong> jetzt ab in Hölderlins Dichtung das Bild des Dionysos<br />
bestimmen. Dabei wird zunächst die antike, horazische Vorstellung<br />
<strong>von</strong> Bacchus als dem Gott der Dichter bedeutsam erweitert:<br />
der Dichter selbst soll - so will es Hölderlin - »wie Bacchus«<br />
werden; er soll Eroberer und Gesetzgeber, der Erwecker einer<br />
schlummernden Menschheit sein. Die kühne Identifikation des<br />
Dichters mit Dionysos bleibt fernerhin kennzeichnend für Hölderlins<br />
Stellung zu dem Gott.<br />
Bedeutsam ist an dem Gedicht aber vor allem die Bezugnahme<br />
auf den Indienzug des Dionysos. Hölderlin las hier<strong>von</strong> genug bei<br />
Horaz, Ovid 9 , Diodor, doch mag er auch Nonnos gekannt haben.<br />
Es ist natürlich stets in Betracht zu ziehen, dass Hölderlin im Schrifttum<br />
der Antike außerordentlich gut belesen war. Diodors Historische<br />
Bibliothek, eine der wichtigsten Quellen für unsere Kenntnis<br />
<strong>von</strong> Dionysos, gab sicherlich die Hauptanregung. Wenn Hölderlin<br />
<strong>von</strong> dem »Triumph« des Bacchus spricht, so wird das darauf zurückzuführen<br />
sein, dass Diodor an zwei Stellen hervorhebt: Dionysos<br />
sei der erste gewesen, der einen Triumph gefeiert habe.lO Bei<br />
Diodor werden ferner auch der Grenzfluß Indus und der Ganges<br />
ausführlich beschrieben. 11 Endlich erzählt Diodor wörtlich, Diony-<br />
9 Vgl. Horaz carm. II 19, 17. Der Ganges wird in diesem Zusammenhang erwähnt:<br />
Ovid met. IV 21. am. I 2, 47. trist. V 3, 23 f. VgJ. ferner Ovid met. XV 413. ars a. I<br />
190. ex Ponto IV 8, 61.<br />
10 Diodor III 65, 8. IV 3, l.<br />
11 Diodor 11 35. 37. Auch hier wird zugleich vom Indienzug des Dionysos gesprochen.<br />
139
sos habe in Indien Gesetze und Gerichte eingeführt sowie die Verehrung<br />
der Gottheit gelehrt. 12 Solche Überlieferung spiegelt sich<br />
wider in Hölderlins Gedicht: »Gebt die Gesetze [ ... 1 ihr nur/Habt<br />
der Eroberung Recht, wie Bacchus.«<br />
Der Eroberungszug des Dionysos,13 der den Gott in fernste<br />
Länder führte, wurde für Hölderlin <strong>von</strong> nun ab das bevorzugte<br />
Sinnbild überhaupt für das Wesen entscheidender geistiger Revolutionen.<br />
Wenn eine Weltzeit sich erneuert - und auf eine solche<br />
Erneuerung ist ja Hölderlins ganzes Dichten und Prophezeien gerichtet<br />
-, wenn eine Weltzeit sich erneuert, so geschieht das durch<br />
Wanderung des Geistes und der Götter. Die Wanderung führt dann<br />
in fernes Ausland, oder <strong>von</strong> dort, <strong>von</strong> der Kolonie, in die Heimat<br />
zurück. In vielen Abwandlungen kehrt dies Bild beim späten Hölderlin<br />
wieder. Seinen Ursprung, dies ist für uns wichtig zu wissen,<br />
nimmt es <strong>von</strong> dem Indienzug des Dionysos.<br />
Die große Hymne, entstanden um die Jahrhundertwende, bringt<br />
abermals eine Gleichsetzung des Dichters mit Bacchus. Auch hier<br />
ist dem Dichter die entscheidende Rolle zugedacht in dem Augenblick,<br />
wo eine neue Weltzeit anbricht, wo die Völker aus langem<br />
Schlaf erwachen. Seine Aufgabe ist es dann nämlich, »dem Volk<br />
ins Lied gehüllt die himmlische Gabe zu reichen« (v. 59 f.). Dichtung<br />
ist dann das »himmlische Feuer, das die Erdensöhne ohne<br />
Gefahr trinken«. Und zwar trinken sie es deswegen ohne Schaden<br />
zu nehmen, weil sich der Dichter bereits der Gefahr unterzogen<br />
hat, die mit der Entgegennahme der himmlischen Gabe verbunden<br />
ist. Um das Wesen dieser Gefahr zu verdeutlichen, vergleicht<br />
Hölderlin die dichterische Empfängnis mit der Geburt des Dionysos.<br />
Semeie, die Mutter des Gottes, wurde bei der Geburt des Dionysos<br />
vom Blitz getroffen. Sie, die sterbliche Geliebte des Zeus,<br />
erbat sich <strong>von</strong> diesem auf Anstiften der eifersüchtigen Hera, er möge<br />
ihr in seiner ganzen Hoheit erscheinen. Als Zeus ihr nun in seiner<br />
12 Diodor II 38: Tllläv Tf xmaödl;m TC> =:dov xai vOIlOUC; d
in Hölderlins Dichtung an vielen Stellen zu spüren. Als Beispiel<br />
führe ich nur an: wenn es in der Ode CHIRON heißt: »Ein waiches<br />
Wild« (v. 6), so stammt diese ungewöhnliche Wendung wörtlich<br />
aus den Bakchen. Dort wird Dionysos in einer bestimmten Situation<br />
geschildert als 6 9i)p npäo
Das Ziel, zu dem der Dichter uns einlädt, ist also die Heimat des<br />
Dionysos: Theben, die Geburtsstadt des Gottes, der Kithairon und<br />
der Parnaß18, die Orte, wo er seine Feiern hielt. Die Erwähnung<br />
der Fichten, der Trauben, des Ismenos und Kadmos, alles das steht<br />
im Zusammenhang mit der Welt des Dionysos, wie wir sie auch<br />
aus den Euripideischen BAKcHEN kennen. Im übrigen spielt der Vers:<br />
»Dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott« speziell<br />
an auf die Wanderungen des Dionysos. Der Gott geht <strong>von</strong> Theben<br />
aus auf seine weiten Wanderungen und er kehrt - wie in Euripides'<br />
BAKCHEN geschildert wird - nach Theben zurück <strong>von</strong> seinen<br />
Asienzügen, um dort gegen ihm feindliche Mächte seinen Kult<br />
einzusetzen.<br />
In einer späten Variante lautet der Vers übrigens: »Dorther<br />
kommt und da lachet verpflanzet, der Gott«.19 Die Rückkehr nach<br />
Theben ist hier als "Verpflanzung" aufgefaßt. Das Bild der Pflanzstadt,<br />
der aJtoLXtU, der Kolonie steht nahe. Gleichzeitig mit dieser<br />
Variante entwarf Hölderlin eine Änderung der Schlußstrophe des<br />
Gedichts, die in gleichem Sinne <strong>von</strong> Wanderung und Kolonie<br />
spricht. Es ist die merkwürdige Stelle, die ans Licht gezogen zu<br />
haben Friedrich Beißners Verdienst ist:20<br />
nemlich zu Hauß ist der Geist<br />
Nicht im Anfang, <strong>nicht</strong> an der Quell. Ihn zehret die Heimath<br />
Kolonie liebt, und tapfer Vergessen der Geist.<br />
Unsere Blumen erfreun und die Schatten unserer Wälder<br />
Den Verschmachteten. Fast wär der Beseeler verbrandt.<br />
Bei der Interpretation dieser Verse hat man vor allem in Betracht<br />
zu ziehen, dass Hölderlin in der Spätzeit, aus der die Variante<br />
stammt, oftmals »der Geist« sagt, wo er früher <strong>von</strong> »der Gott« gesprochen<br />
hätte.21 Es ergibt sich dann aus dem ganzen inhaltlichen<br />
und handschriftlichen Zusammenhang, dass gemeint ist mit dem<br />
18 Über den Pamaß als Kultort des Dionysos vgl. unten 5.170, Fußnote 147.<br />
19 StA II 599 Z. 5.<br />
20 StA II 608. Vgl. Fr. Beißner Hölderlins Übersetzungen aus dem Griechischen . 1. Aufl.<br />
Stuttgart 1933. 2. Auf!. 1961. S. 147 H.<br />
21 Nicht nur in den Übersetzungen. Vgl. StA II 60 v. 1; 68 v. 19; 527; 551 Z. 13 und 19;<br />
557 Z.18.<br />
144<br />
»Geist, der Kolonie liebt« usw.: der Gott Dionysos. Dies scheint<br />
mir durch folgendes bewiesen zu werden: 22<br />
1. Die Verse wollen eine Variante bringen zu der letzten Strophe<br />
des Gedichts. Wie aber die ganze Elegie ja vorn Weingott handelt,<br />
so insbesondere die letzte Strophe, wo in aller Ausführlichkeit<br />
<strong>von</strong> der Hadesfahrt des Dionysos erzählt wird. Es ist also nur<br />
natürlich, dass die Variante - vorn »Geist, der Kolonie liebt« - ebenfalls<br />
gedichtet wurde im Hinblick auf den Weingott. Es kommt aber<br />
noch etwas hinzu: auch in der früheren Fassung dieser letzten Strophe<br />
hatte Hölderlin bereits Dionysos als »Geist« bezeichnet, und<br />
zwar: als »des Weines göttlichgesandter Geist«!23<br />
2. Prüft man in der spätesten Handschrift <strong>von</strong> BROD UND WEIN<br />
die Schicht der Varianten, zu der die in Frage stehenden Verse vorn<br />
»Geist der Kolonie liebt«, gehören, so findet man auch hier, und<br />
zwar an drei Stellen, dass Hölderlin »Geist« sagt statt »Gott«. An<br />
einer <strong>von</strong> diesen Stellen änderte er ebenfalls die Bezeichnung<br />
»Weingott« um in »des Weins Geist«F4<br />
3. Aufschlußreich ist ferner die Gleichzeitigkeit der Variante<br />
»Dorther kommt und da lachet verpflanzet, der Gott«, die eindeutig<br />
auf die Züge, die Wanderungen, das Koloniebilden des Dionysos<br />
anspielt, wie wir sahen.<br />
4. Dass das Wort »Geist« hier <strong>nicht</strong> im allgemeinen Sinn zu verstehen<br />
ist, sondern tatsächlich als »Gott«, bezeugen die Schlußworte<br />
der Variante; »Fast wär der Beseeler verbrandt«. Das Wort »Beseeler«<br />
läßt ja ganz deutlich erkennen, dass der Geist hier personal<br />
gedacht ist, <strong>nicht</strong> begrifflich. Nun kann aber des weiteren <strong>nicht</strong><br />
übersehen werden, dass der Satz »Fast wär der Beseeler verbrandt«<br />
doch ganz offenkundig eine Anspielung auf den Mythos <strong>von</strong> der<br />
Geburt des Dionysos enthält. Gerade der Zug an diesem Mythos,<br />
dass der Gott durch den Blitz des Zeus ni c h t verbrannte, während<br />
seine sterbliche Mutter Semeie daran zugrunde ging, dieser<br />
22 Das Folgende stimmt grundsätzlich überein mit den Ausführungen Beda Allemanns<br />
in: Hölderlin und Heidegger. 2. Auf!. Zürich u. Freiburg i. Br. 1965. S. 167 H.<br />
Ergänzungen zu Allemanns Argumentation enthalten hier Punkt 3 bis 5.<br />
23 StA II 607 Z. 19 f.<br />
24 StA 1I 603 Z. 35; 604 Z. 1 f.; 605 Z. 13 f.; 606 Z. 29 f.<br />
145
III.<br />
Hiermit sei der Überblick über die wichtigsten Dionysos-Stellen in<br />
Hölderlins Dichtung abgeschlossen, um nun alle Aufmerksamkeit<br />
dem Gedicht DIE FRIEDENSFEIER zuzuwenden, das eine der allerbedeutendsten<br />
Erwähnungen des Gottes enthält. Dies Gedicht hat<br />
seit seiner Entdeckung im Jahre 1954 mehr als irgendein anderes<br />
der Forschung Probleme geboten und die Geister bewegt. Hier muß<br />
berührt werden, was man seither den Streit um DIE FRIEDENSFEIER<br />
genannt hat.<br />
Wie man weiß, handelt es sich bei dem Streit um die Frage, wer<br />
zu verstehen sei unter dem sogenannten »Fürsten des Fests«. Bekanntlich<br />
feiert Hölderlin in dem Gedicht den Frieden <strong>von</strong> Lunevi<br />
lle, und zwar als ein Ereignis, das ihn den Anbruch einer neue<br />
Welt-Ära erhoffen läßt, wie er sie erträumte. Wirklich wird eine<br />
F ier geschildert, Menschen und Götter nahmen gemeinsam an ihr<br />
t il. Der Dichter stellt hier aber zwei erhabene Gäste besonders<br />
vor: Christus und eben den »Fürsten des Fests«, wobei auch dieser<br />
I tztere ausdrücklich als »ein Gott« bezeichnet, jedoch mit Namen<br />
<strong>nicht</strong> genannt wird. Man hat nun die verschiedensten Versuche<br />
u nternommen, diesen ungenannten Gott zu identifizieren. Der<br />
Fürst des Fests sollte etwa sein: gleichfalls Christus, dann Napo<br />
I on, dann der personifizierte Friede, der Genius unseres Volkes<br />
oder der des griechischen, Herakles oder auch der Vatergott. Wirklich<br />
d urchschlagende Gründe ließen sich für keine der Hypothesen<br />
rbringen, und so blieb die ganze Frage praktisch in der Schwebe.<br />
Die betreffenden Partien der FRIEDENSFEIER seien hier mit all dem<br />
v rglichen, was bisher über Hölderlins Auffassung <strong>von</strong> Dionysos<br />
in Erinnerung gebracht wurde, woraus sich m. E. unausweichlich<br />
die Schlußfolgerung ergibt, dass Dionysos der unbekannte Gott ist<br />
u nd dass wir hier den dritten Fall vor uns haben, wo Hölderlin<br />
hristus und Dionysos in einem seiner großen Spätgesänge zua<br />
mmenführt.<br />
ie Einladung an den Fürsten des Fests, die so große Rätsel<br />
aufgibt, wird bereits in der 2. Strophe ausgesprochen. Die 1. Stroph<br />
schildert zunächst expositioneIl die Gesamtsituation, das Mi-<br />
148<br />
lieu. Zu einem Fest außergewöhnlicher Art ist ein auch sonst schon<br />
für Feierzwecke benutzter Saal auf das prächtigste ausgeschmückt.<br />
Der himmlischen, still wieder klingenden,<br />
Der ruhigwandelnden Töne voll,<br />
Und gelüftet ist der altgebaute,<br />
Seeliggewohnte Saal; um grüne Teppiche duftet<br />
Die Freudenwolk' und weithinglänzend stehn,<br />
Gereiftester Früchte voll und goldbekränzter Kelche,<br />
Wohlangeordnet, eine prächtige Reihe,<br />
Zur Seite da und dort aufsteigend über dem<br />
Geebneten Boden die Tische.<br />
Denn ferne kommend haben<br />
Hieher, zur Abendstunde,<br />
Sich liebende Gäste beschieden.<br />
Was hier die Exposition schildert, ist, wenn wir es recht überlegen,<br />
<strong>nicht</strong>s anderes als die Symposion-Situation; die Symposion-Situation,<br />
so wie Hölderlin sie oftmals dichterisch dargestellt hat. Wir<br />
haben da<strong>von</strong> gesprochen, dass Hölderlin die festliche Zurichtung<br />
eines Raumes für das Symposion mit Vorliebe schildert und dass<br />
die zeremonielle Schmückung, wie überhaupt das Ritual beim Symposion<br />
<strong>von</strong> ihm durchaus religiös feierlich empfunden wird im Sinne<br />
einer Ehrung der Gottheit des Weins und des Symposions, des<br />
Dionysos. All das kehrt auch hier in der FRIEDENSFEIER wieder. Goldbekränzte<br />
Kelche, prächtig zubereitete Tische, himmlische Musik,<br />
endlich - Weihrauch als Zeichen des Götteropfers. Nämlich das<br />
Wort »Freudenwolke«, an dem die Ausleger so viel herumgerätselt<br />
haben, bedeutet natürlich Weihrauch, so wie auch das Jugendgedicht<br />
AM T ACE DER FREUNDSCHAFTSFEIER in gleichem Zusammenhang<br />
<strong>von</strong> Weihrauch sprach. 30 »Syrischer Weihrauch« ist notabene<br />
in Euripides' BAKcHEN ein selbstverständliches Zubehör zum Dionysoskult.<br />
31<br />
30 Verwandte Züge zwischen AM TAGE DER FREUNDSCHAFTSFEI ER und der FRIEDENS FEIER<br />
stellt auch Kar! Kerenyi fest in: Vergil und Hölderlin. Zürich 1957. S. 12 H.<br />
31 Euripides BAKcHEN 144. Weihrauch bei Opferhandlungen auch: Troades 1064. Ion<br />
89. Wei hrauch, goldene Becher, Musik: Ion 1174 H.<br />
149
Wenn wir seegnen das Mahl, wen darf ich nennen und wenn wir<br />
Ruhn vorn Leben des Tags, saget, wie bring' ich den Dank?<br />
Nenn' ich den Hohen dabei? Unschikliches liebet ein Gott <strong>nicht</strong>,<br />
Ihn zu fassen, ist fast unsere Freude zu klein.<br />
Schweigen müssen wir oft; es fehlen heilige Nahmen ...<br />
Interessant ist, dass Hölderlin die Wendung »Unschikliches liebet<br />
ein Gott <strong>nicht</strong>« später änderte in »Unfürstliches liebet ein Gott<br />
<strong>nicht</strong>«. Nachweislich erfolgte diese Änderung nach Ausführung<br />
der FRIEDENSFEIER. Hier mag die Erinnerung an den Fürsten des Fests<br />
mitgespielt haben.<br />
Die für Hölderlin so bezeichnende Scheu, Götternamen auszusprechen,<br />
wird in den angeführten Versen Gegenstand der Betrachtung.<br />
Man hat berechtigterweise an die ähnliche Scheu beim alttestamentarischen<br />
Judentum erinnert. Lehrreich ist für uns im<br />
Hinblick auf die FRIEDENSFEIER: gerade vor der Nennung des Weingotts<br />
in der Symposion-Situation scheut der Dichter zurück, auch<br />
in der Elegie HEIMKUNFT. Offenbar fürchtet er den Rückfall in die<br />
Konvention der Anakreontik, fürchtet jenen spielenden, scheinheiligen<br />
Umgang mit Götternamen, den er sich gerade verbietet. Den<br />
Gott, der das "Gastmahl segnet", namentlich zu nennen, ist vor<br />
allem deswegen <strong>nicht</strong> nötig, weil ohnehin jeder weiß, um wen es<br />
sich handelt - die Anakreontik hatte es bis zum Überdruß oft gesagt.<br />
Hierauf deutet nun auch die FRIEDENSFEIER, wenn sie Dionysos<br />
- den »Fürsten des Fests« - einfach den »Allbekannten« nennt, wo<br />
er als Gott des Symposions auftritt. In ähnlicher Weise verschweigt<br />
die Ode CHIRON den Namen des Zeus und spricht <strong>von</strong> ihm einfach<br />
als <strong>von</strong> dem »Bekanntesten«, wo es nämlich durch sein Erscheinen<br />
als Gewittergott ganz klar ist, um wen es sich handelt. 52 Wenn also<br />
bereits Situation und Umstände eine Gottheit erkennbar machen,<br />
dann verzichtet Hölderlin gern auf die Nennung ihres Namens.<br />
Übrigens wird in der FRIEDENSFEIER auch Christus nirgends bei Namen<br />
genannt, obwohl <strong>von</strong> ihm noch ausführlicher als vom Fürsten<br />
des Fests die Rede ist. Auch seine Gestalt wird nur durch Umschrei-<br />
52 »Doch keiner wird den Donnerer nennen«, heißt es in ähnlichem Zusammenhang<br />
auch im Entwurf zu AM QUELL DER DONAU ( StA Il690 Z. 30).<br />
160<br />
bungen verdeutlicht. Bewirkt ist damit auch, dass die beiden göttlichen<br />
Gestalten sich in größtmöglicher Freizügigkeit darstellen.<br />
v.<br />
Besondere Schwierigkeiten in dichterischen Werken klären sich<br />
gewöhnlich erst dann in wirklich befriedigender Weise, wenn wir<br />
einzusehen vermögen, warum der Dichter darauf geführt wurde,<br />
den betreffenden seltsamen Zug gerade so und <strong>nicht</strong> anders zu<br />
gestalten. Es läßt sich nun glücklicherweise auch recht gut erkennen,<br />
wie Hölderlin im Laufe der Entstehung der FRIEDENSFEIER dazu<br />
kam, gerade Dionysos als Fürsten des Fests einzuladen. In den<br />
Entwürfen zu dem Gedicht, die wir schon viel länger kennen als<br />
die FRIEDENSFEIER selber, finden sich nämlich eine ganze Reihe <strong>von</strong><br />
gedanklichen Ansätzen, die der Dichter nur seiner Gesinnung gemäß<br />
konsequent weiterzudenken brauchte, um dann mit Notwendigkeit<br />
auf die Gestalt des Dionysos zu kommen. Vorgegeben ist<br />
dort im Entwurf schon die Symposion-Situation, in den folgenden<br />
Versen, die abgewandelt auch in die FRIEDENSFEIER übernommen<br />
wurden: 53<br />
Drum hab ich heute das Fest, und abendlich in der Stille<br />
Blüht rings der Geist \lnd wär auch silbergrau mir die Loke,<br />
Doch würd ich rathen, dass wir sorgten ihr Freunde<br />
Für Gastmahl und Gesang, und Kränze genug und Töne<br />
Bei solcher Zeit unsterblichen Jünglingen gleich.<br />
Zu Gastmahlen dieser Art lädt der Dichter auch sonst Dionysos<br />
ein - als den eigentlichen Gott der Feste. Ich erinnere besonders an<br />
das oben über DIE HERBSTFEIER Gesagte. Es ist durchaus einleuchtend,<br />
dass dies bei der weiteren Ausführung des Entwurfs auch in<br />
der FRIEDENSFEIER geschah. - In den Entwürfen finden wir vorerst<br />
nur Christus eingeladen, der ja in der FRIEDENSFEIER gemeinsam mit<br />
dem Fürsten des Fests als Gast erscheint. Doch findet sich auch in<br />
53 VERSÖ HNENDER DER DU NIMMER GEGLAUBT (StA II 131, v. 34 H.).<br />
161
den Entwürfen schon deutlich der Gedanke ausgesprochen, und<br />
zwar in verschiedenster Weise, dass Hölderlin neben Christus noch<br />
andere Gottheiten einladen möchte. Zum Beleg seien die folgenden<br />
Verse angeführt: »Sei versöhnt« - Christus ist angeredet-<br />
dass wir des Abends<br />
Mit den Freunden dich nennen, und singen<br />
Von den Hohen, und neben dir noch andere sein.<br />
Weiter bittet der Dichter in diesem Sinne um die Erlaubnis, alle<br />
Götter feiern zu dürfen, sie <strong>nicht</strong> »zählen« zu müssen. Auch der<br />
Satz »Und manchen möcht' ich laden« - d. h. manchen Gott möcht'<br />
ich laden -, dieser Satz aus der FRIEDENSFEIER steht schon im Entwurf<br />
und bezeugt hier, dass der Dichter schon ursprünglich eine<br />
Erweiterung der Einladung über Christus hinaus in Betracht gezogen<br />
hatte. An anderer Stelle heißt es:<br />
Und der Vater thront nun nimmer oben allein.<br />
Und andere sind noch bei ihm.<br />
Vielnat erfahren der Mensch. Der Himmlischen viele genannt,<br />
Seit ein Gespräch wir sind<br />
Und hören können <strong>von</strong>einander.<br />
Was in solchen Versen zur Sprache kommt, sind polytheistische<br />
Vorstellungen und Visionen ganz der Art, wie sie der späte Hölderlin<br />
liebte. Die Entwürfe lassen nun aber erkennen, dass dem<br />
Dichter selbst bei dem Aussprechen der Einladung an Christus<br />
ganz besondere Schwierigkeiten erwuchsen, obgleich diese Einladung<br />
offensichtlich <strong>von</strong> Anfang an ein Hauptanliegen war. Wenn<br />
er immer wieder, <strong>nicht</strong> weniger als sechsmal, die Formulierung<br />
versuchsweise niederschreibt - die dann in der·FRIEDENSFEIER selbst<br />
wegfiel-: »Sei gegenwärtig, Jüngling«, »Darum, 0 Göttlicher, sei<br />
gegenwärtig« etc.,54 wenn er dabei immer wieder diese Einladung<br />
an Christus begründet - auf fünf verschiedene Weisen -, dann aber<br />
54 Vgl. Hölderlin, Friedensfeier. Hsg. <strong>von</strong> Wolfgang Binder und Alfred Kelletat. Umschrift-Beilage:<br />
12r Z. 1, 18; 9r Z. 5 f.; 10r Z. 19; 10v Z. 1, 12. (= StA II 131 v. 39,56;<br />
II 702 Z. 7 f.; 706 Z. 27; 700 Z. 1;'699 Z. 19.)<br />
162<br />
schließlich gerade bei diesen Versuchen abbricht, so erhellt daraus:<br />
etwas Entscheidendes hinderte ihn, gerade diesen Gedanken<br />
auszusprechen. Die Ursache ist <strong>nicht</strong> schwer zu finden und sie<br />
wird auch aus dem Wortlaut der Entwürfe ersichtlich: Hölderlin<br />
schreckte zunächst noch davor zurück, Christus 'mit' und 'neben'<br />
anderen Göttern einzuladen. Er hätte ihn dadurch jenen gleichgestellt;<br />
dies aber weckte all die Skrupel, die mit seiner Gewissenhaftigkeit<br />
im Umgang mit göttlichen Dingen zusammenhing.<br />
So bricht der Entwurf an dieser Stelle ab. Der Dichter wartet, bis<br />
ihm neues Erleben weiter hilft.<br />
Er wartet <strong>nicht</strong> vergebens. Im Gesang DER EINZIGE findet eine<br />
neue Vision dichterischen Ausdruck. Hier nehmen Vorstellungen<br />
konkrete Gestalt an, <strong>von</strong> denen der Dichter im Stillen wohl längst<br />
geträumt haben mag: <strong>von</strong> der Zugehörigkeit Christi zum Kreis der<br />
antiken Götter. Da wird nun wirklich Christus als Bruder des Herakles<br />
und insbesondere des Dionysos gefeiert. Dieses Gedicht Der<br />
Einzige aber steht' zeitlich auch genau zwischen den Entwürfen<br />
zur FRIEDENSFEIER mit ihren noch zögernden, tastenden polytheistischen<br />
Versen und der Ausführung des ganzen Gedichts. Nachdem<br />
DER EINZIGE geschrieben war, hatte Hölderlin die innere Freiheit<br />
gewonnen, die ihm erlaubte, neben Christus noch einen anderen<br />
Gott zur FRIEDENSFEIER zu laden. Und zwar den Gott, der die Eigenschaften<br />
besaß, die dem feierlichen Gastmahl nach des Dichters<br />
Sinn erst die eigentliche/Weihe zu geben vermochten: Freudigkeit,<br />
Festlichkeit, befeuernden »Gemeingeist«. All das eignet ja Christus<br />
<strong>nicht</strong>. Er ist der »freundlich ernste« Lehrer der Versöhnung<br />
und Liebe, aber kein Gott der Feste.<br />
So dann noch etwas ganz Entscheidendes. In der zeitlich letzten<br />
Stufe der Entwürfe wird in aller Klarheit ausgesprochen: der festliche<br />
Augenblick, der gefeiert werden soll, hat säkulare Bedeutung,<br />
denn er bringt das, was in Hölderlins Hoffnungen eine so große<br />
Rolle spielte: die Einkehr der Götter.<br />
Denn sieh! es ist der Abend der Zeit, die Stunde<br />
Wo die Wanderer lenken zu der Ruhstatt. Es kehrt bald<br />
Ein Gott um den anderen ein ...<br />
163
des nennt Dionysos: JtOAqUXOC;; TE xai dpTJvaToc;; - zum Kriege ebenso<br />
geschickt wie zum Frieden. 59<br />
Im Entwurf zur F RIEDENSFEIER riefen die ersten Verse: »Versöhnender<br />
der du nimmergeglaubt / Nun da bist« etc. noch den »seeligen<br />
Frieden« als Gottheit an. Wenn Hölderlin diese Gestalt später aufgab<br />
zugunsten der des Dionysos, so hing das natürlich damit zusammen,<br />
dass Dionysos ebenfalls in so ausgeprägter Weise eine<br />
Friedensgottheit war. Da er zugleich Gott der Feste und der Dichtung<br />
war, vereinigte er all die Eigenschaften, die dem Gesang vom<br />
Göttermahl an der Zeitenwende entsprachen, Eigenschaften, die<br />
dem Friedensgott ebenso fehlen wie Christus. Die Gestalt des »seeligen<br />
Friedens« aufzugeben ließen aber noch speziellere Gründe<br />
geraten erscheinen: sie war der Gestalt Christi allzu ähnlich, bedeutete<br />
insofern fast eine Verdoppelung. Das zeigt sich vor allem<br />
auch darin, wie im Entwurf der »seelige Friede« als »Versöhnender«<br />
angeredet wird. Die Wendung mußte sogleich an Christus<br />
denken lassen: den Ausdruck »Versöhner« hatte ja Klopstock im<br />
Messias als stehendes Beiwort für Christus gebraucht und damit<br />
popularisiert (in Anlehnung an das Neue Testament). Nachdem<br />
Hölderlin im Entwurf weiter dann auch Christus selbst ausdrücklich<br />
als »Versöhnender« bezeichnet hatte (v. 57): »0 sei Versöhnender<br />
nun versöhnt«), trat die übermäßige Gleichartigkeit der Gestalten<br />
vollends zutage. Durch die Konzeption des Fürsten des Fests<br />
beseitigte der Dichter die Unklarheit und gab den Hauptgestalten<br />
des Gedichts ein unterschiedlicheres, damit zugleich ausdrucksvolleres<br />
Gepräge. Wie Dionysos nun als Friedensgott auftritt, schafft<br />
er das ihm obliegende Friedenswerk gerade durch die entgegengesetzte<br />
- ihm so gemäße - Handlungsweise: er tritt <strong>nicht</strong> als » Versöhnender«,<br />
sondern als Feldherr auf. Aus dieser extremen Umkehr<br />
in der Bildsprache mag man Hölderlins Gedankengang bei<br />
der Gestaltung des Gedichts erahnen.<br />
59 Aristides Dionysos 5. Vgl. auch Plutarch Demetrius 2. Bei Nonnos entschließt sich<br />
Zeus zur Erzeugung des Dionysos, um die Kriegswut auf Erden einzudämmen.<br />
Dionys. VII 30 ff. Vgl. VIII 90. IX 212.<br />
166<br />
Wie sich das Verhältnis zwischen Christus und Dionysos dem späten<br />
Hölderlin darstellt, darüber gibt neben dem Gesang DER EINZI<br />
GE Aufschluß eine fragmentarische Aufzeichnung, die in unserem<br />
Zusammenhang Beachtung verdient. Hier zeigt sich besonders, bis<br />
zu welchem Grad, aber auch bis zu welcher Grenze die beiden<br />
göttlichen Gestalten schließlich dem Dichter verwandt erschienen.<br />
Das Fragment lautet:60<br />
Seines jedem und ein Ende der Wanderschaft<br />
Einen Orden oder<br />
Feierlichkeit geben oder Geseze<br />
Die Geister des Gemeingeists<br />
Die Geister Jesu<br />
Christi.<br />
Drei wesentliche Züge, die für Hölderlin das Bild des Dionysos<br />
bestimmen - der Gott erscheint hier wieder unter der Benennung<br />
»Gemeingeist« -, findet er also auch in Christus wieder: 1. Das<br />
Ordenstiften: bei Dionysos ist hier an den Thiasos61 , die Kultgemeinschaft<br />
des Gottes gedacht, bei Christus jedenfalls an Kloster<br />
und Orden. 2. Das Spenden <strong>von</strong> Feierlichkeiten: Dionysos ist als<br />
der Weingott Herr, Exarchos der Symposien und Feste. Christus ist<br />
gegenwärtig beispielsweise im Abendmahl, dessen schon BROD UND<br />
W EIN im Zusammenhang mit Dionysos gedenkt. 3. Dionysos führt<br />
als Gesetzgeber - wie wir sahen - die Verehrung der Gottheit ein<br />
sowie Recht, Ordnung und Frieden. Inwiefern auch Christus ähnlicherweise<br />
Gesetzgeber ist, braucht <strong>nicht</strong> ausgeführt zu werden.<br />
Hier aber hat die Gleichsetzung der beiden Gestalten auch ihre<br />
deutliche Grenze. Wenn Dionysos 'Gesetzgeber' ist, so übt er in<br />
Hölderlins Sicht damit dasselbe Amt wie der Dichter aus, er wird<br />
gerade durch diese Eigenschaft zum Gott der Dichtung. Dergleichen<br />
gilt <strong>nicht</strong> mehr für Christus. Hölderlin konnte <strong>nicht</strong> sagen:<br />
6(l StA 11 334.<br />
(, I Vgl. oben 5. 152 Fußnote 37.<br />
167
eide geben »Gesang« - das Fragment spricht mit genauer Begrenzung<br />
<strong>von</strong> »Gesetzen«.62<br />
DIE FRIEDENSFEIER aber - dies gilt es immer wieder ins Auge zu fassen<br />
- leitet eine Zeit ein, die vom »Gesang«, <strong>von</strong> der Dichtung her<br />
bestimmt wird. Hierauf deutet vor allem das Auftreten des Dionysos<br />
in dem Gedicht. Grundsätzlich ist zu sagen: wir werden DIE<br />
FRIEDENSFEIER erst in angemessener Weise verstehen, wenn wir berücksichtigen,<br />
welche Rolle Hölderlin gerade hier der Dichtung<br />
zuer<strong>kennt</strong>. Von dem Postulat, in das Hölderlins gesamtes Dichten<br />
und Denken immer wieder mündet: jetzt, wo die Menschheit ihrer<br />
größten Erneuerung seit der Antike entgegengeht, müßten die Dichter<br />
die Führung übernehmen - <strong>von</strong> diesem Postulat spricht die<br />
FRIEDENSFEIER hoffnungsvoller und konkreter als irgendein anderes<br />
Gedicht. Sollte da vom Dichter und seiner entscheidenden Rolle<br />
nirgends die Rede sein? Das wäre schlechthin undenkbar, weil es<br />
Hölderlins Sehweise ganz widerspräche. Es ist <strong>von</strong> ihm die Rede:<br />
er erscheint in der Gestalt des Dionysos, des Gottes der Dichter,<br />
um der Feier vorzustehen, welche die langgetrennten Götter und<br />
Menschen wieder zusammenführt.<br />
VI.<br />
Vom Fürsten des Fests handeln in der FRIEDENSFEIER noch ferner die<br />
3. und 9. Strophe. Es bleibt uns zu fragen, welche Aufschlüsse über<br />
diese Partien im Lichte der bisherigen Betrachtungen zu gewinnen<br />
sind. Zunächst die 3. Strophe. Sie steht, wie die beiden vorhergehenden,<br />
ganz im Zeichen des Dionysos - die folgenden drei Stro-<br />
62 Das Verhältnis des Dionysos zum »Gesang«, zum Dichter und zur Dichtung, dessen<br />
Kenntnis für das Verstehen der FRIEDENSFEIER ebenfalls so wichtig ist, erscheint<br />
nochmals in einem anderen, wohl sehr späten Fragment Hölderlins auf wundersame<br />
Weise bezeichnet. »Wenn zu baun anfangen die Himmlischen«, so heißt es<br />
hier, also wenn eine neue Zeit der Göttereinkehr anbricht, dann wird »dem Gesang«<br />
ein »gewaltiges Gut« zugetragen, und zwar mit Hilfe Aphrodites und - bezeichnenderweise<br />
- des »Weingotts«. (StA II 205.)<br />
168<br />
phen sind dann Christus gewidmet. DIE FRIEDENSFEIER ist ja so gebaut,<br />
dass jeweils drei Strophen inhaltlich eine Einheit bilden, das<br />
Ganze also aus vier Triaden besteht.<br />
III Von heute aber <strong>nicht</strong>, <strong>nicht</strong> unverkündet ist er; 25<br />
Und einer, der <strong>nicht</strong> Fluth noch Flamme gescheuet,<br />
Erstaunet, da es stille worden, umsonst <strong>nicht</strong>, jezt,<br />
Da Herrschaft nirgend ist zu sehn bei Geistern und Menschen.<br />
Das ist, sie hören das Werk,<br />
Längst vorbereitend, <strong>von</strong> Morgen nach A.bend, jezt erst, 30<br />
Denn unermeßlich braußt, in der Tiefe verhallend,<br />
Des Donnerers Echo, das tausendjährige Wetter,<br />
Zu schlafen, übertönt <strong>von</strong> Friedenslauten, hinunter.<br />
<strong>Ihr</strong> aber, theuergewordne, 0 ihr Tage der Unschuld,<br />
<strong>Ihr</strong> bringt auch heute das Fest, ihr Lieben! und es blüht 35<br />
Rings abendlich der Geist in dieser Stille;<br />
Und rathen muß ich, und wäre silbergrau<br />
Die Loke, 0 ihr Freunde!<br />
Für Kränze zu sorgen und Mahl, jezt ewigen Jünglingen ähnlich.<br />
Was das »ernste Tagwerk« war, das - nach den Worten der 2. Strophe<br />
- der Fürst des Fests auf seinem langen »Heldenzuge« vollbrachte,<br />
das erfahren wir nun hier. Es brachte den lange ersehnten<br />
und prophezeiten Frieden. Mit diesem Frieden geht allerdings weit<br />
mehr zu Ende als der augenblickliche, der Zweite Koalitionskrieg,<br />
nämlich ein »tausendjähriges Wetter«. Gekommen ist der friedliche<br />
Ausgleich einer aurea aetas, der die eigentliche Voraussetzung<br />
dafür ist, dass nun die »Himmlischen« zusammen mit den Menschen<br />
beim gemeinsamen »Gastmahl« erscheinen, »gastfreundlich<br />
untereinander«, wie es in der 9. Strophe heißt. Wie der Abzug des<br />
»tausendjährigen Wetters« durch das Bild des Einschlafens gekennzeichnet<br />
wird - es braust hinunter, »zu s chI a f e n, übertönt<br />
<strong>von</strong> Friedenslauten« - das läßt wieder an Dionysos denken. Damit<br />
rfährt das Motiv des Müdigkeitsbringens, das in der 2. Strophe so<br />
harakteristisch auftrat, hier eine Fortführung (der in der 9. Strophe<br />
eine weitere folgen wird).<br />
es Dionysos ist, der auch hier wie in BROD UND WEIN - Hölderlins<br />
Vorstellungen gemäß - das Erscheinen der Himmlischen her-<br />
169
chus und Apollo gesagt, dass diesen beiden Göttern - und nur ihnen<br />
- "ewige Jugend" zukomme (14,37):<br />
solis aeterna est Baccho Phoeboque iuventas.<br />
Es steht außer Frage, dass Hölderlin diese Stellen kannte. 68 Von<br />
Ovid hat er verschiedenes übersetzt, auch eine Partie aus den ME<br />
TAMORPHOSEN. Die römischen Elegiker überhaupt aber waren ihm<br />
natürlich vertraut: ihr Studium war die selbstverständliche Voraussetzung<br />
für die eigene Elegiendichtung, <strong>nicht</strong> anders als bei<br />
Goethe. So wird man auch in der Hindeutung auf die "ewigen J ünglinge"<br />
in der FRIEDENSFEIER die Dionysoshuldigung <strong>nicht</strong> verkennen<br />
dürfen, die darin liegt. Wie so oft ist auch hier bei Hölderlin die<br />
Wahl der Worte <strong>von</strong> der antiken Dichtung her bestimmt.<br />
VII.<br />
In der 9. Strophe der FRIEDENSFEIER, die »den Fürsten des Fests« nochmals<br />
nennt, gewinnt endlich eine Vision Gestalt, die Hölderlins<br />
Träumen lange beschäftigt hatte: die eigentliche Zusammenführung<br />
Christi und der olympischen Götter. Vergeblich hatte der Dichter<br />
sich bis dahin gemüht, das schwierigste der hiermit sich auf tuenden<br />
Probleme zu lösen: welches bei einer solchen<br />
Zusammenführung - sie ist alter Traum der Renaissance - die Rolle<br />
des göttlichen Vaters, des Vaters Christi sein könnte. Der Entwurf<br />
VERSÖHNENDER DER DU NIMMER GEGLAUBT hatte bei dieser Frage<br />
gestockt. Ein Hauptansatz war gegeben in den Versen: 69<br />
Und der Vater thront nun nimmer oben allein.<br />
Und andere sind noch bei ihm.<br />
In DER EINZIGE wird der erste dieser Verse wiederholt:7°<br />
Denn nimmer herrscht er allein.<br />
68 Vgl. auch Ovid ars a. I 189: »qui puer es [ ... ] Bacche« etc.<br />
69 StA II 137 v. 47 f.<br />
70 StA II 155 v. 71.<br />
174<br />
Der Vers bezeichnet hier aber - wie schon Hellingrath richtig bemerkte<br />
- gerade diejenige Partie des Gesanges, die dem Dichter<br />
auszuführen <strong>nicht</strong> gelingen wollte. Er steht in der Handschrift ganz<br />
isoliert und fand, obgleich Hölderlin reichlich Raum für weitere<br />
Verse freiließ, keine Fortführung. In DER EINZIGE gelang dem Dichter<br />
doch nur soviel: die »Bruder«-Verwandtschaft zwischen Christus,<br />
Dionysos und Herakles in "kühnem Be<strong>kennt</strong>nis" zu proklamieren.<br />
Das Verhältnis des allmächtigen, herrschenden Vaters zu<br />
dieser Vision blieb noch unberührt, dies war eben das "schwerst<br />
Auszusprechende", mit Hellingrath zu reden.<br />
In der FRIEDENSFEIER ist die Lösung gefunden. Schon in der 3.<br />
Strophe wird, um die Größe der nunmehrigen Wende zu bezeichnen,<br />
verkündet, dass" jetzt Herrschaft nirgend zu sehen sei bei Geistern<br />
und Menschen" - was besagt, dass nun auch im Götterbereich<br />
keine Alleinherrschaft mehr stattfinde. 71 Damit ist derjenige<br />
Freiheitszustand eingetreten, der ja die Voraussetzung bildet für<br />
das nunmehr stattfindende Göttermahl. Die Herbeiführung dieses<br />
Zustands ist ein wesentlicher Bestandteil vorn »Werk« des Fürsten<br />
des Fests.<br />
Aber damit begnügt Hölderlin sich <strong>nicht</strong>. Der Ausgleich der<br />
Götter untereinander, vor allem auch unter Einbeziehung des" Vaters",<br />
ist etwas so Schwieriges und Gewaltiges, dass sogar der Fürst<br />
ges Fests dies <strong>nicht</strong> allein bewirken kann. Zu Hilfe kommt ihm der<br />
»stille Gott der Zeit«, <strong>von</strong> dem die 7. Strophe - die erste der jetzt<br />
<strong>von</strong> uns betrachteten Trias - meldet. Er bringt, ein Verwandter des<br />
'Genius der Zeit', <strong>von</strong> dem die damalige junge Generation viel redeten,<br />
das »schönausgleichende« Gesetz der Liebe, das »<strong>von</strong> hier<br />
an bis zum Himmel« gilt (v. 90).<br />
Es ist der »Vater«, der »hohe Geist der Welt«, der sich damit »zu<br />
Menschen geneigt hat« (v. 75 ff.). Da er selbst »zum Herrn der Zeit<br />
71 »Geister« bedeutet wiederum »Götter«, gemäß dem Sprachgebrauch des späten<br />
Hölderlin. Vgl. oben S. 144 Fußnote 105 und StA III 560: Beißner zu FRIEDENSFEIER<br />
v. 28. Zur Bedeutung des Worts »Herrschaft« vgl. Beißners Hinweis auf DER FRIE<br />
DEN V. 30 in Friedrich Beißner, Hälderlins Friedensfeier. Stuttgart 1954. S. 27.<br />
72 Auf diesen 'Genius der Zeit' spielt auch Goethe an in PALÄOPHRON UND NEOTERPE<br />
(WA 113 1, 5 v. ll).<br />
175
ZU groß« ist (v. 79), muß ein anderer Gott, »Tagewerk erwählend«<br />
(v. 81), als Helfer die Wende herbeiführen - eben jener stille Zeitgott.<br />
Der »große Geist« - so drückt die 8. Strophe das nochmals<br />
aus - »entfaltet« auf diese Weise »das Zeitbild«, das nunmehr seinerseits<br />
ein »Zeichen« genannt wird dafür, "daß zwischen ihm und<br />
andern Mächten ein Bündnis ist". An diesem »Zeichen« erkennen<br />
sich jetzt »alle« Gottheiten. Damit ist die Lösung gefunden für das<br />
Problem des Entwurfs. Die Frage, wie es angängig sein könne, dass<br />
»andere noch bei ihm«, dem »Vater«, seien, fand so ihre Beantwortung.<br />
Von dem Erscheinen des 'Zeichens' sprechen am Schluß der<br />
7. und Zu Beginn der 8. Strophe die folgenden Verse:<br />
VII So dünkt mir jezt das Beste,<br />
Wenn nun vollendet sein Bild und fertig ist der Meister,<br />
Und selbst verklärt da<strong>von</strong> aus seiner Werkstatt tritt,<br />
Der stille Gott der Zeit und nur der Liebe Gesez,<br />
Das schönausgleichende gilt <strong>von</strong> hier an bis zum Himmel. 90<br />
VIII Viel hat <strong>von</strong> Morgen an,<br />
Seit ein Gespräch wir sind und hören <strong>von</strong>einander,<br />
Erfahren der Mensch; bald sind wir aber Gesang.<br />
Und, das Zeitbild, das der große Geist entfaltet,<br />
Ein Zeichen liegts vor uns, dass zwischen ihm und andern 95<br />
Ein Bündniß zwischen ihm und andern Mächten ist.<br />
Nicht er a'llein, die Unerzeugten, Ew' gen<br />
Sind kennbar alle daran, gleichwie auch an den Pflanzen<br />
Die Mutter Erde sich und Licht und Luft sich kennet.<br />
Zu entscheidender Bedeutung gelangt hier noch ein in den drei<br />
Anfangsversen der 8. Strophe hinzutretendes Motiv: es wird wiederum<br />
auf die welterneuernde, die Einkehr der Götter bewirkende<br />
Macht des dichterischen Worts hingewiesen. »Von Morgen an«,<br />
das will sagen: <strong>von</strong> Urzeiten her waren Götter und Menschen durch<br />
das Wort verbunden, hörten <strong>von</strong>einander, sie waren »ein Gespräch«.<br />
Dass dies der Sinn der ersten Verse ist, dass sie <strong>nicht</strong>, wie man<br />
auch gemeint hat, ' bedeuten: Menschen untereinander verständigen<br />
sich durch das Wort, erhellt aus den entsprechenden Versen<br />
des Entwurfs: 73<br />
73 StA II 137 v. 49 ff.<br />
176<br />
Viel hat erfahren der Mensch. Der Himmlischen viele genannt,<br />
Seit ein Gespräch wir sind<br />
Und hören können <strong>von</strong>einander.<br />
Der Mensch und die Himmlischen also sind »ein Gespräch«. In<br />
der FRIEDENSFEIER konnte der Hinweis auf die »Himmlischen« fortfallen,<br />
da im Vorhergehenden (dem Schluß der 7. Strophe) <strong>von</strong> ihnen<br />
die Rede ist - die Strophe endet ja mit dem Wort »Himmel«.<br />
»Wir« meint also natürlich auch hier wie im Entwurf; Götter und<br />
Menschen. Von solchen 'Gesprächen' zwischen Mensch und Gott<br />
berichtet auch AM QUELL DER DONAU. Das »Wort«, das aus dem Osten<br />
(Jonien, Arabien, Asien) belebend zu uns kommt, schließt außer<br />
der antiken Dichtung ein das alttestamentarische Wort der »Propheten«,<br />
<strong>von</strong> denen es ausdrücklich heißt, dass sie .<br />
Zuerst es verstanden,<br />
Allein zu reden<br />
Zu Gott.<br />
Die 8. Strophe der FRIEDENSFEIER spricht nun die Verkündung aus,<br />
dass aus dem »Gespräch« demnächst »Gesang« werde (v. 93). Hier<br />
deutet sich an, welchen ungeh<strong>eure</strong>n Zuwachs an Wert und Würde<br />
Hölderlin dem dichterischen Wort prophezeit. Durch den »Gesang«<br />
wird dem Menschen Kunde <strong>von</strong> dem neuen Zeitbild des großen<br />
Geistes, dem Bündnis zwischen den Göttern, <strong>von</strong> all dem, worüber<br />
im folgenden gesprdchen wird, eingeleitet durch die Partikel<br />
»Und« (v. 94).<br />
Mit dem Motiv der welterneuernden Dichtung sind wir aber<br />
mitten im Wirkungsbereich des Dionysos - er ist ja für Hölderlin<br />
der eigentliche Gott dieser Dichtung. So deutet die 8. Strophe schon<br />
auf sein Erscheinen als Fürst des Fests in der 9. hin, in der das<br />
Dichtungsmotiv dann beherrschend auftritt. Aber Dionysos' Ercheinen<br />
in der 9. Strophe wird auch noch in anderer Weise sehr<br />
wirkungsvoll vorbereitet. Wenn in den zitierten Versen der 8. Strohe<br />
<strong>von</strong> dem »Zeichen« gesprochen ward, das der »große Geist«<br />
ntfaltete, so erfährt dieser Gedankengang in den folgenden Vern<br />
noch eine bedeutsame Erweiterung. Denn dieses Zeichen -<br />
ölderlin nennt es jetzt noch genauer »Das Liebeszeichen«: Zei-<br />
177
chen des Bündnisses zwischen den »heiligen Mächten« (100 f.) -<br />
dieses Zeichen wird nun in aller Form i den t i f i z i e r t mit dem<br />
jetzt zu feiernden Fest, dem »Festtag« (102). Es ist dieser Festtag<br />
als solcher, der die eigentliche Verwirklichung des Wunders zustandebringt,<br />
die »Allversammlung« der »Himmlischen« und ihre<br />
Einkehr bei den Menschen, denen sie nun sichtbar erscheinen.<br />
Damit sind wir auch im zweiten Wirkungsbereich des Dionysos:<br />
er ist der Gott solcher Feste, Symposien, Göttermahle katexochen.<br />
Dadurch aber, dass jetzt die Bedeutung des Festtags eine unendliche<br />
Steigerung erfährt, wird auch Dionysos nur um so dringlicher<br />
beschworen; mit um so größerer Notwendigkeit ist er der Fürst<br />
gerade dieses Festes. Überdies war die Herbeiführung dieses Festes<br />
ja recht eigentlich sein »Werk«. Denn die »Tage der Unschuld«,<br />
die er heraufführte - da<strong>von</strong> berichtete die 3. Strophe - sie eben<br />
brachten ja »heute das Fest«.<br />
Betrachten wir nunmehr mit dem Schluß der 8. die 9. Strophe,<br />
die den feierlichen Hergang am »Festtag«, beim »Gastmahl« schildert:<br />
178<br />
VIII Zuletzt ist aber doch, ihr heiligen Mächte, für euch<br />
Das Liebeszeichen, das Zeugniß<br />
Dass ihrs noch seiet, der Festtag,<br />
IX Der Allversammelnde, wo Himmlische <strong>nicht</strong><br />
Im Wunder offenbar, noch ungesehn im Wetter,<br />
Wo aber bei Gesang gastfreundlich untereinander 105<br />
In Chören gegenwärtig, eine heilige Zahl<br />
Die Seeligen in jeglicher Weise<br />
Beisammen sind, und ihr Geliebtestes auch,<br />
An dem sie hängen, <strong>nicht</strong> fehlt; denn darum rief ich<br />
Zum Gastmahl, das bereitet ist, 110<br />
Dich, Unvergeßlicher, dich, zum Abend der Zeit,<br />
o Jüngling, dich zum Fürsten des Festes; und eher legt<br />
Sich schlafen unser Geschlecht <strong>nicht</strong>,<br />
Bis ihr Verheißenen all,<br />
All ihr Unsterblichen, uns 115<br />
Von <strong>eure</strong>m Himmel zu sagen,<br />
Da seid in unserem Hauße.<br />
100<br />
In den <strong>von</strong> uns kursiv gedruckten Versen tritt aufs neue, nun in<br />
großartiger Steigerung, das Motiv <strong>von</strong> der welterneuernden Dichtung<br />
auf. Was in der Formulierung zunächst dunkel erscheinen<br />
kann, klärt sich, wenn man die entsprechenden Sätze des Prosaentwurfs<br />
zum Vergleich heranzieht. Sie lauten: 74<br />
Ein Chor nun sind wir. Drum soll alles Himmlische was genannt war, eine<br />
Zahl, geschlossen, heilig, ausgehen rein aus unserem Munde. Denn sieh! es ist<br />
der Abend der Zeit, die Stunde wo die Wanderer lenken zu der Ruhstatt. Es<br />
kehrt bald Ein Gott um den anderen ein ...<br />
Hier wird es deutlich: es ist der Gesang des Menschen, nämlich<br />
der Dichter, der die Götter beschwört und ihre Einkehr herbeiruft.<br />
Der endgültige Wortlaut der FRIEDENSFEIER zeigt den des Vorentwurfs<br />
in souveräner Weise umgestaltet. Es ist vor allem berücksichtigt,<br />
dass die Götter selbst »gegenwärtig« sind, ihre Einkehr effektiv<br />
stattfindet. Die Feier selbst bedeutet den Beginn dieser Einkehr.<br />
Hier sind nun Götter und Menschen zu gemeinsamem »Gesang«<br />
vereinigt - doch sind Ziel und Aufgaben des Gesangs unverkennbar<br />
die gleichen wie im Entwurf: die Himmlischen »sagen« nunmehr<br />
in »Chören gegenwärtig« <strong>von</strong> »ihrem Himmel« (115 f.). Bildlich,<br />
mythisch ist damit genau so <strong>von</strong> der Mission der Dichtung<br />
gesprochen. Nur vermeidet der Dichter jetzt, <strong>von</strong> den Menschen<br />
und »unserem Munde« zu sprechen. Sein ausgeprägtes Gefühl für<br />
Pietät, für Schicklichkeit in religiösen Dingen gebot es ihm, bei solcher<br />
Zusammenkunft <strong>von</strong> Unsterblichen und Sterblichen des Menschen<br />
möglichst wenig zu gedenken. Auf die Anwesenheit und<br />
tätige Mitwirkung des Menschen deuten einzig die Worte, dass<br />
die Himmlischen »bei Gesang« gegenwärtig seien. In dieser absichtlich<br />
zurückhaltenden Formel darf, ja muß der Mensch als einbegriffen<br />
gelten.<br />
Wie die 9. Strophe der FRIEDENSFEIER und der Entwurf das Wesen<br />
der Dichtung <strong>von</strong> zwei verschiedenen Seiten her betrachten, einmal<br />
mehr die Aktivität des Menschen, des Dichters, das andere<br />
74 StA II 699.<br />
179
Mal mehr die der inspirierenden Götter in den Vordergrund rükken,<br />
das hat in einem früheren Gedicht Hölderlins eine aufschlußreiche<br />
Parallele. Die Ode ERMUNTERUNG kündet in der 4. Strophe<br />
zunächst da<strong>von</strong>, dass »bald aus der Menschen Munde der Götter<br />
Lob sich neu verkünde«. Dann aber heißt es in der Schlußstrophe:<br />
»der Gott, der Geist, nenne sich (selbst) mit Namen«, und zwarder<br />
Zusatz ist bezeichnend -: »im Menschenwort«!<br />
Letzlich ist zweifellos in der FRIEDENSFEIER der Gesang genau in<br />
dem gleichen Sinne »der Götter und Menschen« gemeinsames<br />
»Werk«, wie es in der Hymne WIE WENN AM FEIERTAGE so eindrucksvoll<br />
geschildert wird. Beda Allemann wies mit Recht auf diese Entsprechung<br />
hin.1 5 Hier aber dürfen wir uns daran erinnern, dass<br />
gerade diese <strong>von</strong> uns weiter oben zitierte Partie aus WIE WENN AM<br />
FEIERTAGE in engster Beziehung zu Dionysos stand. In jenen Versen<br />
vergleicht Hölderlin ja die dichterische Empfängnis mit der Geburt<br />
des Gottes, des »heiligen Bacchus«. Der Semele-Mythos bildete<br />
den Hintergrund. Es zeigt sich immer wieder, dass die letzten<br />
und höchsten Gedanken über das Wesen der Dichtung bei Hölderlin<br />
unauflöslich verbunden sind mit seinen Vorstellungen <strong>von</strong> Dionysos.<br />
In diesem Sinne dürfen wir auch in der FRIEDENSFEIER sehr bedeutungsvolle<br />
Einzelheiten verstehen. Wenn die 9. Strophe geheimnisvoll<br />
vom »Gastmahl, das bereitet ist«, singt, so knüpft das an<br />
die 3. Strophe an, wo das »Werk« des Gottes als »längst vorbereitend«<br />
bezeichnet wurde. Ebenso: wenn die Götter in der 9. Strophe<br />
mit den Worten »<strong>Ihr</strong> Verheißene« angeredet werden, so steht<br />
das in Korrespondenz mit der auf den Fürsten des Fests bezüglichen<br />
Wendung »<strong>nicht</strong> unverkündet ist er« in der 3. Strophe: Dichter<br />
und Weise - Hölderlin deutet hier vor allem auf sich selbst -<br />
haben längst das Erscheinen der Götter verkündet, und zwar aller<br />
Götter, <strong>nicht</strong> nur das des Dionysos. Dass mit dem »Werk« des Fürsten<br />
des Fests sich ein Friede <strong>von</strong> säkularer Bedeutung vorbereitet<br />
habe, wird ebendort in der 3. Strophe mit der seltsamen Wendung<br />
ausgedrückt, dass »Friedenslaute« jetzt das tausendjährige Wetter<br />
75 Beda Allemann, Hälderlins Friedens/eier. Pfullingen 1955. S. 95.<br />
180<br />
»übertönen«. Auch diese Formulierung deutet - wie uns jetzt durch<br />
die 9. Strophe begreiflich wird - in ihrer Eigenart auf die Rolle,<br />
welche die erneuernde Dichtung spielt.<br />
Zu beachten ist ferner: der Augenblick, an dem die Himmlischen<br />
einkehren und der neue Gesang beginnt, wird in der 9. Strophe<br />
bezeichnet als der »Abend der Zeit«. Nicht zu übersehen ist<br />
die Korrespondenz dieser Zeitbestimmung mit derjenigen, die sich<br />
zu Beginn der vorhergehenden Strophe findet: »<strong>von</strong> Morgen an«<br />
sind Götter und Menschen »ein Gespräch«. In der Zeit <strong>von</strong> »Morgen«<br />
bis »Abend« also vollzieht sich die Umwandlung des »Gesprächs«<br />
zum »Gesang«, an deren Ende die dichterische Neugeburt<br />
steht. Es scheint auch hier geboten, an die Richtung zu denken,<br />
die nach den Worten der 3. Strophe der Zug des Fürsten des Fests<br />
nahm: »<strong>von</strong> Morgen nach Abend«. Wir sahen, wie dies in Zusammenhang<br />
stand mit Hölderlins Vorstellungen <strong>von</strong> den Zügen des<br />
Dionysos als Sinnbild für den Weg des <strong>von</strong> Osten kommenden dichterischen<br />
Worts. Nun läßt sich <strong>von</strong> dem, was Hölderlin hier im<br />
Blick hat, tatsächlich sowohl geographisch wie zeitlich-historisch<br />
betrachtet sagen, dass es »<strong>von</strong> Morgen nach Abend« gehe. So besteht<br />
eine innere Korrespondenz zwischen der geographisch n<br />
Angabe Morgen - Abend in der 3. Strophe und derjenigen in d r<br />
8., die sicherlich empfunden werden soll bei diesem Dichter, d r<br />
geheime Bezüge und gelegentlich auch Mehrdeutigkeiten schätzte<br />
und gern als Kunstmittel verwendete.<br />
Endlich noch eine Korrespondenz zwischen der 9. Strophe und<br />
dem Anfang des Gedichts. Wir sahen, dass jenes der Antike abg<br />
sehene Motiv des Müdigkeit, Schlaf bringenden Dionysos in der 2.<br />
und 3. Strophe besonders charakteristisch den Fürsten des Fests<br />
bezeichnete. Es darf als einer der erstaunlichsten Züge in der Fm;<br />
DENSFEIER bezeichnet werden, wie gerade dieses Motiv in den letzten<br />
fünf Versen der 9. Strophe zu monumentaler Steigerung g -<br />
führt wird. Hier ist es die Einkehr der Himmlischen, die d r<br />
Menschheit den Schlaf bringt - wobei nun Schlaf sinnbildlich b -<br />
zeichnet den beruhigten und durch die Dichtung göttlich gewei hten<br />
Friedenszustand einer aurea aetas. Wie aber der Fürst des Fests<br />
»zur Abendstunde« (v. 11) Müdigkeit verbreitend auftrat, so wer-<br />
181
einem Gesang, der ebenfalls <strong>von</strong> dem Heraufdämmern eines neuen<br />
Weltzeitalters kündet, ähnliches aussprach:<br />
Der an dem Baum des Heiles hing warf ab<br />
Die blässe blasser seelen· dem Zerstückten<br />
Im glut-rausch gleich ..<br />
Es ist heute bekannt, dass diese gleichfalls geheimnisvollen Verse<br />
Stefan Georges 77 durch Hölderlins Spätdichtung, übrigens auch<br />
durch Euripides' BAKcHEN mit inspiriert wurden. Sicherlich muß<br />
die Übereinstimmung zweier solcher Dichter vieles zu denken geben:<br />
scheinen sie doch ihr prophetisches Wort einander zuzuwerfen<br />
wie die Nornen an der Weltesche ihr schicksalwebendes Seil.<br />
77 In der Schlußstrophe <strong>von</strong> DER KRIEG (Stefan George, DAS NEUE REICH. Gesamt-Ausgabe<br />
der Werke. Endgültige Fassung. 18 Bde. Berlin: Georg Bondi. 1927-1934. Bd.<br />
9. S. 34).<br />
184<br />
Traditionsbezüge als Geheimschicht<br />
in Hölderlins Lyrik<br />
Zu den Gedichten: DIE WEISHEIT DES TRAURERS,<br />
DER WANDERER, FRIEDENSFEIER, BROD UND WEIN<br />
;<br />
Wenn"-man Hölderlins Verhältnis zur Tradition betrachtet, so wird<br />
zunächst mit Bezirken des echten Geheimnisses zu rechnen sein.<br />
Wie will man es etwa erklären, dass seine Sprache dem Griechischen<br />
auf so rätselhafte Weise nahekommt, auch da, wo er mißversteht,<br />
wie bei seiner Nachahmung griechischer Chorlyrik, oder<br />
wo ihm unbegreifliche Fehler unterlaufen, wie so oft in seinen<br />
Übersetzungen? Oder wie soll man jenes andere Phänomen erklären:<br />
wenn Hölderlin dasselbe tut, was <strong>von</strong> jeher, seit den Tagen<br />
Roms, Dichter zu tun liebten, wenn er griechische Namen verwendet<br />
- mythologische oder geographische -, um seinen Gesang mit<br />
echthellenischen Elementen zu schmücken, dann bleibt wohl<br />
kaum ein andrer so frei <strong>von</strong> dem Vorwurf wie er, dass dabei doch<br />
etwas wie Gelehrtendichtung herauskommt. Alles trägt bei ihm<br />
das Gepräge des Ursprünglichen. Es ließe sich allenfalls sagen:<br />
Hölderlins Spracherlebrris kommt offenbar dem der Griechen besonders<br />
nahe. Aber das ist mehr eine Feststellung als eine Erklärung.<br />
Denn gerade das Spracherlebnis, das den Kern aller Kunstdichtung<br />
bildet, ist-ja wiederum etwas Geheimnisvolles, etwas, das<br />
sich wissenschaftlicher Begründung beinahe gänzlich entzieht.<br />
Zudem steht das Spracherlebnis bei Hölderlin mit dem Erleben<br />
dessen, was er selbst etwa als die »gegenwärtige Gottheit« bezeichnen<br />
würde, in einem Zusammenhang, der wiederum undurchdringlich<br />
geheimnisvoll ist.<br />
Andere Bereiche aber si1).d erforschbar. Hölderlin liebte es, auf<br />
Sage, Dichtung, Geschichte anzuspielen - <strong>nicht</strong> nur der Antike -,<br />
und er setzt dabei voraus, verstanden zu werden, auch wenn es<br />
bei knappsten Andeutungen blieb. Für uns, denen das zu Ende<br />
185
des 18. Jahrhunderts die Geister beherrschende Bildungsgut kein<br />
selbstverständlicher Besitz mehr ist, blieb hier, auch heute noch,<br />
manches geheim, weil unser Wissen <strong>nicht</strong> mehr zureicht. Wir sind<br />
genötigt, nachzuforschen, Traditionsbezüge aufzuzeigen, damit<br />
wir das ursprünglich vom Dichter Gemeinte besser verstehen lernen.<br />
1.<br />
Es sei dies an einigen Beispielen verdeutlicht. Das erste stammt<br />
aus der Jugenddichtung Hölderlins, aus früher Tübinger Zeit. Es<br />
handelt sich um die Ode DIE WEISHEIT DES TRAURERS. Das Gedicht<br />
ist handschriftlich datiert: 1789. Seitens der Forschung ist die Vermutung<br />
ausgesprochen worden, DIE WEISHEIT DES TRAURERS stehe in<br />
Zusammenhang mit der Karzerstrafe, die Hölderlin im Herbst<br />
1789 verbüßen mußte, was für ihn zu einer ersten Krisensituation<br />
am Tübinger Stift führte. Er dachte damals an Austritt aus dem<br />
Stift, und sein Zorn richtete sich vor allem gegen den Herzog Karl<br />
Eugen <strong>von</strong> Württemberg, durch dessen verschärfte Strafbestimmungen<br />
jene Karzerstrafe verursacht worden war. Diese Deutung<br />
- sie stammt <strong>von</strong> Siegmund Schultze 1 - ist auch angezweifelt worden.<br />
Sie läßt sich aber bestätigen durch Beobachtungen, <strong>von</strong> denen<br />
nun zu sprechen sein wird. Es finden sich nämlich in dem<br />
Gedicht Anspielungen, die, wenn man sie ihrem Traditionsbezug<br />
nach richtig versteht, in außerordentlich krasser und unbezweifelbarer<br />
Weise auf das Despotenturn des Herzogs Karl Eugen deuten.<br />
Zunächst seien daraufhin die Einleitungsstrophen betrachtet:<br />
Hinweg, ihr Wünsche! Quäler des Unverstands!<br />
Hinweg <strong>von</strong> dieser Stätte Vergänglichkeit!<br />
Ernst, wie das Grab, sei meine Seele!<br />
Heilig mein Sang, wie die Todtenglocke!<br />
1 Friedrich Siegmund-Schultze, Der junge Hölderlin . Breslau 1939. (Sprache und Kultur<br />
der germanischen und romanischen Völker. B. Germanistische Reihe. Bd. 32)<br />
5. 109.<br />
186<br />
Du, stille Weisheit! öfne dein Heiligtum.<br />
Laß, wie den Greis am Grabe Cecilias<br />
Mich lauschen deinen Göttersprüchen,<br />
Ehe der Todten Gericht sie donnert.<br />
Da unbestochne Richterin richtest du<br />
Tirannenfeste, wo sich der Höflinge<br />
Entmanntes Heer zu Trug begeistert,<br />
Wo des geschändeten Römers Kehle<br />
Die schweiserrungne Haabe des Pflügers stiehlt,<br />
Wo tolle Lust in güldnen Pokalen schäumt,<br />
Und hat des Gräuels! an getürmten<br />
Silbergefäßen des Landes Mark klebt.<br />
Halt ein! Tyrann! Es fähret des Würgers Pfeil<br />
Daher. Halt ein! es nahet der Rache Tag ...<br />
Was bedeuten diese Verse, in denen man doch recht schwer einen<br />
Zusammenhang, überhaupt auch nur eine logische Folge sehen<br />
kann? Der Dichter lauscht der Stimme der Weisheit am Grabe einer<br />
Frau, die er Cäcilia nennt. Weiter ist da<strong>von</strong> die Rede, dass die<br />
Weisheit als unbestochne Richterin »Tyrannenfeste« verdammt, bei<br />
denen aus güldnen Pokalen und geraubten Silbergefäßen getrunken<br />
wird. Diejenigen, die solche Feste, offenbar angesichts des Grabes,<br />
feiern, werden aber »Römer« genannt, »geschändete Römer«.<br />
Der Tadel zielt darauf, dass diese Römer das Land ausgeraubt,<br />
dass sie den Bauern bestohlen haben etc. Für all das fehlt uns jedwede<br />
Erklärung. Darum aber ist das Gedicht schwer verständlich.<br />
Natürlich ist vor allem zu fragen: wer könnte jene Cäcilia sein,<br />
um deren Grab es sich hier handelt? Eine Möglichkeit der Deutung<br />
scheint sich zunächst aus den Handschriften zu ergeben. Ursprünglich<br />
stand nämlich da <strong>nicht</strong> der Name »Cecilia, sondern<br />
»Narzissa«. Mit diesem Namen ließ sich scheinbar eher etwas anfangen.<br />
Friedrich Beißners Kommentar gibt hierüber wertvolle<br />
Auskünfte 2 • Mit jener Narzissa ist gedeutet auf die Schwiegertoch-<br />
2 tA 1402 f.<br />
187
lungen auf die römische Geschichte leicht durchschaubar. Sie waren<br />
so leicht verständlich, dass Hölderlin als Student des Tübinger<br />
Stifts sicherlich besorgt sein mußte, Unannehmlichkeiten zu<br />
bekommen, falls diese seine Verse in unrechte Hände gerieten. So<br />
mag er aus Vorsicht, ganz einfach zu Zwecken der Tarnung, ein<br />
anderes Motiv, die Reminiszens an Youngs NACHTGEDANKEN, mit der<br />
Sulla-Episode verknüpft haben. Er stellte den Namen "Narzissa"<br />
voran - der war unverfänglich. Es wurde so eine gefährliche Überdeutlichkeit<br />
vermieden. Nachdem Hölderlin sich entschlossen hatte,<br />
die verschleiernde Überlagerung der Motive auch in der Endfassung<br />
zu belassen, konnte er es wagen, den Namen »Narzissa«<br />
mit dem der »Cecilia« zu vertauschen - Plutarchs Cäcilia Metalla<br />
war natürlich die Gestalt, auf die es ihm <strong>von</strong> vornherein wesentlich<br />
ankam.<br />
Tarnungen dieser Art sind in Zeiten der Despotie <strong>nicht</strong>s Seltenes.<br />
Als Beispiel sei angeführt: als ein jüdischer Dichter kurz vor<br />
dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland emigrieren mußte, ließ<br />
er in Freundeskreisen Abschriften eines Gedichts zirkulieren. Das<br />
Gedicht enthielt sein Abschiedswort an Deutschland - nämlich den<br />
Fluch auf das Land, das er geliebt hatte, und das nun einem verbrecherischen<br />
Despoten sklavisch huldigte. Dies Gedicht, das eigentlich<br />
Der Fluch betitelt war, trug aber in jenen zirkulierenden<br />
Kopien die Überschrift: An den Mond. Das war eine notwendige<br />
Tarnung, um gegebenenfalls die Aufmerksamkeit der Gestapo abzulenken.<br />
DIE WEISHEIT DES TRAURERS enthält noch an anderer Stelle eine<br />
Textänderung hinsichtlich eines Namens. Eine frühere Fassung der<br />
Verse 30-32 spricht <strong>von</strong> einer Elisa. Diesen Namen ließ Hölderlin<br />
jedoch später überhaupt weg. Auch hierfür dürfte den Anlaß gegeben<br />
haben die nämliche Sorge: dass man seinem Gedicht allzuleicht<br />
die Polemik gegen das despotische Regime Karl Eugens ansehen<br />
könnte. Mit jener Elisa war nämlich offenkundig die<br />
berühmte Heloisa gemeint, die Freundin des Scholastikers Abälard.<br />
Betrachten wir die Strophen 6-10 des Gedichtes genauer, so erweist<br />
es sich, dass die Einzelheiten sämtlich auf Ereignisse aus der<br />
190<br />
tragischen Lebens- und Leidensgeschichte Abälards anspielen.<br />
Dem Theologen Hölderlin war notwendig die Selbstbiographie<br />
Abälards bekannt wie auch der berühmte Briefwechsel zwischen<br />
Abälard und Heloisa. Seit der ersten Ausgabe <strong>von</strong> Abälards Werken<br />
(1616) war auch sein Leben wiederholt beschrieben worden.<br />
1787 veröffentlichte Joseph Berington in England eine umfangreiche<br />
Biographie, welcher der Briefwechsel Abälard-Heloisa beigefügt<br />
war. Das Buch erschien 1789 auch in deutscher Übersetzung 3 .<br />
Hier<strong>von</strong> mag noch eine aktuelle Anregung ausgegangen sein: Hölderlin<br />
schrieb ja DIE WEISHEIT DES TRAURERS 1789, wie man annehmen<br />
darf, im Spätherbst. Die auf Abälard bezügliche Partie - innerhalb<br />
derer früher der Name Elisa genannt ward - lautet:<br />
... In licht're Hallen, gute Göttin! -<br />
Wandle der Sturm sich in Haingeflüster!<br />
Da schlingst du liebevoll um die Jammernde<br />
Am Grabe des Erwälten den Mutterarm,<br />
Vor Menschentrost dein Kind zu schüzen,<br />
Schenkest ihr Tränen, und lispelst leise<br />
Vom Wiederseh'n vom seeligen Einst ins Herz<br />
Da schläft in deiner Halle der Jammermann<br />
Dem Priesterhaß das Herz zerfleischet,<br />
Den ihr Gericht im Gewahrsam foltert,<br />
Der blaiche Jüngling, der in des Herzens Durst<br />
Nach Ehre rastlos klomm auf der Felsenbahn<br />
Und ach umsonst! wie wandelt er so<br />
Ruhig umher in der stillen Halle.<br />
Mit Brudersinn zu heitern den Kummerblik<br />
Der Kleinen Herz zu leiten am Gängelband,<br />
Sein Haus zu bau'n, sein Feld zu pflügen<br />
Wird ihm Beruf! und die Wünsche schweigen.<br />
3 Joseph Berington, The History of the Lives of Abeillard and Heloisa [ .. . ] with their genuine<br />
letters. Birmingham 1787. - Geschichte Abälards und der Heloise nebst beider ächter<br />
Briefe nach des d' Amboise Ausgabe aus dem Englischen des Herrn Joseph Berington.<br />
Übersetzt <strong>von</strong> D. Samuel Hahnemann. Leipzig 1789.<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
191
Die am Grabe der Erwählten Jammernde wird <strong>von</strong> Hölderlin - in<br />
jener sogleich zu besprechenden Variante - als »Elisa« bezeichnet.<br />
Hieraus wie auch aus dem Gesamtzusammenhang erhellt, dass<br />
die um Abälard klagende Heloisa gemeint ist. Abälards Leichnam<br />
wurde bald nach seinem Tode auf Heloisas Wunsch in ihr Kloster<br />
Paraklet überführt und dort begraben. (Paraklet war eine Gründung<br />
Abälards, Heloisa lebte später dort als Priorin mit ihren Nonnen.)<br />
Die Verse 29 ff., die in der Endfassung <strong>von</strong> dem »Jammermann«,<br />
d.i. Abälard, sprechen, handeln im Entwurf noch weiter<br />
<strong>von</strong> der am Grabe Klagenden und lauteten dort: 4<br />
Wie in den Schlaf die Mutter den Säugling singt<br />
Vom Wiedersehn, vom seeligen Einst ins Herz,<br />
Bis ihr gestärktes Herz geneset,<br />
Und ihr geläuterter Geist sich aufraft.<br />
Die letzten drei Verse wollte Hölderlin ursprünglich ersetzen<br />
durch jenen Passus, der den Namen Heloisas auch wirklich nennt<br />
- angeredet ist, wie auch im vorigen, die Weisheit -:<br />
o Dank, du Gute! weinender heißer Dank!<br />
Genesen ist Elisas Seele!<br />
Ach! wie entsta [bricht ab.]<br />
Die Namenform Elisa entstand aus der früher <strong>nicht</strong> selten begegnenden<br />
Schreibung: Eloisa oder Eloise 5 • Gehen wir nun die ganze<br />
auf Abälard und Heloisa bezügliche Partie des Gedichtes durch,<br />
so lassen sich die Motive eins um das andere ihren historischen<br />
Bezügen nach erklären.<br />
Der Zug, dass Heloisa durch die Weisheit geschützt und getröstet<br />
wird, findet in ihrer Gesamtpersönlichkeit seine Entsprechung.<br />
Heloisa war die gelehrteste Frau ihrer Zeit und wurde als<br />
solche anerkannt. Als" prudens Heloisa" wurde sie noch in einer<br />
4 StA I 400, Z. 17-26.<br />
5 V gl. Alexander Pope: Eloisa 10 Abelard. So auch in dem 1787 zu Straßburg erschienenen<br />
Bel. 2 der deu tschen Übersetzung der Werke Popes (<strong>von</strong> Jos. Jak. Dusch): Eloise<br />
an den Abälard. Herder in der AORASTEA (kritisch über Pope und Berington): Eloise.<br />
192<br />
Grabinschrift bezeichnet 6 • Sie beherrschte die antiken Sprachen,<br />
kannte die Dichter, die Philosophen Griechenlands und Roms, die<br />
sie vielfach zitiere. <strong>Ihr</strong> eignete aber auch ein spezielles Verhältnis<br />
zur Weisheit, sie galt als deren "Jüngerin" (Petrus Venerabilis an<br />
Heloisa). Besonders eindrücklich manifestiert sich dies Verhältnis<br />
durch den Vorgang, dass Heloisa unter Berufung auf Philosophie<br />
und Weisheit (sapientia), hinweisend auf deren größte Vertreter<br />
<strong>von</strong> Pythagoras ab, den Abälard belehrte: er müsse um seiner Aufgabe<br />
willen ehelos bleiben, dürfe sie <strong>nicht</strong> heiraten. Hier<strong>von</strong> handelt<br />
ein ausführlicher Abschnitt in Abälards Autobiographie, der<br />
HISTORIA CALAMITATUM. Die Weisheit tröstet Heloisa besser als die<br />
Menschen - darin mag noch eine Anspielung auf den Namen Paraklet<br />
liegen, den Abälard seiner Klostergründung gab. Die bekannten<br />
Stellen vom "anderen Tröster" (Paraklet) im Johannes<br />
Evangelium schweben vor - es ist der "Geist der Wahrheit,<br />
welchen die Welt <strong>nicht</strong> kann empfangen". (Johannes 14, 17.) Was<br />
das Motiv der Klage am Grabe Abälards und des Traums vom Jenseits,<br />
vom »seeligen Einst« betrifft, so sei Berington angeführt:<br />
"Wer Einbildungskraft besitzt, kann sich nun Heloisen [bei der<br />
Bestattung Abälardsl selbst mahlen mit den feinsten Zügen des<br />
gelassenen Grams, ihre Augen gen Himmel gerichtet, oft aber nach<br />
Abeillarden hingewandt, und auf den Gegenstand ds Jammers geheftet."<br />
(430) "Sie hieng über Abeillards Grabe, und war nur mit<br />
Mühe <strong>von</strong> dannen zu bri'ngen." (432) "Die ein und zwanzig Jahre<br />
hindurch, die sie noch zu leben hatte, hören wir <strong>nicht</strong>s mehr <strong>von</strong><br />
ihr, außer dass sie [ ... 1 mit Beibehaltung der zärtlichsten Zuneigung<br />
einer Frau, unablässig am Grabe ihres Mannes betete. Sicherlich<br />
ist wenigstens etwas menschliches in der Lehre, welche uns<br />
lehrt, eine Gemeinschaft mit der andern Welt zu unterhalten, und<br />
zu glauben, dass Freundschaft auch jenseits des Grabes dienlich<br />
sey!" (436)<br />
6 Berington (1789) S. 498.<br />
7 Berington (1789) 5. 498: "Der gelehrten Kenntnisse Heloisens eingedenk zu bleiben,<br />
sagt man, sollen viele Jahre nach ihrem Tode die Nonnen des Paraklets zu<br />
Pfingsten den Gottesdienst griechisch gehalten haben."<br />
193
In der Schilderung des Betrauerten Toten, DIE WEISHEIT DES TRAU<br />
RERS v. 30 ff., steht am Anfang die Kennzeichnung dessen, was dem<br />
gesamten Leben Abälards sein Gepräge gab: der Verfolgung durch<br />
»Priesterhaß«. Das Wort »zerfleischen« v. 31 könnte auch an die<br />
Entmannung durch Fulbert, den Kanonikus <strong>von</strong> Notre-Dame zu<br />
Paris, den Oheim Heloisas denken lassen. Vers 32 (»Den ihr Gericht<br />
im Gewahrsam foltert«) hat zum Hintergrund die vielfachen<br />
Verurteilungen durch inquisitorische Kirchenversammlungen, Synoden,<br />
Konzile, wo Abälard als Häretiker angesehen und ihm<br />
schwere Haftstrafen, Schriftenverbrennung u.dgl. zudiktiert wurden.<br />
Ursprünglich lautete v. 32: »Den der Despot im Gewahrsam<br />
foltert«. Siegmund-Schultze schloß namentlich aus diesem Wort<br />
»Despot« auf eine Polemik gegen Karl Eugen - <strong>nicht</strong> zu Unrecht,<br />
wie sich jetzt zeigt. Despotengestalten begegnen in der Vita Abälards<br />
vielfach, u.a. der Abt <strong>von</strong> st. Denis, der Prior Gosvin, vor<br />
allem auch jener gewalttätige Landesfürst, der das Kloster St. Gildas<br />
in Ruys tyrannisierte - eine Gestalt, die an solche Züge erinnern<br />
konnte, wie Hölderlin sie damals an Karl Eugen zu bemängeln<br />
fand. Vgl. HISTORIA CALAMITATUM: "Ipsam etiam abbatiam<br />
tirannus quidam in terra illa potentissimus jam diu sibi subjugaverat<br />
[ ... ] me tyrannus ille et satellites sui assidue opprimebant."8<br />
Das Motiv vom Ehrgeiz bei dem »bleichen Jüngling«, das in<br />
den nächsten Versen erscheint (v. 33 ff.), hat seine Entsprechung<br />
in den frühsten Lebensabschnitten Abälards. Die HISTORIA CALAMI<br />
TATUM schildert die schnell zu unglaublichen Erfolgen führende<br />
Laufbahn des jugendlich genialen Philosophie- und Theologielehrers,<br />
mit reuiger Selbstkritik: Abälard konnte sich bald für den<br />
"einzigen Philosophen in der Welt" halten - ("cum jam me solum<br />
in mundo superesse philosophum estimarem"); Gott aber habe ihn<br />
gedemütigt für solche superbia und sublimitas 9 • Dabei war Abälard<br />
körperlich zart. Er berichtet, wie Überarbeitung ihn gelegentlich<br />
zu längerer Unterbrechung seiner Tätigkeit zwang, bis zur<br />
Behebung seiner 'infirmitas'.<br />
8 Abelard, Historia calamitatum. Texte critique [ ... ] publie par J. Monfrin. Paris 1959.<br />
5.99.<br />
9 Ebd. 5. 70 f.<br />
194<br />
Wirklich war der so verheißungsvolle Beginn dann »umsonst«<br />
gewesen (v. 35) - nach dem schweren Schicksalsschlag, der ihn traf,<br />
gab Abälard sein Lehramt in Paris auf und zog sich ins Kloster<br />
zurück, wie überhaupt das Kloster nun immer mehr seine Zuflucht<br />
wurde, wenn neue Konzilssprüche ihn verdammten. Freilich blieb<br />
Abälard noch im Kloster ein Lehrender. Er hatte reichen Zustrom<br />
an Schülern. Später fielen ihm dann schwere Pflichten der Seelsorge<br />
zu - etwa als Abt <strong>von</strong> St. Gildas - inmitten <strong>von</strong> zuchtlosen,<br />
seelisch hilfsbedürftigen, aber schwer zu leitenden Mönchen. Darauf<br />
spielen die Verse 37 f. an:<br />
Mit Brudersinn zu heitern den Kummerblik<br />
Der Kleinen Herz zu leiten am Gängelband ...<br />
Die folgenden Verse erinnern an den größten Einschnitt im Leben<br />
Abälards: die Gründung der Einsiedelei ('solitudo'), die <strong>von</strong> ihm<br />
den Namen 'Paraklet' erhielt. Tatsächlich baute sich Abälard, zusammen<br />
mit einem befreundeten Kleriker, aus primitivstem Material<br />
('callis et culmo') ein 'oratorium' (v gl. auch v. 36: »in der stillen<br />
Halle«). Wieder fanden sich allerdings nach und nach junge<br />
Schüler bei ihm ein, die als 'Eremiten' mit ihm lebten und das taten,<br />
wozu er selbst zu schwach war: für ihre Gemeinschaft Häuser<br />
bauen und das Feld bestellen. "Scolares autem ultro mihi quelibet<br />
necessaria preparabant, tarn in victu scilicet quam in vestitu<br />
vel cultura agrorum seu in expensis edificiorum."lo All diese in<br />
der Selbstbiographie erzählten Einzelheiten spiegeln sich in den<br />
Versen, mit denen der Abälard-Teil des Gedichtes DIE WEISHEIT DES<br />
TRAURERS abschließt:<br />
Sein Haus zu bau'n, sein Feld zu pflügen<br />
Wird ihm Beruf! und die Wünsche schweigen.<br />
Dass der junge Hölderlin sich einmal so intensiv in die Persönlichkeit<br />
Abälards hineingedacht hat, ist leicht genug zu erklären.<br />
Parallelen mit seinem eigenen Leben fanden sich viele: der Ehr-<br />
10 Ebd .5.94.<br />
195
geiz - oft behandeltes Motiv in seiner Jugendlyrik; ebenso ein Streben<br />
nach Stille, Ruhe, Einsamkeit (nach der »stillen Halle«). Das<br />
Interesse für Philosophie und Theologie zugleich - es ist charakteristisch<br />
für Hölderlin wie für viele Schüler des Tübinger Stifts.<br />
Denken wir ferner an die Situation, die für Abälards Leben in späteren<br />
Jahren bezeichnend ist: das Versetztwerden <strong>von</strong> Kloster zu<br />
Kloster, so hatte der junge Hölderlin - auf den Stationen Denkendorf,<br />
Maulbronn, Tübinger Stift - ähnliches erlebt: überall klosterartige<br />
Zustände; auch das Stift war ja für die Studierenden das<br />
'Kloster'. Sogar die Ehelosigkeit um der großen Aufgabe willen,<br />
die Abälard in seiner Autobiographie so eingehend motiviert, hat<br />
ihre Entsprechung. Hölderlin erhob solche Ehelosigkeit gerade in<br />
der damaligen Zeit zum Programm (verbunden mit dem Eingeständnis<br />
seines Ehrgeizes). Das bezeugt der Abschiedsbrief an<br />
Louise Nast <strong>von</strong> Frühjahr 1790, ferner das Schreiben an die Mutter<br />
<strong>von</strong> Juni 1791: "Bei Gelegenheit muß ich Ihnen sagen, dass ich<br />
seit Jar und Tagen fest im Sinne habe, nie zu freien [ ... ] Mein sonderbarer<br />
Karakter, meine Launen, mein Hang zu Projekten, u. (um<br />
nur recht die Warheit zu sagen) mein Ehrgeiz [ ... ] lassen mich<br />
<strong>nicht</strong> hoffen, daß ich im ruhigen Ehestande [ ... ] glücklich sein werde."<br />
Seit "Jahr und Tagen" - zurückschauend kommt man doch<br />
gerade in die Zeit, da DIE WEISHEIT DES TRAURERS geschrieben ward,<br />
folglich Beschäftigung mit Abälard angenommen werden kann.<br />
Endlich kam hinzu die als ungerecht empfundene Freiheitsstrafe<br />
und das Aufbegehren gegen das Regiment im Stift-'Kloster', gegen<br />
Karl Eugen. Hierfür bot das Leben Abälards die vielfältigsten<br />
Parallelen. So dient der Abälard-Abschnitt in der Weisheit des<br />
Traurers ebenso wie die Cäcilia-Episode, der oppositionellen Stimmung<br />
Ausdruck zu verleihen, die Hölderlin damals erfaßt hatte.<br />
Allerdings ließ er in diesem Falle schließlich doch vorsichtshalber<br />
die beiden Worte weg, die den revolutionären Charakter jener Strophen<br />
in allzu gefährlicher Weise verraten konnten: das Wort »Despot«<br />
und den Namen »Elisa«Y<br />
11 Herman Meyer in Amsterdam verdanke ich den Hinweis darauf, dass Hölderlin<br />
das seltene Wort »Iraurer« im Titel des besprochenen Gedichts vermutlich <strong>von</strong> Hölty<br />
196<br />
H.<br />
Im Hinblick auf die Bedeutung <strong>von</strong> Traditionsbezügen und deren<br />
oft seltsames Verborgenbleiben kann ein weiteres Beispiel <strong>von</strong> Interesse<br />
sein: die Elegie DER WANDERER, auf die wir einen kurzen<br />
Blick werfen wollen. Die drei Teile, die das Gedicht in seinen beiden<br />
Fassungen aufweist, schildern die Klimazonen der Erde: extreme<br />
Hitze in der »Afrikanischen Ebene«, extreme Kälte am »Eispol«,<br />
gemäßigte Zone in der »glücklichen Heimat«. Bekanntlich<br />
fand die Art und Weise, wie Hölderlin die beiden ersten Zonen<br />
"durch Negationen" charakterisiert, den harten Tadel Goethes.<br />
"Freylich ist die Afrikanische Wüste und der Nordpol weder durch<br />
sinnliches noch durch inneres Anschauen gemahlt, vielmehr sind<br />
sie beyde durch Negationen dargestellt, da sie denn <strong>nicht</strong>, wie die<br />
Absicht doch ist, mit dem hinteren deutsch-lieblichen Bilde genugsam<br />
contrastiren", so schreibt Goethe am 28. Juni 1797 an Schiller<br />
(WA IV 12, 171).<br />
Es ist verwunderlich, dass Goethe hier <strong>nicht</strong> bemerkte, was es<br />
mit diesen Negationen auf sich hatte. Gerade mit ihnen lehnt Hölderlin<br />
sich an die antike Tradition an. In der römischen Dichtung<br />
sind derartige Negationen <strong>nicht</strong>s Seltenes. Sie begegnen aber in<br />
ganz ungewöhnlicher Weise gehäuft in einer berühmten Elegie,<br />
welche Hölderlin offensichtlich die stoffliche Anregung gab für das<br />
Schildern der drei Zonen. Es ist der PANEGYRICUS MESSALLAE, das<br />
große Gedicht, das in der Sammlung <strong>von</strong> Tibulls ELEGIEN steht<br />
(IV 1), obwohl es nach heutiger Ansicht das Werk eines anderen,<br />
unbekannten Verfassers ist. In dieser Elegie werden v. 151 bis 174<br />
gleichfalls die drei Hauptklimazonen de Erde geschildert, in der<br />
Reihenfolge: Eiszone (151-57), Hitzezone (158-64), gemäßigte -<br />
»unsre« - Zone (165-74). Die Detailschilderung weist viele Übereinstimmungen<br />
mit Hölderlin auf; wie im WANDERER ist die Hitze-<br />
entlehnte und damit HÖltyschen Odengeist evozieren wollte. Wirklich bringt<br />
Grimms Wörterbuch aus neuerer Zeit nur einen Beleg <strong>von</strong> Hölty erosen schließen<br />
sich zu, nahet dein traurer sich. Ged. 92 Halm"). H. Meyer fand das Wort "Iraurer"<br />
noch ferner in Höltys Ode A N DIE GRILLE (1774).<br />
197
zone der versengte, ausgetrocknete Raum der Wüste, <strong>nicht</strong> etwa<br />
der tropische feuchte Urwald. Charakterisiert werden aber die<br />
Zonen der extremen Kälte und Hitze durch eine Kette <strong>von</strong> Negationen:<br />
keine Bäche, niemals Sonne, keine Bearbeitung durch<br />
den Pflug, <strong>nicht</strong> Feldfrucht, <strong>nicht</strong> Futter, kein Gott, der die Fluren<br />
betreut, <strong>nicht</strong> Bacchus, <strong>nicht</strong> Ceres, kein lebendes Wesen<br />
wohnt dort. Auf diese Weise finden sich innerhalb <strong>von</strong> insgesamt<br />
14 Versen neun Negationen. Die Schilderung der gemäßigten Zone<br />
reiht dagegen nur positiv gefaßte Aussagen aneinander. Unter<br />
letzteren finden sich wie bei Hölderlin die Erwähnung des Weinstocks,<br />
des Stiers, des Pflugs, der Mahd, der menschlichen Siedlungen.<br />
In den <strong>von</strong> Goethe bemängelten Negationen liegt also ein beabsichtigtes<br />
Antikisieren. Hölderlin tat <strong>nicht</strong>s anderes als Goethe<br />
selbst und die anderen Dichter, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts<br />
die Elegie erneuerten: er lehnte sich and die römischen Elegiker<br />
an. Den PANEGYRICUS MESSALLAE, der ihm thematisch-stoffliche<br />
Anregung gab, nahm Hölderlin auch im formalen zum Vorbild.<br />
Das führte ihn auf die Darstellung durch Negationen. Im Hinblick<br />
hierauf verdient erwähnt zu werden, dass der PANEGYRICUS MES<br />
SALLAE <strong>von</strong> diesem Stilmittel auch sonst reichlichen Gebrauch<br />
macht. In den dreißig Versen, die der Schilderung der Erdzonen<br />
unmittelbar vorausgehen (118-148), finden sich <strong>nicht</strong> weniger als<br />
11 Negationen. Mit Vorliebe werden im PANEGYRICUS MESSALLAE wie<br />
auch sonst, wo in der römischen Dichtung solche Negationsreihen<br />
vorkommen, die verneinenden Partikeln an den Versanfang gestellt.<br />
Auch darin schließt Hölderlin sich der antiken Tradition an.<br />
Nochmals: es bleibt rätselhaft, dass Goethe diesen Traditionszusammenhang<br />
<strong>nicht</strong> erkannte. War er doch gerade zur Zeit, als er<br />
Hölderlins DER WANDERER las, mit den römischen Elegikern durch<br />
vieles Studium bestens vertraut. Goethes Ausstellungen an Hölderlins<br />
Gedicht richten sich, ihm selbst unbewußt, gegen charakteristische<br />
Züge antiker Dichtung.<br />
Eine Übersetzung des PANEGYRICUS MESSALLAE hatte übrigens Joh.<br />
Heinr. Voß 1786 veröffentlicht; sie erschien nochmals im zweiten<br />
Band der Gedichte <strong>von</strong> Voß 1795 - bald darauf entstand Hölder-<br />
198<br />
lins DER WANDERER. Voß gab der Elegie den Titel: TIBULL AN MES<br />
SALLA - er nahm Tibull als Verfasser an. Wie sehr Hölderlin sich<br />
bei Abfassung <strong>von</strong> DER WANDERER in die Situation eines römischen<br />
Dichters hineindachte, wird auch dadurch bemerkbar, dass ihm<br />
bei dem dritten Teil des Gedichtes ursprünglich <strong>nicht</strong> die rheinische,<br />
sondern die römisch-italische Landschaft vorschwebte. »Ausonien<br />
kehr ich zurük in die freundliche Heimath« - so lautet der<br />
Anfang dieses Teils im Entwurf.<br />
III.<br />
Die weiter zu betrachtenden Beispiele stammen aus Hölderlins<br />
Spätdichtung. In der FRIEDENSFEIER stellt die 3. Strophe eins der<br />
kunstvollsten Gebilde Hölderlinschen Schaffens dar. Wiederum<br />
spielen dabei Traditionsbezüge eine wesentliche Rolle. 12<br />
Von heute aber <strong>nicht</strong>, <strong>nicht</strong> unverkündet ist er; 25<br />
Und einer, der <strong>nicht</strong> Fluth noch Flamme gescheuet,<br />
Erstaunet, da es stille worden, umsonst <strong>nicht</strong>, jezt,<br />
Da Herrschaft nirgend ist zu sehn bei Geistern und Menschen.<br />
Das ist, sie hören das Werk,<br />
Längst vorbereitend, <strong>von</strong> Morgen nach Abend, jezt erst, 30<br />
Denn unermeßlich braußt, in der TIefe verhallend,<br />
Des Donnerers Echo, qas tausendjährige Wetter,<br />
Zu schlafen, übertönt <strong>von</strong> Friedenslauten, hinunter.<br />
<strong>Ihr</strong> aber, theuergewordne, 0 ihr Tage der Unschuld,<br />
<strong>Ihr</strong> bringt auch heute das Fest, ihr Lieben! und es blüht 35<br />
Rings abendlich der Geist in dieser Stille;<br />
Und rathen muß ich, und wäre silbergrau<br />
Die Loke, 0 ihr Freunde!<br />
Für Kränze zu sorgen und Mahl, jezt ewigen Jünglingen ähnlich.<br />
Mit einer nur geringen Anzahl <strong>von</strong> Versen vermag der Dichter den<br />
rieden, der jetzt gefeiert werden soll, so erscheinen zu lassen, wie<br />
12 Die folgenden Betrachtungen ergänzen die Interpretation der 3. FRIEDENSFEIER-Strophe<br />
(oben S. 168 ff.) im vorausgehenden Kapitel Dionysos in der Dichtung Hölder<br />
/ins.<br />
199
er ihn sah: <strong>nicht</strong> als ein ephemeres politisches Ereignis, sondern<br />
als einen Wendepunkt <strong>von</strong> säkularer Bedeutung, als Zeichen für<br />
den Anbruch eines neuen Weltzeitalters. Um diese verklärende<br />
Deutung in aller Kürze geben zu können, bringt Hölderlin mehrere<br />
sehr wirksame Kunstmittel zur Anwendung.<br />
1. Bei der Charakterisierung des Friedens bedient er sich mythischer<br />
Sageweise. Er schildert ihn <strong>nicht</strong> direkt, sondern er berichtet<br />
<strong>von</strong> ihm als <strong>von</strong> dem »Werk« des Dionysos. In Dionysos<br />
sieht Hölderlin hier - nach antikem Vorbild - vor allem den Gott<br />
der Dichtung und den gesetzgebenden Eroberer. Wie auch in anderen<br />
Hölderlinschen Gedichten leitet der Gott in solcher Eigenschaft<br />
den Vorgang der Welterneuerung ein.<br />
2. Statuiert wird, dass alles, was die FRIEDENSFEIER in Anlehnung<br />
an den Mythos über den »Heldenzug« und die Ankunft des Gottes<br />
berichtet, längst Gegenstand <strong>von</strong> Prophezeiungen war. Auch<br />
dies trägt zur Verklärung des Friedensereignisses bei. Gerade hierdurch<br />
wird es aus der Sphäre des Ephemeren herausgenommen<br />
und in die des Wunderhaften gerückt. Das Ereignis ist »<strong>von</strong> heute<br />
[ ... ] <strong>nicht</strong>«, ist »<strong>nicht</strong> unverkündet« (v. 25). Verkündet ward es<br />
- so ist zu supplieren - <strong>von</strong> Dichtem und Weisen, wobei Hölderlin<br />
natürlich in erster Linie auf sich selbst deutet. Sein eigenes<br />
Dichten stellt ja in vielen und gerade den wichtigsten Partien solche<br />
Prophetie dar. In diesem Sinne spricht die Hymne ROUSSEAU<br />
vom »Vorausfliegen« des »kühnen Geistes«. Entwurfverse zu AM<br />
QUELL DER DONAU nennen Dichter, Propheten und Helden, die »zuerst«<br />
und »ganz allein« zu Gott reden, bevor ein »Frühlingsanfang«<br />
eintritt. Sehr deutlich drückt ein Distichon diesen Gedanken<br />
aus, das sich in der Vorstufe zur 3. Strophe <strong>von</strong> BROD UND WEIN<br />
findet:<br />
Vor der Zeit! ist Beruf der heiligen Sänger und also<br />
Dienen und wandeln sie großem Geschike voran. 13<br />
13 StA II 597 Z. 15 f. Bezeichnenderweise beginnt an dieser Stelle die 3. Strophe <strong>von</strong><br />
BROD UND WEIN auf das Dionysos-Thema überzugehen. »Frohlockender Wahnsinn«<br />
ergreift die "Sänger« - Aufforderung, in die Heimat des Dionysos zU ziehen (Theben,<br />
Kithairon) - Hinweis auf die Feldzüge des Dionysos (des »kommenden Got-<br />
200<br />
3. Besonders intensiv wirkt sich im gleichen verklärenden Sinne<br />
das Motiv aus: dass das Friedens-»Werk« des Gottes zu größtem<br />
»Staunen« Anlaß gibt (v. 27). Dies Staunen erfaßt alle diejenigen,<br />
die, unbekannt mit den Sprüchen der Propheten, bisher <strong>nicht</strong>s geahnt<br />
haben <strong>von</strong> dem Heldenzuge des Gottes und seinem »Werk«.<br />
Den Ohren der Ungeweihten ist dies »Werk« vernehmlich »jezt<br />
erst«, bei Eintritt der durch den Gott herbeigeführten Stille (v.<br />
27.30). Diesen Gedanken, der den größeren Teil der Strophe bestimmt,<br />
kennen wir auch sonst bei Hölderlin. Kunde <strong>von</strong> den Göttern<br />
und ihrem »Werk« erreicht nur wenige - nur solche, »die noch<br />
gefangen <strong>nicht</strong> /Vom Rohen sind«, wie es in PATMOS heißt (v. 185).<br />
Gerade in Zusammenhang mit den Erneuerungstaten des Weingotts<br />
begegnet uns dieses Motiv in BROD UND WEIN. Als der Weingott<br />
»die Spur der entflohenen Götter Götterlosen hinab unter das<br />
Finstere bringt« - letzte Strophe <strong>von</strong> BROD UND WEIN - heißt es ausdrücklich<br />
einschränkend: »Seelige Weise sehns«. Das bedeutet: nur<br />
die Weisen sehen es. In Der Rhein vermag der mit dem Weingott<br />
gleichgesetzte Rousseau mit seiner erneuernden Botschaft nur<br />
»den Guten« verständlich zu werden, während er »Die Achtungslosen<br />
mit Blindheit schlägt«. So Strophe 10 <strong>von</strong> DER RHEIN, wo alles<br />
in diesem Zusammenhang Gesagte das Wesen des prophetischen<br />
Dichters kennzeichnet, Rousseau nur ein anderer Name für<br />
Hölderlin ist, wie schon Hellingrath grundsätzlich feststellte. BROD<br />
UND WEIN betont mehrrhals den Unterschied zwischen den wenigen<br />
Weisen, den Dichtern und Propheten, und der vorerst noch<br />
blinden Menge. So v. 73 ff.: »die Himmlischen [ ... ] Unempfunden<br />
kommen sie erst, es streben entgegen Ihnen die Kinder [. .. ] kaum<br />
weiß zu sagen ein Halbgott [wie Rousseau-Dionysos], Wer mit<br />
Namen sie sind«. Bezeichnend sind die späten Varianten hierzu:<br />
»Darum siehet mit Augen / Kaum ein Halbgott; und ist Feuer um<br />
tes«). -Im Entwurf der FRIEDENSFEIER entspricht dem Gedanken des Vorherverkündetseins<br />
der Passus: ,>Zuvorbestimmt wars« (StA II 131). Auch in BROD UND WEIN<br />
heißt es <strong>von</strong> der »Einkehr der Himmlischen« in früherer Fassung: »so steiget in<br />
Nächten Vorbereitet herab unter die Menschen ihr Tag.« (StA II 600). Vgl. auch die<br />
späte Variante: ,>Lang und schwer ist das Wort <strong>von</strong> dieser Ankunft« (StA II 603).<br />
201
Des Göttlichen aber empfiengen wir<br />
Doch viel. Es ward die Flamm' uns<br />
In die Hände gegeben, und Ufer und Meersfluth.<br />
Viel mehr, denn menschlicher Weise<br />
Sind jene mit uns, die fremden Kräfte, vertrauet.<br />
Stehen etwa auch hier die Gedanken und Bilder jener Horazode<br />
im Hintergrund? Zunächst möchte man dies in Frage stellen, da<br />
eine Entsprechung zu dem »non timuit« fehlt und damit - wie es<br />
scheint - auch der Hybrisgedanke. Der Sieg über die Elemente ist<br />
vor allem göttliches Geschenk. Immerhin sind Flut und Flamme<br />
doch auch hier als 'fremde Kräfte' gekennzeichnet, und in der vorhergehenden<br />
Strophe ward <strong>von</strong> der Undankbarkeit der Menschen<br />
gegenüber Göttergeschenken gesprochen, was noch bis hierher<br />
hinüberwirkt. Sehr anders nimmt sich aber die Stelle im Entwurfsstadium<br />
aus.19 Da wird der Zusammenhang mit Horaz wieder<br />
vollkommen deutlich:<br />
Und menschlicher Wohlthat folget der Dank,<br />
Auf göttliche Gaabe aber jahrlang<br />
Die Mühe erst und das Irrsaal,<br />
Bis Eigentum geworden ist und verdient<br />
Und sein sie darf der Mensch dann auch<br />
Die menschlich göttliche nennen.<br />
So gewann er empfangend,<br />
Ein räthselhaft Geschenk,<br />
Und ringend dann als er das Gefährliche des<br />
Siegs das trunkenübermüthige mit göttlichem Verstand<br />
überwunden der Mensch, gewann er die Flamme und die Wooge<br />
des Meeres und den Boden der Erd und ihren Wald und das heiße Gebirg,<br />
und den finstern Teich ...<br />
. Unverkennbar tritt in diesen Formulierungen noch das Hybris<br />
Motiv hervor. Zwar ist die Beherrschung der Elemente auch hier<br />
Göttergeschenk, aber der Mensch muß dies Geschenk erst 'ringend<br />
19 StA II 135. - Orig.-Umschrift in: Hölderlin Friedensfeier. Hsg. <strong>von</strong> W. Binder und A.<br />
Kelletat. Tübingen 1959. S. III.<br />
206<br />
gewinnen'. Bis es sein Eigentum geworden ist, hat er sich durch<br />
»Irrsaal« durchzuarbeiten. Überhaupt wird die Bändigung der Elemente<br />
hier zugleich als 'Sieg' aufgefaßt, an welchem etwas 'Gefährliches'<br />
ist, ein 'Trunkenübermütiges', das der Mensch erst 'mit<br />
göttlichem Verstand' überwinden muß. All das erinnert an die Beispiele<br />
der Hybris in der Horazode, insbesondere an die dortige<br />
Verwendung der Prometheus-Sage.<br />
Wie aber das Prometheus-Motiv aus diesen Versen <strong>nicht</strong> wegzudenken<br />
ist, so gibt es auch anderweitige Reminiszenzen ganz<br />
ähnlicher Art: an Heroen und Giganten. Außer Flamme und Flut<br />
»gewann« der Mensch hier ja noch mehr - unter anderem: »das<br />
heiße Gebirg und den finstern Teich«. Die letzten Worte wurden<br />
bisher <strong>nicht</strong> erklärt. Sie lassen sich aber durch Beachtung <strong>von</strong> Traditionsbezügen<br />
sehr wohl genauer deuten. Was den »finstern<br />
Teich« betrifft, so kann es wohl kaum fraglich sein, worauf der <strong>von</strong><br />
antiker Mythologie durchdrungene Dichter damit anspielte: es ist<br />
der Averner See, der wegen seines düstern Aussehens als Eingang<br />
der Unterwelt betrachtet wurde. In der römischen Dichtung trägt<br />
er die stehende Bezeichnung 'finster'. Vergil nennt ihn in berühmten<br />
Versen »lacus niger«20, spricht <strong>von</strong> ihm wie Hölderlin geradezu<br />
als »Teich«21 und schildert seine Lage inmitten unheimlichen,<br />
sagenumwobenen Waldes. 22 (Was daran denken läßt, dass auch in<br />
Hölderlins Bilderreihe der 'finstere Teich' nachbarlich neben dem<br />
»Wald« figuriert.) Damit wird sich auch für das »heiße Gebirg«<br />
die Deutung ergeben: hier ist an die vulkanische Gegend zu denken,<br />
innerhalb derer der Averner See liegt - die Vergil-Landschaft<br />
20 Vergil Aeneis VI 238. Properz III 18, 1: umbroso Averno. Diodor IV 22: das kristallklare<br />
Wasser des Averner Sees erscheint wgen seiner Tiefe völlig schwarz. Wenn<br />
Avemus, was bei römischen Dichtern oft geschah, überhaupt gleichgesetzt wurde<br />
mit "die Unterwelt" (Acheron), so wird er natürlich gern als "finster" bezeichnet.<br />
Vgl. OvidAm. III 9, 27: nigro [ ... ] Averno. Statius Theb. III 146: nigri [ ... ]Averni. VII<br />
823: lucemque exclusitAverno. Vgl. auch Schiller, DIE KÜNSTLER v. 247: »In des Avernus<br />
schwarzen Ozean«.<br />
21 Vergil Georg. IV 493: stagnis [ ... ] Avernis. Vgl.Aen. VI 107: palusAcheronte refuso.<br />
Plin. 1II 61: palus Acherusia.<br />
22 Vergil Aen. III 442. VI 118, 238, 564. Statius Silvae IV 3, 131 ff.<br />
207
der Campi Phlegraei, darüber hinaus allgemein an vulkanisches<br />
Gebirge.<br />
Mit beiden Lokalitäten verband die Phantasie der Römer Vorstellungen<br />
<strong>von</strong> Ereignissen sagenhafter Hybris, aber auch <strong>von</strong> Taten<br />
der Kultur. Die Campi Phlegraei galten - wie bei den Griechen<br />
das makedonische Phlegra - als Geburtsort der Giganten.<br />
Infolgedessen wurde auch der Schauplatz der Gigantomachie gern<br />
hierher verlegt. (Sonst aber stets in vulkanische Gegenden: unter<br />
feuerspeiende Berge begrub Zeus die besiegten Giganten, so den<br />
Enkelados unter den Ätna.) Den Averner See - der natürlich oft<br />
mit den Campi Phlegraei zusammengenannt wird 23 - erwähnt die<br />
lateinische Dichtung ähnlich wie den Acheron mit Vorliebe, wenn<br />
vom Eintritt in das Totenreich die Rede ist. Ihn mußten auch jene<br />
Heroen passieren, denen es gelang, lebend in die Unterwelt einzudringen<br />
und wiederzukehren, wie Orpheus,24 Äneas, Odysseus.<br />
25 Das ruft die Erinnerung wach an andere, denen ähnliches<br />
gelang: Dionysos, Herakles, Theseus.<br />
Hier mag daran erinnert werden: jene gleiche Horazode I 3,<br />
die uns beschäftigte, nennt innerhalb der Reihe <strong>von</strong> Beispielen<br />
menschlicher Hybris, die zum kulturellen Fortschritt führt, neben<br />
Schiffahrt und Feuerraub des Prometheus noch ferner: das Eindringen<br />
des Herkules in die Unterwelf 6 und die Kämpfe der Giganten<br />
sowie deren Besiegung durch Jupiter (v. 37 ff.). Auch das mag<br />
Hölderlins Vorstellungen beeinflußt haben. Übrigens war aber<br />
Herkules in jener Gigantomachie ein entscheidender Helfer der<br />
Götter. Wieder führt uns da in die Vergil-Landschaft der Campi<br />
Phlegraei zurück. Herkules nämlich - so wird bei Diodor erzählt<br />
- besiegte auf den Phlegräischen Feldern die Giganten und errichtete<br />
anschließend einen Damm, der den Averner und Lucriner See<br />
vom Meer abtrennte: die auch in der römischen Dichtung oft genannte<br />
Via Herculea.<br />
23 Diodor IV 21, 5; 22, 1. Strabo V 24. Statius Theb. XI 7 ff.<br />
24 Vergil Georg. IV 493. Ovid Met. X 51.<br />
25 Strabo V 24.<br />
26 Horaz carm. I 3, 36: Perrupit Acheronta Herculeus labor.<br />
208<br />
All dies zusammen gibt uns Aufschluß darüber, wie die Bilderreihe<br />
in der Entwurfskizze zur FRIEDENSFEIER aufzufassen ist. Offenbar<br />
dachte Hölderlin hier ursprünglich an eine Zusammenstellung<br />
<strong>von</strong> Beispielen für die Hybris, für das 'Gefährlich'e und<br />
'Trunkenübermütige' jener Siege, die in ihrer Gesamtheit die<br />
menschliche Kultur herbeiführten. Später bemerkte der Dichter die<br />
Unstimmigkeit, die darin bestand, dass in dieser Zusammenstellung<br />
die Kultursiege doch allzuwenig den Charakter <strong>von</strong> »göttlichen<br />
Gaben« hatten, dass das Hybris-Motiv zu stark hervortrat.<br />
Das Überwiegen der menschlichen Selbständigkeit vertrug sich<br />
schlecht mit dem Gedanken, dass die Besiegung der Elemente<br />
doch vor allem ein »rätselhaft Geschenk« der Götter sein sollte.<br />
Nun führte er durch Kürzung der Beispielreihe leicht die notwendige<br />
Änderung herbei. Wir werden aber, nachdem wir die Gedankengänge<br />
des Entwurfs genauer kennen, noch immer etwas vom<br />
Geist jener Horazode auch in der 6. Strophe der FRIEDENSFEIER verspüren;<br />
werden nun auch beispielsweise den Satz anders lesen:<br />
Viel mehr, denn menschlicher Weise [I]<br />
[Entwurf: Denn menschlicher Weise, nimmermehr 27 ]<br />
Sind jene mit uns, die fremden Kräfte, vertrauet [!].<br />
Diese Worte enthalten <strong>nicht</strong> nur den Hinweis auf die göttliche Hilfe,<br />
sondern gemahnen a?ch, mit der für Hölderlin so charakteristischen<br />
Mehrdeutigkeit, an das Hybris-Motiv, wie es im Vorentwurf<br />
sich herangedrängt hatte, doch wohl in Erinnerung an Horaz.<br />
Als der <strong>von</strong> Hölderlin nachweislich geschätzte Friedrich Wilhelm<br />
Zachariä jenes Horazische Propemptikon an Vergil zur<br />
Grundlage nahm für eine Ode, der er den Titel gab: AN DAS SCHIFF,<br />
WELCHES KLOPSTOCKEN NACH DÄNNEMARK FÜHRTE, formte er das lateinische<br />
»illi robur et aes triplex« folgendermaßen um28:<br />
27 StAll 705 Z. 28 ff. - Original-Umschrift der FRIEDENSFEIER <strong>von</strong> Binder-Kelletat (1959)<br />
S. VII Z.4.<br />
28 Poetische Schriften <strong>von</strong> Friedrich Wilhelm Zachariä. Th. 2. Braunschweig 1772. S.<br />
299. In anderen Zachariä-Ausgaben ist das Gedicht stets unter der Abteilung Oden<br />
und Lieder zu finden.<br />
209
Wir dürfen nun im Hinblick auf DIE WEISHEIT DES TRAURERS annehmen,<br />
dass derartige Motivüberlagerungen bei Hölderlin ein<br />
absichtlich und gern angewendetes Stilmittel sind, dass man in ihnen<br />
<strong>nicht</strong> unbedingt - der Gedanke läge nahe - ein Unsicherwerden<br />
des Bewußtseins im Zeichen zunehmender Erkrankung sehen<br />
muß. Das berechtigt uns, eines der schwierigsten Probleme der<br />
Hölderlininterpretation in neuem Lichte zu sehen: jene rätselhafte<br />
Stelle vom »Syrier« in der letzten Strophe <strong>von</strong> BROD UND WEIN.<br />
Man erinnert sich: in der Handschrift, die noch dem Gedicht den<br />
TItel DER WEINGOTT gab (H2a), war es bekanntlich auch Dionysos,<br />
der hier· am Schluß in den Hades hinabsteigt:<br />
Aber indessen kommt, als Freudenbote, des Weines<br />
Göttlichgesandter Geist unter die Schatten herab.<br />
Später änderte Hölderlin dies in:<br />
Aber indessen kommt als Fakelschwinger des Höchsten<br />
Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab.<br />
Die Bezeichnung »Syrier« nötigt zunächst, an Christus zu denken,<br />
um so mehr als Hölderlin in einem anderen Gedicht mit dem Wort<br />
syrisch auf die Heimat Christi weist. Indessen blieb immer das Rätsel<br />
bestehen: wie das gesamte Gedicht vom »Weingott« handelt,<br />
so auch die letzte (9.) Strophe, und zwar diese mit besonders charakteristischen<br />
Akzenten. Als Hölderlin nun eine Reinschrift des<br />
Gedichtes anfertigte (H3a), die die Änderung »Syrier« aufnahm,<br />
blieben in der 9. Strophe alle diejenigen Sätze bestehen, in denen<br />
auf Wesenszüge des Dionysos angespielt ist, die infolgedessen auf<br />
Christus <strong>nicht</strong> passen wollen.31 In der geänderten Stelle aber trat<br />
31 Bezüglich des ersten Verses der Strophe wies Emil Petzold auf den Zusammenhang<br />
mit Demeterkult und eleusinischen Mysterien hin. Wenn in dem folgenden<br />
Vers (144) gesagt ist, der Weingott »Führe des Himmels Gestirn ewig hinunter, hinauf«,<br />
so beruht auch das auf antiker Tradition. In Sophokles' ANTIGONE wird Dionysos<br />
v. 1147 angeredet: xopay ä
vor Augen, die Hölderlin .zuerst sah. So entdeckten sie den gleichen<br />
Weg, den er eingeschlagen hatte - ihr Dichten stand im Zeichen<br />
schonsamen Bewahrens. <strong>Ihr</strong>e Wirkungsweise ist charakterisiert<br />
durch Georges Vers des Gedichts FRANKEN in DER SIEBENTE RING:<br />
»Da schirmten held und sänger das Geheimnis.«<br />
Spinoza und die deutsche Klassik<br />
Spinoza kam in Deutschland nur einmal seiner Bedeutung gemäß<br />
zur Geltung: während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.<br />
Damals wirkte er unverkennbar stark auf führende Geister wie<br />
Lessing, Herder, den jungen Schiller, auf Goethe, Hölderlin, Schelling,<br />
Friedrich Schlegel - um nur die wichtigsten zu nennen. Den<br />
vielgesichtigen Zeitraum <strong>von</strong> 1750 bis 1800 generalisierend als<br />
»Deutsche Klassik« zu bezeichnen, wie es oft geschieht, läßt sich<br />
kaum rechtfertigen. Wenn wir dennoch die Genannten mit dem<br />
Begriff »Klassik« in Verbindung bringen, so deshalb, weil jeder <strong>von</strong><br />
ihnen jenes besonders intensive Verhältnis zur Antike hatte, das,<br />
wofern es überhaupt Kennzeichen für Klassik gibt, eins der<br />
beachtenswertesten ist.<br />
Die Beziehungen zwischen der deutschen Klassik und Spinoza<br />
sind bisher nur unzureichend dargestellt worden. Richtunggebend<br />
hätten schon Heines Hinweise auf die Bedeutung Spinozas für<br />
Goethe sein müssen. 1 Wer jedoch in Schriften über Goethe oder die<br />
deutsche Klassik nachschlägt, wird feststellen, dass auch nur Erwähnungen<br />
des Namens Spinoza allezeit selten blieben, dass ihre<br />
Zahl oft gleich Null ist., Eigentlich nennenswert in früherer Zeit<br />
sind nur Korffs verdienstvolle Ausführungen über den Pantheismus<br />
der Klassik, innerhalb derer Spinoza wirklich berücksichtigt<br />
wird. Doch haben gerade diese Partien <strong>von</strong> Korffs Geist der Goethezeit<br />
sich wenig durchgesetzt. 2<br />
Herkömmliche Aversion gegen Spinoza führte zu diesem fast<br />
gänzlichen Verschweigen. So alt wie die Lehre Spinozas ist der Vor-<br />
1 Heinrich Heine, ZUR GESCHICHTE DER RELIGION UND PHILOSOPHIE IN DEUTSCHLAND. 3.<br />
Buch (HHA 8/1, 101): "Goethe war der Spinoza der Poesie. Alle Gedichte Goethes<br />
sind durchdrungen <strong>von</strong> demselben Geiste der uns auch in den Schriften des<br />
Spinoza anweht. Daß Goethe gänzlich der Lehre des Spinoza huldigte ist keinem<br />
Zweifel unterworfen. Wenigstens beschäftigte er sich damit während seiner ganzen<br />
Lebenszeit ... "<br />
2 Vgl. H. A. Korff, Geist der Goethezeit. T. I-IV. 2. durchges. Auf!. Leipzig 1927-1955.<br />
216 217
wurf, sie laufe auf Atheismus heraus. Offenes Be<strong>kennt</strong>nis zu seiner<br />
Philosophie war daher lange Zeit gefährlich. Noch im 18. Jahrhundert<br />
blieben Exemplare seiner Schriften schwer zugänglich. Soweit<br />
es damals Spinoza-Anhänger gab, entwickelte sich unter ihnen<br />
eine Art Chiffernsprache, mit der man sich verständlich machte.<br />
Zu ihr gehören Wendungen wie "Eins und Alles" - nachdem Lessing<br />
erregendes Wort bekannt geworden war: "Hen kai pan! Ich<br />
weiß <strong>nicht</strong>s anders." Oder man sagte: "Gott und die Natur", "die<br />
göttliche Natur" etc. Letzteres verdeutscht übrigens "divina natura",<br />
einen <strong>von</strong> Spinoza oft gebrauchten Terminus. 'Es erforderte<br />
viel Mut, so öffentlich für Spinoza einzutreten, wie es Herder am<br />
Ende des 'Pantheismusstreits' in seiner Schrift GOTT tat. 3 Nur im<br />
liberalen Weimar war dergleichen möglich. Doch kam Herder noch<br />
1799 in Bedrängnis, als Fichte, selbst wegen Atheismus behördlich<br />
verklagt, jene Schrift GOTT für atheistisch erklärte. Bezeichnenderweise<br />
galten Fichtes eigene gewagte Gottesbegriffe damals als<br />
'Spinozismus' katexochen. Den entscheidenden Schlag gegen<br />
Spinoza führte schließlich K a n t, als er mit seiner großen Autorität<br />
den Vorwurf des Atheismus erhärtete, mehr noch, indem er vom<br />
Standpunkt der alleinseligmachenden kritischen Philosophie die<br />
gesamte Lehre Spinozas diskreditierte. Dies lieferte den Spinozagegnern<br />
künftiger Generationen die erwünschten Argumente.<br />
Durch Kant wurde erreicht, dass man Spinoza <strong>nicht</strong> mehr las.<br />
Obwohl im 19. Jahrhundert Be<strong>kennt</strong>nisse zu Spinoza kein ernstliches<br />
Risiko mehr bedeuteten, blieb Antispinozismus doch in verschiedensten<br />
Formen bestehen. Ablehnend verhielt sich weiter das<br />
orthodoxe Christentum. Neue Gegenkräfte erwuchsen durch Antisemitismus<br />
und Deutschtümelei. Es kamen die Zeiten, in denen<br />
man sich sträubte, zugeben zu müssen, dass' deutscher' Geist wirklich<br />
beeinflußt gewesen sein sollte durch den 'jüdischen' Philosophen.<br />
Mit der 'Spinozalegende' meinte man aufräumen zu müssen.<br />
Haltlose Thesen wurden aufgestellt, eine nach der andern: was<br />
als Spinozismus bei Goethe oder Herder erscheine, beruhe in Wahr-<br />
3 Erstausgabe der Spinozaschrift GOlT. Av yv&e; ,,[l tun eroe;, 1')ölwv f01]. Einige Gespräche<br />
<strong>von</strong> J. G. Herder. Gotha 1787. (SWS 16, S. 401 ff; HFA 4, 679 ff.)<br />
218<br />
h it auf Einwirkung <strong>von</strong> Böhme, Giordano Bruno, Shaftesbury, Leibniz,<br />
Plotin usw. Das Dritte Reich fand dann den 'Philosophen', der<br />
mit dem Fall Spinoza endgültig aufzuräumen hatte. Da galt nun<br />
die Verknüpfung des Namens Spinoza mit der deutschen Klassik<br />
Is "grober Unfug"4.<br />
Nicht zuletzt stand seit dem 19. Jahrhundert der Anerkennung<br />
pinozas auch im Wege, dass man Wert und Rang seiner lateinischen<br />
Sprache <strong>nicht</strong> mehr begriff. Obwohl sie partiell der Mathematik<br />
nahesteht, eignet Spinozas Sprache im ganzen doch eine<br />
Großartigkeit, die <strong>von</strong> den Dichtern noch empfunden wurde. Dem<br />
jungen Herder erschien "das System des Spinoza" als "Dichtung"5.<br />
Goethes Liebe für das Latein Spinozas ist bezeugt; dass er in seiner<br />
FARBENLEHRE sich bewußt der Vortragsweise <strong>von</strong> Spinozas ETHIK<br />
nschloß, hat er selbst bekannt. Heine hob an Spinozas Sprache<br />
"Gedankengrandezza", "Ernst" und selbstbewußten "Stolz" hervor.<br />
6 Noch Nietzsche mit seinem ausgeprägten Sprachgefühl<br />
empfand ähnlich, als er <strong>von</strong> Spinozas Stil sagte: "Schlicht und er-<br />
4 Ernst Krieck: Mythologie des bürgerlichen Zeitalters. 1939.<br />
5 Vgl. Herders Rezension <strong>von</strong> James Beattie, Versuch über die Natur und Unveränderlichkeit<br />
der Wahrheit. A. d. Engl. FRANKFURTER GELEHRTE ANZEIGEN, Nr. LXXXV. Den 23.<br />
Oktober 1772. (SWS 5, 456-462)<br />
6 Heine, ZUR GESCHICHTE DER RELIGION UND PHILOSOPHIE IN DEUTSCHLAND. 2. Buch (HHA<br />
8/1, .54): "Die mathematische Form giebt dem Spinoza ein herbes Aeußere. Aber<br />
dieses ist wie die herbe Schale der Mandel; der Kern ist um so erfreulicher. Bey<br />
der Lektüre des Spinoza ergreift uns ein Gefühl wie beim Anblick der großen Natur<br />
in ihrer lebendigsten Ruhe. Ein Wald <strong>von</strong> himmelhohen Gedanken, deren blühende<br />
Wipfel in wogender Bewegung sind, während die unerschütterlichen Baumstämme<br />
in der ewigen Erde wurzeln. Es ist ein gewisser Hauch in den Schriften<br />
des Spinoza, der unerklärlich. Man wird angeweht wie <strong>von</strong> den Lüften der Zukunft.<br />
Der Geist der hebräischen Propheten ruhte vielleicht noch auf ihrem späten<br />
Enkel. Dabey ist ein Ernst in ihm, ein selbstbewußter Stolz, eine Gedankengrandezza,<br />
die ebenfalls ein Erbtheil zu seyn scheint; denn Spinoza gehörte zu<br />
jenen Märtyrerfamilien, die damals <strong>von</strong> den allerkatholischsten Königen aus Spanien<br />
vertrieben worden. Dazu kommt noch die Geduld des Holländers, die sich<br />
ebenfalls, wie im Leben, so auch in den Schriften des Mannes, niemals veriäugnet<br />
hat. I Constatirt ist es, daß der Lebenswandel des Spinoza frey <strong>von</strong> allem Tadel<br />
war, und rein und makellos wie das Leben seines göttlichen Vetters, Jesu Christi.<br />
Auch wie dieser litt er für seine Lehre, wie dieser trug er die Dornenkrone. Ueberall<br />
wo ein großer Geist seinen Gedanken ausspricht ist Golgatha."<br />
219
haben, wie es seine Art ist."7 Demgegenüber richten sich Vorwürfe<br />
der Literarhistoriker, Spinozas Sprache sei rationalistisch trocken<br />
und 'unbeholfen', <strong>von</strong> selbst. Auch urteilte man offenkundig nach<br />
mangelhaften Übersetzungen, während er im Originaltext <strong>nicht</strong><br />
mehr gelesen wurde.<br />
Ungebührlich zunutze machte man sich eine weitere Eigenheit<br />
Spinozas. Der Philosoph hatte die Fülle originaler Gedanken in<br />
lakonischer Kürze vorgetragen unter Verzicht auf effektvolle Ausweitungen.<br />
Dies hatte zur Folge, dass schon seit dem 17. Jahrhundert<br />
- <strong>nicht</strong> nur in Deutschland - volkstümliche Literaten und Philosophen<br />
Spinoza maßlos spoliierten, seine Ideen ausmünzten, sie<br />
in gemütvollerer Gewandung als eigene Schöpfung ausgaben. Unzählige<br />
Plagiate blieben unbemerkt, da das Original so schwer zugänglich<br />
war. Schon Lessing hatte aufgezeigt, wieviele Hauptlehren<br />
bei Leibniz <strong>von</strong> Spinoza stammten, (Monadenlehre, Prästabilierte<br />
Harmonie, Expansion und Kontraktion usw.) Herder wies darauf<br />
hin, dass in der <strong>Bibel</strong>kritik "manche manches als eine neue Entdeckung,<br />
dazu weit unvollkommener gesagt" hätten, "das in Spinoza<br />
bereits gründlicher stand."8 Schillers Jugendgedicht SPINO<br />
ZA spricht höhnend da<strong>von</strong>, wie der »Eichbaum« Spinoza gefällt<br />
wurde, weil sein »schönes Holz« für die Bauten späterer unbedeutenderer<br />
Philosophen »<strong>von</strong>nöten« war 9 • Ähnlich empfand He i n e,<br />
als er feststellte, kein Philosoph hätte so vielIdeendiebstahl zu be-<br />
klagen gehabt wie Spinoza. <<br />
Schelling bezeichnete Spinozas Philosophie einmal als) ein<br />
"nur in äußersten Umrissen entworfenes Werk, in dem man, wenn<br />
es beseelt wäre, erst noch die vielen fehlenden oder unausgeführten<br />
Züge bemerken würde"; übrigens gleiche dies Werk in seiner<br />
Starrheit "den ältesten Bildern der Gottheiten, die, je weniger indi-<br />
7 Friedrich Nietzsche, DIE FRÖHLICHE WISSENSCHAFT. Buch 4, Aphor. 333.<br />
8 Herder, Gott. Erstes Gespräch (HFA 4, 686)<br />
9 Friedrich Schiller, ANTHOLOGIE AUF DAS JAHR 1782. Faksimileausgabe. Hrsg. <strong>von</strong> <strong>Katharina</strong><br />
<strong>Mommsen</strong>. Stuttgart: Metzler, 1973. S. 41: Spinoza I Hier ligt ein Eichbaum<br />
umgerissen, I Sein Wipfel thät die Wolken küssen. I Er ligt am Grund - warum? I Die<br />
Bauren hatten, hör ich reden, I Sein schönes Holz zum Bau'n <strong>von</strong>nöthen, I Und rissen<br />
ihn deßwegen um.<br />
220<br />
viduell-Iebendige Züge aus ihnen sprachen, desto geheimnisvoller<br />
erschienen".l0 Schelling selbst hat Spinoza auf solche Weise ausgiebig<br />
"beseelt", ähnliches gilt <strong>von</strong> Fichte, Schleiermacher, Hegel,<br />
Schopenhauer und vielen anderen. Die Forschung ging solchen<br />
verborgeneren Spinozabezügen nur ungern nach. Sie vermied es,<br />
Entsprechendes bei den Dichtern der deutschen Klassik klarzustellen.<br />
Denn auch diese, sämtlich Meister des Worts, drückten gelegentlich<br />
Gedanken Spinozas phantasievoller und mehr "individuell-lebendig"<br />
aus um einer dichterischen oder eingängigeren<br />
Sprache willen. Statt die wahre Herkunft solcher Formulierungen<br />
zuzugeben, folgerte man unredlich - insbesondere bei Goethe und<br />
Herder -: Spinoza sei 'selbständig' weitergedacht und verändert<br />
worden. Noch irreführender waren die Versuche, auf Grund bestimmter<br />
terminologischer Wendungen nachzuweisen, Goethe oder<br />
Herder seien primär <strong>von</strong> ganz anderen Philosophen abhängig gewesen,<br />
keineswegs <strong>von</strong> Spinoza.<br />
Ein Beispiel hierfür: wollte Goethe seine Stellung zur Unsterblichkeitsfrage<br />
erläutern, so sprach er gern <strong>von</strong> Monade oder "entelechischer<br />
Monade". Diese hielt er für unvergänglich, <strong>nicht</strong> die Person<br />
des MenschenY Monade weist auf Leibniz als Begründer der<br />
Monadenlehre, Entelechie ist aristotelischer Terminus. Dennoch war<br />
es irreführend, Goethe in dieser Frage Abhängigkeit <strong>von</strong> Aristoteies<br />
nachzusagen oder ihn gar als Leibnizianer hinzustellen. 12<br />
(Letzteres wurde besonders hartnäckig versucht.) Schon seit den<br />
Dokumenten des 'Pantheismusstreits' war es bekannt, dass Leibniz<br />
den Begriff der Monade aus Spinoza herausgesponnen hatte.<br />
Die Termini <strong>von</strong> Aristoteles und Leibniz dienten Goethe nur, in<br />
der Konversation faßlich darzulegen, was in Spinozas Sprache zu<br />
schwierig ausgedrückt war. 13 Wie in allen ähnlichen Fällen gilt auch<br />
10 EW.J. Schelling, DAS WESEN DER MENSCHLICHEN FREIHEIT 1809.<br />
11 Vgl. Christian Gottlob Voigt an Heinrich Carl Abraham Eichstädt, 31. Juli 1814:<br />
"Auf Aussichten jenseits des Grabes rechnet er [Goethel <strong>nicht</strong> [ ... 1 <strong>von</strong> Nachfolge<br />
der Toten mag er <strong>nicht</strong>s hören, und gewiß hat er nach seinen Begriffen ganz recht."<br />
(SchrGG 56, S. 455.)<br />
12 Vgl. z. B. Erich Schmidt zu FAUST v. 11824 (JA 14, S. 400).<br />
13 Vgl. in der ETH IK besonders T. V, Prop. 22 und 23.<br />
221
hier: kein anderer Philosoph, sondern Spinoza war es, zu dem<br />
Goethe sich stets bekannte, <strong>von</strong> dem er noch als Siebzigjähriger in<br />
einem Epigramm sagte: »Der Philosoph, dem ich zumeist vertraue<br />
.. «14 Über eine so zentrale Frage wie die der Unsterblichkeit<br />
hätte Goethe nie anders als in Übereinstimmung mit Spinoza gesprochen.<br />
Es beruht auf ähnlichen terminologischen Scheinargumenten,<br />
wenn Goethe und Herder hartnäckig ein 'Dynamismus' zuerkannt<br />
wurde, der sie angeblich <strong>von</strong> Spinoza unterschied, mit dem man<br />
sie zugleich in rechte Nähe zum 'dynamischen Weltbild' des 'nordisch-germanischen<br />
Menschen' bringen wollte. Heute <strong>kennt</strong> und<br />
nennt man die Erörterungen der "potentia" in Spinozas ETHIK,15<br />
die Herder legitimierten, in seinem Buch GOTT <strong>von</strong> "Kräften" zu<br />
sprechen, Goethe <strong>von</strong> 'Tätigkeit', 'Polarität', vom 'Schaffen und Umschaffen'<br />
einer sich nie "zum Starren waffnenden" Natur. Selbst<br />
der müßige Wortstreit um die Begriffe 'Pantheismus' und 'Panentheismus',<br />
bei dem alle Mühe aufgewendet wurde, einen 'echt deutschen<br />
Pantheismus' gegen den des Spinoza zu stellen, basiert auf<br />
einer terminologischen Unterschlagung. In Wahrheit spielt bei Spinoza<br />
selbst der Gesichtspunkt der Immanenz eine beträchtliche<br />
Rolle. Im 11. Teil der ETHIK, Von der Natur und dem Ursprunge des<br />
Geistes, lautet Spinozas 15. Lehrsatz: "Alles was ist, ist in Gott, und<br />
<strong>nicht</strong>s kann ohne Gott sein oder begriffen werden."16 Unter Hinweis<br />
auf diesen Lehrsatz erscheint wiederholt in der ETHIK die Formel'in<br />
Deo'.J7<br />
14 WAl 51,109.<br />
15 Hans M. Wolff: Spinozas Ethik. Eine kritische Einführung. München, 1958. 5.24 ff.<br />
Vgl. Martin Bollacher: Der junge Goethe und Spinoza. Tübingen, 1969. s. 235.<br />
16 Ethices, Pars Secunda, De Natura, et Origine Mentis, Propositio XV: "Quicquid est,<br />
in Deo est, et nihil sine Deo esse, neque concipi potest."<br />
17 So lautet beispielsweise, gleichfalls in T. II, die Demonstratio zu Propositio XVIII:<br />
"Omnia, quae sunt, in Deo sunt, et per Deum concipi debent" (Alles was ist, ist in<br />
Gott und muß aus Gott begriffen werden); oder ebd. die Anmerkung zum 45. Lehrsatz:<br />
(Scholium zu Propositio XLV): Loquor [ ... ] de ipsa existentia rerum singularum,<br />
quatenus in Deo sunt." ("Ich spreche [ .. . ] <strong>von</strong> dem Dasein der einzelnen<br />
Dinge selbst, insofern sie in Gott sind ... ")<br />
222<br />
Indem wir vom Pantheismus sprechen, ist ein entscheidender<br />
Punkt erreicht. Spinozas Wirkung auf die Klassik blieb schwer faßlich,<br />
weil eine auf Pantheismus gegründete Weltanschauung,<br />
bei der die traditionelle Vorstellung vom personalen Schöpfergott<br />
fehlte, letzten Endes auf Ablehnung stieß. Mit der Formel vom<br />
Pan e n t h eis mus suchte man diesen personalen Gott wieder<br />
heranzutragen - im Gegensatz zu Spinoza und zu den Repräsentanten<br />
der Klassik, denen sonst die Formel vielleicht akzeptierbar<br />
gewesen wäre. Gott die Ehre zu geben, <strong>nicht</strong> der Welt - darauf lief<br />
alles Bestreben hinaus. Die Konzeption der Klassiker war gerade<br />
entgegengesetzt: sie gaben der Welt die Ehre, der Natur, und die<br />
hier entdeckten Werte erschienen ihnen <strong>von</strong> solchem Rang, dass<br />
sie das Prädikat "göttlich" für einzig geeignet hielten, ihn auszudrücken.<br />
Anerkannt wurde zwar auch <strong>von</strong> ihnen das unbedingte<br />
Primat des schaffenden Prinzips - Spinozas natura naturans. Doch<br />
erschien es seinem Wesen nach unerforschlich, konnte vom Menschen<br />
<strong>nicht</strong> gefaßt werden, am wenigsten als 'Person'. Nur mittelbar<br />
läßt das Göttliche in der Natur - der natura naturata Spinozas<br />
- sich erkennen. Dies gab der Welt, den Dingen ihren Wert und<br />
dem Menschen seine wichtigste Aufgabe.<br />
Mit dieser Einstellung zur Natur unterscheiden sich die Klassiker<br />
<strong>von</strong> ähnlich gerichteten Anschauungen. Ein allgemeines religiöses<br />
Naturgefühl war schon seit Beginn des 18. Jahrhunderts<br />
aufgekommen bei den B. H. Brockes, E. v. Kleist, A. v. Haller,<br />
bei Rousseau, Hamann, den Empfindsamen. Demgegenüber<br />
bedeutet der Pantheismus der Klassik eine entschiedene Steigerung,<br />
eine ganz neue Stufe ist erreicht. Die Frage erhebt sich: wie kam es<br />
dazu? Sie wäre keinesfalls zu klären mit der These Korffs, derzufolge<br />
jener Pantheismus eine Opposition darstellt gegen die "Entgötterung"<br />
der Welt durch die Aufklärung. Die Entgötterung der<br />
Welt, gegen die sich der Pantheismus kehrt, ist älteren Datums, sie<br />
vollzog sich beim Sieg des Christentums über die Antike, fast vor<br />
anderthalb Jahrtausenden. Genau hierauf zielt Schillers Wort <strong>von</strong><br />
der »entgötterten Natur« in DIE GÖTTER GRIECHENLANDS. Es war aber<br />
gerade ein neues Erlebnis der Antike, das für die Klassiker im 18.<br />
Jahrhundert das Weltbild verändert hatte.<br />
223
lingen zu sagen: "Götter und Helden waren alle aus ihrem Geschlecht,<br />
ihre Vorfahren, ihres Gleichen."24 Goethe äußerte denselben<br />
Gedanken dann freizügig und allgemein, indern er <strong>von</strong> der<br />
"reinen Verehrung der Götter als Ahnherren"25 bei den Griechen<br />
sprach. Solche Einstellung zum Menschen gilt ihm als eins des<br />
Hauptrnerkmale des "heidnischen Sinnes"26, wie er Winckelmann<br />
eigen war. Potentieller Träger des Göttlichen konnte für die Klassiker<br />
auch der Mensch gegenwärtiger Zeit sein. Im Hinblick hierauf<br />
sprach Hölderlin sowohl in seiner Lyrik als auch im HYPERION vorn<br />
»Gott in uns«, übrigens gelegentlich auch Herder und Schiller.27<br />
Wenn Hölderlin Gestalten seiner Dichtung wie Diotima, Adamas,<br />
Alabanda, Empedokles oft mit dem Beiwort »göttlich« versieht, so<br />
beruht das auf ganz der nämlichen 'heidnischen' Gesinnung wie<br />
bei Winckelmann und wurde durch diese inspiriert.<br />
Es bleibt zu fragen: was führte die Klassiker zur pantheistischen<br />
Philosophie des Spinoza? Das Bedürfnis, Natur, Welt und Gott wieder<br />
als identisch zu sehen, hätten es <strong>nicht</strong> wirklich auch andere<br />
ähnliche Philosophien befriedigen können, auf die man so oft verwies?<br />
Ein äußerer Grund für die Bevorzugung Spinozas liegt allgemein<br />
in der Tatsache, dass dieser Philosoph der Hauptvertreter<br />
des Pantheismus aller Zeiten ist. So wendete man sich an das Original,<br />
<strong>nicht</strong> an Nachahmer oder Vorläufer. Was aber Spinoza eigentlich<br />
für die Klassiker attraktiv machte, waren tieferliegende Ursachen.<br />
In Hauptpunkten seiner Lehre fand man die philosophische<br />
Deutung <strong>von</strong> Wesenszügen, die soeben an der Antike neu entdeckt<br />
worden waren. Das erweist sich bereits im Hinblick auf die Auf-<br />
24 PLASTIK. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem<br />
Traume. Vierter Abschnitt (HFA 4, 303).<br />
25 Vgl.WINCKELMANN UND SEIN JAHRHUNDERT. Abschnitt Heidnisches (WA 146,25).<br />
26 Ebd.<br />
27 "Das Göttliche in uns wird mit uns geboren", heißt es in Herders Lobschrift Jo<br />
HANN WINCKELMANN <strong>von</strong> 1781 (HFA 2,682). Schiller in ÜBER ANMUT UND WÜRDE: "der<br />
Gesetzgeber selbst, der Gott in uns." (5NA 20,303.) Vgl. auch Goethes FAUST v. 1566:<br />
"Der Gott, der mir im Busen wohnt." - Ovids "est deus in nobis" (Fast. 6, 5) läßt<br />
sich nur bedingt vergleichen, da es speziell vom Dichter gesagt ist. Allgemeiner<br />
heißt es bei Aristoteles, NIKOMACHISCHE ETHIK 7, 14: "Alle Wesen haben ihrer Natur<br />
nach etwas Göttliches [theion]."<br />
226<br />
fassung, dass Göttliches, wie in allem, so auch im Menschen sei.<br />
Von der Teilhabe des Menschen an der Gott-Natur spricht Spinoza<br />
unter verschiedensten Gesichtspunkten. "Es ist unmöglich, dass<br />
der Mensch kein Teil der Natur sei", lautet ein Lehrsatz des vierten<br />
Teils der ETHIK. 28 Da Natur und Gott für Spinoza gleich sind29,<br />
bedeutet das: der Mensch ist ein Teil Gottes. An anderer Stelle heißt<br />
es: 11 Der menschliche Geist ist ein Teil des unendlichen Verstandes<br />
Gottes."30 Sogar vorn Verhältnis der Menschen untereinander gilt<br />
unter bestimmten Voraussetzungen: "Der Mensch ist dem Menschen<br />
ein Gott. "31 Spinoza weist auf dies als Möglichkeit, vorausgesetzt,<br />
dass der Mensch "nach der Leitung der Vernunft lebt", was<br />
im Gefüge seiner Lehre bedeutet: nach den Gesetzen der göttlichen<br />
Natur handeln. Erfüllt der Mensch diesen schwersten Anspruch,<br />
so wird er dem Mitmenschen "am meisten nützlich", wird ihm<br />
"ein Gott" sein. Wie nüchtern auch Spinozas Formeln sind, sie umschreiben<br />
doch philosophisch gerade das, was Winckelmann so oft<br />
an den 'heroischen Freundschaften' der Antike pries: ein Mensch<br />
wird dem andern "göttlich", indern er selbstlos Opfer für ihn bringt.<br />
Solche Freundespaare schufen dann, <strong>von</strong> Winckelmann angeregt,<br />
die Dichter: Carlos-Posa, Orest-Pylades, Hyperion-Alabanda.<br />
Wichtiger noch war die Übereinstimmung der eigentlich zentralen<br />
l:ehren Spinozas mit den neuen Erfahrungen vorn Gei s t der<br />
An t i k e. Ein solcher Kardinalpunkt war seine Forderung, man solle<br />
vorn Unerforschlichen der Gott-Natur soviel wie möglich zu erkennen<br />
suchen durch intellektuelles Anschaun der Dinge und Erforschung<br />
ihres Wesens. Solche Er<strong>kennt</strong>nis - Spinoza nennt sie Scientia<br />
intuitiva oder auch Dei intuitiva cognitio-errnöglicht es, Natur<br />
in Gott, Gott in der Natur zu sehn. Die Scientia intuitiva "schreitet<br />
28 "Fieri non potest, ut homo non sit Naturae pars ... "(ETHICES Pars Quarta, Oe Servitute<br />
Humana seu de Affectuum Viribus. Propositio IV)<br />
29 Dies ist die Quintessenz des I. Teils <strong>von</strong> 5pinozas ETHIK, auf die in den folgenden<br />
Teilen immer wieder Bezug genommen wird in Wendungen wie z. B. in der Einleitung<br />
zum IV. Teil (Von der menschlichen Knechtschaft oder der Macht der Affekte):<br />
"aeternum [ ... ] infinitum Ens, quod Deum, seu Naturam appellamus (5.382)<br />
30 ETHIC. T. 11, Coroll. zu Prop. 11.<br />
31 ETHIC. T. IV, Schol. zu Prop. 35.<br />
227
e<strong>kennt</strong> Goethe am 9. Juni 1785 brieflich gegenüber Jacobi. Bei der<br />
Beschäftigung mit "Pflanzen und Steinen", mit Anatomie ("zur Erholung<br />
und Ergötzung der Seele"), mit Geologie, Farben usw. ging<br />
es Goethe darum die "Harmonia naturae", die gesetzmäßige Einheitlichkeit<br />
in der Welt der Formen und Dinge nachzuweisen.39<br />
Indem er der "Ordnung und Verknüpfung der Dinge" anschauend<br />
nachspürte, suchte er Erfahrungen <strong>von</strong> der "Ordnung und Verknüpfung<br />
der göttlichen Ideen", die Spinoza als identisch mit jener<br />
sehen lehrt. 40<br />
Dass Goethe zu seiner morphologischen Lieblingsthese <strong>von</strong> der<br />
"Metamorphose, wodurch alles stufenweise hervorgebracht wird",<br />
durch einen Passus aus Spinozas ETHIK angeregt wurde, geht aus<br />
einem eigenhändigen Auszug aus der ETHIK (T. I, Prop. 22) in der<br />
Ausgabe seines Freundes H. E. G. Paulus41 hervor: "Modificatio,<br />
quae et necessario, et infinita existit", wozu er bemerkt: "Die<br />
Metamorphose wodurch alles stufenweise hervorgebracht wird."42<br />
Dass Goethe sich mit der gesamten Konzeption seiner Morphologie<br />
in der Nachfolge Spinozas bewegte, beweisen Sätze wie<br />
die folgenden aus der Ethik: "Die Gesetze und Regeln der Natur,<br />
nach welchen alles geschieht und Formen in Formen verwandelt<br />
werden, sind überall und immer die gleichen [ ... ] Es geschieht<br />
in der Natur <strong>nicht</strong>s, was ihr als Fehler angerechnet werden könn-<br />
39 An eh. v. Stein, 7. Mai 1784. "Harmonia naturae" in Goethes Brief an Herder <strong>von</strong><br />
Anfang November 1784, über seinen Fund des Zwischenkieferknochens. Wohl auf<br />
Grund vieler Gespräche mit Goethe verwendet Herder den Ausdruck "Harmonie<br />
der Natur" gleichbedeutend in Garr (1787), um Spinozas Begriff der göttlichen Gesetzmäßigkeit<br />
in der Natur zu kennzeichnen (SWS 16, 551; HFA4, 778): die "lebendige<br />
Harmonie der Natur" offenbart sich mitihren"einfachen Gesetzen" dem Künstler,<br />
dem Naturforscher durch Anschaun. Das Wort Harmonie auch sonst oft in der<br />
Schrift Gott, zumal im Fünften Gespräch (Vgl. SWS 16, 491, 516, 553, 561, 568.) Der<br />
Terminus "Harmonie" ist Leibnizisch, wurde aber <strong>von</strong> Goethe und Herder auf Spinozas<br />
Lehre angewandt. (Ähnlich bei dem Leibnizischen Terminus "Monade".) In<br />
HölderlinsHYMNE AN DIE GÖTTIN DER HARMONIE 1ST HARMONIE verstanden wiein Herders<br />
Gesprächen GOTT und <strong>von</strong> dorther - <strong>nicht</strong> <strong>von</strong> Leibniz - übernommen. Die Göttin<br />
» Harmonie« fordert den Menschen auf, ihres »Reichs Gesetze zu ergründen«! (v. 75.)<br />
40 ETHIC T. II, Prop. 7.<br />
41 Benedicti deSpinoza Opera quaesupersuntomnia. Iterumedenda cur. praefationes,<br />
vita m auctoris [ ... ] addidit Henr. Eberh. Gottlob Paulus. Jena 1802-03. Vol. 2, S. 57.<br />
42 Vgl. HA 13,562 zur 'Studie nach Spinoza'.<br />
230<br />
te."43 Menschlicher Irrtum ist es, anzunehmen, "es könne sich jede<br />
Form in jede beliebige andere verwandeln"44. Derartige Irrtümer<br />
zu bekämpfen, hat Goethe unendliche Mühe aufgewandt.<br />
Das gleiche Scholium der ETHIK wirkte sogar unmittelbar auf Goethes<br />
Idee einer "Urpflanze" ein. Der Brief an Charlotte <strong>von</strong> Stein,<br />
in dem er aus Rom freudig <strong>von</strong> der Entdeckung des "Hauptpunktes"<br />
berichtet, enthält nämlich Wendungen, die auffallend mit Spinozas<br />
Text übereinstimmen. So schreibt Goethe am 9. Juni 1787:<br />
"Mit diesem Modell [der Urpflanze] [ ... ] kann man alsdann noch<br />
Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen, das<br />
heißt: die, wenn sie auch <strong>nicht</strong> existieren, doch existieren könnten und<br />
[ .. . ] innerliche Wahrheit und Notwendigkeit haben." Bei Spinoza<br />
hatte Goethe gelesen: während Substanz "in sich ist und durch sich<br />
selbst begriffen wird", soll unter Modifikationen verstanden werden:<br />
"das, was in einem andern ist und deren Begriff nach dem<br />
Begriff des Dinges, in welchem sie sind, gebildet wird. Daher auch<br />
können wir richtige Ideen <strong>von</strong> Modifikationen haben, welche <strong>nicht</strong> existieren,<br />
weil nämlich, obschon sie außerhalb des Intellekts <strong>nicht</strong> wirklich<br />
existieren, ihr Wesen doch in einem andern so enthalten ist, daß<br />
sie durch dieses begriffen werden können."45<br />
Mit der Scientia intuitiva in engstem Zusammenhang steht eine<br />
weitere für die Klassiker wichtige Hauptlehre Spinozas: die vom<br />
43 ETHIC T. III, Vorwort: "Nihil in natura fit, quod ipsius vitio possit tribui; est na mque<br />
natura sem per eadem, et ubique una, eademque ejus virtus, et agendi potentia,<br />
hoc est, naturae leges, et regulae, secundum quas omnia fiunt, et ex unis formis<br />
in alias mutantur, sunt ubique, et semper eaedem ... "<br />
44 ETHIC T. I, Schol. 2 zu Prop. 8: "qui enim veras rerum causas ignorant, omnia confundunt,<br />
et si ne ulla mentis repugnantia tarn arbores, quam homines, loquentes<br />
fingunt, et homines tarn ex lapidibus, qua m ex semine, formari, et, quascunque<br />
formas in alias quascunque mutari, imaginantur."<br />
45 ETHIC T. I, Schol. 2 zu Prop. 8: " ... Nam per substantiam intelligerent id, quod in se<br />
est,et per se concipitur, hoc est, id, cujus cognitio non indiget cognitione alterius<br />
rei. Per modificationes autem id, quod in alio est, et qua rum conceptus a conceptu<br />
rei, in qua sunt, formatur; quocirca modificationum non existentium veras ideas<br />
possumus habere; quandoquidem, quamvis non existant actu extra intellectum,<br />
earum tarnen essentia ita in alio comprehenditur, ut per idem concipi possint. .. "<br />
231
Amor Dei intellee tualis. Was wir aus dem Anschaun der Natur,<br />
nach Weise der cognitio intuitiva erkennen, sagt Spinoza, "daran<br />
erfreuen wir uns, indem nämlich die Idee Gottes uns gleichsam<br />
das Geleit gibt"46. Die entspringende Freude (Laetitia) nennt Spinoza<br />
Amor Dei intellectualis, zugleich erklärend: der Amor Dei<br />
intellectualis bedeutet die Er<strong>kennt</strong>nis, I dass Gott unveränderlich<br />
und ewig ist.47 In dieser Liebe zu Gott besteht für den Menschen<br />
das höchste Gut; sie bringt die höchste Befriedigung des Geistes. 48<br />
Je mehr Einzeldinge der Mensch mit der Scientia intuitiva er<strong>kennt</strong>,<br />
sie, wie Spinoza sagt, sub specie aeternitatis betrachtend, deso mehr<br />
wächst im Menschen selbst das Teilhaben am Ewigen, das Göttliche.<br />
Denn der daraus entspringende Amor Dei intellectualis ist<br />
selber Teil Gottes, Teil der göttlichen Liebe. 49 Unter dem Gesichtspunkt<br />
der Ewigkeit betrachten wir die Dinge, wenn wir sie <strong>nicht</strong><br />
"in Bezug auf Zeit und Raum", sondern "als in Gott enthalten,<br />
und aus der Notwendigkeit (necessitas) der göttlichen Natur folgend<br />
begreifen."<br />
Diese Lehre vom Amor Dei intellectualis, mit der das letzte Buch<br />
<strong>von</strong> Spinozas ETHIK in mächtiger Steigerung ausklingt, hat die stärk-<br />
46 ETHIC. T. V, Prop. 32.]: "Quicquid intelligimus tertio cognitionis genere, eo delectamur,<br />
et quidem concomitante idea Dei, tanquam causa.<br />
47 ETHIC. T. V, Zusätze zu Prop. 32: ". .. Laetitia concomitante idea Dei, tanquam causa,<br />
hoc est, Amor Dei, non quatenus ipsum ut praesentem imaginamur; sed quatenus<br />
Deum aeternum esse intelligimus, et hoc est, quod amorem Dei intellectualern<br />
voco.[ ... ]Laetitia in transitione ad majorem perfectionem consistit, beatitudo<br />
sane in eo consistere debet, quod Mens ipsa perfectione sit praedita."<br />
48 ETHIC. T. V, Demonstr. zu Prop. 20:"Hic erga Deum Amor summum bonum est, quod es<br />
dictamine rationis appetere possumus ... " Prop. 27: "Ex hoc tertio cognitionis genere<br />
summa quae dari potest, Mentis acquiescentia oritur ... " Demonstr.: Summa Mentis<br />
virtus est Deum cognoscere [ ... ] quae quidem virtus eo major est, quo Mens hoc cogni<br />
tionis genere magis res cognoscit; adeoque qui res hoc cogni tionis genere COgnOSCI t,<br />
is adsummam humanam perfectionem transit, etconsequenter, summa Laetztla afflCltur,<br />
idqueconcomitante idea sui, suaeque virtutis, ac proinde ex hoc cognitionis genere<br />
summa, quae dari potest, oritur acquiescentia; vgl. auch Demonst. zu Prop 32.<br />
49 ETHIC., T. V, Prop. 36: "Mentis Amor intellectualis erga Deum est ipse Dei Amor,<br />
quo Deus se ipsum amat, non quatenus infinitus est, sed qua.tenus per essenharn<br />
humanae Mentis, sub specie aeternitatis consideratam, exphcan po test, hoc est,<br />
Mentis erga Deum Amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo Deus se ipsum amat."<br />
Vgl. auch Prop. 29 mit Zusätzen.<br />
232<br />
sten Wirkungen ausgeübt. Keine ist aber auch so verkannt worden,<br />
da man ihren eigentlichen Charakter zuwenig beachtete. Sehr<br />
zu Unrecht hat man sie mit christlicher Mystik verglichen, ja sogar<br />
darin ein Zugeständnis ans Christentum sehen wollen. Soweit mit<br />
der Liebe zur Gott-Natur ein gewisses Gefühlsmoment die sonst<br />
so wissenschaftliche Er<strong>kennt</strong>nislehre Spinozas ergänzt, handelt es<br />
sich keineswegs um ein verschwommen religiöses, christlich auf<br />
Jenseitiges gerichtetes Gefühl. Derartiges, wie es im 18. Jahrhundert<br />
die Gefühlslehren Lavaters, Hamann1?, Jacobis, Schleiermachers<br />
boten, konnten die Klassiker <strong>nicht</strong> mehr akzeptieren. Es war gerade<br />
die Nicht-Christlichkeit, die Übereinstimmung mit antiker Weltsicht,<br />
durch die Spinozas Amor Dei intellectualis, wie alle seine<br />
Lehren, so befreiend wirkte.<br />
Die Nicht-Christlichkeit erweist sich schon durch die Art und<br />
Weise, wie Spinoza selbst das den Amor Dei intellectualis bestimmende<br />
Gefühl kennzeichnet: er nennt es ja Laetitia, Freude,<br />
und diese Laetitia ist Freude am Diesseits, an der Welt der Dinge,<br />
deren Wert sie <strong>nicht</strong> aufhebt, sondern betont und erhöht. Dies wird<br />
allzu oft übersehen, <strong>nicht</strong> berücksichtigt aber auch, welche Rolle<br />
der Begriff der Laetitia sonst in Spinozas Philosophie spielt. Laetitia<br />
ist der einzige Affekt, den Spinoza ganz positiv bewertet. Durch<br />
Laetitia "geht der Geist zu größerer Vollkommenheit über", während<br />
Tristitia, Traurigkeit, ihn unvollkommener macht. 50 "Von je<br />
mehr Laetitia wir erregt werden, zu desto größerer Vollkommenheit<br />
gehen wir über, und um so mehr sind wir folglich der göttlichen<br />
Natur teilhaftig." Nur "Aberglauben" betrachtet Tristitia als<br />
etwas Gutes. 51 Mit alledem wird spürbar gegen christliche Auffas-<br />
50 ETHIC., T. III, Schol. zu Prop. 11: " ... Per Laetitiam itaque in sequentibus intelligarn<br />
passionem, qua Mens ad majorem perfectionem transit. Per Tristitiam autem passionem,<br />
qua ipsa ad minorem transit perfectionem. = Unter Lust verstehe ich also im Folgenden<br />
die Leidenschaft, wodurch der Geist zu grässerer Vollkommenheit übergeht, unter<br />
Ul1lust aber die Leidenschaft, wodurch er zu geril1gerer Vollkommel1heit übergeht." Ahnlich<br />
an zahlreichen Stellen.<br />
5'1 ETHIC., T. IV, Append, $ 31: At superstitio id contra videtur statuere bonum esse,<br />
quod Tristitiam, ed id contra malum, quod Laetitiam affert. Sed, ut jam diximus<br />
(vid e Schol. Prop. 45. p.4) nemo, ni si invidus, mea impotentia, et incommodo delecta<br />
tur. Nam quo majori Laetitia afficimur, eo ad majorem perfectionem transi-<br />
233
TIeck": "Man müßte nur sagen mit allem Gleichmut, wir sind betrübt<br />
über der Herren ihre Traurigkeit!"54 Zu den Romantikern,<br />
denen die Laetitia fehlt, zählte Goethe auch Heinrich <strong>von</strong> Kleist,<br />
obwohl er hier <strong>nicht</strong> genannt wird. Goethes tiefe Abneigung gegen<br />
diesen,den Konvertiten Adam Müller und Friedrich Schlegel<br />
nahestehenden Dichter resultierte zum guten Teil aus der Kleistschen<br />
'Tristitia'. So tadelte Goethe an ihm die "nordische Hypochondrie",<br />
das einseitige Aufsuchen des "Unschönen in der Natur",<br />
um demgegenüber die "Heiterkeit" und "fröhlich bedeutsame<br />
Lebensbetrachtung" italienischer Novellen zu loben.55 Auch hier<br />
bildete Spinozas Wertung der 'Laetitia' den Maßstab. Kleists Tristitia'<br />
war für Goethe ein Zeichen des Nichtverstehens der Gott<br />
Natur. Goethes provozierendes Diktum gegenüber Eckermann,<br />
Klassik sei das Gesunde, Romantik das Kranke 56 , erscheint gleichfalls<br />
im Hinblick auf Spinozas Laetitia in anderem Licht. Das "Ge-<br />
54 Ebd. S. 229.<br />
55 In dem berühmt gewordenen Gesprächsbericht Joh. Daniel Falks <strong>von</strong> Ende<br />
1810:"Goethe tadelt an ihm [Kleistl die nordische Schärfe des Hypochonders; es<br />
sei einem gereiften Verstande unmöglich, in die Gewaltsamkeit solcher Motive, wie<br />
er sich ihrer als Dichter bediene, mit Vergnügen einzugehen. Auch in seinem >Kohlhaas
Gotteslust",,,heilige Liebeslust" am Schluß <strong>von</strong> FAUST 11, überhaupt<br />
die gesamte Schlußszene "Bergschluchten" sind Darstellungen der<br />
Laetitia des Amor Dei intellectualis. Das gleiche gilt vom Schluß<br />
der KLASSISCHEN WALPURGISNACHT in FAUST, <strong>von</strong> manchen berühmten<br />
Gedichten, besonders im DIVAN. Im Sinne des Amor intellectualis<br />
Dei feierten auch der junge Schiller oder Hölderlin die Natur als<br />
"göttliche Geliebte". Bei Hölderlin wird allerdings, anders als bei<br />
Goethe, vom Amor Dei intellectualis überall gesprochen. Hyperions<br />
Verehrung des Eins und Alles, der Natur, der Elemente, des<br />
Göttlichen im Menschen gehören hierzu, so aber auch vieles in<br />
Oden, Elegien, Hymnen, im EMPEDOKLES. Wenn beim späten Hölderlin<br />
die Freude - bis hin zur FRIEDENSFEIER - immer intensiver<br />
vergeistigte Bedeutung bekommt, so steht das in Übereinstimmung<br />
mit Spinozas Laetitia. 60<br />
Auch Sc hell in g und Friedrich Sc h 1 e gel begeisterten sich in ihrer<br />
Jugend für den Amor Dei intellectalis. Alle drei sprachen dann gern<br />
<strong>von</strong> "intellektualer Anschauung". Schelling fand in der intellektualen<br />
Anschauung den "höchsten Punkt <strong>von</strong> Spinozas System", womit<br />
die hervorragende Bedeutung des fünften, abschließenden Teils<br />
der Ethik rechtens anerkannt ist. Den Terminus "intellektuale Anschauung"<br />
leitete Schelling ab aus Spinozas "intelligendo concipere"<br />
sowie "Mentis erga Deum amor intellectualis" - Wendungen, welche<br />
Schelling den Ausruf entlockten: "Was geht über die stille Wonne<br />
dieser Worte, das Hen kai pan unsres besseren Lebens."61 Nach<br />
Hölderlin lag intellektuale Anschauung auch der griechischen Tragödie<br />
zugrunde, womit deren religiöses Fundament auf moderne<br />
Weise gedeutet wurde. (ÜBER DEN UNTERSCHIED DER DICHTARTEN.)<br />
60 In einem Brief Hölderlins an seinen Bruder Karl <strong>von</strong> 1801 wird der Begriff vom<br />
unpersonalen Gott definiert im Anschluß an Spinoza, nämlich ganz wie bei Lessing<br />
unter Hinweis auf das Hen kai pan: "Alles unendliche Einigkeit, aber in diesem<br />
Allem ein vorzüglich Einiges und Einigendes, das, an sich, kein Ich<br />
ist, und dieses sei unter uns Gott!" (StA VI 419.)<br />
61 Die Stellen: ETHIC. T. V, Schol. zu Prop. 23; Prop. 36. - Schellings Schriften VOM IcH<br />
ALS PRINZIP DER PHILOSOPHIE (.1795) und PHILOSOPHISCHE BRIEFE ÜBER DOGMATISMUS UND<br />
KRITIZISMUS (1796). Hen kai pan wal' spinozistische Losung unter den Freunden<br />
Hölderlin, Schelling und Hegel.<br />
238<br />
Durch den Gesichtspunkt des Amor Dei intellectualis wurde<br />
der Realismus Spinozas für die Dichter ebenso förderlich, wie der<br />
zur Vorherrschaft gelangte Idealismus Kants sie behinderte. Diese<br />
Problematik offenbarte sich dem Scharfblick des genialen jungen<br />
Friedrich Schlegel. 1800 sprach er darüber im ATHENAEUM, diplomatisch<br />
und doch provozierend genug. Sein GESPRÄCH ÜBER DIE POE<br />
SIE, das noch <strong>von</strong> Goethe sehr geschätzt wurde, enthält eine große<br />
Lobrede auf Spinoza.62 Schlegel macht aufmerksam auf den Wert<br />
der Hauptlehren Spinozas für den modernen Dichter. Die Scientia<br />
intuitiva regt die anschauende Phantasie an, bewirkt zugleich, "daß<br />
wir uns wegen des Höchsten <strong>nicht</strong> so ganz allein auf unser Gemüt<br />
verlassen". Der Amor Dei intellectualis vermag den "Funken des<br />
Enthusiasmus" zu entzünden, den Dichtung benötigt. Übrigens<br />
müsse jedes Kunstwerk eine "neue Offenbarung der Natur" sein.<br />
"Nur dadurch, daß esEins und Alles ist, wird ein Werk zum Werk."<br />
Spinoza hinstellend als Lehrer eines "neuen Realismus", sagt Schlegel<br />
ferner: "Ieh begreife kaum, wie man ein Dichter sein kann, ohne<br />
den Spinoza zu verehren, zu lieben und ganz der seinige zu werden.[<br />
... ] Im Spinoza findet <strong>Ihr</strong> denAnfang und das Ende aller Phantasie,<br />
den allgemeinen Grund und Boden, auf dem Euer Einzelnes<br />
ruht [ ... ] Ergreift die Gelegenheit und schaut hin! Es wird Euch ein<br />
tiefer Blick in die innerste Werkstätte der Poesie gegönnt."<br />
Eine kühne Vision steht als Möglichkeit vor Schlegels Blick: es<br />
werde eine neue Poesie kommen, in der sich der "grenzenlose<br />
Realismus" Spinozas mit dem neuen philosophischen Idealismus<br />
vereine. Unter Anspielung auf antike Mythen vergleicht Schlegel<br />
Spinoza mit dem Urgott Saturn, der <strong>von</strong> seinem Sohn Jupiter der<br />
62 ATHENAEUM. Eine Zeitschrift <strong>von</strong> August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel.<br />
Dritten Bandes Erstes Stück. Berlin 1800 (Reprint Berlin 1960) S. 94 ff.: REDE ÜBER<br />
DIE MYTHOLOGIE. Dort heißt es u.a.: "Spinosa, scheint mil'S, hat ein gleiches Schicksal,<br />
wie der gute alte Saturn der Fabel. Die neuen Götter haben den Herrlichen<br />
vom hohen Thron der Wissenschaft herabgestürzt. In das heilige Dunkel der Fantasie<br />
ist er zurückgewichen, da lebt und haust er nun mit den andern Titanen in<br />
ehrwürdiger Verbannung. [ ... ] ich begreife kaum, wie man ein Dichter seyn kann,<br />
ohne den Spinosa zu verehren, zu lieben und ganz der seinige zu werden [. .. ] Im<br />
Spinosa [ ... ] findet <strong>Ihr</strong> den Anfang und das Ende aller Fantasie, den allgemeinen<br />
Grund und Boden, auf dem Euer Einzelnes ruht .. . "<br />
239
Herrschaft beraubt worden war: "Spinoza, scheint mirs, hat ein<br />
gleiches Schicksal wie der gute alte Saturn der Fabel. Die neuen<br />
Götter [des Idealismus] haben den Herrlichen vom Thron der<br />
Wissenschaft herabgestürzt. In das heilige Dunkel der Phantasie<br />
ist er zurückgewichen, da lebt und haust er nun mit den andern<br />
TItanen in ehrwürdiger Verbannung." In der Kunst aber, der "neuen<br />
Poesie", die Realismus und Idealismus vereine, werde die "Erinnerung<br />
an die alte Herrschaft" wachbleiben. Von Saturn-Spinoza<br />
wird abschließend gesagt: "Er teile dann die Wohnung im Tempel<br />
der neuen Poesie mit Homer und Dante und geselle sich zu den<br />
Laren und Hausfreunden jedes Gottbegeisterten Dichters."63<br />
An anderer Stelle nennt Schlegel Spinozas Philosophie geradezu<br />
"die Mysterien des Realismus" und fügt hinzu: in ihr liege der<br />
"Urquell aller Poesie". Eigentlich müsse man "den Geist des Spinoza"<br />
und seines Realismus in einem großen Dichtwerk darstellen.<br />
Dazu bedürfte es jedoch eines neuen Dante. Möglicherweise hatte<br />
Schlegel gehört, dass Goethe sich soeben mit dem Projekt eines<br />
solchen großen "Naturgedichts" beschäftigte.<br />
Als Altertumskenner spricht Schlegel, wenn er ferner auf Spinoza<br />
eine "neue Mythologie" begründet sehen möchte, eine Mythologie,<br />
die ein "Kunstwerk der Natur" sei. Dahinter steht die<br />
Er<strong>kennt</strong>nis, die Schlegel mit den Klassikern gemein hat: die Mythologie<br />
der Griechen, ihre Vergöttlichung der Natur- und Lebensmächte,<br />
hatte zur Voraussetzung ein ganz ähnlich lebendiges,<br />
ehrendes Verhältnis zur Welt, wie es in Spinozas Lehre vom Amor<br />
Dei intellectualis wiederkehrt. Auf letztere deutend sagt Schlegel:<br />
"Mythologie ist ein hieroglyphischer Ausdruck der umgebenden<br />
Natur in dieser Verklärung <strong>von</strong> Phantasie und Liebe." Schlegel war<br />
sich bewußt, wie zwischen dem Verständnis der griechischen<br />
Mythologie und Spinoza ein enger Zusammenhang bestand, dass<br />
63 Vielleicht wurde Hölderlins schwer deutbare Ode NATUR UND KUNST oder SATURN<br />
UND !UPITER, gedichtet bald nach dem Erscheinen <strong>von</strong> Schlegels Aufsatz, angeregt<br />
durch diese Version des Saturn-Mythos. Die Wendung »heilige Dämmerung« im<br />
Schlußvers erinnert an Schlegels "heiliges Dunkel". Vgl. auch Herder in der Schrift<br />
Gon (SWS 16, 492): "Ich wünschte, daß andre auf dem Wege tapfer fortschreiten<br />
mögen, für welchen Spinoza in seiner Dämmerung die Bahn brach."<br />
240<br />
jene durch den Philosophen erklärt, Spinoza selbst hierdurch aktuell<br />
geworden war. "Versucht es nur einmal", so ruft er den Dichtem<br />
zu, "die alte Mythologie voll vom Spinoza und <strong>von</strong> jenen Ansichten,<br />
welche die jetzige Physik in jedem Nachdenkenden erregen<br />
muß, zu betrachten, wie Euch alles in neuem Glanz und Leben<br />
erscheinen wird." Die Aufforderung, eigentlich konform gehend<br />
mit dem, was die Klassik soeben geleistet hatte, ist bedeutungsvoll<br />
vor allem, weil zum erstenmal auf die Verbindung zwischen Mythologie<br />
und Spinoza-Rezeption hingewiesen war. An Leistungen der<br />
Klassik denkt Schlegel auch mit dem Verweis auf die "jetzige Physik"<br />
- der größte "Physiker" war für die Frühromantiker Goethe. 64<br />
Schlegel beendet seine Spinoza-Lobrede mit den Worten: "Ich kann<br />
<strong>nicht</strong> schließen, ohne noch einmal zum Studium der Physik aufzufordern,<br />
aus deren dynamischen Paradoxien jetzt die heiligsten<br />
Offenbarungen der Natur <strong>von</strong> allen Seiten ausbrechen."<br />
Dass Spinoza selbst der Mythologie <strong>nicht</strong> gerade Vorschub leistet,<br />
indem er den Polytheismus ablehnte, konnte Schlegel sowenig<br />
irritieren wie die Klassiker. Insgesamt ließ die ETHIK sehr große Freiheit,<br />
z. B. durch die Lehre <strong>von</strong> den unendlichen Attributen der Gott<br />
Natur. Gerade diese Freiheit wirkte auf die Dichter erlösend und<br />
inspirierend. So konnte Goethe <strong>von</strong> sich sagen, er sei als Dichter<br />
und Künstler Poly theist, als Naturforscher Pantheist, als Persönlichkeit<br />
und sittlicher Mensch Monotheist. 65 All das ließ sich mit<br />
der Lehre Spinozas vereinen.<br />
Der Amor Dei intellectualis führt die Menschen deswegen zur<br />
Annäherung an die Gott-Natur, weil er einen seelischen Zustand<br />
herbeiführt, wie er in Vollkommenheit Gott selbst eigen ist. Er befreit<br />
nämlich <strong>von</strong> der Herrschaft der Affekte. "Je mehr der Geist<br />
64 "Goethe der erste Physiker seiner Zeit." Novalis ScHRIFTEN. Hg. <strong>von</strong> Richard Samuel.<br />
Bd 2. Darmstadt, 1965, S. 640.<br />
65 Maximen und Reflexionen Nr. 807: "Wir sind naturforschend Pantheisten, dichtend<br />
Poly theisten, sittlich Monotheisten." (SchrGG 21, S. 179). An F. H. Jacobi<br />
schrieb Goethe am 6. Jan. 1813: "Ich für mich kann [ ... ] <strong>nicht</strong> an einer Denkweise<br />
genug haben; als Dichter und Künstler bin ich Poly theist, Pantheist hingegen als<br />
Naturforscher [ ... ] Bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit, als sittlicher<br />
Mensch, so ist dafür auch schon gesorgt."<br />
241
als Fehler angerechnet werden könne, die Gesetze und Regeln, nach<br />
welchen Formen in Formen verwandelt werden, sind immer die<br />
gleichen.89<br />
Nicht Unterdrückung aller, sondern Einschränkung der schlechtenAffekte<br />
ist Ziel des Menschen. "Schlecht" und "gut" sind theoretisch<br />
für Spinoza freilich nur "Denkformen". (An diese Lehre schloß<br />
sich Nietzsehe an.) Da Spinoza jedoch bestrebt ist, ein "Muster der<br />
menschlichen Natur aufzustellen" - wie nahe steht das dem Ziele<br />
der Klassik! - erklärt er praktisch den Begriff "gut" dahingehend,<br />
dass es ein Mittel sei, uns dem "Muster mehr und mehr zu nähern".<br />
"Schlecht" ist, was solche Annäherung hindert.90 In der Entscheidung<br />
zwischen gut und schlecht betätigt sich der Wille des<br />
Menschen, bejahend oder verneinend. Unter Wille versteht Spinoza<br />
allein "die Fähigkeit des Bejahens und Verneinens", <strong>nicht</strong> das<br />
Begehren <strong>von</strong> Dingen.91 Damit ist Wollen Sache der Einsicht, Er<strong>kennt</strong>nis,<br />
Vernunft. Eine zentrale Formulierung lautet geradeswegs:<br />
"Wille und Einsicht (intellectus) sind einunddasselbe."92 Hier aber<br />
liegt die Determiniertheit des Willens durch Naturgesetze verankert.<br />
Das Wollen ist abhängig vorn Maß der Einsicht, das die Natur<br />
verlieh, gerade in dieser Hinsicht sind die Menschen verschieden<br />
ausgestattet: "Jeder verlangt oder verschmäht nach den Gesetzen<br />
seiner Natur notwendig das, was er für gut oder für schlecht hält. "93<br />
"Ich bestreite", sagt Spinoza, "dass der Wille sich weiter erstreckt<br />
als das Auffassungsvermögen oder die Fähigkeit des Erkennens."94<br />
Bei aller Determiniertheit des Willens durch das dem Menschen<br />
<strong>von</strong> Natur mitgegebene Verhältnis zu den Affekten, durch das ihm<br />
verliehene Maß der Einsicht vor allem, bleibt doch ein gewisser<br />
Spielraum, wodurch Freiheit gegenüber den Affekten erweitert<br />
werden kann. Einsicht läßt sich steigern. Ja, das Streben nach Meh-<br />
89 Vgl. oben S. 230 mit Anm. 42.<br />
90 ETHIC T. IV, Vorwort.<br />
91 ETHIC T. 11, Schol. zu Prop. 48.<br />
92 ETHIC T. 11, Coroll. zu Prop. 49.<br />
93 ETHIC T. IV, Prop. 19.<br />
94 ETHIC T. 11, Schol. zu Prop. 49.<br />
250<br />
rung der Einsicht ist dem Menschen aufgegeben, auch dies gehört<br />
zum "Gesetz seiner Natur". Im 4. Teil der ETHIK führt Spinoza den<br />
Begriff der Vervollkommnung ein. Wo Vervollkommnung möglich<br />
ist, herrscht Bewegungsfreiheit. Der 4. Teil, mit dem bezeichnenden<br />
Titel DE SERVITUTE HUMANA, geht <strong>von</strong> der Feststellung aus, dass die<br />
wahre "Knechtschaft" der Menschen darin besteht, dass sie ihre<br />
Affekte <strong>nicht</strong> mäßigen, <strong>nicht</strong> einschränken können. "Frei" wären<br />
sie, wenn sie nur <strong>von</strong> der Vernunft geleitet würden. Wege werden<br />
dann gezeigt, wie der Mensch durch "Erkennen" wirklich "frei"<br />
sein, d. h. seine Affekte mäßigen kann. Der Satz "nach Leitung der<br />
Vernunft handeln" bildet das Leitthema. Von der Vernunft geleitet<br />
werden, diese Devise betrachtet Spinoza als identisch mit vielem<br />
Positivem, in erster Linie mit Erkennen (intellegere), aber auch mit<br />
"aus Tugend handeln", mit tätiger Nächstenliebe, Vollbringen guter<br />
Werke usw. Das Erkennen gipfelt in der Cognitio Dei intuitiva,<br />
der Er<strong>kennt</strong>nis Gottes, die damit ein wichtigster Schritt zur Befreiung<br />
<strong>von</strong> den Affekten ist.<br />
Bedeutsam ist eine weitere Gleichsetzung, wonach Spinoza das<br />
"<strong>von</strong> der Vernunft geleitet werden" versteht als das "Suchen des<br />
wahrhaft Nützlichen", letzteres aber erklärt als das Streben, "sein<br />
Sein zu erhalten".95 Die Formel "sein Sein erhalten" (suum esse<br />
conservare) wird leicht mißverstanden, als bezöge sie sich nur<br />
auf die Bewahrung der körperlichen Existenz. Spinoza meint aber<br />
zugleich und vor allem: Erhaltung der jeweiligen Seinsstufe, die<br />
dem Menschen durch Gesetz seiner Natur angewiesen wurde. Es<br />
gibt auch ein Sterben bei lebendigem Leibe, wenn der Mensch seelisch<br />
und geistig verkümmert, <strong>nicht</strong> mehr er selbst ist, hinter dem<br />
Gesetz seiner Natur zurückbleibt.96 Herders Horen-Aufsatz DAS EI<br />
GENE SCHICKSAL (1795) handelt <strong>von</strong> dieser Art Sterben. Nur durch<br />
Bezug auf die Seinsstufe läßt sich die Gleichsetzung <strong>von</strong> suum esse<br />
conservare mit "nach Leitung der Vernunft handeln" begreifen.<br />
Goethes Verse "Allen Gewalten / Zum Trutz sich erhalten"97 deu-<br />
95 ETHIC. T. IV, Schol. zu Prop. 18; Prop. 24.<br />
96 ETHIC T. IV, Scho l. zu Prop. 39.<br />
97 L ILA (1 777) 2. Au fzug / Magus. (WA 112, 62)<br />
251
ten auf den allgemeineren Aspekt der Seinsbewahrung. Von Bewahrung<br />
der geistigen Seinsstufe handelt das ganz an Spinoza orientierte<br />
Gedicht BEHERZIGUNG (1789): "Eines schickt sich <strong>nicht</strong> für alle!<br />
... Sehe jeder, wo er bleibe, / Und wer steht, daß er <strong>nicht</strong> falle!"98<br />
Alles Handeln nach der Vernunft indessen, alle Einsicht, selbst<br />
das Erkennen Gottes als solches genügt noch <strong>nicht</strong>, um das Ziel<br />
größtmöglicher Befreiung <strong>von</strong> Affekten zu erreichen. Es dient lediglich<br />
der Vorbereitung. Den Satz, dass Wille und Einsicht dasselbe<br />
sind, ergänzt Spinoza durch den fundamentalen Gedanken: ein<br />
Affekt kann nur durch einen andern, stärkern Affekt aufgehoben<br />
werden. So kann auch die" wahre Er<strong>kennt</strong>nis des Guten und Schlechten"<br />
als solche Affekte <strong>nicht</strong> einschränken, sondern nur, insofern sie<br />
selbst zu einem Affekt wird, stärker als die einzuschränkenden<br />
Affekte".99) Im V. Teil der ETHIK, betitelt ÜBER DIE MACHT DER ERKENNT<br />
NIS, ODER DIE MENSCHLICHE FREIHEIT, wendet Spinoza diesen Grundgedanken<br />
auf die Er<strong>kennt</strong>nis an. Gezeigt wird, wie Er<strong>kennt</strong>nis zum<br />
Affekt, die immer reinere Er<strong>kennt</strong>nis zum immer stärkeren Affekt<br />
(die niederen übertreffend) werden kann. Souveränster aller Affekte,<br />
fähig alle andern zu beruhigen, ist die zum Amor Dei intellectualis<br />
gewordene Er<strong>kennt</strong>nis Gottes. Damit ist, wie es am Schluß<br />
der ETHIK heißt, die eigentliche Freiheit, im Sinne der Acquiescentia<br />
animi erreicht. Der volle Sinn der Acquiescentia in se ipso, wo<strong>von</strong><br />
schon früher die Rede war 100 , ergibt sich erst aus dem genaueren<br />
Verfolg <strong>von</strong> SpinozasAffektenlehre. Die mit dem Amor Dei intellectualis<br />
erreichte Freiheit ist die höchste dem Menschen mögliche, sie<br />
ähnelt ihn dem affektlosen Zustand der Gott-Natur an.<br />
In allen Phasen seiner Argumentation über Will e n s fr e i h e i t<br />
bleibt Spinoza Psychologe und Realist, indem er die natürliche Ungleichheit<br />
der Menschen berücksichtigt. Dies bestimmt seinen<br />
Determinismus. Immer wieder weist er darauf hin, wie ver-<br />
98 "Ach, was soll der Mensch verlangen?" (WA 11,65) Vgl. auch ZUR FARBENLEHRE,<br />
Kap. Newtons Persönlichkeit: "Jedes Wesen, das sich als eine Einheit fühlt, will sich<br />
in seinem eigenen Zustand ungetrennt und unverrückt erhalten. Dies ist eine ewige<br />
notwendige Gabe der Natur."<br />
99 ETHIc. T. IV, Prop. 7; Prop. 14 mit Demonstr.<br />
100 Vgl. oben 5.242 m. Anm. 67.<br />
252<br />
schieden die Menschen sind. "Sofern sie <strong>von</strong> Affekten bestürmt<br />
werden, weichen sie <strong>von</strong>einander ab", stimmen "<strong>von</strong> Natur <strong>nicht</strong><br />
überein", sind überhaupt "veränderlich und unbeständig".lol Von<br />
der" Vernunft geleitet" werden, ist als Möglichkeit zwar "allen<br />
Menschen gemeinsam", doch schränkt Spinoza den Satz realistisch<br />
ein: es sei "ein Gut, das <strong>von</strong> allen Menschen, sofern sie gleicher Natur<br />
sind, in gleicher Weise besessen werden kann".102<br />
Als Psychologe und Realist erweist Spinoza sich auch in der<br />
Art, wie er formuliert, was Kant nachmals im Kategorischen Imperativ<br />
ausdrückte. Wiederholt kehrt im IV. Teil der ETHIK der Satz<br />
wieder: Wer nach Leitung der Vernunft lebt, verlangt für sich <strong>nicht</strong>s,<br />
was er <strong>nicht</strong> auch für andere Menschen begehrte. Bei dieser für<br />
das gesellschaftliche Leben so wichtigen Lehre läßt Spinoza <strong>nicht</strong><br />
die Wirklichkeit außer Acht. Er weist auf die Unterschiede des Menschen,<br />
auf die Schwere der Aufgabe, nennt die Voraussetzung für<br />
ihre Erfüllung. Indem Kant die gleiche Lehre als "Imperativ" für<br />
alle gültig vorträgt, ist er formal berechtigt, <strong>von</strong> Erfahrungstatsachen<br />
- die er <strong>kennt</strong> - abzusehen. So aber entsteht die Fiktion, als<br />
sei jeder imstande, sich zu verhalten wie der <strong>von</strong> der Vernunft Geleitete,<br />
um so mehr, als Kant in diesem Zusammenhang die Autonomie<br />
des Willens betont. Das war populär und erfolgreich. Doch<br />
hat man oft auch die Enge der Kantischen Lehre empfunden, das<br />
"Mönchische", wie Schiller kritisierte. 103 Gerade beim Vergleich mit<br />
Spinozas WeItblick schmeckt der Kategorische Imperativ ein wenig<br />
zu sehr nach preußischem Drill und Kasernenhof.<br />
Psychologischer Realismus liegt insbesondere Spinozas Lehre<br />
zugrunde, dass Affekte nur durch stärkere Affekte eingeschränkt<br />
werden können, dass mithin selbst die Erlangung eigentlicher Freiheit<br />
nur durch einen sublimsten Affekt (den Amor intellectualis<br />
Dei) erreichbar ist. Noch hier bleibt Spinoza Determinist, indem er<br />
die Veranlagung des Menschen als maßgeblichen Faktor sieht. Der<br />
101 ETHIc. T. IV, Prop. 32-34.<br />
102 ETHIc. T. IV, Demonstr. zu Prop. 36.<br />
103 "Kants Entwicklung [vom freien Willen) ist mir gar zu mönchisch, ich habe nie<br />
damit versöhnt werden können." Schiller an Goethe, 2. August 1799; ähnlich 22.<br />
Dezember 1798.<br />
253
Amor Dei intellectualis setzt eine entsprechende Mitgift der Natur<br />
voraus, einen "besonders befähigten Geist", bzw. einen "zu sehr<br />
vielen Dingen befähigten Körper".l04 Determiniert ist aber auch<br />
das aus dem Amor Dei intellectualis folgende Streben nach "Verwandlung",<br />
das Bemühen, den Geist zu immer höherem Bewußtund<br />
Tätigsein anzutreiben, worin wir den Schlüssel zu Fausts tätigem<br />
Bemühn erkannten.105 Solche Verwandlungen sind gleichfalls<br />
nur möglich, "soweit es die Natur des Körpers zuläßt und ihm<br />
zuträglich ist".l06 Aus den letzten Sätzen der ETHIK geht hervor, wie<br />
wenige Menschen Spinoza solcher Entwicklung für fähig hält. Nur<br />
die Weisen erlangen "Macht über die Affekte", "Freiheit des Geistes",<br />
sind den "Unwissenden" dadurch weit "überlegen". Fast <strong>von</strong><br />
allen wird das Heil vernachlässigt. "Aber alles Erhabene", damit<br />
schließt Spinoza, "ist ebenso schwierig wie selten."<br />
Welche Bedeutung für Goethe die Affektenlehre Spinozas hatte,<br />
geht daraus hervor, dass sie in seiner Darstellung <strong>von</strong> Spinozas<br />
Lehre im 16. Buch <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT eine zentrale Stellung<br />
einnimmt, wobei die Einzelheiten, trotz aller Einkleidung, aus<br />
dem Wortlaut erkennbar sind, was die Kommentatoren <strong>nicht</strong> weiter<br />
beachtet haben. Den Gedanken, dass ein Affekt nur durch einen<br />
anderen, stärkeren abgelöst werden kann, umschreibt Goethe<br />
so: der Mensch ist "fähig, dem Einzelnen in jedem Augenblick zu<br />
entsagen, wenn er nur im nächsten Moment nach etwas Neuem<br />
greifen darf [ ... ] Wir setzen eine Leidenschaft an die Stelle der andem<br />
[ ... ] um zuletzt auszurufen, daß alles eitel sei".107 Auf die generelle<br />
Befreiung <strong>von</strong> den Affekten durch die Cognitio Dei intuitiva<br />
deutet Goethe mit dem Ermahnen, "sich <strong>von</strong> dem Ewigen, Notwendigen,<br />
Gesetzlichen [d.i. deus sive natural solche Begriffe zu<br />
bilden, welche unverwüstlich sind", diese Begriffe bestätigt zu finden<br />
durch "Betrachtung des Vergänglichen". Nur so kann es gelin-<br />
104 ETHIC. T. V, Prop. 26 und 39.<br />
105 Vg!. oben 5.237 m. Anm. 58.<br />
106 ETHIC. T. V, Seho!. zu Prop. 39.<br />
107 Eine Anspielung auf des Pred. Salomonis "a II es ist ei te I" findet sich auch in<br />
der ETHIK im gleichen Zusammenhang: T.v, Seho!. zu Prop. 10.<br />
254<br />
gen, "allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein- für<br />
allemal im Ganzen zu resignieren". Dies Ziel ist für Goethe wie<br />
für Spinoza "nur wenigen" erreichbar, in deren Leistung dann<br />
wahrhaft "etwas Übermenschliches liegt".<br />
Spinozas Ablehnung der Willensfreiheit war die Lehre, die<br />
sich auch bei den Klassikern am schwersten, am wenigsten einheitlich<br />
durchsetzte. Haupthindernis bildete ihre Diskreditierung<br />
durch Kant. Noch für Lessing war es, in der Frühzeit <strong>von</strong> Spinozas<br />
Einwirkung, <strong>nicht</strong> schwer, sich zu dessen Determinismus zu<br />
bekennen. In dem historischen Pantheismusgespräch sagte Lessing<br />
1780 zu dem sich vor Spinozas "Fatalismus" bekreuzigenden ]acobi:<br />
"Ich merke, Sie hätten gern <strong>Ihr</strong>en Willen frei. Ich begehre keinen<br />
freien Willen." In ähnlichem Sinne deterministisch hatte Lessing<br />
sich schon 1776 ausgesprochen im Begleitschreiben zur<br />
Ausgabe der Philosophischen Aufsätze ]erusalems, des Spinoza<br />
Anhängers, dessen Selbstmord eine Hauptanregung zum WERTHER<br />
gab: "Was verlieren wir, wenn man uns die Freiheit abspricht? Etwas<br />
[ ... ] was wir <strong>nicht</strong> brauchen [ ... ] Zwang und Notwendigkeit,<br />
nach welchen die Vorstellung des Besten wirket, wieviel willkommner<br />
sind sie mir, als kahle Vermögenheit, unter den nämlichen Umständen<br />
bald so, bald anders handeln zu können! Ich danke dem<br />
Schöpfer, daß ich muß, das Beste muß." etc.<br />
Von Lessing stammt' andererseits das berühmte Diktum aus<br />
NATHAN DER WEISE: "Kein Mensch muß müssen." Dass auch dieses<br />
Wort an seiner Stelle <strong>nicht</strong> so indeterministisch gemeint ist, wie es<br />
klingt, brauchen wir hier <strong>nicht</strong> weiter zu verfolgen. Wohl aber darf<br />
an einen Goetheschen Aphorismus erinnert werden, der sich gerade<br />
mit jenem Wort Lessings befaßt. In ihm haben wir einen Beweis,<br />
wie Goethe auch noch in spätester Zeit an einem Hauptgedanken<br />
der Determinismuslehre Spinozas festhält. 1829 erschien in den<br />
WANDERJAHREN folgender Merkspruch:<br />
Lessing, der mancherlei Beschränkung unwillig fühlte, läßt eine seiner Personen<br />
sagen: niemand muß müssen. Ein geistreicher frohgesinnter Mann<br />
sagte: wer will, der muß. Ein Dritter, freilich ein Gebildeter, fügte hinzu: wer<br />
einsieht, der will auch. Und so glaubte man den ganzen Kreis des Erken-<br />
255
nens, Wollens und Müssens abgeschlossen zu haben. Aber im Durchschnitt<br />
bestimmt die Er<strong>kennt</strong>nis des Menschen, <strong>von</strong> welcher Art sie auch sei, sein<br />
Tun und Lassen; deswegen auch <strong>nicht</strong>s schrecklicher ist, als die Unwissenheit<br />
handeln zu sehen.<br />
Bekanntlich liegt dem Aphorismus ein Briefgespräch mit Zelter zugrunde.<br />
1826 hatte Zelter in einem Schreiben das Lessingwort vom<br />
Nichtrnüssen angeführt und hinzugefügt: "Ich [Zelter] aber sage<br />
euch: Wer will, der muß." Goethe, erfreut über Zelters zu Spinoza<br />
passende Formulierung, hatte erwidert: " 'Wer will, der muß!' Und<br />
ich fahre fort: Wer einsieht, der will." Damit brachte Goethe ein<br />
wirkliches Spinozawort, er paraphrasiert den oben erwähnten<br />
Kernsatz: Wille und Einsicht sind einunddasselbe. In seinem Aphorismus<br />
erinnert Goethe auf Grund dieses Satzes an die Notwendigkeit<br />
auch des schlechten Wollens, wie Lessing das Wollen des "Besten"<br />
als determiniert ansah. Bei dem Seufzer: "<strong>nicht</strong>s schrecklicher,<br />
als die Unwissenheit handeln zu sehen" mag Goethe im spezielleren<br />
an den politischen Bereich denken, an die Restaurationszeit,<br />
die schon der DIVAN als Epoche der "Zaunkönige" kritisierte. lOS Im<br />
allgemeineren stimmt er jedoch überein mit der pessimistischen<br />
Perspektive in den Schlußworten der ETHIK: dass die Unwissenheit<br />
handelt, ist im Leben der gewöhnliche Fall, denn die Mehrheit<br />
kommt über den Status des Unwissenden (ignarus) <strong>nicht</strong> heraus.<br />
Einsicht, Vernunft sind selten.<br />
Zu Spinozas Ablehnung der Willensfreiheit bekannte sich sehr<br />
nachdrücklich der frühe Herder in seiner Schrift VOM ERKENNEN<br />
UND EMPFINDEN DER MENSCHLICHEN SEELE (1778). Dem betreffenden,<br />
viele Seiten langen Abschnitt liegt zugrunde wiederum der Satz<br />
über die Identität <strong>von</strong> Wille und Einsicht:<br />
Ist jedes gründliche Er<strong>kennt</strong>nis <strong>nicht</strong> ohne Wollen, so kann auch kein Wollen<br />
ohn' Erkennen sein: sie sind nur Eine Energie der Seele [ ... ] Auch die Frage<br />
entschiede sich hier also: ob dies unser Wollen was Angeerbtes oder Erworbnes,<br />
was Freies oder Abhängiges sei? es entscheidet sich ganz aus dem Grunde:<br />
daß wahres Erkennen und gutes Wollen nur Einerlei sei, Eine Kraft und<br />
Würksamkeit der Seele [ ... ] Von Freiheit schwätzen [ ... ] ist meistens ein erbärm-<br />
108 Vgl. im BUCH DES UNMUTS: >>Verschon uns Gott mit deinem Grimme ... «<br />
256<br />
licher Trug [ ... ] Da ists wahrlich der erste Keim zur Freiheit, fühlen, daß man<br />
<strong>nicht</strong> frei sei.<br />
Mit wörtlichem Anklang an Spinoza sagt Herder über die Determiniertheit<br />
der Er<strong>kennt</strong>nis durch die göttliche Mitgift: "Die Seele<br />
spinnet, weiß, erkennet <strong>nicht</strong>s aus sich, sondern was ihr <strong>von</strong> innen<br />
und außen ihr Weltall zuströmt, und der Finger Gottes zuwinket." In<br />
den letzten Worten paraphrasiert Herder folgende Stelle der ETHIK:<br />
"Wir handeln nur nach dem Wink Gottes (ex solo Dei nutu), sind<br />
der göttlichen Natur teilhaftig, und zwar in um so stärkerem Maß,<br />
als wir vollkommnere Taten tun und je mehr wir Einsicht in die<br />
Gottheit haben. "109 Herder schließt den Abschnitt über Erkennen<br />
und Wollen mit einer ungewöhnlichen, für die damalige Zeit gewagten<br />
Lobpreisung Spinozas. Indem er auf das 5. Buch der ETHIK<br />
und die Verherrlichung des Amor Dei intellectualis hindeutet, sagt<br />
er: 110<br />
Je tiefer, reiner und göttlicher unser Erkennen ist, desto reiner, göttlicher und<br />
allgemeiner ist auch unser Würken, mithin desto freier unsre Freiheit [ ... ]<br />
Liebe [ ... ] ist die höchste Vernunft, wie das reinste, göttlichste Wollen; wollen<br />
wir dieses <strong>nicht</strong> dem h. Johannes, so mögen wirs dem ohne Zweifel noch<br />
göttlichem Spinoza glauben, dessen Philosophie und Moral sich ganz um<br />
diese Achse beweget.<br />
Keiner der Klassiker hat sich nochmals ähnlich wortreich zu Spinozas<br />
Willenslehre bekannt wie hier Herder, auch dieser selbst <strong>nicht</strong>.<br />
In seiner Spinozaschrift GOTT (1787) wird das so wichtige Thema<br />
kaum gestreift. Dies mag Goethe noch mit veranlaßt haben, in DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT SpinozasAffektenlehre wieder so in den Mittelpunkt<br />
zu stellen, wie wir gezeigt haben. Schiller neigte durch sein<br />
Temperament zur Betonung der Willensfreiheit. Den einseitig kantischen<br />
Standpunkt, den er in ANMUT UND WÜRDE (1793) vertrat, gab<br />
er jedoch später Goethe und dem eigenen Schaffen zuliebe auf.<br />
1803 konnte Goethe Schillers Einverständnis gewiß sein, wenn er<br />
109 ETHIc. T. II Schluß, in der Erläuterung zu dem Satz: Wille und Einsicht sind einunddasselbe.<br />
Die Vorstellung des göttlichen "Winkens" ist antik. Zeus gibt durch<br />
Nicken, Winken mit dem Haupt (lat. nutusl die Schicksalsentscheidungen.<br />
110 SWS 8,193 - 202.<br />
257
an ihn schrieb: "Übrigens bekömmt es uns ganz wohl, daß wir mehr<br />
an Natur als an Freiheit glauben und die Freiheit, wenn sie sich ja<br />
einmal aufdringt, geschwind als Natur traktieren."m<br />
Wenden wir uns nun zu dem zweiten Aspekt des Determinismus:<br />
Verhalten des Menschen gegenüber dem leitenden Schicksal. In der<br />
ETHIK spricht sich Spinoza hierüber nur in wenigen, aber stark beachteten<br />
Sätzen aus. Hauptgesichtspunkte sind: Schicksalsfügungen<br />
ergeben sich aus den ewigen Gesetzen der divina natura, müssen<br />
deshalb "mit Gleichmut ertragen" werden. Allerdings ist es die<br />
"Pflicht" des Menschen, den "äußeren Ursachen" entgegenzuwirken,<br />
"Dinge, die außer ihm sind, seinem Nutzen anzupasssen".<br />
Erst wenn unsre eigene "Macht" - sie ist "beschränkt" und "keineswegs<br />
absolut" - bis an die Grenze des Möglichen ausgeübt wurde,<br />
gilt das Gebot des gleichmütig gefaßten Ertragens. Solche Schicksalsergebenheit<br />
ist dann gleichbedeutend mit rechtem Erkennen,<br />
mit völliger Beruhigung des besseren Teils in uns. Je mehr Gleichmut,<br />
Er<strong>kennt</strong>nis, Beruhigung wir erlangen, desto mehr stimmen<br />
wir überein mit der "Ordnung der Allnatur"l12. Schicksalsergebenheit<br />
bewirkt ferner - ein wichtiger Gesichtspunkt - auch rechtes<br />
Verhalten im "gesellschaftlichen Leben". Wer einsieht, "daß alles<br />
aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur erfolgt" wird "dem<br />
Mitmenschen hilfreich beistehen", wird "streben, gut zu handeln<br />
und fröhlich zu sein". Übrigens darf man für gute Handlungen<br />
keine "höchsten Belohnungen <strong>von</strong> Gott erwarten". Als "Dienst<br />
Gottes" sind sie selbst "Glück und höchste Freiheit".113<br />
Indem Spinoza Aktivität, Selbstbehauptung im Rahmen des Möglichen<br />
fordert, ist er Determinist, <strong>nicht</strong> Fatalist. Jacobi hatte also<br />
kein Recht, Spinoza des Fatalismus zu bezichtigen (im Gespräch<br />
mit Lessing, der dadurch denn auch <strong>nicht</strong> zu irritieren war). Andererseits<br />
hat doch Spinozas Maxime vom gleichmütigen Ertragen<br />
111 5. Juli 1803.<br />
112 ETHIc. T. II, Schluß; T. IV, Appendix, Schluß.<br />
113 Vgl. ETHIc. T. 11, Schluß; T. IV, Appendix, Schluß; Schol. zu Prop. 50 und 73.<br />
258<br />
des Schicksals Goethe und H ö I der I i n stärkstens beeindruckt. Eine<br />
ganz spezifische Haltung der Schicksalsfrömmigkeit, des Amor fati<br />
bei beiden findet ihre Erklärung erst durch die Einwirkung <strong>von</strong><br />
Spinoza. So spricht Hölderlin in seinen Briefen immer wieder <strong>von</strong><br />
dem heiligen, dem weisen, gerechten, allmächtigen, allesbeherrschenden<br />
Schicksal. Der "Herr der Natur", bei dem "Wille und Tat<br />
Eines sind"114, bestimmt mit seinem "heiligen Gesetz" auch die<br />
"weise Lenkung unserer Schicksale, insofern sie <strong>nicht</strong> <strong>von</strong> uns abhängig<br />
sind". Natur und Schicksal sind "die einzigen Mächte, denen<br />
man den Gehorsam niemals aufkündigen darf". Gegen den<br />
"Lenker seines Schicksals" will Hölderlin nie "übermütig, ungeduldig,<br />
unbescheiden" sein. Wenn es einmal (1798) heißt: "Das Schicksal,<br />
das ich auch im Unglück liebe", so ist damit zugleich die Form<br />
des Amor fati genannt, die Hölderlin in seinen Dichtungen mit Vorliebe<br />
behandelt. (Hymne DAS SCHICKSAL, HYPERION usw.)<br />
Bei Goethe ist Verehrung des leitenden Schicksals eine sich schon<br />
ganz früh manifestierende Anschauung. Berühmtes Zeugnis dafür<br />
ist die PROMETHEUs-Ode <strong>von</strong> 1773, in der Lessing gleich Spinoza erkannte<br />
("Ich habe das schon lange aus der ersten Hand"). Weniger<br />
bekannt ist, wie oft in Briefen aus jener Epoche Goethes Blick auf<br />
das Schicksal gerichtet ist. Besonders in der letzten Frankfurter Zeit,<br />
als die großen Schicksalswendungen sich vollzogen (Trennung <strong>von</strong><br />
Lili, Übergang nach Weimar), häufen sich Wendungen wie: das schöne,<br />
weise Schicksal; das ewige Schicksal; was das eherne Schicksal<br />
noch künftig mir und den Meinigen zugedacht hat; jeder muß seinen<br />
Kelch austrinken ... fiat voluntas. "Das liebe Ding, das sie Gott<br />
heißen, sorgt doch sehr für mich." "Ich tanze auf dem Draht, Fatum<br />
congenitum genannt, mein Leben so weg! ... Fiat voluntas." "Ich<br />
lasse mich treiben und halte das Steuer, daß ich <strong>nicht</strong> strande."<br />
Während der ersten Weimarer Jahre verdichten sich die Hindeutungen<br />
auf ein "leitendes Schicksal" in Freundesbriefen wie nie<br />
114 Vgl. ETHIc. T. I, Schol. zu Prop. 17: Gottes Wille und Macht (potentia) sind einunddasselbe.<br />
Sein Wille ist Ursache der Dinge. Im Entwurf zur 8. Strophe <strong>von</strong> DER<br />
RHEIN sagt Hölderlin ähnlich: »Immer ist gleich die Tat und der Wille bei Göttern.«<br />
Diese gehen »irrlos [ ... ] vorn Anfang zum vorbestimmten Ende«. (StA II 725.)<br />
259
zuvor und hernach. Beherrschend ist das Dankbarkeitsgefühl für<br />
gewährtes Glück. "Was mir das Schicksal alles gegeben hat", ruft<br />
Goethe staunend aus, zwei Jahre nach dem Ankunftstag in Weimar.<br />
"Mir gehts nach dem Ratschlusse der Götter, den ich in tiefer Ahndung<br />
ehre", heißt es an anderer Stelle im Einklang mit Spinozas<br />
Wort vom "Dei nutu" (vgl. oben S. 257). "Wie seltsam uns ein tiefes<br />
Schicksal leitet", ist der Hauptvers eines Gedichts an earl August<br />
vom 3. August 1776.115 Vom Schicksal handeln auch sonst viele Gedichte<br />
der Frühweimarer Zeit. Sehr bald bedrücken Goethe Hinderungen<br />
durch Beruf und Vereinsamung, worauf in Briefen das<br />
Schicksals thema zurücktritt oder skeptischer klingt: "Auch hier bleibe<br />
ich meinem alten Schicksale geweiht und leide wo andere genießen,<br />
genieße wo sie leiden. Ich habe unsäglich ausgestanden."116<br />
Die Stimmung zur Zeit der wichtigsten Schicksalswendung in Goethes<br />
Leben hält dichterisch der Herbst 1775 konzipierte EGMONT<br />
fest. Allgemein deterministisch ist Egmonts Ausspruch: "Es glaubt<br />
der Mensch sein Leben zu leiten, sich selbst zu führen; und sein<br />
Innerstes wird unwiederstehlich nach seinem Schicksale gezogen."<br />
(Schlußszene.) Die Forderung Spinozas nach möglichster Selbstbehauptung<br />
gegenüber dem Schicksal erscheint eingekleidet in das<br />
Wagenlenker-Gleichnis, die Worte Egmonts, mit denen DICHTUNG<br />
UND WAHRHEIT schließt: "Wie <strong>von</strong> unsichtbaren Geistern gepeitscht,<br />
gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem<br />
Wagen durch, und uns bleibt <strong>nicht</strong>s als, mutig gefaßt, die Zügel<br />
festzuhalten, und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze<br />
da, die Räder wegzulenken." Ähnliche Gleichnisse finden sich<br />
in Briefen und Gedichten jener Frankfurter und Frühweimarer Jahre.<br />
So das vom Steuermann in MEERES STILLE, GLÜCKLICHE FAHRT, SEE<br />
FAHRT; antiker Topos wie das Wagenlenker-Gleichnis); oder die Metaphern<br />
vom Drahtseiltänzer und Eisläufer (an Herder, 13. Mai<br />
1775; Gedicht Mut). Als Hölderlin während des Diotima- Erlebnisses<br />
die Einwirkung des Schicksals besonders erfuhr, findet das<br />
115 DEM SCHICKSAL; später EINSCHRÄNKUNG. (»Ich weiß <strong>nicht</strong>, was mir hier gefällt«)<br />
116 An F. H. Jacobi, 17. November 1782.<br />
260<br />
in Briefen Ausdruck durch Goethesche Metaphern: "Wenn unser<br />
[. .. ] Schicksal in den Meeresgrund hinab und an den Himmel hinauf<br />
uns wirft, das bildet den Steuermann." - "Das Schicksal treibt<br />
uns vorwärts und im Kreise herum ... wie einer, mit dem die Rosse<br />
da<strong>von</strong>gegangen sind."117<br />
Die für Spinoza besonders charakteristische Gedankenverbindung:<br />
rechte Einstellung zu den Schicksalsgesetzen führt auch zu rechtem<br />
sozialen Verhalten, erscheint in vielen Goetheschen Dichtungen<br />
als zentraler Zug. Sie ist auch bei Hölderlin anzutreffen. Egmont,<br />
der im Wagenlenker-Gleichnis usw. seine Schicksalserfahrung bekundet,<br />
ist als Mensch zugleich durch tätige Nächstenliebe, verbunden<br />
mit Frohsinn, ausgezeichnet. Deswegen erfreut er sich beim<br />
Volk größter Beliebtheit. Goethes Gedicht »Edel sei der Mensch,<br />
hilfreich und gut«,das F. H. Jacobi 1785 in seiner Spinoza-Schrift<br />
veröffentlichte, verbindet Anerkennung der "ewigen, ehrnen"<br />
Schicksalsgesetze mit der Devise: das "Nützliche, Rechte" für die<br />
Mitmenschen zu schaffen. In dem Wort »edel« liegt ein Spinoza<br />
Anklang. Die ETHIK bezeichnet mit Edelmut, Generositas, das<br />
Streben, dem Leben und Nutzen der Gesellschaft zu dienen. In<br />
WILHELM MEISTERS WANDERJAHRE üben sich "die Entsagenden" in vielfachen<br />
Formen um das Wohl des Nächsten. Ein besonders interessantes<br />
Zeugnis findet sich im SANCT ROCHUS-FEST zu BINGEN <strong>von</strong> 1816.<br />
Hier gleicht die Predigt zum Gedenken des Heiligen geradezu einem<br />
spinozistischen Exerzitium. Indem der Geistliche seine Gemeinde<br />
zu Nachahmung des St. Rochus auffordert, empfiehlt er ihr<br />
vor allem: Ergebenheit in den Willen Gottes, seine Schickungen,<br />
Fügungen (entsprechende Wendungen leitmotivisch wiederholt).<br />
Im Einklang mit Spinoza betont er drei Punkte: 1.) Diese Schicksalsergebenheit<br />
bewirkt sicherste Annäherung an das höchste Wesen.<br />
2.) Ergebung in den Willen Gottes muß zusammengehn mit "grenzenloser<br />
Nächstenliebe", mit Opfern selbst unter Gefährdung des<br />
eigenen Lebens. 3.) Auch die größten Aufopferungen haben "selige<br />
Folgen" nur, wenn jeder Gedanke an göttliche Belohnung aufgege-<br />
117 An Neuffer, 16. Februar und 10. Juli 1797.<br />
261
en wird, Wohltun muß um seiner selbst willen geübt werden. Sämtliche<br />
drei Punkte entsprechen Einzelheiten in Spinozas Schicksalslehre,<br />
wie unsere oben gegebene Zusammenfassung zeigt.<br />
Am St. Rochus-Fest zu Bingen nahm Goethe 1815 teil, als er die<br />
Ethik immer auf der Reise bei sich führte.118 Dies erklärt die Spinoza-Anklänge<br />
in seiner Gedenkschrift. Hier ist jedoch auch Folgendes<br />
zu berücksichtigen. Zu erneuter intensiver Beschäftigung<br />
. mit Spinoza, und zwar mit seinem Determinismus, wurde Goethe<br />
während der Abfassung seiner Biographie veranlaßt. Bedeutende<br />
Auswirkungen da<strong>von</strong> finden sich in seinem Alterswerk wie auch<br />
in Briefen. Zwei Aufsätze über deterministische Probleme, die 1812<br />
als Nebenarbeiten zu DICHTUNG UND WAHRHEIT entstanden, werden<br />
uns noch beschäftigen. 1813 schrieb Goethe den Spinoza-Abschnitt<br />
des 16. Buchs seiner Autobiographie. Dass er 1814 plötzlich ein so<br />
spontanes Interesse am Islam zu nehmen vermochte (als Dichter<br />
des WESTÖSTLICHEN DIVAN), dafür bildete die erneute Durchdringung<br />
mit Spinoza eine entscheidende Voraussetzung. Der Determinismus<br />
des Islam ist mit dem der Ethik Spinozas in hohem Grade<br />
wesensverwandt. So erhöhte sein seit 1812 wieder besonders intensiv<br />
betriebenes Spinoza-Studium Goethes Bereitschaft, sich mit<br />
muslimischerDenkweise mehr zu identifizieren als je zuvor.<br />
Der mit dem Spinoza-Abschnitt eingeleitete, mit dem Wagenlenker<br />
Motiv aus EGMONT schließende vierte Teil (Buch 16-20) <strong>von</strong> DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT hat zum geheimen Thema: Goethes Einstellung<br />
gegenüber dem Schicksal. Es entsprach das der darzustellenden<br />
Lebensepoche, der großen Schicksalskrise vor dem Übersiedeln<br />
nach Weimar. Im Spinoza-Abschnitt zu Anfang <strong>von</strong> Buch 16,<br />
weist die zentrale Partie über das Entsagen auf den einen Hauptgesichtspunkt:<br />
die Notwendigkeit, sich dem Schicksal zu fügen.<br />
Mit den Worten Entsagen, Resignieren - genau Entsprechendes<br />
kommt bei Spinoza <strong>nicht</strong> vor - bezeichnet Goethe vor allem auch<br />
Schicksalsergebenheit. Sucht man dafür außer dem DICHTUNG UND<br />
118 Vgl. oben 5.235.<br />
262<br />
WAHRHEIT-Text Beweise, so finden sie sich in URWORTE. ORPHISCH (wie<br />
gleich zu zeigen sein wird), aber auch im WERTHER. In der 2. Fassung<br />
des Werther <strong>von</strong> 1787 ersetzte Goethe das Wort "resignieren"<br />
der Urfassung <strong>von</strong> 1774 durch die Wendung: "Ergebung in unvermeidliche<br />
Schicksale"119!<br />
Spinozas zweite Hauptmaxime: Pflicht der Selbstbehauptung<br />
gegenüber dem Schicksal in Grenzen des Möglichen erscheint am<br />
Schluß des 20. Buchs, an Egmont exemplifiziert. Einen dritten Aspekt<br />
bringt zwischenhinein die Partie über Jung-Stilling in Buch<br />
16. Kritisiert wird hier eine Form christlicher Schicksals ergebenheit:<br />
"man hält alles für übernatürliche Bestimmung, mit der Überzeugung,<br />
daß Gott unmittelbar einwirke." Unglücksfälle - wie Stillings<br />
dilettantische Augenoperation -, denen man durch Fleiß,<br />
durch "aufmerksames männliches Betragen" hätte zuvorkommen<br />
sollen, gelten dann als "göttliche Pädagogik". Goethe sah darin<br />
"Dünkel" und "fromme Dreistigkeit". Auch in alledem folgt er Spinoza.<br />
Gegen den tiefgewurzeIten "Aberglauben", dass eine persönlich<br />
aufgefaßte Gottheit unmittelbar "alles zum Nutzen der<br />
Menschen" leite, verbreitet sich die ETHIK innerhalb der großen Polemik<br />
gegen die Endzwecke. 120 Dieser Partie, die für Goethe als Naturwissenschaftler<br />
richtungweisend war, folgt der Dichter auch beim<br />
Präzisieren seiner Schicksalsauffassung.<br />
Über einen anderen Bereich des Determinismus spricht Goethe im<br />
Anschluß an die Spinoza-Darstellung des 16. Buchs <strong>von</strong> DICHTUNG<br />
UND WAHRHEIT: die Determiniertheit des Innern, der Veranlagung<br />
des Menschen. Spinoza löste ihm, wie Goethe offen be<strong>kennt</strong>, das<br />
Rätsel des eigenen dichterischen Schaffens. Schwer begreiflich war<br />
ihm, dass freier Wille bei seinem Produzieren nur wenig vermochte.<br />
Das meiste und Wesentlichste trat "unaufgefordert, unwillkürlich"<br />
hervor. Darin lag etwas Irrationales, das Goethe irritierte, ihn vom<br />
Standpunkt der Aufklärung und Wissenschaft zu Fragen veranlaß-<br />
119 WA 19, 61; 378.<br />
120 ETHI ., Anhang zu T.1.<br />
263
te. Äußerungen über denAnteil des Unbewußten beim Schaffensprozeß<br />
gibt es <strong>von</strong> vielen Dichtem, selbst <strong>von</strong> solchen, bei denen man<br />
es <strong>nicht</strong> erwartet, beispielsweise Schiller und Fontane. Goethe sprach<br />
darüber in seinem Leben außerordentlich oft. Hier in DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT bezeichnet er das Phänomen als sein "nachtwandlerisches<br />
Dichten", dazu erzählend, wie ihm wirklich Dichtungen oft "beim<br />
nächtlichen Erwachen" fertig vorm Geiste standen. Er vergleicht es<br />
mit ungewöhnlichen" vernunftähnlichen" Leistungen <strong>von</strong> Tieren<br />
und Pflanzen. Die Vergleiche entnahm Goethe, es scheint dies <strong>nicht</strong><br />
nachgewiesen zu sein, demselben Abschnitt der ETHIK, dem er auch<br />
die Lösung des ganzen Problems verdankte, welche besagt: auch<br />
künstlerisches Schaffen beruht auf Naturgesetzen.<br />
Ein einzigesmal kommt Spinoza in seinem Hauptwerk auf das<br />
Wesen der Kunst zu sprechen. l21 Das Rätsel des künstlerischen<br />
Schaffens, so sagt er, wird gewöhnlich falsch erklärt durch die Annahme,<br />
es könne der "Geist" des Menschen mit freiem Willen den<br />
"Körper" zu allem bestimmen. Sind doch Geist und Körper dasselbe,<br />
nur unter verschiedenen Attributen - des Denkens und der<br />
Ausdehnung - begriffen. In Wahrheit bestimmen Gesetze der Natur<br />
auch hier das Leistungsvermögen des Menschen. Nur weil die<br />
Grenzen dessen, wozu die Natur den Körper zu befähigen vermag,<br />
unerforschlich weit sind, kann es rätselhaft erscheinen, wenn<br />
einzelne Menschen Tempel, Gemälde, Gedichte zu schaffen vermögen.<br />
Zum Vergleich führt Spinoza zwei Fälle an, wo <strong>nicht</strong> erforschte<br />
Naturgesetze wie beim genialen Künstler scheinbar Unbegreifliches<br />
bewirken: 1.) Tiere übertreffen oft mit ihrer Sinnesschärfe<br />
den Menschen. 2.) Nachtwandler im Schlaf tun vieles, was sie im<br />
Wachbewußtsein <strong>nicht</strong> vollbringen können. Diese Beispiele übernimmt<br />
Goethe, mit Spinoza im Detail ebenso konform gehend wie<br />
in der Konklusion.<br />
"Dichtertalent als Natur", so formuliert ein Schema zu dem Abschnitt<br />
über das unbewußte Dichten die <strong>von</strong> Spinoza gewonnene<br />
Er<strong>kennt</strong>nis, dass auch die schöpferische Tätigkeit durch Naturgesetze<br />
determiniert ist. Unmittelbar anschließend bezeichnet das-<br />
121 ETHIC., Scholium zu Prop. 2 des 3. Teils.<br />
264<br />
Jbe Schema das gleiche Phänomen mit: "Betragen als Naturkind<br />
(Naturbetragen) [ ... ] Zwey Geschichten." In der Ausführung läßt<br />
as für DICHTUNG UND WAHRHEIT so charakteristische understatement<br />
kaum noch erkennen, was gemeint ist: durch Gesetze der Natur,<br />
ehr als durch freien Willen bestimmt, sah Goethe auch Grundzüge<br />
seines menschlichen Verhaltens gegenüber der Gesellschaft.<br />
y, n den "zwey Geschichten" deutet die erste - Brand in der Judenasse<br />
- auf den Drang, den Mitmenschen tätige Hilfe und Fröhlichkeit<br />
zu bringen (ähnlich wie Egmont). Die zweite - Eislauf im<br />
P lz der Mutter - zeigt symbolisch Goethes Unbekümmertheit um<br />
ritik der Gesellschaft. Bei der ersten mag man an Goethes Verhalt<br />
n als Freund und Staatsmann denken, bei der zweiten an so antoßerregende<br />
Handlungen wie die Wahl Christianes als Partnerin.<br />
Wir erinnern uns: das Bestreben, dem "gemeinschaftlichen<br />
Nutzen" zu dienen, wohltätig und froh zu sein, läßt Spinoza folen<br />
aus Er<strong>kennt</strong>nis der determinierenden Naturgesetze. Dementprechend<br />
war für Goethe die vom Determinismus handelnde Partie<br />
<strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT der rechte Ort, dies zur Sprache zu<br />
bringen. Vorsätzlich verundeutlichte er die Zusammenhänge, um<br />
zu verbergen, <strong>von</strong> wie großen eigenen Vorzügen die Rede ist.<br />
r Aufschluß, den Goethe durch Spinoza über die Determit\<br />
i e r t h e i t seines Dichtens erhielt, war ihm auch aus zwei weit<br />
ren Gründen wichtig:<br />
1.) Wiederum interpretierte Spinozas Philosophie eine Grundnschauung<br />
der Antike. Der Dichter ist - für Griechen und Römer<br />
- entheos, 'des Gottes voll'. Er schafft aus Begeisterung, aus ihm<br />
pricht 'der Gott'. Verstand und Wollen allein erzeugen keine Poeie.<br />
Spinozas Formel: Kunst entsteht aus bloßen Gesetzen der göttlichen<br />
Natur, drückt das gleiche aus, beruht aber auf philosophicher<br />
Argumentation, wie sie dem Wissenschaftsbedürfnis der<br />
Klassik entsprach.<br />
2.)Der Vorstellung, Dichtung sei durch freien Willen zu schaff<br />
n, begegnete Goethe in späterer Zeit bei den Schülern Kants, benders<br />
bei Schiller und den Romantikern. Nun half ihm Spinoza,<br />
igene Position zu behaupten, als er in DICHTUNG UND WAHRHEIT<br />
265
en ließ. Als Arzt stand Faust bereits mitten in der Vita activa und<br />
hat sich in dieser aufs äußerste bewährt. In Pestzeiten versuchte er<br />
unter ständiger Gefährdung des eigenen Lebens zahllose Menschen<br />
vor dem Tode zu retten. Seither ist Faust allgeliebt. Kaum erscheint<br />
er am Ostertag, »sammelt sich das Volk im Kreis« um ihn, huldigt<br />
dem »guten«, opferwilligen Helfer (v. 996 ff.), verehrt ihn fast als<br />
Heiligen. (»Und wenig fehlt, so beugten sich die Knie, / Als käm'<br />
das Venerabile.« v. 1020 f.) Faust weist "vorsehungsgläubig" (Robert<br />
Petsch) auf den »Helfer droben«, erinnert sich seiner damaligen<br />
frommen Gebete. Dagegen lehnt er Ruhm ab (v. 1033). Von seinen<br />
Großverdiensten schweigend, gedenkt er der Verschuldung, in die<br />
ihn gerade sein ärztliches Wirken führte. Es war ein »Meer des<br />
Irrtums«, durch Vergabe minderwertiger Arzneien wurde er, bester<br />
Absicht, an vielen zum »Mörder«. In dem Motiv der Rettung<br />
Pestkranker unter Gefährdung des eigenen Lebens symbolisiert<br />
Goethe größtmögliche Bewährung. Darauf weist das SANCT RocHUS<br />
FEST ZU BINGEN, das Goethe vielleicht auch als Kommentar zu diesen<br />
FAUST-Szenen schrieb.<br />
Viele Verschuldungen Fausts, oft so verständnislos bewertet, sind<br />
an dieser Vorgeschichte zu bemessen. Bis in Einzelheiten zeigt sie<br />
Charakterzüge, die ihn nachmals zu Tat und Schuld auf staatsmännischer<br />
Ebene treiben. Wie früher, handelt Faust auch jetzt <strong>nicht</strong><br />
um Ruhmes willen. (»Die Tat ist alles, <strong>nicht</strong>s der Ruhm.« v. 10188.)<br />
Nützliches für die Mitmenschen zu schaffen ist sein Traum, und<br />
ein »freies Volk« müßte ihm dankbar sein wie die Menge beim<br />
Osterspaziergang. Doch wie der als Heiliger verehrte Arzt <strong>von</strong><br />
schwerer Verschuldung <strong>nicht</strong> frei bleibt, wird auch der Staatsmann<br />
durch tragische Lebensgesetze bei seinem Handeln.in Schuld verstrickt.<br />
Im FAUST wird die Schuld dem Handelnden, der grundsätzlich<br />
ein »guter Mensch« ist, vergeben.<br />
Alle wesentlichen Aspekte des Determinismus, wie ihn die Klassik<br />
durch Spinoza verstand, finden wir beispielhaft vereinigt in<br />
Hölderlins großer Hymne DER RHEIN. Indem das Gedicht <strong>von</strong> dem<br />
»Schicksal« des Flusses erzählt - das Wort Schicksal kehrt leitmotivisch<br />
wieder - stellt Hölderlin sein eigenes Schicksal als Dichter<br />
270<br />
dar. Wie Goethe (in URWORTE. ORPHISCH) innere und äußere Determination<br />
unterscheidet, die innere als die am stärksten wirksame<br />
bezeichnet, so auch Hölderlin. Bekannt ist die erstaunliche Ähnlichkeit<br />
mit Goethes UR WORTE. ORPHISCH in den Versen: »Denn / Wie<br />
du anfingst, wirst du bleiben, / So viel auch wirket die Not, / Und<br />
die Zucht, das meiste nämlich / Vermag die Geburt, / Und der<br />
Lichtstrahl, der / Dem Neugebornen begegnet.« Mitgeboren ist<br />
dem Rhein, wie dem Dichter Hölderlin, das Verlangen, das »Hoffen«,<br />
auf schnellstem Wege die heimatliche Zone gotterfüllten Lebens<br />
aufzusuchen. Deswegen »wollt' er wandern«, ursprünglich<br />
auswandern nach »Asia« als dem Raum antiker und patriarchischer<br />
Religiosität. »Doch unverständig ist / Das Wünschen vor dem<br />
Schicksal.« Das Schicksal bzw. »ein Gott« bestimmen es anders.<br />
Der Rhein muß seinen Weg durch »deutsches Land« nehmen. Mit<br />
der Nötigung durch das Schicksal stände im Widerspruch, dass<br />
der Rhein »geboren ist, um frei zu bleiben«, um »des Herzens<br />
Wunsch allein zu erfüllen«. (v. 33, 55 ff.) Der Widerspruch löst sich,<br />
indem die Freiheit - ganz im Sinne Spinozas - in Schicksals erge<br />
benhei t gefunden wird. Das »Schicksal« wird als »wohlbeschieden«<br />
angesehen, »seligbescheiden« ruht der Rhein in den »Grenzen,<br />
/ Die bei der Geburt ihm Gott / Zum Aufenthalte gezeichnet«.<br />
Hier, auch in deutschen Landen, »umfängt« ihn »alles, was er gewollt,<br />
/ Das Himmlische, <strong>von</strong> selber ... unbezwungen, lächelnd /<br />
Jetzt, da er ruhet.« Auffallend ist auch die mit Spinoza und Goethe<br />
zusammenstimmende Motivverknüpfung: aus Schicksalsergebenheit<br />
resultiert Tätigkeit zu Nutzen der Mitmenschen. Indem der<br />
Rhein sich »stillwandelnd im deutschen Lande begnüget«, stillt er<br />
das Sehnen im »guten Geschäfte«, »baut das Land« und nährt als<br />
>Vater« liebe Kinder, »In Städten, die er gegründet«.<br />
Am meisten überraschen Übereinstimmungen mit Spinoza und<br />
Goethe in der Partie, wo Hölderlin den »Halbgott« Rousseau und<br />
den Halbgott Rhein vergleicht, damit jedoch die Besonderheit seines<br />
eigenen Dichtens charakterisiert. Alles finden wir hier wieder,<br />
was Goethe später <strong>von</strong> seinem "nachtwandlerischen" Dichten sagte:<br />
dass es <strong>nicht</strong> "forciert", aus freien Willensakten entsteht, sondern<br />
271
geben durch den Zusammenhang, den der durch Kanzler <strong>von</strong><br />
Müller überlieferte Ausspruch innerhalb des Gesprächs hat. Die<br />
Unterhaltung ging damals, am 7. April 1830, um die "Heiligkeit<br />
der Ehe", die Scheu vor "ungeregelten, ehelosen Liebesverhältnissen";<br />
beides betrachtet Goethe als Kulturerrungenschaft des<br />
Christentums. Wir kommen darauf zurück. Zuvor mag es naheliegen,<br />
im Bereich dessen Umschau zu halten, was der späte Goethe<br />
"Entsagung" nennt. Scheint doch hier eine Verwandtschaft mit<br />
christlichen Anschauungen am ehesten gegeben. Über dies Entsagen<br />
ist lang und breit diskutiert worden. Dabei war zuviel <strong>von</strong><br />
Entsagung als Theorie die Rede, zuwenig <strong>von</strong> etwas anderem: dass<br />
Goethe auch in seinem Handeln ein großer Entsagender war, dass<br />
er nämlich lebte, was er lehrte. Denken und Tun in Einklang zu<br />
bringen, die große Lehre des "Entsagungs"-Romans WILHELM MEI<br />
STERS WANDERJAHRE zu verwirklichen, war Goethes Bemühn. Bei genauerer<br />
Untersuchung lassen sich Anzeichen hierfür beim jungen<br />
wie auch beim alten Goethe finden. Die folgenden Betrachtungen<br />
gelten einer Epoche des jungen Goethe.<br />
Eine der wichtigsten Auslassungen Goethes über das Entsagungsthema<br />
in DICHTUNG UND WAHRHEIT enthält den Hinweis,<br />
dass der Dichter tatsächlich an sein Verhältnis zu Christus dachte,<br />
wenn er <strong>von</strong> Entsagen sprach. Auch deutet er in diesem<br />
Zusammenhang ähnlich kühn auf sich selbst wie in der so erstaunlichen<br />
Gesprächsäußerung gegenüber dem Kanzler <strong>von</strong> Müller.<br />
Beides ist aber in DICHTUNG UND WAHRHEIT so unauffällig, ja versteckt<br />
gesagt, dass nur sorgfältiges Lesen zur Wahrnehmung der<br />
Winke führt. Betrachten wir daraufhin die folgenden Sätze aus<br />
dem <strong>von</strong> Spinoza handelnden Abschnitt im 16. Buch <strong>von</strong> DICHTUNG<br />
UND WAHRHEIT, geschrieben 1813:<br />
276<br />
Unser physisches sowohl als geselliges Leben, Sitten, Gewohnheiten, Weltklugheit,<br />
Philosophie, Religion, ja so manches zufällige Ereignis, alles ruft<br />
uns zu: dass wir entsagen sollen. So manches, was uns innerlich eigenst angehört,<br />
sollen wir <strong>nicht</strong> nach außen hervorbilden; was wir <strong>von</strong> außen zu<br />
Ergänzung unsres Wesens bedürfen, wird uns entzogen ... Ehe wir hierüber<br />
recht ins klare sind, finden wir uns genötigt, unsere Persönlichkeit erst<br />
stückweis und dann völlig aufzugeben." Der Mensch ist nun allenfalls - so<br />
sagt Goethe weiter - "fähig, dem einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen,<br />
wenn er nur im nächsten Moment nach etwas Neuem greifen darf;<br />
und so stellen wir uns unbewußt unser ganzes Leben immer wieder her.<br />
Wir setzen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen,<br />
Liebhabereien, Steckenpferde, alles probieren wir durch, um zuletzt<br />
auszurufen, dass alles eitel sie. Niemand entsetzt sich vor diesem<br />
falschen, ja gotteslästerlichen Spruch; ja man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches<br />
gesagt zu haben. Nur wenige Menschen gibt es, die solche<br />
unerträgliche Empfindung vorausahnen und, um allen partiellen Resignationen<br />
auszuweichen, sich ein für allemal im ganzen resignieren. [Absatz.] Diese<br />
überzeugen sich <strong>von</strong> dem Ewigen, Notwendigen, Gesetzlichen und suchen<br />
sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüstlich sind, ja durch die<br />
Betrachtung des Vergänglichen <strong>nicht</strong> aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt<br />
werden. Weil aber hierin wirklich etwas Übermenschliches liegt, so werden<br />
solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gott- und weltlose;<br />
ja man weiß <strong>nicht</strong>, was man ihnen alles für Hörner und Klauen andichten<br />
soll.<br />
Beachten wir die beiden Möglichkeiten, die Goethe unterscheidet,<br />
und die sich ergebenden Folgen. Entsagung wird verlangt <strong>von</strong> allen,<br />
jeder übt sie teilhaft und bis zu einem gewissen Grade, ob er<br />
sich nun <strong>von</strong> Sitte, Weltklugheit, Philosophie oder Religion leiten<br />
läßt. Nicht ein jeder aber vermag es, sich auf die Höhe zu erheben,<br />
dass er alle partiellen Resignationen als unzureichend betrachtet<br />
und nun "ein für allemal im ganzen" resigniert. Mit diesem<br />
totalen Entsagen "im ganzen" ist etwas "Übermenschliches"<br />
gemeint. Es ist ein Schwerstes und Letztes, zu dem nur wenige<br />
gelangen, solche, die etwas wissen vom "Ewigen, Notwendigen,<br />
Gesetzlichen", d. h. nach Goetheschem Sprachgebrauch: <strong>von</strong> Gott.<br />
Diese wenigen - man könnte sie Heilige nennen, Goethe vermeidet<br />
nur den Ausdruck -, diese wenigen aber werden <strong>von</strong> ihrer Umgebung<br />
und Nachwelt verteufelt, man dichtet ihnen Hörner und<br />
Klauen an, hält sie für gott- und weltlos. Das Übermenschliche gilt<br />
als unmenschlich.<br />
Es erhebt sich die Frage: wer gehört zu diesen wenigen, wer<br />
ist gemeint? Die Formel "gott- und weltlos" gibt einen Fingerzeig.<br />
Der Gottlose ist Spinoza, <strong>von</strong> dem Goethe ja hier generell spricht<br />
mit ausdrücklicher Ablehnung herkömmlicher Vorwürfe der Gegner,<br />
die den Philosophen als "verwerflichen Atheisten" bezeich-<br />
277
"Ein jeglicher sei gesinnt, wie Christus auch war: welcher, ob er wohl in göttlicher<br />
Gestalt war, sah er doch das Gleichsein mit Gott <strong>nicht</strong> als festen Besitz<br />
an, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward<br />
gleich wie ein anderer Mensch ... er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam<br />
bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz."<br />
Auch hier ist offensichtlich <strong>von</strong> einer Entsagung im ganzen die Rede.<br />
Nahe steht der Schlußsatz des 8. Buchs <strong>von</strong> DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT, wo es heißt, es sei unsere Pflicht, die Absichten der Gottheit<br />
dadurch zu erfüllen, dass wir, indem wir <strong>von</strong> einer Seite uns<br />
zu verselbsten genötigt sind, <strong>von</strong> der andern in regelmäßigen Pulsen<br />
uns zu entselbstigen <strong>nicht</strong> versäumen".<br />
So klären auch die <strong>Bibel</strong>worte etwas vom Sinn der Goetheschen<br />
Entsagungsiehre. Wenn <strong>von</strong> Christus aus die Aufforderung an seine<br />
Jünger ergeht, sich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu<br />
nehmen, so bedeutet das, bezieht man es auf die Jünger selbst: den<br />
Appell zu einer großen grundsätzlichen Lebensentscheidung. Die<br />
Jünger - wir wissen es - bleiben schwach, bleiben Menschen. Sie<br />
irren, sie fehlen im einzelnen. Aber sie richten in großen Zügen<br />
ihr Leben darauf ein, sich so zu verhalten, so zu handeln, dass sie<br />
die geistigen Aufgaben, die das Schicksal ihnen gestellt hat, erfüllen<br />
können. Das heißt natürlich in erster Linie, dass sie die wesentlichsten<br />
Lehren und Gebote Christi befolgen und damit ein<br />
Beispiel geben. Da<strong>von</strong> ist das oberste praktische Gebot: die Menschen<br />
zu lieben, sie zu fördern, ihnen zu helfen, <strong>nicht</strong> so sehr für<br />
sich als für andere dazusein, zu schaffen, zu wirken; zu verzichten<br />
auf ein Glück, wenn es andern schadet.<br />
In diesem Sinne faßte Goethe die Entsagung auf: zu verzichten<br />
auf ein Glück, wenn es andern schadet. Spinoza galt ihm deshalb<br />
als ein hervorragender Vertreter christlicher Ethik, weil bei<br />
ihm Lehre wie Leben durch solche Art des Entsagens geprägt waren.<br />
Im Hinblick auf die Lebensführung Spinozas sagt Goethe in<br />
DICHTUNG UND WAHRHEIT Buch 14: es sei die an dem Philosophen<br />
wahrzunehmende "grenzenlose Uneigennützigkeit", die ihn<br />
geradezu an Spinoza "gefesselt" habe. Goethe fährt fort: "Jenes<br />
wunderliche Wort [aus Spinozas ETHIK]: 'Wer Gott recht liebt, muß<br />
<strong>nicht</strong> verlangen, dass Gott ihn wieder liebe', mit allen den Vorder-<br />
282<br />
sätzen, worauf es ruht, mit allen den Folgen, die daraus entspringen,<br />
erfüllte mein ganzes Nachdenken. Uneigennützig zu<br />
sein in allem, am uneigennützigsten in Liebe und Freundschaft,<br />
war meine höchste Lust, meine Maxime, meine Ausübung [!], so<br />
dass jenes freche spätere Wort: 'Wenn ich dich liebe, was geht's<br />
dich an?' mir recht aus dem Herzen gesprochen ist."<br />
Wieder erschwert vorsätzliches understatement das Verständnis<br />
für den Leser. Besonders wird auch hier die Anwendung auf Goethe<br />
selbst verundeutlicht. Betrachten w.ir daraufhin den letzten<br />
Satz etwas genauer. Er enthält allgemein die Feststellung: "Uneigennützig<br />
zu sein in allem [ .. . ] war meine höchste Lust, meine<br />
Maxime, meine Ausübung." Das sind sogar vergleichsweise kühne<br />
Worte, stellt man sie sich verwirklicht vor. Uneigennützigkeit<br />
so total wie das Entsagen, und das <strong>nicht</strong> als Idee, sondern als Ausübung!<br />
Die Uneigennützigkeit schließt selbst das Verhältnis zum<br />
Göttlichen ein, worauf unmittelbar vorher das Zitat aus Spinozas<br />
ETH IK hinweist. Der Leser gelangt aber kaum dazu, dies alles zu<br />
realisieren dank Goethes hartnäckiger Verschleierungs taktik. 4<br />
Denn der Dichter versieht den Satz ja mit einem Einschub, der<br />
dem Uneigennützigkeitsgedanken sogleich - wenigstens scheinbar<br />
- viel <strong>von</strong> der Strenge seines Anspruchs nimmt. Es heißt: "Uneigennützig<br />
zu sein in allem, am uneigennützigsten in Liebe und<br />
Freundschaft, war meine höchste Lust, meine Maxime, meine Ausübung."<br />
Wer das Ganze so liest, wird nur allzusehr verleitet sein,<br />
sich zu sagen: "Ach so, Liebe und Freundschaft, darum handelt<br />
s sich vor allem. Dann ist das mit der Uneigennützigkeit offenbar<br />
doch gar <strong>nicht</strong> so absonderlich. Nichts Übermenschliches wird<br />
prätendiert." Dieser Eindruck scheint sich zu bestätigen dadurch,<br />
4 Den Zusammenhang mit dem Göttlichen hätte deutlicher machen können jener<br />
Passus, in dem Goethe berichtet: in der Jugend sei es sein Lieblingsgedanke gewesen,<br />
die "liebliche Naturgabe" der Dichtung "als ein Heiliges uneigennützig<br />
auszuspenden". Der Passus steht aber <strong>nicht</strong> hier im 14. Buch <strong>von</strong> DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT, sondern in Buch 16, am Ende des dortigen Spinoza-Abschnitts. An dieser<br />
Stelle wiederum fehlen sonstige Hinweise auf die "Uneigennützigkeit", so daß<br />
die Wendung "Heiliges uneigennützig" in voller Bedeutung nur aus Buch 14 erkannt<br />
werden ka nn.<br />
283
dass Goethe dem Satz einen scheinbar nochmals abschwächenden<br />
Schluß hinzufügt: "so dass jenes freche spätere Wort: >Wenn ich<br />
dich liebe, was geht's dich an?< mir recht aus dem Herzen gesprochen<br />
ist." Damit ist ja auf Philine angespielt, die "zierliche Sünderin"<br />
aus WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE.<br />
So wird innerhalb des drei gestuften Satzgefüges Schritt für<br />
Schritt das Außerordentliche, Goethes Handlungsweise im Kern<br />
Bezeichnende gleichsam zurückgenommen, jedenfalls völlig verundeutlicht.<br />
Und doch ermöglicht bei sorgfältigem Lesen gerade<br />
diese Stelle, den Begriff der totalen Entsagung, nach dem wir fragten,<br />
mit konkretem Inhalt auszufüllen. Vergegenwärtigt man sich<br />
nämlich, was hier tatsächlich ausgesprochen ist: dass die "grenzenlose<br />
Uneigennützigkeit" Spinozas auch für Goethe Maxime, ja<br />
Ausübung war, so ist damit grundsätzlich konkretisiert, was Goethe<br />
unter der "Resignation im ganzen" verstand. Damit aber begreifen<br />
wir viel besser, inwiefern das 16. Buch <strong>von</strong> I?ICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT in diesem Zusammenhang <strong>von</strong> etwas Ubermenschlichem<br />
sprechen konnte, weshalb dabei auch auf Christus verwiesen<br />
wird. Denn solche grenzenlose Uneigennützigkeit ist <strong>von</strong> Christus<br />
gelehrte, gelebte, <strong>von</strong> den Jüngern geforderte Tugend.<br />
Der besprochene Passus sollte jedenfalls zweierlei lehren: erstens,<br />
dass die Wendung" Uneigennützig zu sein in allem" bei<br />
gebührender Beachtung Immenses an Forderungen einschließt;<br />
zweitens, dass Goethe mit dem Be<strong>kennt</strong>nis, Uneigennützigkeit<br />
besonders in Liebe und Freundschaft bewiesen zu haben, ein Gebiet<br />
ins Blickfeld rückt, auf dem der Dichter sich lebenslänglich -<br />
in einem bestimmten Sinne - zu totaler Entsagung durchrang, mit<br />
sehr großen Opfern, beträchtlichen Leiden. Die uneigennützige<br />
Liebe zu Frauen insbesondere, eine Liebe, die <strong>nicht</strong> an das eigene<br />
Glück, sondern an das Wohl <strong>von</strong> andern denkt, an die Notwendigkeit,<br />
ihnen <strong>nicht</strong> zu schaden, <strong>nicht</strong> wehe zu tun - diese Liebe<br />
hat Goethe wieder und wieder betätigt <strong>von</strong> der Wertherzeit an bis<br />
in seine spätesten Jahre. Die großen Altersromane, DIE W AHLVER<br />
WANDTSCHAFTEN und WILHELM MEISTERS WANDERJAHRE, aber auch vieles<br />
andere, so die NOVELLE, die KLASSISCHE WALPURGISNACHT machen<br />
es klar, dass der Dichter mit dem Wort Entsagung in erster Linie<br />
284<br />
- wenn auch <strong>nicht</strong> ausschließlich - den Liebesverzicht aus Gewissensgründen<br />
meint. Nicht zuletzt im Hinblick auf diese Form<br />
der Entsagung fühlte Goethe sich in seinem Handeln als Christ.<br />
Es zeigt sich jetzt, wie bedeutungsvoll es ist, dass jenes Wort: " Wer<br />
ist denn noch heutzutage ein Christ, wie Christus ihn haben wollte?"<br />
geäußert wurde innerhalb eines Gesprächs über die Heiligkeit<br />
der Ehe - das Problem, dem Goethe ein ganzes Werk, seine<br />
WAHLVERWANDTSCHAFTEN, gewidmet hatte. Goethe war sich bewußt,<br />
dass er in dieser Hinsicht: die Heiligkeit der Ehe <strong>nicht</strong> anzutasten,<br />
viele Male in seinem Leben ein Äußerstes getan hatte.<br />
Mit der anscheinend so harmlos klingenden Formel "Uneigennützigkeit<br />
in der Liebe" bezeichnet Goethe also doch etwas sehr<br />
Schwerwiegendes: eine Form der Nachfolge Christi. Wenn der<br />
Dichter in diesem Zusammenhang sogar an Philine erinnert und<br />
an ihre Uneigennützigkeit in der Liebe, so will das recht verstanden<br />
sein. Es bedeutet, dass auch dieses Wesen, das ganz Leib, personifizierte<br />
Sinnenfreude und Lebensbejahung ist, durch gewisse<br />
Züge agapeischer Liebe teilhat an spinozistisch-christlicher Haltung.<br />
Jene "Uneigennützigkeit" - ausgesprochene Liebe zu Wohltätigkeit<br />
ist ihr beigemischt - hebt Philine auf eine höhere Stufe.<br />
Das ermöglicht in WILHELM MEISTERS LEHRJAHREN den scherzhaft<br />
paradoxen Spruch <strong>von</strong> der "auf dem Wege zur Heiligkeit" befindlichen<br />
Philine. Deshalb hat auch am Schluß <strong>von</strong> WILHELM MEISTERS<br />
WANDERJAHREN Philine ohne Umstände Zutritt zu Makarie, der echten<br />
Heiligen.<br />
Durch die Nennung Philines im Spinoza-Abschnitt <strong>von</strong> DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT ist andererseits auch eine Abgrenzung gegenüber<br />
allzu christlicher Auslegung vollzogen. "Grenzenlose Uneigennützigkeit"<br />
totaler Entsagung ist für Goethe <strong>nicht</strong><br />
gleichbedeutend mit Askese. Goethe war kein Asket. Wenn Sinnenfeindlichkeit<br />
und Abtötung des Leibes christlichen Vorstellungen<br />
zufolge heilig machen sollen, so strebte Goethe <strong>nicht</strong> nach solcher<br />
Heiligkeit. Bejahung des Eros gehört zum Wesen des klassischen<br />
Menschen. Es gab bekanntlich im Leben des Dichters Epochen freiz<br />
ügigen erotischen Genießens. Und der Satz: "Nun in allen<br />
L bensreihen / Müsset ihr genießen können" aus dem WEST-ÖST-<br />
285
LICHEN DIVAN bildet einen Teil der Goetheschen Altersweisheit. Erscheint<br />
Goethe hierin recht modem, so trennt ihn doch zweierlei<br />
<strong>von</strong> heutiger Mentalität. Erstens stand die Bejahung des Eros bei<br />
Goethe im Zeichen souverän geistiger Heiterkeit nach Weise der<br />
Antike oder des Alten Orients; dafür gibt es in moderner Zeit keine<br />
Parallele. Zweitens bedeutet Genußfreude für Goethe <strong>nicht</strong> ungehemmtes<br />
Ausleben der Triebe im modemen Sinne. Eine gewisse<br />
Grenze bleibt immer gezogen. Zu allen Zeiten, auch in des Dichters<br />
Jugend, hielt der Freizügigkeit im Genießen ein sehr bestimmtes<br />
Maßgefühl die Waage. Das Einhalten dieser Grenze, dieses<br />
Maßes führte zu schweren inneren Kämpfen bei einer so unvorstellbar<br />
leidenschaftlichen und leidensfähigen Natur wie der Goethes.<br />
Was der Dichter in diesem Ringen erreichte, das In-Schranken-Halten<br />
größter Affizierbarkeit, betrachtete er als Entsagen im<br />
Sinne Spinozas, als sein praktiziertes Christentum.<br />
Lebenslänglich erzog sich Goethe auch dazu, in den kleineren<br />
Dingen des Alltags verzichten und entbehren zu können. Dass der<br />
Mensch seine Affekte beherrschen müsse, war ein Postulat Spinozas,<br />
das Goethe zu befolgen suchte. Wie weit er es darin brachte,<br />
zeigt ein Wort Friedrich Riemers, der den Dichter aus jahrzehntelangem<br />
Umgang kannte. Riemer berichtet: die stoische<br />
Formel "sustine et abstine" habe Goethe "tatkräftig durch ein ganzes<br />
Leben hindurch ausgeführt."5 Riemer betont, wie schwer es<br />
dem Dichter im Grunde fiel, sich zu solcher Haltung durchzuringen.<br />
Die Ruhe, wie Spinoza sie forderte, lag - so sagt Riemer<br />
- ursprünglich <strong>nicht</strong> in Goethes ungeduldig-lebhaften Wesen,<br />
"aber das dunkelgefühlte Bedürfnis nach ihr stand wie ein letztes<br />
Ziel all dieser Bewegungen in seiner Seele. Er mußte sie erst<br />
sich anerwerben oder durch Erfahrung, Vernunft und Studium dahin<br />
gelangen." Wenn Goethe es vermochte, so berichtet Riemer '<br />
weiter, sich Geduld und Gelassenheit anzuerziehen und sein ganzes<br />
geselliges Betragen und Benehmen zu regulieren, so habe ihm<br />
5 Friedrich Wilhelm Riemer, Mitteilungen über Goethe. Hrsg. <strong>von</strong> Arthur Pollmer. Leipzig<br />
1921. S. 362.<br />
286<br />
dabei vor allem auch geholfen das Betrachten <strong>von</strong> Kunstgegenständen,<br />
<strong>von</strong> griechischer Plastik, italienischer Malerei. 6<br />
Es ist aber zu sagen, dass alles, was Goethe durch Selbsterziehung<br />
erreichte, schwer erworben war, dass es seiner Natur abgerungen<br />
werden mußte. Der Dichter war eigentlich ungestüm,<br />
expansiv, heftig in jeder Regung, in Zuneigung und Lieben, in Ablehnung<br />
und Zorn. Er brachte sich aber dazu, auf allen Gebieten<br />
sein Temperament zu zügeln. Man braucht es <strong>nicht</strong> in Abrede zu<br />
stellen, dass auch die Akte der Selbsterziehung im Kleinen, Alltäglichen<br />
noch ins Gebiet des Entsagens bei Goethe gehören. Der<br />
Dichter selbst sah es etwas anders. Er bezeichnete solche Selbsterziehung<br />
lieber mit dem Wort Kultur. Der Mensch, der sich unter<br />
Kontrolle nimmt, sich bändigt, Schwächen bekämpft, gibt sich<br />
damit eine 'Kultur' und erfüllt erst so die Voraussetzung, für ein<br />
höheres Menschliches in Betracht zu kommen. In Eckermanns Gesprächssammlung<br />
begegnen wir dem Wort 'Kultur' überaus häufig<br />
in diesem Sinne. Eckermann stellte es als eine Hauptlehre Goethes<br />
dar, die der Dichter <strong>nicht</strong> müde wurde, seinen Freunden<br />
einzuprägen: sich auf solche Weise eine Kultur zu geben. Dem geamten<br />
Buch Eckermanns liegt als eine der wesentlichsten Tendenzen<br />
zugrunde: darzutun, dass Goethe selbst es in staunenswertem<br />
Maß erreicht hatte, seine eigene Existenz zu einer derartigen Kultur<br />
zu bringen.<br />
Hingegen was Goethe mit dem Wort Entsagung, totaler Entagung,<br />
Resignation im ganzen bezeichnet, meint eigentlich etwas<br />
anderes. Es ist damit gedeutet auf gewisse grundlegende, einzelne<br />
Lebensentscheidungen. Hierbei handelt es sich weniger um den<br />
Kampf des Menschen mit einzelnen Fehlern und Untugenden. In<br />
diesem Kampf wird der einzelne nie ganz frei <strong>von</strong> menschlichen<br />
chwächen. Die großen Lebensentscheidungen dagegen, in denen<br />
Ebd . S. 68. Ähnlich S. 116: man müsse gestehn, daß G. "Selbstbeherrschung und<br />
Resignation in einem ungewöhnlichen Grade besaß, die um so höher anzuschlag<br />
n waren, als er sie gegen die Hindernisse eines lebhaften Naturells sich erworb<br />
n und angeübt hatte."<br />
287
sich die totale Resignation manifestiert, sind Schritte, mit denen<br />
mehr geleistet wird als den Menschen üblicherweise zu erfüllen<br />
gelingt, Akte der ungewöhnlichen Selbstlosigkeit, der schweren<br />
Überwindung. In WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE ist das Wesen solcher<br />
Akte gekennzeichnet mit dem schönen Wort: "große und kühne<br />
Aufopferungen". Der Oheim in den "Be<strong>kennt</strong>nissen einer schönen<br />
Seele" meint damit das Leben bestimmende Handlungen des<br />
Glücksverzichts, und zwar des Verzichts auf Eheglück. Wenn DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT <strong>von</strong> der Uneigennützigkeit in Liebe und<br />
Freundschaft spricht, so ist damit benannt, in welcher Form Goethe<br />
besonders oft solche großen Lebensentscheidungen getroffen<br />
hat. Handlungen dieser Art gehören auch zum Fundament dessen,<br />
was Goethe in DICHTUNG UND WAHRHEIT beiläufig einmal seinen<br />
"sittlichen Lebensbau" nennt (Buch 12). Von diesem sittlichen<br />
Lebensbau - Goethe setzt ihn seinem literarischen als ebenbürtig<br />
zur Seite - ist allzu wenig bekannt. Ihm gelten unsere Betrachtungen,<br />
zeigt sich doch hier recht eigentlich das Verhältnis des<br />
Dichters zu Christus und Spinoza.<br />
Ein Fall, wo Goethe Uneigennützigkeit in Liebe und Freundschaft<br />
exemplarisch bewährte, ist immerhin allgemein sichtbar: des<br />
Dichters Verzicht auf Marianne <strong>von</strong> Willemer. Ausschlaggebend<br />
bei diesem Entsagen war die Respektierung einer Freundesehe.<br />
Die Versuchung war die größte. Erstmals im Leben hatte Goethe<br />
eine Frau getroffen, die ihm geistig ebenbürtig war, eine Dichterin.<br />
Nach dem Tode Christianes 1816 war Goethe selbst frei. Der<br />
Freund Jacob <strong>von</strong> Willemer wäre bereit gewesen, Marianne abzutreten.<br />
Die Reise zu Will emers im Juni 1816 brach Goethe jedoch<br />
ab, nachdem eines jener "zufälligen Ereignisse" eingetreten<br />
war, <strong>von</strong> denen DICHTUNG UND WAHRHEIT sagt, dass auch sie uns<br />
zurufen: dass wir entsagen sollen. Ein Unfall des Reisewagens<br />
ver anlaß te die Rückkehr nach Weimar. Es war Goethe endgültig<br />
klargeworden, dass er die Frau eines Freundes <strong>nicht</strong> antasten, die<br />
Heiligkeit der Ehe <strong>nicht</strong> verletzen dürfe, die er selbst in den W AHL<br />
VERWANDTSCHAFTEN verteidigt hatte gegen die laxe Ehemoral sich<br />
christlich gebärdender Romantiker. Denken und Tun hätten <strong>nicht</strong><br />
in Einklang gestanden, wie Goethe es doch forderte. Der Dichter<br />
288<br />
hat Marianne <strong>von</strong> Willemer nie wiedergesehen. Den Schmerz<br />
hierüber bekunden die Dichtungen der Altersjahre.<br />
Ein anderes Beispiel ähnlicher Entsagung, des Liebesverzichts<br />
aus Gewissensgründen, fällt in die Jugendepoche, über die DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT berichtet, wo <strong>von</strong> Goethes "sittlichem Lebensbau"<br />
die Rede ist. (Kommen doch, wie schon Riemer wußte, bei<br />
Goethe dieselben Gedanken immer wieder vor, in "seiner jugendlichen,<br />
mittleren oder späteren Epoche".7 Es ist der den Erlebniskern<br />
für DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS bildende Liebesverzicht,<br />
<strong>von</strong> dem wir nun zu sprechen haben. DICHTUNG UND WAHRHEIT gibt<br />
hierüber anscheinend umfassende Informationen. In einem entscheidenden<br />
Punkt erweisen sie sich jedoch als unzureichend. Das<br />
understatement der Autobiographie läßt <strong>nicht</strong> erkennen, wie groß<br />
auch in diesem Fall die Versuchung war, der Goethe zu widerstehen<br />
hatte. Das Außerordentliche im Verlauf der Wertherkrise<br />
wird erst dann sichtbar, berücksichtigt man die Rolle, welche die<br />
ungeh<strong>eure</strong> Attraktionskraft des jungen Goethe spielte. Diese<br />
Attraktionskraft bildete ein Gefahrenmoment solcher Art, dass ein<br />
ganz anderer Ausgang nur allzu nahegelegen hätte. Woran zu denken<br />
ist, soll ein kurzer Überblick in Erinnerung bringen.<br />
Schon seit seinen Jünglingsjahren machte Goethe an sich die<br />
Erfahrung, dass <strong>von</strong> seiner Persönlichkeit die allergrößte, intenivste<br />
Wirkung auf Menschen ausging. Eine Anziehungskraft war<br />
ihm gegeben, die mit unwiderstehlicher Gewalt die Herzen gewann.<br />
Jüngere schlossen sich ihm an, Ältere wollten <strong>von</strong> ihm lernen.<br />
Wo er hinkam, stand er im Mittelpunkt, bildeten sich um ihn<br />
Kreise heiterer oder auch ernster Geselligkeit. Denken wir an den<br />
Studenten Goethe im Kreise Oesers, seine Wirkung unter den<br />
herrnhutischen Frommen in Frankfurt, an seine dominierende Roll<br />
in der Straßburger Tischgesellschaft ("er hatte die Regierung am<br />
Tisch, ohne daß er sie suchte"). Mittelpunkt ist Goethe im Kreis<br />
d r Darmstädter Gemeinschaft der Heiligen, gebildete Frauen<br />
chwärmten für ihn, Frauen <strong>von</strong> Freunden, denen Goethe deshalb<br />
7 Riemer a.a.O. 5. 128.<br />
289
<strong>nicht</strong> zu nahe trat, wie er in dichterischer Form andeutete. Im Kreise<br />
des Gießener Professors Höpfner - wir sind in der WERTHER<br />
Zeit - macht die Erscheinung Goethes furore: man läßt ihn "fast<br />
allein" sprechen, "verwundert und begeistert" hören alle dem<br />
"Götterjüngling" zu. "Götterkraft in seinem Wesen" schrieb ihm<br />
Heinse zu, und <strong>von</strong> götterähnlicher Wirkung Goethes bei festlichen<br />
Zusammenkünften spricht wiederholt Friedrich Heinrich Jacobi.<br />
Lavater empfand Goethes beherrschende Ausstrahlung als die eines<br />
"Königs", dem Männer und Frauen gleicherweise huldigten.<br />
Als "größtes Genie und zugleich der liebenswürdigste Mensch unserer<br />
Zeit" wird Goethe <strong>von</strong> Wieland gefeiert. Mit Worten wie "Königswürde",<br />
"echter Geisterkönig", "liebenswürdigster, größter<br />
und bester Menschensohn" sucht Wieland den Eindruck wiederzugeben,<br />
den der junge Goethe bei seiner Ankunft in Weimar<br />
machte. "Menschensohn" deutet auf Christus - so erschien Goethe<br />
dem Rationalisten Wieland, der damals berichtete: "Außer mir<br />
kniet' ich neben ihn, drückte meine Seele an seine Brust, und betete<br />
Gott an."<br />
So hat sich nie in Gottes Welt<br />
Ein Menschensohn uns dargestellt.<br />
Die Wielandschen Verse <strong>von</strong> Anfang 1776 spiegeln den gleichen<br />
Erlebnisbereich. Das Gedicht AN PSYCHE, dem sie entstammen,<br />
schildert das Charisma Goethes auch im Hinblick auf dessen erotische<br />
Ausstrahlung:<br />
Ein schöner Hexenmeister es war,<br />
Mit einem schwarzen Augen-Paar,<br />
Zaubernden Augen voll Götterblicken,<br />
Gleich mächtig zu töten und zu entzücken.<br />
Welche Wirkung auf Frauen vom jungen Goethe ausgegangen sein<br />
muß, darüber sind wir auch informiert durch die Autobiographie<br />
Hufelands: "Man kann sich keinen schöneren Mann vorstellen.<br />
Dabei sein lebhafter Geist und seine Kraft, die seltenste Vereinigung<br />
geistiger und körperlicher Vollkommenheit, groß, stark und<br />
290<br />
schön; in allen körperlichen Übungen: Reiten, Fechten, Voltigieren,<br />
Tanzen war er der Erste." So habe Goethe eine" wunderbare Revolution"<br />
durch sein Kommen in Weimar hervorgerufen: "Alle jungen<br />
Leute legten Goethes Uniform: gelbe Weste und Beinkleider<br />
und dunkelblauen Frack an, und spielten junge Werther [. .. ] Alles<br />
kam aus seinen Fugen." Wie "durchaus geliebt" und "angebetet"<br />
Goethe damals war, ist u. a. <strong>von</strong> Klinger und Schiller bezeugt.<br />
Der Bericht einer" vornehmen Dame" - überliefert <strong>von</strong> Zimmermann<br />
- läßt die unvergleichliche Verführungs gabe ahnen, die Goethe<br />
zu jener Zeit eigen war. <strong>Ihr</strong> zufolge sei Goethe damals gewesen:<br />
"der schönste Mensch, der lebendigste, originellste, der<br />
feurigste, ungestümste, der sanfteste, der verführerischste und der<br />
gefährlichste für das Herz einer Frau, den sie in ihrem Leben gesehen<br />
habe." Als Charlotte <strong>von</strong> Stein Goethe kennengelernt hatte,<br />
schrieb sie zunächst, ihrer Natur nach zur Kritik neigend, an Zimmermann:<br />
"Es ist <strong>nicht</strong> möglich, mit seinem Betragen kömmt er<br />
<strong>nicht</strong> durch die Welt; wenn unser sanfter Sittenlehrer gekreuz' get<br />
wurde, so wird dieser bittere zerhackt [ ... ] Ich fühl's, Goethe und<br />
ich werden niemals Freunde." Zwei Monate später schrieb sie an<br />
denselben Adressaten: "Jetzt nenn ich ihn meinen Heiligen."<br />
Aus solchen zeitgenössischen Zeugnissen - sie lassen sich vermehren<br />
- erhellt die eigentliche Situation in der 'Wertherkrise' . Sie<br />
lassen darauf schließen, welche Möglichkeiten Goethe gegeben<br />
waren, als er Lotte Kestner begegnete, und welche innere Kraft<br />
die Lebensentscheidung erforderte, die er damals traf: der Entschluß<br />
zum Verzicht. Was wir aus DICHTUNG UND WAHRHEIT erfahren,<br />
ist zusammengefaßt dies: im Sommer 1772, als Goethe am<br />
Reichskammergericht in Wetzlar tätig war, entstand ein Liebesverhältnis<br />
zwischen ihm und der Verlobten seines Freundes Kestner.<br />
Die drei, Kestner, Goethe und Lotte verbrachten zwei Monate als<br />
"unzertrennliche Gefährten". In Goethes ausführlichem Bericht<br />
heißt es weiter: "Sie hatten sich alle drei aneinander gewöhnt ohne<br />
es zu wollen, und wußten <strong>nicht</strong>, wie sie dazu kamen, sich <strong>nicht</strong><br />
ntbehren zu können." Den Zauber jener Epoche schildert DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT mit den Worten: "Und so nahm ein gemeiner<br />
Tag den andern auf, und alle schienen Festtage zu sein; der gan-<br />
291
ze Kalender hätte müssen rot gedruckt werden." Plötzlich aber,<br />
an einem Septembertag des Jahres 1772 verließ Goethe Wetzlar,<br />
ohne sich <strong>von</strong> Kestner und Lotte zu verabschieden. Das Verhältnis<br />
zu Lotte sei - so berichtet DICHTUNG UND WAHRHEIT - "leidenschaftlicher<br />
als billig" <strong>von</strong> Goethes Seite geworden. Da habe er,<br />
als die Eheschließung näherrückte, sich freiwilllig entfernt, um<br />
<strong>nicht</strong> "durch das Unerträgliche vertrieben" zu werden.<br />
Was Goethe erzählt, entspricht im ganzen den tatsächlichen<br />
Vorgängen, über die wir gut unterrichtet sind. Und doch fehlt in<br />
DICHTUNG UND WAHRHEIT etwas Entscheidendes. Goethe verschweigt,<br />
was sein eigentliches Verdienst in der damaligen Situation<br />
gewesen ist. In Wirklichkeit lagen doch die Dinge so: selbstverständlich<br />
hätte er damals Lotte für sich gewinnen, hätte er die<br />
Verlobte des Freundes diesem abspenstig machen können. Es wäre<br />
dazu <strong>nicht</strong>s weiter <strong>von</strong>nöten gewesen als der Entschluß Goethes,<br />
die ganze Macht seiner Persönlichkeit einzusetzen. War Goethe<br />
ernstlich willens, Menschen zu gewinnen, so konnte sich niemand<br />
dem entziehen. Er überwand alle Widerstände. Selbst ehemalige<br />
Gegner und Kritiker - wie Jacobi, Wieland, Charlotte <strong>von</strong> Stein -<br />
machte er zu seinen Adoranten. In diesem Fall aber, bei der Entscheidung<br />
um Kestners Lotte, unterließ Goethe es bewußt und freiwillig,<br />
<strong>von</strong> seiner Macht über die Menschen Gebrauch zu machen.<br />
Es war dies ein Akt des Entsagens, der "großen und kühnen Aufopferung",<br />
dass er verzichtete, sich eine Frau anzueignen, die<br />
schon vergeben war. Goethe versagte es sich, einem Freund sein<br />
Glück zu rauben und gab damit auf - wie später noch oftmals -<br />
das eigene Glück.<br />
Betrachtet man die Nachrichten aus der Wetzlarer Zeit genauer,<br />
so bedarf es nur einiger Aufmerksamkeit, um zu erkennen, dass<br />
tatsächlich ein solch freiwilliger Verzicht Goethes vorlag. Obgleich<br />
Kestner es in seinen Aufzeichnungen begreiflicherweise zumeist<br />
so hinstellt, als habe Lotte nie eigentlich geschwankt, so ist doch<br />
ersichtlich, wie sehr sie Goethe geliebt hat. Nach dessen plötzlicher<br />
Abreise war sie zu Tränen erschüttert. Entscheidend ist - neben<br />
vielen andern Zeugnissen - ein Geständnis Kestners, das er damals<br />
brieflich ablegte. Goethe habe - so schrieb er einem Freund -<br />
292<br />
"solche Eigenschaften, die ihn einem Frauenzimmer, zumal einem<br />
empfindenden und das <strong>von</strong> Geschmack ist, gefährlich machen<br />
können" - also war er Lotte gefährlich geworden. Kestner fährt<br />
fort: "Es entstanden bei mir innerliche Kämpfe, da ich auf der einen<br />
Seite dachte, ich möchte <strong>nicht</strong> imstande sein, Lottchen so<br />
glücklich zu machen, als er, auf der andern Seite aber den Gedanken<br />
<strong>nicht</strong> ausstehen konnte, sie zu verlieren." Demnach stand Kestner<br />
sehr wohl die Möglichkeit vor Augen, dass der weit überlegene<br />
Goethe Lotte gewinnen könnte und dass diese damit notwendig<br />
hätte glücklicher werden müssen als mit ihm. Es war Goethes freiwilliger<br />
Verzicht, dass es hierzu <strong>nicht</strong> kam. Welche Gesinnung hinter<br />
diesem Verzicht stand, das verrät einer der vielen Briefe Goethes<br />
an das Kestnersche Paar nach der Trennung. Darin heißt es:<br />
"Daß ich sie so lieb habe ist <strong>von</strong> jeher uneigennützig gewesen."<br />
Kein Zweifel also, dass bereits damals tatsächlich die Devise "Unigennützigkeit<br />
in Liebe und Freundschaft" <strong>von</strong> Goethe gekannt<br />
und befolgt, "ausgeübt" worden ist. Die Autobiographie sagt hierin<br />
<strong>nicht</strong>s als die lautere Wahrheit.<br />
Der WERTHER-Roman, der dieses Erlebnis spiegelt, wurde<br />
geschrieben anderthalb Jahre nach Goethes Trennung <strong>von</strong> Lotte.<br />
Es traf sich merkwürdig, dass Goethe während der Niederschrift<br />
des Romans - die in wenigen Wochen, Frühjahr 1774, erfolgte -<br />
nochmals in einen Spannungszustand versetzt wurde ähnlich dem<br />
im Roman geschilderten. Im Januar 1774 heiratete die 18jährige<br />
Maximiliane La Roche, Tochter der Schriftstellerin Sophie <strong>von</strong> Laroche,<br />
den Frankfurter Kaufmann Brentano. Für Maximiliane, die<br />
spätere Mutter <strong>von</strong> Clemens und Bettina Brentano, faßte Goethe<br />
bereits eine sehr intensive Neigung, seit er sie im Herbst 1772, nach<br />
s inem Weggang <strong>von</strong> Wetzlar, kennengelernt hatte. Deshalb wurde<br />
es ihm zu einem tiefschmerzlichen Erlebnis, als sie Anfang 1774<br />
nach Frankfurt zog, nun aber verheiratet mit einem viel älteren<br />
Manne, den sie <strong>nicht</strong> liebte. Ungewollt fiel Goethe eine Zeitlang<br />
die Rolle des Hausfreundes zu, der die junge Frau trösten mußte<br />
- wie Merck damals schrieb - über den Geruch <strong>von</strong> Öl und Käse<br />
im Hause des Kaufmanns und über dessen schlechte Manieren.<br />
01 HTUNG UND WAHRHEIT teilt mit, dass diese Erlebnisse den un-<br />
293
Faksimile wiedergegeben nach: DER JUNGE G OETHE. Neu bearbeitete Ausgabe in fünf<br />
Bänden. Hrsg. <strong>von</strong> Hanna Fischer-Lamberg. Bd. IV. Berlin 1968. S. 325.<br />
296<br />
Mit der bedeutsamen Lebensentscheidung, die das Uneigennützigsein<br />
in Liebe und Freundschaft zum Gesetz machte, hat Goethe<br />
wirklich die Wege seiner künftigen Existenz vorgebildet. Viele<br />
Male wurde später <strong>von</strong> ihm das Gesetz erfüllt. Es entstand aber -<br />
dies gilt es festzuhalten - bereits das Jugendwerk, das Goethe den<br />
größen Erfolg seiner literarischen Laufbahn brachte, der WERTHER,<br />
auf ähnliche Weise im Geiste des Entsagens wie soviele der großen<br />
Dichtungen späterer Epochen. In DICHTUNG UND WAHRHEIT wird<br />
der Einschnitt, den die den WERTHER-Roman begleitende Lebensentscheidung<br />
machte, einmal bezeichnet mit den Worten: die wahre<br />
Sehnsucht dürfe nur auf ein Unerreichbares gerichtet sein (Buch<br />
12). Dieser Satz gilt fürs ganze Leben Goethes und bestimmte weitgehend<br />
sein Verhältnis zu Frauen. Bekanntlich war es zumeist die<br />
unerreichbare, die entfernte Geliebte, die Goethe als dichterisch<br />
Schaffenden am meisten inspirierte.<br />
Der WERTHER-Roman ist alles andere als etwa die eindeutige<br />
und womöglich prahlerische Darstellung eines moralischen Sieges.<br />
Was der Dichter sich als Verdienst anrechnen durfte, darüber<br />
sprach er <strong>nicht</strong>. Das Kreuz, das er auf sich nahm, das er in der<br />
erwähnten Briefunterschrift einmal andeutungsweise sehen ließ,<br />
im Werke hielt er es verborgen. DICHTUNG UND WAHRHEIT tut ein übriges,<br />
die wirkliche moralische Leistung zu verschleiern, z. B.<br />
wenn Goethe dort DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS eine Beichte<br />
nennt. Nach der Niederschrift, so heißt es, habe der Dichter sich<br />
"wie nach einer Generalbeichte wieder froh und frei gefühlt". Mit<br />
derartigem lenkt Goethe eher <strong>von</strong> der Hauptsache ab. Es gab<br />
<strong>nicht</strong>s zu "beichten". Vielmehr hätte die Möglichkeit bestandenandere<br />
Poeten hätten sie <strong>nicht</strong> vorbeigelassen - auf Grund der<br />
igenen Verdienste als mahnender Prophet aufzutreten und direkt<br />
ufzufordem: handelt so wie ich, begeht keinen Ehebruch, entsagt,<br />
verzichtet, seid uneigennützig ... Nichts da<strong>von</strong> gab er dem Werke<br />
mit. Ganz anders ging Goethe vor. Wie so oft später kehrt er<br />
auch hier die Erfahrungen seines Lebens um. Er stellt <strong>nicht</strong> dar,<br />
wie er sich verhielt, der im Besitz ungewöhnlicher moralischer<br />
Kräfte war und die Stärke besaß, auch aus der verführendsten<br />
ituation herauszufinden. Vielmehr schildert er einen gutgearte-<br />
297
so stand ihm natürlich die WERTHER-Zeit vor Augen. Von ihr wußte<br />
Goethe mit Sicherheit, wievieles er Spinoza damals verdankte.<br />
So mag er während der Abfassung des Fragments zu dem Entschluß<br />
gekommen sein, über das Thema Spinoza erst in einem späteren<br />
Buch <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT zu sprechen, bei Charakterisierung<br />
der Wertherzeit. Plötzlich ward sich Goethe vermutlich<br />
darüber klar, wieviel reicher, dankbarer die Behandlung dieses<br />
Stoffes dann zu gestalten wäre; so plötzlich, dass er, beim Diktat<br />
an den Namen des "geliebten" Philosophen gekommen, innehielt<br />
und schließlich abbrach. Erst zwei Jahre danach, 1813, verfaßte er<br />
die Spinoza-Abschnitte, die wir kennen. Ihnen gegenüber verhalten<br />
sich die Betrachtungen <strong>von</strong> Jugend-Epoche wie eine erste Improvisation.<br />
Bei Vergleichung des Inhalts zeigt sich das Frühere dem Späteren<br />
gegenüber durchweg verwandt. Doch findet sich in dem<br />
Fragment Jugend-Epoche ein Gesichtspunkt, der Goethes Einstellung<br />
zu Spinoza verdeutlicht, über das in DICHTUNG UND W AHR<br />
HEIT Gesagte hinaus. Die Spinoza-Partien <strong>von</strong> 1813 enthalten prinzipiell<br />
die nämlichen Gedanken wie das Fragment <strong>von</strong> 1811. Was<br />
Goethe hier "Mäßigkeit" nennt, bezeichnet er dort als Beruhigung<br />
der Leidenschaften, ausgleichende Ruhe, Friedensluft usw. Wie im<br />
Fragment so wird auch in Buch 14 hingewiesen auf den "Kontrast"<br />
zwischen Mäßigkeitsanspruch und Leidenschaftlichkeit des Jugendalters.<br />
In den eingangs <strong>von</strong> uns zitierten Sätzen aus Buch 16<br />
findet sich die überzeugendste Parallele zu den Gedanken des<br />
Schlußsatzes <strong>von</strong> Jugend-Epoche. Wird hier gesagt: die "Umgebungen<br />
beschränken uns, wir mögen uns stellen wie wir wollen",<br />
so heißt es dort: Gesellschaft, Sitten, Philosophie usw., "alles<br />
ruft uns zu, dass wir entsagen sollen".<br />
Unter einem andern Aspekt gesehen ist im Fragment, was Goethe<br />
als das Heilmittel gegen Beschränkung durch die" Umgebungen"<br />
bezeichnet. Es taucht der Begriff der Freiheit auf. In Jugend-Epoche<br />
sagt Goethe, er habe gesucht, sich "i n n e r li c h<br />
unabhängig zu machen". DICHTUNG UND WAHRHEIT nennt als Arkanum<br />
gegen die <strong>von</strong> außen andringenden Entsagungsansprüche:<br />
Beruhigung der Leidenschaften, "Resignieren im ganzen". Es<br />
304<br />
ist aber daran zu erinnern, dass beides für Goethe wesensgleich<br />
war. In dem Begriff der inneren Freiheit ist befaßt, was totale Resignation<br />
ihm bedeutete. Angesichts der Spärlichkeit seiner Mitteilungen<br />
über Spinoza darf uns jedes Wort <strong>von</strong> Wert sein, das die<br />
Be<strong>kennt</strong>nisse der Autobiographie ergänzt. Zwar sagt Goethe auch<br />
in dieser (Buch 14) andeutend ähnliches wie im Fragment: er habe<br />
sich "in aller Welt um ein Bildungsmittel umgesehn" und sei endlich<br />
auf Spinozas ETHIK geraten. Der nun folgende, auf den Freiheitsbegriff<br />
bezügliche Passus ist aber wieder so versteckt in der<br />
Formulierung, dass man den Inhalt kaum erfaßt: "Was ich mir aus<br />
dem Werke mag herausgelesen, was ich in dasselbe mag hineingelesen<br />
haben, da<strong>von</strong> wüßte ich keine Rechenschaft zu geben, genug<br />
ich fand hier eine Beruhigung meiner Leidenschaften,<br />
es schien sich mir eine große und freie Aussicht über die sinnliche<br />
und sittliche Welt aufzutun." Mit Rückblick auf das Fragm nt<br />
Jugend-Epoche läßt sich dem entnehmen: Spinozas Entsagungslehr<br />
brachte Goethe innere Freiheit.<br />
Suchen wir nach weiteren Erweisen, dass totale Resignation<br />
und innere Freiheit für Goethe zusammengehörten, so verhelf n<br />
uns zur Einsicht erstens Spinozas ETHIK und zweitens Goeth eh<br />
Dichtung. Bei Spinoza ist das ethische Postulat, das Goeth<br />
"im ganzen Resignieren" bezeichnet, genannt: Macht üb<br />
Affekte erlangen. Diese Macht über die Affekte aber ist es, di Spjnoza<br />
zufolge dem Menschen einzig innere Freiheit, "Freih it<br />
Geistes" gibt. Das letzte Buch seiner ETHIK, das lehrt, Macht ü '<br />
die Affekte zu erlangen (durch den Intellectus), ist denn au h<br />
titelt: Von der menschlichen Freiheit. In solcher Form erschi n cl<br />
Deterministen Spinoza Freiheit möglich und höchstes Gut.<br />
the, mit seiner Sympathie für deterministische Weltanschauun n<br />
(Spinoza, Calvinismus, Islam), dachte <strong>nicht</strong> viel anders.<br />
Innerhalb <strong>von</strong> Goethes Dichtung legt die folgende Stanz<br />
dem Fragment DIE GEHEIMNISSE Zeugnis ab, dass totale Ent<br />
(hier heißt es: "sich Überwinden") und innere Befreiung g<br />
über der einengenden Außenwelt unlösbar zusammenhän<br />
wesensgleich sind:
gab. Aus MEINEM LEBEN. DICHTUNG UND WAHRHEIT - diese vorsichtige<br />
Formulierung gibt Rechenschaft über das nach bestem Gewissen<br />
zu Leistende. Wahrheit ist angestrebt, doch kann ein Bericht aus<br />
später Rückschau das faktisch Gewesene weder lückenlos noch vollkommen<br />
genau wiedergeben. Die "Erinnerung" wird das Vergangene<br />
notwendig "bildend modeln". In diesem Sinne erklären Goethes<br />
TAG- UND JAHREs-HEFTE im Abschnitt 1811 den Titel des Werks:<br />
Ich hatte die Entwicklung eines bedeutend gewordenen Kindes, wie sie sich<br />
unter gegebenen Umständen hervorgetan, aber doch wie sie im Allgemeinen<br />
dem Menschenkenner und dessen Einsichten gemäß wäre, darzustellen.<br />
In diesem Sinne nannt' ich bescheiden genug ein solches mit sorgfältiger<br />
Treue behandeltes Werk: Wahrheit und Dichtung, innigst überzeugt, daß der<br />
Mensch in der Gegenwart, ja vielmehr noch in der Erinnerung die Außenwelt<br />
nach seinen Eigenheiten bildend modele.<br />
Gegen die Möglichkeit, den Titel irrig dahingehend auszulegen,<br />
dass er die vorsätzliche Beimischung <strong>von</strong> rein Fiktivem ankündige,<br />
verwahrt sich der 80jährige Goethe in einem Brief an König Ludwig<br />
I. <strong>von</strong> Bayern. Dem hier Gesagten maß er solche Bedeutung<br />
bei, dass er es abschriftlich Zelter mitteilte; er wußte, dass die betreffenden<br />
Sätze dann bald nach seinem Tode innerhalb der vorausbestimmten<br />
Veröffentlichung des Briefwechsels mit Zelter dem<br />
Publikum zu Gesicht kommen würden. Das am 17. Dezember 1829<br />
abgefaßte, für das Verständnis <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT so wichtige<br />
Dokument lautet:<br />
308<br />
Was den freilich einigermaßen paradoxen Titel der Vertraulichkeiten aus<br />
meinem Leben Wahrheit und Dichtung betrifft, so ward derselbige durch<br />
die Erfahrung veranlaßt, daß das Publikum immer an der Wahrhaftigkeit<br />
solcher biographischen Versuche einigen Zweifel hege. Diesem 'zu begegnen,<br />
bekannte ich mich zu einer Art <strong>von</strong> Fiktion, gewissermaßen ohne Not,<br />
durch einen gewissen Widerspruchs-Geist getrieben, denn es war mein<br />
ernstestes Bestreben das eigentliche Grundwahre, das, insofern ich es einsah,<br />
in meinem Leben obgewaltet hatte, möglichst darzustellen und auszudrücken.<br />
Wenn aber ein solches in späteren Jahren <strong>nicht</strong> möglich ist, ohne<br />
die Rückerinnerung und also die Einbildungskraft wirken zu lassen, und<br />
man also immer in den Fall kommt gewissermaßen das dichterische Vermögen<br />
auszuüben, so ist es klar, daß man mehr die Resultate und, wie wir uns<br />
das Vergangene jetzt denken, als die Einzelheiten, wie sie sich damals ereig-<br />
neten, aufstellen und hervorheben werde. Bringt ja selbst die gemeinste Chronik<br />
notwendig etwas <strong>von</strong> dem Geiste der Zeit mit, in der sie geschrieben<br />
wurde. Wird das vierzehnte Jahrhundert einen Kometen <strong>nicht</strong> ahnungsvoller<br />
überliefern als das neunzehnte? Ja ein bedeutendes Ereignis wird man, in<br />
derselben Stadt, Abends anders als des Morgens erzählen hören. Dieses alles,<br />
was dem Erzählenden und der Erzählung angehört, habe ich hier unter<br />
dem Worte: Dichtung, begriffen, um mich des Wahren, dessen ich mir bewußt<br />
war, zu meinem Zweck bedienen zu können. Ob ich ihn erreicht habe<br />
überlass' ich dem günstigen Leser zu entscheiden, da denn die Frage sich<br />
hervortut: ob das Vorgetragene kongruent sei? ob man daraus den Begriff<br />
stufenweiser Ausbildung einer, durch ihre Arbeiten schon bekannten Persönlichkeit<br />
sich zu bilden vermöge.<br />
Mit der Umsicht des echten Historikers weist Goethe hier auf etwas<br />
hin, das grundsätzlich <strong>von</strong> allen autobiographischen Schriften<br />
gilt: Selbstdarstellungen sind stets zugleich Selbstdeutungen.<br />
Ein genaues Bild des Gewesenen können sie niemals vermitteln,<br />
das Vermögen der "Rückerinnerung" hat seine natürlichen Grenzen,<br />
unvermeidlich mischt sich die "Einbildungskraft" hinein. So<br />
entsteht aus geschichtlicher Wahrheit und deutendem Erinnern ein<br />
Drittes, dessen Wert vom historischen Gesichtspunkt aus notwendig<br />
problematisch bleiben muß. Ausschlaggebend ist, welche Persönlichkeit,<br />
welcher Charakter dem Berichtenden eignet. Wenn es<br />
ihm so sehr wie Goethe darum geht, das "eigentliche Grundwahre"<br />
darzustellen, so wird jenes resultierende Dritte <strong>von</strong> großer Bedeutung<br />
sein. Es besitzt dann eine eigene Realität, die der Realität des<br />
wirklich Gewesenen ebenbürtig zur Seite steht.<br />
Der Begriff "stufenweiser Ausbildung" ist einer der wesentlichsten<br />
Bestandteile jenes "Grundwahren", <strong>von</strong> dem GoethesAutobiographie<br />
Mitteilung macht. Entwicklung, inneres Fortschreiten<br />
in jedem Moment und in atemberaubendem Tempo - das ist eine<br />
Eigenheit, die Goethe, den Menschen und Dichter, auszeichnet und<br />
<strong>von</strong> anderen grundsätzlich unterscheidet. "Wenn ich ihn drei Tage<br />
<strong>nicht</strong> gesehen hatte, so kannte ich ihn <strong>nicht</strong> mehr; so riesenhaft<br />
waren die Fortschritte, die er in seiner Vervollkommnung machte."<br />
Das sagte Goethe <strong>von</strong> Schiller (zu Carl Friedrich <strong>von</strong> Conta),<br />
aber <strong>nicht</strong> weniger galt es <strong>von</strong> Goethe selber. Darum weist DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT auf dieses Fortschreiten, dies unvergleichliche<br />
309
Schauspiel einer Vervollkommnung als auf das Allerwesentlichste.<br />
Hier liegt das eigentliche fabula docet des Buches. Wenn Goethe<br />
auf diesen Zug hin die Vergangenheit deutete - und er brauchte<br />
hier <strong>nicht</strong> viel umzudeuten -, so geschah das mit Berechtigung und<br />
Sinn. Er traf damit ein "Grundwahres", das zugleich im höchsten<br />
Maße anregend und erzieherisch wirkte. Seine Autobiographie<br />
wird gerade durch diese Besonderheit zur "moralischen Schrift",<br />
und noch der für alle Literaturgeschichtsschreibung so fruchtbar<br />
gewordene Gedanke der Entwicklung geht <strong>nicht</strong> zuletzt auf die<br />
Wirkung <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT zurück - vor diesem Buch<br />
wußte man hier<strong>von</strong> <strong>nicht</strong> allzu viel.<br />
Entstehung<br />
Als Goethe im Alter <strong>von</strong> 60 Jahren daranging, sein Leben zu schildern,<br />
war er für diese Aufgabe in ganz besonderer Weise vorbereitet.<br />
Die Arbeiten am Historischen Teil seiner FARBENLEHRE hatten<br />
ihn soeben in umfassendster Weise mit den Problemen der<br />
Geschichtsschreibung vertraut gemacht. Zweierlei hatte er hier gelernt:<br />
sich durch ingeniöses Studium <strong>von</strong> Quellen rasche Einsicht<br />
in historische Verhältnisse zu verschaffen, dann aber auch eine Form<br />
zu entwickeln, in der er Geschichte darstellen konnte, wie es seiner<br />
Schriftstellereigenheit gemäß war. Für das gesamte wissenschaftliche<br />
Schreiben Goethes, das ja erst im Alter breiten Umfang<br />
annahm, wurden jene Arbeiten an der Geschichte der Farbenlehre<br />
richtungweisend. Für DICHTUNG UND WAHRHEIT bedeuten sie eine<br />
der wesentlichen schicksalhaften Voraussetzungen, die das Werk<br />
zu einem so außergewöhnlichen Buch machten. Nur weil Goethe<br />
bereits tief durchdrungen war vom Geist der Historie, weil er ihre<br />
Technik schon weitgehend beherrschte, als er sein Leben zu schildern<br />
begann, bekam seine Autobiographie auch als Geschichtswerk<br />
jene überragende Qualität, die an ihm geschätzt wird.<br />
Diese schicksalhaften Voraussetzungen erklären auch die verhältnismäßige<br />
Leichtigkeit, mit der die Arbeit an DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT <strong>von</strong>statten ging. Dabei verfuhr Goethe hier ebenso gründ-<br />
310<br />
lich wie bei allem, was er unternahm. Im Herbst 1809 schrieb er<br />
ein chronologisches Schema nieder als erste Vorbereitung auf das<br />
geplante Werk. Darin wurden, unter Jahreszahlen geordnet, die<br />
wichtigsten Ereignisse in Stichworten für den Zeitraum 1742 bis<br />
1809 vermerkt. Detailliertere Schemata folgten 1810. Dies Jahr verwendete<br />
Goethe im übrigen auf verschiedenartige Vorstudien. Aus<br />
Frankfurt besorgte er sich allerlei Nachrichten und dokumentarische<br />
Unterlagen <strong>von</strong> Bettina Brentano und Joh. Friedr. Heinrich<br />
Schlosser. Vor allem begann er systematisch, eine ausgebreitete<br />
Lektüre zu treiben. Über Geschichte, Literatur, Philosophie des<br />
18. Jahrhunderts informierte er sich aus einschlägigen Werken. Daneben<br />
las er Historiker wie Tacitus und Johannes <strong>von</strong> Müller, um<br />
sich an großen Mustern der Geschichtsschreibung zu orientieren.<br />
Dass im Winter 1810/11 der lange ins Auge gefaßte Plan einer Biographie<br />
<strong>von</strong> Philipp Hackert endlich ausgeführt werden konnte,<br />
war ebenfalls dem größeren Vorhaben dienlich. Die Arbeit an der<br />
Biographie des ihm befreundeten Malers stellte gleichsam eine letzte<br />
Etüde für die eigene Lebensschilderung dar.<br />
Erst im Jahre 1811, unmittelbar im Anschluß an die Abfassung<br />
der Hackert-Biographie, begann Goethe mit der Arbeit an DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT. Zunächst stellte er zusammenhängend die<br />
wichtigsten Episoden der beiden ersten Teile dar. Durch Vorlesungen<br />
- bei Christiane und ihren Freundinnen sowie bei der<br />
Herzogin - suchte er sich der guten Wirkung seiner "biographischen<br />
Aufsätze" zu vergewissern. Im Mai 1811 wurde eine "Einteilung<br />
in Bücher" vorgenommen (Tagebuch 20. Mai 1811). Zunächst<br />
dachte Goethe noch daran, jedem Teil den Umfang <strong>von</strong> sechs<br />
Büchern zu geben, wobei ihm sicherlich das Vorbild der Rousseauschen<br />
CONFESSIONS vorschwebte. (Die CONFESSIONS enthalten zwei<br />
Teile zu je sechs Büchern.) Bei der Redaktion des ersten Teils ergab<br />
sich dann jedoch die Fünf-Bücher-Einteilung, wie wir sie kennen,<br />
als die praktischere Lösung.<br />
Im Oktober 1811 lag bereits der erste Teil <strong>von</strong> DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT gedruckt vor. In Anbetracht der Schwierigkeit und Fülle<br />
des bewältigten Stoffes war das Buch in erstaunlicher Geschwindigkeit<br />
entstanden. Erklärbar ist das wohl nur durch die bei der<br />
311
Geschichte der FARBENLEHRE erworbene technische Versiertheit, <strong>von</strong><br />
der wir sprachen. Doch kam noch etwas anderes hinzu. Goethe<br />
arbeitete an DICHTUNG UND WAHRHEIT mit einer durch Enthusiasmus<br />
gespornten Intensität, vergleichbar durchaus jener, die ihn DIE<br />
LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS oder DIE WAHLVERWANDTSCHAFfEN in so<br />
rätselhaft kurzer Zeit zu schreiben befähigte. Rückblickend deuten<br />
noch die TAG- UND JAHREs-HEFfE auf diese Besonderheit hin, wo<br />
es im Abschnitt 1811 mit Bezug auf die Arbeit am ersten Teil <strong>von</strong><br />
DICHTUNG UND WAHRHEIT heißt:<br />
Dieses Geschäft, insofern ich durch geschichtliche Studien und sonstige Lokal-<br />
und Personen-Vergegenwärtigung viel Zeit aufzuwenden hatte, beschäftigte<br />
mich wo ich ging und stand, zu Hause wie auswärts, dergestalt daß<br />
mein wirklicher Zustand den Charakter einer Nebensache annahm.<br />
Ein Beispiel mag verdeutlichen, mit welcher Intensität Goethe damals<br />
arbeitete. Zur Darstellung der schwierigen, in der Hauptsache<br />
auf Quellen beruhenden Partien über die Wahl und Krönung im 5.<br />
Buch benötigte der Dichter kaum mehr als 14 Tage, wobei noch<br />
das Studium der Quellenschriften einbegriffen ist.<br />
In ähnlich kurzer Zeit entstand im Jahre 1812 der zweite Teil.<br />
Etwas länger zog sich die Arbeit am dritten Teil hin. Die politische<br />
Entwicklung, die schließlich zur Schlacht bei Leipzig führte, bedrängte<br />
Goethe äußerlich und innerlich. So schrieb er <strong>von</strong> Teplitz<br />
aus - wohin er sich vor dem Kriegsgeschehen geflüchtet hatte -<br />
am 24. Juli 1813 an Riemer (WA IV 23, 410):<br />
Ich wünsche nur daß man <strong>nicht</strong> sagen möge: in doloribus pictam esse tabulam.<br />
Leider habe ich mich nie in einer so ungünstigen Lage befunden als<br />
diese letzten Monate, wo die Krankheit Johns , durch das<br />
innere Mißverhältnis, das jetzt unvermeidliche Gegenstreben gegen das Äußere<br />
höchst schwer machte.<br />
Die widrigen Begleitumstände bei seiner ,Entstehung merkt man<br />
dem dritten Teil <strong>nicht</strong> an, der sogar Episoden <strong>von</strong> besonders heiterer<br />
Prägung enthält. Lange Zeit trug sich Goethe mit der Absicht,<br />
diesen Teil mit dem Aufbruch nach Weimar enden zu lassen, also<br />
noch vieles was jetzt im vierten Teil steht, schon einzubeziehen,<br />
312<br />
und das Werk auf die Weise vorläufig abzuschließen. Das erwies<br />
sich bei der endgültigen Redaktion des dritten Teils aus räumlichen<br />
Gründen als unmöglich.<br />
Der vierte Teil hat eine ganz andere Entstehungsgeschichte als<br />
die übrigen, er ist ein Nachzügler, ein opus postumum. Noch aus<br />
dem Kriegsjahr 1813 stammen - dies zu wissen ist <strong>von</strong> Bedeutung<br />
- die wichtigen Partien über Spinoza (Anfang des 16. Buchs) sowie<br />
über das Dämonische und (Schluß des 20. Buchs). Beide waren ursprünglich<br />
noch für das 15. Buch bestimmt gewesen. Die Ausführung<br />
des übrigen schob Goethe seit 1813 immer wieder hinaus.<br />
Als Eckermann 1824 das Manuskript las, war das meiste "nur in<br />
Andeutungen" vorhanden, das heißt in mehr oder weniger ausgeführten<br />
schematischen Aufzeichnungen, die wir noch besitzen.<br />
Die eigentliche Ausarbeitung erfolgt dann - unter beratender Teilnahme<br />
Eckermanns -1830 und 1831. Veröffentlicht ward der vierte<br />
Teil erst nach Goethes Tod (1833).<br />
Schon während der Arbeit am ersten Teil war Goethe sich darüber<br />
schlüssig geworden, dass er in DICHTUNG UND WAHRHEIT keinesfalls<br />
über sein gesamtes Leben berichten werde. Damals bereits<br />
plante er, mit der Schilderung des Aufbruchs nach Weimar, der im<br />
November 1775 erfolgte, das Werk zu beschließen. 1 Allerdings<br />
tauchte später - noch 1825/26 - gelegentlich doch der Gedanke<br />
auf, einen fünften Teil <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT zu schreiben,<br />
der die ersten zehn Jahre in Weimar (vor der Italienischen Reise)<br />
behandeln sollte. Ausschlaggebend für die Aufgabe dieses Projekts<br />
war die Schwierigkeit, dass eine Schilderung der abenteuerlichen<br />
Frühweimarer Zeit die lokalen Persönlichkeiten und Verhältnisse<br />
mit zuviel Offenheit hätte darstellen müssen. "Häufige und<br />
dringende Vorstellungen" seiner Freunde, diesen Teil <strong>von</strong> DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT trotzdem zu schreiben, beschied er abweisend;<br />
so gegenüber dem Kanzler <strong>von</strong> Müller:<br />
Pauline Gotter an Schelling, 7. Sept. 1811 (Aus Schellings Leben. Hg. v. Plitt. Bd 2.<br />
Leipzig 1870. S. 264) .<br />
313
Die wahre Geschichte der ersten zehn Jahre meines Weimarischen Lebens<br />
könnte ich nur im Gewande der Fabel oder eines Märchens darstellen; als<br />
wirkliche Tatsache würde die Welt es nimmermehr glauben. Kommt doch<br />
jener Kreis, wo auf hohem Standort ein reines Wohlwollen und gebührende<br />
Anerkennung - durchkreuzt <strong>von</strong> den wunderlichstenAnforderungen - ernstliche<br />
Studien neben verwegensten Unternehmungen, und heiterste Mitteilungen<br />
trotz abweichenden Ansichten sich betätigten, mir selbst, der das alles<br />
mit erlebt hat, schon als ein mythologischer vor. Ich würde Vielen weh, vielleicht<br />
nur Wenigen wohl, mir selbst niemals Genüge tun; wozu das? Bin ich<br />
doch froh, mein Leben hinter mir zu haben; was ich geworden und geleistet,<br />
mag die Welt wissen; wie es im Einzelnen zugegangen, bleibe mein eigenstes<br />
Geheimnis.<br />
Weitere autobiographische Schriften<br />
Das autobiographische Interesse war indessen durch die Beschäftigung<br />
mit DICHTUNG UND WAHRHEIT in Goethe so rege geworden,<br />
dass er es nie mehr ganz aus den Augen verlor. Unter der Devise<br />
Aus meinem Leben ließ er noch die dreiteilige ITALIENISCHE REISE<br />
folgen 2 ), sowie die KAMPAGNE IN FRANKREICH. 3 Die wichtigste Ergänzung<br />
<strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT waren die TAG- UND JAHRES<br />
HEFTE, deren Abfassung ihn in Abständen <strong>von</strong> 1817 bis 1830 beschäftigte.<br />
Hinzu kommen die historischen Berichte über seine<br />
Arbeiten auf den verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebieten.<br />
Mit besonderer Sorgfalt führte er auch in diesen Jahrzehnten seine<br />
Tagebücher, sorgte überdies durch planmäßiges Sammeln <strong>von</strong> Akten<br />
und Briefen für eine vollkommene dokumentarische Erhellung<br />
seiner Altersjahre. Es verging praktisch seit 1819 bis zu Goethes<br />
Tod kaum ein Jahr, in dem der Dichter sich <strong>nicht</strong> auch autobiographischen<br />
Arbeiten widmete.<br />
In den Darstellungen seines Lebens schlug Goethe zwei grundsätzlich<br />
verschiedene Wege ein: das ausführliche Schildern längerer<br />
Epochen in erzählerischem Zusammenhang, wie es DICHTUNG<br />
UND WAHRHEIT zeigt, aber in etwas abgewandelter Form auch die<br />
2 ausgearbeitet 1813 bis 1817 und 1828 bis 1829.<br />
3 geschrieben 1820 bis 1822.<br />
314<br />
ITALIENISCHE REISE und die KAMPAGNE IN FRANKREICH; sodann das<br />
resümierende Zusammenfassen, die schlichte Aufzählung dessen,<br />
was sich in einzelnen Lebensjahren an Bedeutendem ereignet hatte.<br />
Dies war die Schilderungsweise in den TAG- UND JAHRES-HEFTEN,<br />
die in ihrer lakonischen Nüchternheit mehr einen Tätigkeitsbericht<br />
geben als eine eigentliche Biographie.<br />
In den ausführlich erzählenden Schriften steht das Leben des<br />
Dichters, in den resümierenden TAG- UND JAHRES-HEFTEN das des<br />
TheaterIeiters und vor allem des Gelehrten im Vordergrund. Dies<br />
entspricht auch der Perspektive, unter der Goethe im Alter sein<br />
Leben zu überschauen pflegte. Die in DICHTUNG UND WAHRHEIT<br />
geschilderte Zeit betrachtete er als die seines "Privat- und ersten<br />
Autorlebens", es war die Epoche, in der er "sich noch ganz selbst<br />
angehörte" (an Cotta, 12. November 1812). Seit er sich in Weimar<br />
festgesetzt hatte - so erschien es ihm später -, führte er im allgemeinen<br />
das "Leben eines Gelehrten", <strong>von</strong> dem er bescheiden genug<br />
zu Eckermann sagte: "Das Leben eines deutschen Gelehrten, was<br />
ist es? Was in meinem Fall daran etwa Gutes sein möchte, ist <strong>nicht</strong><br />
mitzuteilen, und das Mitteilbare ist <strong>nicht</strong> der Mühe wert." Mit dieser<br />
Erklärung wollte er begründen,warum in den TAG- UND JAHRES<br />
HEFTEN die "Epoche seines späteren Lebens <strong>nicht</strong> die Ausführlichkeit<br />
des Details haben könne, wie die Jugendepoche <strong>von</strong> Wahrheit<br />
und Dichtung". Damals sagte er zu Eckermann:4<br />
Ich muß diese späteren Jahre mehr als Annalen behandeln; es kann darin<br />
weniger mein Leben als meine Tätigkeit zur Erscheinung kommen. Überhaupt<br />
ist die bedeutendste Epoche eines Individuums die der Entwickelung,<br />
welche sich in meinem Fall mit den ausführlichen Bänden <strong>von</strong> Wahrheit und<br />
Dichtung abschließt. Später beginnt der Konflikt mit der Welt, und dieser<br />
hat nur insofern Interesse als etwas dabei herauskommt.<br />
Aber <strong>nicht</strong> nur was bei Goethes Tätigkeit "herausgekommen" ist,<br />
stellen die TAG- UND JAHREs-HEFTE ins Licht, sondern vor allem auch<br />
das Wesen dieser Tätigkeit selbst: das beispielhafte strebende Sichbemühen<br />
eines, dessen "Acker", wie es im WEST-ÖSTLICHEN DIVAN<br />
4 27. Januar 1824 (Houben 65 f.).<br />
315
heißt, "die Zeit" war, die pausenlos zu Welt- und Gotterforschung<br />
genutzte Zeit:<br />
Ich habe es mir ein halbes Jahrhundert lang sauer genug werden lassen. Ich<br />
kann sagen, ich habe in den Dingen, die die Natur mir zum Tagewerk bestimmt,<br />
mir Tag und Nacht keine Ruhe gelassen und mir keine Erholung<br />
gegönnt, sondern immer gestrebt und geforscht und getan so gut und soviel<br />
ich konnte. Wenn jeder <strong>von</strong> sich dasselbe sagen kann, so wird es um alle gut<br />
stehen. 5<br />
Genau das, was diese Sätze besagen, sucht Goethes unablässiges<br />
autobiographisches Bemühen in dauerhafter Form zu überliefern.<br />
Heiterkeit der Darstellung<br />
Die TAG- UND JAHRES-HEFrE machen es auf jeder Seite deutlich, dass<br />
Goethe, wie er zu Eckermann sagte, in den fünfundsiebzig Jahren<br />
seines Lebens "keine vier Wochen eigentliches Behagen gehabt",<br />
dass es das "ewige Wälzen eines Steines" war, "der immer <strong>von</strong><br />
neuem gehoben sein wollte". In DICHTUNG UND WAHRHEIT steht dasselbe<br />
mehr zwischen den Zeilen, doch kommt es immer noch wahrnehmbar<br />
genug zum Ausdruck.<br />
Charakteristisch für DICHTUNG UND WAHRHEIT ist eine Grundstimmung<br />
der Heiterkeit, die sich durch das ganze Werk zieht und ihm<br />
seinen besondern, eigentümlichen Reiz verleiht. Diese Heiterkeit<br />
wurde dem Buch ganz absichtlich <strong>von</strong> Goethe verliehen. Schon in<br />
den ersten Anfängen der Ausarbeitung war hier<strong>von</strong> die Rede. "Jeder<br />
der eine Confession schreibt, ist in einem gefährlichen Falle,<br />
lamentabel zu werden, weil man nur das Morbose, das Sündige<br />
be<strong>kennt</strong> und niemals seine Tugenden beichten soll."6 In dieser Betrachtung<br />
setzt Goethe sich - auch wenn das <strong>nicht</strong> ausdrücklich<br />
gesagt ist - vor allem mit Rousseau auseinander. Es war unvermeidlich,<br />
dass der Dichter sich an Rousseaus CONFESSIONS als an<br />
5 Zu Eckermann, 14. März 1830 (Houben 581 f.).<br />
6 Tagebuch 18. Mai 1810 (WA III 4, 121).<br />
316<br />
dem großen Muster moderner Autobiographik orientierte. Hier<br />
fand er viele Anregungen. Noch das 17. Buch <strong>von</strong> DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT enthält eine Anspielung auf die CONFESSIONS, die <strong>von</strong><br />
Goethes Dankbarkeit für das Werk zeugt - die Schilderung der<br />
Nachtstimmung nach Lilis Geburtstag. Aber einen Grundzug <strong>von</strong><br />
Rousseaus Autobiographie suchte er strikt zu vermeiden: das<br />
"Lamentable", die allgemeine Tendenz, "Sünden" zu beichten, über<br />
Gebresten und Mißgeschicke zu klagen. Demgegenüber fand Goethe<br />
es angebracht, seiner Lebensdarstellung grundsätzlich "eine<br />
gewisse spezifische Leichtigkeit" zu geben, gleichgültig, was auch<br />
in den geschilderten Daseinsepochen auf ihn "losgehämmert" und<br />
in ihm "gewaltig widerstanden und entgegengewirkt" hatte.? So<br />
war es sein Bestreben, <strong>von</strong> der Vergangenheit "ein reines Bild" zu<br />
geben, "heitersten Gebrauch" <strong>von</strong> dem ihm vorliegenden Tatsachenmaterial<br />
zu machen und die Dinge im ganzen "klar und<br />
freundlich hinzustellen".8<br />
Mit der Opposition gegen Rousseau verband sich ein Gegenstreben<br />
allgemeiner Art. Tendenzen zum Lamentablen, zum Klagen<br />
und Anklagen, zum Hadern mit sich und der Welt waren auch<br />
in der deutschen Literatur vielfach hervorgetreten, vor allem durch<br />
den Einfluß des Pietismus. Gerade in der Zeit, als DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT geschrieben wurde, erneuerte sich dies. Ein gewisser<br />
Hang zur Verdüsterung wurde Mode, bei den Romantikern, im<br />
Schicksalsdrama etc. Hi'ergegen erhob Goethe die ewige Forderung<br />
des klassischen Menschen nach Weltbejahung, wie auch immer das<br />
Leben beschaffen sei. Sein Opponieren zeigte sich in den verschiedensten<br />
Formen. Damals schrieb er für Zelters LIEDERTAFEL das fröhliche<br />
Gedicht RECHENSCHAFT mit dem derben Spottrefrain:<br />
Denn das Ächzen und das Krächzen<br />
Haben wir nun abgetan.<br />
7 An Zelter, 2. September 1812 (WA IV 23, 88).<br />
8 An F. J. Bertuch, 15. Dezember 1816 (WA IV 27, 274).<br />
317
graphie in dieser strengen Form hätte einen unverhältnismäßigen<br />
Aufwand an Zeit und Kraft gekostet.<br />
Es kam aber noch etwas anderes hinzu. Für DICHTUNG UND W AHR<br />
HEIT lag Goethe <strong>von</strong> vornherein umfangreiches stoffliches Material<br />
vor, das seiner Natur nach eine bestimmte Form trug. Im Laufe der<br />
Zeit hatten sich dem Dichter eine Fülle <strong>von</strong> Erinnerungen zu Geschichten<br />
ausgebildet, die er zu erzählen liebte. Namentlich in den<br />
letzten Jahren vor der Abfassung <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT ist<br />
häufig da<strong>von</strong> die Rede, dass Goethe seinen Freunden solche Erinnerungen<br />
zum besten gab. Diese Geschichten bilden einen Hauptbestandteil<br />
<strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT. Infolgedessen ist das Formelement,<br />
das dem Werke zugrunde liegt, die erzählerische Episode,<br />
und die kompositorische Aufgabe bestand vor allem darin, diese<br />
Episoden aneinander zu reihen. Das war nun bei Anwendung eines<br />
ähnlich strengen Bauprinzips wie dem der W AHLVERWANDTSCHAF<br />
TEN <strong>nicht</strong> zu leisten. Goethe mußte eine weniger anspruchsvolle<br />
und beengende Lösung suchen.<br />
Den Ausweg bot die für Goethe so charakteristische und <strong>von</strong><br />
ihm mit einzigartiger Virtuosität gehandhabte Form des "Aggregatsl/.<br />
Es handelt sich hier um das ganz freizügige Verfahren der<br />
Reihung: Bestandteile verschiedenster Art werden in zwangloser<br />
Weise zusammengestellt, lose verbunden und nach Art eines<br />
,,straußkranzesl/ zu einem Ganzen gefügt. Besonders im Alter liebte<br />
es der Dichter, auf diese Weise erzählerisch zu verfahren. WILHELM<br />
MEISTERS WANDERJAHRE weisen diese Kompositionsform auf, und in<br />
bezug auf dies Werk sprach Goethe selbst auch <strong>von</strong> einem "Straußkranz",<br />
einem "AggregatI/1o. Doch findet sich die Form auch in wissenschaftlichen<br />
Abhandlungen und vor allem in Aufsätzen des alten<br />
Goethe.<br />
Eine Besonderheit der Goetheschen Aggregatform im Bereich<br />
des Erzählerischen besteht darin, dass sie willkürliche Unterbre-<br />
10 An Zelter, 24. Mai 1827 und 5. Juni 1829; zu Kanzler v. Müller am 18. Februar 1830.<br />
Vgl. auch das Kap. Formaler Einfluss <strong>von</strong> 1001 Nacht: Unterhaltungen deutscher<br />
Ausgewanderten, Wilhe1m Meisters Wanderjahre, Dichtung und Wahrheit in: <strong>Katharina</strong><br />
<strong>Mommsen</strong>, Goethe und 1001 Nacht. 2. Aufl. Frankfurt a. M.1981. S. 57-68.<br />
320<br />
chungen und Fortsetzungen liebt - wobei absichtlich die Neugier<br />
gereizt wird -, ebenso Einschaltungen, Verschachtelung und Verflechtung.<br />
Hierfür war die Erzählweise <strong>von</strong> TAUSENDUNDEINE NACHT<br />
für Goethe das bewußt gewählte und hochgeschätzte Vorbild. DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT bietet alle angeführten Merkmale der Aggregatform.<br />
Die erzählerischen Episoden, <strong>von</strong> denen wir sprachen, wurden<br />
gemäß dieser Form aneinander gereiht. Hinzu traten im Laufe<br />
der Abfassung noch essayistische Episoden, Abhandlungen diversesten<br />
Inhalts, historischen, literarhistorischen, kunstgeschichtlichen<br />
etc., die Schilderungen <strong>von</strong> Freunden und bekannten Persönlichkeiten.<br />
Es gibt mancherlei Fälle der Verschachtelungstechnik,<br />
so die Erzählung des Märchens DER NEUE PARIS, Herders Vortrag<br />
des Vicars of Wakefield etc. und viele Beispiele für das Erzählen<br />
mit Unterbrechungen, Fortsetzungen, Verflechtungen. Die Gretehen-Episoden<br />
sind auf diese Weise kunstvoll in die Wahl- und<br />
Krönungsgeschichte eingefügt. Der zweite Teil bricht mitten in der<br />
interessanten Erzählung der Friederiken-Episode ab, die dann im<br />
dritten Teil ebenso unvermittelt wieder aufgenommen wird. Den<br />
dritten Teil beschloß Goethe, wie wir sahen, bei der Endredaktion,<br />
<strong>nicht</strong> bis zu einem organischen Abschluß - dem Aufbruch nach<br />
Weimar - zu führen, sondern ihn vorzeitig mitten in der Erzählung<br />
abzubrechen. Auch hier ward die Neugier des Lesers gereizt.<br />
Die Fortsetzung aber erschien erst zwei Jahrzehnte später, und <strong>nicht</strong><br />
zufällig verglich Goethe gerade in den Tagen, in denen er die kühne<br />
kompositorische Umstellung vornahm, DICHTUNG UND WAHRHEIT<br />
mit TAUSENDUNDEINE NACHT. ll<br />
Bei der Abfassung <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT fühlte sich der<br />
Dichter also gelegentlich in der Situation des Märchenerzählers. So<br />
ist es erklärlich, wenn er gern <strong>von</strong> seiner Autobiographie als <strong>von</strong><br />
seinem "Lebensmärchen" sprach, <strong>von</strong> den "alten Märchen", die er<br />
sich "in der Einsamkeit zu erzählen anfange.1/12 Den eigentlichen<br />
Titel DICHTUNG UND WAHRHEIT nennt er in Briefen und Tagebüchern<br />
11 "Die Tausend und eine Nacht meines wunderlichen Lebens": an Zelter, November<br />
1813; ähnlich an Trebra, 24. November 1813.<br />
12 An Charlotte v. Stein, Oktober 1811; an Rochlitz, 30. Januar 1812.<br />
321
höchst selten. Der gewöhnlicheArbeitstitellautet: "Biographisches"<br />
oder "meine Biographie". Doch heißt es auch wohl: "meine Confessionen";<br />
"meine Be<strong>kennt</strong>nisse" - womit wieder an Rousseaus<br />
Confessions als an das stets beachtete Gattungsmuster gedacht war.<br />
Oder aber auch: "Biographischer Versuch"; "meine Lebensfabel";<br />
"meine Lebenspoesie oder Poetenleben"; "Biographisches Poem";<br />
"Biographische Scherze" oder "Späße". Als Goethe 1811 mit der<br />
Abfassung begann und er der episodenhaften Eigenart des Stoffes<br />
gewahr wurde, sprach er bezeichnenderweise mit Vorliebe ganz<br />
einfach <strong>von</strong> "Biographischen Aufsätzen" - so auch noch 1824 bei<br />
Betrachtung der schematischen Skizzen zum vierten Teil. Der vollendete<br />
erste Teil galt ihm (1811) geradezu als "Bilderreihe".<br />
Die Form des' Aggregats', auf die uns diese Termini immer wieder<br />
hinweisen, wurde nun <strong>von</strong> Goethe in einer ganz einzigartigen<br />
Weise gemeistert, wann immer er auch <strong>von</strong> ihr Gebrauch machte.<br />
Er besaß die Fähigkeit, verschiedenartigste Bestandteile, Fragmente,<br />
Episoden so zusammenzufügen, dass sie auf geheimnisvolle Weise<br />
ein geformtes Ganzes bilden. Obwohl <strong>von</strong> den herkömmlichen<br />
architektonischen Mitteln bewußt wenig Gebrauch gemacht wird,<br />
entsteht dennoch ein Organismus, kein chaotisches Konglomerat.<br />
Es hängt dies damit zusammen, dass Goethe als Dichter und Künstler<br />
eine immense Kraft des Gestaltens zu eigen war. Was immer er<br />
schöpferisch behandelte - in seiner Hand nahm es Form an. Das<br />
zeigt noch jeder Aufsatz des alten Goethe, der so oft ein Aggregat<br />
aus zusammengewürfelten Ingredienzien ist, trotzdem aber wie<br />
ein künstlerisch gerundetes Ganzes wirkt. In den NOTEN UND AB<br />
HANDLUNGEN ZUM WEST-ÖSTLICHEN DIVAN tritt diese Eigenschaft hervor,<br />
aber auch in WILHELM MEISTERS WANDERJAHRE und im zweiten<br />
Teil des FAUST. Dass man immer wieder versucht, in solchen aggregathaften<br />
Werken besondere Kompositionsgeheimnisse aufzuspüren,<br />
beweist, welche starke formale Kraft ihnen innewohnt.<br />
Im Sinne des Goetheschen 'Aggregats' ist auch DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT mit mancherlei kompositorischen Reizen ausgestattet.<br />
Zwar gilt im allgemeinen Emil Staigers Feststellung: "Goethe hatte<br />
<strong>nicht</strong> die Absicht, das Ganze oder auch nur die einzelnen Teile und<br />
Bücher kunstgerecht durchzuführen." Dennoch geht <strong>von</strong> dem Werk<br />
322<br />
in formaler Hinsicht eine geheimnisvolle Wirkung aus, über die oft<br />
gesprochen wurde. Im Einzelnen ist sie schwer zu fassen. Man erinnerte<br />
an die kompositorische Schönheit der novellistischen Partien<br />
- der Gretchen-, Friederiken- und Lili-Geschichten zum Beispiel.<br />
Doch können hiermit immerhin noch Rousseaus CONFESSIONS erfolgreich<br />
wetteifern. Ganz Goethe zu eigen ist aber die formal sehr stark<br />
wirksame Kunst der Übergänge: das mit größter rhetorischer Anmut<br />
behandelte Verknüpfen der einzelnen Episoden, das Hinüberwechseln<br />
<strong>von</strong> einem Thema zum anderen. Goethe sei in DICHTUNG<br />
UND WAHRHEIT, so sagte Gundolf, "der größte Meister der unmerkbaren<br />
und doch zugleich selbständigen Übergänge unter allen deutschen<br />
Erzählern"13. Dem lohne es sich, eine eigene Abhandlung zu<br />
widmen; vornehmlich durch Reflexion und Assoziation pflege Goethe<br />
solche Übergänge herzustellen. Hingewiesen ist hiermit auf einige<br />
der wichtigsten Kunstrnittel der Goetheschen Aggregat-Form,<br />
solche, die sich in den Spätwerken wirklich oft antreffen lassen.<br />
Mit spezieller Sorgfalt behandelte Goethe in DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT die Buchschlüsse. Vielfach endigen die Bücher mit einer<br />
besonders eindrucksvollen Partie, sei es, dass ein Handlungsabschnitt<br />
wirkungsvoll abgeschlossen wird, sei es, dass ein Ausblick<br />
ins Allgemeine oder Metaphysische hier seine Stelle bekommt.<br />
Auch darin liegt ein wirkungsvolles kompositorisches Mittel, das<br />
unschwer nachzuweisen und auch oft diskutiert worden ist.<br />
Verborgener sind gewisse formale Wirkungen, die Goethe durch<br />
Akzentuierungen des Gehaltes erzielt. Als Beispiel hierfür möge<br />
beachtet werden, wie auf diese Weise in das 4. Buch ein konstruktives<br />
Element hineingebracht ist. Äußerlich bekommt das Buch eine<br />
gewisse Einheit schon durch das Thema: Unterricht. De facto besteht<br />
es aber aus lauter Einzelepisoden, deren mechanische Aneinanderreihung<br />
etwas Ermüdendes hätte haben können. Am Anfang<br />
wird <strong>von</strong> den verschiedenen Lehrern erzählt, zum Schluß <strong>von</strong><br />
bekannten Frankfurter Bürgern, die einen pädagogischen Einfluß<br />
auf den Knaben Goethe ausübten. Dazwischen treten noch thematisch<br />
abweichende Berichte über "Liebhabereien" des Vaters wie<br />
13 Friedrich Gundolf, Goethe. Berlin 1916 (zahllose Aufl.)<br />
323
Seidenzucht oder das Bleichen der Kupferstiche, ferner der Exkurs<br />
über Biblische Urgeschichte. Ein Konglomerat droht zu entstehen,<br />
und doch wußte Goethe dem abzuhelfen. Er fügte nebenher ein<br />
wichtiges Thema ein, das dem Ganzen ein Schwergewicht gibt und<br />
es dadurch auch formal zusammenhält - in dem Buch wird erstmals<br />
auf die dichterische Begabung des Knaben Goethe hingewiesen.<br />
Der Sprachunterricht, so erfahren wir beiläufig, führte zu einer<br />
kleinen Genieleistung: dem Roman in sechs Sprachen. Der<br />
Hebräisch-Unterricht des Rektors Albrecht hatte sodann zur Folge,<br />
dass Goethe umfangreiche <strong>Bibel</strong>studien und kritische Betrachtungen<br />
über die Urgeschichte anstellt; letzteres aber wirkte wieder<br />
unmittelbar auf die dichterische Produktion - der Knabe schreibt<br />
einen Joseph-Roman, den wir <strong>nicht</strong> mehr besitzen. An dieser Stelle<br />
werden dann auch "geistliche Oden" erwähnt und das erhaltene<br />
Jugendgedicht <strong>von</strong> der HÖLLENFAHRT CHRISTI. In Wahrheit gibt Goethe<br />
hier ein umfassendes Bild da<strong>von</strong>, wie bei ihm der Weg des Produzierens<br />
verläuft. Es erfolgt eine Anregung, Quellen werden auf<br />
fast wissenschaftliche Weise st:udiert, aus all dem entsteht dann<br />
ein dichterisches Werk. Der aus der Jugend geschilderte Vorgang<br />
enthält allerwichtigstes Künftiges schon in nuce. Im Hinblick hierauf<br />
erweist sich auch, dass der an sich so befremdliche Exkurs über<br />
die Urgeschichte tiefe funktionelle Bedeutung hat. Er ist in Wirklichkeit<br />
alles andere als Zutat, <strong>nicht</strong> zufällig steht er auch äußerlich<br />
in der Mitte des 4. Buchs. Sehr geschickt weiß Goethe am Ende<br />
des Buches nochmals auf dessen geheimes Zentrum hinzudeuten<br />
und so das Ganze auch formal zu verklammern. Hier wird berichtet,<br />
wie die älteren pädagogischen Freunde den Knaben auf bestimmte<br />
praktische Lebensberufe nach eigenem Vorbild hinzulenken<br />
suchten, wie aber auch Jüngere ihm bereits damals als Muster<br />
vorgehalten wurden für eine solid bürgerliche Gestaltung seiner<br />
Laufbahn. Dazu bemerkte Goethe: er habe allerdings damals schon<br />
im Sinne gehabt, etwas Außerordentliches zu leisten; wenn er aber<br />
an ein "wünschenswertes Glück" gedacht habe, so sei ihm dies<br />
"am reizendsten in der Gestalt des Lorbeerkranzes erschienen, der<br />
den Dichter zu zieren geflochten ist". Mit dieser Wendung wird<br />
dem 4. Buch ein anmutig pointierter Schluß gegeben, zugleich aber<br />
324<br />
auch an das in seiner Mitte breit ausgestaltete Thema angeknüpft:<br />
die Schilderung der dichterischen Anfänge. Das trägt wesentlich<br />
dazu bei, den Eindruck formaler Geschlossenheit zu erwecken.<br />
Bei wiederholtem Lesen <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT wird man<br />
<strong>nicht</strong> wenige Fälle finden, in denen inhaltliche Bezüge und Verknüpfungen<br />
- auch solche, die <strong>nicht</strong> auf den ersten Blick zutag<br />
treten - Einfluß auf die formale Erscheinung des Ganzen oder größerer<br />
Partien ausüben. So wird beispielsweise im 1. Buch, in d m<br />
überhaupt Goethes Vorliebe für sorgfältiges Exponieren bemerklich<br />
wird, durch eine beiläufige, aber sehr präzise Erwähnung d r<br />
Wahl- und Krönungsfeierlichkeiten bereits auf den Inhalt des 5.<br />
Buchs hingedeutet.<br />
Der vierte Teil <strong>von</strong> DICHTUNG UND W ARHEIT ist kompositori h<br />
am nachlässigsten behandelt, was mit seiner verspäteten Ent t -<br />
hung zusammenhängt. Goethe gab sich kaum noch die Mühe, d,<br />
fragmentarische Material durch Übergänge zu verknüpfen. D nnoch<br />
hat auch hier das Aggregat jenen spezifisch Goetheschen Z uber,<br />
der das Fehlen einer geschlossenen Form <strong>nicht</strong> als Mang 1 rscheinen<br />
läßt. Gerade in diesem Teil findet sich sogar in<br />
kompositorischer Zug <strong>von</strong> besonderer Schönheit, und zwar in d r<br />
Art, wie abermals durch inhaltliche Zusammenhänge der Anf n<br />
mit dem Ende verbunden ist. Im ersten Satz des 16. Buchs wird i'<br />
These ausgesprochen, "der Mensch habe die Kraft, das wa zusammengehört,<br />
an sich heranzuziehen". Genau das wird au '<br />
führt in der grandiosen Schluß partie des 20. Buchs. Das Zust nd -<br />
kommen des Aufbruchs nach Weimar trotz aller Schwi rigk it n<br />
verdankt Goethe eben jener Kraft: hierauf deutet der Abschnitt v m<br />
Dämonischen mit der Bezugnahme auf EGMONT.<br />
Andererseits stehen auch innerhalb des 16. Buchs Anfan un<br />
Ende - der Spinoza-Abschnitt und die Erzählung <strong>von</strong> Jung-Stillin<br />
- miteinander in Verbindung, diesmal durch eine vom Inhalt h<br />
bestimmte Kontrastwirkung. Goethe stellt hier seine eigen Art<br />
Frömmigkeit - an Spinoza orientiert ist sie praktischer Natur n<br />
läuft auf "Entsagen" heraus - gegenüber der pietistischen, di ihm<br />
so oft in seinem Leben an geehrten Menschen begegn t Wt r.<br />
klärt er den eigenen Standpunkt. Die Erzählung <strong>von</strong> Jung- tillin<br />
2
verunglückter Augenkur verdeutlicht zugleich, was den Dichter<br />
vom Pietismus und ähnlichen Richtungen immer wieder entfernte:<br />
ein allzu naiver Dogmatismus, der doch auch Züge eines gewissen<br />
"Dünkels" hatte. Vergleicht man diese Partien des 16. Buchs übrigens<br />
mit dem Schluß des 20., so zeigt sich auch hier wieder ein<br />
vielsagender Kontrast. Stilling scheitert mit seinem dogmatischen<br />
Gottvertrauen, die Operation, bei der sein ganzer Ruf auf dem Spiel<br />
stand, ward ein Fehlschlag. Goethes Schicksalsgläubigkeit und <strong>nicht</strong><br />
zuletzt sein Entsagen - der Verzicht auf Lili - führt Gelingen herbei<br />
und die entscheidende Lebenswendung - den Weg nach Weimar.<br />
Der gesamte vierte Teil <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT wird durch<br />
diese geheimen Bezüge auch formal zusammengehalten. Zwischen<br />
den weltanschaulichen Abschnitten des 16. und dem großartigen<br />
Finale des 20. Buchs verläuft die eigentliche Handlung wie der <strong>von</strong><br />
starken Pfeilern getragene Bogen einer Brücke.<br />
Selbstdarstellung<br />
Überblicken wir den Inhalt <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT in seiner<br />
Gesamtheit, so fällt uns eine Eigentümlichkeit des Werkes vor allem<br />
in die Augen: wie wenig in dieser Autobiographie <strong>von</strong> dem<br />
Verfasser selbst die Rede ist. Die breiten Schilderungen der Umwelt<br />
- der physischen und der geistigen - scheinen in keinem Verhältnis<br />
zu stehen zu den sparsamen Mitteilungen Goethes über<br />
sein eigenes Ich. Es ist offensichtlich, dass hier ein Programm befolgt<br />
wird. Vorsätzlich geht Goethe einen andern Weg als die früheren<br />
Autobiographen, die ihm als Vorbilder dienen konnten.<br />
Rousseau beispielsweise erzählt <strong>von</strong> seinem Leben vornehmlich<br />
aus Freude an der Beleuchtung des Ego, um <strong>von</strong> seiner Seele zu<br />
berichten, um Beichte abzulegen und Rechtfertigungen zu geben.<br />
Die Außenwelt wird nur dargestellt, soweit es diesem Endzweck<br />
dient. Ganz anders Goethe. An Selbstbeobachtung, Beichte, dem<br />
eigentlichen Be<strong>kennt</strong>nis-Eifer der üblichen Autobiographen ist ihm<br />
- der so oft gegen das delphische "Erkenne dich selbst" polemisierte<br />
- gar <strong>nicht</strong>s gelegen. Sein Interesse an sich selbst ist <strong>nicht</strong><br />
326<br />
psychologischer, sondern morphologischer Natur. Seine Entwicklung<br />
ist ihm wichtig, und auch das vorwiegend darum, weil andere<br />
daraus lernen können, weil der "Begriff stufenweiser Ausbildung"<br />
eines Individuums <strong>von</strong> seiner Bedeutung paradigmatischen<br />
Wert haben muß. Das bestimmt die <strong>von</strong> aller Subjektivität so weit<br />
entfernte Erzählweise <strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT wie auch die<br />
Haltung aller sonstigen autobiographischen Schriften Goethes. Seinem<br />
Ich steht der Dichter bewußt distanziert gegenüber. Er ist sich<br />
selbst im Alter "historisch" geworden, wie er am 1. Dezember 1831<br />
an Wilhelm v. Humboldt schreibt. Das will sagen, er sieht sich selbst<br />
unparteiisch, objektivierend, wie alles Geschehen der Welt. Wie<br />
die Tagebuchaufzeichnungen des alten Goethe <strong>von</strong> subjektiver Reflexion<br />
frei sind, wie seine Briefe das Innenleben schweigsam verhüllen,<br />
so ziehen auch die autobiographischen Schriften um das<br />
Ich absichtlich einen Schleier. Das Typische, Sinnbildhafte hält der<br />
Dichter an seinem vergangenen Leben für wichtig, das Private <strong>nicht</strong>.<br />
Für DICHTUNG UND WAHRHEIT folgt aus dieser objektivierenden<br />
Betrachtungsweise, dass Goethe sogar über wichtige Erlebnisse mit<br />
großer Zurückhaltung spricht. Nur an verhältnismäßig wenigen<br />
Stellen läßt er wissen, dass es sich hier um Höhe- oder Tiefpunkte<br />
seines Lebens handelt. Auch dann ist der Bericht meist nur andeutend.<br />
An die Stelle ausführlicher Beichte treten knappe Bem rkungen<br />
der Selbstkritik; die Ausmalung <strong>von</strong> Unglück und Leid<br />
wird möglichst eingeschränkt und oft begleitet durch ein paar flüchtige<br />
ironische Betrachtungen. Der Ausgang des Gretchen-Abenteuers<br />
am Schluß des 5. Buchs ist eine solche Episode, wo Go th<br />
einmal wirklich <strong>von</strong> einer "tragischen Katastrophe" spricht. Der<br />
Bericht hat hier <strong>nicht</strong> ganz die Sparsamkeit wie sonst, steht ab r<br />
doch auch mehr im Zeichen der Ironie und Selbstkritik als der Klage.<br />
"Ich empfand nun keine Zufriedenheit, als im Wiederkäuen<br />
meines Elends und in der tausendfachen imaginären Vervielfältigung<br />
desselben [ ... ] Ich hatte Zeit genug, mir den seltsamsten Roman<br />
<strong>von</strong> traurigen Ereignissen und einer unvermeidlich tragischen<br />
Katastrophe selbstquälerisch auszumalen." Solche und ähnliche<br />
B merkungen ironisieren ziemlich mitleidlos das ehemalige Verhalten<br />
und haben zugleich inen pädagogischen Sinn. Der spezielle<br />
327
Fall wird zum Anlaß genommen, auf Allgemeingültiges hinzuweisen<br />
zu warnen vor Hypochondrie.<br />
Etwas wie eine Beichte wäre recht wohl denkbar gewesen bei<br />
dem Rückblick auf die Leipziger Zeit in Buch 8. In keiner Epoche<br />
seines Lebens hat Goethe sich vielleicht weiter <strong>von</strong> seinem eigentlichen<br />
Selbst entfernt wie während des Aufenthalts in Leipzig. Das<br />
zeigen noch die Briefe aus jener Zeit. Für eine Weile hatte das lebenslustige<br />
Rokoko ihn ganz in seinen Bann gezogen. Die Gefährdungen<br />
dieser Zeit werden in DICHTUNG UND WAHRHEIT mit symbolischen<br />
Zügen angedeutet. Bei der Abreise nach Leipzig - der ersten Ausfahrt<br />
seines Lebens - sieht der Jüngling das seltsame Schauspiel<br />
des "Pandämoniums <strong>von</strong> Irrlichtern" (Buch 6). Das war ein bedenkliches<br />
Vorzeichen ebenso wie der bald hinterher sich ereignende<br />
Unfall mit dem Wagen. Ominöses ereignete sich auch beim Verlassen<br />
<strong>von</strong> Leipzig: der Studententumult, so dass Goethe zu berichten<br />
hat, "mit einem so gellenden Nachklang akademischer Großtaten"<br />
sei er schließlich 1768 aus Leipzig abgefahren. Sicherlich<br />
kehrte Goethe tief unzufrieden mit sich nach Frankfurt zurück. Zur<br />
Selbstbesinnung führte die aus Leipzig mitgebrachte Krankheit.<br />
All das wird in DICHTUNG UND WAHRHEIT aber <strong>nicht</strong> in Form einer<br />
Beichte <strong>von</strong> reuigen Betrachtungen dargestellt. Es bleibt bei Andeutungen,<br />
wobei man zwischen den Zeilen lesen muß. "Gleichsam<br />
als ein Schiffbrüchiger" sei er zurückgekehrt - soviel wird<br />
immerhin gesagt. Doch habe er sich "<strong>nicht</strong> sonderlich viel vorzuwerfen"<br />
gehabt, infolgedessen sich bald "ziemlich zu beruhigen<br />
gewußt". Von der nun folgenden Epoche einer tiefgreifenden Verinnerlichung<br />
und Umkehr erfahren wir recht wenig und auch das<br />
Wichtigste nur in märchenhafter Einkleidung. Es fallen mehr als<br />
sonst selbstkritische Bemerkungen; das immer wiederholte Betrachten<br />
der so verräterischen Leipziger Briefe spielt eine gewisse Rolle.<br />
Dann aber läßt erst der Bericht <strong>von</strong> den alchemistischen Studien<br />
es ahnen, dass Goethe ganz neue Wege geht. Wohin diese<br />
führen, zeigt der Abschnitt über das "mystische Dogma" am Schluß<br />
des 8. Buchs: zu einer religiösen Selbstbesinnung. So steht diese<br />
ganze Partie, für die eine mehr subjektive Erzählweise so nahe gelegen<br />
hätte, ganz im Zeichen des Objektivierens. Goethe stellt die<br />
328<br />
inneren Vorgänge <strong>nicht</strong> mit historischer Treue dar - wie er gekonnt<br />
hätte -, sondern in dichterischer Umschreibung. Wahrheitsgemäße<br />
Beichte wird ersetzt durch das andeutende Bild.<br />
Der Zurückhaltung im Schildern seiner Erlebnisse entspricht<br />
die auffällige Bescheidenheit, mit der Goethe seine Fähigkeiten,<br />
seine Talente zur Darstellung bringt. Auch hier ist programmatische<br />
Absicht zu erkennen. Diese hängt mit einem wesentlichen Charakterzug<br />
Goethes zusammen: er war zwar sehr selbstbewußt, aber<br />
<strong>nicht</strong> eitel. Da mußte es ihn in echte Verlegenheit bringen, wenn die<br />
Autobiographie ihn nötigte, <strong>von</strong> seiner Genialität, seinen Erfolgen,<br />
<strong>von</strong> Ruhm und Ehre zu sprechen, die daraus entsprangen. Es gab<br />
für ihn nur eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu lösen, wie es Geschmack<br />
und Taktgefühl ihm vorschrieb: eine fast auf Selbstverleugnung<br />
hinauslaufende Bescheidenheit in der Berichterstattung - jenes<br />
weitgehende understatement, das wir bei der Schilderung seiner<br />
außergewöhnlichen Begabungen überall feststellen können.<br />
Nun hat aber diese Bescheidenheit in ihrer Auswirkung auf das<br />
Ganze etwas geradezu Irreführendes. Schließlich war der Held<br />
dieser Autobiographie ein Genie, ein großer Dichter, und als Mensch<br />
- gerade in der hier dargestellten Jugendzeit - eine Persönlichkeit<br />
<strong>von</strong> faszinierender Ausstrahlung. All das wird in DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT <strong>nicht</strong> in angemessener Weise deutlich. Man muß schon<br />
feste Vorstellungen <strong>von</strong> Goethe mitbringen, will man ihn in seiner<br />
Autobiographie richtig erkennen.<br />
Insbesondere in den ersten beiden Teilen wird der Leser stets<br />
genötigt, sich das Bild zu ergänzen und sich daran zu erinnern: es<br />
ist Goethes Jugend, die Frühzeit eines großen Dichters, die hier<br />
beschrieben wird. Denn <strong>von</strong> der Genialität des Knaben, des Jünglings<br />
ist so gut wie keine Rede. Dass auch Goethe eine Art Wunderkind<br />
gewesen sein muß, da<strong>von</strong> würde DICHTUNG UND WAHRHEIT<br />
allein schwer einen Begriff geben. Nur spärliche Andeutungen sprechen<br />
da<strong>von</strong>, und man muß beim Lesen sorgfältig auf sie achten.<br />
Hierher gehören beispielsweise verschiedene Berichte über Goethes<br />
Eigenschaften als Schüler. Man erfährt schon im 1. Buch, dass<br />
r "durch schnelles Ergreifen, Verarbeiten und Festhalten sehr bald<br />
d m Unterricht entwuchs". Mit Leichtigkeit verfaßt er Aufsätze,<br />
329
"in rhetorischen Dingen, Chrien und dergleichen tat es mir niemand<br />
zuvor" (Buch 1). Wiederholt ist <strong>von</strong> seinem guten Gedächtnis<br />
die Rede, besonders aber <strong>von</strong> seiner ungewöhnlichen Begabung,<br />
Sprachen zu lernen (Buch 1 und 4). Das deutet auf das Wunderkind,<br />
den künftigen Dichter - aber diesen Schluß muß der Leser<br />
selber ziehen. Goethe berichtet darüber, als sei es etwas gar <strong>nicht</strong><br />
Ungewöhnliches. Nur dass er diese Züge mit einer gewissen absichtlichen<br />
Wiederholung erwähnt, gibt ihnen eine spürbare Betonung,<br />
die auf ihre Bedeutung aufmerksam machen kann. In ähnlich<br />
unauffälliger Weise wird <strong>von</strong> der frühzeitigen "Reimwut des<br />
Knaben" gesprochen (Buch 1), dann zieht sich das Thema versteckt<br />
als roter Faden durch die ersten Teile. Immer wieder kommt Goethe<br />
darauf zurück: die "Leichtigkeit zu reimen und gemeinen<br />
Gegenständen eine poetische Seite abzugewinnen" ist ein Zug, den<br />
er gern erwähnt, ohne ihn als das, was er in seinem Falle war, zu<br />
kennzeichnen - als Merkmal frühzeitiger Genialität. Viel eher<br />
knüpft er ironische Wendungen daran: "und wenn ich auch meinen<br />
Produktionen <strong>nicht</strong> recht traute, so konnte ich sie wohl als<br />
fehlerhaft, aber <strong>nicht</strong> als ganz verwerflich ansehen" (Buch 6). An<br />
anderer Stelle heißt es: "Meine Lust am Hervorbringen war grenzenlos";<br />
unmittelbar darauf folgt aber eine Charakteristik des<br />
Sturm-und-Drang-Treibens, die den Hinweis auf die eigene Produktivität<br />
wieder relativiert. Bescheiden stellt Goethe sich hin als nur<br />
einen aus der "Masse junger genialer Männer", die damals - in<br />
Straßburg - sich in jenem "Quirlen und Schaffen" gefielen und<br />
dabei "manches Übel stifteten" (Buch 12).<br />
Nur einmal werden die Karten auf den Tisch gelegt. Bei der<br />
Besprechung <strong>von</strong> GÖTZ und WERTHER im 13. Buch ließ es sich <strong>nicht</strong><br />
vermeiden, den ungeh<strong>eure</strong>n Erfolg dieser Werke wenigstens zu<br />
erwähnen. Hier erfährt man auch ein paar Details, die erstmals<br />
einen wirklichen Begriff <strong>von</strong> der Genialität des Dichters geben: dass<br />
die Niederschrift des Werther in vier Wochen ohne vorherige Skizzen<br />
erfolgt sei, dass Goethe "dieses Werklein ziemlich unbewußt,<br />
einern Nachtwandler ähnlich" geschrieben habe. Aber der Leser<br />
muß bis zum 13. Buch warten, bis er auf Enthüllungen dieser Art<br />
trifft. Und bei ihnen bleibt es auch im wesentlichen. Genialität und<br />
330<br />
Erfolge werden möglichst <strong>nicht</strong> erwähnt. Da aber <strong>von</strong> ihnen die<br />
Ereignisse in Goethes Leben in vielfacher Weise bestimmt waren,<br />
bringt diese durchgehende Zurückhaltung in die autobiographische<br />
Darstellung eine gewisse Unklarheit.<br />
Ein Drittes, das in DICHTUNG UND WAHRHEIT nur ungenügend zur<br />
Darstellung kommt, ist die Wirkung <strong>von</strong> Goethes Persönlichkeit.<br />
Auch hier machte sein Taktgefühl dem Dichter die Ausführung<br />
schwierig. Der Wahrheit gemäß hätte er einen jugendlichen Helden<br />
schildern müssen, der kraft seines persönlichen Zaubers einen wahren<br />
Siegeszug antritt, der aus einer günstigen, schmeichelhaften<br />
Situation in die andere kommt. Dies in aller Offenheit zu erzählen<br />
war Goethe <strong>nicht</strong> möglich. So läßt er darüber ebenfalls einen dichten<br />
Schleier fallen. Was sich hinter Bescheidenheit und understatement<br />
verbirgt, ist nun für den Nichtinformierten kaum noch zu erraten.<br />
Man muß vom jungen Goethe aus andern Quellen - Briefen,<br />
Gesprächsberichten - etwas wissen, um DICHTUNG UND WAHRHEIT in<br />
dieser Hinsicht zu verstehen und das Verschwiegene ergänzen zu<br />
können.<br />
Goethe hatte in seiner Jugend eine Macht über Menschen, eine<br />
Gabe, die Herzen zu gewinnen, die in ihrer Art einzig war. DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT zeigt nun zwar überall den Dichter <strong>von</strong> Menschen<br />
umgeben, in Kreisen geistreich heiterer Geselligkeit. Es bleibt<br />
aber unausgesprochen, dass er stets und mit Selbstverständlichkeit<br />
das Haupt solcher Zirkel war, das eigentlich belebende Zentrum.<br />
Auch dafür sei ein Beispiel herausgegriffen. In den recht ausführlichen<br />
Berichten über die Straßburger Tischgesellschaft (Buch<br />
9 bis 11) werden wir über die Verhältnisse dieses lustigen Kreises<br />
scheinbar gut informiert. Den Präsidenten der Gesellschaft, Salzmann,<br />
schildert Goethe eingehend mit allen seinen Qualitäten,<br />
ebenso viele Mitglieder: Meyer <strong>von</strong> Lindau, den Ludwigsritter, Lerse,<br />
Weyland etc. Aber <strong>von</strong> der Rolle, die der Dichter selber in jenem<br />
Zirkel spielte, erfahren wir <strong>nicht</strong>s. Hierüber belehrt uns besser<br />
Jung-Stilling, der ja, wie auch DICHTUNG UND WAHRHEIT erzählt,<br />
der Straßburger Tischgesellschaft angehört hatte: "Besonders karn<br />
einer mit großen hellen Augen, prachtvoller Stirn und schönem<br />
Wuchs, mutig ins Zimmer. Dieser zog Herrn Troosts und Stillings<br />
331
Augen auf sich; ersterer sagte gegen letztem: das muß ein vortrefflicher<br />
Mann sein. Stilling bejahte das ... Goethe saß gegen Stilling<br />
über und er hatte die Regierung am Tisch, ohne daß er sie suchte." So<br />
also war es in Wirklichkeit. Der eigentliche "Präsident" der Straßburger<br />
Tischgesellschaft war Goethe. Wo der Dichter auftrat, beherrschte<br />
er die Szene. Der angeführte Bericht steht in STILLINGS<br />
WANDERSCHAFT, einem Buch, das Goethe nachweislich als Quellenwerk<br />
studierte, als er seine Straßburger Zeit beschrieb. Aber dieses<br />
entscheidende Detail verwendete er <strong>nicht</strong>. Nur auf ganz versteckte<br />
Weise erfolgt eine Andeutung darüber, dass damals die Fama<br />
<strong>von</strong> seiner Rolle innerhalb der Straßburger Tischgesellschaft eine<br />
Menge zu berichten wußte: die Sesenheimer Pfarrersfamilie erkundigt<br />
sich bei Weyland "nach dem lustigen Tischgesellen, der in<br />
Straßburg mit ihm in Einer Pension speise und <strong>von</strong> dem man ihnen<br />
allerlei verkehrtes Zeug erzählt hatte" (Buch 10).<br />
Von den vielen geselligen Szenen in DICHTUNG UND WAHRHEIT<br />
wird man sich entsprechend diesem Beispiel eine Vorstellung machen<br />
dürfen. Ein sehr wichtiges Selbstzeugnis über Goethes Verhältnis<br />
zur Gesellschaft steht aber dennoch in seiner Autobiographie.<br />
Gelegentlich der Schilderung festlich verbrachter Tage in<br />
Sesenheim be<strong>kennt</strong> der Dichter: "Es war <strong>nicht</strong> das erste und letzte<br />
Mal, das ich mich in Familien, in geselligen Kreisen befand, gerade<br />
im Augenblick ihrer höchsten Blüte." Er dürfte sich schmeicheln, so<br />
heißt es weiter, etwas zu dem Glanz solcher Epochen beigetragen<br />
zu haben (Buch 11). Goethe berührt hier eine Seite seiner Persönlichkeit,<br />
die etwas Geheimnisvolles an sich hat, weil sie mit äußern<br />
Gaben: Aussehen, Beredsamkeit etc. <strong>nicht</strong>s mehr oder nur noch in<br />
sekundärer Weise zu tun hat. Es war nämlich einfach Gunst des<br />
Glücks, wenn er immer wieder "geselligen Kreisen" in ihrem jeweils<br />
besten Moment begegnete. Doch ein Glück dieser Art ist großen<br />
Persönlichkeiten wie der seinigen schicksalhaft verliehen, es<br />
ist ihnen angeboren wie ihre Genialität. Letztlich manifestiert sich<br />
darin auch wieder die dem schöpferischen Menschen in ganz besonderem<br />
Maß verliehene "Kraft, das was zusammengehört an sich<br />
heranzuziehen" (Anfang Buch 16). Ohne dies Glück wären des Dichters<br />
Werke <strong>nicht</strong> entstanden, ihm verdankte er Stoff, Stimmung,<br />
332<br />
Anregung zur Produktion. Die Biographien vieler bedeutender Persönlichkeiten<br />
melden <strong>von</strong> solch mitgeborenen Glücksumständen.<br />
DICHTUNG UND WAHRHEIT schildert sie in Fülle - mit Recht, denn sie<br />
waren ein wesentlicher Bestandteil <strong>von</strong> Goethes Leben. Der Sesenheimer<br />
Kreis ist nur ein Beispiel: <strong>von</strong> ähnlichen geselligen Zirkeln<br />
ist immer wieder die Rede. Der Kreis um die Schwester (Buch 6),<br />
der Oesersche Kreis (Buch 8), die Straßburger TIschgesellschaft (Buch<br />
9), die Darmstädter "Gemeinschaft der Heiligen" (Buch 12), der<br />
Zirkel der Frau <strong>von</strong> Laroche (Buch 13), das gesellige Treiben um<br />
Lavater - all das und noch vieles mehr gehört in diesen Bereich.<br />
Stets trug Goethe freilich, wenn er in Kreise bedeutender Menschen<br />
eintrat, das Seinige dazu bei, den "Glanz solcher Epochen"<br />
entscheidend zu steigern. Immer gilt für solche "Augenblicke höchster<br />
Blüte", was der Dichter in diesem Zusammenhang über Sesenheim<br />
berichtet - mit charakteristischem Bescheidenheitsakzent -:<br />
"Wir trugen alle Freude, wie ein Gemeingut, zusammen und wußten<br />
sie durch Geist und Liebe zu steigern." Wenn DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT <strong>von</strong> vielen schönen Augenblicken dieser Art erzählt, so<br />
wird man auf sie besondere Aufmerksamkeit zu richten haben.<br />
Denn hier verrät die Autobiographie, wie sehr in Goethes Wesen<br />
die ganze Festlichkeit des genialen Menschen beschlossen lag, wie<br />
recht eigentlich <strong>von</strong> ihm gilt, was er in der Marienbader ELEGIE <strong>von</strong><br />
der Geliebten sagt: "Zum Geleite gab dir ein Gott die Gunst des<br />
Augenblickes." I<br />
Darstellung der Umwelt<br />
Um sein Selbst darzustellen, <strong>von</strong> seiner "stufenweisenAusbildung"<br />
einen" Begriff" zu geben, schildert Goethe vor allem greifbar und<br />
klar die Welt, die ihn umgab, die Objekte, die dem äußern und<br />
innern Sinn entgegentraten. Der strömend freie Bericht über das,<br />
was <strong>von</strong> außen auf ihn einwirkte, enthüllt sein Ich weit mehr als<br />
die vagen persönlichen Be<strong>kennt</strong>nisse.<br />
"Immer findet der Verfasser sein Ich nur in der Begegnung mit<br />
der Welt" (Erich Trunz). Folgerichtig enthält denn auch Goethes<br />
333
Autobiographie ein Maximum an Welt, weit mehr als alle früheren<br />
entsprechenden Vorbilder. Schon die Städte, in denen er lernte,<br />
liebte und litt, mit welcher Lebendigkeit hat er sie geschildert! Während<br />
noch Rousseau weder <strong>von</strong> der Geburtsstadt Genf noch <strong>von</strong><br />
dem für ihn so wichtigen Paris ein wirkliches Bild gibt - die Kenntnis<br />
der Städte setzt er voraus -, stellt Goethe jeden Ort, der zum<br />
Schauplatz seiner Entwicklung wurde, aufs eindrucksvollste dar.<br />
Besonders Goethes Frankfurt haben Generationen später mit seinen<br />
Augen gesehen. DICHTUNG UND WAHRHEIT hat das Bild dieser<br />
Stadt hinübergerettet in Zeiten, die sich sonst <strong>von</strong> ihrer ursprünglichen<br />
Gestalt kaum noch eine Vorstellung machen könnten. Aber<br />
auch Leipzig, Straßburg, Wetzlar und viele andere Orte wurden<br />
durch die Darstellungen in DICHTUNG UND WAHRHEIT zu historischen<br />
Landschaften. Was sich in ihnen <strong>von</strong> Goetheschem Leben abspielte,<br />
blieb der Nachwelt durch sein verzauberndes Erzählen bewahrt.<br />
Eindrücklicher noch als die lokale Umwelt des Dichters schildert<br />
DICHTUNG UND WAHRHEIT die menschliche. In den Menschendarstellungen<br />
liegt das eigentliche Zentrum des Werks. Auf ihnen<br />
beruht alles, was Handlung darin ist, was zum eigentlichen Fabulieren<br />
gehört. Goethe sucht stets <strong>von</strong> den für ihn wichtig gewordenen<br />
Menschen beides zu berichten: in welchem Verhältnis sie<br />
zu ihm standen, und was sie an und für sich waren. Zur Handlung<br />
gehörte das eine wie das andre. Denn auch was eine Persönlichkeit<br />
objektiv gesehen darstellte, wirkte auf den Dichter, <strong>nicht</strong> nur<br />
was sie ihm an Gutem oder Ungutem zufügte. (Eine Ausnahme<br />
bildet das Fehlen einer Gesamtdarstellung der Mutter. Doch beabsichtigte<br />
Goethe sie zu geben. Wir besitzen die ausführliche Skizze<br />
dazu: die - zumeist auf Bettina Brentanos Erzählungen beruhende<br />
ARISTEIA DER MUTTER.)<br />
Das porträthafte Schildern <strong>von</strong> Menschen bedeutete abermals<br />
einen Schritt über Rousseau hinaus. Dieser erzählt meist nur, und<br />
zwar auch <strong>von</strong> den berühmtesten Zeitgenossen, was der andere<br />
ihm persönlich antat, <strong>nicht</strong> was er als Person eigentlich war. Goethes<br />
Menschenporträts in DICHTUNG UND WAHRHEIT stellen dagegen<br />
eine kostbare historische Galerie dar. Viele der geschilderten Persönlichkeiten<br />
leben nur durch die Darstellung <strong>von</strong> DICHTUNG UND<br />
334<br />
WAHRHEIT weiter. Das gilt vor allem <strong>von</strong> der illustren Reihe der<br />
Frankfurter Honoratioren. <strong>Ihr</strong>e liebevoll eingehende Schilderung<br />
diente gewiß zugleich dem Zweck, <strong>von</strong> der Menschenart jener Zeit<br />
einen Begriff zu geben, in der Goethe aufwuchs. Verkörperte sich<br />
doch in diesen Männern noch eine ganze dahingegangene Epoche<br />
- das kraftvolle 18. Jahrhundert vor der Revolution. Es waren Originale,<br />
auch wohl Sonderlinge, mit einer Fülle und Wucht der Persönlichkeit<br />
ausgestattet, wie sie spätere Zeiten so <strong>nicht</strong> mehr hervorbrachten.<br />
Diesem Menschentum hat Goethe in DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT ein Denkmal gesetzt. War der Dichter doch noch einer<br />
der ihren, er, der im Alter an Zelter schrieb: "Wir werden, mit vielleicht<br />
noch wenigen, die Letzten sein einer Epoche, die sobald <strong>nicht</strong><br />
wiederkehrt" (6. Juni 1825).<br />
Eltern, Lehrer und Freunde schildert Goethe mit Achtung und<br />
Milde, doch so, dass man ahnt: es gab in seiner Umwelt vieles Ungemäße,<br />
mit dem er zu kämpfen hatte. Das Elternhaus war - durch<br />
die Eigenheiten des Vaters - für den jungen Goethe schwierig genug.<br />
Die Lehrer erwiesen sich nie ganz als die rechten. Den Darstellungen<br />
Behrischs, Gellerts, Oesers, Herders merkt man noch<br />
manche ehemalige Enttäuschung an. Jedem begegnete Goethe zunächst<br />
verehrungs freudig mit der Hoffnung, in ihm den entscheidenden<br />
Ratgeber seiner Jugend zu finden - und alle versagten.<br />
Winckelmann, der einzige, bei dem diese Hoffnungen wohl <strong>nicht</strong><br />
getrogen hätten, gelangte im entscheidenden Moment wider alles<br />
Erwarten <strong>nicht</strong> nach Leipzig. So mußte Goethe die schwierigsten<br />
Lebensentscheidungen immer selbst treffen.<br />
Die Porträts der männlichen Freunde zeigen Licht und Schatten<br />
gemischt. Goethes Realismus läßt ihn hier alle Einseitigkeit vermeiden.<br />
Auch in seinen Dichtungen stellte er Männer niemals als<br />
reine Idealfiguren hin. Doch sind die Freunde meist positiver gPschildert,<br />
als die Einstellung Goethes zu ihnen in Wirklichkeit gewesen<br />
war. Die Charakteristik Lavaters beispielsweise hat zwar<br />
viele kritische Züge, verrät aber doch <strong>nicht</strong>s mehr <strong>von</strong> dem heiligen<br />
Zorn, der den Dichter einstmals gegen den Zürcher Propheten<br />
erfüllt hatte.<br />
Vergessen waren auch die ehemaligen Mißhelligkeiten mit Klin-<br />
335
ger, als Goethe dem Freunde in DICHTUNG UND WAHRHEIT ein verschönerndes<br />
Denkmal setzte. Im Falle <strong>von</strong> Merck und Herder wurden<br />
die schwierigen Charaktereigenschaften dieser Männer offensichtlich<br />
mit Schonung dargestellt. Allgemein färbt ein gutmütiges<br />
Wohlwollen die Menschendarstellung in DICHTUNG UND WAHRHEIT.<br />
So entsprach es Goethes Intention, die Welt mit Liebe zu betrachten,<br />
das Vergangene mit Heiterkeit zu schildern und das "Lamentable"<br />
fern zu halten.<br />
Anders steht es mit den Frauen. Wie Goethe als Dichter seine<br />
Geliebten stets idealisierend sah, so gibt er auch in DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT <strong>von</strong> den Freundinnen der Jugend ein Bild ungetrübter<br />
Schönheit. Die besonderen Eigenheiten einer jeden werden so geschildert,<br />
dass sie dadurch an individuellem Liebreiz noch gewinnt.<br />
Hier bewährt sich die ganze Kunst des großen Meisters der Frauendarstellung.<br />
Als die dichterisch glanzvollsten Partien in Dichtung<br />
und Wahrheit gelten denn auch die novellistischen Erzählungen<br />
<strong>von</strong> Gretchen, Käthchen, <strong>von</strong> Friederike, Lotte und Lili.<br />
Bildungswelt und Schaffen<br />
In entscheidender Weise erschwert wurde Goethes Entwicklung<br />
durch die Rückständigkeit der kulturellen Verhältnisse im Deutschland<br />
des 18. Jahrhunderts. "Als ich achtzehn war, war Deutschland<br />
auch erst achtzehn." Diese zu Eckermann gesprochenen Worte<br />
(15. Februar 1824) kennzeichnen die Situation, in die der Dichter<br />
gestellt war. Goethe war genötigt, auf allen Gebieten seines Wirkens<br />
den Boden, den er bearbeiten wollte, erst urbar zu machen.<br />
Um künstlerisch schaffen zu können, mußte er selbst erst das gesamte<br />
Kunstniveau seiner Zeit heben. Hierüber in umfassender<br />
Weise zu berichten, war eins der Hauptanliegen <strong>von</strong> DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT.<br />
Insbesondere die vielen Abschnitte über Literatur - deutsche,<br />
französische, englische - weisen kritisch und vergleichend hin auf<br />
die <strong>von</strong> dem jungen Goethe zu bewältigenden Schwierigkeiten. In<br />
Deutschland war die Verskunst noch unentwickelt, es fehlte an kri-<br />
336<br />
tisch-ästhetischen Maßstäben, aber auch an Stoffen, die der höheren<br />
Dichtung angemessen gewesen wären. Ausführlich wird geschildert,<br />
warum eine etwaige Anlehnung an die dominierende französische<br />
Literatur, wie sie noch Friedrich der Große befürwortete,<br />
keine Lösung darstellte (Buch 11). Gerade in Straßburg, wohin Goethe<br />
nach seinem eigenen Eingeständnis ursprünglich gegangen war,<br />
um sich in der französischen Sprache zu vervollkommnen, kam der<br />
Entschluß zur Abkehr <strong>von</strong> Frankreich. Hier erkannte er, dass dem<br />
Streben der jungen Dichtergeneration nach "Natur und Wahrheit"<br />
mit den Mitteln einer "bejahrten" Literatur und Sprache wie der<br />
französischen <strong>nicht</strong> mehr abzuhelfen war. Da lagen in der noch<br />
jungen deutschen Sprache die größeren Möglichkeiten. Herders<br />
Einfluß mag zu dieser Er<strong>kennt</strong>nis mitgeholfen haben. Entscheidend<br />
war aber wohl etwas anderes, wo<strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT <strong>nicht</strong><br />
spricht. In Straßburg erlebte Goethe das Wunder, dass ihm erstmals<br />
Gedichte glückten mit jenen Ur- und Naturlauten, die die Gewähr<br />
für eine Erneuerung der deutschen Sprache <strong>von</strong> Grund auf boten.<br />
Damit war das Französische als Vorbild entbehrlich geworden.<br />
Goethe war später mit seiner Darstellung der französischen<br />
Literatur in DICHTUNG UND WAHRHEIT <strong>nicht</strong> mehr zufrieden. "Voltaire<br />
und seine großen Zeitgenossen [. .. ] es geht aus meiner Biographie<br />
<strong>nicht</strong> deutlich hervor was diese Männer für einen Einfluß<br />
auf meine Jugend gehabt, und was es mich gekostet, mich gegen<br />
sie zu wehren und mich auf eigene Füße in ein wahreres Verhältnis<br />
zur Natur zu stellen." (Zu Eckermann, 3. Januar 1830.) DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT stellt - darauf spielen diese Worte an - die französische<br />
Literatur betont negativ dar, weil Goethe hier die Abkehr<br />
einer jungen Generation <strong>von</strong> dem für sie Veralteten historisch begründen<br />
mußte. Solche generationsbedingten Gesinnungen sind<br />
stets einseitig. Dass er in Wirklichkeit der französischen Dichtung<br />
außerordentlich viel verdankte, hat Goethe bei anderen Gelegenheiten<br />
oft betont.<br />
Auch in den Abschnitten über die deutsche Literatur des 18.<br />
Jahrhunderts findet sich manche Einseitigkeit des Urteils. Vielfach<br />
vermittelte Goethe auch hier mehr die Einsicht in eine bestimmte<br />
Zeitsituation; insofern sind diese Abschnitte in erster Linie wert-<br />
337
voll als literarhistorische Zeugnisse. Objektive Literaturgeschichte<br />
geben sie <strong>nicht</strong> und wollen sie <strong>nicht</strong> geben. Am Anfang des 7. Buches<br />
erklärt der Dichter ausdrücklich, dass er die deutsche Literatur<br />
"<strong>nicht</strong> sowohl wie sie an und für sich beschaffen sein mochte,<br />
darzustellen gedenke, als vielmehr wie sie sich zu ihm verhielt".<br />
So kommt unter anderen Gottsched unverhältnismäßig schlecht<br />
weg. Den Leistungen des "Altvaters" gegenüber war man zur Zeit,<br />
als Goethe studierte, besonders ungerecht, da die Entwicklung soeben<br />
neue Wege einschlug. Das drückt sich nOFh in DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT aus. Die köstliche Anekdote <strong>von</strong> der Ohrfeige charakterisiert<br />
sehr zutreffend die Oppositionsstimmung der damaligen<br />
Jugend. Doch hat sie dem Ansehen Gottscheds unverhältnismäßig<br />
geschadet, indem hier Goethes Erzählkunst das Bild eines bedeutenden<br />
Mannes für lange Zeit einseitig bestimmte.<br />
In anderen Fällen gibt es bei den literarischen Porträts leichte<br />
Verzeichnungen, weil Goethe <strong>nicht</strong> die Last umfangreicher Nachforschungen<br />
auf sich nehmen konnte. Gelegentlich schildert er einen<br />
Dichter nur auf Grund eines einzelnen Werks, das ihm zufällig<br />
zur Hand war. Die Charakteristik des Klingersehen Schaffens beispielsweise<br />
beruht im wesentlichen auf der Geschichte eines Teutsehen,<br />
die Goethe gerade 1813 gelesen hatte. Nur auf diesen Roman,<br />
der erst im Jahr 1798 erschienen war, trifft speziell alles in<br />
DICHTUNG UND WAHRHEIT Gesagte zu. Die aus der Sturm-und-Drang<br />
Zeit stammenden Jugendwerke Klingers - <strong>von</strong> denen eigentlich in<br />
DICHTUNG UND WAHRHEIT hätte gesprochen werden müssen - tragen<br />
aber ein ganz anderes Gepräge. Bei der Schilderung der Sturmund<br />
-Drang-Bewegung verfährt Goethe im übrigen ähnlich eigenwillig<br />
wie viele Literarhistoriker nach ihm. Er verschweigt die Tatsache<br />
oder deutet sie doch nurin unzureichender Weise an, dass ein wesentliches<br />
Charakteristikum des Sturm und Drangs die politische, sozialkritische<br />
Blickrichtung war. Meisterhaft sind innerhalb der Abschnitte<br />
über die literarischen Zeitgenossen die Darstellungen der<br />
Persönlichkeiten als solcher, soweit sie auf eigener Erinnerung beruhen.<br />
Besonders das 14. Buch - mit den Abschnitten über Klinger,<br />
Lavater, Basedow, Jacobi - zeichnet sich in dieser Hinsicht aus. Befriedigt<br />
schrieb Goethe nach seiner Fertigstellung an Riemer: "Lava-<br />
338<br />
ter und Basedow sind, dünkt mich, gut geraten, aus kleinen Zügen<br />
bildet sich die Imagination die Individualitäten gern zusammen. "14<br />
Zur Schilderung der Bildungswelt gehört in DICHTUNG UND W AHR<br />
HEIT neben der Erörterung der literarischen vor allem die der religiösen<br />
Zustände. Auch auf weltanschaulichem Gebiet waren die<br />
Schwierigkeiten, die sich Goethes Entwicklung entgegenstellten,<br />
beträchtlich. Die "öffentliche Religion" konnte dem Dichter, wie<br />
auch vielen seiner Zeitgenossen, <strong>nicht</strong> mehr Genüge tun. Ebensowenig<br />
auf die Dauer Pietismus und Herrnhuterturn, mit denen der<br />
junge Goethe sich zeitweise intensiv beschäftigte. In dem damals<br />
zwischen Glauben und Wissen entbrannten Streit sich schlechtweg<br />
auf die Seite der Aufklärung zu stellen, war ihm gleichfalls <strong>nicht</strong><br />
möglich, daran hinderte ihn die Stärke seiner metaphysischen Erlebnisfähigkeit.<br />
So war er in weltanschaulichen Dingen ebenso wie in<br />
literarischen lange Zeit ein Suchender. Doch fand er schließlich den<br />
Weg. Wie ihm als Dichter Shakespeare das große Vorbild wurde, so<br />
schloß er sich in Sachen der Philosophie und Religion hauptsächlich<br />
an Spinoza an. Linne, Shakespeare und Spinoza bezeichnete Goethe<br />
noch im Alter als diejenigen "Abgeschiedenen", die auf ihn die<br />
größte "Wirkung getan" hätten. (An Zelter, 7. November 1816.)<br />
Die Erörterung religiöser Fragen nimmt in DICHTUNG UND W AHR<br />
HEIT großen Raum ein. Von den zwanzig Büchern des Werks enthalten<br />
dreizehn diesbezügliche Abschnitte. Das zeigt, dass Goethe<br />
seiner weltanschaulichen Entwicklung ähnliche Bedeutung beimaß<br />
wie seiner künstlerischen. Außerordentlich groß war die religiöse<br />
Erregtheit der Epoche, in die seine Jugend fiel. Zu Goethes Freunden<br />
zählten bedeutende Vertreter des religiösen Lebens - Susanna<br />
<strong>Katharina</strong> <strong>von</strong> Klettenberg, Lavater, Herder, Jacobi u. a. -, die ihn<br />
immer wieder zur Auseinandersetzung mit dem Christentum nötigten.<br />
In DICHTUNG UND WAHRHEIT schildert der Dichter die allmähliche<br />
Verselbständigung seines Denkens in vielen Etappen. Während<br />
die <strong>Bibel</strong>, namentlich das Alte Testament, stets als<br />
Lieblingsbuch wichtig blieb, war es doch Goethes unablässiges Bestreben,<br />
sich "seine eigene Religion zu bilden" (Buch 8). Erst da-<br />
14 27. Juli 1813 (WA IV 23, 416).<br />
339
durch, dass ihm dies gelang, hatte er auch als Dichter den Standpunkt<br />
gefunden, <strong>von</strong> dem aus er wirken konnte. Zwar wurde Goethe,<br />
trotz manchen Drängens <strong>von</strong> Freunden, kein religiöser Dichter<br />
wie Klopstock. Aber durch die ethische Tendenz, die sein<br />
Schaffen so stark bestimmt, wirkte er doch auch im religiösen Sinn<br />
erzieherisch für viele Generationen.<br />
Wie ihn äußere Eindrücke, Erlebnisse und Bildungserlebnisse<br />
schließlich zu seinen ersten Dichtungen inspirierten, schildern die<br />
Entstehungsgeschichten der Frühwerke in DICHTUNG UND WAHRHEIT.<br />
Im 12. Buch wiederholt Goethe, was er schon im Vorwort ausgesprochen<br />
hatte: vor allem sei die Autobiographie dazu "bestimmt,<br />
die Lücken eines Autorlebens auszufüllen, manches Bruchstück zu<br />
ergänzen und das Andenken verlorner und verschollener Wagnisse<br />
zu erhalten". Die entsprechenden Partien sind darum <strong>von</strong> so großer<br />
Bedeutung, weil sie einen unvergleichlichen Einblick gewähren<br />
in die Schaffensgeheimnisse eines großen Dichters. Übrigens<br />
spricht Goethe mit besonderer Ausführlichkeit gerade über die dichterischen<br />
Fragmente und Pläne. Was ihm <strong>nicht</strong> auszuführen gelang,<br />
sind besonders die Projekte großer religiöser Dichtungen:<br />
MAHOMET, DER EWIGE JUDE, PROMETHEUS. Hier war das Interesse an<br />
den Problemen stärker als der Drang zu dichterischer Realisierung.<br />
Gerade an diesen Projekten mag Goethe aufgegangen sein, dass<br />
religiöse Dichtung außerhalb seiner Bestimmung lag.<br />
Symbolische Darstellung<br />
Goethe äußerte einmal, er habe in DICHTUNG UND WAHRHEIT "eigentlich<br />
nur sein späteres Leben hinter das frühere versteckt". Er<br />
bezeichnete seine Autobiographie in diesem Zusammenhang<br />
geradezu als "Maskerade". (An Gräfin O'Donell, 22-. Januar 1813.)<br />
Diese Worte verdienen ganz besondere Beachtung, weil sie eine<br />
der wichtigsten Seiten des Werks berühren. Tatsächlich läßt sich<br />
feststellen, dass Goethe mit Vorliebe solche Züge ins Licht rückt,<br />
die gleichnishaft auf Späteres weisen, auf dauernde Persönlichkeitsund<br />
Lebenseigentümlichkeiten. Dadurch schildert DICHTUNG UND<br />
340<br />
WAHRHEIT, obgleich nur die ersten 26 Lebensjahre behandelt werden,<br />
doch in gewisser Weise den ganzen Goethe.<br />
Einige Beispiele mögen das verdeutlichen. Schon in frühester<br />
Kinderzeit zeigt sich - beim Blick aus dem Gartenzimmer - das<br />
"Gefühl der Einsamkeit", das später für den Dichter, für das "<strong>von</strong><br />
der Natur in ihn gelegte Ernste und Ahnungsvolle", bezeichnend<br />
ist (Buch 1). Der "Gott der Natur", dem das Kind seltsame Opfer<br />
darbringt, läßt an die spätere Entwicklung Goethes zum Spinozismus,<br />
zur Naturwissenschaft denken (Schluß Buch 1). Die ersten<br />
Liebeserlebnisse - mit dem Frankfurter Gretchen, dem Leipziger<br />
Käthchen - zeigen schon jene Vorliebe Goethes für "Naturwesen",<br />
die später in seiner Ehe zum Ausdruck kam. In den Märchen DER<br />
NEUE PARIS und DIE NEUE MELUSINE sind es speziell die "kleinen"<br />
Frauen, auf die Goethes Liebe fällt. Auch darin mag man eine symbolisierende<br />
Vordeutung auf Christiane sehen. Andererseits ist es<br />
aber auch ganz charakteristisch, dass bereits Goethes erste Liebe<br />
eine "durchaus geistige Wendung" nahm, dass er "in dem andern<br />
Geschlecht das Gute und Schöne sinnlich gewahr werden" wollte<br />
(Buch 5). Zeitlebens hat der Dichter seine Geliebten in diesem Sinne<br />
verehrt. Die "Schöne-Gute" heißt noch eine der hervorragendsten<br />
Frauengestalten in Goethes letztem Roman WILHELM<br />
MEISTERS WANDERJAHRE. Vordeutend sind aber auch die verschiedenen<br />
Schilderungen des Liebeswahnsinns (vor allem in Buch 6<br />
und 7): noch in hohem Alter konnte seine Leidenschaftlichkeit den<br />
Dichter zu ähnlichem" Weinen und Rasen" bringen wie damals<br />
nach dem Gretchen-Abenteuer.<br />
Selbst ein scheinbar so geringfügiger Zug wie die Erwähnung<br />
des Diktierens im 4. Buch wird bedeutungsvoll, wenn man des Dichters<br />
späteres Leben mit in Betracht zieht. Alles in Prosa Verfaßte<br />
pflegte Goethe zu diktieren. Er schrieb wie er sprach und sprach<br />
wie er schrieb. Namentlich im Alter vermochte er dadurch wie kein<br />
anderer der deutschen Prosa etwas vom Glanz antiker Rhetorik<br />
mitzuteilen. DICHTUNG UND WAHRHEIT legt da<strong>von</strong> beredtes Zeugnis<br />
ab. Da geschah es mit gutem Vorbedacht, wenn Goethe darauf hinwies,<br />
wie es ihm schon in frühester Jugend "bequem" erschien,<br />
alles" was ihm durch den Kopf ging", zu diktieren. Über sein wohl-<br />
341
tätiges Unterstützen und Fördern eines jungen Menschen wird zu<br />
Anfang des 12. Buchs mit dem ausdrücklichen Hinweis berichtet,<br />
dass dies ein Beispiel sei für eine "Eigenheit", die Goethe auch<br />
später geblieben und ihn "viel gekostet" habe.<br />
Unzählige derartige Züge bestätigen es, dass Goethe in DICH<br />
TUNG UND WAHRHEIT sein "späteres Leben hinter das frühere versteckt".<br />
Doch enthält die Autobiographie <strong>nicht</strong> nur das eigene künftige<br />
Leben im Gleichnis, sie ist auch in einern weiteren Sinne<br />
symbolisch. "Ich dächte, es steckten darin einige Symbole des Menschenlebens",<br />
sagte der Dichter zu Eckerrnann (30. März 1831). Es<br />
war Goethe im Alter deutlich geworden, wie sehr sein Leben, seine<br />
Entwicklung, sein Schaffen überpersönliche, sinnbildliche Bedeutung<br />
hatte. Daher rührte der autobiographische Eifer in den<br />
letzten Jahrzehnten seines Lebens. Der Dichter wollte die eigenen<br />
Erfahrungen in weitestem Umfang für andere nutzbar machen und<br />
damit Sinn- und Leitbilder geben.<br />
Zu allen Zeiten seines Lebens sprach Goethe gern <strong>von</strong> der<br />
Swedenborgschen Vorstellung, dass "Geister", die <strong>nicht</strong> mit den<br />
rechten Sinnesorganen ausgestattet sind, sich der Augen des Weisen<br />
bedienen müssen, wollen sie die Welt schauen und aus ihr lernen.<br />
Als eine solchen Swedenborgschen Seher-Weisen mag er sich<br />
selbst im Alter betrachtet haben. Er ließ andere die Welt, sein Leben,<br />
wie er es geschaut hatte, durch seineAugen sehen. Wie in der Schlußszene<br />
<strong>von</strong> Faust 11 der Pater Seraphicus und Faust selbst auf diese<br />
Swedenborgsche Weise den Seligen Knaben zu Lehrern werden -<br />
<strong>nicht</strong> zufällig taucht das Bild in der AItersdichtung wieder auf - so<br />
ward Goethe der Erzieher einer in vielem noch unmündigen Menschheit.<br />
Durch das Medium seiner autobiographischen Schriften haben<br />
ganze Generationen mit Goethes Augen gesehen, was Goethe<br />
gelernt und gelehrt hat. Frankfurt, Leipzig, Straßburg, Wetzlar, Weimar,<br />
Rom - die Stationen des Goetheschen Lebens - wurden für<br />
Unzählige ein geistiger Besitz wie selbst Erfahrenes. Was er lebte,<br />
wurde andern zur Lehre. (Selige Knaben in FAUST 11, Vs. 12082:)<br />
342<br />
Doch dieser hat gelernt,<br />
Er wird uns lehren.<br />
"Schwänchen" und "Schwan"<br />
im SCHENKENBUCH des WEST-ÖSTLICHEN DIVAN<br />
Schenke<br />
Heute hast du gut gegessen,<br />
Doch du hast noch mehr getrunken;<br />
Was du bei dem Mahl vergessen<br />
Ist in diesen Napf gesunken.<br />
Sieh, das nennen wir ein Schwänchen<br />
Wie's dem satten Gast gelüstet,<br />
Dieses bring' ich meinem Schwane<br />
Der sich auf den Wellen brüstet.<br />
Doch vom Singschwan will man wissen<br />
Daß er sich zu Grabe läutet;<br />
Laß mich jedes Lied vermissen,<br />
Wenn es auf dein Ende deutet.<br />
Dies Gedicht entstand im Oktober 1814, nachdem Goethe in dem<br />
13jährigen August Wilhelm Paulus, dem Sohn des Heidelberger<br />
Orientalisten Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, das wichtigste<br />
menschliche Vorbild für die Gestalt des 'Schenken' gefunden hatte.<br />
Eine Abschrift des Gedichts vom 1. Januar 1815 ging als Neujahrsgruß<br />
an den jungen Paulus nach Heidelberg1• Dort lautete die Überschrift:<br />
Der gute Schenke spricht, am Ende aber stand der Zusatz:<br />
Nach dem Lateinischen. Diesen Quellenhinweis hielten die<br />
Kommentatoren, sofern sie überhaupt darauf eingingen, für fingiert.<br />
So Gustav v. Loeper 2 : "Paulus zu Heidelberg erhielt das Gedicht<br />
mit dem absichtlich irrigen Zusatz 'Nach dem Lateinischen'."<br />
Das wurde <strong>von</strong> Heinrich Düntzez-3 übernommen: "Das 'Nach dem<br />
1 Vgl. WAIV 25,236 f.<br />
2 Hempel: Goethe's Werke, 36 Teile in 23 Bdn. Berlin 1868-1879. -4. Teil: Gedichte. Hg.<br />
v. Gustav v. Loeper. Bd 4 (1872) S. 183.<br />
3 Heinrich Düntzer, Erläuterungen zu den Deutschen Klassikern. Goethes westöstlicher<br />
Divan. Leipzig 1878. S. 375.<br />
343
tale, seltsame Wirkung hervorzubringen, das Ungereimte zusammenreimt,<br />
so soll der Deutsche, dem dergleichen wohl auch begegnet,<br />
dazu <strong>nicht</strong> scheel sehen."<br />
In unserem Fall liegt nur eins der vielen praktischen Beispiele<br />
vor, die Goethe für die Eigenart orientalischer Dichtung im Divan<br />
bringt, und gerade der ominöse achte Vers dürfte die Aufgabe haben,<br />
das quasi "aus dem Lateinischen" stammende Gedicht intensiv<br />
mit dem Hafis-Stil zu verbinden. Es ist also orientalisierendes<br />
Metaphernspiel, wenn in Goethes Gedicht der 'Schenke' den Dichter<br />
»Schwan« nennt. Gegenüber der Kühnheit echter östlicher Tropen<br />
ist das noch vergleichsweise zahm. Denn man vermag - was<br />
bei orientalischen Gleichnissen <strong>nicht</strong> immer der Fall ist - das tertium<br />
comparationis, Sänger = Schwan, zu durchschauen. Auch die<br />
Verselbständigung des Schwanbildes in v. 8 ist <strong>nicht</strong> so abwegig,<br />
dass gar keine Erklärung mehr möglich wäre. Bezieht man den<br />
»Schwan«, der »sich auf den Wellen brüstet« auf den Dichter als<br />
»Singschwan«, so darf man in dem 'Sichbrüsten' doch immer noch<br />
das Wohlgefühl des Dichters in der Trunkenheit gemalt sehen, das<br />
»herrliche Gefühl der Gegenwart«, welches ihm »im Becher« gewährt<br />
ist, wie Goethe in v. 21 f. des Gedichts »Jene garstige Vettel«<br />
rühmt.<br />
Das Gedicht vorn Schwänchen und Schwan darf also auf einern<br />
einheitlichen Gedanken beruhend erkannt werden. Seine Einheit<br />
liegt in dem Kontrapost: Schwänchen-Dichterschwan. Nur so wird,<br />
was der Schenke empfindet und tut, verständlich. Nur so wird es<br />
auch begreiflich, daß das Gedicht in der Paulus-Handschrift überschrieben<br />
war: Der gute Schenke spricht. Den gleichen Kontrapost<br />
erkennen wir in dem Martial-Distichon. Auch hier ist das<br />
Entscheidende, dass ein Xenion = Schwänchen den »cantator cygnus«,<br />
den Sänger-Schwan zum Gegenstand hat. So mag uns auch<br />
die Kenntnis der antiken 'Quelle' einen Hinweis mehr auf die innere<br />
Einheit des Gedichtes geben. 19<br />
19 Wolfgang Kayser bestätigte: "Die Deutung <strong>Mommsen</strong>s erweist sich vom Rhythmus<br />
her als die richtige." Vgl. W. K., Die Vortrags reise. Studien zur Literatur. Bern<br />
1958, S. 160 f.<br />
352<br />
Goethe und Zel ter<br />
Zelter [ ... ] befand sich in dem seltsamsten Drange zwischen einern ererbten,<br />
<strong>von</strong> Jugend auf geübten, bis zur Meisterschaft durchgeführten Handwerk,<br />
das ihm eine bürgerliche Existenz ökonomisch versicherte, und zwischen<br />
einern eingebornen, kräftigen, unwiderstehlichen Kunsttriebe, der aus<br />
seinem Individuum den ganzen Reichtum der Tonwelt entwickelte. Jenes<br />
treibend, <strong>von</strong> diesem getrieben, <strong>von</strong> jenem eine erworbene Fertigkeit besitzend,<br />
in diesem nach einer zu erwerbenden Gewandtheit bestrebt, stand<br />
er <strong>nicht</strong> etwa wie Herkules am Scheidewege zwischen dem, was zu ergreifen<br />
oder zu meiden sein möchte, sondern er ward <strong>von</strong> zwei gleich werten<br />
Musen hin und her gezogen, deren eine sich seiner bemächtigt, deren andere<br />
dagegen er sich anzueignen wünschte. Bei seinem redlichen, tüchtig<br />
bürgerlichen Ernst war es ihm ebensosehr um sittliche Bildung zu tun, als<br />
diese mit der ästhetischen so nah verwandt, ja ihr verkörpert ist, und eine<br />
ohne die andere zu wechselseitiger Vollkommenheit <strong>nicht</strong> gedacht werden<br />
kann.<br />
Goethe, TAG- UND JAHRES-HEFTE 1803.<br />
Das hat mir die Mutter prophezeit: "Dir", sagte sie, "muß es wohlgehn,<br />
das ist mein Gebet. Du wirst vieles vor dir hingehn sehn, aber du wirst <strong>nicht</strong><br />
allein sein; du sollst den besten Freund haben und behalten; ihr werdet, mei-<br />
. lenweit auseinander, Eine;; Sinnes sein; du wirst sehen, hören und genießen,<br />
was Tausende dir beneiden werden." Da nun das alles so ist und trifft, so<br />
muß ich dir nachlaufen, und wie und warum es geschieht, weißt du.<br />
Zelter an Goethe 27. Apri/1828.<br />
Ich danke Gott stündlich auf den Knieen meines Herzens, daß ich endlich<br />
<strong>Ihr</strong> Angesicht gesehn habe. Die Erinnerung dieser Tage wird nur mit meinem<br />
Gedächtnisse aufhören. Ein neuer Geist ist in mir durch die Berührung<br />
erweckt, und wenn ich je etwas hervorgebracht oder hervorbringe, das der<br />
Musen würdig ist, so weiß ich, daß es Gabe ist und woher sie kommt.<br />
Zelter an Goethe 7. Apri/1802.<br />
353
Leben (er bedurfte das früher) über Gemeines und gelegentlich-heftige Ausbrüche<br />
desselben emporgehoben, emporgehalten. Und alles dies, ohne daß<br />
er an Kraft und Freiheit des Geistes, an Festigkeit und Eigentümlichkeit des<br />
Charakters, selbst an Besonderheit des Individuellen und jener Art verloren<br />
hätte. Seit Errichtung dieser Freundschaft war er im Grunde stets bei und<br />
mit Goethen. Bei jedem Bedeutenden, das er dachte und empfand, erfuhr<br />
und tat, schwebte ihm vor: wie würde Er's ansehen, wie es aufnehmen, wie<br />
damit verfahren? [ ... ] <strong>Ihr</strong> Zusammensein hatte für einen dritten Mann, wenn<br />
dieser auch nur auf das Nächste, was vor den Sinnen lag, merken wollte -<br />
etwas Erhebendes, ja, daß ich so sage, etwas Erbauliches. Zwei hochbetagte,<br />
ganz eigentümliche, würdevolle Männer, in allem und jedem, was der<br />
äußern Welt und ihren Verhältnissen zugehört, <strong>von</strong> einander so gänzlich verschieden:<br />
in vielem und Wesentlichem, was der innern eignet, einander so<br />
nahe verwandt - einer den andern durch und durch kennend, einer dem<br />
andern in alle dem, was ihm eigen, volle Gerechtigkeit, angenehme Förderung,<br />
sorgsame Schonung erweisend - der eine mit ruhiger Freundlichkeit<br />
und heiterer Zuneigung entgegenkommend: der andere mit heller Freude<br />
und zwischendurch mit stürmischem, auch wohl barockem Enthusiasmus<br />
herausbrechend - beide ohne allen Rückhalt und <strong>von</strong> Grund aus sich gegen<br />
einander aussprechend über jedes, was sie vorzüglich und in eben dieser<br />
Zeit beschäftigt, oder absichtslos scherzhaft hinwerfend, was der Zufall<br />
und die gesteigerte Laune gibt - jeder das Beste, was er eben hat, darbringend,<br />
jeder aufs beste, wie er eben kann, aufnehmend - dann beide, losgebunden<br />
<strong>von</strong> allem Beschränkenden, fröhlich mit einander, wie Jünglinge,<br />
im Vergessen aller Welt außer den vier Pfählen am schönsten Augenblicke<br />
hangend - - noch einmal: Es hatte etwas Seelenerhebendes, ja etwas Erbauliches.<br />
Goethes Freundschaft mit Zelter<br />
Goethe und Zelter begegneten sich erstmals im Februar 1802. Sehr<br />
bald entwickelte sich zwischen beiden ein Freundschaftsverhältnis,<br />
das seiner Festigkeit und Dauer nach im Leben beider Männer<br />
<strong>nicht</strong> seinesgleichen hatte. In den drei Jahrzehntel1 ihrer .<br />
Freundschaft gab es keine Trübung, kein Nachlassen, keine Pause,<br />
wie man es sonst in fast allen menschlichen Beziehungen Goethes<br />
feststellt, die sich über vergleichbar lange Zeiträume erstrecken.<br />
Im Gegenteil, eine stetige Intensivierung charakterisiert<br />
356<br />
diesen Bund bis zu seinem Ende - und selbst dieses Ende erscheint<br />
noch wie eine letzte wundersame Steigerung. Der Tod Zelters, keine<br />
zwei Monate nach Goethes Ableben, wurde verursacht - darüber<br />
gibt es nur eine Meinung - durch den Schmerz über den Verlust<br />
des Freundes. "Excellenz hatten natürlich den Vortritt, aber<br />
ich folge bald nach" - mit diesen Worten verbeugte sich der<br />
Trauernde vor der Büste des Dichters, und in wenigen Tagen machte<br />
er seine Prophezeiung wahr.<br />
Schon 1796 war Goethe aufmerksam geworden auf Zelters<br />
Kompositionen seiner Gedichte. Diese Vertonungen sagten ihm zu,<br />
mehr als alle anderen, weil ihre schlichte Musik sich <strong>nicht</strong> vordrängte<br />
und die Aufmerksamkeit vom Dichterwort ablenkte. In<br />
diesem Sinne empfand er Zelters Lieder als "radicale Reproduction<br />
der poetischen Intentionen" (an A. W. Schlegel 18. Juni 1798).<br />
Entscheidend war für den Dichter, dass Zelter an einem Lied "den<br />
Charakter traf", während anspruchsvollere Kompositionen den<br />
Nachteil hatten, dass sie "den Eindruck des Ganzen durch vordringende<br />
Einzelnheiten zerstören" (an W. v. Humboldt 14. März<br />
1803). Darüber hinaus hat Goethe Zelter als Komponisten <strong>nicht</strong><br />
eigentlich überschätzt, wie auch bekanntlich Zelter selbst seinen<br />
Tonschöpfung.en nur einen begrenzten Wert zumaß. So bildete<br />
denn auch durchaus <strong>nicht</strong> etwa die Musik das wesentliche Fundament<br />
der Freundschaft zwischen beiden Männern. Was Goethe an<br />
Zelter bewunderte und 1iebte, war <strong>nicht</strong> in erster Linie sein fachliches<br />
Können und Wissen; den Ausschlag gaben vielmehr seine<br />
menschlichen Eigenschaften, sein Charakter, seine Persönlichkeit.<br />
Das unterscheidet die Freundschaft mit Zelter <strong>von</strong> den vielen Verbindungen<br />
Goethes mit Männern, die in bestimmten Fächern exzellierten<br />
und dadurch wertvolle Berater und Helfer wurden.<br />
War Zelter <strong>nicht</strong> genial als Komponist, so durchdrang doch<br />
Genialität sein ganzes Wesen. Durch Kraft und Energie einer<br />
außerordentlichen Persönlichkeit war er dazu geboren, Dirigent,<br />
Anführer, Mittelpunkt einer großen künstlerischen Gemeinde zu<br />
sein. So gingen <strong>von</strong> seiner Tätigkeit als Leiter der Singakademie,<br />
als Gründer der »Liedertafel« Generationen überdauernde<br />
Wirkungen aus. Liebenswürdig und attraktiv, imponierend in<br />
357
höchstem Maße - schon durch seinen riesenhaften Wuchs - gewann<br />
er als Mensch die Herzen. Es zeugt <strong>von</strong> der ungewöhnlichen<br />
Ausstrahlung seiner Persönlichkeit, dass eine Stadt wie Berlin ihn<br />
in einem seiner Art nach unvergleichlichen Plebiszit zum Besten<br />
und Würdigsten erklärte, als es galt, Napoleon den geeigneten<br />
Volksvertreter entgegenzustellen. Geistreich und gebildet, war<br />
Zelter selbst für Männer wie Goethe, Schiller, Fichte, Schlegel,<br />
Schleiermacher und viele andere Prominente seiner Zeit ein fruchtbarer<br />
Gesprächspartner. Was ihm dabei zugute kam, war etwas,<br />
das keine Schule und Gelehrsamkeit verleiht: Gedanke und Wort<br />
entwickelten sich bei ihm auf dem Grunde einer urwüchsig gesunden,<br />
wie Goethe es nannte, "derb und tüchtigen" Natur. "Seine<br />
Reden sind handfest wie Mauern, aber seine Gefühle zart und<br />
musikalisch" - so charakterisiert ihn A. W. Schlegel (an Goethe<br />
10. Juni 1798), anspielend auf Zelters Herkunft aus dem Maurerberuf.<br />
Und in der Tat: 'auf dem Bau', <strong>von</strong> den Berliner Handwerkern<br />
lernte Zelter, immer das rechte, treffend-griffige, <strong>von</strong> Schlagfertigkeit<br />
und prallem Humor gewürzte Wort zu finden. All dies<br />
bewirkte, dass Zelters Urteile bei Goethe so hoch in Ehren standen,<br />
auch wenn sie sein eigenes Schaffen betrafen. Mochte er <strong>von</strong><br />
Gelehrteren "manches Gute und Freundliche" über ein Werk hören,<br />
den ausschlaggebenden, brauchbaren Spruch erwartete und<br />
empfing er in der Regel <strong>von</strong> Zelter: schließlich blieb dieser "der<br />
erste und einzige, der in die Sache selbst eingeht" (an Zelter<br />
3. Dezember 1812, über dessen Bemerkungen zu DICHTUNG UND<br />
WAHRHEIT). Wie Zelters Persönlichkeit an Reichtum, so übertraf<br />
sein Charakter an Stärke, Lauterkeit und Tiefe die meisten, mit<br />
denen der späte Goethe freundschaftliche Kontakte pflegte. "Tüchtig",<br />
"redlich", "grandios", "grundwahr und trefflich" - Vokabeln<br />
wie diese kehren in Goethes Zelterlob immer wieder. Mit ganz<br />
ähnlichen Ausdrücken definierte er in WINCKELMANN UND SEIN JAHR<br />
HUNDERT die Besonderheit des Winckelmannschen Charakter$. Das<br />
berühmte Wort über Zelter: "Wenn die Tüchtigkeit sich aus der<br />
WeIt verlöhre; so könnte man sie durch ihn wieder herstellen", läßt<br />
vermuten, dass vieles bei dem Freund ihn an Winckelmann erinnerte:<br />
es wurde geschrieben wenige Monate nach Abfassung der<br />
358<br />
Winckelmannschrift und kam aus deren Gedankenkreis (an Herzog<br />
Carl August 10. August 1805).<br />
Besonders beeindruckt war Goethe immer wieder <strong>von</strong> der Uneigennützigkeit<br />
Zelters. Als "rührend" empfand er das selbstlose<br />
Anerkennen und Fördern <strong>von</strong> Schülern, auch wenn diese größer<br />
waren als er selber (vgl. Goethe an Zelter 8. März 1824). Bewundernswert<br />
war ihm stets, wie Zelter mit den Sorgen ums tägliche<br />
Brot (für eine zeitweilig mehr als fünfzehnköpfige Familie!) fertig<br />
wurde, Sorgen, die er freiwillig auf sich nahm seit der Ausübung<br />
seines zweiten, des Musikerberufs. Dabei wird es ihm noch <strong>nicht</strong><br />
einmal zu Ohren gekommen sein, dass Zelter noch im Jahre 1811<br />
"wöchentlich 27 Lectionen unentgeltlich" erteilte, um unbemittelten,<br />
aber begabten Schülern weiterzuhelfen.1<br />
Goethes Freundschaft mit Zelter erhält dadurch ihr besonderes<br />
Gepräge, dass sie sich mehr auf einen intensiven Briefwechsel<br />
stützte als auf persönliche Gegenwart. Insgesamt haben sich beide<br />
Freunde nur etwa 27 Wochen gesehen. Jede Begegnung mit Zelter<br />
steigerte allerdings Goethes Zuneigung, oft genug bedeutete<br />
sie ihm Trost und Erquickung in schwerer Krise. So war es im Jahre<br />
1805, einige Monate nach Schillers Tod, Zelters Besuch, der dem<br />
Dichter" wieder.Lust zu leben gegeben und vermehrt hat" (an Zelter<br />
1. September 1805). So riß ihn der Freund 1814 aus seiner tiefen<br />
Verstimmung über die Entwicklung des öffentlichen Lebens<br />
und erweckte die Lust zu neuen Liedern. Zelters Gegenwart und<br />
Zuspruch richtete ihn auf, als er 1823, im Jahr der Marienbader<br />
ELEGIE, <strong>von</strong> leidenschaftlicher Depression erfaßt darniederlag. Kein<br />
zweiter kann sich rühmen, dem späten Goethe als Helfer in ähnlichen<br />
Situationen ähnliches bedeutet zu haben.<br />
Dennoch: was Goethes Dankbarkeit mehr als alles andere hervorrief,<br />
waren Zelters Briefe. Schätzte er diese anfangs als Quelle<br />
der Belehrung und Erheiterung oder als menschliche Dokumente,<br />
so erkannte er bald ihren eigentlichen Wert. Er entdeckte, dass<br />
Siehe Zelters Bericht Über den Zustand des allgemeinen Gesangswesens, zitiert bei: AIfred<br />
Morgenroth, earl Friedrich Zelter. Berliner Dissertation 1922 (ungedruckt).<br />
5.65.<br />
359
sie Kunstwerke waren. Goethe hat einen großen Teil der bei ihm<br />
eingehenden Briefe geachtet und geehrt: Zelters Briefe hat er genossen.<br />
Vielfach ist es bezeugt, wie gern er sie Freunden vortrug<br />
und mit Begeisterung <strong>von</strong> ihnen sprach. Noch im hohen Alter ließ<br />
er sich die sorgfältig zusammengehefteten Jahrgänge an stillen<br />
Winterabenden "zu erbaulicher Unterhaltung" vorlesen. Vom Jahr<br />
1825 ab beschäftigte er sich bis zu seinem Tode mit der Redaktion<br />
seines Briefwechsels mit Zelter, den er als nahezu druckfertiges<br />
Manuskript hinterließ zur Veröffentlichung "nach.beiderseitigem<br />
Ableben". In ähnlicher Weise hatte er nur den Bnefwechsel<br />
mit Schiller selbst redigiert. Andeutungsweise gab er dem Freunde<br />
auch zu verstehen, dass er seine Briefe <strong>nicht</strong> geringer schätzte<br />
als die Schillerschen, ja dass er ihnen sogar in mancher Hinsicht<br />
Vorzüge zuerkannte. 2 Das Besondere an Zelters Briefen bestand<br />
für Goethe vor allem darin, dass in ihnen ganz allgemein das "genre<br />
epistolaire" mit wirklicher Meisterschaft behandelt war. Hierin<br />
sah er einen ganz ungewöhnlichen Fall, in Anbetracht der Tatsache,<br />
dass die deutsche Sprache gerade der "Gattung" des Briefs<br />
so wenig günstig sei (zu F. Soret 3. Juni 1824).. . . .<br />
Durch den ganzen Briefwechsel mit Zelter zIehen sIch dIe BItten<br />
Goethes an den Freund, er möge ihm häufig und ausführlich<br />
schreiben: Goethe konnte <strong>von</strong> diesen "erquickenden" Briefen <strong>nicht</strong><br />
genug bekommen. Nicht zuletzt Zelters Reisebeschreibungen hatten<br />
es ihm als schriftstellerische Bravourstücke angetan. Trotz oft<br />
erdrückender Arbeits- und Sorgenlasten, die Goethe einmal zu der<br />
Äußerung veranlaßten: "Es ist wirklich etwas prometheisches in<br />
<strong>Ihr</strong>er Art zu seyn, das ich nur anstaunen und verehren kann" (an<br />
Zelter 30. August 1807), trotz Behinderung durch Alter und Augenkrankheit<br />
kam Zelter unermüdlich den Wünschen des Freundes<br />
nach. "Nur Geben heißt Leben" war seine Maxime (an Goethe<br />
19. Juli 1828), und selten trat ein Freund Goethes so entschieden<br />
und nachhaltig als Schenkender auf wie Zelter. Belustigend<br />
ist es zu sehen, wie er Goethes unersättliches Verlangen schließ-<br />
2 An Zelter 28. Dez. 1830; 4. Jan. 1831. Vgl. EGW I 444-70: BRIEFWECHSEL ZWISCHEN GOE<br />
360<br />
THE UND ZELTER.<br />
lich bei Gelegenheit auch stillt, indem er ihm Briefe an andere<br />
Adressaten mitschickt: "Da du mein Geschreibsel gerne hast [. .. ]"<br />
- mit solchen und ähnlichen Begründungen werden dann Beilagen<br />
dieser Art angekündigt. Unverkennbar groß war Goethes Bestreben,<br />
sich zu revanchieren und Zelter mit, wenn auch <strong>nicht</strong> so umfangreichen<br />
so doch gehaltvollen Briefen zu bedenken, ihm die<br />
geistige Nahrung zu spenden, nach der er stärkstes Verlangen trug.<br />
Seit die postume Veröffentlichung des Briefwechsels beschlossen<br />
war, breitete er planmäßig in den Schreiben an Zelter ein besonders<br />
reiches Gedankengut aus, als Vermächtnis an die Nachwelt.<br />
"Wenn nur etwas Gutes <strong>von</strong> mir übrigbleibt und nachzuwirken<br />
vermag, so bin ich über mein Schicksal völlig getröstet" (an<br />
Goethe 7. August 1807). Dieser sehnliche Wunsch Zelters, etwas<br />
Bleibendes zu hinterlassen, ging in Erfüllung: zwar <strong>nicht</strong> der<br />
Komponist, aber der Schriftsteller Zelter schuf Unvergängliches.<br />
Bereits an seinem Grabe rühmte Schleiermacher, er sei "einer unserer<br />
ersten Meister geworden in der vaterländischen Sprache". Kein<br />
Wort hier<strong>von</strong> ist zuviel gesagt. Auf dem Gebiet, innerhalb dessen<br />
vor allem er zu schreiben verstand, dem des 'genre epistolaire',<br />
eroberte sich Zelter einen ersten Platz. Einmal weil hier der ganze<br />
Reichtum seiner vielfarbigen Persönlichkeit einen adäquaten<br />
sprachlichen Ausdruck fand; vor allem aber auch darum, weil<br />
<strong>nicht</strong> das geringste 'Literarische' diesen Briefen anhaftet - obgleich<br />
Zelter doch mit echter Künstlersorgfalt an ihnen feilte. Sie sind<br />
ganz und gar spontanes unmittelbares Leben. Dass Zelter es zu<br />
dieser Meisterschaft des Briefstils brachte, verdankte er seiner Verehrung<br />
für Goethe. Er hatte hier den Weg gefunden, dem Freund,<br />
mit Sokrates zu sprechen, kata dynamin, nach bestem Vermögen<br />
nützlich zu sein. Die vielen Stellen, in denen er jener Verehrung<br />
Ausdruck gab, gehören zum Schönsten in seinen Briefen. Sie bilden<br />
für sich einen stillen Weihebezirk, wie es ähnliche im Schrifttum<br />
der Welt <strong>nicht</strong> allzuviele gibt.<br />
Goethes Freundschaftsverhältnisse standen im ganzen unter<br />
keinem günstigen Stern. Bei den Empfindsamen, den Religiösen,<br />
den Stürmern und Drängern - den Kreisen, in denen besonders<br />
viel <strong>von</strong> Freundschaft geschwärmt wurde - galt er leicht als kalter<br />
361
zurückstoßender Antonio; für die Welt-, Hof- und Vernunftmenschen<br />
war er eher ein Tasso, entrückt in der Ferne seines Künstlerlebens.<br />
Fast immer fühlte man sich irritiert durch seine Überlegenheit,<br />
und dem älteren Goethe warf man noch dazu vor, dass er sich<br />
durch sein rastloses Arbeiten "den Freunden entzog". So war es<br />
ihm <strong>nicht</strong> oft vergönnt, sich freundschaftlich »vertrauend ohne<br />
Rückhalt hinzugeben« (TASSO). Dass ihm dies bei Zelter möglich<br />
war, macht seine Verbindung mit diesem Manne zu dem seltenen<br />
Glücks- und Ausnahmefall. Es war Zelters Verdienst, dahin zu gelangen,<br />
jede Seite des Menschen Goethe zu verstehen. Vielleicht<br />
weil er selbst mit seiner genialen Natur hoch genug stand, dass<br />
ihn des Freundes Größe <strong>nicht</strong> drückte. Vor allem aber, weil er Goethes<br />
Spruch aus den WAHLVERWANDTSCHAFTEN zu beherzigen verstand:<br />
"Gegen große Vorzüge eines andern gibt es kein Rettungsmittel<br />
als die Liebe."<br />
362<br />
Goethe und Eckermann<br />
Dr. Eckermann, ein junger, wahrhaft bedeutender Herankömmling, der sich<br />
mit aufrichtiger Neigung an meinem Tun, Schreiben, Treiben und Lassen<br />
ausgebildet hat, und mir gegenwärtig bei Redaktion der vielfachsten Papiere<br />
treuen Beistand leistet [ ... ]<br />
An C. F. Graf v. Reinhard, 2. Juni 1824<br />
Der getreue Eckart ist mir <strong>von</strong> großer Beihülfe. Reinen und redlichen Gesinnungen<br />
treu, wächst er täglich an Kenntnis, Ein- und Übersicht und<br />
bleibt, wegen fördernder Teilnahme, ganz unschätzbar.<br />
An C. F. Zelter, 14. Dezember 1830<br />
Eckermann versteht am besten, literarische Produktionen mit mir zu extorquieren<br />
durch den verständigen Anteil, den er an dem bereits Geleisteten,<br />
bereits Begonnenen nimmt. So ist er vorzüglich Ursache, daß ich den Faust<br />
fortsetze, daß die zwei ersten Akte des zweiten Teils beinahe fertig sind.<br />
Zu F. v. Müller, 8. Juni 1830<br />
Es ist <strong>nicht</strong> gut, daß der Mensch alleine sei, und besonders <strong>nicht</strong>, daß er alleine<br />
arbeite; vielmehr bedarf er der Teilnahme und Anregung, wenn etwas<br />
gelingen soll. Ich verdanke Schillern die Ach i 11 eis und viele meiner<br />
Ball ade n, wozu er mich getrieben, und Sie können es sich zurechnen,<br />
wenn ich den zweiten Teil des Faust zustande bringe. Ich habe es Ihnen<br />
schon oft gesagt, aber ich muß es wiederholen, damit Sie es wissen.<br />
ZU J. P. Eckermann, 7. März 1830<br />
Mein Verhältnis zu Goethe war eigentümlicher Art und sehr zarter Natur.<br />
Es war das des Schülers zum Meister, das des Sohnes zum Vater, das des<br />
Bildungs-Bedürftigen zum Bildungs-Reichen.<br />
Eckermann, Vorrede zum 3. Teil der G ESPRÄCHE<br />
363
kommen, damit das Kleinod der GESPRÄCHE das Licht der Welt erblicken<br />
konnte. Da war Eckermanns bewundernswerter Instinkt,<br />
der ihn schon in der Jugend <strong>von</strong> fern seine Bestimmung erahnen<br />
ließ; da war jene nachtwandlerische Sicherheit, mit der er stets die<br />
richtigen Wege einschlug - nach seinen eigenen Worten "wie die<br />
Tiere durch ihre Organe belehrt" -, um dorthin zu gelangen, wo<br />
die Lebensaufgabe seiner harrte; da war schließlich und vor allem<br />
die Stärke des Charakters, die ihn niemals vor den Opfern zurückschrecken<br />
ließ, wie sie ihm seine Sendung auferlegte. Mußte<br />
er doch, um seinen Platz bei Goethe behaupten zu können, jeden<br />
Gedanken an bürgerliche Sekurität hintanstellen. Warnender<br />
Freunde und der klagenden Braut <strong>nicht</strong> achtend, ließ er Jahr um<br />
Jahr verstreichen, in denen er sich eine 'Existenz' hätte gründen<br />
können und müssen: Goethe zu dienen war ihm wichtiger. So blieb<br />
er ein armer Mann bis an sein Ende, und für das Buch, dem er<br />
seine Unsterblichkeit verdankt, war ein zerschelltes Leben der<br />
Preis.<br />
Einzigartige moralische Kräfte ließen Eckermann die kaum<br />
überdurchschnittliche Mitgift natürlicher Gaben zusammenraffen<br />
zur fruchtbaren Tat. Dass es nötig sei, um höherer Zwecke willen<br />
Opfer zu bringen, zu entbehren, zu entsagen, diese Lebenslehre<br />
Goethes war ihm zum Evangelium geworden - Eckermann war<br />
einer der ersten, wenn <strong>nicht</strong> überhaupt der erste und auf lange<br />
hinaus der einzige, der mit dieser Lehre rigoros Ernst machte. <strong>Ihr</strong>er<br />
Realisierung durch die Tat kam eine tief in seiner Natur begründete<br />
Tendenz entgegen: eine Art Kreuzfahrergesinnung, die<br />
ihn <strong>von</strong> früh auf beherrscht. "Der guten Sache dienen" - "für die<br />
gute Sache etwas tun" - in den "Streit des Rechten und Verkehrten"<br />
aktiv eingreifen, das waren typisch Eckermannsche Devisen.<br />
Unter ihnen griff schon der Student zur Feder, um die BEYTRÄGE<br />
ZUR POESIE MIT BESONDERER HINWEISUNG AUF GOETHE zu schreiben, das<br />
Buch, das ihm den Weg nach Weimar bahnte. Von der 'Sache' her<br />
also wird Eckermann zu Goethe getrieben, <strong>nicht</strong> etwa <strong>von</strong> einem<br />
unklaren, zum Selbstzweck erhobenen Heroenkult! Dass in der<br />
Welt des Geistes und der Kunst vieles im Argen liegt, die 'gute<br />
Sache' Streiter braucht! damit <strong>nicht</strong> das 'Verkehrte' obsiege - das<br />
366<br />
ruft Eckermanns Aktivität auf den Plan. Zu Goethe stößt er, für<br />
Goethe kämpft er, weil er in ihm den Exponenten der guten Sache<br />
sieht. Noch an seinen GESPRÄCHEN ist ihm das Wichtigste, das<br />
sie geeignet seien, "die heilsamste Wirkung auf die Welt" - "auf<br />
den jetzigen Stand deutscher Kultur einen wohltätigen Einfluß<br />
auszuüben". Sie sind gleichsam ein Nachhutgefecht des <strong>von</strong> Go _<br />
the geführten bellum iustum: ein Buch bewußt geschrieben zu Nutz<br />
und Frommen des "Guten". Welch entscheidende Rolle dies r<br />
Trieb, sich der "guten Sache" zur Verfügung zu stellen, in sein m<br />
Leben spielt, darüber spricht sich eine briefliche Äußerung des alten<br />
Eckermann bescheiden-deutlich aus: "Es liegt in meiner N •<br />
tur, das Gute unbedingt zu verehren, und wenn aus mir etwas g _<br />
worden ist und noch ferner werden möchte, so verdanke ich<br />
lediglich dieser meiner Einrichtung; sintemalen mein Wissen ni ht<br />
weit her ist und meine Lebensumstände sehr widerwärtiger N •<br />
tur waren und noch sind."<br />
Das Arbeits- und Freundschaftsverhältnis zwischen Goethe und<br />
Eckermann hatte zur Grundlage die gemeinsame Herausgabe d r<br />
Goetheschen Schriften. Hier entfaltete Eckermann, durchdrun n<br />
vom Gefühl seiner Mission, für des Dichters" Wirkung in d r<br />
Gegenwart" etwas tun zu müssen, eine fruchtbare, <strong>von</strong> Goeth mit<br />
reichem Lob bedachte Tätigkeit. Bald wurde er für den Dicht r in<br />
so unentbehrlicher Berater bei allem Schaffen, wie es in früh r r<br />
Zeit nur Schiller gewesen war. Er wußte als anregender Kritik<br />
Ergänzungen und Korrekturen zu "fordern", er verstand zu in j.<br />
rieren und zu "treiben". Der realen Auswirkung nach übertraf in<br />
Einfluß selbst den Schillers: kein geringeres Werk als der FAu r<br />
TRAGÖDIE ZWEITER TEIL ist dem unablässigen Drängen Eck rm nn<br />
zu verdanken. Auch in Goethes Naturwissenschaft war er im < uf<br />
der Jahre so eingedrungen, dass er für die Herausgabe des n turwissenschaftlichen<br />
Nachlasses vorgesehen wurde. Goeth 'Ti t .<br />
ment gibt dann die eindeutige Bestätigung, bis zu welch m f< _<br />
de Eckermann in die Stellung des nächsten Vertrauten gerü kt w, r.<br />
Ihm wurde die Veröffentlichung des gesamten literarisch n N hlasses<br />
übertragen, ihm der Schlüssel zu dem Kasten ausgehän t,<br />
in dem sich die Manuskripte zum 11. Teil des FAu T, zum .IV. iI<br />
3 7
ten."5 Diese Worte des siebzigjährigen Goethe können unserem<br />
Unternehmen in vieler Hinsicht als Leitsatz dienen. Mit ihnen<br />
wollte er die Schwierigkeiten veranschaulichen, die sich dem Erhellen<br />
chronologisch-entstehungsgeschichtlicher Verhältnisse bei<br />
seinen Werken entgegenstellen, und zugleich dartun, dass man solchen<br />
Schwierigkeiten nur begegnen könne durch gründliche umfassende<br />
Arbeit. 6 Von besonderem Interesse in unserem Zusammenhang<br />
ist, dass Goethe, indem er hier selbst auf die eigentümlich<br />
enge Verbindung seiner Werke mit ihrem entstehungsgeschichtlichen<br />
Hintergrund zu sprechen kommt, das eigene Schaffen ganz<br />
aus der Perspektive des Morphologen sieht. Wie die Gebilde der<br />
Pflanzenwelt, so deutet er an, verdanken seine schriftstellerischen<br />
Bemühungen ihr Dasein und Sos ein dem oft komplizierten Zusammenwirken<br />
bestimmter biologischer Bedingungen. Diesen Bedingungen,<br />
dem Lebensboden, auf dem seine Werke wurzelten und<br />
wuchsen, wird man daher sorgfältige Aufmerksamkeit zuwenden<br />
müssen. Ohne Kenntnis der jeweiligen Wachstumsvoraussetzungen<br />
bleibt die Pflanze als Gebilde rätselhaft; man kann sie <strong>nicht</strong> als<br />
fertige Form allein aus sich erklären. Nicht anders steht es mit Goethes<br />
Werken. Isoliert, als Einzelheiten betrachtet, erschließen sie sich<br />
nur ungenügend und teilhaft. <strong>Ihr</strong> Wurzeln und Wachsen gilt es zu<br />
erforschen, vor allem aber den Boden, der sie so und <strong>nicht</strong> anders<br />
hervorbrachte. Dem Einfluß des Bodens auf Wachstum und Gestalt<br />
der Pflanzen hatte Goethe schon frühzeitig Beachtung schenken<br />
gelernt, als seine ersten morphologischen Er<strong>kennt</strong>nisse in ihm<br />
zu reifen begannen. 7 Wenn er nun im Alter die entstehungsgeschichtlichen<br />
Voraussetzungen seiner Werke ganz nach der Weise<br />
des Morphologen als deren Lebensb 0 den ansieht, so charakterisiert<br />
das spezieller die Bedeutung, die er ihnen zuerkannte.<br />
5 S. SUMMARISC HE JAHRESFOLGE GOETHE'SCHER ScHRIFTEN (WA 142', 81).<br />
6 Goethe nahm die obigen Worte als Ausgangspunkt, um zu erklären, dass er eine<br />
umfangreiche 'autobiographische Schrift - die T AG- UND JAHR ES-HEFTE - dem Zweck<br />
widmen wolle, Licht in die Entstehungsverhältnisse seiner Arbeiten zu bringen.<br />
7 Vgl. denAbschnitt D ER VERFASSER THEILT DIE GESCHICHTE SEINER BOTANISCHEN STUDIEN MIT<br />
im dritten Druck der METAMORPHOSE DER PFLANZEN (WA II 6, 120 0.<br />
374<br />
Dem Philologen erwächst hieraus die Verpflichtung, sich Goethes<br />
morphologische Betrachtungsweise gleichfalls zu eigen zu machen.<br />
Er muß nach Möglichkeit das Werk wieder mit dem zu ihm<br />
gehörigen Lebensboden vereinigen. Notwendige Voraussetzung zur<br />
Erreichung dieses Ziels aber ist die Kenntnis des entstehungsgeschichtlichen<br />
Zeugnismaterials. Dieses Material repräsentiert jenen<br />
Lebensboden, wenn auch <strong>nicht</strong> ausschließlich, so doch in seinen<br />
wichtigsten Bestandteilen; es spiegelt ihn wieder, für uns <strong>nicht</strong><br />
anders als für Goethe: ihm hatte sich der oben angeführte morphologische<br />
Vergleich bezeichnenderweise aufgedrungen nach intensiver<br />
Betrachtung derartigen Materials.<br />
Jeder Versuch, Klarheit und Ordnung zu bringen in die entstehungsgeschichtlichen<br />
Verhältnisse - das was Goethe den schwer<br />
zu entwirrenden Knaul nannte - wird also mit der Sichtung des dokumentarischen<br />
Materials beginnen müssen. Dabei wird die Vereinigung<br />
<strong>von</strong> Werk und zugehÖrigem Lebensboden mehr eintragen als<br />
bloße historische Er<strong>kennt</strong>nis. Sie kann uns helfen, ein lebendiges<br />
Verhältnis wiederzugewinnen zu vielen Werken, die uns so fremd<br />
geworden sind, dass sie praktisch nur noch ein Schattendasein führen.<br />
Von den üblichen 36 oder 40 Bänden der Goetheausgaben in<br />
unseren Bücherschränken - wie viele pflegen unbenutzt zu bleiben,<br />
weil die darin enthaltenen Schriften keinen Aspekt darbieten,<br />
<strong>von</strong> deII) aus sie uns interessant erscheinen könnten. Da wir <strong>nicht</strong><br />
mehr wahrnehmen, was Goethe bewegte, als er sie schrieb, bewegen<br />
sie auch uns <strong>nicht</strong> mehr. Unverstandene Werke aber geraten in<br />
Vergessenheit. Bleiben wir in der Bildsprache <strong>von</strong> Goethes Vergleich,<br />
so ließe sich sagen: wie eine Pflanze ohne den rechten, ihr<br />
zuträglichen Boden <strong>nicht</strong> existenzfähig bleibt, so ist auch das echte<br />
Leben vieler Goethescher Werke in Gefahr zu verdorren, sofern sie<br />
getrennt bleiben <strong>von</strong> dem ihnen zugehörigen Boden, in dem sie wurzelten<br />
und wuchsen.<br />
Wenn die entstehungsgeschichtlichen Dokumente, wie wir sahen,<br />
besonders den wissenschaftlichen Zweig <strong>von</strong> Goethes Schaffen<br />
zu erhellen vermögen, so ist das <strong>von</strong> erheblicher Bedeutung, da<br />
gerade viele Schriften dieser Gattung zu den unverstandenen und<br />
vergessenen gehören. Es hat den Anschein, dass Goethe bei jen m<br />
75
nen Aufsatz Schillers für die Prophyläen mit der Wendung quittiert:<br />
"Meine Per 0 rat ion, die Sie mir zum Theil weggenommen<br />
haben ... "18 Auch dass Goethe kleinere Einschübe und Überleitungen<br />
innerhalb umfangreicher Schriften mit Vorliebe als<br />
"E i n red e" oder "Z w i s c h e n red e" bezeichnet l9 , weist darauf<br />
hin, dass er sich oft beim Schreiben in die Situation des Redners<br />
versetzt fand. Endlich ist als besonders wichtiges Zeugnis in<br />
diesem Zusammenhang auf das Schreiben an Riemer vom 20. Juni<br />
1813 hinzuweisen, das in breiter Ausführlichkeit erkennen läßt,<br />
welche Rolle r h e tor i s c h e Eie m e n t e bei der Abfassung<br />
<strong>von</strong> DICHTUNG UND WAHRHEIT spielten, wobei Ernesti' s Lehrbuch über<br />
antike Rhetorik zur Orientierung diente.2o<br />
Betrachtet man Goethes wissenschaftliche Arbeiten unter diesem<br />
Gesichtspunkt: dass sie auch Dokumentationen seiner Rednergabe<br />
sind, so wird es immer deutlicher, warum er in dem morphologischen<br />
Vergleich besonders auf den zu diesen Werken<br />
gehörigen Lebensboden hinweist. Für das Verständnis rhetorischer<br />
Äußerungen ist die Kenntnis entstehungsgeschichtlicher Bedingungen<br />
unentbehrlich. Auch eine Rede Ciceros ist <strong>nicht</strong> aus sich, <strong>nicht</strong><br />
als Einzelheit zu verstehen, sie kann nur im Zusammenhang mit<br />
den historischen Begleitumständen erklärt und gewürdigt werden.<br />
Dementsprechend kommt den Zeugnissen zur Entstehungsgeschichte<br />
<strong>nicht</strong> zuletzt die wichtige Funktion zu, den historischen<br />
Hintergrund sichtbar zu machen, auf dem Goethes Beredsamkeit<br />
sich manifestierte. Seine Redegabe, <strong>von</strong> der Goethe in DICHTUNG<br />
UND WAHRHEIT bedauernd sagt, er habe sie <strong>nicht</strong> praktisch zur Anwendung<br />
bringen können, weil "sich bei seiner Nation <strong>nicht</strong>s zu<br />
reden fand "21, - in seinen wissenschaftlichen Schriften machte er<br />
wenigstens mittelbar <strong>von</strong> ihr Gebrauch.<br />
***<br />
18 An Schiller 30. Sept 1800 (WA IV 15, 125).<br />
19 So im Historischen Teil der FARBENLEHRE, in der CAMPAGNE IN FRANKREICH und in den<br />
NarEN UND ABHANDLUNGEN ZU BESSEREM VERSTÄNDNIß DES WEST-ÖSTLICHEN DIVANS.<br />
20 s. EGW 2, 455 m. Anm. 1.<br />
21 DICHTUNG UND WAHRHEIT Buch 10, Schluß (WA 127,374).<br />
378<br />
Da in dieser Sammlung erstmalig die Entstehungsgeschichten <strong>von</strong><br />
Goethes wissenschaftlichen Arbeiten ans Licht treten, sei zusammenfassend<br />
auf einige typische Möglichkeiten der Wechselbeziehungen<br />
zwischen Werk und dokumentarischem Supplement hingewiesen<br />
mit Bezug auf Beispiele aus den ersten jetzt vorgelegten<br />
Bänden. Zunächst sind zwei Vorteile, die das dokumentarische Material<br />
bietet, als besonders wesentlich hervorzuheben:<br />
1. Es versetzt uns unmittelbar in den Zeitmoment, in dem eine<br />
Schrift entstand, Anlässe und Anregungen rücken ins historische<br />
Licht, was <strong>von</strong> besonderer Wichtigkeit ist angesichts der Tatsache,<br />
dass Goethes schriftstellerische Verlautbarungen fast immer Aktionen<br />
oder Reaktionen darstellen. Bei seinem poetischen Schaffen<br />
pflegen wir auf Anlässe und Anregungen achtzuhaben, da wir<br />
längst wissen, wie sehr Goethes Poesie 'G eie gen h e i t s d ich -<br />
tun g' ist. Aber die Gelegenheit spielt bei den Arbeiten des Gelehrten<br />
Goethe eine <strong>nicht</strong> minder wichtige Rolle. Sie bildet auch hier<br />
meist den Lebenspunkt, aus dem heraus der Organismus eines Werkes<br />
wächst. Dieses muß daher im Bereich jener Aktualität gesehen<br />
werden, in dem es entstand. Gerade das über die ersten Anlässe<br />
zu derlei Arbeiten Aufschluß gebende dokumentarische Material<br />
wurde mit besonderer Sorgfalt gesammelt, in vielen Fällen erstmalig<br />
vorgeführt. Im Hinblick auf die rhetorische Seite <strong>von</strong> Goethes<br />
wissenschaftlichem Schrifttum wird die Er<strong>kennt</strong>nis des geschichtlichen<br />
Augenblicks mit seinen Eingebungen und Einflüssen<br />
besonders wertvoll. Vom philologischen Gesichtspunkt endlich gesehen<br />
sind selbstverständlich alle aktuellen Verlautbarungen, die<br />
einen Goetheschen Text beeinflußten, <strong>von</strong> hervorragender Bedeutung;<br />
und hier bieten die Sekundärzeugnisse eine Fülle <strong>von</strong> Quellenmaterial,<br />
auch <strong>von</strong> bisher völlig unbekanntem.<br />
2. Das dokumentarische Supplement bringt ferner unmittelbar<br />
zur Anschauung die Beziehungen zu Menschen, die Goeth s<br />
wissenschaftliches Arbeiten durchweg mitbestimmen, ohne die<br />
<strong>nicht</strong> zu denken und zu verstehen ist. Es war schon da<strong>von</strong> di Rde,<br />
welche Bedeutung in dieser Hinsicht der Teilnahme befr undeter<br />
Gelehrter, aber auch Goethes eigener Teilnahme an d n Angelegenheiten<br />
anderer zukommt. Wa s die erstere betrifft ,<br />
7
eweisen viele einschlägige Artikel dieser Sammlung, wie sehr der<br />
endgültige Text eines Werkes durch Mitteilungen anderer bestimmt<br />
ist. Nicht nur auf die vorgetragenen Meinungen und Resultate, sondern<br />
auch auf das jeweilige rednerische Gewand wirkten sich solche<br />
- zustimmenden oder verneinenden - Mitteilungen aus. Sichtbar<br />
wird dabei aber auch ein anderer wesentlicher Umstand, über<br />
den man sich bisher kaum genügend Rechenschaft gab. Fast zu<br />
jeder Schrift gehört gleichsam ein bestimmtes menschliches Klima,<br />
das, einmal erkannt, <strong>von</strong> ihr <strong>nicht</strong> mehr wegzudenken ist. Welche<br />
Menschen überhaupt bei der Entstehung einer Schrift nahestanden,<br />
so das sie in Betracht und ins Vertrauen gezogen wurden, mitsprechen<br />
oder mitwirken durften: da<strong>von</strong> wird der gesamte innere<br />
und äußere Habitus eines Werks entscheidend mitbestimmt; es gilt<br />
das übrigens in begrenzterem Maß auch <strong>von</strong> dichterischen Arbeiten:<br />
soweit Goethe überhaupt während ihrer Entstehung Freunde<br />
ins Vertrauen zog, ist es <strong>von</strong> natürlicher Bedeutung, wer diese Freunde<br />
waren. - Die umfangreiche Gruppe derjenigen wissenschaftlichen<br />
Schriften, die durch Goethes Teilnahme an den Bestrebungen<br />
Dritter hervorgerufen wurden, umfaßt vor allem rezensionsartige<br />
Schriften. Das dokumentarische Material bringt an den Tag, was<br />
diese Arbeiten selbst <strong>nicht</strong> erkennen lassen: welchen Belastungen<br />
Goethe dadurch ausgesetzt war, dass ihm als dem einflußreichsten<br />
Kritiker der Zeit Bitten um öffentliche Fürsprache und Empfehlung<br />
im Übermaß zugingen. Erstaunlich ist es zu sehen, was Goethe<br />
es sich kosten ließ, solche Bitten zu erfüllen. Nicht zuletzt sind<br />
aber auch <strong>von</strong> Interesse die vielerlei Fälle, in denen er aus äußeren<br />
oder inneren Gründen <strong>nicht</strong> imstande war, den an ihn gestellten<br />
Forderungen so zu entsprechen, wie man es erwartete. So kam die<br />
Besprechung <strong>von</strong> Boisseree's Domwerk niemals zustande, um die,<br />
mit jahrelangem Werben, Boisseree ihn gebeten hatte. Goethe mußte<br />
andere Wege gehen, um auf seine Weise die Bemühungen des Freundes<br />
nach Kräften zu propagieren. 22 So unterblieb auch die erbetene<br />
Fortsetzung der Kritik <strong>von</strong> DES KNABEN WUNDERHORN 23 oder die der<br />
22 s. den Artikel ,,5. Boisseree:Ansichten, Risse ... des Doms zu Köln" (EGW 1, 351 ff.).<br />
23 s. den Artikel "Arnim und Brentano: Des Knaben Wunderhorn" (EGW 1, 146 ff.).<br />
380<br />
Gries' schen Calderonübersetzung: 24 in allen derartigen Fällen ist<br />
Goethes Reserve, wie sie das dokumentarische Material erkennen<br />
läßt, <strong>nicht</strong> weniger <strong>von</strong> Interesse, wie seine zunächst durch öffentliche<br />
Verlautbarungen bezeugte Hilfsbereitschaft. - Auf eine weitere<br />
Gruppe <strong>von</strong> Schriften sei in diesem Zusammenhang noch hingewiesen,<br />
weil die Entstehungszeugnisse besonders eindrücklich<br />
erkennen lassen, wie überragend Goethes Autorität auf wissenschaftlichem<br />
Gebiet war. Nicht selten wurde er <strong>von</strong> hervorragenden<br />
Fachgelehrten um Gutachten über spezielle Probleme ersucht.<br />
Liest man diese Gutachten isoliert, so bildet ihr Text eine verhältnismäßig<br />
spröde Lektüre. Erfährt man aber aus den Entstehungszeugnissen,<br />
wie berühmte Zeitgenossen ihnen den Wert einer<br />
wissenschaftlichen Weissagung beimaßen, so gewinnt auch diese<br />
Art <strong>von</strong> Schriften ein lebendiges Interesse innerhalb des weiten<br />
Bereichs der für Goethes Gelehrtentätigkeit so charakteristischen<br />
menschlichen Beziehungen.25<br />
Unter den im Vorstehenden angeführten Gesichtspunkten betrachtet,<br />
wird das dokumentarische Supplement zu den meisten<br />
wissenschaftlichen Arbeiten wertvolle Aufschlüsse geben. In gewissen<br />
Fällen kommen demselben darüber hinaus noch Funktionen<br />
besonderer Art zu. Auf einige der wichtigsten sei hier hingewiesen.<br />
Vielfach spricht das entstehungsgeschichtliche Zeugnismaterial<br />
eine allgemeinverständlichere Sprache als das betreffende Werk<br />
selbst. Diese Tatsache kommt unter Umständen dem Verständnis<br />
solcher Arbeiten besonders zugute, die sehr entschieden im Rahmen<br />
einer wissenschaftlichen Disziplin gehalten sind. Die ersten<br />
Bände dieser Sammlung bieten hierfür eindrucksvolle Beispiele,<br />
vor allem in den Artikeln zu den Aufsätzen: BEYTRÄGE ZUR OPTIK<br />
und DEM MENSCHEN WIE DEN THIEREN IST EIN ZWISCHEN KNOCHEN 0 R<br />
OBERN KINNLADE ZUZUSCHREIB EN. Beide Schriften, die Erstveröffentlichungen<br />
auf dem Gebiet der Farbenlehre und der Osteologie, ge-<br />
24 s. den Artikel "Calderon: Die Tochter der Luft" (ECW 2, 17 ff.) .<br />
25 s. die Artikel "Über Bildung <strong>von</strong> Edelsteinen" (EGW 1, 281 ff.); "Üb reine altd utsche<br />
Taufschale" (ECW 1, 28 ff.); " Das Deutsche Recht in Bildern" (EGW 2,322 H.).<br />
3 1
Goethe und Eckermann - Zum Gedächtnis Johann Peter Eckermanns. In: GOE<br />
THE. Neue Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft. Bd. 16. Weimar, 1954.<br />
S. XI-XIII.<br />
Zur Entstehung <strong>von</strong> Goethes Werken. - Einleitung (auszugsweise): Momme<br />
Momrnsen unter Mitwirkung <strong>von</strong> <strong>Katharina</strong> Momrnsen, DIE ENTSTEHUNG<br />
VON GOETHES WERKEN IN DOKUMENTEN. Bd. I. Berlin: Akademie Verlag, 1958.<br />
S. XIII - XXXIX.<br />
392<br />
Abälard (Abeillard, Abelard) Peter,<br />
Scholastiker und Theologe 0079-<br />
1142) 190-196,211.<br />
Historia calamitatum 192-195.<br />
Achilles (Achilleus), Hauptheld in<br />
Homers Ilias 96, 225.<br />
Aeschylos (Aeschylus, Äschylus,<br />
Aischylos)<br />
Agamemnon 183,344.<br />
Eumeniden 170.<br />
Albrecht, Joh. Georg, Rektor in Frankfurt<br />
324.<br />
Alkaios, attischer Komödiendichter<br />
mytholog. Travestien 157.<br />
Allemann, Beda 114,145,180.<br />
Anakreon, ionischer Lyriker 150.<br />
Äneas-Mythos 208.<br />
Angelloz,Jean-Fran\ois 387.<br />
Anna Amalia, Herzogin <strong>von</strong> Sachsen<br />
Weimar-Eisenach 311. ,<br />
Aphrodite 137,168.<br />
Apollo (Apollon) 127, 138, 174,246 (A.<br />
<strong>von</strong> Belvedere) 348.<br />
Apollodor (<strong>von</strong> Athen) 143.<br />
Aratos (aus Soloi in Kilikien) griech.<br />
Dichter.<br />
Scholien 211.<br />
Ariosto, Lodovico, itai. Dichter 0474-<br />
1533) 344.<br />
Aristides, P. Aelius 146,151,166,171<br />
Dionysos 146.<br />
Aristogeiton, griech. Jüngling, Freund<br />
des Harmodios, mit ihm beim gemeinsamen<br />
Tyrannenmord 514 v.<br />
Chr. getötet 96.<br />
Register<br />
Personen und Werke<br />
Aristophanes, Athener Komödiendichter<br />
des 4. Jhts. v. Chr.<br />
Nubes (Die Wolken) 170,213.<br />
Pax (Frieden; Scholien) 165.<br />
Ranae (Die Frösche) 165, 170,<br />
213.<br />
Vespae (Die Wespen) 159.<br />
Aristoteles 221,226,366.<br />
Nikomachische Ethik 226.<br />
Arnim, LudwigAchim <strong>von</strong> 380.<br />
Des Knaben Wunderhorn 380.<br />
Athenaios (aus Naukratis in Ägina,<br />
Anf. des 3. Jh. n. Chr. in Rom). Poikilograph;<br />
viele literar. Fragmente<br />
nur durch ihn überliefert 137,<br />
150f., 159.<br />
Augustus, röm. Kaiser (Julius Caesar<br />
Octavianus) 154.<br />
Bacchus s. Dionysos.<br />
Basedow, Johann Bernhard 338.<br />
Baudelaire, Charles 32.<br />
Baumgart, Hermann 344, 348.<br />
Bayern, König Ludwig I. <strong>von</strong> 308.<br />
Beaulieu-Marconnay, Henriette <strong>von</strong><br />
300.<br />
Beattie, James 219.<br />
Beck, Adolf 53f., 57f., 64.<br />
Behrisch, Ernst Wolfgang 335.<br />
Beißner, Friedrich 95,101,132,144,152,<br />
170,175,182,187.<br />
Berington, Joseph 191.<br />
Bernhard, Prinz <strong>von</strong> Weimar 383.<br />
Bertuch, Friedrich loh. }ustin 317.<br />
Beutler, Ernst 348.<br />
393
<strong>Bibel</strong> 1-8,11 (Menge-B.), 12, 14-16, 20,<br />
22f., 132f., 220, 278, 28lf., 324, 339.<br />
Altes Testament 1,5, 8f., 11, 13-16,<br />
339.<br />
Das Buch Esra 7.<br />
Das Buch Nehemia 7.<br />
Das Buch Ruth 7, 344.<br />
Das Buch Josua 6.<br />
Das Hohelied Salomonis 351.<br />
David. 7 (Mose) 344.<br />
Der Prophet Hesekiel 1,10-13.<br />
Der Prophet Hosea 6,10f.<br />
Der Prophet Jeremia 2f.,9-11 .<br />
Der Prophet Jesaia 9f.<br />
Der Prophet Micha 10.<br />
Der Prophet Sacharia 13.<br />
Könige 3, 8f., 13.<br />
Leviticus 132.<br />
Mose 5-7, 8f., 14f., 59, 132.<br />
Pentateuch 7, 132.<br />
Prediger Salomon 254.<br />
Propheten 59.<br />
Psalmen 6, 8,10,13 f., 344<br />
(David).<br />
NeuesTestament 10f., 166,224,281.<br />
Apostelgeschichte 10.<br />
Lukas 2.<br />
Matthäus 10.<br />
Johannes-Evangelium 193, 278.<br />
Paulus an die Korinther 6.<br />
Paulus an die Philipper 281.<br />
Binder, Wolfgang 162,206,219.<br />
Birus, Hendrik 344.<br />
Boehringer, Robert 21, 30.<br />
Böhlendorff, C. U 117.<br />
Böhm, Wilhelm 65,67,69,72,78,84,<br />
92,97,99,101,211.<br />
Böhme, Jakob 219.<br />
Boisseree, Sulpiz 235,349,377, 380.<br />
Kölner Domwerk 380.<br />
Tagebücher 235,349.<br />
Bollacher, Martin 222.<br />
Bollak, Jean 108.<br />
394<br />
Bonaparte, Napoleon 25,358.<br />
Borcherdt, Hans Heinrich 53,64.<br />
Bossi, Giuseppe 377.<br />
Böttiger, Karl August 345.<br />
Brasch, Hans 23.<br />
Bräuning-Oktavio, Hermann 370.<br />
Brentano, Bettina 293,311,334.<br />
Brentano, Clemens 293.<br />
Des Knaben Wunderhorn 380.<br />
Brentano, Maximiliane geb. Laroche<br />
294f.<br />
Brentano, Peter Anton (Kaufmann)<br />
293.<br />
Breysig, Kurt 3.<br />
Stefan George 3.<br />
Brion, Friederike 321,323,332 (Sesenheimer<br />
Kreis) 336.<br />
Brockes, Barthold Hinrich 223.<br />
Bruno, Giordano 219.<br />
Burdach, Konrad 348.<br />
Cäcilia s. Metella, Caecilia.<br />
Calderon de la Barca, Don Pedro 381.<br />
Die Tochter der Luft 381.<br />
CarlAugust, Herzog/Großherzog <strong>von</strong><br />
Sachsen-Weimar-Eisenach 260,<br />
274,359,377.<br />
Carlyle, Thomas 346.<br />
Cäsar (L. Julius Caesar, röm. Imperator)<br />
17.<br />
Catull (c. Valerius Catullus, bahnbrechend<br />
als röm. Elegiker) 146,170,<br />
174.<br />
Ceres-Mythos (Demeter) 213.<br />
Christus 130 f., 142, 147, 148 (c. u.<br />
Dionysos) 160 f., 162 ('Bruder' d.<br />
Herakles) 163,165-167,174,181-<br />
182f., 212-214, 275f., 278-282, 288,<br />
290,294,295,306.<br />
Cicero, M. Tullius Cicero, Meister der<br />
lat. Rede, (106-43 v. Chr.) 17, 156,<br />
377f.<br />
Epistulae ad familiares 17.<br />
De finibus 214.<br />
De natura deorum 154, 156.<br />
In Verrem 154.<br />
TuscuIanae disputationes 214.<br />
Colerus (Coler), Johannes 279.<br />
La vie de Spinoza 279.<br />
Conta, Carl Friedrich <strong>von</strong> 309.<br />
Cotta, Joh. Friedrich <strong>von</strong> 60,102,<br />
315.<br />
Dädalus-Mythos 70f.<br />
Dante, Alighieri 20,22, 24f., 240, 307.<br />
Comedia: Fegefeuer 21; Paradiso 22.<br />
Demeter-Mythos (Ceres) 213.<br />
Demokrit (Democritus) griech. Philosoph<br />
107.<br />
Dilthey, Wilhelm 370.<br />
Diodor (Diodorus Siculus), griech.<br />
Geschichtschreiber im 1. Jh. v Chr.<br />
118,137.<br />
Historische Bibliothek 118,120,137-<br />
139,143,152,165,208,209.<br />
Dion (<strong>von</strong> Syrakus), Jünger des Platon<br />
96.<br />
Dionysos (Bacchus) 108, 113, 117,<br />
121,135-184,137 (Bacchus-Oden),<br />
138f. (D.-Melpomenos, Musagetes),<br />
140 (Gleichsetzung des<br />
Dichters mit Bacchus), 142f. (Gott<br />
der Dichter, Thyoneus, Bacchus<br />
Ode des Horaz), 144, 147 (Doppelnatur),<br />
147 (Gott der Dichtung),<br />
147, 148 (Christus u. D.),<br />
149 (D.-Kult), 150 (Bacchus<br />
Lyaeus), 154 (Theodaisios, Beiname),<br />
155, 158 (Euhius, iocosus<br />
Liber, Lyaeus), 164 (Gott d. Dichter),<br />
165 (Liber pater, Eroberer u.<br />
Friedensgott, Horaz' Bacchus<br />
Ode), 167 (Christus u. D.), 167<br />
(Gesetzgeber), 173f., 175 (D. u.<br />
Herakles), 183 (D. u. Christus),<br />
200, 201, (Rousseau), 205, 209,<br />
212,213 (D.-Iakchos), 213, 214, 272,<br />
(Bacchus).<br />
Dioskuren (Kastor und Pollux) 87.<br />
Dschami (pers. Dichter Maulana Nur<br />
od-DinA'bdor-Rachman) 351.<br />
Medschnun und Leila 351.<br />
Dschingis-Khan, mongoI. Eroberer<br />
25.<br />
Düntzer, Heinrich 343,347.<br />
Dusch, Jos. Jakob 192.<br />
Eckermann, Johann Peter 25,236,281,<br />
287, 30lf., 313, 315f., 336f., 342,<br />
346,364-368,372,392.<br />
Bey träge zur Poesie mit besonderer<br />
Hinweisung auf Goethe 364 f.,<br />
368.<br />
Gespräche mit Goethe 366, 368.<br />
Eichstädt, Heinrich CarlAbraham 221,<br />
318.<br />
Eiselein, Joseph (Editor:)<br />
Winckelmanns sämtliche Werke IX,<br />
213.<br />
Empedokles (<strong>von</strong> Akragas) 57, 112 f.,<br />
118, 120f., 123, 129, 139, 155, 226,<br />
238,245,273.<br />
Enkelados-Mythos 208.<br />
Enweri (pers. Dichter Anwar) 25.<br />
Ernesti, Johann Christian Gottlieb 378.<br />
Eubulos, griech. Komödiendichter 159.<br />
Euripides, griech. Tragödiendichter<br />
(ca. 480-407 v. Chr.) 53, 90, 98-100,<br />
117f., 14lf., 146, 149f., 152 , 154,<br />
157-159,165,170,184,391.<br />
Bakchen. (Bacch.) 108, 117, 14lf.,<br />
144,146,149,152,157-159,165, 170,<br />
184,212-214.<br />
Cyclops 159.<br />
Hekabe (Hecuba) 90,98-100,146.<br />
Ion 149,170,213.<br />
Iphigenie in Aulis 150.<br />
Iphigenie auf Tauros 170.<br />
Orestes 96,100,118,227.<br />
395
Phoinissai (Phoeniss.) 170,213.<br />
Troades 149.<br />
Euryalos, trojan. Jüngling in der Begleitung<br />
des Aeneas, berühmt durch<br />
seine Schönheit und Freundschaft<br />
mit Nisus, mit dem er gemeinsam<br />
den Tod findet. (Vergil, Aeneis 9,<br />
177-445) 90,95-97.<br />
Fabius Maximus (Verrucosus), Quintus<br />
154.<br />
Fahlmer, Johanna 295.<br />
Falk, Joh. Daniel 236.<br />
Fichte, Johann Gottlieb 65,79,218,221,<br />
355.<br />
Fischer-Lamberg, Hanna 296.<br />
Flach, Willy 370.<br />
Fontane, Theodor 264.<br />
Franz, Viktor 370.<br />
Friedrich der Große, König <strong>von</strong> Preußen<br />
337.<br />
Fulbert, Kanonikus <strong>von</strong> Notredame<br />
194.<br />
Gaedertz, Karl Theodor 345.<br />
Gellert, Christian Fürchtegott 335.<br />
George, Stefan 1-5,7-9,11-15,20-31,<br />
33-52, 61, 112, 120, 133, 184, 216,<br />
39I.<br />
Blätter für die Kunst 36.<br />
Das Jahr der Seele 29.<br />
Das Neue Reich 1, 20, 37, 184.<br />
Der Krieg 1 f., 6, 11 f., 14, 16, 21-<br />
26, 184, 390.<br />
Der Letzte der Getreuen 20.<br />
Geheimes Deutschland 26,52.<br />
Der Siebente Ring 16, 25, 28-30,<br />
34,37,41,51 f.<br />
Aachen: Graboeffner 48.<br />
Bamberg 49.<br />
Bild: einer der 3 Könige 50.<br />
Brücke 29f., 35.<br />
Einzug 25,29.<br />
396<br />
Franken 29,34,216.<br />
Jahrhundertspruch 50.<br />
Ein Vierter: Schlacht 50.<br />
Ein Fünfter: Östliche Wirren 50.<br />
Rhein (Blüht am hange <strong>nicht</strong> die<br />
rebe?) 28,34.<br />
Rhein: I. Ein fürstlich paar geschwister<br />
hielt in frone 34 f.,<br />
4Of., 47f.<br />
Rhein: II. Einer steht auf und<br />
schlägt mit mächtiger gabel 34,<br />
4Of., 45f.<br />
Rhein: III. Dann fährt der wirbel<br />
aus den tiefsten höllen 34,35,<br />
40f.<br />
Rhein: IV. Nun fragt nur bei dem<br />
furchtbaren gereut 34-36,40 f.,<br />
43f.<br />
Rhein: V. Dies ist das land: solang<br />
die fluren strotzen 34,36,40 f.<br />
Rhein: VI. Sprecht <strong>von</strong> des Festes<br />
<strong>von</strong> des Reiches nähe 34, 36f.,<br />
40f.<br />
Tafeln 25,28,34-37,40 f., 44-46,<br />
48, 5lf., 39I.<br />
Traumdunkel 29.<br />
Ursprünge 1,29,31,35,37.<br />
Wogen brachen aus einer tosenden<br />
see 40.<br />
Zum Abschluss des Siebenten<br />
Rings 4O,5I.<br />
Ein Gleiches: Kehraus 4O,5I.<br />
Der Stern des Bundes 37,52,133.<br />
Von weIchen wundern lacht die<br />
morgen-erde 37 f.<br />
Vorabend war es unsrer bergesfeier<br />
38.<br />
Der Teppich des Lebens 30,33-35.<br />
Vorspiel 30,33.<br />
Hymnen 29.<br />
Aufschrift 29.<br />
Weihe 29.<br />
[Übersetzung:] Dante 20, 22.<br />
Goethe, Christiane <strong>von</strong>, geb. Vulpius<br />
(G's Frau) 265,288,311,341.<br />
Goethe, Cornelia (G's Schwester) 333.<br />
Goethe, Johann Kaspar (G's Vater) 335.<br />
Goethe, Johann Wolfgang(<strong>von</strong>) 16,20,<br />
25,27,32, 34,39,4O,41,45f., 52, 104,<br />
108f., 110, 120, 138, 174f., 197-199,<br />
215,217,219,221, 224f., 228f., 236,<br />
237,240,242 f., 245 f., 247, 251, 254-<br />
392.<br />
Achilleis 364, 390.<br />
Amtliche Schriften 37I.<br />
Aphorismus 110.<br />
Aristeia der Mutter 334.<br />
Bey träge zur Optik 38l.<br />
Biographische Einzelheiten 302.<br />
Boisseree, Ansichten und Risse des<br />
Doms zu Köln 380.<br />
Claudine <strong>von</strong> Villa Bella 109,244.<br />
Das Abendmahl <strong>von</strong> Leonard da Vinci<br />
377.<br />
Das Deutsche Recht in Bildern 38I.<br />
Dem Menschen wie den Thieren ist<br />
ein Zwischenknoehen der obern<br />
Kinnlade zuzuschreiben 381.<br />
Der Ewige Jude 278,340.<br />
Der Neue Paris 321,341.<br />
Der Verfasser theilt die Geschichte seiner<br />
botanischen Studien mit 374.<br />
Des Epimenides Erwachen 273.<br />
Dichtung und Wahrheit 57, 109,<br />
243, 254, 257, 260-268, 273, 276,<br />
278f., 280-285, 288f., 291-293, 295,<br />
297-304,307-342, 358, 369, 378f.,<br />
384.<br />
Die Geheimnisse 306.<br />
Die Leiden des jungen Werthers 255,<br />
263,289,291,293-295,297-299,304,<br />
312,318.<br />
Die Natürliche Tochter 20, 273.<br />
Die Neue Melusine 34l.<br />
Die Wahlverwandschaften 244,269,<br />
285,288,312,319.<br />
Epoche der forcierten Talente 266.<br />
Egmont 25,260-263,268,299,325.<br />
Farbenlehre 219,252,310,379,382.<br />
Faust 34,45,221,226,237,254,269<br />
(Prolog im Himmel) 269 (Vor dem<br />
Tor), 270, 284 (Klass. Walpurgisnacht)322,342,363,367,373,388.<br />
[Gedichte, einzelne:]<br />
Beherzigung 252.<br />
Dem Schicksal 260.<br />
Der Becher 344.<br />
Der Philosoph. (Epigramm) 222.<br />
Die Geheimnisse 305.<br />
Die Metamorphose der Pflanzen<br />
319,374.<br />
Einschränkung 260.<br />
Glückliche Fahrt 260.<br />
Mahomets Gesang 272.<br />
[Marienbaderl Elegie 333,359.<br />
Meeres Stille 260.<br />
Mut 260.<br />
Rechenschaft 317.<br />
Seefahrt 260.<br />
Urworte. Orphisch 263,266,27].<br />
Götz <strong>von</strong> Berlichingen 330.<br />
Hermann und Dorothea 273.<br />
Höllenfahrt Christi 324.<br />
Iphigenie 96,100,118,227, 244,268,<br />
273.<br />
Italienische Reise 314f.<br />
Jugend-Epoche 302-305.<br />
Kampagne in Frankreich 314f.<br />
Lila 25l.<br />
Mahomet (Voltaire-Übers.) 340.<br />
Maximen und Reflexionen 237, 24] .<br />
Paläophron und Neoterpe 175.<br />
Philipp Hackert (Biographie) 311 .<br />
Propyläen 244.<br />
Reise in die Schweiz 28l.<br />
Sanct Rochus-Fest zu Bingen 261,<br />
270.<br />
Shakespeare und kein Erlde 268.<br />
Studie nach Spinoza 230.<br />
7
400<br />
Bruchstück Nr. 68 132.<br />
Chiron 129,142,160,211.<br />
Das Ahnenbild 150.<br />
Dem Genius der Kühnheit 72f.<br />
Dem Schicksal 68,72,81, 155,259.<br />
Der blinde Sänger 211.<br />
Der Einzige 63, 146, 147, 151, 156,<br />
163, 167, 174, 182, 183, 211, 213,<br />
273.<br />
Der gefesselte Strom 211.<br />
Der Rhein 164,201,259,270 f., 273.<br />
Der Tod des Empedokles 57, 112 f.,<br />
119-121,123,129,139,155,226,238,<br />
245,273.<br />
Der Wanderer 185,197-199.<br />
Der Weingott 142,143,212.<br />
Dichterberuf 113,135,141.<br />
Dichtermuth 164.<br />
Die Eichbäume 53,76-79,82-90.,95,<br />
99,101-103,391.<br />
Die Friedensfeier 114,135,148-168,<br />
171-175,177,179-183,185,199-206,<br />
209, 211f., 238f., 391.<br />
Die Herbstfeier 15lf., 159, 161.<br />
Die Liebe 129.<br />
Die scheinheiligen Dichter 135.<br />
Die Weisheit des Traurers 185f., 189-<br />
191,194-196,210-213.<br />
Diotima 225.<br />
Emilie vor ihrem Brauttag 17.<br />
Ermunterung 129,180.<br />
Fragment: Seines jedem und ein Ende<br />
167.<br />
Ganymed 211.<br />
Germanien 113, 126, 129, 154, 164,<br />
215, 224.<br />
Hälfte des Lebens 126-129.<br />
Heimkunft 159 f.<br />
Hero 92.<br />
Hyperion oder der Eremit in Griechenland<br />
56 f., 60, 63-65, 69, 79, 82, 96,<br />
100,102-106,110,113,118,123,136,<br />
225f., 238, 245 f., 256, 273.<br />
Hyperions Jugend 63-65,69,74,76,<br />
79,82,100.<br />
Lied der Freundschaft 155.<br />
Meine Genesung 155.<br />
Ovid-Übersetzung (Heroiden Phaeton)<br />
71,90,92,95,98.<br />
Natur und Kunst 240.<br />
Neue Briefe über die ästhetische Erziehung<br />
des Menschen 102.<br />
Patmos 130f., 141, 164, 201, 211,<br />
273.<br />
Proemium 10lf.<br />
'Reimhymnen' 56, 67, 84f.<br />
Rousseau 129.<br />
Saturn und ]upiter 239.<br />
Stutgard 151.<br />
'Tübinger Hymnen' 112.<br />
Über den Unterschied der Dichtarten<br />
238.<br />
Versöhnender der du nimmer geglaubt<br />
141,161,174.<br />
Wie wenn am Feiertage 112-117,<br />
121 f., 124-127, 129, 141, 180.<br />
Hölderlin, Johanna Christiane (Mutter)<br />
89,196.<br />
Hölty, Ludwig Heinrich Christoph,<br />
Lyriker 197.<br />
An die Grille 197.<br />
Höpfner, Ludwig Julius Friedrich, Prof.<br />
der Jurisprudenz in Gießen 290.<br />
Homer (Homeros) 107, 153, 158,225,<br />
236,240,307.<br />
Höpfner, Ludwig Julius Friedrich 290.<br />
Horaz (Quintus Horatius Flaccus)<br />
röm. Dichter (65-8 v. Chr.) 1, 15-<br />
24,71,73,95, 107f., 137-139, 143,<br />
147,150, 156-158,165,172,203f.,<br />
206,208 f., 272, 391.<br />
Bacchus-Ode 137,143,165.<br />
Carmen saeculare 165.<br />
Carmina (Oden) 16,71,73,95,138 f.,<br />
147,150,156-158,172,203,208,272.<br />
Epistulae 138,156,165.<br />
Epoden 16-22.<br />
Ode I 3 An das Schiff des Vergil 203-<br />
206.<br />
Sermones 150.<br />
Hötzer, Ulrich 81.<br />
Houben, Heinrich Hubert 236,346.<br />
J.P. Eckermann. Sein Leben für Goethe<br />
346.<br />
Hufeland, Christoph Wilhelm 290.<br />
Humboldt, Wilhelm <strong>von</strong> 183,357.<br />
lkarus-Mythos 69,70,71.<br />
Iken, Car! Jakob Ludwig 128.<br />
Ion <strong>von</strong> Chios, Tragiker, Lyriker, Philosoph<br />
des 5. Jh. v. Chr. inAthen 151.<br />
Iphigenie (Iphigeneia) Priesterin der<br />
Artemis 183.<br />
Jacobi, Friedrich Heinrich 228f., 233,<br />
241,255,258, 260f., 290, 292, 338 f.,<br />
377.<br />
Wider Mendelssohns Beschuldigungen.<br />
Leipzig 1786. 228.<br />
Jean Paul (Richter, Johann Paul Friedrich)<br />
32.<br />
Jerusalem, Kar! Wilhelm 0747-1772)<br />
Jurist, 1771 braunschweigischer<br />
Legationssekretär bei der Kammergerichtsvisitation<br />
in Wetzlar 255,<br />
298.<br />
Jesus s. auch Christus 2,281.<br />
John, Joh. August Friedrich (Sekretär<br />
Goethes) 312.<br />
JuliusCaesarOctavianus (späterer Kaiser<br />
Augustus, geb 23 v. Chr.) 154.<br />
Jung-Stilling 263, 325f., 33lf.<br />
Jung-Stillings Wanderschaft 325f.,<br />
33lf.<br />
Juno Ludovisi 244.<br />
Jupiter-Mythos 75, 239.<br />
Kalb, Charlotte <strong>von</strong> 54,58,70.<br />
Kant,lmmanuel 218, 239, 249,253,255.<br />
Kar! Eugen, Herzog <strong>von</strong> Württemberg<br />
186, 189f., 194, 196, 274.<br />
Kastor (und Pollux) 87,96.<br />
Kayser, Wolfgang 352, 387.<br />
Kelietat,Alfred 162,206,209.<br />
Kerenyi, Kar! 149.<br />
Kestner, Johann Christian 291 f.<br />
Kestner, Char!otte, geb. Buff 291-294,<br />
336.<br />
Kleist, Ewald <strong>von</strong> 223.<br />
Kleist, Heinrich <strong>von</strong> 236.<br />
Michael Kohlhaas 235.<br />
Klinger, Friedrich Maximilian <strong>von</strong> 291,<br />
338.<br />
Geschichte eines Teutschen 338.<br />
Klingner, Friedrich 16.<br />
Klettenberg, Susanna <strong>Katharina</strong> <strong>von</strong><br />
339.<br />
Klopstock, Friedrich Gottlieb 110, 166,<br />
340,376.<br />
Messias 166.<br />
Kluckhohn, Paul 107.<br />
Knebel, Kar! Ludwig <strong>von</strong> 266,376.<br />
KommereII, Max 65.<br />
Korff, HermannAugust 217, 223.<br />
Geist der Goethezeit 217.<br />
Körner, Christian Gottfried 267.<br />
Krauss, Werner 107.<br />
Krieck, Ernst 219.<br />
Kronberger, Maximilan (Maximin) 33.<br />
Kuhn, Dorothea 370.<br />
Landauer, Gustav 151.<br />
Landmann, Edith 25.<br />
Gespräche mit Stefan George 25.<br />
Landmann Michael 385.<br />
Laroche (La Roche), Maximiliane (später<br />
Brentano) 293f.<br />
Laroche (La Roche), Sophie <strong>von</strong> 293 f.,<br />
333.<br />
Lavater 232,279 f., 290, 333, 335, 338 f.<br />
Jesus Messias 279.<br />
Lehmann, Emil 101.<br />
401
Leibniz, Gottfried Wilhelm 219,220,<br />
221.<br />
Lerse, Franz Christian 331.<br />
Lessing, Gotthold Ephraim 217 f., 220,<br />
238, 255f., 258 f.<br />
Nathan der Weise 255.<br />
Lili s. Schönemann.<br />
Linne, Kar! <strong>von</strong> 339.<br />
Loeper, Gustav <strong>von</strong> 343 f., 345, 347.<br />
Lucan, M.Annaeus, Röm. Epiker 165.<br />
Pharsalia 165,170.<br />
Ludwigsritter, Der (Freiherr <strong>von</strong> Cronhjelm?),<br />
Goethes Tischgenosse in<br />
Straßburg 331.<br />
Lukian (Lukianos aus Samosata), Sophist<br />
und Satiriker 118.<br />
De sacr. 118.<br />
De Syria dea 214.<br />
Luther, Martin 281,371.<br />
Lygdamus (Verf. eines im Corpus Tibullianum<br />
überlieferten Zyklus<br />
<strong>von</strong> 6 Elegien) 150.<br />
Mallarme, Stephane 33.<br />
Martial (M. Valerius Martialis) bedeutendster<br />
röm. Epigrammatiker 344.<br />
Epigramme 344.<br />
Xenia (Cygni-Distichon) 345.<br />
Matthaei, Rupprecht 370.<br />
Maximin s. Kronberger.<br />
Meinecke, Friedrich 307.<br />
Merck, Johann Heinrich 293.<br />
Metella, Caecilia (Frau des röm. Diktators<br />
Sulla) 188,190,213.<br />
Meyer, Heinrich 386.<br />
Meyer, Herman 197, 387.<br />
Meyer, Johann Heinrich (Maler und<br />
Kunsthistoriker, Freund Goethes)<br />
280f., 377.<br />
Meyer (<strong>von</strong> Lindau), Johann, (Medizinstudent,<br />
Goethes Tischgenosse<br />
in Straßburg) 331.<br />
Minor, Jakob 225.<br />
402<br />
Möbus, Gerhard 275.<br />
Morgenroth, Alfred 359 f.<br />
Morwitz, Ernst 2.<br />
'An den Mond' (Der Fluch) 190.<br />
Müller,Adam 236.<br />
Müller, Ernst 65.<br />
Müller, Friedrich Theodor Adam Heinrich<br />
<strong>von</strong> (Kanzler) 275.<br />
Müller, Joachim 389.<br />
Müller, Johannes <strong>von</strong> 311.<br />
Napoleon Bonaparte 25,358.<br />
N ast, Louise 196.<br />
Neuffer, Christian Ludwig 62,87,97,<br />
98,153,247,261.<br />
Newton, Isaac 252.<br />
Nibelungenlied 236.<br />
Nicolovius,Alfred 346.<br />
Niethammer, Emil 102.<br />
Nietzsehe, Friedrich 32,63,87, 219f.,<br />
250.<br />
Die fröhliche Wissenschaft 220.<br />
Nisus s. Euryalos 90, 96f.<br />
Nonnos (<strong>von</strong> Panopolis) 139, 166.<br />
Dionysiaka 166.<br />
Nostradamus (Michel de Notredame)<br />
34-36,40-52.<br />
Centuries 34, 40-52.<br />
Proömium 47.<br />
Novalis (Friedrich Philipp Frhr. <strong>von</strong><br />
Hardenberg) 107,241.<br />
Heinrich <strong>von</strong> Ofterdingen 107.<br />
Schriften 241.<br />
Octavian (Kaiser Augustus) 17.<br />
O'Donell, Josephine Gräfin 340.<br />
Odysseus 93,208.<br />
Oeser, Adam Friedrich 333,335.<br />
Ohly, Friedrich 301.<br />
Oppenheimer, Ernst Martin 391.<br />
Orestes, Sohn <strong>von</strong> Agamemnon u.<br />
Klytaimnestra, Freund des Pylades<br />
(s. d.) 96,100,118,227.<br />
Ovid (P. Ovidius Naso), geb. 43 v. Chr.,<br />
röm. Dichter 53, 69, 70, 71, 75,<br />
90, 91, 92, 95 (Hölderlins Übersetzung),<br />
98, 118, 139, 150, 173,<br />
391.<br />
Amores 118, 138f., 207.<br />
Ars amatoria 139,158,174.<br />
Heroiden 90-95.<br />
Dejanira an Herkules 91 f., 95.<br />
Ex Ponto 139.<br />
Fasti 139, 150, 159, 211, 226.<br />
Metamorphosen 69 f. (Dädalus), 139,<br />
147,150,173,208.<br />
Phaeton 98.<br />
Tristia 138 f.<br />
Panyassis (<strong>von</strong> Halikarnassos). Epischer<br />
Dichter des frühen 5. Jh. v.<br />
Chr. 150.<br />
Patroklos, des Achilleus Freund 96.<br />
Paulus,August Wilhelm 343f., 349.<br />
Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob<br />
230,343 f., 346, 349, 352.<br />
Benedicti de Spinoza Opera 230.<br />
Paulus, Karoline 350.<br />
Pausanias, griech. Reiseschriftsteller<br />
des 2. Jhdts 138,154, 170,213.<br />
Pelletier, Anatole le (Editor des Nostradamus)<br />
4O,43f., 46, 49.<br />
Pelops-Mythos 118.<br />
Persephone-Mythos 213.<br />
Petsch, Robert 270,348.<br />
Petrus Venerabilis (1094-1156) Abt u.<br />
Klosterreformator der Cluniacenser<br />
193.<br />
Petzold, Emil 142,212.<br />
Phaethon-Mythos 70,98, 106.<br />
Philochoros (Athener Seher, Gelehrter)<br />
Hauptwerk Atthis 137.<br />
Philonides (Dichter der Alten Komödie)<br />
137.<br />
Philoxenos (Dithyrambiker aus Kythera)<br />
150.<br />
Pindar (Pindaros) griech. Lyriker (522-<br />
448 v. Chr.) 107, 118, 146, 158,225<br />
(Diagoras),272.<br />
Olympische Oden 118.<br />
Pythische Oden (Hypoth.) 146.<br />
Platen, Hallermund, August Graf <strong>von</strong><br />
17,19,21.<br />
Polenlieder 17,19,21.<br />
Platon (Plato) griech. Philosoph (427-<br />
347 v. Chr.) 94, 96, 107f., 110, 150,<br />
365.<br />
Ion 107f.<br />
Phaedon 344.<br />
Phaidros 107f.<br />
Symposion 150.<br />
Plessing, Friedrich Victor Leberecht<br />
243.<br />
Plinius (c. Plinius Secundus), Historiker,<br />
Schriftsteller (23-79 n. Chr.)<br />
154,207.<br />
Plotin, platonischer Philosoph (ca. 205-<br />
270) 219.<br />
Plutarch (Plutarchos <strong>von</strong> Chaironeia,<br />
ca. 45-120), berühmter Biograph<br />
und popularphilosoph. Schriftsteller<br />
152, 166, 188f., 190, 211,<br />
213.<br />
Vitae (Biographie des Sulla) 188f.<br />
Pollmer, Arthur 286.<br />
Pollux s. Dioskuren 87.<br />
Pope, Alexander, eng!. Dichter (1688-<br />
1744) 192.<br />
Eloisa to Abelard 192.<br />
Praxiteles, griech. Bildhauer des 4. Jhdts.<br />
v. Chr 213.<br />
Priamos, der letzte König <strong>von</strong> Troja<br />
99.<br />
Prometheus, 109, 120, 203, 205, 207,<br />
208,259,340.<br />
Properz (Sextus Propertius) röm. cl 'g.<br />
Dichter 138,153, 159,207,229,250-<br />
254,258,264, 272.<br />
Pseudo-Anakreon 150.<br />
403
Pylades, Freund des Orestes 96,<br />
227.<br />
Pythagoras (aus Samos, 6. Jh.) Begründer<br />
einer religiös fundierten Lebensgemeinschaft<br />
146,193.<br />
Raabe, Paul 53.<br />
Reinhard, Carl Friedrich Graf <strong>von</strong><br />
363.<br />
Richter, Karl 344.<br />
Richter, Rudolf 348.<br />
Riemer, Friedrich Wilhelm 242, 286,<br />
289,312,338,378.<br />
Mitteilungen über Goethe 286.<br />
Ritter, Heinz 107.<br />
Rochlitz, Johann Friedrich 321,355.<br />
Rousseau, Jean-Jacques 123,129,164,<br />
200 f., 223, 271, 314, 317, 334.<br />
Confessions 311, 316f., 322.<br />
Sachsen-Weimar-Eisenach, Carl August<br />
Herzog/Großherzog <strong>von</strong> 260,<br />
274,359,377.<br />
Salin, Edgar 108.<br />
Salomon 350.<br />
Hohes Lied 350.<br />
Salzmann, Johann Daniel 331.<br />
Samuel, Richard 107.<br />
Sandvoß, Franz 345,347.<br />
Sappho (DichterinaufLesbos, 7./6.Jh.<br />
v. Chr.) 107.<br />
Saturn-Mythos 239f.<br />
Schadewaldt, Wolfgang 117,370 f.<br />
Goethe-Wörterbuch 370.<br />
Scheffer, Thassilo <strong>von</strong> 71.<br />
Schelling, Friedrich Wilhelm Josef <strong>von</strong><br />
217, 220f., 274, 313.<br />
Das Wesen der menschlichen Freiheit<br />
221.<br />
Philosophische Briefe über Dogmatismus<br />
und Kritizismus 238.<br />
Vom Ich als Prinzip der Philosophie<br />
238.<br />
404<br />
Schiller, Christophine (Schwester) 274.<br />
Schiller, Friedrich (<strong>von</strong>) 32,53-106,112,<br />
137,138,197,207,217,223,226,238,<br />
244,249,253,257,264,266-269,274,<br />
291,309,358, 360f., 367, 372, 377f.,<br />
391.<br />
An die Freude 67, 137.<br />
Anthologie auf das Jahr 1782 (Spinoza)<br />
220.<br />
Briefe über die ästhetische Erziehung<br />
des Menschen 53,244. .<br />
Das Reich der Schatten 72 f., 81, 92,<br />
102.<br />
Das verschleierte Bild zu Sais 103-<br />
106.<br />
Der philosophische Egoist 79-83,85 f.,<br />
102.<br />
Der Spaziergang 78, 84, 102.<br />
Die Götter Griechenlands 85, 223.<br />
Die Horen 78f., 101, 103.<br />
Die Ideale 70, 102.<br />
Die Künstler 85,207.<br />
Don Carlos 227.<br />
Einem jungen Freund, als er sich der<br />
Weltweissheit widmete 105f.<br />
Elegie (Der Spaziergang) 78,84,102.<br />
Epigramm 73.<br />
Musenalmanach 69.<br />
Spinoza 220.<br />
Thalia 72,81,82,103-105.<br />
Über Anmut und Würde 226,257.<br />
Wallenstein-Trilogie 249,267.<br />
Zeus zu Herkules 73,75,102.<br />
Schlegel, August Wilhelm 266,357 f.<br />
Athenäum 239,248.<br />
Schlegel, Friedrich 217, 235, 238-241,<br />
248,266,358.<br />
Athenäum 239,247.<br />
Gespräch über die Poesie 239.<br />
Prosaische Jugendschriften 225.<br />
Rede über die Mythologie 239.<br />
Über das Studium der Griechischen<br />
Poesie 225.<br />
Schleiermacher, Ernst Christian FriedrichAdam<br />
221.<br />
Schlosser, Cornelia Friedrike Christiane,<br />
geb. Goethe 333.<br />
Schlosser, Johann Friedrich Heinrich<br />
311.<br />
Schmid, Günther 370.<br />
Schmidt, Erich 221.<br />
Schönemann, Lili (später <strong>von</strong> Türekheim)<br />
259,273,300,317,323,326,<br />
336.<br />
Schönkopf, Käthchen 336,340.<br />
Schopenhauer, Arthur 221.<br />
Schulz, Gerhard 107.<br />
Seebaß, Friedrich 101.<br />
Sembdner, Helmut 236.<br />
Semele-Mythos 117,129,140-143,180,<br />
202.<br />
Shaftesbury, Anthony Ashley-Cooper<br />
219.<br />
Shakespeare,William 268,307,339.<br />
Hamlet 355.<br />
Siegmund Schultze, Friedrich 186.<br />
Silius Halicus (TIb. Catius Asconius S.<br />
1.), röm. Epiker (ca. 35-100).<br />
Punica 154,159,170.<br />
Sophokles, griech. Tragiker (497-405 v.<br />
Chr.) 94f., 100, 138, 158, 165, 170f.,<br />
212f.<br />
Antigone 138, 158, 165, 170, 171,<br />
212,267.<br />
Elektra 100.<br />
Oedipus Rex 213.<br />
Trachinierinnen 94 f.<br />
Sokrates (470-399 v. Chr.) 361.<br />
Soret, Frederic Jean (Jacques) 360.<br />
Spinoza, Baruch 57, 109, 217-288,<br />
294, 298, 302-306, 313, 325, 339,<br />
391.<br />
Ethik 219,221-265,274,282,298,<br />
302, 304-306.<br />
Städel, Rosine 346.<br />
Staiger, Emil 94, 322.<br />
Statius, P. Papinius, röm. Dichter (ca.<br />
40-96).<br />
Silvae 207.<br />
Thebais 208.<br />
Stein, Charlotte <strong>von</strong> 230 f., 29lf., 354.<br />
Stern, Julius (Ps. für Sturm, Julius) 249.<br />
Stilling, Johann Heinrich (genannt<br />
Jung-Stilling) 26lf., 325f., 333.<br />
Stillings Wanderschaft 33lf.<br />
Strabo (Strabon <strong>von</strong> Amaseia) Stoischer<br />
Historiker und Geograph<br />
208,214.<br />
Sueton (S. Suetonius Tranquillus) Röm.<br />
Biograph (1. Jh. n. Chr.) 154.<br />
De vita Caesarum 214.<br />
Suidas (Suda), Titel d. umfangreichsten<br />
erhaltenen byzantinischen Lexikons<br />
170.<br />
Sulla, Ludus Cornelius, röm. Diktator<br />
(137-78 v. Chr.) 188f., 213.<br />
Swedenborg, Emanuel, schwedischer<br />
Theosoph (1688-1772) 342.<br />
Szondi, Peter 114,125.<br />
Tadtus, P. Cornelius, röm. Geschichtsschreiber<br />
311.<br />
Tantalos-Mythos 117f., 120, 122, 129.<br />
Tausend und eine Nacht 320f.<br />
Theseus-Mythos 208.<br />
Tibull (Albius TIbullus, geb. ca. 50 v.<br />
Chr.) Röm. Elegiendichter 138, 150,<br />
159,173,197-199.<br />
Elegien 198.<br />
Lygdamus 138.<br />
Panegyricus Messallae 198 f.<br />
Tieck, Johann Ludwig 236.<br />
Trebra, Friedrich Wilh. Heinrich <strong>von</strong><br />
321,349.<br />
Troll, Wilhelm 370.<br />
Trunz, Erich 333,388.<br />
Türckheim,Anna Elisabeth (Lili), geb.<br />
Schönemann 259, 273, 300, 317,<br />
323,326,336.<br />
405