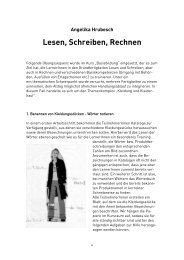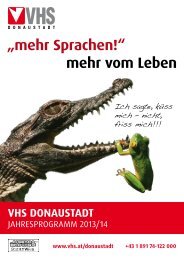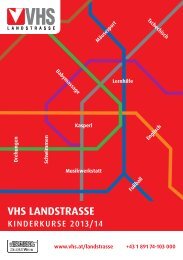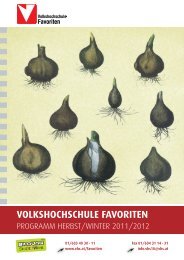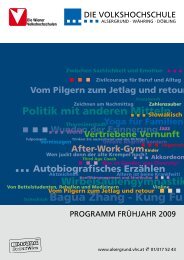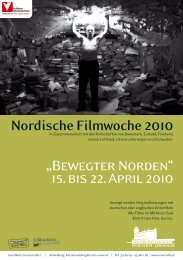WISSENSCHAFTLICHE NACHWUCHSFÖRDERUNG
WISSENSCHAFTLICHE NACHWUCHSFÖRDERUNG
WISSENSCHAFTLICHE NACHWUCHSFÖRDERUNG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Masterlehrgang<br />
Internationale Genderforschung<br />
& Feministische Politik<br />
Rosa-Mayreder-College Wien<br />
Jänner 2007 – Dezember 2008<br />
<strong>WISSENSCHAFTLICHE</strong> <strong>NACHWUCHSFÖRDERUNG</strong><br />
STRUKTURVERÄNDERNDE POTENZIALE VON MENTORING AN DER UNIVERSITÄT<br />
Erstbegutachtung: Dr. in Claudia Neusüss<br />
Zweitbegutachtung: Dr. in Ursula Kubes-Hofmann<br />
Marietta Bauernberger
Ich widme diese Arbeit<br />
meiner Mutter, die mich zu diesem Studium ermutigt und unterstützt hat und selbst nur die Möglichkeit<br />
hatte, am Leben zu lernen<br />
meinem Vater, der die Worte verloren hat und trotzdem noch lächelt<br />
meinem Sohn, in der Hoffnung, dass er seinen zukünftigen Lebensmenschen ein gleichberechtigter<br />
Partner ist<br />
meinem Lebensgefährten, der mich genug provoziert<br />
meiner Chefin, Dr. Daniela Werndl, die mir Zeit gegeben hat<br />
2
Vorwort<br />
Als Akteurin der Gleichstellungsarbeit und Frauenförderung an der Universität wird<br />
man unweigerlich mit einem frustrierenden Tatbestand konfrontiert. Dem beinahe<br />
statischen, seit Jahrzehnten kaum veränderlichen Anteil an weiblichen<br />
Wissenschafterinnen in Führungspositionen in den oberen Hierarchieebenen der<br />
Universität.<br />
Da gibt es mittlerweile gesetzliche Maßnahmen und Mittel, immer wieder neue Ideen<br />
und Anreizsysteme zur Erhöhung des weiblichen wissenschaftlichen Anteils bzw. die<br />
Erhöhung der Leitungsfunktionen im Verwaltungsbereich, ein mission statement der<br />
Universität zur Gleichbehandlung und Geschlechtergerechtigkeit in der Satzung und<br />
doch wird man das Gefühl nicht los, als Akteurin dieser institutionalisierten<br />
Einrichtungen zur Gleichstellungsarbeit, auf der Stelle zu treten. Dabei ist die<br />
Entwicklung der Zahlen der weiblichen Studierenden und Absolventinnen mittlerweile<br />
durchaus erfreulich und auch auf der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnenebene<br />
findet ein Aufholprozess statt.<br />
Die auf den ersten Blick unsichtbaren Hürden sind dennoch vorhanden, ein zweiter<br />
Blick daher unbedingt notwendig. Befristete Verträge für die wissenschaftlichen<br />
MitarbeiterInnen, entziehen sie wieder der Universität und die gläserne Decke auf der<br />
oberen hierarchischen Ebene ist stabil wie eh und je. Zudem sind die Universitäten<br />
durch ihre Autonomie in eine neue Wettbewerbssituation getreten, die auch intern<br />
Wettbewerb, Konkurrenz und Verteilungskampf um finanzielle Mittel steigen lassen.<br />
Keine Voraussetzungen, die die Steigerung des weiblichen wissenschaftlichen<br />
Anteils bzw. Frauenförderung auf die Agenda der Universitätsleitung nach oben<br />
befördert. Trotzdem, es hilft nicht, den Status quo zu bedauern.<br />
Strukturveränderungen einhergehend mit einer notwendigen Kulturveränderung sind<br />
langfristige Ziele. Die Potenziale und Ansatzpunkte dafür zu finden, ein wichtiger<br />
Aspekt in der Gleichstellungs- und Frauenförderungsarbeit.<br />
Frauenförderungsmaßnahmen zur Erhöhung der Chancengleichheit sind notwendige<br />
Errungenschaften, die durch MultiplikatorInnen ihre Wirkung tun werden. Der<br />
Entwicklung effizienter Maßnahmen, die mit Unterstützung der Universitätsleitung<br />
langfristig konzipiert werden können, gilt es, das Hauptaugenmerk als AkteurIn der<br />
Gleichstellungsarbeit zu legen.<br />
3
Inhalt<br />
Vorwort 3<br />
Inhaltsverzeichnis 4<br />
Abstract 7<br />
1. Einleitung 8<br />
1.2 Thema und zentrale Fragestellungen 8<br />
1.3 Methodischer Hintergrund 11<br />
1.4 Aufbau der Arbeit 12<br />
2. Organisationen – Strukturen und Dynamiken 13<br />
2.1 Organisationskultur 14<br />
2.2 Organisation und Geschlecht 15<br />
2.3 Die Universität als besondere Organisation 19<br />
2.4 Die Universität als ExpertInnenorganisation 19<br />
2.5 Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe einer Organisation 21<br />
3. Männlichkeit als System –<br />
Die Universität als hegemonial männliches System 24<br />
3.1 Wissenschaftskultur 30<br />
3.2 Wissenschaft als soziales Feld 32<br />
3.3 Die Vereinbarkeitsproblematik 37<br />
3.4 Die Öffnung der Universität für Frauen – ein Überblick 40<br />
3.4.1 Wichtige Reformschritte auf dem Weg zur Gleichbehandlung 42<br />
3.4.2 Das Prinzip Gender Mainstreaming 46<br />
3.4.3 Diversity – Das Prinzip der Vielfalt 48<br />
4. Gleichstellungsarbeit und Geschlechterverhältnis an der Universität 50<br />
4.1 Gesetzlichen Gleichstellung und reale Situation an der Universität 50<br />
4.2 Das Geschlechterverhältnis an der Universität Salzburg 54<br />
4.3 Die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses an der Universität Salzburg 55<br />
4.1.1 Gleichstellungsarbeit, Frauenförderung und<br />
Geschlechtergerechtigkeit 63<br />
4
4.1.2 Gender Mainstreaming 64<br />
4.1.3 Frauenförderung 66<br />
5. Gleichstellungsarbeit – Gleichheit, Differenz, Dekonstruktion? 71<br />
5.1 Die Dilemmata in der Gleichstellungsarbeit 73<br />
5.1.1 Das Differenzdilemma 73<br />
5.1.2 Das Gleichheitsdilemma 74<br />
5.1.3 Das Dekonstruktionsdilemma 75<br />
5.1.4 Gleichheit oder Differenz? 76<br />
6. Wissenschaftliche Nachwuchsförderung durch Mentoring 80<br />
6.1 Mentoring – ein widersprüchliches Konzept 80<br />
6.1.1 Begrifflichkeit von Mentoring 80<br />
6.1.2 Formen von Mentoring 81<br />
6.2 Mentoring-Projekte –<br />
mu:v der Universität Wien<br />
Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung 90<br />
6.2.1 Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung –<br />
Mentoring an der Universität Salzburg 91<br />
6.2.2 Mentoring-Projekt mu:v der Universität Wien 94<br />
6.3 Struktur- und Kulturveränderung durch Mentoring an den Universitäten 96<br />
6.3.1 Mögliche Potenziale zur Strukturveränderung an den<br />
Universitäten 102<br />
6.3.1.1 Das Potenzial der Implementation 102<br />
6.3.1.2 Das Potenzial der Finanzierung 104<br />
6.3.1.3 Das Potenzial der Vernetzung 105<br />
6.3.1.4 Das Potenzial der MultiplikatorInnen 107<br />
6.3.1.5 Das Potenzial durch Integration abseits Frauenförderungsund<br />
Gleichstellungseinrichtungen 108<br />
6.3.1.6 Das Potenzial der AkteurInnen 108<br />
6.3.1.7 Das Potenzial der Reflexion 109<br />
6.3.1.8 Das Potenzial der Verantwortung 110<br />
6.3.1.9 Das Potenzial der Anerkennung 111<br />
6.3.1.10 Das Potenzial der Sensibilisierung 111<br />
5
7. Methodik 113<br />
7.1 Qualitative Forschung 113<br />
7.1.2 Qualitative Interviews 115<br />
7.1.3 Das narrative Interview 115<br />
7.1.4 Das Leitfaden-Interview 116<br />
7.1.5 Das Leitfaden-Interview mit narrativem Charakter 116<br />
7.1.6 Interpretation der Interviews 117<br />
8. Resümée 118<br />
9. Literaturverzeichnis 124<br />
Anhang 131<br />
Interviewleitfaden 132<br />
Interviews 134<br />
Abbildungsverzeichnis 151<br />
6
Abstract<br />
Die vorliegende Arbeit untersucht Veränderungspotenziale des Förderkonzeptes<br />
Mentoring in Hinblick auf strukturelle Veränderung der Organisation Universität.<br />
Diese ist trotz Gleichstellungsarbeit geprägt durch konstante<br />
Ausschlussmechanismen von weiblichen Wissenschafts- und Führungspersonal auf<br />
den oberen hierarchischen Ebenen.<br />
Mentoring ist ein Instrument der wissenschaftlichen Nachwuchs- und<br />
Frauenförderung, das in den letzten Jahren an den österreichischen Universitäten<br />
populär geworden ist.<br />
Geschlechtshierarchisch geprägte Strukturen müssen überwunden werden. Ebenso<br />
bedarf es aber auch der Änderung der geschlechtshierarchisch geprägten<br />
Organisationskultur, um langfristige Veränderungen in Richtung<br />
Geschlechtergerechtigkeit erreichen zu können.<br />
Die vorliegende Arbeit macht deutlich, dass Mentoring, um strukturell wirksam zu<br />
werden, immer nur ein Teil eines komplexen Förderkonzeptes sein kann. Generell<br />
müssen Förderkonzepte auf verschiedenen hierarchischen Ebenen als auch bei<br />
unterschiedlichen Zielgruppen ansetzen. Bei der Konzeption von<br />
Förderungsmaßnahmen sollte in Zukunft neben der Geschlechterperspektive auch<br />
die Vielfalt von sozialen, biographischen und kulturellen Hintergründen der möglichen<br />
Zielgruppen mitgedacht werden, um für Ausschlussmechanismen in ihrer Komplexität<br />
und Verschränkung sensibilisiert zu sein und Ansatzpunkte zu ihrer Überwindung zu<br />
finden.<br />
Um möglichst nachhaltige Effekte zu erzielen, ist es daher notwendig, dass<br />
Fördermaßnahmen in ein umfassendes Gesamtförderkonzept eingebettet werden<br />
und dieses Konzept nach Zielen und Zielgruppen „maßgeschneidert“ ist.<br />
Transparenz, Sensibilisierung und Sichtbarmachen der informellen Abläufe und<br />
Handlungsmuster im Zusammenspiel mit formellen strukturellen und rechtlichen<br />
Voraussetzungen ist Grundlage für die Entfaltung der Potenziale.<br />
Erst so werden die Veränderungspotenziale in Richtung geschlechtergerechte und<br />
sozial gerechte Universität adäquat aktiviert werden.<br />
7
1. Einleitung<br />
1.2. Thema und zentrale Fragestellungen<br />
Die österreichischen Universitäten befinden sich seit Entlassung in die Autonomie in<br />
einer Phase der Reform und Transformation, des Umbaus und der strukturellen<br />
Renovierung der Organisation.<br />
Auf dem Weg in die Selbstbestimmung gibt es zahlreiche Veränderungen und<br />
Neuheiten in Struktur und Organisation. Diese zu bewältigen ist für alle Beschäftigten<br />
der Universitäten eine ständige Herausforderung. Gleichzeitig muss die Universität<br />
nach außen hin konkurrenzfähig sein. Noch nie gab es so viele Angebote an<br />
Universitäten und Fachhochschulen.<br />
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung mit Ziel der Wettbewerbsfähigkeit und<br />
des Bestehen Könnens, im Spannungsfeld der Bildung und Ausbildung und neuer<br />
Konkurrenz auf dem (Hochschul-)Markt muss erst gelernt und bewiesen werden.<br />
Eine Tatsache scheint sich allerdings nicht oder nur wenig zu verändern. Die Zahl<br />
weiblicher Wissenschafterinnen an den oberen Hierarchieebenen verändert sich<br />
kaum. Darüber können auch einzelne Spitzenleistungen von Forscherinnen nicht<br />
hinwegtäuschen. Und das, trotz der ständigen Präsenz von Begriffen wie<br />
Gleichstellung, Frauenförderung und Gender Mainstreaming als feste Bestandteile<br />
des Diskurses um die „neue“ Universität.<br />
Ist Universität als Organisation ein „männliches System“, dass sich ständig<br />
reproduziert?<br />
Können institutionalisierte Einrichtungen zur Gleichstellung und Frauenförderung an<br />
den Universitäten, Maßnahmen und Programme zur Erhöhung der<br />
Chancengleichheit zur Steigerung des weiblichen wissenschaftlichen Anteils<br />
beitragen? Wird der Umbau der österreichischen Universitätenlandschaft im Kontext<br />
einer europäischen Angleichung des Bildungssystems der letzten Jahre (bzw.<br />
Jahrzehnts), dieses Geschlechter(miss-)verhältnis zugunsten der Karriere von<br />
Nachwuchswissenschafterinnen verändern?<br />
8
Oder: Sind die Maßnahmen der Frauenförderungen und Diskussionen um<br />
Geschlechtergerechtigkeit an der Universität als reine „rhetorische Präsenz, faktische<br />
Marginalität“ zu bezeichnen, wie Angelika Wetterer 1 dies aufzeigt?<br />
In diesem Spannungsfeld befinden sich die Einrichtungen für die<br />
Gleichstellungsarbeit und Frauenförderung mit dem Ziel „sinnvolle“, nachhaltige,<br />
langzeitige Maßnahmen zu entwickeln, deren Erfolge verändernd auf die Hierarchie<br />
der Organisation wirken und an deren Ende eine (geschlechter-)gerechte Universität<br />
steht.<br />
Die Gefahr, Projekte und Programme zu initiieren, die als „Herzeigeprojekte“ mit<br />
einer gewissen Außenwirkung enden, besteht und liegt daher viel am Engagement<br />
und den Absichten der AkteurInnen, wie Initiativen zur Gleichstellungsarbeit wirken<br />
und wahrgenommen werden.<br />
Mentoringprojekte gibt es mittlerweile viele. Mentoring ist in den letzten Jahren<br />
„modern“ geworden. Klassische one-to-one Mentoringbeziehungen bergen auf<br />
persönlicher Ebene Chancen für die Unterstützung der Karriere. Aber: Was ändert<br />
sich für die Organisation?<br />
Hat Mentoring als Instrument der Frauenförderung das Potenzial und die<br />
Möglichkeiten organisational verändernd zu wirken im Sinn einer strukturellen<br />
Veränderung und wenn ja, welche nützlichen Rahmenbedingungen, Erfolgsfaktoren<br />
oder Hindernisse bedingen diese strukturellen Änderungen?<br />
Die Universität ist in ihren formellen und informellen Strukturen geprägt vom<br />
jahrhundertlangen Ausschluss von Frauen aus dem Wissenschaftssystem. Auch<br />
wenn die Zahlen der weiblichen Studierenden kontinuierlich ansteigen und<br />
mittlerweile an den österreichischen Universitäten mehr als die Hälfte ausmachen,<br />
sind auf den oberen hierarchischen Ebene Frauen dünn gesät. Die gläserne Decke<br />
ist in der Organisation Universität besonders beständig. Der in mehreren Phasen<br />
praktizierte Ausschluss von Frauen aus dem institutionalisierten<br />
Wissenschaftsbetrieb, prägt die Strukturen und codiert sie männlich, bildet eine<br />
1<br />
Wetterer, Angelika (2000): Noch einmal. Rhetorische Präsenz – faktische Marginalität. Die<br />
kontrafaktischen Wirkungen der bisherigen Frauenförderung im Hochschulbereich. In: Krais, Beate (Hg.):<br />
Wissenschaftskultur und Geschlechterordnung. Über die verborgenen Mechanismen männlicher Dominanz in der<br />
akademischen Welt. Frankfurt/M. – New York, 195-221.<br />
9
männerbündische Arbeitskultur 2 und bestimmt das Wissenschaftsfeld als<br />
androzentristische Enklave.<br />
1994 fragt sich Friederike Hassauer 3 ob sich etwas „geändert hat, in den wenigen<br />
Jahren, seit die Institution sich auf ihre (die Frau als Wissenschafterin, Anm. der<br />
Autorin) zwar singuläre, aber konstante Anwesenheit einrichtet?“ Sie gibt sich selbst<br />
ein eindeutiges Nein als Antwort und stellt fest: „Wissenschaft als Beruf ist<br />
Männerdomäne geblieben. Wissenschaft als Beruf stattet den homo academicus aus<br />
mit Habitus, mit Bildungskapital, mit universitärem Machtkapital, mit symbolischem<br />
Kapital – alles gebunden an die im Feld wirksame Eigenschaft, an das stärkste<br />
Machtpotential: männliches Geschlecht. Was hat sich geändert? Nur Besteckfragen.<br />
Konversationelle Usancen. Sprachregelungen“ (Hassauer 1994, 32).<br />
Noch 2002 schreibt Hassauer: „Sie (die Homo Academica, Anm. d. Verf.) ist noch<br />
immer „eine Absenz!“ Denn Weiblichkeit sei in der symbolischen Ordnung der<br />
Wissenschaft nicht symmetrisch zu Männlichkeit repräsentierbar; Autorität lasse sich<br />
nicht symmetrisch auf Weiblichkeit zuschieben“ (Hassauer 2002, 52).<br />
Das Spannungsfeld zwischen männlichen Strukturen und Kulturen auf formeller vor<br />
allem aber auf informeller Ebene im Wissenschaftsbetrieb einerseits und eine<br />
steigende Anzahl qualifizierter Frauen ist das Feld für Gleichbehandlung und<br />
Fördermaßnahmen, das es zu bearbeiten gilt.<br />
Das Instrument Mentoring gilt als traditionelles Frauenförderungsinstrument und<br />
stößt auf widersprüchliche Debatten und ambivalente Ansichten.<br />
Stabilisiert und reproduziert Mentoring als Maßnahme zur Frauenförderung das<br />
„männliche System“ oder wirkt es strukturverändernd?<br />
2<br />
Vgl. Kreisky, Eva (1994)<br />
3<br />
Friederike Hassauer, geb. 1951 in Würzburg, ist Essayistin und Universitätsprofessorin für Romanistik in<br />
Wien. Hassauer, Friederike (1994): Homo.Academica. Geschlechterkontrakte, Institution und die Verteilung des<br />
Wissens. Wien.<br />
10
1.3 Methodischer Hintergrund<br />
Mentoring geht ursprünglich auf eine klassische one-to-one-Förderbeziehung zurück<br />
und ist ein traditionelles Förderinstrument zur Einführung einer (ursprünglich<br />
männlichen) Person in die Gesellschaft. Ähnlich einer Vater-Sohn-Beziehung nimmt<br />
ein Mentor seinen Schützling unter seine Fittiche.<br />
Im englischsprachigen Raum ist Mentoring seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil<br />
eines Karriereverlaufes. In den letzten Jahren kommt auch im deutschsprachigen<br />
Raum das Förder-Konzept in den verschiedensten Formen und Bereichen zur<br />
Anwendung, ist ein „modernes“ Instrument der Nachwuchs- und Frauenförderung<br />
geworden.<br />
Die vorliegende Arbeit basiert auf Literaturrecherche zur aktuellen Literatur zum<br />
Thema Mentoring und damit verbundenen Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten,<br />
die zum Konzept Mentoring debattiert werden. Die Beschäftigung mit Organisationen,<br />
ihren Strukturen und Dynamiken und die Auseinandersetzung mit der „besonderen“<br />
Organisation Universität, der Wissenschaftskultur sowie ein Überblick über die<br />
Entwicklung der Gleichstellungsarbeit und Frauenförderung an der Universität folgen.<br />
Nach der theoretischen Auseinandersetzung stelle ich zwei aktuelle<br />
Mentoringprojekte vor. Das Mentoring-Programm m:uv der Universität Wien unter der<br />
Leitung des Referats für Frauenförderung und Gleichstellung, das mittlerweile den<br />
vierten Durchgang absolviert und das Mentoring-Programm Chancengleichheit in der<br />
Nachwuchsförderung, konzipiert im Rahmen des Kooperationsprojekt karriere_links<br />
des gendup-Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung der Universität<br />
Salzburg und der Stabsabteilung für Gleichstellungspolitik der Johannes-Kepler-<br />
Universität Linz. Die beiden Programme sind von ihren Ansätzen her verschieden.<br />
Während das Wiener Programm mit Gruppenmentoring (peer-group-Ansatz) gute<br />
Erfahrung gemacht hat, geht das Salzburg-Linzer Projekt universitätsübergreifend<br />
vom klassischen one-to-one Mentoring, im Sinne einer Elitenförderung, aus. Mit den<br />
beiden Leiterinnen bzw. Projektkoordinatorinnen der Programme habe ich ein<br />
leitfadengestütztes Interview geführt, um aus ihren Absichten bei der Konzipierung<br />
der Programme sowie ihren Einschätzungen und Erfahrungen, Potenziale der<br />
Strukturveränderung fest zu machen und zur Illustration einzufügen.<br />
11
1.4. Aufbau der Arbeit<br />
Nach dem ersten Teil der Einleitung beschäftigt sich das zweite Kapitel meiner Arbeit<br />
mit Organisationen und deren Strukturen und Dynamiken. Organisationen<br />
funktionieren nicht nur nach sichtbaren ausgehandelten und vereinbarten<br />
Regelsystemen, sondern passiert ein Großteil von Handlungen auf den informellen<br />
Ebenen. Struktur und Kultur sind ein wesentlicher Bestandteil von Organisationen<br />
und ausschlaggebend für den jeweiligen Erfolg einer Organisation.<br />
Im dritten Kapitel beschäftige ich mich mit der Universität als „männliches System“<br />
mit der ihr eigenen Wissenschaftskultur basierend auf den jahrhundertlangen<br />
Ausschluss von Frauen aus der institutionellen Wissenschaft und den<br />
Nachwirkungen bis heute.<br />
Kapitel vier und fünf beschäftigen sich mit der Gleichstellungsarbeit der letzten<br />
Jahrzehnte an den Universitäten und veranschaulichen das Geschlechterverhältnis<br />
und seine Entwicklung an den Universitäten am Beispiel der Universität Salzburg.<br />
Die Beschäftigung mit Gleichstellungsarbeit beinhaltet auch immer wieder die<br />
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Strömungen und Ansätzen um die<br />
Themen Gleichheit, Differenz und Dekonstruktion.<br />
Kapitel sechs beschäftigt sich schließlich mit dem Instrument Mentoring und seinen<br />
Potenzialen zur Nachwuchsförderung bzw. strukturellen und kulturellen<br />
Veränderungspotenzialen an den Universitäten. Um Potenziale festmachen bzw.<br />
erkennen zu können, habe ich zwei in der Programmatik unterschiedliche<br />
Mentoringprojekte vorgestellt und mit den beiden Projektleiterinnen bzw.<br />
-koordinatorinnen Interviews geführt.<br />
Abschließend versuche ich, die Fragestellungen mit den Ergebnissen der<br />
Recherchearbeiten und den Erfahrungen und Einstellungen der<br />
Interviewpartnerinnen zu verknüpfen und daraus mögliche Potenziale der<br />
Strukturveränderung erkennen bzw. entwickeln zu können.<br />
12
2. Organisationen – Strukturen und Dynamiken<br />
Michael Wolf (1994) definiert Organisation als „eine Ordnung von arbeitsteilig und<br />
zielgerichtet miteinander arbeitenden Personen und Gruppen“, die „alle Institutionen,<br />
Gruppen und sozialen Gebilde, die bewusst auf ein Ziel hinarbeiten, dabei geplant<br />
arbeitsteilig gegliedert sind und ihre Aktivität auf Dauer eingerichtet haben“, umfasst<br />
(Wolf 1994, 132).<br />
Die bei dieser Definition implizierte Rationalität des Handelns aller Beteiligten und die<br />
Konzentration auf ein gemeinsames höheres Ziel, werden in der Realität so nicht<br />
stattfinden. Vielmehr spiegelt sich in den Organisationen der Aushandlungsprozess<br />
der beteiligten AkteurInnen um unterschiedlich gelagerte Interessen wider. Klaus<br />
Türk (1993) bezeichnet daher Organisation auch als „historisch-gesellschaftlich<br />
spezifische Form von Herrschaft“ (Türk 1993, 223).<br />
Neuberger (1997) sieht in Organisationen stabilisierte und legitimierte Ordnungen,<br />
die als Einheiten symbolisiert und erlebt werden, durch sie bzw. in ihnen werden<br />
Ressourcen dauerhaft zusammengelegt und instrumentalisiert (vgl. Neuberger 1997,<br />
494).<br />
Nach Gebert und Rosenstiel (2005) werden Organisationen als „vielfach als ihrer<br />
Umwelt gegenüber offene Systeme definiert, die zeitlich überdauernd existieren,<br />
spezifische Ziele verfolgen u.a. aus Individuum bzw. Gruppen zusammengesetzt sind<br />
und eine bestimmte Struktur zur Koordination der einzelnen Tätigkeiten aufweisen,<br />
die in der Regel durch Arbeitsteilung und eine Hierarchie der Verantwortung<br />
gekennzeichnet sind“ (vgl. Rosenstiel 2005, 225).<br />
Um als stabile Systeme und Ordnungen in einer ebenso strukturierten Umwelt<br />
bestehen zu können, müssen sich Organisationen in Organisations-Struktur und<br />
Organisations-Kultur verfestigen. Strukturelle Veränderungsprozesse in einer<br />
Organisation ziehen m.E. einen zeitlich versetzten kulturellen Veränderungsprozess<br />
einer Organisation mit sich.<br />
Die Definitionen von Organisation sind geprägt durch eine gemeinsame<br />
Begrifflichkeit wie Einheitlichkeit, Stabilität, Ziele, legitimierte Ordnungen und<br />
Hierarchien. Andererseits finden in einer Organisation nicht nur Prozesse statt,<br />
deren Motive von Rationalität, Sachlogik, Effizienz und einem gemeinsamen Zweck<br />
13
geprägt sind, sondern treten auch unterschiedliche Ansprüche der verschiedenen<br />
AkteurInnen innerhalb einer Organisation gegeneinander an (vgl. Lehner 2002, 19).<br />
Das Handeln der beteiligten Menschen in Organisationen ist vielfältig.<br />
Neben „harten“ Elementen wie Struktur, Strategie, Steuerungs- und<br />
Kontrollmechanismen besitzt eine Organisation „weiche“ Elemente, die für den Erfolg<br />
eines Unternehmens wichtig sind. Zu diesen „weichen“ Zutaten zählen Faktoren wie<br />
soziale Qualifikationen, Vorgangsweise bei Stellenbesetzungen, Führungsstile,<br />
Betriebsklima. Diese weichen Zutaten sind der kulturellen und sozialen Ebene einer<br />
Organisation zuzuschreiben.<br />
2.1 Organisationskultur<br />
Schreyögg (1992) bezeichnet diese „weichen“ Ingredienzien als Organisationskultur<br />
und erklärt die Merkmale einer solchen mit:<br />
_Sie ist ein implizites Phänomen, das Selbstverständnis und Eigendefinition<br />
der Organisation prägt;<br />
_Sie ist „selbstverständlich“ und wird in der Regel nicht reflektiert;<br />
_Sie bezieht sich auf gemeinsame Orientierungen an Werten, macht<br />
organisatorisches Handeln einheitlich und kohärent;<br />
_Sie ist das Ergebnis eines Lernprozesses im Umgang mit Bedingungen, die<br />
innerhalb und außerhalb der Unternehmungen liegen;<br />
_Sie vermittelt Sinn und Orientierung in einer komplexen Welt und<br />
vereinheitlicht so deren Interpretation und enthält Handlungsprogramme;<br />
_Sie ergibt sich aus einem Sozialisationsprozess, der dazu führt, aus einer<br />
kulturellen Tradition heraus zu handeln, was bedeutet, dass sie nicht bewusst<br />
gelernt wird<br />
(vgl. Schreyögg, Georg 1992, zit. nach Rosenstiel 2005, 227).<br />
Die Handlungsabläufe in Organisationen finden auf drei Ebenen statt:<br />
Auf der strukturellen Ebene, der kulturellen Ebene und der sozialen Ebene.<br />
14
Die kulturelle und soziale Ebene wird dabei für den Erfolg einer Organisation oft<br />
unterschätzt. Informelle Abläufe, Rituale und Kommunikation sind diesen Ebenen<br />
zuzurechnen.<br />
Neben einer offiziellen Organisationskultur, wie dem Leitbild und dem mission<br />
statement einer Organisation, existiert eine inoffizielle Organisationskultur, die durch<br />
informelle Spielregeln und Sozialisationsprozesse die Arbeitsabläufe stark<br />
beeinflussen.<br />
Das Zusammenspiel von harten und weichen Elementen, die Dynamiken die dabei<br />
entstehen, ergeben m.E. eine Organisationskultur, die vor allem durch die<br />
handelnden Personen geprägt ist und formbar sein kann.<br />
Handlungsabläufe und Entscheidungsprozesse in Organisationen sind durch Regeln<br />
und Hierarchien geprägt, allerdings entsprechen die Mechanismen zur<br />
Entscheidungsfindung tatsächlich oft nicht den formal geregelten Abläufen. Neben<br />
der formellen Ebene wird hier eine informelle Ebene der Organisation unterschieden.<br />
Die informelle Ebene rückt die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der<br />
Organisation in den Blick.<br />
2.2 Organisation und Geschlecht<br />
Eine zentrale Ebene im Inneren der Organisation betrifft die Positionierung der<br />
Geschlechter, dem Verlauf der Geschlechterlinie innerhalb einer Organisation.<br />
Die Beschäftigung mit dem Aufbau von und Ablauf in Organisationen ist für die<br />
Frauenforschung erst seit den 1980er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein zu<br />
bearbeitendes Themenfeld geworden. Bis dahin werden Organisationen, vor allem<br />
staatliche Verwaltungen und Unternehmen von der Frauenbewegung als<br />
„Reproduzenten gesellschaftlicher Diskriminierung“ angesehen (vgl. Hark 2005, 20).<br />
Aus der Ablehnung entsteht nachfolgend ein etwas differenzierterer Zugang. Der<br />
innere Aufbau von Organisationen wird nicht mehr nur als Wiederholung<br />
gesellschaftlicher Diskriminierungen betrachtet, sondern darin ein Versuchsfeld<br />
gesehen, die Strukturen die eine (staatliche) Organisation zur Verfügung stellt, für<br />
eigene Interessen zu nutzen. Dabei sollen organisationale Strukturen nutzbar<br />
15
gemacht werden und durch Einschluss in und Einflussnahme auf eine Organisation<br />
Veränderungen von Innen bewirken. Der Blick sollte auf die<br />
Reproduktionsmechanismen geschlechtsspezifischen Diskriminierungen durch<br />
Organisationsstrukturen gerichtet und damit Änderungen in Struktur und Kultur<br />
ermöglicht werden.<br />
Die Einstellungen der Frauenbewegung zu organisationalen Strukturen sind nach wie<br />
vor ambivalent. Die kontroversen Diskussionen reichen von Benutzung der<br />
Strukturen und Instrumentalisierung für die eigenen Interessen bis zur totalen<br />
Ablehnung von vor allem staatlichen Strukturen und Organisationen, die als<br />
frauenfeindlich enttarnt werden.<br />
Die feministische Kritik richtet sich gegen eine „Absorbierung“ der Forderungen nach<br />
Chancengleichheit durch (staatliche) Institutionen und Organisationen. Die<br />
Integration der Forderungen nach (Chancen)Gleichheit würde wie Cornelia Klinger<br />
(1998) es formuliert, eine Strategie der „Immunisierung“ gegenüber feministischer<br />
Kritik nach sich ziehen: nämlich die Behauptung, alles, was feministische Kritik zu<br />
bieten hat, sei bereits längst akzeptiert und integriert worden, alle Forderungen seien<br />
erfüllt und alle Ziele erreicht. Die institutionelle Berücksichtigung feministischer<br />
Forderungen würde die „historischen Überholung“ derselben mit sich bringen (vgl.<br />
Hark 2005, 21).<br />
Dass diese Befürchtungen nicht unbegründet sind, lässt sich m.E. an einer gewissen<br />
„Ambivalenz der Gefühle“ gegenüber Maßnahmen der Frauenförderung und<br />
Chancengleichheit, die selbst IdeenentwicklerInnen und AkteurInnen derselben<br />
immer wieder formulieren, feststellen.<br />
Hark (2005) führt als Beispiel die „Verstaatlichung“ der Frauenpolitik in den 1980er<br />
Jahren an, deren Forderung nach Gleichstellung in einer Vielzahl von Gesetzen und<br />
Politiken des Gender Mainstreamings dazu geführt hat, dass die Gleichberechtigung<br />
zwischen den Geschlechtern als umgesetzt gilt. Hark erkennt dabei, dass<br />
geschlechtsbezogene Benachteiligungen in der Wahrnehmung junger Frauen und<br />
Männer kaum noch existieren, bzw. als Einzelfälle betrachtet werden. Außerdem sei<br />
es „vielfach nicht mehr zeitgemäß, Diskriminierungserfahrungen aufgrund weiblicher<br />
Geschlechtszugehörigkeit zu thematisieren“ (vgl. Kuhlmann 2002, 232).<br />
16
Diese Wahrnehmung führt Hark zu der Einschätzung, dass sich Gleichheit als Norm<br />
weltweit etabliert (vgl. Hark 2005, 22).<br />
Joan Acker (1991) entwickelt und begründet ihr Konzept der „gendered<br />
Organisationen“ und macht fünf organisationale Prozesse aus:<br />
1. Trennungen von Arbeitstätigkeiten, von erlaubtem Verhalten, Raum,<br />
Macht u.a. können auch in Organisationen entlang der<br />
Geschlechterlinie identifiziert werden.<br />
2. Organisationen sind Räume, in denen kulturelle Bilder der<br />
Geschlechter sowohl erfunden als auch reproduziert werden. Das<br />
Bild des Managers als tatkräftige Männlichkeit und auch das Bild des<br />
Arbeiters, der Männlichkeit mit Technik verbindet, sind solche<br />
Produkte.<br />
3. Interaktionen zwischen Frauen und Männern untereinander<br />
produzieren vergeschlechtlichte soziale Strukturen und<br />
vergeschlechtlichte Organisationen.<br />
4. Einige Aspekte individueller Geschlechtsidentität, z.B. die beinahe<br />
ausschließliche Berufsorientierung von Männern, sind Ergebnis<br />
organisationaler Prozesse und Zwänge.<br />
5. Geschlecht ist ein grundlegendes konstitutives Element nicht nur für<br />
Familie und Verwandtschaft, sondern auch für die Grundannahmen<br />
und Praktiken heutiger Arbeitsorganisationen. So zeigt sich<br />
beispielsweise, dass betriebliche Beurteilungsverfahren von<br />
MitarbeiterInnen sehr oft gängige Geschlechtsrollenstereotypen<br />
widerspiegeln (vgl. Acker, Joan 1991, 163, zit. nach Schreyögg 1998,<br />
32ff).<br />
In den Organisationen besteht eine „Hierarchisierung von Männerarbeit und<br />
Frauenarbeit“, die ihre Basis in der heterosexuellen Konstruktion von<br />
Arbeitsbeziehungen hat. Auf gesellschaftlicher Ebene hat dieses Phänomen der<br />
Hierarchisierung von Männer- und Frauenarbeit Angelika Wetterer beschrieben.<br />
Dabei ist zu beobachten, dass beim Eindringen von Frauen in männlich dominierte<br />
Branchen am Arbeitsmarkt, die gesamte Branche an Bedeutung verliert und<br />
marginalisiert wird, mit dem negativen Effekt geringerer Einkommens- und<br />
17
Karrieremöglichkeiten. Es zeigt sich, dass eine „Verweiblichung“ einer Branche einen<br />
Statusverlust zur Folge hat (vgl. Lehner 2002, 21).<br />
Geschlecht als Kategorie erweist sich auf allen Ebenen von Organisationen nach wie<br />
vor als relevanter Faktor und Lehner (2002) spricht in diesem Zusammenhang von<br />
der „(...) Berufstätigkeit und damit verbunden die Organisation von Arbeit als eines<br />
der wichtigsten Mittel zur Aufrechterhaltung männlicher Vorrangstellung (...)“<br />
(vgl. Lehner 2002, 22).<br />
Unter der Oberfläche funktionaler Organisationslogiken ist immer auch die<br />
Geschlechterordnung in Organisationen der modernen Gesellschaft eingelagert. Die<br />
Geschlechterordnung findet sich wieder in Aufbau und Struktur der Organisation, im<br />
hierarchischen Aufbau der Organisation, in der Karrierelaufbahn der Mitglieder der<br />
Organisation. Gesellschaftliche Einrichtungen, Institutionen, Organisationen sind<br />
gendered, „vergeschlechtlicht“ (vgl. Krais 2000, 49).<br />
18
2.3 Universitäten als besondere Organisationen<br />
Die Universität als wissensproduzierende Organisation wird als besondere<br />
Organisation bezeichnet. Diese besonderen Organisationen „bestehen von ihrer<br />
Struktur her aus nur locker miteinander verbundenen Einheiten unterschiedlicher<br />
Fachrichtungen, die sich mit ihren Partikularzielen und Partikularinteressen an der<br />
jeweiligen scientific community orientieren. Entscheidungsfindung soll unter den<br />
wissenschaftlich kommunizierenden Individuen im Konsens geschehen“ (vgl. Roloff<br />
1998, 25). Eine Universität ist demnach kein homogenes Gebilde und von einer<br />
Organisation „als Ganzes“ zu sprechen, ist für Neusel (1998) eher problematisch.<br />
Neusel spricht von einer Reihe von dezentralen Einheiten, deren fachspezifische<br />
Normen und Standards differieren (vgl. Neusel 1998, 70).<br />
Roloff (1998) sieht die Handlungsabläufe und Entscheidungsprozesse an der<br />
Hochschule durch Gesetze und Ordnungen geregelt, betont aber, dass das<br />
Zusammenwirken jedoch vielfach auf informeller Basis, durch Vorklärungsprozesse<br />
außerhalb und im Vorfeld der Gremien, geschieht (vgl. Roloff 1998, 25).<br />
Universitäten sind komplexe Organisationen kooperierender und auch<br />
konkurrierender AkteurInnen und Organisationseinheiten. Dazu kommt die<br />
Doppelstruktur von Verwaltung und Wissenschaft als prägendes Element der<br />
Universität als besondere Organisation. Dennoch trifft nach Scholz (1990) für diese<br />
besonderen Organisationen eine ausgeprägte Organisationskultur, die Sinn<br />
vermittelt, Motivationspotenziale schafft, Konsens stiftet und Orientierung gibt,<br />
Koordination vereinfacht, Identität begründet und Lernpotenziale eröffnet, zu (vgl.<br />
Scholz 1990, 15).<br />
2.4 Universitäten als ExpertInnenorganisationen<br />
In einer aktuellen Wirkungsanalyse frauenfördernder Maßnahmen des<br />
Bundesministeriums 4 wird in der organisationalen Einschätzung der Universität der<br />
Begriff der „ExpertInnenorganisation“ geprägt. Folgende Charakteristika<br />
kennzeichnen laut dieser Analyse die universitäre Organisation:<br />
4<br />
Materialen zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft. Wirkungsanalyse frauenfördernder<br />
Maßnahmen im bm:bwk 2007. Band 21. Wien.<br />
19
• Hoher Grad an Individualität und Autonomie der ExpertInnen<br />
Das Kapital der Universität liegt in der Leistungsfähigkeit einzelner ExpertInnen.<br />
Professionalität und Motivation der ExpertInnen müssen für den „Output“<br />
stimmen.<br />
• Dominanz des Faches<br />
ExpertInnenorganisationen verfügen über eine Struktur, in der Fach und<br />
Organisation einander überlagern. Die Organisation wird jedoch zumeist nur als<br />
der Rahmen gesehen, innerhalb der die professionelle Tätigkeit erfolgt.<br />
ExpertInnen definieren sich vorwiegend über ihr Fach und nicht über die<br />
Universität. Einer der Gründe dafür ist, dass wissenschaftliche Reputation an<br />
innovative Forschung im eigenen Feld 5 gekoppelt ist, Managementtätigkeiten<br />
werden eher gering honoriert.<br />
• Spezialisierung von Wissen und Fragmentierung<br />
Die Bildung neuer, spezialisierter Disziplinen ist ein wichtiger Mechanismus in der<br />
Produktion von Wissen und zur Sicherung der eigenen Position. Auf der Ebene<br />
der Organisation führt dies zu einer losen Kopplung kleiner Einheiten mit<br />
unterschiedlichen Kulturen und ohne gemeinsames „Gesamtprodukt“.<br />
• Professionelle Selbstkontrolle<br />
Die Kontrolle der eigenen Arbeiten erfolgt durch die ExpertInnen bzw. durch<br />
etablierte „Fach-Peers“. Die externe Beurteilung der wissenschaftlichen Leistung<br />
wird kritisch gesehen.<br />
Management, Administration und Leitung sind „ungeliebte“ Aufgaben.<br />
Administration hält eine ExpertInnenorganisationen zusammen. ExpertInnen<br />
verbinden diese aber zumeist mit Hindernissen und Störungen der<br />
wissenschaftlichen Tätigkeit. Sie wird als lästig gesehen. Dieses<br />
Spannungsverhältnis ist typisch für die Form der ExpertInnenorganisation:<br />
während ein Teil des Personals für Integration und Kohärenz zuständig ist,<br />
tendieren ExpertInnen in Richtung Spezialisierung und Fragmentierung.<br />
5<br />
vgl. Kapitel 3.2 Wissenschaft als soziales Feld.<br />
20
• Innovation erfolgt primär auf der Ebene der einzelnen Organisationseinheiten<br />
Innovative Leistungen sind für ExpertInnen die Basis für Karriere und Zugang zu<br />
Ressourcen. Auf Ebene der Gesamtorganisation ist Innovation aber insofern<br />
schwierig, da eine Organisation die kein gemeinsames „Gesamtprodukt“<br />
entwickelt, in ihrer Fragmentierung aber eher keine kollektiven Anstrengungen<br />
unternimmt (vgl. Wirkungsanalyse frauenfördernder Maßnahmen im bm:bwk<br />
2007, 44).<br />
Da Organisationsstrukturen niemals geschlechtsneutral sind, bedeutet das für die<br />
Expertinnenorganisation Universität, dass die beschriebenen Merkmale<br />
unterschiedlich auf die Arbeitsbedingungen von Männern und Frauen wirken.<br />
Deutlich beschreibt diesen Umstand Färber (2001):<br />
„Organisationsstrukturen wirken sich in einer geschlechterhierarchisch konstituierten<br />
Gesellschaft geschlechterdifferenzierend und damit selektiv aus“ (Färber 2001, 140).<br />
Hindernisse für Wissenschafterinnen liegen bei den oben charakterisierten Punkten<br />
vor allem in der Dominanz des Faches und der Professionellen Selbstkontrolle.<br />
2.5 Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe von Organisationen<br />
Die Herstellung von Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit ist für eine<br />
Organisation eine notwendige Querschnittsaufgabe, die auf allen organisationalen<br />
Ebenen greift. Gender Mainstreaming und Frauenförderung sind die gängigsten<br />
Schlagworte die auf den Weg zu geschlechtergerechteren Strukturen in<br />
Organisationen benannt werden. Traditionelle Frauenförderung setzt überwiegend<br />
auf die individuelle Unterstützung von Frauen an, Gender Mainstreaming als topdown-Prinzip,<br />
nimmt alle AkteurInnen auf allen organisationalen Ebenen in die Pflicht<br />
und zielt auf die Veränderung der strukturellen Ebene in Richtung<br />
Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit ab.<br />
Ziel einer effizienten Frauenförderungspolitik ist aber nicht nur eine quantitative<br />
Erhöhung der Anzahl von Frauen auf der höheren Hierarchieebene, sondern eine<br />
grundsätzliche Enthierarchisierung und Umstrukturierung von Organisationskulturen.<br />
21
Frauenförderungspolitik ist die zur Verfügung Stellung von<br />
Durchsetzungsinstrumenten zur Herstellung von Bedingungen, die Frauen und<br />
Männern entsprechend ihren Qualifikationen die gleichen beruflichen Chancen bieten<br />
soll.<br />
Traditionelle Frauenförderung muss also ergänzt werden um Instrumente und<br />
Maßnahmen, die auf die strukturelle Ebene wirken. Neben dem nicht unumstrittenen<br />
Konzept von Gender Mainstreaming kann Mentoring ergänzend zur traditionellen<br />
Frauenförderung, zusätzlich zu Effekten auf der individuellen Ebene (Förder-<br />
Beziehung zwischen einzelnen Personen), die Organisationskultur,<br />
Handlungsweisen und tradierte Handlungsmuster herausfordern und in Frage<br />
stellen. Das Bekenntnis einer Organisation zur Chancengleichheit zeigt sich neben<br />
dem internen Handeln auch im Erscheinungsbild und Auftreten nach Außen bzw. in<br />
deren Leitbild.<br />
Die Reformprozesse in der Universitätenlandschaft in den letzten Jahren (Stichworte<br />
sind: UG 2002, Entstaatlichung, Entlassung in die Autonomie, Neoliberalisierung der<br />
Universitäten) bedeuten gravierende Veränderungen und Umstrukturierungen auf<br />
personeller, finanzieller und organisationaler Ebene. Betriebswirtschaftliche<br />
Kennziffern werden in diesen Umstrukturierungsprozessen prioritär. Leitbegriffe wie<br />
Effizienz, Effektivität, Qualitätssicherung, Evaluationen, etc. prägen den Prozess.<br />
Ziel- und Leistungsvereinbarungen und davon abhängige Budgetzuteilungen sind die<br />
Vorgaben und Herausforderungen an die AkteurInnen auf Verwaltungs- und<br />
Wissenschaftsebene. Diese Leitbegriffe verdeutlichen eine Paradigmenwechsel, der<br />
die traditionellen Paradigmen „Wissenschaft und Wahrheit“ bzw. „Wissenschaft und<br />
gesellschaftlicher Fortschritt“ ablöst und ein neues Paradigma „Wissenschaft und<br />
Markt“ installiert. Ziel ist nach Nöbauer/Genetti (2006) letztendlich eine<br />
Umstrukturierung der ehemaligen Massenuniversitäten mit freiem Hochschulzugang<br />
hin zu deregulierten Dienstleistungsunternehmen (vgl. Nöbauer/Genetti 2006, 70).<br />
Diese Reformprozesse erfordern von der Universität als besondere Organisation die<br />
Notwendigkeit lernende Organisation zu sein. Eine lernende Organisation umfasst<br />
alle Mitglieder auf allen Ebenen der Organisation. Veränderungsprozesse und<br />
Umstrukturierungen fordern von den Mitgliedern und AkteurInnen als ersten Schritt<br />
22
die Entwicklung von Veränderungsbereitschaft, da Umstrukturierungen gewohnte<br />
Hierarchien, Handlungsmuster und -abläufe in Frage stellen.<br />
Die Umstrukturierung der Universitäten bietet abseits der „Neoliberalisierung“ aber<br />
auch die Möglichkeit diesen Prozess zu nutzen, das Hochschulsystem<br />
geschlechterpolitisch zu reformieren. Möglichkeiten zur Intervention in bisher<br />
zementierte Organisationsstrukturen eröffnen sich durch Implementation 6<br />
gleichstellungspolitischer Maßnahmen und Programme.<br />
6<br />
Das Thema „Implementation“ wird im Kapitel 6.2.1.1 noch ausführlicher behandelt.<br />
23
3. Männlichkeit als System – Die Universität als hegemonial männliche<br />
Organisation<br />
Die Universität muss aufgrund ihrer Geschichte des Ausschlusses von Frauen bis ins<br />
Jahr 1897 und der daraufhin eher zögerlichen Integration von Frauen auf allen<br />
Hierarchieebenen und deren Auswirkung bis in die Gegenwart als eine<br />
männerbündische Institution betrachtet werden (vgl. Strasser 1998, 40/Kreisky 1994/<br />
Sombart 1996, 142).<br />
Der Begriff Männerbund, hat seinen Ursprung in Deutschland Anfang des 20.<br />
Jahrhunderts. Wie Sombart (1996) ausführt, wird zu der Zeit, als die Forderungen der<br />
ersten Frauenbewegungen nach Etablierung von Frauenrechten erstmals erfolgreich<br />
waren, mit der „wissenschaftlichen“ Fundierung der Männerbünde eine<br />
„Gegengewicht“ zur „Verweichlichung und Verweiblichung“ der Gesellschaft<br />
installiert. Die Männerbünde stellen für die Mitglieder eine Möglichkeit dar, ihre<br />
Freundschaften 7 auf eine höhere, wissenschaftlich legitimierte Ebene zu übertragen<br />
und individuelles Machtstreben als das gemeinsame Streben eines Kollektivs zu<br />
legitimieren (vgl. Strasser 1998, 40/Sombart 1996, 153).<br />
Der Begriff der Seilschaften wurde in Zusammenhang mit Männerbünden und<br />
geschlossenen Netzwerken von Emrich (1996) aus dem Alpinismus übernommen. Er<br />
untersuchte mit einer Forschergruppe zahlreiche Organisationen aus Wirtschaft,<br />
Politik, Sport, Kirche und Wissenschaft. Entsprechend einer Seilschaft ist die<br />
gegenseitige Sicherung verschiedener Personen während eines Aufstiegs zum<br />
Gipfel gewährleistet. Der erste Mann des Aufstiegs, der „Obermann“ geht beim<br />
Erklimmen unbekannter Höhen ein Risiko ein, das von der nachfolgenden<br />
Mannschaft Dankbarkeit, Loyalität und Vertrauen verlangt (vgl. Strasser 1998, 41).<br />
„Seilschaften sind Systeme sozialer Transaktionen, in denen Ressourcen<br />
getauscht, Informationen übertragen, Einfluss und Autorität ausgeübt,<br />
Unterstützung mobilisiert und durch Gemeinsamkeiten emotionale und<br />
affektuale Bindungen zum Zweck des sozialen Aufstiegs erzeugt werden“<br />
(Emrich, 1996, zit. nach Strasser 1998, 41).<br />
Die von Emrich in seinen Untersuchungen von Organisationen dabei vernachlässigte<br />
Bedeutung des Geschlechts zeigen Birgit Buchinger und Erika Pircher (1994) in ihrer<br />
7<br />
In diesen Freundschaftsbeziehungen und Männern kann bereits ein Mentoringansatz durch gegenseitige<br />
Unterstützung gesehen werden.<br />
24
Studie über versteckte Diskriminierungen auf und ergänzen das Bild einer<br />
funktionierenden Männerkultur:<br />
„Männer können sich bei ihrem Weg hinauf der Fußstapfen bedienen, die<br />
ihresgleichen vor ihnen ausgetreten haben. Die nach wie vor existierenden<br />
Seilschaften sind ihnen dabei behilflich. Und wenn sie dort anlangen, wo sie<br />
hinwollen, werden sie nicht die ersten Männer sein. D.h., sie können sich -<br />
abgesichert durch ihre Vorgänger – identitätskonform „hinaufhanteln“<br />
(Buchinger/Pircher 1994, 157).<br />
Nach Öffnung der Universitäten für Frauen 8 , der Bildungsoffensive der letzten<br />
Jahrzehnte, den Bemühungen um Gleichstellung und Chancengleichheit der<br />
Geschlechter, ist die österreichische Universitätenlandschaft auf den höheren<br />
hierarchischen Ebenen nach wie vor von einer ausgeprägten<br />
geschlechtsspezifischen Segregation geprägt.<br />
In den veröffentlichten Zahlen von 2006 gleicht die Verteilung von Männer und<br />
Frauen einer weit geöffneten Schere.<br />
Bei der Anzahl der StudienanfängerInnen und der AbsolventInnen stellen Frauen in<br />
Österreich längst die Mehrheit. Doch je höher es in der Hierarchie nach oben geht,<br />
desto weiter geht die Gender-Schere zugunsten der Männer auf: Mit knapp 15<br />
Prozent bei den ProfessorInnen und fünf Prozent bei den RektorInnen gehört<br />
Österreich zu den europäischen Schlusslichtern beim universitären Frauenanteil:<br />
8<br />
Vgl. Kapitel 3.4<br />
25
Abb 1: Gender-Schere, Zahlen 2006<br />
Quelle: heureka, Wisseschaftsmagazin im Falter 9<br />
Grafik: Hackl, APA; rot = weiblicher Anteil, blau = männlicher Anteil<br />
Bemerkenswert dabei ist, dass der Anteil der Studienanfängerinnen die Zahl der<br />
männlichen Studierenden bereits um 14 Prozent übersteigt.<br />
Gängige Erklärungsmuster für das Phänomen des „akademische Frauensterbens“<br />
werden wie Beate Krais (2005) anführt, von der deutschsprachigen wie auch<br />
internationalen Forschungsliteratur in der Situation der Frauen an sich gesehen, in<br />
ihren Sozialisationsprozessen, biographischen Verläufen, spezifisch weiblichen<br />
Prozessen der Identitätsentwicklung und der Konfliktbewältigung, oder auch im<br />
besonderen Umgang von Frauen mit Problemen der Vereinbarkeit von Familie und<br />
Beruf (vgl. Krais 2005, 30).<br />
Dies scheint zunächst durchaus plausibel, gibt es doch keine formalen Barrieren oder<br />
Zugangsbeschränkungen mehr, die Frauen im Einschlagen einer wissenschaftlichen<br />
Karriere behindern würden.<br />
Die auf formeller Ebene gesetzlich verankerten Maßnahmen zur Frauenförderung<br />
und Gleichbehandlung an den Universitäten sollten ein Übriges tun und eventuelle<br />
Geschlechter diskriminierende Hindernisse aus dem Weg räumen.<br />
9<br />
http://www.falter.at/web/heureka/blog/?p=119, abgerufen am 15.08.2008<br />
26
Nach den Erkenntnissen aus einer Untersuchung 10 von Höyng/Puchert/Raschke<br />
(2004) sind Gründe für die Ausgrenzung von Frauen vor allem im informellen Bereich<br />
einer Organisation zu suchen. Es sind nicht offene frauenfeindliche Aktionen, die den<br />
Fortbestand der Hierarchie gewährleisten, sondern die Geschlechterhierarchie wird<br />
als eine kulturelle Hegemonie des männlichen Geschlechts verstanden. Diese<br />
männliche Hegemonie wird im Arbeitsprozess von Männern, aber auch von Frauen<br />
reproduziert und sichert somit die Vorherrschaft der Männer. Höyng spricht von den<br />
Männern als Hauptgewinner dieser Kultur, dessen Preis die Frauen bezahlen mit der<br />
Einschränkung, dass auch Männer in unterschiedlichem Maß bezahlen. Höyng sieht<br />
hier nicht alle Männer als Gewinner und gibt es ebenso männliche „Verlierer“ dieses<br />
Hegemoniestrebens.<br />
Hyöng prägt in diesem Zusammenhang auch den Begriff einer interessensgeleiteten<br />
Nichtwahrnehmung von Geschlechterdifferenzen bei Männern.<br />
Es zeigt sich aus seinen Untersuchungen, dass Männer bei einer allgemeinen<br />
Bewertung der Frage der Gleichstellung von Frauen und Männern eine generelle<br />
Aufgeschlossenheit zeigen. Gleiche Chancen und Rechte für Männer und Frauen<br />
werden bejaht, die Notwendigkeit von Gleichstellungsmaßnahmen erkannt. Der<br />
relativ offenen Einstellung steht aber häufig ein Verharren in Untätigkeit gegenüber.<br />
Hyöng sieht in diesem Zusammenhang, dass Erfahrungen mit Gleichheit und/oder<br />
Differenz und daraus resultierende Diskriminierungen, von den meisten Menschen<br />
kaum in Abstraktion von der eigenen Situation wahrgenommen werden. Seiner<br />
Meinung nach liegt es nahe, dass die eigene Situation und die eigenen Interessen<br />
als allgemein wahrgenommen werden.<br />
Diese Form der Wahrnehmung führt dazu, dass Männer geschlechtsspezifische<br />
Diskriminierungen nur selektiv wahrnehmen und diese Diskriminierung<br />
gesamtgesellschaftlich anerkennen. Im eigenen Arbeitsumfeld überschätzen sie den<br />
bereits erreichten Stand der Gleichbehandlung meist erheblich und sehen Defizite<br />
eher in anderen Organisationen (vgl. Höyng/Lange 2004, 104).<br />
„Interessensgeleitete Nichtwahrnehmung, Gleichheitspostulat und die<br />
wiederkehrenden Argumentationsmuster erklären vor allem das gute<br />
Gewissen vieler Männer, das Selbstverständnis als „Gerechter“. Für sie<br />
existiert keine Notwendigkeit, für ihre egalitäre Haltung einzutreten und zu<br />
handeln, sie können untätig bleiben angesichts von Diskriminierung. So wirken<br />
10<br />
Basis ist eine Untersuchung von Höyng, Puchert und Raschke 1992/93 an 40 Männern in der Berliner<br />
Senatsverwaltungen zu Gleichstellung, Arbeitskultur und zur Vereinbarung von Beruf und Privatleben.<br />
27
die meisten Männer an der Verhinderung der beruflichen Gleichstellung mit,<br />
allerdings in den meisten Fällen weder strategisch noch bewusst. Doch allein<br />
diese Wahrnehmungsmuster erklären immer noch nicht die Männerdominanz<br />
im Beruf“ (Höyng 2004, 105).<br />
Die Wahrnehmung der eigenen Situation als „allgemein“, das fehlende Geschlechter-<br />
Bewusstsein, resultiert aus der Voraussetzung des männlichen Geschlechts als<br />
„absolut“.<br />
Aus dieser „Absolutheit“ leitet sich eine Machtstellung ab, die das eigene Geschlecht<br />
(männlich) als Norm betrachtet und das andere Geschlecht (weiblich) dazu immer in<br />
Bezug setzt.<br />
Der Mann ist sich dieser dominanten Stellung nicht extra bewusst. Sie ist für ihn<br />
selbstverständlich und bildet die Norm. Die Frau ist sich aufgrund ihrer<br />
„Andersartigkeit“ ihres Geschlechts stets bewusst und muss dieses in jeder Situation<br />
mitdenken. Maßstab dieses Anders-Sein ist immer der Mann (vgl. Simmel 1983, 53).<br />
Simmel verglich bereits 1923 das Geschlechterverhältnis mit dem Verhältnis<br />
zwischen Herrn und Sklaven. Während der Herr seine Privilegien als<br />
selbstverständlich sieht, denkt der Sklave seine Position immer mit.<br />
Simmel geht weiter, indem ein fehlendes Geschlechterbewusstsein im<br />
Geschlechterverhältnis, die als selbstverständlich angenommene Überlegenheit des<br />
Mannes ihm die Macht gibt, sich als das „allgemein Menschliche“ zu definieren:<br />
„Daß das männliche Geschlecht nicht einfach dem weiblichen relativ<br />
überlegen ist, sondern zum Allgemein-Menschlichen wird, das die<br />
Erscheinungen des einzelnen Männlichen und des einzelnen Weiblichen<br />
gleichmäßig normiert(…).“ 11<br />
Die Philosophin und Schriftstellerin Simone de Beauvoir begründet 1949 in ihrem<br />
Werk Le Deuxieme Sex (übersetzt: „Das andere Geschlecht“) die Ungleichheit der<br />
Geschlechter ähnlich wie Simmel. Die Frau wird fortwährend auf ihre Andersartigkeit<br />
festgelegt und somit ihre Unfreiheit produziert. Ihr Satz: „Man kommt nicht als Frau<br />
zur Welt, man wird es“ wendet sich gegen jede biologische Begründung des „Anders-<br />
Sein“ (vgl. de Beauvoir, Simone 2000).<br />
11<br />
Simmel, Georg (1911): Das Relative und Absolute im Geschlechterverhältnis. In: Doyé, Sabine/Heinz,<br />
Marion/Kuster, Friederile (Hg.): Philosophische Geschlechtertheorien. Ausgewählte Texte von der Antike bis zur<br />
Gegenwart, Stuttgart 2002, 324-348, zit. nach den privaten Vorlesungungsunterlagen von Prof. Gesine Spieß für<br />
das Modul „Lebens- und Arbeitskontexte im sozialen Wandel“, 28.03-01.04.2007, Masterlehrgang RMC Wien.<br />
28
Dieses fehlende Geschlechterbewusstsein bezeichnen die Soziologen Michael<br />
Meuser und Rüdiger Lautmann (1998) auch als „Geschlechterblindheit“ und stellen in<br />
einer von ihnen durchgeführten empirischen Studie fest:<br />
„Die Geschlechterblindheit macht den Mann einerseits zum Menschen,<br />
andererseits zum Individuum. Damit ist er nur noch in einem übergeordnetem,<br />
allgemeinen Sinne Gattungswesen: als Mensch“ (Meuser/Lautmann 1998,<br />
257).<br />
Die formale Einführung einer Vielzahl von Förder-Maßnahmen in Organisationen mit<br />
dem Ziel der Chancengleichheit und Geschlechtergleichstellung führt, wie oben<br />
bereits erwähnt, zu der Einschätzung bzw. subjektiven Wahrnehmung, dass die<br />
Männlichkeit als Norm von der Gleichheit als Norm abgelöst wird und sich<br />
hierarchisch aufgebaute Geschlechterverhältnisse in Organisationen zunehmend von<br />
innen her auflösen (vgl. Hark 2005, 22).<br />
Die Organisationskultur und die darin enthaltene Arbeitskultur der Mitglieder dieser<br />
Organisation ist ein Abbild der gesamtgesellschaftlichen Kultur. Ist diese männlich<br />
dominiert, wird die Organisation eine männerbündische Arbeitskultur reproduzieren<br />
bzw. widerspiegeln.<br />
Hyöng/Lange (2004) unterscheiden verschiedene Typen von Arbeitskulturen:<br />
eine traditionell patriarchale, eine lebensvolle und eine männerbündische<br />
Arbeitskultur.<br />
Eva Kreisky (1994) bezeichnet die gegenwärtige dominante Kultur als<br />
männerbündische Arbeitskultur, in Betrachtung der hierarchischen Struktur der<br />
Universität.<br />
Die statische geschlechtsspezifische Segregation im Wissenschaftsbereich und in<br />
den Führungsetagen der Administration der Universitäten spricht dazu eine deutliche<br />
Sprache.<br />
Wesentliche Merkmale einer männerbündischen Arbeitskultur fassen Hyöng/Lange<br />
(2004) zusammen:<br />
29
• Unausgesprochene Spielregeln<br />
Diese finden sich in den meisten Führungsetagen von Unternehmen. Sie<br />
bestimmen das angemessene Verhalten in bestimmten Situationen. Nur<br />
diejenigen, die die Spielregeln kennen werden akzeptiert.<br />
• Prüfungen und stufenweise Einweihung<br />
Durch immer wieder aufs Neue bewiesenen Loyalität und Hingabe kann man<br />
Schritt für Schritt in dieses informelle Informationssystem einbezogen werden.<br />
• Zugehörigkeit und Ausgrenzung<br />
Beweisen, dass man in den “inneren Kreis“ durch Anpassung und Loyalität<br />
passt.<br />
• Beruf als Lebenstraum<br />
Der Beruf wird zum Mittelpunkt des Lebens. Berufliche Netzwerke sind auch<br />
persönlicher Halt. Personen, die ihre Zeit nicht unbegrenzt zur Verfügung<br />
stellen, werden ausgegrenzt.<br />
• Geschlossenheit, Erfolg und glänzende Darstellung<br />
Ein starker Zusammenhalt folgt durch diese informellen Mechanismen. Diese<br />
„Freundschaften“ werden durch Rituale erhalten. Funktionierende<br />
männerbündische Gruppen geben nach außen ein geschlossenes Bild ab und<br />
prägen die Inhalte nach innen. Sie prägen die Arbeitskultur (vgl. Höyng/Lang<br />
2005, 107).<br />
3.1 Wissenschaftskultur<br />
Wissenschaft ist nach Jürgen Mittelstraß (1997) nicht nur eine Form der<br />
Wissensbildung, sondern auch eine gesellschaftliche Veranstaltung (Mittelstrass,<br />
1997).<br />
Der Wissenschaftsbereich, die Wissenschaftskultur ist ein Abbild der<br />
gesamtgesellschaftlichen Kultur und reproduziert die gleichen Verhaltensweisen.<br />
30
Die Betrachtung der Wissenschaft als gesellschaftliche Veranstaltung skizziert einen<br />
Wandel in der Betrachtung der Wissenschaft auf sich selbst, eine neue<br />
Wissenschaftsforschung, die davon ausgeht, dass wissenschaftliche Erkenntnis nicht<br />
mehr nur aus der Untersuchung eines Gegenstand gewonnen werden kann, sondern<br />
wissenschaftliche Erkenntnis vielmehr ein sozialer Prozess ist, in dem nicht nur<br />
theoretische Vorannahmen, sondern auch der jeweilige soziale Kontext der scientific<br />
community mit einzubeziehen ist (vgl. Krais 2000, 32).<br />
Wissenschaft besteht also aus einer epistemischen Sphäre der Erkenntnis,<br />
Denkmuster, Problemlösungsstrategien, Methodik u.a.m. und einer sozialen Sphäre,<br />
in der Menschen arbeitsteilig Wissen produzieren. Die in die soziale Sphäre<br />
eingebettete Hierarchie, Sitten und Gebräuche, Ideologien und Denkmuster, in der<br />
diese Wissensproduktion stattfindet, prägen die jeweilige scientific community.<br />
Die Strukturen der alltäglichen wissenschaftlichen Praxis im universitären<br />
Wissenschaftsbetrieb werden in hohem Maß als geschlechterblind bezeichnet. Eine<br />
Vielzahl von Begriffen, u.a. „akademisches Frauensterben“, die „leaky pipeline“, die<br />
„gläserne Decke“ der „Glasdeckenindex“, bezeichnen alle dasselbe Phänomen: die<br />
Geschlechtersegregation in der Wissensproduktion, ist in den Strukturen fest<br />
verankert, dennoch unsichtbar bzw. schwer festzumachen.<br />
Krais (2000) erscheint die Art wie Wissenschaft gemacht wird, der soziale Kontext in<br />
der die Wissensproduktion passiert, den AkteurInnen in hohem Maß als<br />
selbstverständlich und als müsse Wissenschaft auf diese Art und Weise<br />
funktionieren, wie sie eben funktioniert. Organisationsform, Hierarchie,<br />
Interaktionsmuster und Zeitstrukturen erscheinen als natürlich und gegeben und in<br />
der Sache der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnis, begründet (vgl. Krais 2000,<br />
34). Unter der Oberfläche ist die Geschlechterordnung in der sozialen Sphäre<br />
eingelagert und schwieriger zu erkennen, in die Strukturen der epistemischen<br />
Sphäre.<br />
31
3.2 Wissenschaft als soziales Feld<br />
Bei der Untersuchung der sozialen Sphäre der Wissenschaft ist es hilfreich, auf das<br />
von Pierre Bourdieu entwickelte soziale Konstrukt des sozialen Feldes als<br />
„Erkenntniswerkzeug“ zurückzugreifen. Der Wissenschaftsbereich wird dabei als<br />
sozialer Kosmos mit eigenen Funktionslogiken betrachtet.<br />
Die Herangehensweise von Pierre Bourdieu erfolgt über die Untersuchung der<br />
sozialen Praxis von AkteurInnen. Die AkteurInnen konstruieren ihre Realitäten in<br />
unterschiedlichen sozialen Feldern und sind in ihrem jeweiligen Gefüge kreativ und<br />
erfinderisch. Dieser Kreativität ist mit klassischen Untersuchungs- und<br />
Klassifikationsrastern nicht beizukommen und bricht Bourdieu mit der klassischen<br />
klassifikatorischen dualistischen Denkweise. Er entwickelt Erkenntnis- und<br />
Denkwerkzeuge wie das Habitus-Konzept, die Theorie der sozialen Felder sowie die<br />
Konstruktion des sozialen Raumes.<br />
In der deutschsprachigen Frauen- und Geschlechterforschung wird immer wieder auf<br />
die Konzepte von Bourdieu zurückgegriffen, um sie zur Analyse von Dominanz- und<br />
Herrschaftsverhältnissen zu nutzen. Auch wird ihm als Forscher grundsätzlich keine<br />
Geschlechterblindheit vorgeworfen (vgl. Engler 2003, 233).<br />
Das Konzept des sozialen Feldes nimmt dabei nicht nur den eigenen Arbeits- oder<br />
Wirkungsbereich in einer Organisation (z.B. Universität) in den Blick, sondern dehnt<br />
die Analyse auf die im Fall der Wissenschaft als sozialem Feld, auf die gesamte<br />
scientifc community aus. Das soziale Feld Wissenschaft ist demnach ein sehr<br />
differenziertes Feld, differenziert nach Fächern, die jeweils nach ihren eigenen<br />
inneren Logiken und Methoden funktionieren.<br />
Ausgangspunkt des Konzeptes vom sozialen Feld ist, dass die Entwicklung von<br />
Produkten bzw. Objekten, im Fall der Wissenschaft als sozialem Feld<br />
wissenschaftliche Erkenntnisse, einerseits einer eigenen inneren Logik folgen,<br />
andererseits an soziale Strukturen angebunden sind. In seinem Konzept geht es<br />
Bourdieu um das Zusammenwirken von Subjekt und Organisation. Keine<br />
Organisation, kein Zusammenschluss wirkt allein auf der Grundlage der inneren<br />
Logik, sondern um wirksam zu sein, wird sie in ihren Subjekten über den Habitus<br />
verkörpert (vgl. Krais 2000, 36).<br />
32
Über den Habitus schreibt Bourdieu (1980) in seinem Sens pratique, er ist es, der es<br />
erlaubt, „die Institutionen zu bewohnen, sie sich praktisch anzueignen, und sie<br />
dadurch in Aktion, am Leben, bei Kräften zu erhalten, sie beständig dem Zustand<br />
toter Buchstaben, toter Sprache zu entreißen, den in ihnen abgelegten Sinn wieder<br />
mit Leben zu erfüllen, aber nur, indem er ihnen Veränderungen und Umwandlungen<br />
aufzwingt, die das Gegenstück und die Bedingung ihrer Reaktivierung sind“<br />
(vgl. Krais 2000 nach Bourdieu 1980, 96; Übersetzung Krais).<br />
Zur Erklärung seines Konzeptes bedient sich Bourdieu der Metapher eines „Spiels“.<br />
Ein soziales Feld ist demnach ein „Spielfeld“, eine Arena in der die SpielerInnen und<br />
AkteurInnen um ihre Vorrangstellung kämpfen. Es geht immer um Macht und<br />
Einfluss. Jede/r Akteur/in im Spiel muss den Glauben an das Feld haben, die „illusio“,<br />
als Vorbedingung für das Mitspiel (vgl. Krais 2000, 39 nach Bourdieu, 1980). Die<br />
AkteurInnen müssen sich für das Spiel qualifizieren und mit dem Spiel identifizieren<br />
und sich einen Habitus aneignen, der das „Mitspielen“ erlaubt, die Regeln bestimmen<br />
zunächst die etablierten SpielerInnen.<br />
Dabei hängt die Entwicklung des Habitus von den Investitionen ab, die im Spiel<br />
getätigt werden. Im Fall der Wissenschaft als „Spielfeld“ wären die Investitionen in<br />
Form von Zeit, Energie, Arbeit usw. zu tätigen. Das Spiel erfordert vollen Einsatz, der<br />
Einsatz ist die soziale Existenz der Individuen.<br />
Das soziale Feld wird geprägt oder verändert durch ihre AkteurInnen und deren<br />
Relationen untereinander. Bei Veränderung des „Spielerstandes“ verändern sich<br />
auch die Positionen der AkteurInnen.<br />
Die Anerkennung wissenschaftlicher Leistung ist verknüpft mit der Anerkennung der<br />
Person, die durch ihre Verhaltensweisen, dem Habitus, geprägt wird und der in die<br />
Beurteilung und Bewertung von den erbrachten Leistungen herangezogen wird (vgl.<br />
Krais 2000, 41).<br />
Der Habitus ist Ausdruck einer in den Körper eingeschriebenen Geschichte und<br />
Ursache für die daraus entstehenden Praktiken.<br />
Für die notwendigen Investitionen zur Entwicklung des Habitus für das Bestehen und<br />
Anerkennen im sozialen Feld der Wissenschaft, sehen Krais und Beaufays (2005) in<br />
ihrer Analyse über die verborgenen Mechanismen der Macht, in Anlehnung an<br />
Bourdieu, vier Aspekte, die nach ihren empirischen Untersuchungen von Bedeutung<br />
sind:<br />
33
• Wissenschaft als Lebensform<br />
Angehende WissenschafterInnen müssen einen Habitus entwickeln, der glaubhaft<br />
vermittelt, dass ihnen Wissenschaft der wichtigste Lebensinhalt ist und zum<br />
Lebensmittelpunkt wird. Die Vermittlung passiert in erster Linie durch die<br />
Investition Zeit. Krais und Beaufays beschreiben die Schilderungen ihrer<br />
InterviewpartnerInnen so:<br />
„Sich am Wochenende oder bis zehn Uhr abends im Labor zu zeigen, sich am<br />
Freitagnachmittag oder –abend zu Meetings zu verabreden und nach dem<br />
Meeting noch Geselligkeit mit anderen WissenschaftlerInnen und damit<br />
wichtige Netzwerke in der Kneipe zu pflegen, dies alles sind in erster Linie<br />
symbolische Praktiken, denen sich zu unterwerfen hat, wer dazugehören<br />
möchte. […]<br />
Diese von den Interviewpartnerinnen geschilderten ,symbolischen Praktiken<br />
lassen erkennen, dass nicht allein die Bearbeitung eines Problems, sondern<br />
vor allem die damit einhergehende – durchaus auch körperliche –<br />
Unterwerfung unter den Rhythmus der Forschung erst den Wissenschaftler<br />
ausmacht.[…] Die „Auserwählten“, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit<br />
wissenschaftlichen Ambitionen, zeichnen sich durch ihre Bereitschaft aus, ihr<br />
Leben in den „Dienst der Sache“ zu stellen“ (vgl. Krais/Beaufays 2003, 36).<br />
Das Konzept der wissenschaftlichen Leistung<br />
Durch erfolgreiche wissenschaftliche Leistung wird man zum/zur Wissenschafter/in.<br />
Sie gilt als Eintrittskarte in die scientific community. Erst die Anerkennung durch die<br />
KollegInnen bringt den Erfolg. Ganz oben angelangt, müssen für diese Leistungen,<br />
ein hohes Frustrationspotenzial, Ausdauer Belastbarkeit, Leistungs- und<br />
Einsatzwilligkeit an Investitionen erbracht werden.<br />
Anerkennung und Missachtung in der unmittelbaren Interaktion<br />
Interaktionen spielen sich nicht nur zwischen den unmittelbaren Beteiligten ab. Sie<br />
vermitteln ein Bild an Dritte, Zuschauer, Beobachter, dem Umfeld, das erkennen<br />
kann, welche Regeln in diesem Interaktionsfeld herrschen, wie der hierarchische<br />
Ablauf ist, wer Regeln setzen, wer sie verletzen kann. Auf dieser Interaktionsebene<br />
kommen verborgene Mechanismen, symbolische Akte der Anerkennung und Gewalt,<br />
zum Einsatz.<br />
34
Die Rolle der wissenschaftlichen MentorInnen<br />
Eine wissenschaftliche Karriere, der Weg zu einer anerkannten Position ist lang und<br />
erfordert die Unterstützung eines Mentors 12 . Die Formen dieser Beziehungen sind<br />
unterschiedlich, als Basis wird zwischen Förderer und Geförderten eine gewisse<br />
Gleichgestimmtheit, eine gemeinsame Wellenlänge, im Selbstverständnis als<br />
Wissenschafter angenommen.<br />
Diese kaum in Frage gestellten Strukturen und Mechanismen im sozialen Feld der<br />
Wissenschaft sind in hohem Maß vergeschlechtlicht. Wie in jeder Organisation liegt<br />
dem Wissenschaftsbetrieb eine Geschlechterordnung zugrunde.<br />
Die Kernfrage beschäftigt sich mit den vergeschlechtlichten Mechanismen im<br />
wissenschaftlichen Feld, wie die Anerkennung von Leistung konstruiert wird, dass es<br />
nach wie vor möglich ist, Frauen den Zugang zu diesem Feld zu erschweren.<br />
Wissenschaft als Lebensform und Lebensmittelpunkt ist demnach wenig vereinbar<br />
mit einem „weiblichen Lebensmuster“. Auch wenn es kein explizites Modell einer<br />
weiblichen Normalbiographie gibt, wird doch immer wieder unterstellt, dass weibliche<br />
Lebensmuster mit den Verhältnissen im Wissenschaftsbetrieb nicht kompatibel sind.<br />
Hagemann-White/Schultz fassen diese Unterschiede wie folgt zusammen:<br />
„Der Werdegang des männlichen Hochschullehrers kann als berufliche<br />
Sozialisation bestimmt und als Fortsetzung der typisch männlichen<br />
Sozialisation in der Kindheit und Jugend gesehen werden: der Werdegang der<br />
Frau an der Hochschule wird hingegen als ein Prozess der Akkulturation zu<br />
bestimmen sein und steht vielfach im Widerspruch zu der<br />
geschlechtstypischen Sozialisation in Kindheit und Jugend“<br />
(Hagemann-White/Schultz 1986, 101).<br />
Die „Schuld“ an der statischen Situation von Unterrepräsentation der Frauen in der<br />
Wissenschaft wird vor allem bei den Frauen selbst gesucht. Erklärungen für dieses<br />
„Unvermögen“ sind in ihren Sozialisationsprozessen, biographischen Verläufen, ihrer<br />
Identitätsentwicklung und Konfliktbewältigung und als eine Hauptursache, der<br />
Umgang mit der Problematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu finden. Die<br />
12<br />
Die männliche Form ist hier beabsichtigt.<br />
35
Gründe für die Unterrepräsentanz, die Ausschlussmechanismen werden vor allem<br />
außerhalb der Universitäten vermutet und gesucht.<br />
Die Organisations- inklusive Zeitstrukturen im sozialen Feld der Wissenschaft werden<br />
dabei selten in Frage gestellt.<br />
Ein dominantes Leistungsmerkmal für die Aufnahme in die scientific community und<br />
wissenschaftliche Reputation zu erlangen, ist die Anzahl der Publikationen. Etablierte<br />
WissenschafterInnen (Fach-Peers) entscheiden über die Qualität des Outputs und<br />
entscheiden über die weitere Förderung und Unterstützung der zukünftigen<br />
wissenschaftlichen Karriere.<br />
Krais (2001) bezeichnet die wissenschaftliche Produktivität gemessen an der Zahl<br />
der Veröffentlichungen und an der Häufigkeit des Zitiert Werdens, als den „zentralen<br />
Aspekt der Universalisierung männlicher Lebensmuster“. Dass Frauen im<br />
Durchschnitt seltener als Männer der Gruppe der Wissenschafter mit<br />
überdurchschnittlicher Publikationstätigkeit angehören, ist schon relativ früh in<br />
amerikanischen Untersuchungen gezeigt worden 13 . Woran dies liegt, ist nach wie vor<br />
strittig (vgl. Krais 2001, 20).<br />
Die „besondere Hingabe“ der Person, die die wissenschaftliche Forschung verlangt,<br />
ist für Frauen mit familiären Verpflichtungen weniger möglich als für Männer, lautet<br />
der Grundtenor der von Wissenschaftern und Wissenschafterinnen gleichermaßen<br />
vertreten wird (vgl. Krais 2001, 21).<br />
Aus den Untersuchungen von Krais/Beaufays (2003) zu ihrem Konzept der<br />
wissenschaftlichen Leistung geht hervor, dass ein wesentliches Misstrauen<br />
gegenüber Frauen besteht, der Herausforderung einer wissenschaftlichen Karriere<br />
überhaupt gewachsen zu sein. Durchhaltevermögen wird mit männlicher Potenz<br />
gleichgesetzt, Frauen mit Kindern ist es aufgrund des Zeitmangels kaum mehr<br />
möglich Wissenschaft zu leisten (vgl. Krais/Beaufays 2003, 38).<br />
Diese Einschätzung wird höchst kontrovers diskutiert und gehört sicher zu den<br />
zentralen Aspekten der Diskussion um die hartnäckige Unterrepräsentanz der<br />
Frauen in der oberen „Liga“ der Wissenschaft.<br />
Bei den „Fach-Peers“, welche die Qualität der Forschung beurteilen, dominieren<br />
männliche Experten, die auf ihre Netzwerke und Seilschaften zurückgreifen können,<br />
13<br />
Krais führt aus der amerikanischen Debatte eine Untersuchung J.R. Cole/ St. Cole, 1973 an, in der eine<br />
geringere Produktivität der Frauen festgestellt wurde. Bochow/Joas haben dies 1987 für den akademischen<br />
Mittelbau in der BRD bestätigt.<br />
36
welche durch Insiderwissen, informelle Regeln und Kommunikationsstrukturen<br />
entsprechend verankert sind.<br />
Dazu kommt, dass Frauen laut Neusel 1998/Buchinger 2002/Pellert 2002 oft in<br />
Forschungsbereichen arbeiten, die abseits vom Mainstream liegen (z.B. Frauen- und<br />
Geschlechterforschung) und ein größeres Engagement in den Bereichen Lehre und<br />
Administration zeigen, die aber zur Reputation wenig beitragen (vgl.<br />
Wirkungsanalyse frauenfördernder Maßnahmen im bm:bwk 2007, 48).<br />
Das erwähnte „größere Engagement“ in der Administration liegt m.E. ebenfalls in<br />
einem historisch männlich geprägten Grundverständnis von Arbeitsteilung, der<br />
Zuständigkeit von Frauen und höheren Erwartungen an die Frauen bei<br />
administrativen Tätigkeiten.<br />
3.3 Die Vereinbarkeitsproblematik<br />
Eine Untersuchung von Lydia Buchholz (2004) durchgeführt 2002/2003 unter<br />
ProfessorInnen an Österreichs Universitäten im Rahmen des EU-Projektes<br />
„Research and Training Network (RTN) Women in European Universities“ zeigt<br />
insbesondere Differenzen bei der Verteilung der Reproduktionsaufgaben sowie in der<br />
Analyse der Stellung von Frauen in Wissenschaft und Gesellschaft.<br />
Die Ergebnisse haben die vielfachen geschlechtsspezifischen Unterschiede<br />
innerhalb dieser Berufsgruppe bestätigt. So sind fast alle männlichen befragten<br />
Professoren verheiratet, während die Professorinnen wesentlich häufiger<br />
Trennungen hinter sich haben. Von den männlichen Befragten haben mehr als drei<br />
Viertel Kinder, während nur ca. die Hälfte der Professorinnen Kinder haben.<br />
Zur Frage der Vereinbarkeitsthematik lässt sich zusammenfassen, dass die<br />
Professorinnen zu einem größeren Teil für die Reproduktionsaufgaben zuständig<br />
sind. Auffallend dabei ist, dass ledige Frauen und Frauen ohne Kinder es eher für<br />
problematisch halten, Arbeit und Familie zu vereinbaren, während Professorinnen mit<br />
Kindern und/oder Partner eher eine Vereinbarkeit sehen. Da die Realität aber ein<br />
anderes Bild zeigt, vermutet die Autorin, dass es durchaus möglich ist, dass die<br />
Akademikerinnen sich bewusst gegen eine Partnerschaft und eigene Kinder<br />
entscheiden, da sie eine zu große Belastung für die eigene akademische Karriere<br />
sehen.<br />
37
Für Professoren ist die Situation eine andere. Sie verspüren weniger Konflikte als<br />
ihre Kolleginnen und sind nicht mit mehr Problemen konfrontiert, die aus<br />
Lebensgemeinschaft und Kinder entstehen können.<br />
Die Annahme, dass die Vereinbarkeitsproblematik für Wissenschafterinnen<br />
bedeutender ist als für Wissenschafter hat sich bestätigt. Sie bleibt somit ein<br />
entscheidender Aspekt in der Erklärung der Persistenz der Unterrepräsentation der<br />
Frauen.<br />
Interessant ist, dass Professoren die Situation von Frauen in der Wissenschaft<br />
weniger dramatisch einschätzen, als ihre Kolleginnen. Obwohl die Professoren die<br />
Schwierigkeiten der Kolleginnen durchaus erkennen, schätzen sie diese positiver ein.<br />
Bewerkenswert ist auch, dass die männlichen Kollegen in der Untersuchung die<br />
Schwierigkeiten nicht in den Frauen selbst oder ihrer Sozialisation (siehe oben)<br />
sehen, sondern diese durchaus in den strukturellen und informellen Bedingungen<br />
des Wissenschaftsbetriebes begründet sehen. Trotz dieses Erkennens treten sie<br />
allerdings zum Großteil nicht für die Veränderung des Systems ein. Generell<br />
vertreten die Professoren eine progressive Haltung und befürworten die<br />
Erwerbstätigkeit von Frauen und auch den Einsatz von Gleichstellungsmaßnahmen.<br />
Wenn es aber um Fragen geht, die Veränderungen des Familienlebens und der<br />
Rollenverteilung betreffen, reagieren sie mit ablehnender Haltung.<br />
Hier spielen deutlich die Befürchtungen hinein, durch Erwerbstätigkeit der<br />
Partnerinnen in der eigenen beruflichen Verwirklichung eingeschränkt zu werden.<br />
Die Diskrepanz zwischen Befürwortung der Erwerbsfähigkeit der Frauen und<br />
geringer Beteiligung an Haus- und Erziehungsarbeit (damit verbunden auch kaum<br />
Unterbrechungen der Karriere durch Kindererziehungszeiten) bewirkt, dass<br />
Professoren auch weiterhin nicht von der Vereinbarkeitsproblematik betroffen sind,<br />
während Professorinnen und alle erwerbstätigen Frauen mit Mehrfachbelastungen<br />
umgehen müssen (vgl. Buchholz 2004, 88).<br />
Der Widerspruch zwischen Einstellung und Aussagen und dem Verhalten von<br />
Wissenschaftern kann als Indiz für subtile Barrieren und verborgende Mechanismen<br />
der männlichen Dominanz in der Wissenschaft und im Wissenschaftsbetrieb gewertet<br />
werden.<br />
38
Bei der Frage nach Barrieren im sozialen Feld der Wissenschaft, in der scientific<br />
community, beschreibt Krais (2001) das interessante Phänomen des<br />
„Diskriminierungs-Paradox“. Demnach werden Barrieren, Diskriminierungen und<br />
mangelnde Förderung im Wissenschaftsbetrieb subjektiv nicht als Diskriminierung<br />
empfunden. Übereinstimmend wird in Untersuchungen, die sich mit<br />
Diskriminierungserfahrungen von Frauen beschäftigen, berichtet, dass<br />
Wissenschafterinnen, auf die Frage nach Diskriminierungserfahrungen aufgrund<br />
ihres Geschlechts, angeben, davon nicht betroffen zu sein. Die gleichen Frauen<br />
berichten aber von einer großen Anzahl von Blockierungen, mehr oder weniger<br />
subtilen Behinderungen und Ausschlüssen in ihrer Laufbahn. Wesentlich ist auch die<br />
Erfahrung der Frauen, wonach sie von ihren Betreuern (Doktorväter, Vorgesetzte)<br />
weniger gefördert und unterstützt werden als Männer (vgl. Krais 2001, 22).<br />
Wie oben schon erwähnt, werden Diskriminierungserfahrungen der betroffenen<br />
Frauen nicht als strukturell, sondern oftmals in der eigenen Person begründet,<br />
gesehen. Oder – wie die Untersuchung von Buchholz unter den befragten<br />
Professoren zeigt – sehr wohl ungerechte strukturelle und informellen Bedingungen<br />
erkannt werden, aber keine Notwendigkeiten gesehen werden, diese zu verändern.<br />
Die Befürchtung, dass Veränderungen der strukturellen Bedingungen in Richtung<br />
geschlechtergerechte Bedingungen auf Kosten der männlichen Wissenschafter<br />
gehen, schlägt dabei immer wieder durch.<br />
39
3.4 Die Öffnung der Universität für Frauen – ein kurzer Rückblick<br />
„Völlige Gleichberechtigung der Geschlechter auf dem Gebiet der Wissenschaft.<br />
Nicht mehr kann ich fordern, mich mit weniger nicht begnügen.“<br />
Hedwig Dohm, Die wissenschaftliche Emancipation der Frau, 1874<br />
Im Jahr 1897 durfte erstmals eine Frau als Studentin die Universität Wien betreten.<br />
1907 wurden Frauen als Assistentinnen zugelassen und 1956 gab es in Wien die<br />
erste weibliche Berufung. Die Geschichte der Universität (Wien wurde im Jahr 1365<br />
gegründet) und der Wissenschaft ist geprägt vom Ausschluss der Frauen.<br />
Bemerkenswert für die Entwicklungsgeschichte der Universität und der Wissenschaft<br />
ist, dass der Grundstein als Männerbund bereits im Mittelalter gelegt wurde und<br />
Wissenschaft und Hochschullehre eine rein männliches Berufsprivileg war. Marianne<br />
Friese (2003) sieht den Ausschluss des weiblichen Geschlechts im „philosophischtheologischen<br />
Frauenbild der zeitgenössischen Scholastik und der zeitlich vom<br />
Beginn des Humanismus bis zur Aufklärung reichenden Debatte um die Stellung der<br />
Frau“, begründet (Friese 2003, 10).<br />
Die im 19. Jahrhundert wieder aufgeflammte Debatte um die Teilhabe von Frauen an<br />
wissenschaftlicher Theorie und Praxis wird im Kontext der Entstehung der Ersten<br />
Frauenbewegung gesehen. Die Forderung der Ersten Frauenbewegung nach<br />
Bildungsmöglichkeiten für Frauen führt letztendlich zu einer späten Zulassung der<br />
Frauen zum akademischen Studium um die Jahrhundertwende.<br />
Die weitere Entwicklung der Wissenschaftsgeschichte der Frau ist trotz<br />
zahlenmäßiger Aufholjagd geprägt von Beschränkungen und begrenzten<br />
Möglichkeiten, bis zu offenem Widerstand gegen ihre wissenschaftliche<br />
Qualifizierung.<br />
Eine erwähnenswerte Ausnahme nach Öffnung der Universitäten für Frauen ist die<br />
institutionelle Verankerung des „Vereins für Sozialpolitik“. Der Verein gegründet<br />
1906 von Alfred und Max Weber, ermöglicht Wissenschafterinnen eigene<br />
Forschungen durchzuführen. Es entsteht eine Fülle von Studien von<br />
Wissenschafterinnen zur Lage von Arbeiterinnen, Hausfrauen, Dienstboten,<br />
Heimarbeiterinnen und Prostituierten. In der Regel erhalten Akademikerinnen aber<br />
kaum Chancen zur Profilierung und Etablierung im wissenschaftlichen Bereich (vgl.<br />
Friese 2003, 10).<br />
40
Wissenschaftliche Mentoren waren für Frauen, die ein Studium ergreifen wollten,<br />
unabdingbar. Ohne Unterstützung und Empfehlung wären Frauen nicht zum Studium<br />
zugelassen worden, noch hätten sie nach Abschluss des Studiums Möglichkeiten für<br />
eigene Forschungstätigkeiten gehabt. Sie führten das Etikett einer „Ausnahmefrau“ 14 .<br />
„Berühmte Wissenschafterinnen, die zu den Pionierinnen und<br />
Ausnahmefrauen ihrer Zeit gehörten, waren auf Gedeih und Verderb auf das<br />
Wohlwollen und die Unterstützung von Mentoren angewiesen“<br />
(Brandner 2005, 20).<br />
Der Frauenanteil der Studierenden nimmt ab dem 20. Jahrhundert kontinuierlich zu.<br />
Verstärkte Restriktionen gegen weibliche Studierende gibt es wiederum während des<br />
Ständestaates, der eine Debatte um eine 10prozentige Beschränkung des<br />
Frauenanteils unter den Studierenden führt.<br />
Das Dritte Reich fügt durch seine Vertreibungs- und Ermordungspolitik von jüdischen<br />
und politisch nicht opportunen Intellektuellen der Universität immensen Schaden zu,<br />
in Wien werden 54% der Professoren vertrieben.<br />
Die Vertreibung von jüdischen Akademikerinnen und dem weitgehenden Ausschluss<br />
von Frauen aus der Wissenschaft hinterlässt einen tiefen Riss in der Geschichte der<br />
Universität und Wissenschaft. Die emigrierten Frauen kehren nach Kriegsende nicht<br />
mehr an die österreichischen Universitäten zurück.<br />
Die gesellschaftliche Stellung der Universität ist nach dem Krieg eine marginale. Nur<br />
wenige Universitätsangestellte sind politisch unbelastet. Die Nachkriegszeit ist weiter<br />
geprägt vom Ausschluss der Frauen in der Wissenschaft. Bis zur Bildungsoffensive<br />
in den 1970er Jahren werden nur wenige Wissenschafterinnen an den Universitäten<br />
zugelassen.<br />
Im Jahr 1955 markiert eine Gesetzesnovelle, die eine einheitliche Verwaltung aller<br />
Universitäten ermöglicht, den Beginn einer Reihe gesetzlicher Änderungen, die das<br />
Hochschul-Organisationsgesetz betreffen. Die Studierendenzahlen steigen in den<br />
1950er und 1960er Jahren kontinuierlich an, personelle und materielle Ressourcen<br />
sind aber völlig unzureichend. Die 1960er und 1970er Jahre sind die „goldenen“<br />
14<br />
Berühmtes Beispiel in der ersten Hälfte des 20. Jhdts ist die Atomphysikerin Lise Meitner und ihr Mentor<br />
Max Planck. Für Max Planck war Lise Meitner „die Ausnahmefrau“, da er grundsätzlich gegen Frauen in der<br />
Wissenschaft war. Von ihm stammt auch der Satz „Amazonen sind auch auf geistigem Gebiet naturwidrig“ (vgl.<br />
Brandner 2005, 20).<br />
41
Jahre der Bildungsoffensive der Politik, mit dem Ziel, den Bildungsstand der<br />
Bevölkerung anzuheben. Die Reorganisation der Universität folgt im UOG 1975.<br />
Diese Reform beinhaltet Maßnahmen zur Einbeziehung der UniversitätslehrerInnen,<br />
Studierenden und des Verwaltungspersonals in Entscheidungen der Kollegialorgane.<br />
Jahrelange Forderungen der StudentInnenbewegung nach Reformen,<br />
Mitbestimmung und besseren Arbeitsbedingungen wird hier Rechnung getragen. Die<br />
Vergrößerung der Kollegialorgane die dadurch notwendig wird, führt aber auch zu<br />
heftiger Kritik an der Effizienz der Universitäten.<br />
3.4.1 Wichtige Reformschritte auf dem Weg Gleichbehandlung<br />
1975 im Internationalen Jahr der Frau gibt es erste Initiativen zur Verbesserung der<br />
rechtlichen Situation in Richtung Gleichbehandlung von Mann und Frau. Folge davon<br />
ist 1979 das erste Gleichbehandlungsgesetz für die Privatwirtschaft, das vor allem<br />
auf die massive Lohnungleichbehandlung bei der Festsetzung der Gehälter abzielt.<br />
Der Bildungsbereich, der im öffentlichen Dienst angesiedelt ist, besitzt weiterhin kein<br />
Gleichbehandlungsgesetz mit der Begründung, Ungleichbehandlung in der<br />
Lohngestaltung sei im öffentlichen Dienst von vornherein ausgeschlossen. Allerdings<br />
ist damals der Umstand nicht wegzuleugnen, dass Frauen im öffentlichen Dienst<br />
niedrig qualifiziertere Arbeiten erledigen, die eine geringere Entlohnung mit sich<br />
bringen.<br />
An den Universitäten bilden sich in den 1980er Jahren vielfältige Initiativen von<br />
Seiten der StudentInnen aber auch von Gruppen weiblicher Universitätsangehöriger<br />
im Kontext der Frauenbewegung, die gegen den vorherrschenden male bias in den<br />
Arbeitssituationen und Studieninhalten auftreten. Hintergrund ist der stetig steigende<br />
Anteil weiblicher Studentinnen und Absolventinnen, bei gleichzeitiger Stagnierung<br />
des weiblichen wissenschaftlichen Anteils des Universitätspersonals. Das Argument<br />
eines historisch bedingt und zeitlich begrenzten Qualitätsrückstandes der Frauen,<br />
aufgrund der Tradition des Ausschlusses von der Universität, ist immer schwieriger<br />
zu halten. Folge dieser Zeit in den 1980er und 1990er Jahren ist die Schaffung der<br />
Grundlagen für Frauenforschung und Frauenförderung (vgl. Seiser 2003, 20).<br />
42
Die Verrechtlichung der Gleichbehandlung und Frauenförderung umfasst mittlerweile<br />
einen Zeitraum von beinahe 20 Jahren. Im Jahr 1990 im Zuge einer Novelle des<br />
Universitäts-Organisations-Gesetzes 1975 (UOG 75) wird eine Bestimmung zur<br />
Einrichtung der Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen eingefügt, dessen<br />
Aufgaben im Entgegenwirken von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts durch<br />
Kollegialorgane der Universität, ist. Als rechtliches Mittel steht dem Arbeitskreis die<br />
Aufsichtsbeschwerde an das Ministerium, allerdings ohne aufschiebende Wirkung,<br />
zur Verfügung. Im Universitäts-Organisations-Gesetz 1993 (UOG 93) werden die<br />
Kontrollrechte der Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen verbessert und<br />
ausgeweitet. Kernstück wird ein zweistufiges Verfahren von Einspruch und<br />
Aufsichtsbeschwerde gegen mögliche diskriminierende Beschlüsse.<br />
Ein Bündel an Normen und Regelwerken zur Gleichbehandlung und<br />
Frauenförderung an den Universitäten werden bis zum Universitäts-Gesetz 2002 (UG<br />
02) institutionalisiert. Mit dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz für den öffentlichen<br />
Dienst, das 1993 (14 Jahre nach Einrichtung des Bundes-<br />
Gleichbehandlungsgesetzes für die Privatwirtschaft) installiert wird, wird die Basis für<br />
den ersten Frauenförderungsplan im Wissenschaftsressort im Jahr 1995 geschaffen.<br />
Die Vorschreibung einer qualifikationsabhängigen Frauenquote von 40%<br />
Frauenanteil und Vorrangregeln für Frauen, die Einsetzung von<br />
Gleichbehandlungsorganen sind die zentralen Bestimmungen, die in die<br />
Frauenförderpläne der Universitäten Eingang finden. Dabei ist vor allem die damalige<br />
neue Quotenregelung ein Meilenstein: zum ersten Mal können Frauen bei<br />
Einstellungen und Beförderungen bevorzugt werden.<br />
Die Quotenregelung ist von Anfang an bis heute eine umstrittene Regelung. Dabei<br />
wird gerne vergessen, was die Intention einer leistungsabhängigen Quotenregelung<br />
ist: eine Gleich- oder Besserqualifikation als der bestgeeignetste Mitbewerber. Das<br />
Argument, nur aufgrund des weiblichen Geschlechts vorrangig behandelt zu werden<br />
und Männer bei Personalentscheidungen bewusst zu diskriminieren, wird auch 15<br />
Jahre nach Einführung der Regelung immer wieder strapaziert und bewusst<br />
eingesetzt.<br />
Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Form von Frauenförderungsplänen für die<br />
österreichischen Universitäten treten erstmals 1995 seitens des zuständigen<br />
43
Ministeriums in Kraft. Darüber hinaus können sich die Universitäten eigene<br />
Frauenförderungsbestimmungen geben. Verpflichtend ist die Festlegung auf<br />
Richtlinien für universitätseigene Frauenförderungspläne, die seit dem UOG 1993 ein<br />
Bestandteil der Satzung sind. Vorschläge für die Richtlinien und die darauf<br />
aufbauenden Frauenförderungspläne werden vom Arbeitskreis für<br />
Gleichbehandlungsfragen gemacht. Eine entscheidende Kompetenzerweiterung<br />
passierte unter dem UOG 1993 für den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen:<br />
der Aufgabenbereich wurde auf die gesamten Personalaufnahmeverfahren<br />
ausgedehnt (vgl. Holzleithner 2002, 191ff).<br />
Der Wirkungsbereich der Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen umfasst vor<br />
allem Personalentscheidungen. Durch Einspruch und Beschwerde kann der<br />
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen bei Verdacht einer Diskriminierung<br />
aufgrund des Geschlechts mit aufschiebender Wirkung in ein Personalverfahren<br />
eingreifen. Beschreitet der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen den Weg von<br />
Einspruch und Beschwerde, wird das Verfahren bis zur Entscheidung im Ministerium<br />
ruhend gestellt (vgl. Seiser 2003 17ff, Holzleithner, Benke 2003, 191ff, Holzleithner<br />
2002, 191).<br />
Die im UOG 1993 vorbereiteten Umstrukturierungen finden im Universitäts-Gesetz<br />
2002 (UG 02) ihren Abschluss und leiten einen Paradigmenwechsel in der<br />
Universitätslandschaft ein. Das grundlegende Anliegen des UG 02 liegt in der<br />
gesetzlichen Deregulierung. Das Ziel der dem Gesetz vorangehenden<br />
Reformdebatten liegt in der Kürzung des Umfangs des Universitätsrechts und in der<br />
Privatautonomie im Personalbereich (vgl. Holzleithner 2004, 27).<br />
Durch das UG 02 erhalten die Universitäten ihre Vollrechtsfähigkeit und Autonomie,<br />
ebenso Zielvorgaben und Globalbudgets. Die HochschullehrerInnen werden zu<br />
Angestellten der Universität. Das Management ist dreigliedrig: Universitätsrat<br />
(dessen Mitglieder vom Ministerium und der Universität für einen Zeitraum von 3<br />
Jahren berufen werden), Senat und Rektorat (zuständig für die operative<br />
Geschäftsführung).<br />
Die Reform spiegelt deutlich den Rückzug des Staates aus dem Universitätsbereich<br />
durch Deregulierung und Dezentralisierung wider.<br />
44
Die Universitätsreformen der 1970er Jahre dienen der Öffnung und Demokratisierung<br />
der Universitäten und entstehen u.a. aus einer Vielzahl von StudentInneninitiativen<br />
und Zusammenschlüssen der Frauenbewegungen und –initiativen, die gegen eine<br />
„verstaubte“ Universität auftreten.<br />
Auf die nachfolgende Reform, verrechtlicht im UOG 1993, trifft das Schlagwort<br />
„Managementisierung“ der Universitäten zu. Das UOG 1993 wird in drei Phasen und<br />
stufenweise bis 1999 an den Universitäten implementiert. Die Managementisierung<br />
steht ursächlich mit der Entwicklung der Universität durch Öffnung und<br />
Demokratisierung zur „Massenuniversität und mit der zunehmenden an die Grenzen<br />
stoßenden Finanzierung“ der Universitäten in Zusammenhang. Das UOG 93 wird als<br />
Kompromiss zwischen „Mitbestimmung“ und „Managementisierung“ gehandelt und<br />
leitet die Dezentralisierung (Verlagerung wesentlicher Entscheidungen auf<br />
universitäre Ebene) ein (vgl. Pellert/Welan 1995).<br />
Mit dem UG 02 erfahren die Universitäten, wie bereits vorhin erwähnt, nun einen<br />
grundlegenden Wandel.<br />
Neben dem Erhalt der vollen Rechtsfähigkeit durch institutionelle Autonomie von der<br />
staatlichen Verwaltung haben sich auch die inneruniversitären<br />
Entscheidungsstrukturen grundlegend geändert. Die Universität wird Arbeitgeberin<br />
und erhält ein Globalbudget.<br />
Ada Pellert (2003) beschreibt die neue organisationale Struktur so:<br />
„Es wird ein neues Steuerungsmodell eingeführt, das aus einem relativ<br />
starkem Rektorat, einem neu eingeführten Universitätsrat und aus Ziel- und<br />
Leistungsvereinbarungen zwischen Staat und Universität besteht“ (Pellert<br />
2003, 28).<br />
Die neuen Steuerinstrumente, die das UG 02 mit sich bringt, sind neben<br />
Leistungsvereinbarungen auch regelmäßige Evaluierungen und<br />
Qualitätsmanagement.<br />
Durch den Paradigmenwechsel ist auch die Gleichstellungspolitik der Universitäten<br />
betroffen. Die Gleichstellungspolitik und –instrumentarien, die ihre Verrechtlichung im<br />
UOG 93 finden und in die bestehende Universitätsstruktur eingewoben sind, liegen<br />
nun ebenfalls in der Verantwortung der autonomen Universitäten. Da die steuernde<br />
45
Funktion des Ministeriums zum Teil wegfällt, fällt den Universitäten in vielen<br />
Bereichen und Politiken eine aktive, gestaltende und neu auszufüllende Rolle zu.<br />
3.4.2 Das Prinzip Gender Mainstreaming 15<br />
Die Universitätsreform wird unter den Vorgaben des Prinzips des Gender<br />
Mainstreamings gestaltet, sogar zu einem Pilotprojekt in Sachen Gender<br />
Mainstreaming ausgerufen. Gender Mainstreaming ist, wie Elisabeth Holzleithner<br />
(2004) ausführt,<br />
„die neue Methode der Genderpolitik, die vor allem im Rahmen der<br />
Europäischen Union ein hohes Ausmaß an Prominenz, rechtlicher<br />
Verankerung (EG-Vertrag Art. 2 und 3) und rhetorische Wirkungsmacht erlangt<br />
hat“ (Holzleithner 2004, 28).<br />
Das Prinzip Gender Mainstreaming bedeutet, dass auf allen Entscheidungsebenen<br />
die Geschlechterfrage gestellt wird. Entscheidungsträger sind angehalten<br />
„geschlechtsspezifische Belange in die Konzeption aller Politiken und<br />
Programme einzubeziehen, so dass vor dem Fällen von Entscheidungen die<br />
Folgen für Männer und Frauen analysiert werden“ (Europäische Kommission<br />
Leitfaden 2, zit. nach Holzleithner 2004, 28).<br />
Neben der Implementierung von Gender Mainstreaming ist die zweite Strategie in<br />
Maßnahmen zur Frauenförderung begründet. Die Bestimmungen zu Gleichstellung<br />
und Frauenförderung sind enthalten als Grundsatz der Universitäten (§2 Z 9, § 3 Z 9<br />
UG 02) und ist im § 41 UG 02 ein allgemeines Frauenförderungsgebot normiert.<br />
Silvia Ulrich (2004) beschreibt drei genderspezifische Reformoptionen, die im UG 02<br />
verwirklicht sind:<br />
1. Implementierung eines effektiven genderspezifischen Rechtsschutzsystems<br />
Dieses besteht aus dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen mit der<br />
Aufgabe, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts 16 entgegenzuwirken<br />
15<br />
Gender Mainstreaming wird in Kapitel 4.1.2. genauer behandelt.<br />
46
sowie die Universitätsangehörigen in Fragen der Gleichstellung und<br />
Frauenförderung zu beraten und zu unterstützen (§42 UG 02).<br />
2. Sicherstellung von Frauenförderungsinstrumenten zur Verwirklichung<br />
struktureller Gleichstellungseffekte<br />
Darunter fällt die Verpflichtung, in der Satzung einen Frauenförderungsplan zu<br />
erlassen (319 Abs. 2 Z6 UG 02). Der ministerielle Frauenförderplan fällt weg<br />
und damit auch die gesetzlichen Vorgaben.<br />
3. Schaffung organisationsrechtlicher Rahmenbedingungen<br />
Die Universitäten sind verpflichtet zu der Einrichtung einer<br />
Organisationseinheit zur Koordination der Aufgaben der Gleichstellung, der<br />
Frauenförderung sowie der Geschlechterforschung (§ 19 Abs. 2 Z 7 UG 02)<br />
(vgl. Ulrich 2004, 346).<br />
Die Ausgliederung der österreichischen Universitäten, deren Grundstein mit dem<br />
UOG 93 bereits gelegt wird, von Jessica Bösch (2004) auch als neoliberaler Umbau<br />
des Hochschulsystems bezeichnet (Bösch 2004, 12), die zunehmend kaum mehr<br />
überblickbare Zahl von Fachhochschulen und Privatuniversitäten, die dadurch<br />
entstehende neue Wettbewerbssituation am Bildungsmarkt – diese Faktoren stellen<br />
die „klassische Universität“ vor eine Situation die in den letzen Jahren auch für alle<br />
Universitätsangehörige eine große Herausforderung ist. Das Universitätspersonal<br />
wird konfrontiert mit veränderten Organigrammen und Anstellungsverhältnissen, die<br />
Studierenden mit neuen Curricula und dem Umbau des Studien-Systems auf das<br />
europaweite Bologna-System (Bachelor-Master-Studium) und nicht zuletzt mit der<br />
Einführung von Studiengebühren, welche den Paradigmenwechsel augenscheinlich<br />
macht.<br />
Die Europäisierung der Ausbildungsstandards und Studienbedingungen sowie die<br />
Qualitätssicherung von Lehre und Forschung werden und sind neben der<br />
Wettbewerbsfähigkeit am zunehmend segregierten Bildungsmarkt, die wichtigsten<br />
Herausforderungen und Zielvorgaben, die die „klassische“ Universität zu bewältigen<br />
hat.<br />
16<br />
Mit der Novelle des B-GlBG 2004 wurden die Zuständigkeiten des AKG auf die<br />
Diskriminierungstatbestände ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder<br />
der sexuellen Orientierung ausgeweitet.<br />
47
Der grobe Überblick, der bei weitem nicht vollständig ist 17 , soll veranschaulichen,<br />
dass eine Vielzahl von Regelungen zur Gleichbehandlung und Frauenförderung in<br />
den Universitäten entwickelt wurde. Es mangelt den Universitäten nicht an formellen<br />
gesetzlichen Regelungen, sondern muss das bestehende geschlechtspezifische<br />
Ungleichgewicht in den oberen wissenschaftlichen Hierarchien, auf der informellen<br />
Ebene der Symbole und eingeschriebenen Geschlechter-Ordnungen, im Verhalten<br />
der täglichen Arbeits-Praxis, in den sozialen Beziehungen inklusive Netzwerken und<br />
Abhängigkeitsverhältnissen zu suchen sein.<br />
3.4.3 Diversity – Das Prinzip der Vielfalt<br />
Neben dem Prinzip Gender Mainstreaming ist aktuell auch der Begriff Diversity bzw.<br />
Gender und Diversity in der Gleichstellungsarbeit an den Universitäten präsent.<br />
Diversity beschreibt das Prinzip der Vielfalt und der Andersheit und umfasst neben<br />
der Geschlechterdifferenz andere Differenzierungsmuster, wie Hautfarbe, ethnische<br />
Herkunft, Weltanschauung, Religion, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung, etc.<br />
Die Strategie Diversity Management geht dabei von der Anerkennung und Nutzung<br />
dieser vielfältigen Dimensionen als Entwicklungspotenzial für eine Organisation aus.<br />
Die unterschiedlichen sozialen, kulturellen und biographischen Hintergründe können<br />
wie die Geschlechterdifferenz, Projektionsflächen für Diskriminierungen sein.<br />
Durch die Novelle zum Bundes-Gleichbehandlungsgesetz von 2004 sind etwa die<br />
Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen an den österreichischen Universitäten<br />
nicht mehr nur für den Diskriminierungstatbestand aufgrund des Geschlechts<br />
zuständig, sondern auch bei Ungleichbehandlung aufgrund ethnischer Herkunft,<br />
Weltanschauung, Religion, sexuelle Orientierung und Alter.<br />
Die soziale Herkunft der Studierenden ist ein Thema, dass durch die OECD Studie<br />
„Bildung auf einem Blick 2008“ 18 – und aufgrund der bevorstehenden<br />
17<br />
Einen umfassenden chronologischen Überblick über die Entstehung der Verrechtlichung der<br />
Gleichbehandlung und Frauenförderung sowie einen Überblick über die Universitätsreformen bieten u.a.<br />
Elisabeth Holzleithner (2002) (2004), Elisabeth Holzleithner/ Nikolaus Benke (2003), Gertraud Seiser (2003),<br />
Silvia Ulrich (2004).<br />
18<br />
Aus Der Standard :OECD Studie: Aufteilung in Hauptschule und Gymnasium zu früh. Defizite am Anfang<br />
und am Ende des Bildungsspektrums zeigt eine neue OECD-Studie: Österreich hat zu wenig Kinder im<br />
Kindergarten und zuwenig Akademiker. Printausgabe 10. September 2008.<br />
48
Nationalratswahlen in Österreich und der für die Parteien zentrale Frage<br />
Studiengebühren ja oder nein – in den öffentlichen Debatten präsent ist. Dabei ist<br />
auffällig, dass eine soziale Selektion nach wie vor wirksam ist. Der Anteil der<br />
AkademikerInnenkinder an den Universitäten ist zweieinhalb Mal höher, als es ihrem<br />
Bevölkerungsanteil entspricht. Der sozioökonomische Status der Eltern ist für die<br />
Entscheidung eines Studiums ein wichtiger Aspekt. Neben der Entscheidung über<br />
ein Studium spielt der sozioökonomische Hintergrund aber auch bei der Wahl des<br />
Studiums eine Rolle.<br />
Ein weiterer wichtiger Untersuchungsgegenstand und Ansatz für Förderprogramme<br />
im Sinne von Diversity sind StudentInnen mit Migrationshintergrund und ihre<br />
Studienwahl.<br />
Für diese Themenkomplexe gibt es zumindest an der Universität Salzburg keine<br />
Zahlen und werden diese Aspekte bei der Konzeption von Förderprogrammen noch<br />
vernachlässigt.<br />
Zur Erhöhung der Chancengleichheit beim Zugang zu den Bildungsressourcen<br />
wären diese Themenfelder für die Universitäten noch zu untersuchen und<br />
Grundlagenarbeit notwendig.<br />
49
4. Gleichstellungsarbeit und Geschlechterverhältnis an den Universitäten<br />
4.1. Gesetzliche Gleichstellung und die reale Situation an der Universität<br />
„Das Universitätsgesetz 2002 beinhaltet ein Rechtsschutzinstrumentarium<br />
(Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, Schiedskommission) und<br />
Frauenförderungsinstrumente zum Abbau strukturell bedingter Ungleichheiten sowie<br />
organisationsrechtliche Rahmenbedingungen für die Weiterführung bewährter<br />
Einrichtungen, wie etwa die Koordinationsstellen für Frauen- und<br />
Geschlechterforschung oder die Kinderbüros. Ein wichtiges<br />
Frauenförderungsinstrument ist die Verpflichtung der autonomen Universität, einen<br />
Frauenförderungsplan zu erlassen.<br />
Die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Gleichbehandlung und<br />
Frauenförderung ist Aufgabe der Universität“. 19<br />
Trotz einer Vielzahl von Gleichstellungsinstrumentarien und gesetzlichen<br />
Regelungen ist es eine Tatsache, dass Österreich im Ländervergleich in Sachen<br />
Gleichstellung der Geschlechter im Wissenschaftsbereich am unteren Ende rangiert<br />
(vgl. Appelt 2004, 1).<br />
Vereinzelt brechen konservierte und einzementierte Handlungsweisen - wie zuletzt<br />
2007 die Berufung der ersten Rektorin an der Universität für Bodenkultur Wien zeigt -<br />
auf. Bei Betrachtung der folgenden Grafik wird der mittlerweile leichte Überhang von<br />
weiblichen Absolventinnen an den gesamtösterreichischen Universitäten in den<br />
letzten Jahren deutlich. Dies steht im krassen Gegensatz zu dem weiblichen Anteil<br />
an Führungspositionen auf den oberen Hierarchieebenen. Die Diskrepanz ist wie in<br />
der Abbildung zu sehen, mehr als deutlich:<br />
19<br />
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung auf ihrer Homepage zu Frauenförderung und<br />
Gleichbehandlung an den Universitäten<br />
http://www.bmwf.gv.at/submenue/wissenschaft/gender/fauenfoerdan_universitaeten/ abgerufen am 14.08.2008<br />
50
Abb 2: Studienabschlüsse Universitäten nach Studienjahr / Universitäten gesamt<br />
Studienjahr<br />
Studienjahr 2000/01<br />
(endgültig)<br />
Studienjahr 2001/02<br />
(endgültig)<br />
Studienjahr 2002/03<br />
(endgültig)<br />
Studienjahr 2003/04<br />
(endgültig)<br />
Studienjahr 2004/05<br />
(endgültig)<br />
Studienjahr 2005/06<br />
(endgültig)<br />
Studienjahr 2006/07<br />
(endgültig)<br />
Studienabschlüsse<br />
Geschlecht Frauen Männer Gesamt<br />
8.636 8.519<br />
8.580 8.283<br />
9.836 9.029<br />
10.588 9.841<br />
11.456 9.522<br />
11.828 10.102<br />
12.221 9.900<br />
17.155<br />
16.863<br />
18.865<br />
20.429<br />
20.978<br />
21.930<br />
22.121<br />
Quelle: bmwf, Datenmeldungen der Universitäten auf Basis UniStEV zum jeweiligen Stichtag Datenprüfung und -aufbereitung:<br />
bmwf, Abt. I/9<br />
Der Umstand, dass die hartnäckige Unterrepräsentanz von Frauen in den oberen<br />
Hierarchieebenen des Wissenschaftsbetriebes – trotz mittlerweile höherer<br />
Absolventinnenzahlen an den Universitäten und einer Vielzahl von<br />
gleichstellungspolitischen Instrumentarien, Institutionalisierungen von<br />
Gleichbehandlungs- und Frauenförderungseinrichtungen, Etablierung der Frauenund<br />
Geschlechterforschung in der Lehre – nach wie vor besteht, dieser gender bias<br />
nicht überwunden werden kann, rückt neben den Strukturen auch die<br />
Instrumentarien und Maßnahmen zur Gleichstellungsarbeit und deren Wirkung in den<br />
Blickpunkt.<br />
Seit mehr als 10 Jahren beginnen mehr Frauen ein Universitätsstudium als Männer.<br />
Mittlerweile liegt der Anteil der Studentinnen im gesamten Hochschulbereich bei 57<br />
Prozent. Seit Beginn der 1970er Jahre hat sich der Frauenanteil damit verdoppelt.<br />
Das relativ ausgewogene Geschlechterverhältnis unter den Studierenden kann über<br />
eine zähe und anhaltende Unterrepräsentanz von Frauen beim wissenschaftlichen<br />
Personal und hier vor allem bei den akademischen Führungspositionen nicht<br />
hinwegtäuschen.<br />
51
Die Verteilung der Geschlechter unterscheidet sich entlang unterschiedlicher Linien<br />
(vgl. Ulmi/Maurer 2003, 17) durch:<br />
Vertikale Segregation<br />
Je höher die Hierarchiestufe, desto seltener sind Frauen zu finden.<br />
Horizontale Segregation<br />
Frauen und Männer verteilen sich nach Fächern unterschiedlich.<br />
Erhebliche Geschlechterdifferenzen gibt es bei den Erstabschlüssen in<br />
naturwissenschaftlichen und technischen Fächern. Besonders stark<br />
unterrepräsentiert sind Frauen in Fächern wie Maschinenbau, Elektrotechnik oder<br />
Informatik, in denen ihr Anteil weiterhin weniger als 15 Prozent beträgt. In der<br />
Pharmazie, aber auch in der Biologie sind sie mittlerweile deutlich in der Mehrheit.<br />
Abb. 3: Gender Schere – horizontale Segregation<br />
Quelle: heureka, Wisseschaftsmagazin im Falter 20 , Grafik: Hackl, APA;<br />
rot = weiblicher Anteil, blau = männlicher Anteil<br />
20<br />
http://www.falter.at/web/heureka/blog/?p=119, abgerufen am 14.08.2008<br />
52
In ihrer Studie Geschlechterdifferenz und Nachwuchsförderung in der Wissenschaft<br />
stellen Ulmi und Maurer (2005) für die Schweizer Hochschulen noch weitere<br />
Bruchlinien fest:<br />
Vertragliche Segregation<br />
Auf allen Stufen der Qualifizierung sind Frauen weniger häufig an<br />
Hochschulen angestellt und im Durchschnitt auch statustiefer.<br />
Soziale Segregation<br />
Männer mit erfolgreicher akademischer Karriere kommen überdurchschnittlich<br />
häufig aus einem Elternhaus mit einem akademisch gebildeten Vater.<br />
Erfolgreiche Akademikerinnen haben auffällig häufig auch eine akademisch<br />
gebildete Mutter.<br />
53
4.2 Das Geschlechterverhältnis an der Universität Salzburg<br />
Mit knapp 14.000 Studierenden, 1.382 Mitglieder des wissenschaftlichen Personals<br />
und 131 ProfessorInnen, reiht sich die Universität Salzburg größenmäßig ins<br />
Mittelfeld der österreichischen Universitäten ein. 21 Die Hälfte der Studierenden ist auf<br />
der Juridischen Fakultät vertreten (Recht, Wirtschaft, Sozialwissenschaften), je ca.<br />
2000 Studierende sind auf Geisteswissenschaften, Erziehungswissenschaften und<br />
Naturwissenschaften verteilt. Die Sportwissenschaften haben ca. 500 Studierende.<br />
Der Frauenanteil beim hauptberuflich wissenschaftlichen Personal liegt bei<br />
insgesamt 33,3 %, bei ProfessorInnen 15,3%. Auch hier zeigt sich deutlich das<br />
„akademische Frauensterben“ wie in der folgenden Abbildung verdeutlicht:<br />
Abb 4: „leaky pipeline“ an der Universität Salzburg –<br />
Frauen und Männer in unterschiedlichen Qualifikationsstufen in Prozent<br />
Die „ Schere“ ähnelt deutlich jener aus der Abbildung 1, die die Verteilung an den<br />
gesamtösterreichischen Universitäten darstellt, wobei doch auffällt, dass der<br />
weibliche Anteil der Studierenden und Studierende mit Erstabschluss deutlich höher<br />
ist, als im gesamtösterreichische Durchschnitt.<br />
Wie die leaky pipeline deutlich zeigt, sind Frauen bei den UniverstitätsassistentInnen<br />
unterdurchschnittlich vertreten. Bei der Anzahl der Habilitationen 2006 weisen sie<br />
21<br />
Die Zahlen sind dem 1. Zwischenbericht zur Evaluierung von excellentia 2007 des IHS unter der<br />
Autorenschaft von Angela Wroblewsiki und Andrea Leitner entnommen.<br />
54
nur mehr einen Anteil von 13% auf. Die erste Professorin wurde 1967 an die<br />
Universität Salzburg berufen. Von einer sichtbaren Erhöhung des Frauenanteils,<br />
kann man aber erst Ende der 1990er Jahre sprechen. Mit dem 15,3 % Anteil<br />
weiblicher Professorinnen, reiht sich die Universität Salzburg an die Universitäten mit<br />
dem höchsten weiblichen ProfessorInnenanteil (vgl. Wroblewski/Leitner 2007, 26). 22<br />
4.3 Die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses an der Universität<br />
Salzburg<br />
Die Zahlenverhältnisse bei Studierenden und AbsolventInnen der Universität<br />
Salzburg sprechen eine deutliche Sprache. Betrachtet man die Entwicklung der<br />
Zahlen der AbsolventInnen seit dem Studienjahr 2000/01 so kann festgestellt<br />
werden, dass im Studienjahr 2000/01 bei den Studienabschlüssen gesamt, die<br />
Anzahl der weiblichen Absolventinnen deutlich höher ist und sich dieser Überhang an<br />
weiblichen Studierenden bis ins Studienjahr 2006/2007 kaum verändert.<br />
Abb 5: Gender Monitoring Ordentliche Studierende WS 2007 / Universität Salzburg<br />
WS 2007<br />
(Stichtag:<br />
28.02.08)<br />
Universitäten<br />
der<br />
Wissenschaften<br />
Universität<br />
Salzburg<br />
Staatsangehörigkeit:<br />
Alle<br />
Ordentliche<br />
Studierende<br />
Frauen-<br />
Männeranteile in %<br />
Geschlecht Frauen Männer Gesamt Frauen Männer<br />
Universität Staatengruppe<br />
(Ö, andere)<br />
Universität<br />
7.488 4.299 11.787 63,5% 36,5%<br />
Salzburg<br />
Inländer/innen 5.905 3.388 9.293 63,5% 36,5%<br />
Ausländer/inne<br />
n<br />
1.583 911 2.494 63,5% 36,5%<br />
Quelle: Datenmeldung der Universität auf Basis BidokVUni, Datenprüfung und –aufbereitung: bmwf, Abt.I/4 & I/9<br />
22 Die Berufungen von Frauen in den letzten Jahren sind auf die Geistes- und Sozialwissenschaften begrenzt. Bei<br />
den letzten 8 Berufungen an den Naturwissenschaften wurde keine einzige Frau bestellt. Siehe auch:<br />
Leitner/Wroblewiski (2008): Begleitende Evaluierung von excellentia, 2. Zwischenbericht 2008. IHS, Wien.<br />
55
Abb 6: Gender Monitoring Studienabschlüsse gesamt / Universität Salzburg<br />
Universität Salzburg<br />
Studienart:<br />
alle<br />
Studienabschlüsse Frauen-/Männeranteile<br />
in %<br />
Studienjahr<br />
Geschlecht<br />
Studienjahr 2005/06 1.487 100,0%<br />
Frauen 972 65,4%<br />
Männer 515 34,6%<br />
Studienjahr 2004/05 1.376 100,0%<br />
Frauen 923 67,1%<br />
Männer 453 32,9%<br />
Studienjahr 2003/04 1.384 100,0%<br />
Frauen 916 66,2%<br />
Männer 468 33,8%<br />
Studienjahr 2002/03 1.250 100,0%<br />
Frauen 783 62,6%<br />
Männer 467 37,4%<br />
Studienjahr 2001/02 1.096 100,0%<br />
Frauen 652 59,5%<br />
Männer 444 40,5%<br />
Studienjahr 2000/01 994 100,0%<br />
Frauen 606 61,0%<br />
Männer 388 39,0%<br />
Quelle: Datenmeldung der Universität auf Basis BidokVUni, Datenprüfung und –aufbereitung: bm.wf, Abt.I/4 & I/9<br />
Abb 7: Studienabschlüsse nach Studienart / Universität Salzburg<br />
Studienjahr<br />
2006/07<br />
Universität<br />
Salzburg<br />
Abschlussart<br />
Staatsangehörigkeit<br />
Staatengruppe<br />
(Ö, andere)<br />
Studienabschlüsse<br />
Geschlecht Frauen Männer Gesamt<br />
Studienart<br />
Bachelorstudium 476 185 661<br />
Diplomstudium 404 189 593<br />
Masterstudium 161 71 232<br />
Doktoratsstudium 63 62 125<br />
Insgesamt 1.104 507 1.611<br />
Quelle: Datenmeldung der Universität auf Basis BidokVUni, Datenprüfung und –aufbereitung: bmwf, Abt.I/4 & I/9<br />
Eine Erklärung für diesen Überhang an weiblichen Studierenden ist sicher im<br />
Studienangebot der Universität Salzburg zu finden. So verfügt die Universität<br />
Salzburg über ein großes Angebot an geisteswissenschaftlichen Studien, die<br />
historisch und traditionell einen hohen Anteil an Studentinnen aufweisen. Eine<br />
weitere Erklärung kann im Fehlen einer medizinischen Universität 23 liegen, die<br />
traditionellerweise mehr männliche Studierende ausbildet.<br />
23<br />
Die neu eingerichtete Paracelsus Medizinische Privat Universität PMU ist hier nicht berücksichtigt.<br />
56
Betrachtet man die Studienabschlüsse der einzelnen Fakultäten, ergibt sich daraus<br />
ein durchaus interessantes und ungewöhnliches Bild:<br />
Abb 8: Gender Monitoring Studienabschlüsse Geisteswissenschaft und Künste / Universität<br />
Salzburg<br />
Studienart: Geisteswissenschaften<br />
Universität Salzburg<br />
und Künste<br />
Frauen-<br />
Studienabschlüsse /Männeranteile in<br />
%<br />
Studienjahr<br />
Geschlecht<br />
Studienjahr 2005/06 205 100,0%<br />
Frauen 121 59,0%<br />
Männer 84 41,0%<br />
Studienjahr 2004/05 177 100,0%<br />
Frauen 125 70,6%<br />
Männer 52 29,4%<br />
Studienjahr 2003/04 191 100,0%<br />
Frauen 126 66,0%<br />
Männer 65 34,0%<br />
Studienjahr 2002/03 154 100,0%<br />
Frauen 97 63,0%<br />
Männer 57 37,0%<br />
Studienjahr 2001/02 156 100,0%<br />
Frauen 91 58,3%<br />
Männer 65 41,7%<br />
Studienjahr 2000/01 151 100,0%<br />
Frauen 94 62,3%<br />
Männer 57 37,7%<br />
Quelle: Datenmeldung der Universität auf Basis BidokVUni, Datenprüfung und –aufbereitung: bmwf, Abt.I/4 & I/9<br />
Bei den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern ergibt sich ein<br />
erwartetes Bild. Hier ist der Anteil der weiblichen Studienabsolventinnen in allen<br />
angeführten Studienjahren dominierend.<br />
57
Abb 9: Gender Monitoring Studienabschlüsse Sozialwissenschaften Wirtschaft und Recht /<br />
Universität Salzburg<br />
Universität Salzburg<br />
Studienart: Sozialwissenschaften,<br />
Wirtschaft und Recht<br />
Studienfamilie: Alle<br />
Studienabschlüsse<br />
Frauen-/Männeranteile<br />
in %<br />
Studienjahr<br />
Geschlecht<br />
Studienjahr 2005/06 668 100,0%<br />
Frauen 482 72,2%<br />
Männer 186 27,8%<br />
Studienjahr 2004/05 613 100,0%<br />
Frauen 441 71,9%<br />
Männer 172 28,1%<br />
Studienjahr 2003/04 653 100,0%<br />
Frauen 475 72,7%<br />
Männer 178 27,3%<br />
Studienjahr 2002/03 662 100,0%<br />
Frauen 426 64,4%<br />
Männer 236 35,6%<br />
Studienjahr 2001/02 578 100,0%<br />
Frauen 352 60,9%<br />
Männer 226 39,1%<br />
Studienjahr 2000/01 486 100,0%<br />
Frauen 277 57,0%<br />
Männer 209 43,0%<br />
Quelle: Datenmeldung der Universität auf Basis BidokVUni, Datenprüfung und –aufbereitung: bmwf, Abt.I/4 & I/9<br />
Ein unerwartetes Bild ergibt sich bei Betrachtung der Studienabschlüsse in den<br />
sozialwissenschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Fächern. Während im<br />
Studienjahr 2000/01 der weibliche Anteil bereits um 14% höher ist, öffnet sich die<br />
Geschlechter-Schere bis ins Studienjahr 2005/2006 zugunsten des weiblichen<br />
Anteils noch weiter. Das Verhältnis 72,2% weibliche Studienabschlüsse zu 27,8%<br />
männlicher Studienabschlüsse im Studienjahr 2005/2006 ist in Fächern die<br />
traditionell männlich dominiert erscheinen, unerwartet.<br />
58
Abb 10: Gender Monitoring Studienabschlüsse in Naturwissenschaften und Technik<br />
(Naturwissenschaften & Ingenieurwesen) Universität Salzburg<br />
Universität Salzburg<br />
Studien- Frauen-Männeranteile in %<br />
abschlüsse<br />
Studienjahr Geschlecht<br />
Studienjahr 2005/06 350 100,0%<br />
Frauen 178 50,9%<br />
Männer 172 49,1%<br />
Studienjahr 2004/05 351 100,0%<br />
Frauen 180 51,3%<br />
Männer 171 48,7%<br />
Studienjahr 2003/04 292 100,0%<br />
Frauen 148 50,7%<br />
Männer 144 49,3%<br />
Studienjahr 2002/03 211 100,0%<br />
Frauen 106 50,2%<br />
Männer 105 49,8%<br />
Studienjahr 2001/02 163 100,0%<br />
Frauen 82 50,3%<br />
Männer 81 49,7%<br />
Studienjahr 2000/01 122 100,0%<br />
Frauen 56 45,9%<br />
Männer 66 54,1%<br />
Quelle: Datenmeldung der Universität auf Basis BidokVUni, Datenprüfung und –aufbereitung: bmwf, Abt.I/4 & I/9<br />
Die traditionell männlich dominierten naturwissenschaftlichen und technischen<br />
Fächer ergeben bei Betrachtung der Abbildung Studienabschlüsse in<br />
Naturwissenschaft und Technik, ein völlig unerwartetes Bild. Dominieren im<br />
Studienjahr 2000/01 die Abschlüsse von Männern noch, dreht sich das Verhältnis in<br />
den nachfolgenden Studienjahren um.<br />
Bei Vergleich der Zahlen der Abschlüsse von Doktoratsstudien in der nachfolgenden<br />
Abbildung in den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern nähern sich die<br />
Zahlen wieder an, bzw. zeigt sich wieder eine leichte Männerdominanz. Allerdings<br />
verändert sich die Situation wieder im Studienjahr 2005/06. Bei Betrachtung der<br />
Gesamtsituation kann man von einer Ausgewogenheit in den<br />
naturwissenschaftlichen und technischen Studienabschlüssen sprechen.<br />
59
Abb 11: Gender Monitoring Studienabschlüsse von Doktoratsstudien in Naturwissenschaften und<br />
Technik (Naturwissenschaften & Ingenieurwesen) / Universität Salzburg<br />
Universität:Universität Salzburg<br />
Dissertation<br />
Studienabschlüsse<br />
Frauen-<br />
/Männeranteile in<br />
%<br />
Studienjahr<br />
Geschlecht<br />
Studienjahr 2005/06 24 100,0%<br />
Frauen 13 54,2%<br />
Männer 11 45,8%<br />
Studienjahr 2004/05 46 100,0%<br />
Frauen 19 41,3%<br />
Männer 27 58,7%<br />
Studienjahr 2003/04 24 100,0%<br />
Frauen 12 50,0%<br />
Männer 12 50,0%<br />
Studienjahr 2002/03 34 100,0%<br />
Frauen 16 47,1%<br />
Männer 18 52,9%<br />
Studienjahr 2001/02 47 100,0%<br />
Frauen 18 38,3%<br />
Männer 29 61,7%<br />
Studienjahr 2000/01 28 100,0%<br />
Frauen 12 42,9%<br />
Männer 16 57,1%<br />
Quelle: Datenmeldung der Universität auf Basis BidokVUni, Datenprüfung und –aufbereitung: bmwf, Abt.I/4 & I/9<br />
Diese Interpretation verwirrt, besteht doch bei den naturwissenschaftlichen und<br />
technischen Fächern ein traditioneller male bias. Bei genauer Betrachtung der<br />
Geschlechterverteilung relativiert sich das Bild. Einerseits fehlen an der<br />
naturwissenschaftlichen Universität Salzburg die Studienfächer Physik und Chemie,<br />
andererseits wird das Fach der Psychologie den Naturwissenschaften zugerechnet.<br />
Die Fächer Psychologie sowie Biologie (Zellbiologie, Organismische Biologie und<br />
Molekulare Biologie), zählen zu den so genannten „weichen“ Naturwissenschaften,<br />
und erklären diese den erheblichen Frauenüberhang unter den Studierenden und<br />
AbsolventInnen, während die Fächer Mathematik (hier gibt es bis dato keine einzige<br />
Dissertantin), Materialwissenschaften sowie die neu eingerichteten<br />
Ingenieurswissenschaften eine deutliche Unterrepräsentanz weiblicher Studierender<br />
und Absolventinnen, aufweisen.<br />
Bei Untersuchung der einzelnen naturwissenschaftlichen Studienrichtungen bestätigt<br />
sich das Bestehen einer vertikalen Segregation.<br />
60
Interessant im Vergleich dazu, ist das Geschlechterverhältnis des Wissenschaftlichen<br />
Personals im Vergleich zum Allgemeinen Personal 2005/2006 an der Universität<br />
Salzburg:<br />
Abb 12: Wissenschaftliches Personal, Allgemeines Personal WS 2005, WS 2006 / Universität<br />
Salzburg<br />
Universität<br />
Salzburg<br />
bereinigte bereinigte<br />
Kopfzahlen Kopfzahlen<br />
Geschlecht Frauen Männer Gesamt<br />
Semester<br />
Wintersemester<br />
2006 (Stichtag:<br />
31.12.06) - -<br />
Wissenschaftliches und<br />
künstlerisches Personal<br />
219 422 641<br />
gesamt<br />
Professor/inn/en 21 108 129<br />
Assistent/inn/en und<br />
sonstiges<br />
wissenschaftliches und<br />
198 314 512<br />
künstlerisches Personal<br />
Dozent/inn/en 31 121 152<br />
Allgemeines Personal<br />
gesamt<br />
449 279 728<br />
Insgesamt 659 671 1.330<br />
Wintersemester<br />
2005 (Stichtag:<br />
15.10.05) - -<br />
Wissenschaftliches und<br />
künstlerisches Personal<br />
212 428 640<br />
gesamt<br />
Professor/inn/en 20 110 130<br />
Assistent/inn/en und<br />
sonstiges<br />
wissenschaftliches und<br />
192 318 510<br />
künstlerisches Personal<br />
Dozent/inn/en 31 120 151<br />
Allgemeines Personal<br />
gesamt<br />
365 219 584<br />
Insgesamt 576 641 1.217<br />
Quelle: Datenmeldung der Universität auf Basis BidokVUni, Datenprüfung und –aufbereitung: bmwf, Abt.I/4 & I/9<br />
Eine deutliche horizontale Segregation beim Wissenschaftlichen Personal besteht<br />
bereits auf der Ebene der AssistentInnen, eklatant wird es auf der Ebene der<br />
ProfessorInnen.<br />
Im Vergleich dazu ist auf der Ebene des Allgemeinen Universitätspersonals ein<br />
deutlich höherer Frauenanteil festzumachen.<br />
61
Untersucht man die Zahlen der Geschlechterverteilung des Allgemeinen Personals<br />
genauer, so kann man auch hier eine deutliche Geschlechtersegregation nach<br />
Hierarchieebene festmachen:<br />
Abb 13: Allgemeines Universitätspersonal / Universität Salzburg 2006<br />
Universitätsmanagement<br />
WS 06<br />
gesamt<br />
Quelle: Datenmeldung der Universität auf Basis BidokVUni, Datenprüfung und –aufbereitung: bmwf, Abt.I/4 & I/9<br />
WS 05<br />
gesamt<br />
Frauen Männer<br />
Frauen Männer<br />
Vollzeitäquivalente 7,0 16,9 23,9 0,5 3,2 3,7<br />
Frauen-/Männeranteile in % 29,2% 70,8% 13,5% 86,5%<br />
bereinigte Kopfzahlen 14 40 54 1 7 8<br />
Verwaltung - - - -<br />
Vollzeitäquivalente 304,8 181,8 486,5 277,4 171,2 448,6<br />
Frauen-/Männeranteile in % 62,6% 37,4% 61,8% 38,2%<br />
bereinigte Kopfzahlen 424 214 638 354 188 542<br />
Wartung und<br />
Betrieb - - - -<br />
Vollzeitäquivalente 8,0 25,0 33,0 8,5 24,0 32,5<br />
Frauen-/Männeranteile in % 24,2% 75,8% 26,2% 73,8%<br />
bereinigte Kopfzahlen 11 25 36 10 24 34<br />
Auf der oberen Hierarchieebene des Universitätsmanagements ist der Männeranteil<br />
deutlich höher als der Frauenanteil, die Verwaltungsebene zeigt einen weitaus<br />
höheren Frauenanteil, hier spiegelt sich der traditionell hohe Anteil an<br />
Verwaltungsassistentinnen wider, während Wartung und Betrieb (Hausdienst) einen<br />
deutlichen und nicht überraschenden Männerüberhang zeigt.<br />
62
4.1.1 Gleichstellungsarbeit, Frauenförderung und Geschlechtergerechtigkeit<br />
„Wie jede andere, die von hier aus spricht, bin ich Überlebende des<br />
akademischen Frauensterbens. Überlebende jener Segregationsregeln und<br />
Selektionsraster, die zuverlässig ihre Rekruten heranziehen und die ebenso<br />
zuverlässig die abweichende Population dezimieren – noch in den Fächern mit<br />
Frauenanteilen von 80 und 90%. Erfolgreich dezimieren die Mentalitäten,<br />
Riten und Praktiken der universitären Professionalisierung die Population mit<br />
abweichender Geschlechtsidentität, abweichende Biographiemuster,<br />
abweichende Vereinbarkeit von Privatbereich und Karriere, abweichende<br />
Zeitökonomie, abweichender Habitus, abweichendem symbolischen Kapital.“ 24<br />
(Hassauer 1994, 35)<br />
Gleichstellungsarbeit - der Einsatz für Chancengleichheit und Frauenförderung an<br />
der Universität - ist nur möglich, wenn die Geschlechterdifferenz mitbetrachtet und<br />
mitgedacht wird, um ungleiche Ausgangssituationen von Frau und Männern<br />
auszugleichen.<br />
Es geht darum, für Frauen und Männer soziale Ausgangsbedingungen und<br />
Strukturen zu schaffen, die gleiche Chancen und Wahlmöglichkeiten für beide<br />
Geschlechter anbieten. Dabei geht es nicht um Gleichmacherei, sondern müssen die<br />
bestehenden Differenzen mitgedacht werden, um nachhaltig zu fördern mit dem Ziel<br />
geschlechtergerechte, eigentlich menschengerechte (Roloff 2002, 19) Strukturen zu<br />
schaffen.<br />
Dabei sind diese bestehenden Differenzen in der Ungleichheit begründet, die u.a.<br />
durch Jahrhunderte lange Diskriminierung der Frauen im Erwerbsleben durch eine<br />
männerbündisch dominierte Arbeitskultur sowie dominierende Herrschafts- und<br />
Machtgefüge entstanden sind.<br />
Gleichstellung der Geschlechter, Frauenförderung und Geschlechterdemokratie sind<br />
Vorhaben, die der Verrechtlichung bedürfen, wie Holzleithner (2004) anführt.<br />
Demgegenüber hat die Universitätsreform 2002 den Anspruch eines<br />
Deregulierungsprojekts. Ein offensichtliches Spannungsfeld, denn ohne rechtliche<br />
24<br />
Hassauer, Friederike (1994), zit. nach. Nöbauer/Zuckerhut (2002)<br />
63
Handhabe gegen Diskriminierung, sind Gleichstellungsbekenntnisse reine<br />
Lippenbekenntnisse und meist folgenlos.<br />
Die in den verschiedenen Universitätsrefomen erkämpften und institutionalisierten<br />
gleichstellungspolitischen und frauenfördernden Normen, werden durch die<br />
Einführung des Prinzips Gender-Mainstreaming im Rahmen der Vorgaben der<br />
Europäischen Union unterstützt und die Universitätsreform, wie erwähnt, als Gender-<br />
Mainstreaming-Projekt ausgerufen (vgl. Holzleithner 2004, 28).<br />
4.1.2 Gender Mainstreaming<br />
Der inzwischen schon etwas „abgenutzte“ und inflationär verwendete Begriff Gender<br />
Mainstreaming bezeichnet ein relativ umstrittenes Konzept. Als Zauberformel auf den<br />
Weg zur Gleichstellung findet es als Vorgabe der Europäischen Union Eingang in<br />
alle Politiken und bedeutet, dass „die Genderfrage auf jeder Ebene von allen<br />
politischen Akteurinnen und Akteuren zu berücksichtigen ist. Sie darf nicht in den<br />
Sektor einer spezifischen Frauenpolitik abgeschoben werden.“ (Holzleithner 2004,<br />
28).<br />
Gender Mainstreaming ist kein neues Werkzeug oder Instrument der<br />
Gleichstellungspolitik, sondern soll als Strategie die Geschlechterfrage als<br />
Querschnittsmaterie in die vorhandenen Strukturen auf allen Ebenen einer<br />
Organisation verorten. Ein gewünschter wenn auch m.E. unrealistischer Effekt dieser<br />
Strategieimplementierung ist es, der „Nischenpolitik“ der Frauenförderung zu<br />
entkommen. Tatsache ist, dass es meist am persönlichen Engagement der vor allem<br />
weiblichen AkteurInnen liegt, deren Aktivitäten von vorneherein in der Frauen- und<br />
Gleichstellungsarbeit liegen, wie dieses Prinzip in einer Organisation umgesetzt wird.<br />
Die feministische Kritik sieht hier die Gefahr einer Implementierung des Ansatzes in<br />
die vorhandenen Macht- und Führungsstrukturen, ohne bewusste Herrschafts- und<br />
Systemkritik, die für Struktur- und Kulturveränderung in Organisationen jedoch<br />
immanent ist.<br />
Im Unterschied dazu, sehen BefürworterInnen des Konzeptes Gender Mainstreaming<br />
durch konsequente Anwendung und Implementation des Prinzips in eine<br />
64
Organisation durchaus eine Möglichkeit der strukturellen Veränderung. Da nicht nur<br />
Lebensentwürfe von Frauen, sondern auch die Lebensentwürfe von Männern und<br />
deren Auswirkungen auf die Organisation in den Blickpunkt gerückt werden, können<br />
diese für die Entwicklung von Gleichstellungsmaßnahmen mit herangezogen werden<br />
und zu nachhaltigen Änderungen in Struktur und Kultur führen. So gewinnt auch der<br />
ganze Bereich der Genderdidaktik bei der Ausbildung von Lehrpersonal immer mehr<br />
an Bedeutung.<br />
Ohne genauer auf die Kritiken von Gender Mainstreaming eingehen zu wollen, kann<br />
festgestellt werden, dass der Begriff zwar mittlerweile geläufig ist, aber doch wenig<br />
Greifbares damit verbunden wird. Wichtig ist es - und das ist auch eine der<br />
Hauptkritiken -, dass es nicht bei der Darstellung der Geschlechterverhältnissen<br />
durch regelmäßige Evaluierungen und Veröffentlichungen von Geschlechter-<br />
Statistiken bleibt, sondern diese Ergebnisse in konkrete Maßnahmen einfließen. Hier<br />
ist die Führungsebene einer Organisation gefordert, das Top-down-Prinzip Gender<br />
Mainstreaming ernst zu nehmen. Die Realität von Organisationen zeigt, dass die<br />
Umsetzung des Prinzips Gender Mainstreaming weniger als Führungsaufgabe,<br />
sondern als Aufgabe der Gleichbehandlungsbeauftragten oder -institutionen und<br />
somit wieder am einzelnen Engagement der (meist weiblichen) AkteurInnen liegt.<br />
Dies verhält sich auch an der Universität Salzburg nicht anders. Im § 7 (1)<br />
Frauenförderungsplan heißt es zu Gender Mainstreaming:<br />
„Zur konsequenten Umsetzung des Grundsatzes Gender Mainstreaming greift<br />
die Universität Salzburg auf das vorhandene einschlägige Fachwissen im<br />
AKG, im Interdisziplinären Expertinnen- und Expertenrat (IER) sowie im<br />
gendup (Organisationseinheit zur Koordinierung der Aufgaben der<br />
Gleichstellung, der Frauenförderung sowie der Geschlechterforschung) zurück<br />
und bindet diese aktiv ein.“ 25<br />
Das heißt im Klartext, dass es am Engagement und der Durchsetzungskraft der o.a.<br />
Einrichtungen und der handelnden Personen liegt, inwieweit Maßnahmen zur<br />
Gleichstellung ergriffen und Ressourcen bereitgestellt werden, und nicht zuletzt am<br />
„good will“ des Rektorats, welches Ausmaß die Ressourcen für die<br />
Gleichstellungsarbeit betragen und welchen Stellenwert der Gleichstellungsarbeit an<br />
der Universität zugestanden wird.<br />
25<br />
Frauenförderungsplan der Universität Salzburg, veröffentlicht im MBl. vom 13. März 2007, IV. Teil der<br />
Satzung der Universität Salzburg<br />
65
Das Prinzip Gender Mainstreaming ersetzt wie schon erwähnt, die traditionelle<br />
Frauenförderungsarbeit nicht, sondern liefert m.E. bestenfalls Grundlagen und<br />
Ansatzpunkte für effiziente Frauenförderung.<br />
4.1.3 Frauenförderung<br />
In den letzten Jahrzehnten hat in der universitären Frauenförderung ein<br />
Paradigmenwechsel stattgefunden. Bis zur Entlassung der Universitäten in die<br />
Autonomie wird die Frauenförderung von der staatlichen Seite her betrieben. Auf<br />
Basis der Bundesgleichbehandlungsgesetze werden Normen und Regeln<br />
(Frauenförderungspläne seitens des Ministeriums) erstellt, nun müssen die<br />
Universitäten ihre Rolle in der Frauenförderung zum Großteil selbst bestimmen. Eine<br />
große Veränderung ist dadurch vollzogen worden: wie Frauenförderung und<br />
Gleichstellungspolitik an den Universitäten gestaltet wird, steht und fällt zum Großteil<br />
mit den handelnden (Führungs)-Personen.<br />
Auf einen vorhergegangenen Paradigmenwechsel mit der Institutionalisierung der<br />
Frauenförderung und Gleichbehandlungsarbeit an den Universitäten wurde bereits<br />
hingewiesen. Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen,<br />
Gleichbehandlungsbeauftragte, Koordinationsstellen für Geschlechterforschung und<br />
Frauenförderung werden etabliert bzw. in ihren Rechten gestärkt.<br />
Die Ziele der Frauenförderung sind vor und nach der Universitätsreform dieselben:<br />
den Frauenanteil in allen Funktionsgruppen auf 40 Prozent zu erhöhen. Wobei diese<br />
Quote auf den höheren wissenschaftlichen Ebenen dramatisch unterschritten ist,<br />
trotz Frauenförderungsarbeit der letzten Jahrzehnte an den Universitäten.<br />
Wie Buchinger/Gödl/Gschwandtner (2002) in einer Studie über „Universitäre<br />
Berufsverläufe und Karrieremuster in Österreich“ festhalten, ist trotz der Normen und<br />
Regelwerke der letzten Jahrzehnte ein nur zögerlicher Anstieg der Frauenquoten<br />
festzustellen, konnte trotz „spür- und sichtbarer Erfolge frauenpolitischer Aktivitäten,<br />
die hierarchische Strukturdominanz von Männern nicht wirklich gebrochen werden“<br />
(Buchinger/Gödl/Gschwandtner 2002, 12).<br />
66
Die Autorinnen stellen aber ein gewisses Veränderungspotenzial durch legislative<br />
Maßnahmen der AkteurInnen (Gleichbehandlungsbeauftragte, Arbeitskreise für<br />
Gleichbehandlungsfragen) in Aussicht: dass diese gesetzlichen Maßnahmen das<br />
Potenzial haben, dem „Vorherrschaftsanspruch“ von Männern eine ganz wesentliche<br />
legitimierende Eigenschaft zu nehmen: jene der „Normalität“<br />
(Buchinger/Gödl/Gschwandtner 2002, 12).<br />
Ein zunehmendes Legitimationsbedürfnis des Geschlechterbonus für Männer könnte<br />
die Überwindung desselben, zumindest in dem Bereich des Denkbaren und<br />
Möglichen rücken (vgl. Buchinger/Gödl/Gschwandtner 2002, 12).<br />
Die Effizienz frauenfördernder Maßnahmen wird aufgrund des statischen Zustandes<br />
der Geschlechterverhältnisse auf den oberen hierarchischen Ebenen naturgemäß in<br />
Frage gestellt und führt dieser Zustand Angelika Wetterer (1998) zur Vermutung,<br />
dass die Situation der faktischen Marginalität von Frauen in der oberen<br />
Hochschulhierarchie auch ohne die gesamte Frauenförderungsdebatte nicht anders<br />
wäre. Sie kritisiert, dass durch Frauenförderung die relevante Frage nach den<br />
Ursachen der marginalen Rolle von Frauen in den oberen Rängen der<br />
Hochschulhierarchie, vernebelt wird und aus dem Blickfeld gerät (vgl. Wetterer 1998,<br />
19).<br />
Sie kritisiert dabei massiv, dass Frauenförderung die „gängigen Vorannahmen über<br />
die Frauen“ sowie „tradierte geschlechtsspezifische Zuschreibungsmuster“, welche<br />
die „Ursachen der Misere auf Seiten der Frauen sieht“, nicht in Frage stellt.<br />
Wetterer unterstellt der Frauenförderung weiter, dass sie die Strukturen und<br />
männlichen Mechanismen der Organisationskultur Hochschule nicht ins Blickfeld<br />
rückt und somit keine nachhaltige Veränderung initiieren kann. Sie geht soweit,<br />
Frauenförderung nicht nur als weitgehend wirkungslos zu bezeichnen, sondern stellt<br />
diese gar als kontraproduktiv und wenig hilfreich zur Erlangung des eigentlichen<br />
Zieles der Gleichstellung dar (vgl. Wetterer 1998, 19).<br />
Wetterer 26 teilt nach ihren langjährigen Forschungen und Beobachtungen der<br />
Frauenförderung an den deutschen Hochschulen institutionalisierte<br />
Frauenförderungsmaßnahmen in vier Gruppen ein:<br />
26<br />
Der Beitrag „Noch einmal: Rhetorische Präsenz – faktische Marginalität. Die kontrafaktorischen<br />
Wirkungen der bisherigen Frauenförderung im Hochschulbereich“ von Angelika Wetterer ist in mehreren Büchern<br />
erschienen u.a. in Krais, Beate 2000 und Plöger, Lydia/Riegraf, Beate (Hg.) 1998.<br />
67
• Frauenförderung durch Appelle<br />
Hierzu zählen Appelle und Absichtserklärungen, die Frauen bei Vergabe von<br />
Stipendien, Fördergeldern oder bei Stellenausschreibungen dezidiert ansprechen.<br />
Am Beispiel der Universität Salzburg schreibt die Koordinationsstelle für Frauen- und<br />
Geschlechterforschung (gendup - Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung),<br />
gemeinsam mit dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen jährlich<br />
Dissertationsstipendien, Mobilitäts- und Publikationsförderungen sowie<br />
Diplomarbeitspreise für Naturwissenschafterinnen, ausschließlich für Frauen, aus.<br />
Stellenausschreibungen erhalten den Zusatz:<br />
„Die Paris Lodron-Universität Salzburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils<br />
beim wissenschaftlichen und beim allgemeinen Universitätspersonal<br />
insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen<br />
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen<br />
vorrangig aufgenommen.“<br />
Wetterer bezeichnet Frauenförderung durch Appelle eine Demonstration des guten<br />
Willens der Universitäten, in der die Annahmen leise mitschwingen, dass einfach<br />
zuwenig „richtige“ Frauen vorhanden sind und sie nährt vor allem die Befürchtung,<br />
dass es Frauen mittlerweile im Wissenschaftsbetrieb leichter als Männer hätten, da<br />
ihnen aufgrund ihres „Frau-Seins“ automatisch Vorteile zuteil würden.<br />
Dies dient einerseits nicht, wie Wetterer schlussfolgert, einer Verbesserung der<br />
Umgangsformen zwischen den Geschlechtern, sondern impliziert andererseits<br />
zusätzlich eine Abwertung der Qualifikation von Frauen, die eine Stelle haben, da<br />
sie diese hauptsächlich aufgrund ihres förderungswürdigen Geschlechtes bekommen<br />
haben.<br />
• Frauenförderung durch Nachteilsausgleich und Vereinbarkeitsprogramme<br />
Dazu zählen Frauenförderungsmaßnahmen, die einer besseren Vereinbarkeit von<br />
Beruf und Familie dienen und den Nachteil ausgleichen sollen, die Frauen aufgrund<br />
ihrer Zuständigkeit für den Bereich der privaten Reproduktionsarbeit in Kauf nehmen<br />
müssen. Dazu gehört z.B. die Verlängerung von Fristen, damit den Frauen kein<br />
Nachteil erwächst, wenn sie aufgrund von Erziehungszeiten für ihre Karriere länger<br />
brauchen. Diese Art von Frauenförderung ist wie Wetterer schreibt, besonders<br />
paradox: sie schreibt die tradierte Zuschreibung der Zuständigkeit der Frauen für<br />
68
Erziehungsarbeit fest, lässt Männer außen vor und sie impliziert, dass<br />
Wissenschafterinnen ohne Kinder auch keine Probleme vorzuweisen haben.<br />
Karrierehindernisse von Frauen werden in den sozialen Bereich verschoben und<br />
liegen so außerhalb des wissenschaftlichen Systems. Durch Festschreibung der<br />
Realität wird es keine strukturellen Änderungen geben.<br />
• Frauenförderung durch Sonderprogramme<br />
Diese sind ähnlich wie die vorgenannten Vereinbarkeitsprogramme auf eine<br />
definierte Zielgruppe zugeschnitten oder als Qualifizierungsoffensive zeitlich<br />
begrenzte Angebote, meist auch finanziell schlecht ausgestattet. Wetterer kritisiert<br />
den Defizitansatz, dass Qualifizierungsoffensiven immer noch die Einstellung<br />
transportieren, dass Frauen Qualifikationsoffensiven notwendig haben und der<br />
Mangel an höheren Positionen im Hochschulbereich aus der niedrigeren<br />
Qualifikation der Frauen resultieren. Diese hartnäckigen Vorurteile führen sich selbst<br />
ad absurdum, bedenkt man den seit Jahren wachsenden weiblichen Überhang im<br />
höheren Bildungssegment. Der Blick auf die Ursachen der hierarchischen Struktur im<br />
oberen wissenschaftlichen Bereich wird auf einen Qualifizierungsbedarf der Frauen<br />
gerichtet.<br />
• Frauenförderung durch qualifikationsabhängige Quoten<br />
Unter den Frauenförderungsmaßnahmen ist die „Quotenregelung“ wohl die<br />
umstrittenste als auch die effizienteste Fördermaßnahme. Umstritten, da der Begriff<br />
„Quotenfrau“ fälschlicherweise, aber auch bewusst verwendet wird das Programm<br />
„Frau allein sein genügt“ zu verbreiten und nicht selten auch von den<br />
Wissenschafterinnen selbst abgelehnt wird. Effizient, da die Quotenregelung nicht<br />
wie die vorgenannten Frauenförderungsprogramme auf eine weitere, zusätzliche<br />
Qualifizierung ausgerichtet ist, sondern auf konkrete Posten und Positionen für<br />
Frauen greift. Entsprechend groß ist der Widerstand gegen diese Form der<br />
Frauenförderung.<br />
Niemand will gerne „Quotenfrau“ sein. Dabei ist eine gleiche oder höhere<br />
Qualifikation Grundvoraussetzung. Diese Grundvoraussetzung wird nicht gesehen<br />
bzw. manipuliert oder missinterpretiert. Eine Frau kann nur vorgezogen werden,<br />
wenn sie mindestens gleich gut qualifiziert ist und trotzdem, es bleibt der schale<br />
Nachgeschmack von Protektion. Selbst Wissenschafterinnen, die es durch die<br />
69
Quotenregelung auf die Berufungslisten schaffen und letztendlich berufen werden,<br />
lehnen diese Form der Frauenförderung oftmals ab.<br />
Wetterer (1998) spricht von einem Missverständnis dem die traditionelle<br />
Frauenförderung unterliegt, dass der Schlüssel für Posten und Position im<br />
Wissenschaftsbetrieb in der Qualifikation läge. Sie kritisiert die Frauenförderung die<br />
sich darin erschöpft, Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen anzubieten, erstens, da<br />
dies ein Bild suggeriert, Frauen hätten Weiterqualifikation nötig bzw. nötiger als<br />
Männer und zweitens, ist es zwar richtig, dass Frauen ohne Qualifikationsnachweise<br />
nichts werden können, aber den Umkehrschluss, wonach Frauen, wenn sie<br />
Qualifikationen besitzen und weiter erwerben, geradezu automatisch in Besitz eines<br />
adäquaten Postens kommen, bezeichnet Wetterer – wie ein Blick in die Geschichte<br />
und die Statistik zeigt – bestenfalls als Kurzschluss. Sie kritisiert weiter, dass diese<br />
„Kurzschlüsse“ von den für die Frauenförderung verantwortlichen Personen immer<br />
wieder neu belebt, statt abgebaut werden. Dies vor allem durch die ersten drei der<br />
von Wetterer klassifizierten oben genannten Frauenförderungsmaßnahmen. Sie<br />
spricht die kontraproduktiven Folgen dieser Maßnahmen aus: festgeschriebene<br />
Qualifikationsstandards und ihre Funktion als Ausschlusskriterien samt Reproduktion<br />
sozialer Ungleichheit, ohne dabei als kontraproduktiv erkennbar zu sein.<br />
Dabei nimmt Wetterer die Quotenregelung von dieser Kritik aus. Die eingespielten<br />
Mechanismen werden durch eine veränderte Distribution von Posten und Positionen<br />
gestört und die Reproduktion geschlechtshierarchischer Verteilungssymmetrien<br />
ernsthaft in Frage gestellt. Dementsprechend groß ist auch der Widerstand gegen<br />
diese Frauenförderungsmaßnahme im Vergleich zu den anderen. Wie Wetterer<br />
formuliert, „sind hier die Befürchtungen weit schlimmer als das Wohlwollen milde,<br />
sind hier die Abwehrstrategien handfest und teilweise von kaum noch vornehmer<br />
Subtilität“ (vgl. Wetterer 1998, 30 ff).<br />
70
4. Gleichstellungsarbeit – Gleichheit, Differenz, Dekonstruktion?<br />
In Anlehnung an Gudrun-Axeli Knapp (2001) müssen für die praktische<br />
Gleichstellungsarbeit, aus feministischer Perspektive, verschiedene Ansätze und<br />
Leitlinien mitbedacht werden. In der Praxis gilt es, immer wieder eine Balance<br />
zwischen Forderungen nach Gleichbehandlung und Forderung nach<br />
Berücksichtigung der differenten Ausgangslagen der Geschlechter, zu finden.<br />
Gleichstellungsarbeit ist immer eine Gratwanderung, ein Balanceakt und wie Lorber<br />
(1999) schreibt, sie muss beschwören, was sie eigentlich überwinden will: die<br />
Bedeutsamkeit der Kategorie Geschlecht (vgl. Lorber, 1999).<br />
Im Rahmen einer Studie zur Geschlechterdifferenz und Nachwuchsförderung in der<br />
Wissenschaft von Marianne Ulmi und Elisabeth Maurer 2005 27 , beschreiben die<br />
beiden Autorinnen die Notwendigkeit einer mehrdimensionalen, von verschiedenen<br />
immer wieder reflektierten Leitlinien ausgehenden Gleichstellungsarbeit und finden<br />
ergänzend zu den oben von Angelika Wetterer (1998) geprägten Gruppen der<br />
Frauenförderung verschiedene Ansätze der Gleichstellungsarbeit, die allerdings<br />
jeweils in sich wieder Gefahren der Missinterpretation und des Missverstehens<br />
bergen:<br />
1. Frauenförderungsprogramme zur Laufbahnunterstützung, dazu zählen z.B.<br />
Mentoring, Rhetorik- und Durchsetzungsprogramme. Diese bergen aber die<br />
Gefahr der Vorstellung, Frauen seien gegenüber Männern defizitär und<br />
bedürfen zusätzlicher Unterstützung.<br />
2. Informell vermittelte karriererelevante Informationen müssen öffentlich<br />
zugänglich werden und über Informationsplattformen und Beratungsangebote<br />
von Gleichstellungsstellen erfahrbar sein. Die Gefahr liegt dabei darin, dass<br />
die Gründe der Chancenungleichheit zwischen Frauen und Männer nicht<br />
thematisiert werden und die Ursachen der Ungleichheit aus dem Blickfeld<br />
verloren gehen.<br />
3. Die Einforderung von gesellschaftlichen und institutionellen<br />
Rahmenbedingungen, welche die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für<br />
Frauen und Männer gleichermaßen ermöglichen. Einerseits durch mehr<br />
Betreuungsangebote, anderseits aber auch durch Entlastung der<br />
wissenschaftlichen Laufbahn von Höchstbeanspruchungen, um ein soziales<br />
27<br />
Ulmi, Marianne/Maurer, Elisabeth: Geschlechterdifferenz und Nachwuchsförderung in der Wissenschaft.<br />
Studie 3 ihm Rahmen des SOWI-Disslabors 2005. UniFrauenstelle Universität Zürich.<br />
71
Leben neben einer wissenschaftlichen Laufbahn zu ermöglichen. Der<br />
einseitige Blick auf Frauen und Vereinbarkeitsmodelle für Frauen muss<br />
ausgeweitet und die Männer in diese Modelle miteinbezogen werden. Dieser<br />
einseitige Blick auf Frauen, sobald es um das Thema Karriere und Kinder<br />
geht, die einseitig gesetzten Maßnahmen tragen letztlich nur zu einer weiteren<br />
Segregierung der Arbeitsteilung und Einzementierung der<br />
geschlechterungleichen gesellschaftlichen Strukturen bei.<br />
4. Einen weiteren Zugang, und m.E. der Entscheidende, finden die Autorinnen in<br />
sozialpsychologischen Aspekten der Geschlechterdifferenz: Gleichstellung<br />
muss auch gedanklich vollzogen werden und ungleiche Ausgangslagen von<br />
Frauen und Männer, Geschlechterstereotypen, unterschiedlichen<br />
Sozialisationen, Rollenverständnissen und Wahrnehmungen und deren<br />
Bewusstwerdung dienen als Grundvoraussetzung für Veränderungen. Die<br />
immer wiederkehrenden Diskurse einer biologisch determinierten<br />
Zweigeschlechtlichkeit mit daraus resultierender naturhafter<br />
Aufgabenverteilung muss ebenso mitberücksichtigt werden.<br />
5. Da das Unverhältnis von Männern und Frauen auf höherer Hierarchieebene<br />
im Wissenschaftsbereich mittlerweile nicht mehr als Folge mangelnder<br />
Intellektualität oder Minderbegabung von Frauen bezeichnet werden kann<br />
bzw. mit dem langen Ausschluss aus der Institution Universität begründet<br />
werden kann, rückt die Wissenschaft als sozialer Raum, ihre besonderen<br />
formellen und informellen Strukturen, Ein- und Ausschlusskriterien, welche<br />
Frauen mit formaler Chancengleichheit auf der höheren Hierarchieebene<br />
praktisch ausschließen, ins Blickfeld (vgl. Ulmi/Maurer 2005, 8ff).<br />
72
5.1 Die Dilemmata in der Gleichstellungsarbeit<br />
„Gleichstellung von Ungleichen ist nur mit Einsicht in die ungleichen Bedingungen<br />
möglich“<br />
(Ulmi/Maurer 2005, 9).<br />
5.1.1 Das Differenzdilemma<br />
Genau dieses ins Blickfeld rücken von Ungleichheiten birgt die Gefahr des<br />
Differenzdilemmas 28 :<br />
Wird die Differenz in den Mittelpunkt der Gleichstellungsarbeit gerückt, besteht die<br />
Gefahr, dass geschlechtsspezifische Zuschreibungen festgeschrieben und<br />
Stereotypenvorstellungen nicht aufgeweicht werden können. Wetterer (2002)<br />
beschreibt, selbst wenn „das Weibliche“ gegenüber „dem Männlichen“ (vgl. Wetterer<br />
2002, 142) durch Gleichstellungsarbeit aufgewertet und nicht als defizitär verstanden<br />
wird, kann das Dilemma nicht gelöst werden. Es macht Geschlechtszugehörigkeit zu<br />
einem sozial hoch bedeutsamen Tatbestand und ist Differenz deshalb gerade nicht<br />
geeignet, diese Grundvoraussetzung geschlechtshierarchischer Strukturen zu<br />
erschüttern (vgl. Wetterer 2003, 18).<br />
In der politisch-pragmatischen Gleichstellungsarbeit bezieht sich Differenz auf die<br />
strukturelle Ebene. Differenz bedeutet dabei nicht unterschiedliche Fähigkeiten der<br />
Geschlechter, sondern zielt auf eine gesellschaftlich verankerte und strukturell<br />
festgelegte Ungleichheit der Geschlechter ab. Wetterer (2003) beschreibt das<br />
Abzielen der Differenz auf das Geschlechterverhältnis „als sozialen<br />
Strukturzusammenhang, der die Lebenssituation von Frauen und Männern nach wie<br />
vor präformiert und sie überhaupt erst zu Verschiedenen und zu Ungleichen macht.<br />
Diese Ungleichheit produzierenden Strukturen gilt es zu verändern, statt deren<br />
Effekte zum Ausgangspunkt politischen Handelns zu machen und sie erneut<br />
festzuschreiben.“ (vgl. Wetterer 2003, 18).<br />
28<br />
Das „Dilemma der Differenz“ wurde erstmals von der amerikanischen Juristin Martha Minow 1990 so<br />
benannt: „Die Differenzen von subordinierten Gruppen zu ignorieren, führt zur problematischen Politik falscher<br />
Neutralität – sich aber ganz auf den Aspekt der Differenz zu konzentrieren, kann die Verstärkung des Stigmas der<br />
Abweichung erzeugen“. Minow, Martha, Adjudicating Differences: Conflicts Among Feminist Lawyers. In: Hirsch,<br />
Marianne/Fox Keller, Evelyn (Hg.): Conflicts in Feminismus, New York 1990, 149-163. Zit. nach Knapp, Gudrun-<br />
Axeli (1992): Macht und Geschlecht. Neuere Entwicklungen in der feministischen Macht- und<br />
Herrschaftsdiskussion, Freiburg<br />
73
Differenz, die mit den unterschiedlichen Fähigkeiten der Geschlechter begründet<br />
wird, bezeichnet Wetterer (2003) als Vereigenschaftung der Differenz: Unterschiede<br />
werden nicht auf soziale Strukturzusammenhänge zurückgeführt, die diese Differenz<br />
entstehen lassen, sondern als Verschiedenheit die in den Frauen und Männern<br />
selbst begründet ist, gesehen. Wetterer führt als Beispiele dieser Vereigenschaftung<br />
der Differenz den „weiblichen Führungsstil, „weibliches Arbeitsvermögen“, „weibliche<br />
Moral“ an, die der Dekonstruktion bedürfen (vgl. Wetterer 2003, 19). Die Differenz,<br />
mit dem „Wesen“ der Frau zu begründen, ist wiederum Basis für auf gesellschaftlich<br />
verankerte und strukturell festgelegte Ungleichheit der Geschlechter.<br />
Der Differenzansatz muss sich somit auch mit dem Vorwurf des „Essentialismus“, der<br />
eigenen Wesenhaftigkeit der Frau, beschäftigen, d.h. überlieferte Klischees und<br />
Geschlechterstereotype sowie polarisierte Positionen von Weiblichkeit und<br />
Männlichkeit festzuschreiben, anstatt diese aufzulösen. (vgl. Klinger 2003, 16).<br />
5.1.2 Das Gleichheitsdilemma<br />
Gleichstellungsarbeit birgt die Gefahr einer unbewussten Weiterführung von<br />
ungleichen Voraussetzungen. Das Gleichheitskonzept geht grundsätzlich davon aus,<br />
dass Frauen und Männer gleiche Fähigkeiten und Potenziale haben. Die Gründe für<br />
eine unterschiedliche und ungleiche Entwicklung der Fähigkeiten bei gleicher<br />
Ausgangslage müssen in den gesellschaftlichen Bedingungen liegen. Die<br />
Problematik in der bestehenden Ungleichheit ist, dass diese Ungleichheit nicht als<br />
Problem der Gesellschaft erkannt wird und konsequenterweise zu Änderungen der<br />
gesellschaftlichen Bedingungen führt, sondern die Gründe für die Ungleichheit den<br />
Benachteiligten selbst zugeschrieben wird. Ungleichheit ist demnach ein Problem der<br />
Frauen selbst.<br />
Wetterer (2003) hält in ihrer Beschreibung des Gleichheitsdilemmas fest, dass die<br />
Gleichbehandlung von Ungleichem Ungleichheit nicht abbaut, sondern diese sogar<br />
verstärkt (vgl. Wetterer 2003, 17). Die ungleichen Strukturen und Voraussetzungen,<br />
die dem asymmetrischen Geschlechterverhältnis zugrunde liegen, bleiben im<br />
Verborgenen und werden nicht in Frage gestellt und als gegeben hingenommen.<br />
Das Postulat der Gleichheit zwischen den Geschlechtern birgt als Strategie aber<br />
auch die Gefahr der einseitigen Angleichung weiblicher Lebensweisen an männliche<br />
74
Strukturen in sich, während die weiblichen Existenzweisen übersehen oder als<br />
minder bewertet werden 29 (vgl. Klinger 2003, 16).<br />
Die Annahme einer grundsätzlichen Gleichheit aller Frauen innerhalb der Kategorie<br />
Geschlecht, aufgrund gleicher Lebens- und Erfahrungswelten, die Annahme einer<br />
selbstverständlichen Solidarität zwischen Frauen aufgrund gleicher Leidens- und<br />
Unterdrückungserfahrungen („global sisterhood“) ist ebenso unrealistisch wie auch<br />
die Annahme des Weiblichen als „essentialistisch“ (Betonung des unterschiedlichen<br />
Wesens im Vergleich zum Männlichen). Bei dieser Annahme bleiben die Differenzen<br />
zwischen den Frauen in Hinblick auf ihre unterschiedlichen gesellschaftlichen und<br />
kulturellen Positionierungen unberücksichtigt (vgl. Klinger 2003, 16).<br />
In der politisch-pragmatischen Formulierung der Gleichstellungsarbeit bezieht sich<br />
Gleichheit auf die rechtliche Ebene. Dies setzt eine gesetzliche Regelung zur<br />
Gleichstellung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei gleichzeitigem<br />
unmittelbaren und mittelbaren Diskriminierungsverbots aufgrund des Geschlechts<br />
voraus.<br />
5.1.3 Das Dekonstruktionsdilemma<br />
Der dekonstruktivistische Ansatz stellt die binäre Zweigeschlechtlichkeit radikal in<br />
Frage. Verallgemeinernde Aussagen über das Verhalten der Geschlechter wie auch<br />
Lösungsansätze sind demnach nicht möglich. Konfliktpotentiale und Problemlagen<br />
im Verhältnis der Geschlechter können nach diesem Ansatz gar nicht aufgezeigt<br />
werden, da diese dichotome Kategorisierung nicht möglich ist. Für die<br />
Gleichstellungsarbeit gibt es aus dekonstruktivistischer Perspektive kaum<br />
Ansatzpunkte.<br />
Die Position des Dekonstruktivismus ist der Gegenpol zu Positionen der Differenz.<br />
Geschlecht als Kategorie – als binäres Oppositionspaar, als auch Frau als Kategorie<br />
wird grundsätzlich in Frage gestellt. Das Denken in Kategorien muss, so Judith<br />
29<br />
Ein gutes Beispiel liefert m.E. das Verhalten der neuen spanischen Verteidigungsministerin Carmé<br />
Chacon der Regierung Zapatero, die hochschwanger in ein Krisengebiet fährt um zu beweisen, dass sie<br />
dieselben Leistungen wie ein männlicher Verteidigungsminister erbringen kann und Kritik abzuwehren, die<br />
Schwangerschaft würde sie an der Ausübung ihres Amtes behindern.<br />
75
Butler, dekonstruiert werden. Nach Judith Butler 30 gibt es keine exklusive<br />
Zweigeschlechtlichkeit, sondern viele Identitäten. Die Konstrukte „männlich“ und<br />
„weiblich“ sind soziale Konstrukte und müssen dekonstruiert werden. Diese<br />
geschlechtlichen Identitäten sind nach Butler soziokulturelle Inszenierungen, die<br />
unter Druck der Gesellschaft übernommen werden. Für Butler ist das Denken in<br />
Klassifikationen ein Ausdruck von Herrschaft. Sie plädiert gegen eine kritiklose<br />
Annahme des Denkens in Dualismen der Geschlechtsidentitäts-Kategorien und<br />
kritisiert auch die Positionen jenes Differenzdenkens, das vom spezifisch Weiblichen,<br />
von „den Frauen“ als einheitliche Kategorie ausgeht.<br />
Dekonstruktion beschreibt Wetterer (2003) in diesem Zusammenhang für die<br />
politische und pragmatische Gleichstellungsarbeit als Korrektiv und kritisches<br />
Potenzial, um das Deutungsmuster „männlich – weiblich“ immer wieder in Frage zu<br />
stellen und der Kritik zu stellen.<br />
5.1.4 Gleichheit oder Differenz?<br />
„Gibt es eine Gemeinsamkeit unter den „Frauen“ die ihrer Unterwerfung vorangehen,<br />
oder verdankt sich das Band zwischen den „Frauen“ einzig und allein ihrer<br />
Unterdrückung? […] Gibt es ein Gebiet des spezifisch Weiblichen, das sowohl vom<br />
Männlichen als solchen unterschieden ist als auch in seiner Differenz durch eine<br />
unmarkierte und damit hypothetische Universalität der Kategorie „Frau(en)“<br />
erkennbar ist?“ 31<br />
(Judith Butler, 1991)<br />
In der feministischen Debatte hat die Frage Gleichheit oder Differenz eine lange<br />
Tradition. Zwischen Ende der 1960er Jahre und Mitte der 1980er Jahre liegt der<br />
Focus der Debatte um Gleichheit oder Differenz zwischen den Geschlechtern. Dabei<br />
wird von Gleichheit oder Differenz von einem binären, aber diametral entgegen<br />
gesetzten oppositionellen Paar ausgegangen. Es handelt sich wie Klinger (2003)<br />
anführt, um verschiedene Ansätze und Versuche, dasselbe Problem, nämlich die<br />
Tatsache gesellschaftlicher Ungerechtigkeit, der ungleichen Distribution von<br />
30<br />
31<br />
Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main. 1991<br />
Butler, Judith. Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt am Main 1991, 19.<br />
76
Rechten, Gütern, Chancen und Anerkennung, zu lösen. Dabei weisen die<br />
konkurrierenden Ansätze nach Klinger gravierende Mängel auf, da sie auf<br />
unterschiedliche Weise nicht ausreichen, Lösungsmöglichkeiten für die anstehenden<br />
Probleme anzubieten (vgl. Klinger 2003, 16).<br />
Ab den 1980er Jahre vollzieht sich ein Wandel und werden in der feministischen<br />
Diskussion Differenzen oder Gleichheit zwischen den Frauen in den Blickpunkt<br />
gerückt.<br />
Der thematische Wandel resultiert wie Klinger (2003) anführt aus der Einsicht, dass<br />
die Gesellschaft trotz Fortschritte und formaler Rechtsgleichheit der Geschlechter<br />
seit dem frühen 20. Jahrhundert, von einer geschlechtergerechten Gesellschaft weit<br />
entfernt ist. Dem Versuch des Ausgleichs der Benachteiligten durch Angleichung an<br />
die Privilegierten (Männer), folgte aus differenzfeministischer Sicht die Verfolgung<br />
desselben Ziels auf anderem Weg. Die Konzentration auf die Unterprivilegierten<br />
(Frauen), und die Aufwertung derselben durch ins Zentrum rücken von deren<br />
Eigenwert, Eigengewicht, ihrer Geschichte und Vorbilder.<br />
Klinger (2003) kritisiert die Tatsache, dass der thematische Übergang der Debatte<br />
von der Gleichheit oder Differenz der Geschlechter zur Gleichheit oder Differenz<br />
unter Frauen zwar legitim und richtig sei, die erste Phase der Debatte aber<br />
aufgegeben wurde, bevor sie beantwortet wurde. Es ist anzunehmen, dass dies als<br />
Resultat der Enttäuschung über die trägen Auswirkungen der Gleichheitsdiskussion<br />
geschehen ist. Sie bezeichnet dies als „eine schwere Hypothek für die Gegenwart<br />
und Zukunft“ (vgl. Klinger 2003, 15).<br />
Die Debatte um Gleichheit der Frauen im Sinne einer Verbundenheit untereinander,<br />
aufgrund gleicher Lebens- und Leidenserfahrungen, die sozialromantische Annahme<br />
einer „Schwesternschaft“ erweist sich als unrealistisch und defizitär, da die sozialen<br />
und kulturellen Stellungen der Frauen, somit die Differenzen unter den Frauen<br />
unberücksichtigt blieben.<br />
Die Debatte um Differenzen zwischen den Frauen wird schließlich ausgedehnt auf<br />
Differenzen in Hinblick auf soziale Stellung, ethnische Herkunft, kulturelle<br />
Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Alter, Religion und Weltanschauung. Dies führt<br />
schließlich zu der nach wie vor aktuellen Debatte um die gesamtgesellschaftlichen<br />
77
Ungleichheit(en) und Herrschaftsverhältnisse entlang der Kategorien race, class und<br />
gender.<br />
Schließlich impliziert die Frage nach Gleichheit oder Differenz zwischen den<br />
Geschlechtern bzw. unter den Frauen immer auch die Frage nach dem Wesen und<br />
Identität der Subjekte. Vor allem der Differenzansatz verstärkt die Tendenz<br />
Identitätsfragen zu stellen und natur- bzw. kulturbedingte Erkenntnisse zu gewinnen.<br />
Die Frage des „typisch Weiblichen bzw. Männlichen“, die Annahmen über spezifische<br />
weibliche und männliche Kulturen verändern aber auch wie Klinger (2003) anführt,<br />
die Herangehensweisen der Politik von der Interessens- zur Identitätspolitik. Sie<br />
argumentiert, dass herkömmliche politische Prozesse das Aushandeln und<br />
Durchsetzen von Interessen zum Ziel haben. Vorrangig geht es um gerechte<br />
Teilhabe und Zugang zu materiellen und immateriellen Ressourcen. Die Gesellschaft<br />
ist etwas Allgemeines und Ganzes, zu der Individuen und Gruppen Zugang und auf<br />
gerechte Weise teilhaben wollen. Einer Politik der Identität geht es um<br />
Andersartigkeit und Annerkennung von Eigenarten von Gruppen oder Individuen. Im<br />
Mittelpunkt steht die Wahrung und Entfaltung von (kulturell erworbenen oder<br />
angeborenen) Eigenarten, das Recht auf Differenz (vgl. Klinger 2003, 15 ff).<br />
„Einfach gesagt: zielt Gleichheit auf Allgemeinheit, so legt Differenz die<br />
Betonung auf Besonderheit und Besonderung“ (vgl. Klinger 2003, 16).<br />
Beide Ansätze, wenn auch als oppositionell aufgefasst, versuchen letztendlich das<br />
gleiche Problem der gesellschaftlichen Ungerechtigkeit, der ungerechten Verteilung<br />
der Zugänge zu Rechten, Gütern und Chancen, zu lösen. Allerdings weisen die<br />
Positionen gravierende Mängel auf:<br />
_Der Gleichheitsansatz zwischen den Geschlechtern muss sich immer wieder<br />
mit dem Vorwurf der Angleichung der Frau an das Wesen und die Welt des<br />
Mannes, auseinandersetzen. Eine Vernachlässigung der weiblichen<br />
Existenzweise ist die Folge.<br />
_Der Differenzansatz rückt die weibliche Existenzweise in den Mittelpunkt und<br />
muss sich wiederum dem Vorwurf des Essentialismus aussetzen, d.h. Sein<br />
78
und Wesen von Frauen und Männern werden durch tradierte Zuschreibungen<br />
und Stereotypen festgeschrieben, statt aufgelöst.<br />
_Der Gleichheitsansatz zwischen den Frauen durch die Annahme einer<br />
Schwesternschaft durch gleiche Lebenssituationen, ist ebenso essentialistisch<br />
wie unrealistisch und lässt gesellschaftliche und kulturelle Positionen außer<br />
Acht.<br />
_Der Ansatz der Differenzen zwischen Frauen unter Einbeziehung ihrer<br />
gesellschaftlichen und kulturellen Situation wird schließlich soweit geführt,<br />
dass am Ende nicht mehr erkennbar ist, worin überhaupt noch<br />
Gemeinsamkeiten in der Benachteiligung von Frauen bestehen (vgl. Klinger<br />
2003, 16).<br />
Klinger sieht zusammenfassend eine Pattstellung zwischen Gleichheits- und<br />
Differenzansatz, wobei jeder Ansatz auf die Unzulänglichkeiten des anderen<br />
verweist. Sie sieht die Unlösbarkeit im falschen Ansatz der Frage nach Wesen und<br />
Identität der Geschlechter. „Versucht man den Pol der Gleichheit zu fixieren,<br />
bekommt man es sofort mit Differenzen zu tun; will man diese jedoch festlegen, lösen<br />
sie sich im Nu wieder auf“ (vgl. Klinger 2003, 17).<br />
Für die konkrete und praktische Gleichstellungsarbeit gilt es nach Wetterer (2001),<br />
die Dilemmatas und unterschiedlichen Ansätze in all ihren Widersprüchlichkeiten<br />
mitzudenken und zu verknüpfen. Sie bilden ein gegenseitiges Korrektiv und sind die<br />
Voraussetzung für eine erfolgreiche Gleichstellungsarbeit und dem theoretischen<br />
Diskurs. (vgl. Knapp/Wetterer 2001, 142).<br />
79
6. Wissenschaftliche Nachwuchsförderung durch Mentoring<br />
„Aus Gleichstellungsperspektive ist die Frage der Nachwuchsrekrutierung elementar:<br />
Damit genügend Frauen auf den oberen Hierarchiestufen ankommen, müssen sie als<br />
Nachwuchskräfte gefördert werden – das gilt für Positionen innerhalb wie außerhalb<br />
der Wissenschaft. Angesichts der Tatsache, dass die Bedingungen für den<br />
wissenschaftlichen Nachwuchs in vielen Fächern überhaupt prekär sind, kann die<br />
Erhöhung der Chancengleichheit nur im Zusammenspiel mit einer Verbesserung der<br />
Nachwuchsstrukturen überhaupt gelingen“ 32<br />
Ulmi/Maurer 2005<br />
6.1 Mentoring – ein widersprüchliches Konzept<br />
Auf der Suche nach zielführenden Strategien und Maßnahmen zur Erhöhung des<br />
weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses an den Universitäten, vor allem in<br />
Bereichen mit hoher vertikaler und horizontaler Segregation, erlebt in den letzten<br />
Jahren das Förder-Konzept Mentoring im Rahmen der Frauenförderung und<br />
Gleichstellungsarbeit einen Aufschwung.<br />
Mangelnde Integration basierend auf einer Chancenungleichheit im<br />
Wissenschaftssystem und das Sichtbar machen inneruniversitärer<br />
Ausschlussfaktoren sind Ausgangspunkt jeder Konzeption.<br />
6.1.1 Begrifflichkeit von Mentoring<br />
Die Bezeichnung Mentoring umfasst grundsätzlich eine Vielzahl von Förderpraktiken<br />
in den Sparten Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, im öffentlichen Dienst oder Non-<br />
Profit-Bereichen. Die Vielfalt zeigt sich in den Formen, Inhalten und Zielen der<br />
Mentoring-Konzepte. So kann, nach Nöbauer (2004), Mentoring u.a. ein Instrument<br />
der Personalentwicklung, zur Elitebildung in Politik und Wissenschaft, zum Abbau<br />
geschlechtsspezifischer Hemmschwellen bei der Berufswahl von Mädchen, zur<br />
32<br />
Ulmi, Marianne/Maurer, Elisabeth (2005): Geschlechterdifferenz und Nachwuchsförderung in der<br />
Wissenschaft. Studie 3 ihm Rahmen des SOWI-Disslabors. UniFrauenstelle Universität Zürich, 14.<br />
80
Integration von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt oder als Instrument zur<br />
Frauenförderung und Gleichstellung der Geschlechter, sein.<br />
Eine einheitliche Definition des Begriffes Mentoring ist aufgrund der vielen<br />
verschieden Ansätze und Zugänge zu Konzepten von Mentoring in unterschiedlichen<br />
Disziplinen und Anwendungsgebieten, unterlegt durch unterschiedliche ideologische<br />
Annäherungen, schwer möglich.<br />
6.1.2 Formen von Mentoring<br />
Die ursprüngliche Form von Mentoring-Konzepten ist die klassische one-to-one<br />
Förderbeziehung. Historisch betrachtet ist das Vorbild dabei eine Vater-Sohn-<br />
Beziehung.<br />
Mittlerweile gibt es viele Formen von Mentoring, u.a. Einzelmentoring,<br />
Gruppenmentoring (peer-group), Cross-Mentoring, Same-gender-Mentoring, Crossgender-Mentoring,<br />
auf Dauer angelegte Programme oder einzelne Projekte in<br />
Organisationen, den Kern von Mentoring-Beziehung bildet allerdings immer die<br />
persönliche Beziehung zwischen einem/r (meist älteren) Förderer/in und einem<br />
Schützling.<br />
Unterschieden wird auch zwischen informellen und formellen Formen von Mentoring.<br />
Informelles Mentoring geschieht dann, wenn eine Person durch eine andere Person<br />
gefördert wird, ohne sich dessen bewusst zu sein. Aber auch der oder die Mentor/in<br />
muss sich darüber nicht im Klaren sein, dass er oder sie als Mentor/in agiert. Diese<br />
informelle Form von Mentoring wird häufig als Nachwuchsförderung unter Männern<br />
praktiziert (vgl. Meyerhofer 2005, 116). Anzunehmen ist, dass dabei<br />
zwischenmenschliche Faktoren, wie gegenseitige Sympathien eine (Haupt-)Rolle<br />
spielen. Teresa Schweiger 33 spricht das auch im Interview an, in dem sie betont,<br />
dass männliche Führungskräfte sich bei Personal oder Nachfolge oft unbewusst nach<br />
Personen, die ihnen am ähnlichsten sind, sogenannte Mini-me´s bzw. Kronprinzen,<br />
umsehen.<br />
33<br />
Vgl. Interview im Anhang<br />
81
Die formelle Form von Mentoring basiert auf der Vermittlung einer Mentoring-<br />
Förderbeziehung im Rahmen eines Mentoring-Programms.<br />
MentorInnen sind in einem bestimmten Berufsfeld erfahrene und auch erfolgreiche<br />
Personen, die andere Personen (Mentées) – meist jüngere und unerfahrene – in<br />
ihrer beruflichen Karriere unterstützen und fördern. Die Beziehung ist eine<br />
individuelle Förderbeziehung zwischen Personen mit ungleichem Status (vgl.<br />
Nöbauer 2004, 110).<br />
„Mentoring ist aus der historischen Tradition heraus als eigentlicher<br />
Initiationsprozess zu verstehen, in dem ein junger Mann von einem älteren<br />
Mann auf der Suche nach seiner Identität begleitet und in die Spielregeln der<br />
Gesellschaft eingeführt wird. Der Schützling wird am Schluss dieser<br />
Beziehung zu einem Gleichen unter Gleichen, zu einem erwachsenen Mann,<br />
der in die Autonomie entlassen und als potenzieller Konkurrenz anerkannt<br />
wird, unter der Voraussetzung, dass er das Spiel gelernt und dessen Regeln<br />
übernommen hat“ (vgl. Brandner 2005, 18).<br />
In diesem Sinn ist traditionelles Mentoring kein Instrument mit<br />
gesellschaftsverändernden Auswirkungen, sondern bilden traditionelle Mentoring-<br />
Beziehungen Geschlechterordnungen, soziale Hierarchien, Macht- und<br />
Abhängigkeitsverhältnisse ab, in denen (männliche) Elitebildung produziert und<br />
reproduziert werden. In der Literatur wird auf diese Ambivalenzen und<br />
Schwierigkeiten vom Durchbrechen bestehender Machverhältnisse bzw.<br />
Reproduzieren von Machtverhältnissen mittels Mentoring immer wieder hingewiesen<br />
(vgl. Brandner 2005, 17ff; Schliesselberger/Strasser 2000, 13). Ebenso steht die<br />
Frage des Einschlusses (oder Einführung) in oder Ausschluss von bestehenden<br />
Systemen oder Netzwerken mittels Mentoring Konzepten immer wieder zur Debatte.<br />
Der Name Mentoring geht ursprünglich auf die mythologische Figur des Mentors,<br />
einem Freund des Odysseus, zurück. Während der langjährigen Abwesenheiten von<br />
Odysseus, kümmert sich Mentor um dessen Sohn, Telemachos. Er ist Vorbild und<br />
Lehrer, Berater und Vaterfigur und verantwortlich für die persönliche und politische<br />
Entwicklung seines Schützlings. Er ist dabei emotionale und intellektuelle Leitfigur<br />
82
und vermittelt durch seine Erfahrungen die richtigen gesellschaftlichen<br />
Verhaltensweisen.<br />
Der Name Mentor wurde somit zum Begriff für Vorbild und Erzieher, für eine<br />
erfahrene, erfolgreiche Person, die eine andere, meist jüngere und unerfahrene<br />
Person unter seine Fittiche nimmt.<br />
Hinter der mythologischen Figur des Mentors in Odysseus Homer, steht die Göttin<br />
Pallas Athene, die in männlicher Gestalt die Rolle des Mentors übernommen hat.<br />
(vgl. Strasser/Schliesselberger 2002, 215; Strasser/Schliesselberger 1998, 16).<br />
Diese Grundidee des Vorbild und Erziehers wurde aus der griechischen Mythologie<br />
auf Konzepte der Neuzeit übertragen.<br />
In den USA ist das Konzept Mentoring im Bereich Wirtschaft und Berufsleben seit<br />
den 1970er Jahren ein Instrument der Personalentwicklung und fixer Bestandteil<br />
eines Karriereverlaufes. „Everyone Who Makes It Has a Mentor” betont die Harvard<br />
Business Review 1979 34 die Notwendigkeit von Mentoring. Eine Vielzahl von<br />
theoretischen Abhandlungen und Studien, die den Zusammenhang zwischen<br />
Mentoring und Karriereverlauf erfolgreicher Männer zum Inhalt hatten, wurden<br />
veröffentlicht. 35<br />
Erstmals tritt auch die Rolle des Geschlechts in den Vordergrund und die Bedeutung<br />
von Same-Gender- und Cross-Gender-Mentoring und seine Wichtigkeit für die<br />
berufliche Karriere von Frauen untersucht.<br />
Formelles Mentoring gilt im englischsprachigen Raum als wichtige Maßnahme zur<br />
Nachwuchs- und Laufbahnförderung. Von einer expliziten Förderkultur zeigen auch<br />
die amerikanischen Universitäten mit eigens zur Nachwuchsunterstützung<br />
eingerichteten Institutionen (Career Centers). Credit Points für ProfessorInnen, die<br />
Nachwuchsförderung betreiben, sind im Gegensatz zum deutschsprachigen<br />
Hochschulsystem durchaus üblich.<br />
Trotz dieser ersten Hochphase wurde Mentoring durchaus nicht nur als<br />
funktionierend und gültig gesehen. Ein Zusammenhang zwischen Mentoring und<br />
daraus resultierenden wirtschaftlichen Erfolg (Einkommen, Zufriedenheit, Aufstieg)<br />
34<br />
35<br />
Zitiert nach Schliesselberger/Strasser 1998, 17.<br />
U.a. D.J. Levinson (1978) Studie zur zentralen Bedeutung von Mentoren für „große Männer“ anhand von<br />
40 Männerkarrieren. The seasons of a man´s life 1979.<br />
83
wurde als hypothetisch angenommen und vorausgesetzt, eine erfolgreiche<br />
Evaluation konnte allerdings in Untersuchungen 36 nicht festgestellt werden.<br />
Ein weiterer Problembereich umfasst die Frage des Einschlusses und Ausschlusses<br />
durch Förderbeziehungen bzw. zeigt dessen Ambivalenzen. Je nachdem wie<br />
Mentoring-Konzepte interpretiert oder benützt werden, können benachteiligte<br />
Gruppen gefördert und in ein organisationales System integriert werden, als auch<br />
gezielt Elitenbildung betrieben werden. Förderbeziehungen können sowohl<br />
Einschluss als auch Ausschluss produzieren.<br />
Im englischsprachigen Raum ist Mentoring seit den 1970er Jahren trotz dieser<br />
Ambivalenzen und Unsicherheiten auch im Bereich Wissenschaft und Karriereverlauf<br />
ein zentrales Fördermodell.<br />
In der Hochphase von Mentoring in den 1980er Jahren ist Mentoring essentiell für<br />
den wissenschaftlichen Erfolg und dem universitären Aufstieg und wird ein ideales<br />
Bild der Förderbeziehung gezeichnet. Die Aufgabe der MentorInnen ist es, die<br />
Schützlinge anzuleiten, einzuführen, zu beraten, zu instruieren, die wissenschaftliche<br />
und die persönliche Entwicklung zu fördern (vgl. Strasser 1998, 20).<br />
Die Auseinandersetzung um die Bedeutung der Kategorie Geschlecht, Debatten um<br />
Differenzen zwischen Frauen und zwischen den Geschlechtern, die soziale und<br />
ethnische Herkunft in wissenschaftlichen Förderbeziehungen, wird nach und nach in<br />
die Diskussion miteinbezogen.<br />
Anfang der 1990er Jahre rückte Mentoring als Modell auch für ethnische Gruppen<br />
oder Angehörigen von Minderheiten zur Erhöhung der Chancengleichheit ins<br />
thematische Blickfeld.<br />
Der Versuch, Mentoring als Mittel der Veränderung von bestehenden<br />
Benachteiligungen und Differenzen zu nutzen, bewirkt auch eine Distanzierung vom<br />
Erfolg versprechenden Konzept und zeigte die Widersprüchlichkeiten des Konzeptes<br />
auf.<br />
36<br />
Speitzer (1981) zeigt dies in ihrem Essay „Role Models, Mentors, and Sponsors“ auf und verlangt nach<br />
Definitionen für die unterschiedlichen Begriffe und Konzepte als Voraussetzung für die Untersuchung von<br />
Zusammenhängen zwischen Förderbeziehung und beruflichen bzw. wirtschaftlichen Erfolg (Speitzer 1981, zit.<br />
nach Schliesselberger/Strasser 1998, 18).<br />
84
Mentoring im universitären Feld kann, nach Strasser (1998), grundsätzlich<br />
verschiedene Ebenen der universitären Laufbahn (Studium, Dissertation- und<br />
Habilitationsphase, Einstieg und Aufstieg in der wissenschaftlichen Laufbahn) als<br />
auch unterschiedliche Ebenen innerhalb der Organisationsstruktur (Verwaltung,<br />
Forschung, Lehre) umfassen. Auch existieren verschiedene<br />
Beziehungskonstellationen im universitären Feld: gleich- und höherrangige<br />
KollegInnen, ReferentInnen und AbteilungsleiterInnen von Organisationseinheiten<br />
oder Fachbereichen, u.ä.<br />
Eine einheitliche Definition ist auch bei Beschränkung auf das universitäre Feld nicht<br />
möglich. Zugänge und Intentionen zu den Konzepten sind zu unterschiedlich und<br />
bleiben „Verwirrungen anlässlich der vielen Definitionen,<br />
Instrumentalisierungsmöglichkeiten und synonym verwendeten Begriffen nicht aus“<br />
(vgl. Strasser 1998, 20).<br />
Für die AkteurInnen der Gleichstellungs- und Frauenförderungspolitik an den<br />
Universitäten ist die Erhöhung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses auf<br />
höheren hierarchischen Ebenen elementar. Um die gläserne Decke im sozialen Feld<br />
Wissenschaft zu durchbrechen werden Strategien und Maßnahmen gesucht, um<br />
Chancengleichheit zu fördern. Zwei Ansatzpunkte für die Gleichstellungsarbeit sind<br />
dabei zu bedenken: Erstens spezifische Frauenförderungsprogramme zur<br />
Unterstützung der Nachwuchswissenschafterinnen mit den Vor- und Nachteilen bzw.<br />
Ambivalenzen, auf die zuvor hingewiesen wurde und zweitens Änderung bzw.<br />
Verbesserung von strukturellen Rahmenbedingungen, welche gleichberechtigte<br />
Voraussetzungen für die Karriere in der Wissenschaft schaffen.<br />
Neben monetären Frauenförderungsprogrammen in Form von<br />
Weiterbildungsmaßnahmen (Stipendien, finanzielle Anreizsysteme, u.ä.), ist in den<br />
letzten Jahren ein regelrechter Boom an Förderungsmaßnahmen in Form von<br />
Mentoring-Programmen an den deutschsprachigen Universitäten und Hochschulen<br />
zu beobachten.<br />
Aufgebaut sind diese Aktivitäten auf der Einführung von Gender Mainstreaming in<br />
die gesetzlichen Grundlagen sowie die Implementation von Frauenförderungsplänen<br />
an den Universitäten als weitere Chance, die Geschlechterperspektive auf alle<br />
Ebenen der organisationalen Strukturen und des Handelns einzubringen.<br />
85
Die Bedeutung von MentorInnen zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft,<br />
verschiedene Mentoringmodelle und deren Auswirkungen auf die Produktivität von<br />
WissenschafterInnen, konkrete Auswirkungen auf Karrierechancen von Frauen, aber<br />
auch Abhängigkeiten Ausbeutung und Isolation durch Mentoring werden verstärkt<br />
diskutiert.<br />
Mentoring-Programme für Wissenschafterinnen fallen unter traditionelle<br />
Frauenförderungsinstrumente, auf deren kontraproduktive Wirkungen bereits<br />
hingewiesen wurde. Die steigende Anzahl von Mentoring-Projekten in den letzten<br />
Jahren an den Universitäten im deutschsprachigen Raum, ist auffallend. Aber nicht<br />
nur im tertiären Bildungssektor, sondern auch in Wirtschaftsunternehmen,<br />
Institutionen des öffentlichen Bereichs und nicht zuletzt in die Politik haben<br />
Mentoring-Projekte Eingang gefunden, wird Mentoring als individuelles<br />
Förderinstrument eingesetzt.<br />
Bei der Konzipierung dieser Programme müssen die Rahmenbedingungen, d.h.<br />
immer auch Organisationsstruktur und -kultur mitreflektiert werden. Im Bereich der<br />
Universität heißt dies, die europaweiten Umstrukturierungen, Angleichungen der<br />
Systeme und Reformen im Hochschulbereich, den Drang und die Notwendigkeit zur<br />
„Marktfähigkeit“ der Universitäten und deren Auswirkungen auf die Bemühungen um<br />
„echte“ Gleichstellung in einer komplexen Organisation, bei gleichzeitiger<br />
Verrechtlichung von Gleichstellung und Gleichstellungsmaßnahmen ebenso kritisch<br />
mit zu reflektieren, wie auch die informellen Spielregeln und Beziehungsebenen der<br />
Organisationskultur.<br />
In ihrem Aufsatz über die Problematik von Mentor-Protegé-Beziehungen und ihre<br />
universitäre Sozialisation sieht Agnes Dietzen (1990) eher Nachteiliges für<br />
Wissenschafterinnen bei Eingehen solcher Bindungen. Sie bezeichnet die Universität<br />
für Frauen grundsätzlich als einen „sperrigen“ Ausbildungsort und ein<br />
„problematisches“ Arbeitsmilieu. In Spitzenposition blieben Frauen zahlenmäßig<br />
„kontinuierliche Seltenheiten“. Ihrer Meinung nach liegen die Schwierigkeiten in<br />
„diffusen Abhängigkeitsverhältnissen“, welche im Grunde auf verlängerte Mentor-<br />
Protégé-Bindungen (Professor-Assistenten/Mitarbeiter, Doktorvater/Doktoranden-<br />
Beziehungen) zurückzuführen sind.<br />
86
Sie zeigt in ihrer Analyse von Mentor-Protégé-Bindungen in der Wissenschaft die<br />
bisherige Wichtigkeit der Mentorenschaft für die akademische Sozialisation der<br />
Wissenschafterinnen und Pionierinnen. Fehlende Protegierung ist einer der<br />
Hauptgründe, warum Frauen hartnäckig unterrepräsentiert bleiben. Gleichzeitig stellt<br />
sie dabei die Ambivalenz dieser Beziehungen dar und spricht von einer<br />
„Ghettoisierung“ erfolgreicher Wissenschafterinnen bei Bindung an männliche<br />
Mentoren. Ihrer Meinung nach existieren zu wenig gleichgeschlechtliche Alternativen,<br />
Frauen als „Doktormütter“. Die Beziehungsmodelle folgen dem Muster der<br />
traditionellen Geschlechtersozialisation und haben sich paternalistische Strukturen<br />
bis heute erhalten, wie auch der gängige Begriff „Doktorvater“ impliziert. Die<br />
Beziehung und Verhältnisse zwischen Mentor und seinem weiblichen Protégé sind<br />
Dietzens Meinung nach, schwer fassbar und durch extrafunktionale Faktoren und<br />
Ambivalenzen bestimmt (vgl. Dietzen 1990, 21).<br />
Letztendlich ist die Aufnahme und Bewährung im sozialen, informellen Feld der<br />
Wissenschaft von persönlichen Verhältnissen abhängig. Die Fähigkeiten sich im<br />
wissenschaftlichen Milieu zu bewegen, Kontakte zu knüpfen, Veröffentlichungs- und<br />
Publikationsangebote, Empfehlungen 37 zu erhalten sind auf die Wohlgesonntheit<br />
eines Unterstützers angewiesen.<br />
In diesem Feld der informellen und diffusen Abhängigkeiten lokalisiert Bourdieu in<br />
den Lehrer-Schüler-Beziehungen den Kern einer dauerhaften akademischen Macht.<br />
Für den Mentor besteht die Möglichkeit, Schüler an sich zu binden,<br />
Erwartungshaltungen für die Karriere zu wecken und „Hörigkeit zu produzieren“,<br />
welche den Mentor „erhöht“ und den eigenen Einflussbereich ausweitet. Für<br />
Bourdieu gehen diese individuellen Beziehungen aber weiter, sie setzen einen<br />
„Einverständnisglauben“ der Institution voraus. Nachwuchskräfte werden auf den<br />
stillschweigenden institutionellen Konsens eingeschworen (vgl. Dietzen 1990, 19).<br />
Diese von Abhängigkeiten geprägten Sozialisationsbeziehungen im<br />
wissenschaftlichen Feld nützen einer informellen Struktur, welche sich immer wieder<br />
selbst reproduziert.<br />
37<br />
Pierre Bourdieu 1988 bezeichnet diese Fähigkeiten in „Homo Academicus“ als „soziales Kapital“ von<br />
Wissenschaftern.<br />
87
Von diesem Standpunkt aus, liegt der Auftrag von Mentoring eher im System<br />
erhaltenden und System reproduzierenden Verhalten, ein Instrument mit wenig<br />
Veränderungspotential, das Abhängigkeitsverhältnisse produziert und reproduziert.<br />
In ihrer Studie „In den Fußstapfen der Pallas Athene“ 38 haben sich Schliesselberger<br />
und Strasser 1998 mit den Möglichkeiten und Grenzen von Mentoring im<br />
universitären Feld beschäftigt. Mögliche Grenzen bzw. Hemmnisse des<br />
Förderinstrumentes Mentoring sehen sie in der Beziehung zwischen den<br />
MentorInnen und Mentées, in einer unterschiedlichen sozialen und ethnischen<br />
Herkunft, unterschiedlicher sexueller Orientierungen und nicht zuletzt auch innerhalb<br />
bzw. zwischen den Geschlechtern.<br />
Neben Mentoring als Instrument zur Einführung in bestehende gesellschaftliche<br />
Verhältnisse, dessen Erfolg auch maßgeblich davon abhängig ist, ob die „Chemie“<br />
des Mentoring-Paares stimmt, kommt Ende der 1990er Jahre, wie bereits erwähnt,<br />
ein weiterer Aspekt in die Debatte um Mentoring hinzu. Neben der Einführung und<br />
Unterstützung benachteiligter und unterrepräsentierter Gruppen in bestehende<br />
Systeme, werden die Ungleichheit produzierenden Systeme selbst, Teil der Debatte.<br />
Mentoring soll somit jetzt auch dafür genutzt werden, strukturelle Ungleichheiten in<br />
einem System sichtbar zu machen, zu benennen und so für Veränderungen zu<br />
sorgen.<br />
So beschäftigen sich Genetti/Nöbauer/Schlögl (2005) mit Mentoring für<br />
Wissenschafterinnen im Spannungsfeld der universitären Kultur- und<br />
Strukturveränderung und sehen „gleichstellungspolitische Maßnahmen wie Mentoring<br />
(…) nicht nur als eine Maßnahme zum Ausgleich von Nachteilen für<br />
Wissenschafterinnen (…), sondern auch als Strategie zur Struktur- und<br />
Kulturveränderung der Universitäten im Gesamten.“ (vgl. Genetti/Nöbauer/Schlögl<br />
2005, 14).<br />
Für die Autorinnen ist es unerlässlich, dass Mentoring-Programme in ihrer<br />
Konzeption immer auch die (geschlechts-)hierarchische Organisationsstruktur der<br />
Universität mit einzubeziehen und stellen sie sich weiter die Frage, ob Mentoring als<br />
38<br />
Vgl. Schliesselberger, Eva/Strasser, Sabine (1998): In den Fußstapfen der Pallas Athene. Möglichkeiten<br />
und Grenzen des Mentoring von unterrepräsentierten Gruppen im universitären Feld. Materialen zur Förderung<br />
von Frauen in der Wissenschaft. Band 7. Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr. Wien.<br />
88
Förderinstrument einen Beitrag zur Strukturveränderung der Universitäten in<br />
Richtung Geschlechtergerechtigkeit überhaupt leisten kann (vgl.<br />
Genetti/Nöbauer/Schlögl 2005, 15).<br />
89
6.2 Mentoringprojekte -<br />
m:uv an der Universität Wien<br />
Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung Universität Salzburg<br />
Aktuell laufen an österreichischen Universitäten Mentoring-Projekte bzw. werden<br />
Programme konzipiert und initiiert. Die Zugänge und Ansätze sind dabei je nach<br />
Universität und Fachausrichtung unterschiedlich.<br />
Ich habe zwei Projekte mit unterschiedlicher Ausrichtung genauer untersucht und die<br />
beiden Projektleiterinnen dazu interviewt.<br />
Während das Wiener Programm m:uv vom Ansatz des Gruppenmentoring (peergroup)<br />
ausgeht, bereits dem vierten Durchgang plant und mittlerweile relativ etabliert<br />
ist, ist das Salzburger Programm in Kooperation mit der Universität Linz, als<br />
klassisches one-to-one Mentoring-Programm konzipiert und aktuell gerade in der<br />
Bewerbungs- und Matchingphase.<br />
Das Wiener Programm m:uv greift mittlerweile auf die positiven Erfahrungen von drei<br />
abgeschlossenen und evaluierten Durchgängen zurück, das Salzburger Programm<br />
läuft zum ersten Mal und ist in der Bewerbungs- bzw. Matchingphase, mit Beginn im<br />
Herbst 2008. Beschränkt auf zwei MentorInnen und zwei Mentées pro teilnehmende<br />
Universität, setzt es auf eine gezielte Förderung in den traditionell für<br />
Nachwuchswissenschafterinnen schwierigem Terrain naturwissenschaftlichtechnischer<br />
Fächer.<br />
Die Idee des überuniversitären Kooperationsprogramms mit der Johannes-Kepler-<br />
Universität Linz, entstand aus der Notwendigkeit, geeignete Personen in diesen<br />
Fächern auf MentorInnenseite ebenso wie auf Seiten der Mentées, zu finden.<br />
Ebenso neu an dieser Konzeption ist das gezielte Herantreten an geeignete<br />
MentorInnen nach Auswahl der Mentées. Damit soll ein möglichst großer Profit für<br />
beide Seiten garantiert sein. Gleich ist beiden Programmen, dass sie als Cross-<br />
Gender-Programme konzipiert sind, aus dem profanen Grund der größeren<br />
Auswahlmöglichkeiten unter geeigneten Personen vor allem auf Seiten der<br />
MentorInnen, basierend aber auch auf den bisherigen Erfahrungen der Mentoring-<br />
Programme.<br />
90
6.2.1 Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung –<br />
Mentoring an der Universität Salzburg<br />
Das gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung an der Universität<br />
Salzburg bietet seit 2003 gemeinsam mit der Stabsabteilung für Gleichstellungsarbeit<br />
an der Universität Linz ein Kooperationsprojekt zur wissenschaftlichen<br />
Nachwuchsförderung unter dem Titel karriere_links an.<br />
Entstanden ist die Idee eines gemeinsames Nachwuchsförderungsprogramm durch<br />
dasselbe Ziel der Stärkung der Geschlechterdemokratie an den Universitäten Linz<br />
und Salzburg sowie der Förderung der Karrierechancen für Wissenschafterinnen.<br />
Ausschlaggebend dabei ist die Erkenntnis, dass sich Gleichstellungspolitik nicht in<br />
frauenbezogener Förderung erschöpfen darf, sondern als Strukturpolitik die gesamte<br />
Organisationsentwicklung erfassen muss. Das Programm ist ein mehrschichtiges<br />
Nachwuchsförderungs- und Karriereplanungskonzept, das die Erhöhung des<br />
Frauenanteils in höheren wissenschaftlichen Positionen zum Ziel hat.<br />
Um Frauen bei der durchgängigen Wissenschaftskarriere zu unterstützen setzt das<br />
Konzept auf mehreren Ebenen an:<br />
Auf der Ebene der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen in Ausbildung,<br />
Vertragsassistentinnen, Wissenschafterinnen in Ausbildung, Mitarbeiterinnen von<br />
Forschungsprojekten und Lektorinnen setzt das Konzept durch Unterstützung und<br />
Begleitung in der Dissertationsphase und Laufbahnplanung an.<br />
Auf der postdoc-Ebene liegt das Hauptaugenmerk auf der Unterstützung während<br />
der Habilitationsphase.<br />
Das Kooperationsprojekt karriere_links wird nun durch eine weitere Ebene der<br />
Förderung ergänzt: durch ein Mentoring-Programm für naturwissenschaftliche und<br />
technische Nachwuchswissenschafterinnen auf dem Weg zur Professorin bzw. in<br />
eine Leitungsfunktion.<br />
Der Absolventinnenanteil an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität<br />
Salzburg ist, wie im Kapitel 4.2 erwähnt, in den Fächern Mathematik, Chemie,<br />
Materialwissenschaften, Computerwissenschaften und Ingenieurswissenschaften<br />
sehr gering im Gegensatz zu den ebenfalls an der naturwissenschaftlichen Fakultät<br />
angesiedelten Fächern Biologie, Geographie und Psychologie. In diesen Fächern<br />
91
esteht bereits der Großteil aus Absolventinnen. So gibt es z.B. in den<br />
Materialwissenschaften nur eine weibliche post-doc-Wissenschafterin, in Mathematik<br />
nur eine Habilitierte.<br />
Da inneruniversitär ein Mangel an weiblichen Führungspersönlichkeiten in diesen<br />
Fächern herrscht, ist das Mentoring-Projekt zur Synergiebildung zwischen den<br />
beiden Universitäten Salzburg und Linz angelegt.<br />
Die Konzeption des Programms sieht Vorteile im überuniversitären Austausch durch<br />
Einblicke in andere Forschungsprojekte, Zugang zu neuen Netzwerken und einen<br />
bereitwilligen Austausch von vorhandenem Wissen.<br />
Das Projekt richtet sich an Frauen, die sich für eine wissenschaftliche Karriere<br />
entschieden haben, mit dem Ziel, diese in einer Führungsposition ausüben zu<br />
können.<br />
Das Projekt startet im Oktober 2008 für eine Dauer von zwei Jahren. Die Auswahl<br />
der Mentées erfolgt über Bewerbungen, nach Auswahl der Mentées werden die<br />
MentorInnen gezielt ausgesucht und unter Einbeziehung von bereits vorhandenen<br />
MentorInnenwünsche der Mentées, persönlich angesprochen.<br />
Die Anforderungen an die Mentées bestehen aus einem ernsthaften Anstreben einer<br />
Karriere in der Wissenschaft, einer Entwicklung realistischer Karriereschritte sowie<br />
Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Die Vorteile für die Mentées sind die<br />
bewusste Entwicklung von Karrierestrategien, Nutzung von überuniversitären<br />
Netzwerken und das Kennen lernen anderer Fachkulturen.<br />
Die Anforderungen an die MentorInnen bestehen in der Bereitschaft Wissen<br />
weiterzugeben, in ihrer Beratungskompetenz, im Öffnen von Netzwerken für den<br />
wissenschaftlichen Nachwuchs und dem Interesse an anderen Forschungskulturen.<br />
Die Vorteile dieses Projektes für die MentorInnen sind die Knüpfung neuer,<br />
überuniversitären Kontakte in der scientific community, die Vertiefung ihrer<br />
Beratungskompetenz, Erweiterung der eigenen Netzwerke sowie die Reflexion der<br />
eigenen Forschungstätigkeit. Die MentorInnen haben die Möglichkeit begleitende<br />
individuelle Coachinggespräche zur Selbstreflexion in Anspruch zu nehmen.<br />
Pro Universität wird es zwei MentorInnen und zwei Mentées geben. Die Paare<br />
werden gemischtuniversitär „gematcht“. Geplant sind zwei strukturierte<br />
92
Gesprächstermine pro Semester. Die Mentées werden während der Laufzeit drei<br />
Themenworkshops absolvieren, die MentorInnen werden vier bis sechs<br />
Coachingtermine absolvieren können. Diese Begleitung soll dazu dienen,<br />
uniübergreifend ein möglichst professionelles Verhältnis der MentorIn-Mentée<br />
Beziehung zu ermöglichen.<br />
Im Unterschied zur Same-Gender-Mentoring Beziehung ist dieses Projekt als Cross-<br />
Gender-Mentoring-Projekt konzipiert. Die Konzipierung als Cross-Gender-Projekt<br />
erfolgt aus den bekannten Gründen des Mangels an weiblichen Wissenschafterinnen<br />
in diesen spezifischen Fächern. Durch den Cross-Gender-Ansatz kann der Pool der<br />
in Frage kommenden WissenschafterInnen vergrößert werden. Ein weiterer Grund ist<br />
das Zeitproblem der wenigen weiblichen Wissenschafterinnen in diesen<br />
Studienrichtungen und den zusätzlichen Belastungen, den sie durch<br />
Mentorinnenschaft ausgesetzt wären. Zusätzlich soll, wie Teresa Schweiger 39 im<br />
Gespräch betont, nicht der Eindruck verstärkt werden, es handle sich um ein Projekt<br />
von „Outsiderin“ zu „Outsiderin“. Auch wenn den Mentorinnen aufgrund ihres<br />
Geschlechts die wichtige Funktion eines role models zukommt, lernen männliche<br />
Mentoren – ist Schweiger überzeugt – durch den Prozess ihre eigene Rolle als<br />
Vorbild zu überdenken und als Multiplikatoren für zukünftige geschlechtergerechtere<br />
Strukturen einzutreten.<br />
Der Name des Projektes Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung ist nach<br />
Schweiger bewusst so gewählt, um die Bezeichnung Frauenförderung zu vermeiden<br />
und keine „Abschreckung“ zu produzieren.<br />
Nach einem Jahr Laufzeit wird mit einer öffentlich zugänglichen<br />
Informationsveranstaltung für alle Beteiligten eine Zwischenbilanz gezogen.<br />
Zum Abschluss des Projekts wird es eine Broschüre mit den Evaluationsergebnissen<br />
über das Kooperationsprojekt Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung geben.<br />
Teresa Schweiger betont im Gespräch die Exklusivität des Projektes im<br />
universitätsübergreifenden Konzept. Durch das Programm kann für die Mentées ein<br />
Zugang in andere Forschungskulturen geschaffen werden und Netzwerke geöffnet<br />
werden, die gerade in den spezifischen naturwissenschaftlichen und technischen<br />
Forschungsgebieten durch ihre Spezifikationen schwer zugänglich sind. Schweiger<br />
39<br />
Leiterin des gendup-Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung, Universität Salzburg. Theresa<br />
Schweiger ist Mitinitiatorin des Mentoringprojektes.<br />
93
etont, dass die Mentoring-Beziehungen so angelegt sind, dass sie weniger<br />
Austausch über persönliche Schwierigkeiten und Probleme während der<br />
Karriereplanung, mit dementsprechenden Karrieretipps von MentorInnenseite, sein<br />
sollen – hier unterscheidet sich das Projekt in der Konzeption von m:uv – , sondern<br />
liegt der Focus auf den inhaltlichen, forschungsrelevanten Austausch von Wissen<br />
und der bereitwilligen Weitergabe dieses Wissens. Sie führt aus, dass vor allem in<br />
den spezifischen Forschungen der Naturwissenschaften und Technik ein Einblick in<br />
die Forschungsgebiete anderer Universitäten neue Kooperationsmöglichkeiten und<br />
Netzwerkerweiterungen für alle Beteiligten ermöglicht wird.<br />
6.2.2 Mentoring-Projekt mu:v der Universität Wien<br />
Das Mentoring-Programm mu:v (mentoring university vienna) des Referats für<br />
Frauenförderung und Gleichstellung der Universität Wien ist eine mittlerweile<br />
etablierte Maßnahme zur Förderung der wissenschaftlichen Karriere von Frauen.<br />
Nachwuchswissenschafterinnen erhalten die Möglichkeit durch Mentoring<br />
Beziehungen zu ProfessorInnen aufzubauen und diese für die eigene Karriere zu<br />
nutzen.<br />
Die Konzeption des Programmes beinhaltet neben fächerübergreifendes Gruppen-<br />
Mentoring (peer-group-mentoring), zusätzliche Seminare und begleitende<br />
Informationsveranstaltungen zur Ausbildung von Schlüsselqualifikationen im<br />
wissenschaftlichen Feld. Der Wissensaustausch passiert dabei nicht nur von<br />
MentorIn zu Mentée, sondern auch durch die Mentées untereinander in ihrer<br />
jeweiligen peer-group. Neben den besseren Vernetzungsmöglichkeiten für Mentées<br />
in peer-groups ist ein weiterer struktureller Vorteil dieses Ansatzes bei Mangel an<br />
MentorInnen in bestimmten Fachbereichen, diesen durch die fächerübergreifenden<br />
Kleingruppen auszugleichen.<br />
40 Mentees und 10 MentorInnen nehmen an einem Durchgang teil und arbeiten für<br />
einen Zeitraum von drei Semestern in Kleingruppen (4 Mentees pro MentorIn)<br />
zusammen. Für die gemeinsamen Treffen ist ein zeitlicher Rahmen von 10 Stunden<br />
pro Semester veranschlagt. Zwei Stunden Gruppensupervision pro Semester sollen<br />
pro Gruppe in Anspruch genommen werden und für die Mentées gibt es zusätzlich<br />
das Angebot von Coachingmodulen zu verschiedenen Themen (Karriereplanung,<br />
94
Konfliktmanagement im wissenschaftlichen Feld, Zeitmanagement,<br />
Präsentationstechniken, etc.).<br />
Im Herbst 2009 startet bereits der 4. Durchgang dieses Mentoring-Programms.<br />
Entstanden ist das Programm aus einem Pilotprojekt 2001, das auf Initiative der<br />
damaligen Koordinationsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung ins Leben<br />
gerufen wurde. Bis zur dritten Periode wurde ein Teil des Programms<br />
drittmittelfinanziert, mittlerweile wird es zur Gänze von der Universität Wien finanziert.<br />
Ein wesentlicher Bestandteil des Programms ist eine begleitende, prozessorientierte<br />
Evaluation.<br />
Übergeordnete Zielsetzung der Projektleiterinnen von mu:v ist es,<br />
• Zugänge zu informellen und formellen Netzwerken und wichtige Kontakte im<br />
Wissenschaftsbetrieb zu ermöglichen, und diese transparent zu gestalten;<br />
• Mentées in der Erreichung der beruflichen Ziele zu unterstützen;<br />
• Berufszugang zum Wissenschaftsbetrieb und Stärkung der Position;<br />
• Transparenz über herrschende Beförderungsmechanismen und<br />
Aufstiegsmechanismen herzustellen und dadurch zu verändern.<br />
Weitere konkrete Teilziele werden nach Feststehen der jeweiligen Gruppe und<br />
Abklären individuellen Wünsche und Ziele formuliert.<br />
Wichtig beim Einstieg in das Gruppenmentoring ist es eine jeweilige realistische<br />
Bestandsaufnahme der Ausgangssituation der Mentées vorzunehmen und daraus<br />
realistische Ziele pro Gruppe zu formulieren und diese je nach Entwicklung immer<br />
wieder anzupassen.<br />
Die Heterogenität der Gruppe ist nach den bisherigen Erfahrungen der Leiterinnen<br />
durch die sozialen Prozesse, die darin stattfinden, mehrheitlich positiv zu bewerten.<br />
95
6.3 Struktur- und Kulturveränderung durch Mentoring an den Universitäten<br />
Nöbauer/Genetti (2006) bezeichnen mit der strukturellen und kulturellen Änderung an<br />
den Universitäten einen emanzipatorischen oder gleichstellungspolitischen Wandel<br />
der „sozialen, rechtlichen, politischen und symbolischen Ordnungen einschließlich<br />
der damit verbundenen sozialen Praktiken im universitären Alltag, die die<br />
Geschlechterhierarchie der universitären Organisation und deren<br />
Herrschaftsansprüche prägen, legitimieren und reproduzieren“ (vgl. Nöbauer/Genetti<br />
2006, 69).<br />
Die Dominanz der Männlichkeitsform, die in diese Ordnungen und Praktiken<br />
eingeschrieben ist, gilt es zu verändern, und zwar nicht nur auf der strukturellen<br />
Ebene der Organisation, sondern – dies ist sicher der schwierigere Teil – auch in den<br />
Handlungs- und Denkweisen der Mitglieder der universitären Organisation, der<br />
kulturellen Ebene.<br />
Die hegemoniale Männlichkeit ist nach Conell (2000) „jene Konfiguration<br />
geschlechtsbezogener Praxis, welche die momentan akzeptierte Antwort auf das<br />
Legitimationsproblem des Patriarchats verkörpert und die Dominanz der Männer<br />
sowie die Unterordnung der Frauen gewährleistet“ (vgl. Conell 2000, 98). Diese<br />
hegemoniale Männlichkeit zeichnet sich durch einen erfolgreich erhobenen Anspruch<br />
auf Autorität aus, der sich durchsetzt und sich aus der Männlichkeit ableitet, ohne in<br />
Frage gestellt zu werden.<br />
Effektive Gleichstellungsmaßnahmen können daher nicht mit einer zahlenmäßigen<br />
Erhöhung des Frauenanteils in der Wissenschaft enden, sondern müssen nach<br />
Nöbauer/Genetti (2006) immer auch Wissenschafts- und Institutionenkritik mit<br />
einschließen und die Reproduktion der systemerhaltenden Strukturen in Frage zu<br />
stellen.<br />
Ein Strukturwandel von einer androzentristisch geprägten Organisationsstruktur und<br />
Organisationskultur zur geschlechtergerechten Organisationsstruktur und -kultur an<br />
den Universitäten ist schließlich das Ziel der Frauenförderungs- und<br />
Gleichstellungspolitik, dazu braucht es aber mehr als das Engagement der<br />
AkteurInnen.<br />
96
Astrid Franzke (2003), die sich in Deutschland mit Mentoring an den Hochschulen<br />
beschäftigt, zeigt auf, dass individuelle Fördermaßnahmen und die Ergebnisse<br />
daraus, nicht automatisch strukturelle Wirkungen haben. So wirkt die Steigerung der<br />
Anzahl der Frauen in Hochschulen zwar gegen deren Minderheitenstatus, diese<br />
quantitative Zunahme führt aber nicht automatisch zu geschlechtergerechteren<br />
Strukturen. Dazu sind nach Franzke komplexe Veränderungsprozesse auf allen<br />
Strukturebenen notwendig. Sie sieht es als Pflicht von Mentoring-Programmen und –<br />
konzepten dafür zu sorgen, dass subtile, schwer fassbare Karrierehindernisse für<br />
Frauen sowie die symbolische Macht, die mit dem Androzentrismus der<br />
akademischen Lebens- und Berufsverläufe verbunden ist, sichtbar zu machen, um<br />
dieser gezielt entgegenwirken zu können.<br />
Diese Strukturen, die Franzke als „Set von Regeln und Ressourcen“ definiert,<br />
existieren in Organisationen als gesetzliche Rahmenbedingungen als auch als<br />
ungeschriebene Regeln, die notwendig sind und erfolgreiches Handeln<br />
mitbestimmen. Wesentlich für das Weiterkommen in einer Organisation ist es, diese<br />
Spielregeln zu kennen.<br />
Für die Entwicklung von Mentoring-Programmen gilt es, diese formellen und<br />
informellen Anforderungen mitzudenken, sie zu analysieren und auf ihre<br />
Geschlechtergerechtigkeit hin zu prüfen. Geschlechter diskriminierende Strukturen<br />
und Normen müssen aufgezeigt und somit sichtbar gemacht werden (vgl. Franzke<br />
2003, 95).<br />
Alle Autorinnen sind sich darin einig, dass nur die Sichtbarmachung (vor allem<br />
informeller) Geschlechter diskriminierender Regeln, die Voraussetzung und<br />
Ansatzpunkte für strukturelle Veränderungsmöglichkeiten ist.<br />
Ähnliche Einschätzungen zu den Auswirkungen von Mentoringprojekten teilen die<br />
Autorinnen 40 trotz teilweiser unterschiedlicher Hochschulsysteme und<br />
Universitätskulturen. Individuelle Fördereffekte wie eine „beschleunigte“<br />
Wissensvermittlung – eine exklusive Übergabe informeller Informationen von<br />
Berufserfahrenen an jüngere und beruflich weniger Erfahrene – über Regeln und den<br />
Habitus der scientific community, werden durch eine Kombination von Mentoring-<br />
Beziehung, Netzwerkbildung und Zusatzangeboten erreicht. Aus der Sicht der<br />
40<br />
U.a. Franzke, Astrid 2003, Schliesselberger/Strasser 1998, Genetti/Nöbauer/Schlögl 2005<br />
97
Autorinnen Genetti/Nöbauer/Schlögl 2005, eines der wichtigsten Momente von<br />
Mentoringmaßnahmen (vgl. Genetti/Nöbauer/Schlögl 2005, 24).<br />
Positive individuelle Fördereffekte im Rahmen von Mentoring-Programmen sind<br />
unbestritten der Abbau von Karrierehemmnissen, neue Vernetzungsmöglichkeiten<br />
und die Beschleunigung der wissenschaftlichen Laufbahn durch Vermittlung von<br />
informellem Wissen.<br />
Allerdings stoßen diese Fördereffekte an ihre natürlichen Grenzen, wenn danach die<br />
verfügbaren Stellen fehlen oder die „Beschäftigungsattraktivität“ an den Universitäten<br />
nachlässt. Hier lässt sich ein Schnittpunkt von der individuellen Ebene und der<br />
strukturellen Ebene ausmachen.<br />
Individuelle Fördereffekte ziehen keine strukturellen Änderungen mit sich. Eine<br />
zahlenmäßige höhere Repräsentanz von Frauen in den Universitäten führt, wie<br />
schon erwähnt, nicht automatisch zu geschlechtergerechteren Strukturen.<br />
Mentoringkonzepte müssen daher neben einer Betrachtung der individuellen<br />
Beziehung zwischen den Beteiligten, immer auch das hierarchisch strukturierte<br />
Umfeld und seine sozialen (formellen und informellen) Beziehungen in den Blick<br />
nehmen. Eine Auseinandersetzung in und mit diesem Feld und eine Sichtbar<br />
Machung Geschlechter diskriminierender Strukturen und Normen, können<br />
Änderungen initiieren bzw. vermindern die Gefahr, Geschlechterhierarchien zu<br />
reproduzieren und müssen daher bei der Konzeption von Mentoring-Programmen<br />
mitgedacht werden.<br />
Auf individueller Ebene können die positiven Effekte von Mentoring-Programmen im<br />
Wissenschaftsbereich als Maßnahmen zur Karriereentwicklung und Beschleunigung<br />
durch Zugang zu Netzwerken und Unterstützung, zusammengefasst werden.<br />
Weiteren individuellen Nutzen sieht Katrin Hansen (2006) in der psycho-sozialen<br />
Funktion von Mentoring durch emotionale Unterstützung und Rückhalt in schwierigen<br />
Situationen sowie das Angebot eines Rollenmodells für bewährte Handlungsnormen<br />
und die Übernahme von Normen.<br />
Allerdings hängt das Ausmaß des individuellen Nutzens stark von der<br />
gesellschaftlichen Position des Mentors/der Mentorin ab.<br />
Hansen sieht daher den Erfolg von Mentoring-Programmen im<br />
geschlechterhierarchisch geprägten deutschsprachigen Raum für Männer deutlich<br />
98
ausgeprägter und sieht auch in Cross-Gender-Mentoring-Projekten keinen Ausgleich<br />
dieses Defizits. Vielmehr wird der gender bias einer Benachteiligung auch hier<br />
sichtbar. Wissenschafterinnen sind ihrer Meinung nach immer noch stark auf<br />
männliche Netzwerke und männliche Mentoren angewiesen und sieht sie die Gefahr<br />
einer Anpassung an männlich geprägte Vorstellungen bei Einstieg in die<br />
vorhandenen Seilschaften. Sie sieht die Lösung des Dilemmas im Aufbau mehrerer<br />
zeitlich aneinander gereihten Mentoring-Beziehungen, Mentoring-Netzwerken, mit<br />
verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten (vgl. Hansen 2006, 33).<br />
Nach den Erfahrungen mit den eigenen Mentoring-Programmen sieht Waltraud<br />
Schlögl, m:uv, die Renommiertheit und gesellschaftliche Majorität von MentorInnen<br />
etwas differenzierter und sieht einen wichtigen Punkt in der Generationsfrage bei den<br />
Förderbeziehungen. Sie betont zwar, dass unabhängig vom Geschlecht bekannte<br />
und renommierte Wissenschafterinnen nach ihren Erfahrungen überhäuft werden mit<br />
Mentoringwünschen, sieht aber den Erfolg für eine Förderbeziehung bei einer<br />
kontinuierlich linearen nach oben führenden Wissenschaftsbiographie und<br />
Karriereentwicklung weniger:<br />
„Wir haben überhaupt die Erfahrung gemacht, dass was die Zufriedenheit der<br />
Mentées und auch was den Output betrifft, dass es da nicht so sehr darauf<br />
ankommt, ob der Mentor oder die Mentorin ganz toll renommiert und<br />
international bekannt ist, sondern dass es vielmehr auch auf die Biographien<br />
der MentorInnen ankommt. Also sprich, wenn jemand aus seiner eigenen<br />
Biographie heraus die jetzigen Anforderungen an WissenschafterInnen gut<br />
kennt und am eigenen Leib erlebt hat, dass er/sie nicht eine komplett lineare<br />
und ungefährdete Karriere hat, dann verstehen die viel besser wie es den<br />
Mentées geht und sie können natürlich auch mehr aus ihrer eigenen<br />
Erfahrung weitergeben in dieser Hinsicht. Ich will da jetzt nicht über<br />
Generationen sprechen, aber es deckt sich manchmal bis zu einem gewissen<br />
Grad, dass MentorInnen aus einer jüngeren Generation oder<br />
Erfahrungsgeneration, mehr geben können und mehr Substanz dann da ist für<br />
diese Mentoringbeziehungen, als bei denen die eine tolle lineare Karriere<br />
hingelegt haben und eigentlich aus ihrer eigenen Erfahrung nicht wissen um<br />
was es geht derzeit. Und das ist wirklich sehr unabhängig vom Geschlecht.<br />
Aber natürlich gibt’s schon geschlechtsspezifische Aspekte, sicherlich in dem<br />
sich Frauen manchmal mehr gefährdet fühlen in ihrer eigenen Karriere und<br />
daher auch nicht diese Leichtigkeit und Lockerheit haben, einfach zu geben<br />
und diese Haltung einfach einzunehmen (…).“ 41<br />
41<br />
Im Gespräch mit Mag. a Waltraud Schlögl, Projektleiterin von m:uv Universität Wien, vgl. Interview im<br />
Anhang.<br />
99
Welche Ansatzpunkte bzw. Strategien können mit Hilfe des gleichstellungspolitischen<br />
und frauenfördernden Instrumentariums Mentoring entwickelt werden, um eine<br />
Struktur- und Kulturveränderung der nach wie vor hierarchischen Strukturen der<br />
Universitäten in Richtung Geschlechtergerechtigkeit herbeizuführen?<br />
Abseits der individuellen Karriereförderung sieht Franzke (2003) Ansatzpunkte für<br />
mögliche strukturelle Veränderungspotentiale von Mentoring durch:<br />
• Offenlegung von Geschlechter diskriminierenden Strukturen und Normen<br />
(Identifizierung von Karrierehemmnissen) sowie Wahrnehmungsschärfung und<br />
Sensibilisierung für Benachteiligungen. Wie oben schon erwähnt, birgt das<br />
Sichtbarmachen dieser Strukturen bereits Veränderungspotenzial.<br />
• MultiplikatorInnen.<br />
• Das Kennen von informellen und formellen „Spielregeln“ und Netzwerken der<br />
Organisation ist Vorraussetzung, um agieren zu können.<br />
• Netze erweitern bzw. eigene Netzwerke bilden, um die Reproduktion von<br />
Hierarchien und traditionelle Abhängigkeiten zu überwinden.<br />
• Aufbau von Frauen-Datenbanken (Gutachterinnen, Habilitandinnen,<br />
Expertinnen).<br />
• Implementierung von Mentoring als organisationale Querschnittsaufgabe (als<br />
Aufgabenerweiterung für ProfessorInnen, Personalentwicklung,..) und<br />
Übernahme von Mentoring als strukturierte Personalentwicklungsstrategie<br />
(Herauslösen aus der „Frauenecke“).<br />
• „Atmosphärische“ Veränderung an den Universitäten durch Sensibilisierung<br />
der Entscheidungsebene und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit (vgl.<br />
Franzke 2003, 96).<br />
Unbestritten ist, die Notwendigkeit einer Einbettung von Mentoring-Programmen in<br />
ein breiteres Nachwuchs-Förderprogramm sowie die Implementierung desselben in<br />
das bestehende Regelsystem, zur Veränderung dieser Strukturen von „innen“ heraus<br />
und Herausbildung einer neuen Organisations-Kultur.<br />
Die Attraktivität von Mentoring-Programmen für Frauen in der Wissenschaft liegt<br />
nach Brandner (2005) in den individuell-konkreten Auswirkungen dieser Maßnahmen<br />
und die Ansiedelung auf der persönlich emotionalen Ebene (vgl. Brandner 2005, 26).<br />
100
Dies zeigt wieder deutlich die Widersprüchlichkeiten und Gratwanderungen dieser<br />
Konzepte auf. Individuelle, praktische und zeitlich begrenzte Karriereförderung bietet<br />
m.E. wenig Ansatzpunkte für einen tief greifenden Struktur- und Kulturwandel im<br />
universitären System.<br />
101
6.3.1 Mögliche Potenziale für eine Strukturveränderung durch Mentoring<br />
6.3.1.1 Das Potenzial der Implementierung<br />
Der Begriff „Implementierung“ wird dann verwendet, wenn es um die Einführung<br />
neuer Maßnahmen, Instrumente, Programme, Strategien etc. in bestehende<br />
Strukturen einer Organisation geht. Häufig begleiten das Wort „Implementierungen“<br />
auch Auslegungen wie „Durchführung“, „Umsetzung“ oder „Nachhaltigkeit“.<br />
Mit der Einführung von Maßnahmen oder Projekten in eine „Dauereinrichtung“ sind<br />
Eingriffe in das bestehende organisationale System und deren Handlungsabläufe<br />
notwendig. Dabei werden Veränderungsprozesse in Gang gesetzt, die bestehende<br />
Rollenzuweisungen und Handlungsmuster und die strukturellen<br />
Rahmenbedingungen in Frage stellen.<br />
„Implementierungen“ an der Universität betrachten Nöbauer/Genetti (2006) als einen<br />
„komplexen und lang währenden, bei weitem nicht immer kontinuierlich ablaufenden<br />
Prozess, der von vielfältigen Top-down- und Bottom-up-Schritten auf<br />
hochschulpolitischer, organisationsrechtlicher und konzeptueller Ebene geprägt ist“<br />
(vgl. Nöbauer/Genetti 2006, 68).<br />
Die Implementierung von Mentoring-Programmen in die bestehenden universitären<br />
Regel-Strukturen ist eine mögliche Interventionsmöglichkeit und birgt ein mögliches<br />
Veränderungspotenzial auf struktureller Ebene.<br />
Die Implementierung von Fördermaßnahmen (der Frauen- und<br />
Gleichstellungsförderung, aber auch z.B. der Personalentwicklung) bieten<br />
Zugangsmöglichkeiten zu Strukturen, die „die Leistungsfähigkeit der Organisation<br />
als Ganzes oder bestimmter Bereiche erhalten und verbessern.<br />
Implementierungsprozesse gelten dann als nützlich, wenn sie zur Stabilisierung und<br />
Entwicklung der Organisation beitragen“. (vgl. Franzke 2006, 53).<br />
Ziel des Mentoring-Projektes an der Universität Salzburg ist jedenfalls, nach einer<br />
erfolgreichen Evaluation, seine dauerhafte Verankerung in der Universität und wie<br />
Teresa Schweiger, Projektleiterin von Chancengleichheit in der<br />
102
Nachwuchsförderung, im Interview anführt, ist bereits eine „kleine“ Implementierung<br />
gelungen:<br />
„ Wir haben so eine halbe Implementierung jetzt, dadurch dass wir es schon<br />
an eine bestehende Struktur (im Rahmen von karriere_links, Anm. d. Verf.)<br />
angehängt haben, ich glaube das war relativ geschickt, wenn man nicht ganz<br />
frei schwebend agiert. Das ist auf jeden Fall eine Anbindung, die einer<br />
Implementierung gleich kommt. Eine Implementierung ist auf jeden Fall<br />
erstrebenswert, weil sonst wird es wieder unter irgendeinem Projekt „sowieso“<br />
abgehandelt wird, das ist dann auch das Prestige nach außen. Wenn man<br />
schon Frauenförderungsprogramme hat an Universitäten, dann ist es meiner<br />
Meinung nach schon empfehlenswert, an die anzudocken, damit das ein<br />
Bündel wird“.<br />
Waltraud Schlögl, Projektleiterin des m:uv, betont, dass das m:uv Projekt bereits die<br />
4. Periode durchläuft, und somit weitgehend implementiert und auch anerkannt ist.<br />
Sie berichtet allerdings, dass es anfänglich durchaus Schwierigkeiten bei der<br />
Akzeptanz des Projektes gab:<br />
„ (…)Auf struktureller Ebene gesprochen, was nach wie vor ein bisschen ein<br />
Problem ist – das aber zunehmend weniger wird, bis hin sich auflöst – ist das<br />
sich offenbar in manchen Fachbereichen, die Teilnahme am Mentoring<br />
Programm, seitens der Mentées, zum Beispiel nicht offen gelegt wurde, weil<br />
sie gefürchtet haben, dass sie sich damit irgendwie negativ zu markieren, weil<br />
eben das ganze Umfeld eine negative Haltung hat gegenüber<br />
Frauenfördermaßnahmen oder gegenüber diesem vermeintlichen<br />
Defizitansatz, dass man als Frau eine verstärkte Förderung braucht Gerade in<br />
den Fachbereichen, wo diese Haltung sehr stark vertreten ist, hat dies<br />
natürlich wiederum Auswirkungen auf die Mentées, dass sie sich eher quasi<br />
nicht ertappen lassen wollen. Das war beim ersten Programm noch wesentlich<br />
stärker, mittlerweile habe ich eher das Gefühl, dass sich das zunehmend<br />
auflöst, einfach auch deswegen, weil das Programm mittlerweile eine gute<br />
Reputation hat und einen hohen Bekanntheitsgrad und es da offensichtlich<br />
doch eine strukturelle Dynamik gegeben hat in der Hinsicht (…)“<br />
Sie schränkt ein, dass die momentane kontinuierliche Finanzierung immer auch stark<br />
von der jeweiligen Universitätsleitung abhängt, und eine Prognose für eine zukünftige<br />
dauerhafte Implementierung eher gewagt wäre.<br />
Die erfolgreiche Durchführung von Mentoring-Projekten stärkt einerseits die<br />
Einrichtungen an für Frauen- und Gleichstellungsarbeit an den Universitäten und<br />
fördert auch deren Etablierung, wichtig wäre es m.E. aber auch, diese Projekte in<br />
den alltäglichen Regelbetrieb der Universität zu implementieren, möglicher Weg wäre<br />
auch in Zusammenarbeit mit der Personalentwicklung, um die Programme aus der<br />
„Ecke“ der Frauen- und Gleichstellungsarbeit herauszulösen und schneller<br />
103
Anerkennung und Selbstverständlichkeit zu erreichen und das „Mitschwingen“ eines<br />
Defizitansatzes zu vermeiden.<br />
Da Implementierungsprozesse nach Franzke (2006) zur Stabilisierung von<br />
Organisationen beitragen, müssen weitere Maßnahmen in Richtung<br />
Geschlechtergerechtigkeit gesetzt bzw. schon vorhanden sein, um nicht<br />
androzentristische Strukturen zu stabilisieren.<br />
6.3.1.2 Das Potenzial der Finanzierung<br />
Die Frage der Finanzierung ist bei jeder neuen Projektinitiative eine Entscheidende.<br />
Die Quelle und der Umfang des Budgets zeigt, welche Wichtigkeit das Projekt für die<br />
Universität einnimmt. Mentoring-Projekte werden auf Universitätsebene meist mit<br />
Drittmittel kofinanziert. Wie das Wiener Mentoring-Projekt m:uv zeigt, können<br />
erfolgreiche Projekte von der Organisation in den Regelbetrieb übernommen werden.<br />
Das bedeutet auch, die Universität hat das Potenzial dieses Projekts erkannt und<br />
verspricht sich davon einen Nutzen.<br />
Dies ist ein wichtiges Signal mit Außenwirkung, um mit der Bereitstellung von Mitteln<br />
den Stellenwert der Nachwuchsförderung zu zeigen. Für InitiatorInnen ist es nicht<br />
unerheblich, die Unterstützung ihres Projekts durch den Rückhalt im eigenen Umfeld<br />
gesichert zu wissen.<br />
Teresa Schweiger betont noch einen weiteren Aspekt:<br />
„Man muss für die MentorInnen ein Anreizsystem entwickeln. Das sind ja<br />
WunschmentorInnen, erfolgreiche WissenschafterInnen, die ja auch sehr viel<br />
zu tun haben, in sehr viele Gremien drin sind und Positionen innehaben.<br />
Denen muss man einen Anreiz geben, damit sie bei so einem Programm auch<br />
mitmachen. Und es ist auch in der österreichischen Tradition Mentoring noch<br />
nicht so bekannt, das merke ich auch immer wieder, das ProfessorInnen, die<br />
aus Deutschland kommen, dem auch offener gegenüberstehen. Daher ist<br />
auch das Geld sehr wichtig, weil man auch interessante Personen einladen<br />
möchte, muss, soll und kann zu Auftaktveranstaltungen einladen und das<br />
Ganze professionell umsetzen kann, weil es ja auch Arbeitskraft braucht“.<br />
Auch Waltraud Schlögl betont die Wichtigkeit zeitlicher und finanzieller Unterstützung<br />
der MentorInnen als Anreiz und führt an:<br />
„(...)dass alle MentorInnen für den Zeitraum der Tätigkeit im Programm eine<br />
Kompensation für ihren Zeitaufwand erhalten, und zwar in Form einer<br />
zusätzlichen Tutorin für den Programmablauf. Dieser Aspekt ist in doppelter<br />
104
Weise wichtig, einerseits, weil er genau beim größten aller potenziellen<br />
MentorInnen ansetzt, nämlich beim Zeitproblem, und ihnen andererseits zeigt,<br />
dass der Universität diese Tätigkeit wichtig ist und sie auch bereit ist, dafür zu<br />
zahlen“.<br />
Eine regelmäßige gesicherte Finanzierung von Fördermaßnahmen ist jedenfalls eine<br />
notwendige und nützliche Rahmenbedingung für strukturelle Veränderungen.<br />
6.3.1.3 Das Potenzial der Vernetzung<br />
Mentoring-Programme bieten die Möglichkeit Erfahrungen in Zusammenhang mit<br />
Karrieremöglichkeiten im Wissenschaftssystem einzubringen und sich darüber<br />
auszutauschen. Wissensaustausch und Wissenstransfer ist ein entscheidender<br />
Anreiz.<br />
Ein wesentlicher positiver Effekt von Mentoring-Programmen ist die Vernetzung der<br />
TeilnehmerInnen, sowohl auf Seiten der MentorInnen, als auch bei den Mentées.<br />
Schlögl betont im Gespräch, dass die peer-group Methode des m:uv Programms,<br />
sich dazu sehr bewährt hat:<br />
„Von Anfang an sehr positiv angekommen ist dieses Gruppensetting, das wird<br />
einhellig gewünscht und begrüßt und bringt auch diesen gewünschten Effekt,<br />
dass nicht nur diese one-to-one Beziehung da ist, sondern dass einfach ein<br />
größeres Netzwerk entsteht und mit diesem peer-Netzwerk 42 auch sehr viel<br />
Dynamik reinkommt, dass sich dadurch oft gleichwertige oder wichtigere<br />
Fördereffekte ergeben, als durch die Beziehung zu einer Mentorin oder einem<br />
Mentor, also das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt“.<br />
Im Mentoring-Projekt der Universität Salzburg sieht Schweiger, die<br />
zwischenuniversitäre Vernetzung als großes Potenzial zur Synergiebildung durch<br />
Zugänge in neue Netzwerke:<br />
„Da inneruniversitär ein Mangel an weiblichen Führungspersönlichkeiten in<br />
diesen Fächern herrscht, ist das Mentoring-Projekt zur Synergiebildung<br />
zwischen den beiden Universitäten Salzburg und Linz angelegt.<br />
Die Vorteile werden gesehen im überuniversitären Austausch, Einblicke in<br />
andere Forschungsprojekte, Zugang zu neuen Netzwerken und einen<br />
bereitwilligen Austausch von vorhandenem Wissen. Durch das Programm<br />
42<br />
Aus einer Peer-group des aktuellen Durchgangs ist nachfolgende Publikation entstanden. Dies zeigt im<br />
besten Fall den positiven Aspekt den Netzwerk, Teamarbeit und Synergiebildung durch Mentoring leisten kann:<br />
Nikola Langreiter, Elisabeth Timm, Michaela Haibl, Klara Löffler, Susanne Blumesberger (Hg.): Wissen und<br />
Geschlecht. Beiträge der 11. Arbeitstagung der Kommission für Frauen- und Geschlechterforschung der<br />
Deutschen Gesellschaft für Volkskunde; Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der<br />
Universität Wien, Bd. 31, Wien 2008.<br />
105
kann für die Mentées ein Zugang in andere Forschungskulturen geschaffen<br />
werden und Netzwerke geöffnet werden, die gerade in den spezifischen<br />
naturwissenschaftlichen und technischen Forschungsgebieten durch ihre<br />
Spezifikationen schwer zugänglich sind“.<br />
Der Vorteil von Netzwerken besteht darin, dass diese auch nach Ablauf des<br />
Programms bestehen bleiben. Durch den regelmäßigen Austausch können<br />
strukturelle Barrieren und Karrierehemmnisse sichtbar und besprochen werden. Dies<br />
könnte ein Schritt in Richtung Abbau vorhandener Hemmnisse sein.<br />
Der seit Jahren über nationale Grenzen hinaus praktizierte Austausch von<br />
Mentoringprogrammen und -erfahrungen an Universitäten, hat mittlerweile zu einem<br />
europäischen Austausch-Netzwerk geführt. Im Rahmen des EU-Projekts „eument-net<br />
– European Network of Mentoring Programmes for Women Scientist“ werden in<br />
diesem Netzwerk Strategien zur Förderung von weiblichen Wissenschafterinnen und<br />
Forscherinnen entwickelt 43 .<br />
43<br />
Eument-net ist ein EU-Projekt im Rahmen des FP6 finanziert. Daraus entstanden ist eine Publikation:<br />
Nöbauer, Herta; Genetti, Evi, 2008: Establishing Mentoring in Europe. Strategies for the promotion of women<br />
academics and researchers. A guideline manual edited by eument-net. University Fribourg.<br />
106
6.3.1.4 Das Potenzial der MultiplikatorInnen<br />
Den TeilnehmerInnen an Mentoring-Programmen eröffnen sich nicht nur Zugänge zu<br />
neuen Netzwerken und dadurch die Möglichkeit eines Wissenstransfers und<br />
Wissensaustausches, sie fungieren ihrerseits bei positiven Erfahrung mit einem<br />
Mentoring-Programm als MultiplikatorInnen, die die Idee dieser Maßnahme<br />
weitertragen und gängig machen.<br />
Im Gespräch mit Theresa Schweiger betont sie dabei die<br />
„große Chance, die auch darin besteht, dass Frauen, die ein Mentoring-<br />
Programm erfolgreich durchlaufen haben, sich auch selbst als Mentorinnen<br />
zur Verfügung stellen und durch Vorbildwirkung und Rolle als<br />
Multiplikatorinnen ein Schneeballeffekt entsteht, der die Anzahl der weiblichen<br />
Wissenschafterinnen in Leitungsfunktionen steigen lässt. Ob allerdings die<br />
quantitative Erhöhung weiblicher Leitungsfunktionen strukturelle Änderungen<br />
mit sich bringt, bleibt umstritten und wird sich weisen“.<br />
Eine qualitative Erhöhung der Anzahl weiblicher Wissenschafterinnen ist meiner<br />
Einschätzung nach aber eine solide Ausgangsbasis, um Wissenschafterinnen auch<br />
auf höheren Ebenen „gewöhnlich“ zu machen und eine gewisse „Normalität“<br />
herzustellen. Ein höherer Anteil an weiblichen role models bietet breite<br />
Identifikationsmöglichkeiten für weibliche Studierende.<br />
6.3.1.5 Das Potenzial durch Integration abseits Frauenförderungs- und<br />
Gleichstellungseinrichtungen<br />
Die Konzeption von Angeboten und Maßnahmen der Frauenförderung und<br />
Gleichstellungsarbeit haben mittlerweile auch in die Angebotsentwicklung der<br />
Personalentwicklung Eingang gefunden. Das Beispiel der Personalentwicklung an<br />
der Universität Salzburg zeigt, dass die Mentoring-Idee ein wirksames Instrument für<br />
die Neugestaltung und Unterstützung neuer Lehrformen und Lehrinhalte sein kann.<br />
Lehrkräfte an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät haben die Möglichkeit Angebote<br />
der Personalentwicklung in Anspruch zu nehmen, zur Unterstützung und Reflexion<br />
der eigenen Lehrtätigkeit und Lehrform. Diese Programme bieten den (Nachwuchs-)<br />
Lehrkräften die Möglichkeit ihre Inhalte und Stile kritisch zu überdenken und durch<br />
Unterstützung von Außen weiterzuentwickeln. Dieses Angebot birgt durchaus das<br />
Potenzial, jahrzehntelang festgefahrene Muster und Strukturen im Bereich Lehrform<br />
107
und Lehrinhalt aufzubrechen. Ein Ausdehnen des Programms auf alle Fakultäten<br />
wäre wünschenswert. Eine weitere Möglichkeit wäre die Vermittlung von Mentoring-<br />
Programmen im Rahmen der neu entstehenden Career-Center der Universitäten, wo<br />
die Informationen und Ressourcen gebündelt werden und das Wissen um die<br />
Bedürfnisse der verschieden Fachrichtungen vorhanden ist.<br />
Ein möglichst breiter und komplexer und von allen Organisationseinheiten getragener<br />
und unterstützter Förderansatz, macht Förderung „salonfähig“. Die Unterstellung<br />
eines Defizits kann so ausgeklammert werden.<br />
6.3.1.6 Das Potenzial der AkteurInnen<br />
Einen zentralen Stellenwert bei der Konzeption und Durchführung von Mentoring-<br />
Programmen nehmen die handelnden Personen ein.<br />
Unterschiedliche Institutionen, spezifische Wissenszugänge, Einstellungen und<br />
Positionierungen der AkteurInnen im universitären Feld, sind ausschlaggebend für<br />
den Ablauf von Mentoring-Programmen, wie auch anderen Maßnahmen der<br />
Frauenförderung- und Gleichstellungsarbeit, als der Personalentwicklung.<br />
Die Zielsetzungen der AkteurInnen ebenso wie der institutionelle Kontext der<br />
Programme spielen eine entscheidende Rolle und können zwischen<br />
„Herzeigeprojekt“ und Programmen mit nachhaltigen Auswirkungen auf struktureller<br />
und kultureller Ebene liegen (vgl. Nöbauer/Genetti 2006, 68).<br />
Entscheidend ist immer auch die Einstellung und Intention und natürlich vor allem die<br />
finanzielle Unterstützung der Universitätsleitung für derartige Maßnahmen. Das<br />
Angewiesensein der meisten derzeitigen Programme auf deren „good will“ in<br />
materieller als auch immaterieller Hinsicht steht nachhaltigen<br />
Veränderungspotenzialen entgegen.<br />
Es ist daher auch erheblich, wie die informelle Ebene der sozialen Beziehungen der<br />
Universität und ihrer Leitung auf der einen Seite, zu den verantwortlichen<br />
AkteurInnen und EntwicklerInnen von Förderprogrammen ist bzw. zu den<br />
AkteurInnen der Gleichstellungsarbeit ist.<br />
108
Ein gutes „Standing“ der verantwortlichen AkteurInnen innerhalb der Organisationen<br />
gehört auf jeden Fall zu den nützlichen Rahmenbedingungen struktureller<br />
Veränderungen.<br />
6.3.1.7 Das Potenzial der Reflexion<br />
Mentoring-Programme bieten den MentorInnen die Gelegenheit Ihre eigene Praxis in<br />
der Lehre und im Umgang mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs zu reflektieren.<br />
Für die Mentées besteht eine Möglichkeit ihre Karrierewünsche und Möglichkeiten zu<br />
reflektieren und gegebenenfalls anzupassen. Das gemeinsame Besprechen kann<br />
aber auch die aktuellen wissenschaftlichen Strukturen für Laufbahnen und<br />
Karrieremöglichkeiten zur Sprache bringen und führt zu einer Reflexion über deren<br />
Grenzen und Schwächen.<br />
Im Kooperationsprogramm Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung der<br />
Universität Salzburg und Linz liegt ein wesentlicher Focus darauf, den MentorInnen<br />
eine Vertiefung ihrer Beratungskompetenz, Erweiterung der eigenen Netzwerke<br />
sowie die Reflexion der eigenen Forschungstätigkeit, anzubieten. Die MentorInnen<br />
haben auch die Möglichkeit begleitende individuelle Coachinggespräche zur<br />
Selbstreflexion in Anspruch zu nehmen.<br />
Schliesselberger und Strasser (1998) sehen Mentoring in diesem Zusammenhang im<br />
Idealfall auch als politisierte Praxis. Nicht nur die Reflexion der individuellen<br />
Handlungsweisen soll durch Mentoring angeregt werden, sondern auch eine<br />
Reflexion der universitären Organisationskultur. Sie bezeichnen den begleitenden<br />
Umstand als eine „Reflexion der Machtverhältnisse, der Differenzen und<br />
Differenzierungen parallel mit einer Veränderung der Diskursformen, Lehrinhalte und<br />
–stile sowie der Spielregeln“ (vgl. Schliesselberger/Strasser 1998, 314).<br />
Eine Reflexion der Machtverhältnisse und Einbeziehung herrschender Strukturen<br />
einer Organisation ist für die Konzipierung von Fördermaßnahmen notwendig und<br />
Voraussetzung für organisationale Veränderungen.<br />
109
6.3.1.8 Das Potenzial der Verantwortung<br />
Mentoring-Programme haben den Effekt, dass sie sich mit den Laufbahnen und<br />
Karrieren der teilnehmenden Personen auseinandersetzen und Probleme dabei<br />
aufzeigen. Strukturelle Probleme die dabei auch öffentlich gemacht und debattiert<br />
werden, führen zu einem Diskurs, der die unmittelbar verantwortlichen Einheiten in<br />
die Pflicht nimmt, sich mit diesen Problemlagen auseinander zu setzen und darauf zu<br />
reagieren.<br />
Das Aufzeigen von strukturellen Missständen in den Laufbahnen des<br />
wissenschaftlichen Nachwuchses im Rahmen von Mentoring-Programmen, fordert<br />
hier auch die Verantwortung und das Handeln der Universität bzw. der<br />
verantwortlichen Universitätsleitung ein, sich Karrierehemmnissen auf struktureller<br />
Ebene zu stellen.<br />
Eine Einbindung in Förderkonzepte sowie eine unbedingte Rückendeckung der<br />
Organisationsleitung auf finanzieller, als auch auf ideeller Ebene sind daher nützliche<br />
Voraussetzungen für organisationale Veränderungen.<br />
110
6.3.1.9 Das Potenzial der Anerkennung<br />
Wie Waltraud Schlögl im Gespräch anmerkt, hat es nach der mehrfachen<br />
Durchführung des Mentoring-Programms m:uv eine Änderung der Einstellung<br />
gegenüber an Mentoring-Programmen Beteiligten gegeben:<br />
„Ein wichtiger Aspekt der Strukturveränderung ist, dass wir hier an der Uni<br />
Wien erreicht haben, dass alle MentorInnen für den Zeitraum der Tätigkeit im<br />
Programm eine Kompensation für ihren Zeitaufwand erhalten, und zwar in<br />
Form einer zusätzlichen Tutorin für den Programmablauf. Dieser Aspekt ist in<br />
doppelter Weise wichtig, einerseits, weil er genau beim größten aller<br />
potenziellen Probleme bei MentorInnen ansetzt, nämlich beim Zeitproblem,<br />
und ihnen andererseits zeigt, dass der Universität diese Tätigkeit wichtig ist<br />
und sie auch bereit ist, dafür zu zahlen“.<br />
Die Teilnahme an Mentoring-Projekten kann auf Seiten der Mentées ebenso wie auf<br />
Seiten der MentorInnen als Zusatzqualifikation auf fachlicher wie auf sozialer Ebene<br />
bewertet werden. Die Darlegung persönlicher und beruflicher Ziele, das Ansprechen<br />
von konkreten Schwierigkeiten und der Umgang mit den gebotenen realistischen<br />
Unterstützungsmöglichkeiten, setzt m.E. auch eine gewisse soziale Kompetenz<br />
beider Seiten voraus.<br />
Erfolgreich durchgeführte und anerkannte Mentoring-Programme führen auch die<br />
InitiatorInnen und KonzeptionistInnen dieser Programme – diese sind meist ident mit<br />
den AkteurInnen der Gleichstellungsarbeit – ein Stück aus der Invisibilisierung ihrer<br />
Tätigkeiten zu einer Struktur und Kultur der Anerkennung ihrer Arbeit und ihres<br />
persönlichen Empowerments im Rahmen der Organisation Universität.<br />
6.3.1.10 Das Potenzial der Sensibilisierung<br />
Grundlage aller positiven Effekte von Frauenförderungs- und<br />
Gleichstellungsmaßnahmen und deren Akzeptanz, ist eine gewisse Sensibilisierung<br />
gegenüber Geschlechter diskriminierenden Strukturen. Die Transparenz über<br />
Vorgänge der herrschenden Beförderungs- und Aufstiegsmechanismen,<br />
Mechanismen, die die Karriereentwicklung behindern, das Sichtbarmachen<br />
weiblicher Kompetenzen, bergen strukturelles Veränderungspotenzial. Das Erkennen<br />
wie Abläufe funktionieren auf formeller wie auch informeller Ebene kann diese<br />
111
Abläufe in Frage stellen und andere Ansätze aufzeigen. MentorInnen können durch<br />
eigene Erfahrungen diese Transparenz auch herstellen. Teresa Schweiger spricht<br />
den MentorInnen eine entscheidende Rolle zu:<br />
„ Auf jeden Fall glaube ich, fast noch wichtiger als der Prozess für die Mentées<br />
ist der Prozess den die MentorInnen durchlaufen. Das ist unsere Erfahrung.<br />
Dadurch wird das Bewusstsein geschaffen, dass Ungleichheiten zwischen den<br />
Geschlechtern herrschen, das ist einfach so, die werden auch nicht unbedingt<br />
aus Böswilligkeit bewusst herbeigeführt, sondern das sind Mechanismen, das<br />
weiß man ja auch aus der Psychologie, der „Mini-Me“, man will halt auch einen<br />
haben, der einem ein bisschen ähnlich ist, ich glaube das ist jetzt ganz wichtig<br />
auf der Ebene von Personen, die jetzt in Führungspositionen sind, dass sie<br />
einen Bewusstseinsprozess durchlaufen und sehen, es gibt Frauen die das<br />
können, man muss da wirklich auch auf dieser Stufe anfangen“.<br />
Transparenz, Sensibilisierung und Sichtbarmachen der informellen Abläufe und<br />
Handlungsmuster im Zusammenspiel mit formellen strukturellen und rechtlichen<br />
Voraussetzungen ist die Grundlage für die Entfaltung der Potenziale zur<br />
Veränderung und Neuordnung.<br />
112
7. Methodik<br />
„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten „von innen heraus“ aus der<br />
Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren<br />
Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und<br />
Strukturmerkmale aufmerksam machen.“<br />
(Flick/Kardoff/Steinke 2005, 14)<br />
7.1 Qualitative Forschung<br />
Nach Flick/Kardorff/Steinke 2005 lassen sich die auf „Qualitative Forschung“<br />
zusammengefassten Ansätze auf verschiedene Grundannahmen zusammenfassen:<br />
• Soziale Wirklichkeit als gemeinsame Herstellung und Zuschreibung von<br />
Bedeutungen. Soziale Wirklichkeiten erscheinen als Ergebnisse beständig<br />
ablaufender Konstruktionsprozesse. Für die Methodologie ergibt sich daraus<br />
ein erster Ansatzpunkt die Konzentration auf Formen und Inhalte dieser<br />
alltäglichen Herstellungsprozesse über die Rekonstruktion der subjektiveren<br />
Sichtweisen und Deutungsmuster der sozialen Akteure.<br />
• Prozesscharakter und Reflexivität sozialer Wirklichkeit. Für die Methodologie<br />
ist dabei der zweite Ansatzpunkt die Analyse von Kommunikations- und<br />
Interaktionssequenzen mit Hilfe von Beobachtungsverfahren (Beobachten im<br />
Feld) und anschließender Textanalysen.<br />
• „Objektive“ Lebensbedingungen werden durch subjektive Bedeutungen für die<br />
Lebenswelt relevant. Indikatoren wie Einkommen, Bildung, Beruf, Alter,<br />
Wohnsituation usw. bestimmen die unterschiedlichen Lebenslagen der<br />
Menschen. Die Bedeutung dieser Indikatoren und deren Interpretation<br />
entstehen in einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebensumstände.<br />
Methodologisch führt dies zum Ansatzpunkt der hermeneutischen<br />
Interpretation.<br />
• Der kommunikative Charakter sozialer Wirklichkeit lässt die Rekonstruktion<br />
von Konstruktionen sozialer Wirklichkeit zum Ansatzpunkt der Forschung<br />
werden.<br />
Hintergrundannahmen unterschiedlicher qualitativer Forschungsansätze sind,<br />
dass Realität interaktiv hergestellt und subjektiv bedeutsam und dass sie über<br />
113
kollektive und individuelle Interpretationsleistungen vermittelt und<br />
handlungswirksam wird. Der Kommunikation kommt in der qualitativen<br />
Forschung eine herausragende Rolle zu. Für die Methodologie bedeutet dies,<br />
dass die Strategien der Datenerhebung selbst einen kommunikativen,<br />
dialogischen Charakter aufweisen.<br />
Bei qualitativer Forschung wird die „Subjektivität“ der Forschenden, die Lebenswelt,<br />
miteinbezogen. Die Reflexion der Subjektivität der Forschenden wird sogar als<br />
notwendige Voraussetzung für einen erfolgreichen Forschungsprozess verstanden.<br />
Hier liegt auch ein wesentlicher Unterschied zu quantitativen Forschungsmethoden.<br />
In der quantitativen Forschung wird der Unabhängigkeit der Forschenden vom<br />
Forschungsgegenstand ein zentraler Stellenwert eingeräumt. Qualitative Forschung<br />
greift hingegen auf subjektive Wahrnehmungen der Forschenden und deren<br />
Standortbezogenheit als Bestandteil der Forschung zurück (vgl.<br />
Flick/Kardorff/Steinke 2005, 20ff).<br />
Zu den Methoden der qualitativen Sozialforschung zählen<br />
• Visuelle Methoden wie<br />
_teilnehmende Beobachtung<br />
_Foto- oder Filmanalysen<br />
• Verbale Methoden<br />
_Interviews<br />
_Gruppendiskussionen<br />
114
7.1.2 Qualitative Interviews<br />
„Jedes Interview ist Kommunikation, und zwar wechselseitige, und aber auch ein<br />
Prozess. Jedes Interview ist Interaktion und Kooperation. Das „Interview“ als fertiger<br />
Text ist gerade das Produkt des „Interviews“ als gemeinsamem Interaktionsprozess,<br />
von Erzählperson und interviewender Person gemeinsam erzeugt – das gilt für jeden<br />
Interviewtypus. […] Interviews sind immer beeinflusst, es fragt sich nur wie. Es geht<br />
darum, diesen Einfluss kompetent, reflektiert, kontrolliert und auf eine der<br />
Interviewform und dem Forschungsgegenstand angemessenen Weise zu gestalten.“<br />
(Helfferich, Cornelia 2005, 20)<br />
Das Wort Interview stammt ursprünglich aus dem Angloamerikanischen und wird ab<br />
dem 20. Jahrhundert auch im deutschen Sprachraum verwendet. Das Interview ist<br />
eine Gesprächssituation, die bewusst und gezielt von den InterviewpartnerInnen<br />
hergestellt wird, wobei eine Personen Fragen stellt und die andere Person Fragen<br />
beantwortet. In der qualitativen Forschung ist das Interview ein planmäßiges<br />
Vorgehen bei dem/der die Interviewte durch gezielte Fragen zu verbalen<br />
Informationen veranlasst wird (vgl. Lamnek 2005, 330).<br />
Die Interviewformen unterscheiden sich je nach beteiligten Personen und Ablauf der<br />
Interviewsituation.<br />
Nachfolgend möchte ich kurz auf die Interviewformen eingehen, die ich für meine<br />
Arbeit heran ziehen bzw. kombinieren werde.<br />
7.1.3 Das narrative Interview<br />
Die narrative Interviewform ist gekennzeichnet durch eine niedrige Strukturierung des<br />
Ablaufes. Narrative Interviews werden besonders häufig im Zusammenhang mit<br />
lebensgeschichtlich bezogenen Fragestellungen eingesetzt. Grundelement des<br />
narrativen Interviews ist die an eine Eingangsfrage anschließende Stegreiferzählung.<br />
Die Eingangsfrage bzw. Erzählaufforderung, sollte dabei so formuliert werden, dass<br />
die Erinnerungen der InterviewpartnerInnen mobilisiert werden und sie zum Frei-<br />
115
Erzählen angeregt werden. Wichtig ist die offene Formulierung der Fragen, um zu<br />
weiteren Erzählungen zu animieren. Der Schlussteil des Interviews kann kurz sein<br />
und bezieht sich auf die Einschätzung der Interviewsituation, kann aber auch ein<br />
„Bilanzierungsteil“ sein. Generell ist mit der Form des narrativen Interviews die<br />
Absicht verbunden, dass die Erzählungen stärker an konkreten Handlungsabfolgen<br />
und weniger an den Ideologien und Rationalisierungen der InterviewpartnerInnen<br />
orientiert sind (vgl. Hopf, 2005, 355ff).<br />
In seiner klassischen Form wird das narrative Interview ohne Interviewleitfaden<br />
durchgeführt.<br />
7.1.4 Das Leitfaden-Interview<br />
Es gibt mehrere Typen von Leitfaden-Interviews die in unterschiedlichen Bereichen<br />
angewendet werden. Der Begriff des Leitfaden-Interviews kann als Oberbegriff für die<br />
Art und Weise wie ein leitfadengestütztes Interview geführt wird, herangezogen<br />
werden.<br />
Der Leitfaden kann unterschiedlich stark strukturiert sein, und bewegt sich zwischen<br />
einem offenen Leitfadeninterview mit wenig Strukturierung (halb-/teilstandardisiert)<br />
und einem strukturierten Leitfaden-Interview mit hohem Strukturierungsgrad. Bei der<br />
offeneren Variante entscheidet der/die Interviewte welche Themen und Reihenfolge<br />
angesprochen wird und steuert somit das Gespräch selbst – die Befragten können<br />
ihre Antworten und Ansichten frei formulieren. Der/die Interviewer/in muss darauf<br />
achten, dass alle Themen angesprochen werden.<br />
7.1.5 Das Leitfaden-Interview mit narrativem Charakter<br />
Für die Durchführung der Interviews habe ich einen Leitfaden konzipiert, die Fragen<br />
so formuliert, um zum Erzählen zu animieren.<br />
Flick bezeichnet diese Art der Anwendung von verschiedenen Techniken innerhalb<br />
eines Interviews als „Within-Method-Triangulation“ (vgl. Flick 2005, 312).<br />
116
Die Kombination der beiden Methoden soll die Stärken des Leitfaden-Interviews mit<br />
den Stärken des Erzählens verbinden.<br />
7.1.6 Interpretation der Interviews<br />
Nach Durchführung der beiden exemplarischen Interviews mit den Expertinnen habe<br />
ich diese transkribiert. Die von mir entwickelten möglichen Veränderungspotenziale<br />
des Förderinstrumentes Mentoring in Hinblick auf organisationale Strukturen, habe<br />
ich mit den zentralen Aussagen der beiden Projektleiterinnen zur Illustration bzw. zur<br />
Verdeutlichung der Standpunkte eingearbeitet.<br />
117
8. Resümee<br />
Bei der Beschäftigung mit dem Thema Mentoring und der Suche nach Potenzialen<br />
für einen Strukturwandel durch Mentoring ist für mich klar geworden, dass der<br />
Grundstein für strukturelle Änderungen in einer Organisation zuerst durch einen<br />
ersten Schritt der Verrechtlichung und Implementation von Gleichstellungs- und<br />
Frauenförderungsmaßnahmen gelegt werden muss. Was allerdings gleich wesentlich<br />
ist – aber nicht verrechtlicht werden kann – ist eine damit einhergehende und in der<br />
Realität zeitverzögerte Änderung der Organisationskultur.<br />
Gleichstellungsinstrumentarien und Frauenfördermaßnahmen sind an der Universität<br />
bereits vorhanden. Die Erfahrungen mit Gleichstellungsarbeit zeigen, dass es zum<br />
Großteil auf die einzelnen AkteurInnen und deren Intentionen ankommt, wie diese<br />
gesetzlichen Möglichkeiten umgesetzt werden und welches Ziel verfolgt wird.<br />
Durchaus kann mit tauglichen Instrumenten ein ewiger Status quo reproduziert<br />
werden.<br />
Die Absicht, die hinter der Konzipierung von Mentoring-Programmen steht, ist<br />
deshalb ausschlaggebend, weil damit gezielte Eliteförderung betrieben werden kann,<br />
die Anpassung an die vorgeprägten Laufbahnmuster und das Zurechtfinden im<br />
Kontext der gegenwärtigen Universitätsstruktur und –kultur zur Vorbedingung<br />
machen und diese selbst wieder reproduzieren. Eine Eliteförderung ist zwar nicht per<br />
se abzulehnen, da es ein wesentlicher Effekt auf individueller Ebene von Mentoring<br />
sein kann, strukturelle Veränderungspotenziale aber nur eröffnet und genutzt werden<br />
können, wenn eine kritische Haltung gegenüber den herrschenden Strukturen bei der<br />
Konzeption mitgedacht wird. Es ist daher eine wesentliche Frage, wer diese<br />
Förderungsprogramme konzipiert, finanziert und durchführt.<br />
Formelle Strukturen können sich durch gesetzliche Regelungen ändern,<br />
Handlungsweisen und -muster aber in gewohnten Praktiken fortgesetzt werden. Eine<br />
umfassende gesellschaftliche Veränderung der eingefahrenen Denkweisen und<br />
Handlungsmuster kann wohl eher erst mit einer zeitlichen Verzögerung herbeigeführt<br />
werden.<br />
118
Mit einem strukturellen Wandel muss ein kultureller Wandel einhergehen. Diese<br />
beinhaltet die symbolischen Ordnungen, die informellen Handlungsweisen,<br />
unausgesprochene Spielregeln und darin eingebettete Geschlechterordnungen und<br />
Rollenbilder.<br />
Ein Strukturwandel ist ohne Kulturwandel schwer möglich und auch umgekehrt. In<br />
den Gesprächen mit meinen Interviewpartnerinnen ist klar geworden, dass es der<br />
Änderung traditioneller Vorstellungen über Geschlechterordnungen und<br />
Verhaltensweisen bedarf, um realistische Aufbrüche des männlichen Systems<br />
Universität bewirken zu können. Diese Änderungen einzuleiten, gelingt vereinzelt<br />
und langsam, aber eine rein zahlenmäßige Erhöhung des weiblichen Anteils im<br />
universitären Wissenschaftsbereich, bedingt noch keine grundlegenden Änderungen<br />
des Systems, darüber sind sich die AutorInnen und Gesprächspartnerinnen einig.<br />
Ich denke aber doch, dass die quantitative Erhöhung des weiblichen Anteils eine<br />
notwendige Grundvoraussetzung und ein erster Schritt ist, der Veränderungs-<br />
Potenzial in sich birgt. Die Erhöhung der Anzahl weiblicher Studentinnen,<br />
Absolventinnen und Nachwuchswissenschafterinnen vor allem in Fächern der<br />
traditionellen weiblichen Unterrepräsentation, lassen Forderungen nach Änderung<br />
der (männlichen) Strukturen legitimer wirken. Darüber hinaus werden dadurch role<br />
models erzeugt, die Identifikationsmöglichkeiten bieten.<br />
Der Prozess des Bewusstmachens, des Sensibilisierung und der Transparenz von<br />
Strukturen und Kulturen, ist bei weitem noch nicht abgeschlossen, aber eine<br />
notwendige Grundvoraussetzung.<br />
Veränderungen von festgefahrenen Strukturen, Verhaltensweisen und Rollenbilder<br />
sind eine langfristige Angelegenheit. Nachwuchsförderungsmaßnahmen wie<br />
Mentoring aber meist auf eine gewisse Dauer beschränkt.<br />
Der Erfolg der von mir skizzierten Veränderungspotenziale hängt daher auch von<br />
einer gewissen Regelmäßigkeit der Durchführung bzw. Übernahme der Programme<br />
in den Regelbetrieb ab. Diese Übernahme wiederum hängt an einer gesicherten<br />
Finanzierung.<br />
Förderungsprogramme wie Mentoring, sind zeit- und personalintensiv. Eine<br />
regelmäßige ausreichende Finanzierung muss daher gewährleistet sein. Eine<br />
regelmäßige Finanzierung besteht aber nur dort, wo sich die GeldgeberInnen auch<br />
Nutzen davon versprechen. Somit hängt es wieder an den AkteurInnen, den<br />
119
Verantwortlichen die Effizienz von Nachwuchsförderungsprogrammen bei sonst<br />
drohendem Verlust von wichtigem Humankapital für die Universität, zu vermitteln.<br />
Ein einzelnes Mentoring-Programm kann eine individuelle Verbesserung der<br />
Karrierechancen bewirken, Strukturen können damit sicher nicht verändert werden.<br />
Eine Regelmäßigkeit bei gleichzeitiger Anbindung an ein mehrschichtiges<br />
Förderungskonzept mit einem Pool aus sich ergänzenden Maßnahmen, ist daher<br />
eher sinn- und wirkungsvoll.<br />
Die verschiedenen Ansätze der beiden Mentoring-Programme als one-to-one<br />
Mentoring bzw. Gruppenmentoring unterscheiden sich nach ihrem Wirkungsgrad in<br />
der Reichweite und in den möglichen Veränderungspotenzialen. So hat der one-toone<br />
Förderansatz vor allem einen individuellen Effekt, der durchaus für die eigenen<br />
Karriere förderlich sein kann, der peer-group Ansatz durch seine größere Reichweite<br />
m.E. aber einen größeren MultiplikatorInneneffekt und kann dadurch auch strukturell<br />
mehr wirken. Die Konzeption hängt dabei immer auch von der Größe der Universität<br />
ab sowie der fachlichen und personellen Auswahlmöglichkeiten. Wie Teresa<br />
Schweiger auch erwähnt hat, ist es gar nicht so leicht förderungswillige<br />
Wissenschafterinnen als potenzielle Mentées in bestimmten Fachausrichtungen zu<br />
finden.<br />
Was sich meiner Meinung nach auch gezeigt hat, ist, dass die Ansätze der<br />
weiblichen Nachwuchsförderung gerade in naturwissenschaftlichen und technischen<br />
Studien und dort wiederum in Fächern mit minimalem Frauenanteil, oft zu spät bzw.<br />
ins Leere greifen. Hier besteht, wie auch Schweiger betont, bereits eine eklatante<br />
Lücke an weiblichen Studienanfängerinnen, die den Schluss zulässt, dass hier eine<br />
Förderung der Interessen schon viel früher ansetzen muss. Hier ist auf der Ebene<br />
des Schulsystems und der fachlichen Didaktik anzusetzen. Auf der Ebene der<br />
Universität ist es sicherlich ebenso notwendig, Lehrpläne und Lehrinhalte zu<br />
reflektieren, da diese für weibliche Studierende offensichtlich nicht attraktiv sind.<br />
Sensibilisierung und Bewusstseinsarbeit ist hier für die AkteurInnen der<br />
Frauenförderung ein Ansatzpunkt.<br />
Bei Mentoring-Beziehungen wird das Hauptaugenmerk meist auf die Mentées und<br />
dem Nutzen, den sie aus der Förderbeziehung lukrieren können, gelegt. Bei der<br />
120
Vorstellung der beiden Mentoring-Projekte betonen beide Gesprächspartnerinnen<br />
den Nutzen, den ein solches Programm auch für MentorInnen haben kann, wenn sie<br />
ihre Aufgabe ernst nehmen. Das Potenzial der Reflexion der eigenen Lehr- und<br />
Beratungstätigkeit und Einblicke in neue Netzwerke und der Wissensaustausch mit<br />
einer meist jüngeren Wissenschaftsgeneration kann die eigene fachliche und<br />
persönliche Reputation stärken und wiederum einen Schneeballeffekt durch<br />
Verbreitung der Mentoring-Idee bzw. weitere Teilnahmen der/des Mentorin/s<br />
auslösen.<br />
Ein wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren eines Programm, ob als oneto-one<br />
oder peer-group Förderbeziehung konzipiert, ist das „Matching“, die Auswahl<br />
der Personen, die am besten zueinander passen, auch da sind sich Schweiger und<br />
Schlögl einig. Ein erfolgreiches „Matching“ ist die Grundvoraussetzung für das<br />
Funktionieren des Programms. Wesentlich ist dabei auch, dass die TeilnehmerInnen<br />
aus verschieden Fachbereichen sind. Eine gewisse Distanz zueinander ist bei<br />
Mentoring-Programmen durchaus gewünscht.<br />
Diese Intention ist auch bei der Konzipierung des Salzburger Programms durch ein<br />
uniübergreifendes und gezieltes Ansprechen von MentorInnen, nach Bekanntsein<br />
der Mentées, ausschlaggebend.<br />
Über die Wichtigkeit des Geschlechts der MentorIn für die Mentées können keine<br />
verallgemeinernden Aussagen getroffen werden. Beide Projektleiterinnen bzw. -<br />
koordinatorinnen stimmen in den Erfahrungen überein, dass das Geschlecht der<br />
MentorIn für die Mentées persönlich wichtig sein kann. Ein Zusammenhang über die<br />
Rolle bestimmter Geschlechtermodelle (same-gender, cross-gender) und einer<br />
erfolgreichen Durchführung von Mentoring-Programmen, ist in diesem Rahmen<br />
allerdings nicht möglich.<br />
Auf meine eingangs gestellte Frage, ob Mentoring als Maßnahme zur<br />
Frauenförderung das „männliche System Universität“ stabilisiert und reproduziert,<br />
konnte ich keine Hinweise dafür festmachen. Auch wenn ein Mentoring-Programm<br />
vom klassischen one-to-one Förderansatz im Sinne einer Elitenförderung ausgeht,<br />
und der Nutzen dabei hauptsächlich individueller Natur ist, kommen Defizite und<br />
Karrierehemmnisse zur Sprache, die wiederum in größere Netzwerke getragen<br />
werden und somit auch Lösungs- und damit Veränderungspotenziale mit sich<br />
121
ingen. Deutlich wird, dass es individuell fördert und dabei zum Empowerment der<br />
Geförderten beiträgt.<br />
Allerdings kann wie bereits erwähnt, ein einzelnes, zeitlich befristetes<br />
Förderprogramm, wohl eher nicht zur Struktur- und Kulturveränderung einer<br />
Organisation wie der Universität beitragen. Darin sind sich die AutorInnen wie auch<br />
die Interviewpartnerinnen einig.<br />
Notwendige Voraussetzung dafür, ist die Einbettung eines Mentoring-Programms in<br />
ein gesamtes Förderkonzept zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung, dass auf<br />
die jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedlichen Fachbereiche auf horizontaler und<br />
vertikaler Ebene abgestimmt ist. Dieses Gesamtprogramm in den Regelbetrieb der<br />
Universität zu übernehmen, dabei noch mit gesicherter Finanzierung, wäre dann<br />
noch der Idealfall auf dem Weg zu einer tatsächlichen Veränderung der strukturellen<br />
und kulturellen Ungleichheiten.<br />
Die von Friederike Hassauer 2002 festgestellte Absenz der Homo.Academica und<br />
der fehlende weibliche Gegenpart zur männlichen symbolischen Ordnung in der<br />
Wissenschaft und im Wissenschaftsbetrieb (Hassauer 2002, 52), ist auch Jahre<br />
später zumindest auf den oberen hierarchischen Ebenen gültig. Daraus kann man<br />
einerseits schließen, dass die verschiedenen Förderprogramme, die seit der<br />
Institutionalisierung der Gleichstellungsarbeit und der Implementierung von Gender<br />
Mainstreaming an der Universität im Sinne von Angelika Wetterers rhetorischer<br />
Präsenz und faktischer Marginalität zu beurteilen sind, oder dass veraltete<br />
(männliche) Strukturen auf informellen Ebenen nach wie vor stark wirken. Wirkliche<br />
Alternative wäre daher m.E. die Ergänzung der Maßnahmen um die Einführung einer<br />
Quotenregelung für den wissenschaftlichen Bereich.<br />
Widerstände gegen Frauenförderungsmaßnahmen laufen häufig sehr subtil ab.<br />
Niemand wird offen gegen Maßnahmen und Programme zur Frauenförderung oder<br />
Erhöhung der Chancengleichheit (mit Ausnahme bei der Diskussion um<br />
Quotenregelung) auftreten. Wichtig ist es m.E. auch, dass nicht nur beim internen<br />
Handeln auf Chancengleichheit gesetzt wird, sondern sich die Organisation als<br />
Ganzes im externen Handeln, in ihrem Leitbild zu diesen Maßnahmen bekennt.<br />
122
Aus feministischer Sicht ist es weiterhin notwendig, Frauenförderungsmaßnahmen<br />
und Projekte zur Erhöhung der Chancengleichheit zu forcieren, um dem Ziel näher<br />
zu kommen, diese Maßnahmen durch die Gestaltung geschlechtergerechter<br />
Strukturen unnötig zu machen bzw. wie Waltraud Schlögl im Gespräch anführt:<br />
„Ziel und die Vision wäre, dass diese Mentoring-Programme dann für alle<br />
NachwuchswissenschafterInnen offen sein sollten, nämlich mit großem I, ab<br />
dem Zeitpunkt, wo das alles geschlechtergerecht geändert wurde und sich<br />
entwickelt hat, weil es ja prinzipiell kein Frauenproblem ist, sondern eine<br />
Frage der Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Aber so wie<br />
es ausschaut wird das sicherlich noch recht lange dauern“.<br />
Ein künftiges Ziel muss allerdings auch sein, die Ansätze für Mentoring-Programme<br />
komplex zu denken. Neben dem Focus auf Frauenförderung muss im Sinne von<br />
Gender und Diversity, die Frage der Vielfalt im Sinne von biographischen, kulturellen,<br />
ethnischen und sozialen Hintergründen der Zielgruppen bei der Konzipierung von<br />
Förderungsprogrammen miteinbezogen werden. Der Ansatz der Intersektionalität<br />
muss dabei mitbedacht werden.<br />
Die Frage der Diversitäten scheint mir zumindest an der Universität Salzburg eine<br />
vernachlässigte zu sein. Die damit implizierte Homogenität der Studierenden und<br />
Beschäftigten wäre künftig ein wichtiger Untersuchungsgegenstand.<br />
Der Umstand der sozialen Herkunft der Studierenden, die „Klassenfrage“ in<br />
Zusammenhang mit Studienwahl und Geschlecht, wären Teilaspekte einer<br />
vertiefenden Untersuchung. Die Wahl der Studien ist nicht nur geprägt durch eine<br />
geschlechtliche Segregation, sondern nach wie vor auch durch eine soziale<br />
Segregation.<br />
Dass es möglich ist, Mentoring-Projekte im Rahmen von Förderprogrammen in einer<br />
komplexen Organisation zu initiieren, mag an sich schon Potential zur Veränderung<br />
hierarchischer Strukturen in sich bergen. Eine möglichst breitegestreute Zielgruppe<br />
von Profitierenden ist aber wesentlich. Eine Erhöhung der Anzahl der „kritischen<br />
Masse“ kann strukturellen und kulturellen Veränderungen nur zuträglich sein.<br />
123
Literaturverzeichnis<br />
Appelt, Erna (Hg.) (2004): Karriereschere: Geschlechterverhältnisse im<br />
österreichischen Wissenschaftsbetrieb. Wien.<br />
Brandner, Stefanie (2005): Vom Mythos zum Frauenförderungskonzept. Ein Streifzug<br />
durch die Geschichte des Mentoring. In: Nienhaus, Doris/Pannatier,<br />
Gael/Töngi,Claudia (Hg.): Akademische Seilschaften. Mentoring für Frauen im<br />
Spannungsfeld von individueller Förderung und Strukturveränderung. Genderwissen.<br />
Bern/Wettingen. 17-28.<br />
Buchholz, Lydia (2004): Wissenschaftskarrieren an österreichischen Universitäten.<br />
In: Appelt, Erna (Hg.): Karriereschere: Geschlechterverhältnisse im österreichischen<br />
Wissenschaftsbetrieb. Wien. 71-93.<br />
Buchinger, Birgit/Gödl, Doris/Gschwandtner, Ulrike (2002): Berufskarrieren von<br />
Frauen und Männern an Österreichs Universitäten. Eine sozialwissenschaftliche<br />
Studie über die Vereinbarkeit von Beruf und Privatem. Materialien zur Förderung von<br />
Frauen in der Wissenschaft Band 14. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft<br />
und Kultur, Wien.<br />
Burkhardt, Anke/Schlegel, Uta (Hg.) (2003): Warten auf Gender Mainstreaming.<br />
Gleichstellungspolitik im Hochschulbereich. Die hochschule. Journal für Wissenschaft<br />
und Bildung. Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität, Halle-<br />
Wittenberg.<br />
Conell, Robert.W (2000): Der gemachte Mann: Konstruktionen und Krise von<br />
Männlichkeiten. Opladen, Leske + Budrich.<br />
De Beauvoir, Simone (2000): Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau.<br />
Rohwohlt Taschenbuchverlag.<br />
Dietzen, Agnes (1990): Universitäre Sozialisation. Zur Problematik eines<br />
heterosexuellen Beziehungsmodells: Mentor-Protegée. In: Die Philosophin. Forum<br />
für feministische Theorie und Philosophie. 1. Jahrgang, Heft 1. edition diskord,<br />
Tübingen. 18-39.<br />
Engler, Steffani (2007): Habitus Feld und sozialer Raum. Zur Nutzung der Konzepte<br />
Pierre Bourdieus in der Frauen- und Geschlechterforschung. In: Rehbein,<br />
Boike/Saalmann, Gernot/Schwengel, Hermann (Hg.): Pierre Bourdieus Theorie des<br />
Sozialen. Probleme und Perspektiven. Konstanz UVK.<br />
Färber, Christine (2001): Neue Organisationsstrukturen im Hochschulsystem – eine<br />
Chance für Frauen? In: Geißel, Brigitte/Seemann, Birgit (Hg): Bildungspolitik und<br />
Geschlecht : ein europäischer Vergleich. Opladen 2001.135-155.<br />
Flick, Uwe/Kardorff von, Ernst/Steinke, Ines (Hg.) (2005): Qualitative<br />
Sozialforschung. Ein Handbuch. Rowohlt Taschebuch Verlag GmbH. Reinbek bei<br />
Hamburg.<br />
124
Franzke, Astrid (2003): Mentoring für Frauen an Hochschulen. Potenziale für<br />
strukturelle Veränderungen. In: Burkhardt, Anke/Schlegel, Uta (Hg.): Warten auf<br />
Gender Mainstreaming. Gleichstellungspolitik im Hochschulbereich. Die hochschule.<br />
Journal für Wissenschaft und Bildung. Institut für Hochschulforschung an der Martin-<br />
Luther-Universität, Halle-Wittenberg, 93-107.<br />
Franzke, Astrid (2006): Organisationale Potenziale und Implementierungsstrategien<br />
von Mentoring an niedersächsischen Hochschulen. In: Franzke, Astrid/Gotzmann<br />
Helga (Hg.): Mentoring als Wettbewerbsfaktor für Hochschulen. Strukturelle Ansätze<br />
der Implementierung. Focus Gender, Band 7. Lit Verlag Hamburg, 51-66.<br />
Franzke, Astrid/Gotzmann Helga (Hg.) (2006): Mentoring als Wettbewerbsfaktor für<br />
Hochschulen. Strukturelle Ansätze der Implementierung. Focus Gender, Band 7. Lit<br />
Verlag Hamburg.<br />
Friese, Marianne (2003): Arbeit und Geschlecht in der Erziehungswissenschaft unter<br />
besonderer Berücksichtigung personenbezogener Dienstleistungsberufe. Expertise<br />
im Auftrag des vom BMBF geförderten Projekts GendA – Netzwerk feministische<br />
Arbeitsforschung. Institut für Politikwissenschaft, Philipps-Universität-Marburg.<br />
Genetti, Eva/Nöbauer, Herta/Schlögl, Waltraud (2003): Move on….. Ergebnisse und<br />
Empfehlungen aus dem Wiener Mentoring-Projekt für<br />
Nachwuchswissenschafterinnen. Projektzentrum Frauenförderung der Universität<br />
Wien.<br />
Glawion, Sven/Yekani, Elahe Haschemi/Husmann-Kastein, Jana (Hg.) (2007):<br />
Erlöser. Figurantionen männlicher Hegemonie. Gender-Codes. Transkription<br />
zwischen Wissen und Geschlecht. Transcript, Bielefeld.<br />
Goldberg, Christine/Rosenberger, Sieglinde (Hg.) (2002):<br />
Karriere/Frauen/Konkurrenz. StudienVerlag, Innsbruck.<br />
Hansen, Katrin (2006): Mentoring-Programme nachhaltig erfolgreich implementieren.<br />
In: Franzke, Astrid/Gotzmann Helga (Hg.): Mentoring als Wettbewerbsfaktor für<br />
Hochschulen. Strukturelle Ansätze der Implementierung. Focus Gender, Band 7. Lit<br />
Verlag Hamburg, 31-49.<br />
Hark, Sabine (2005): Dissidente Partizipation. Eine Diskursgeschichte des<br />
Feminismus. Suhrkamp taschenbuch wissenschaft. Frankfurt am Main.<br />
Hassauer, Friederike (1994): Homo.Academica. Geschlechterkontrakte, Institution<br />
und die Verteilung des Wissens, Wien.<br />
Hassauer, Friederike (2002): Die Matrix des Wissens. Autorität und Geschlecht. In:<br />
Freiburger Frauenstudien 12, 49-77.<br />
Helfferich, Cornelia (2005): Die Qualität qualitativer Daten. Manuel für die<br />
Durchführung qualitativer Interviews. Lehrbuch, Wiesbaden.<br />
125
Hopf, Christel (2005):Qualitative Interviews – ein Überblick. In: Flick, Uwe/Kardorff<br />
von, Ernst/Steinke, Ines (Hg.) (2005): Qualitative Sozialforschung. Ein Handbuch.<br />
Rowohlt Taschebuch Verlag GmbH. Reinbek bei Hamburg, 349-360.<br />
Holzleithner, Elisabeth (2002): Gleichbehandlung an den Universitäten –<br />
Erfahrungen mit dem gesetzlichen Instrumentarium. In: Rosenberger,<br />
Sieglinde/Goldberg, Christine (Hg.): Karriere/Frauen/Konkurrenz. StudienVerlag<br />
Innsbruck, 191-204.<br />
Holzleithner, Elisabeth (2004): „Gender Mainstreaming“ an den Universitäten –<br />
Fortschritt, Rückschritt oder Stillstand? In: Appelt, Erna (Hg.): Karriereschere.<br />
Geschlechterverhältnisse im österreichischen Wissenschaftsbetrieb, Wien, 27-46.<br />
Holzleithner, Elisabeth/Benke, Nikolaus (2003): Law meets Gender at the University.<br />
Eine Begegnung zwischen Missverständnissen, Schritten zu praktischer<br />
Geschlechtergleichheit und akademischen Innovationsschüben. In: Schaller-<br />
Steidl/Neuwirth, Barbara (Hg.): Frauenförderung in Wissenschaft und Forschung.<br />
Band 19, Wien, 191-222.<br />
Höyng, Stefan/Lange, Ralf (2004): Gender – Mainstreaming – ein Ansatz zur<br />
Auflösung männerbündischer Arbeits- und Organisationskultur? In: Meuser,<br />
Michael/Neusüß, Claudia (Hg.): Gender Mainstreaming. Konzepte – Handlungsfelder<br />
–Instrumente. Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn, 103-119.<br />
Klinger, Cornelia (1998): Periphere Kooptierung. Neue Formen der Ausgrenzung<br />
feministischer Kritik. Ein Gespräch mit Kornelia Klinger. In: Die Philosophin 9/18, 95-<br />
107.<br />
Klinger, Cornelia (2003): Ungleichheit in den Verhältnissen von Klasse, Rasse und<br />
Geschlecht. In: Knapp, Gudrun-Axeli/Wetterer, Angelika (Hg.): Achsen der Differenz.<br />
Gesellschaftstheorie und feministische Kritik II. Münster, Westfälisches Dampfboot,<br />
14-48.<br />
Knapp, Gudrun-Axeli/Wetterer, Angelika (Hg.) (2001): Soziale Verortung der<br />
Geschlechter: Gesellschaftstheorie und feministische Kritik. Münster, Westfälisches<br />
Dampfboot.<br />
Knapp, Gudrun-Axeli/Wetterer, Angelika (Hg.) (2003): Achsen der Differenz.<br />
Gesellschaftstheorie und feministische Kritik II. Münster, Westfälisches Dampfboot.<br />
Krais, Beate (Hg.) (2000): Wissenschaftskultur und Geschlechterordnung. Über die<br />
verborgenen Mechanismen männlicher Dominanz in der akademischen Welt.<br />
Campus Verlag. Frankfurt am Main.<br />
Kreisky, Eva (1994): Das ewig Männerbündische? Zur Standardform von Staat und<br />
Politik. In: Leggewie, Claus (Hg).: Wozu Politikwissenschaft? Über das Neue in der<br />
Politik. Darmstadt, 191-210.<br />
Kuhlmann, Ellen/Kutzner, Edelgard/Müller, Ursula/Riegraf, Birgit/Wilz, Sylvia (2002):<br />
Organisationen und Professionen als Produktionsstätte der Geschlechterasymmetrie.<br />
In: Schäfer, Eva/ Fritzsche, Bettina/Nagode, Claudia (Hg.): Geschlechterverhältnisse<br />
126
im sozialen Wandel. Interdisziplinäre Analysen zu Geschlecht und Modernisierung.<br />
Opladen, Leske + Budrich, 221-250.<br />
Lamnek, Siegfried (2005): Qualitative Sozialforschung. Weinheim, Basel 2005.<br />
Lang, Sabine/Sauer, Birgit (1997): Gleichstellungspolitische Wendezeit? Eine<br />
Einführung in den Band. In: Lang, Sabine (Hg.): Wissenschaft als Arbeit – Arbeit als<br />
Wissenschafterin. Frankfurt am Main/New York, Campus Verlag, 12-28.<br />
Lehner, Erich (2002): die Organisation als Männerbund. In: Wolf, Michael (Hg.):<br />
Frauen und Männer in Organisationen und Leitungsfunktionen. Unbewusste<br />
Prozesse und die Dynamik von Macht und Geschlecht. Brandes&Apsel Verlag<br />
GmbH, Frankfurt am Main, 19-35.<br />
Lorber, Judith (1999): Gender Paradoxien. Opladen. Leske+Budrich.<br />
Löther, Andrea (Hg.) (2004): Erfolg und Wirksamkeit von Gleichstellungsmaßnahmen<br />
an Hochschulen. CEWS. Beiträge Nr.3. Bielefeld.<br />
Mayring, Philipp(2000): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick, Uwe/Kardorff,<br />
Ernst von/Steinke, Ines (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt<br />
Taschenbuch Verlag GmbH, Hamburg, 468 – 475.<br />
Mayring, Philipp (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung<br />
zum qualitativem Denken. Beltz.<br />
Meuser, Michael/Neusüß, Claudia (Hg.) (2004): Gender Mainstreaming. Konzepte-<br />
Handlungsfelder-Instrumente. Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn.<br />
Meyerhofer, Ursula (2005): (Peer-)Mentoring für Wissenschafterinnen und die<br />
Bedingungen einer nachhaltigen akademischen Laufbahnförderung: Grenzen und<br />
Chancen. 115-136. In: Nöbauer, Herta/Genetti, Evi/Schlögl, Waltraud (Hg.):<br />
Mentoring für Wissenschafterinnen. Im Spannungsfeld universitärer Kultur- und<br />
Strukturveränderung. Materialen zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft.<br />
Band 20. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien.<br />
Mittelstrass, Jürgen (1997): Der Flug der Eule: Von der Vernunft der Wissenschaft<br />
und der Aufgabe der Philosophie. Frankfurt am Main, Suhrkamp.<br />
Neuberger, Oswald (1997): Individualisierung und Organisierung. Die wechselseitige<br />
Erzeugung von Individuum und Organisation und Verfahren. In: Orthmann,<br />
Günther/Sydow, Jörg/Türk, Klaus (Hg.): Theorien der Organisation. Opladen,<br />
Westdeutscher Verlag, 487-522<br />
Neusel, Ayla (1998): Funktionsweise der Hochschule als besondere Organisation. In:<br />
Rofoff Christine (Hg.): Reformpotential an Hochschulen. Berlin.<br />
Nienhaus, Doris/Pannatier, Gael/Töngi,Claudia (Hg.) (2005): Akademische<br />
Seilschaften. Mentoring für Frauen im Spannungsfeld von individueller Förderung<br />
und Strukturveränderung. Genderwissen. Bern/Wettingen.<br />
127
Nöbauer, Herta (2004): Mentoring als politisierte Praxis. In: Appelt, Erna (Hg.):<br />
Karriereschere: Geschlechterverhältnisse im österreichischen Wissenschaftsbetrieb.<br />
Wien, 109-122.<br />
Nöbauer, Herta/Zuckerhut, Patricia (2002): Differenzen. Einschlüsse und<br />
Ausschlüsse – Innen und Außen – Universität und freie Wissenschaft. Materialien zur<br />
Förderung von Frauen in der Wissenschaft Band 12. Bundesministerium für Bildung,<br />
Wissenschaft und Kultur, Wien.<br />
Nöbauer, Herta/Genetti, Evi/Schlögl, Waltraud (Hg.) (2005): Mentoring für<br />
Wissenschafterinnen. Im Spannungsfeld universitärer Kultur- und<br />
Strukturveränderung. Materialen zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft.<br />
Band 20. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Wien.<br />
Pechar, Hans: Die „offene“ Gruppenuniversität und ihre Grenzen. In: Brandstaller,<br />
Trautl (Hg.): Österreich 2. Anstöße zur Strukturreform. Wien 1996, 69-103.<br />
Nöbauer, Herta/Genetti Evi (2006): Geschlecht, Organisation und Transformation:<br />
Reflexionen über die Grenzen und Potenziale von Mentoring-Programmen für eine<br />
universitäre Kultur- und Strukturveränderung. In: Franzke, Astrid/Gotzmann Helga<br />
(Hg.): Mentoring als Wettbewerbsfaktor für Hochschulen. Strukturelle Ansätze der<br />
Implementierung. Focus Gender, Band 7. Lit Verlag Hamburg, 67-81.<br />
Pellert, Ada: Das UG 2002 und seine Auswirkungen auf Personalentwicklung und<br />
Frauenförderung. BUKO Hochschulpolitische Informationen der Bundeskonferenz<br />
des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 03/I-4. Wien 2003, 28-31.<br />
Pellert, Ada/Welan, Manfred: Die formierte Anarchie. Die Herausforderung der<br />
Universitätsorganisation. Wien 1995.<br />
Plöger, Lydia/Riegraf, Birgit (Hg.): Gleichstellungspolitik als Element innovativer<br />
Hochschulreform. Wissenschaftliche Reihe Band 105. Bielefeld 1998.<br />
Roloff, Christine (1998): Hochschulen in Veränderung. Wo stehen die Frauen in der<br />
gegenwärtigen Umbruchsphase? In: Rofoff, Christine (Hg.): Reformpotential an<br />
Hochschulen. Berlin.<br />
Roloff, Christine (Hg.): Personalentwicklung, Geschlechtergerechtigkeit und<br />
Qualitätsmanagement an der Hochschule. Wissenschaftliche Reihe, Band 142,<br />
Bielefeld 2002.<br />
Rosenstiel, Lutz von (2005): Organisationsanalyse. In: Flick, Uwe/Kardorff von,<br />
Ernst/Steinke, Ines (Hg.): Qualitative Sozialforschung. Ein Handbuch. Rowohlt<br />
Taschebuch Verlag GmbH. Reinbek bei Hamburg, 224-237.<br />
Schaller-Steidl, Roberta/Neuwirth, Barbara (Hg.) (2003): Frauenförderung in<br />
Wissenschaft und Forschung. Konzepte-Strukturen-Praktiken. Materialen zur<br />
Förderung von Frauen in der Wissenschaft Band 19. Bundesministerium für Bildung,<br />
Wissenschaft und Kultur. Wien.<br />
128
Schliesselberger, Eva/Strasser, Sabine (1998): In den Fußstapfen der Pallas Athen?<br />
Möglichkeiten und Grenzen des Mentoring von unterrepräsentierten Gruppen im<br />
universitären Feld. Materialien zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft, Band<br />
7. Wien.<br />
Schliesselberger, Eva/Strasser, Sabine (2002): Mentoring: ein widersprüchliches<br />
Konzept als Instrument der Frauenförderung in der Wissenschaft. In: Rosenberger,<br />
Sieglinde/Goldberg, Christine (Hg.): Karriere/Frauen/Konkurrenz. Innsbruck, 215-<br />
227.<br />
Scholz, Christian/Hofbauer, Wolfgang (1990): Organisationskultur. Die vier<br />
Erfolgsprinzipien. Wiesbaden.<br />
Schreyögg, Georg (1998): Organisation. Grundlagen modernen<br />
Organisationsgestaltung. Wiesbaden.<br />
Seiser, Gertrud (2003): “Man muss die gewinnen, die das Handeln haben“. Die<br />
Entwicklung der Frauenförderung an Österreichs Universitäten in den 1990er-Jahren<br />
aus Verwaltungsperspektive. In: Schaller-Steidl, Roberta/Neuwirth, Barbara (Hg.):<br />
Frauenförderung in Wissenschaft und Forschung. Konzepte-Strukturen-Praktiken.<br />
Materialen zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft Band 19.<br />
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Wien, 17-39.<br />
Simmel, Georg (1983): Zur Philosophie der Geschlechter. In: Philosophische Kultur.<br />
Über das Abenteuer, die Geschlechter und die Krise der Moderne. Gesammelte<br />
Essais, Berlin, 52-98.<br />
Sombart, Nikolaus (1996): Männerbund und Politische Kultur in Deutschland. In:<br />
Kühne, Thomas (Hg.): Männergeschichte-Geschlechtergeschichte. Männlichkeit im<br />
Wandel der Moderne. Frankfurt am Main, 136-155<br />
Strasser, Sabine/Schliesselberger Eva (2000): Integration oder Abhängigkeit? Zur<br />
Ambivalenz von Mentoring als politische Praxis in der Wissenschaft. In: Page,<br />
Julie/Leemann, Regula Julia (Hg.): Karrieren von Akademikerinnen: Bedeutung des<br />
Mentoring als Instrument der Nachwuchsförderung. Dokumentation der Fachtagung<br />
vom 27. März 1999 an der Universität Zürich. Bern: Bundesamt für Bildung und<br />
Wissenschaft (BBW), 13-26.<br />
Strasser, Sabine (1998): Zum Begriff Mentoring – Konzepte zwischen der<br />
Reproduktion akademischer Macht und der Integration unterrepräsentierter Gruppen.<br />
In: Schliesselberger, Eva; Strasser, Sabine (Hg.): In den Fußstapfen der Pallas<br />
Athen? Möglichkeiten und Grenzen des Mentoring von unterrepräsentierten Gruppen<br />
im universitären Feld. Materialien zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft,<br />
Band 7. Wien, 16-56.<br />
Türk Klaus (1993): Politische Ökonomie der Organisation. In: Kieser, Alfred (Hg.):<br />
Organisationstheorien. Stuttgart, 297-331.<br />
Ulmi, Marianne/Maurer, Elisabeth (2005): Geschlechterdifferenz und<br />
Nachwuchsförderung in der Wissenschaft. Studie 3 ihm Rahmen des SOWI-<br />
Disslabors. UniFrauenstelle Universität Zürich, 17.<br />
129
Ulrich, Silvia (2004): Die Genderdimension des Universitätsgesetzes 2002. In:<br />
Höllinger/Titscher (Hg.), 344-361.<br />
Wetterer, Angelika (2000): Noch einmal: Rhetorische Präsenz – faktische<br />
Marginalität. Die kontrafaktischen Wirkungen der bisherigen Frauenförderung im<br />
Hochschulbereich. In: Krais, Beate (Hg.): Wissenschaftskultur und<br />
Geschlechterordnung. Über die verborgenen Mechanismen männlicher Dominanz in<br />
der akademischen Welt. Campus Verlag. Frankfurt am Main, 195-221.<br />
Wetterer, Angelika (2002): Strategien rhetorischer Modernisierung. Gender<br />
Mainstreaming. Managing Diversity und die Professionalisierung der Gender-<br />
ExpertInnen. In: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterforschung 3/2002.<br />
Bielefeld, Kleine.<br />
Wetterer, Angelika (2003): Gender Mainstreaming & Managing Diversity. Rhetorische<br />
Modernisierung oder Paradigmenwechsel in der Gleichstellungspolitik. In: Burkhardt,<br />
Anke/Schlegel, Uta (Hg.): Warten auf Gender Mainstreaming. Gleichstellungspolitik<br />
im Hochschulbereich. Die hochschule. Journal für Wissenschaft und Bildung. Institut<br />
für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität. Halle-Wittenberg, 6-27.<br />
Wolf, Michael (1994): Institutionenanalyse in der Supervision. In: Pühl, Harald (Hg.):<br />
Handbuch der Supervision 2. Spiess Volker GmbH, 132-151.<br />
Wroblewski, Angela/Gindl, Michaela/Leitner, Andrea/Pellert, Ada/Woitech, Birgit<br />
(2007): Wirkungsanalyse frauenfördernder Maßnahmen im bm:bwk. Materialien zur<br />
Förderung von Frauen in der Wissenschaft, Band 21. Wien.<br />
Wroblewski, Angela/Leitner, Andrea (2007): Begleitende Evaluierung von<br />
„excellentia“. 1. Zwischenbericht. IHS, Wien.<br />
130
ANHANG<br />
131
Interviewleitfaden<br />
Komplex 1: Einleitung / Rahmenbedingungen der Befragten<br />
Welche Funktion haben Sie und welche Tätigkeiten üben Sie beim Mentoring-Projekt<br />
Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung/m:uv aus?<br />
Wie sind Sie zu dem Projekt gekommen?<br />
Komplex 2: Motive<br />
Was waren die Motive für die Initiierung des Projektes Chancengleichheit in der<br />
Nachwuchsförderung/m:uv?<br />
Welches Ziel steht bei Ihrem Projekt Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung/<br />
m:uv im Vordergrund?<br />
Was ist aus Ihrer Sicht generell das Motiv von Mentoring?<br />
Welches Motiv verbindet man speziell mit Mentoring an Universitäten?<br />
Komplex 3: Erfahrungen<br />
Welche Erfahrungen haben Sie mit ihrem bis dato Projekt gemacht?<br />
Welche Erfahrungen würden Sie als besonders positiv im Hinblick auf Ihr Ziel<br />
einschätzen?<br />
Welche negativ?<br />
Was sind Ihrer Meinung nach die Erfolgsfaktoren für ein effektives Mentoring?<br />
Ist Ihrer Meinung nach die Implementierung von Mentoring-Projekten ein Ziel zur<br />
Strukturveränderung und wie könnte diese Implementierung ausschauen?<br />
132
Komplex 4: strukturelle und kulturelle Veränderungspotenziale für<br />
Universitäten<br />
Wo liegen Ihrer Meinung nach strukturelle Effekte und Veränderungspotenziale in der<br />
Hierarchie einer Universität durch Mentoring? Inwieweit ist Mentoring Ihrer<br />
Einschätzung nach eine Möglichkeit zur strukturellen und kulturellen Veränderung an<br />
der Universität?<br />
In der Literatur ist immer wieder vom „widersprüchlichen Konzept“ die Rede. Wie<br />
sehen Sie die Gefahr einer Reproduktion bestehender Verhältnisse durch<br />
Förderbeziehungen?<br />
Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach das Geschlecht in Förderbeziehungen?<br />
Wie sehen Sie Mentoring im Verhältnis zu anderen Frauenförderungsmaßnahmen?<br />
Ist Mentoring Ihrer Meinung nach ein feministisches Projekt?<br />
133
Interview mit Mag. a Teresa SCHWEIGER, Leiterin des gendup-Zentrum für Gender<br />
Studies und Frauenförderung an der Universität Salzburg, Projektleiterin des<br />
Mentoringprojektes Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung, durchgeführt am<br />
20.08.2008<br />
Welche Funktion haben Sie und welche Tätigkeiten üben Sie beim Mentoring-Projekt<br />
Chancengleichheit in der Nachwuchsförderung aus? Wie sieht das Projekt aus?<br />
Ich bin Leiterin des gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung an<br />
der Universität Salzburg. Ich habe das Zentrum als Karenzvertretung jetzt ein Jahr<br />
geleitet und in dieser Funktion gemeinsam mit meiner Kollegin, Dr. Margit Waid aus<br />
Linz, von der Stabstelle für Gleichstellung an der Universität Linz, das Mentoring-<br />
Programm entwickelt. Also, wir haben es konzipiert, wir haben auch die<br />
Besonderheit, dass es eben universitätsübergreifend ist, miteinbezogen. Insofern<br />
habe ich das betreut und meine letzte Aufgabe war es jetzt noch in Salzburg<br />
MentorInnen gezielt anzusprechen.<br />
Der Name des Projekts kommt daher, dass wir uns überlegt haben, dass Wort<br />
Frauenförderung bewusst auszuklammern, da das Wort ja nicht so einen guten Ruf<br />
hat und da das Projekt auch konzipiert ist für weniger - sag ich jetzt einmal -<br />
„frauenbewusste“ Bereiche wie den naturwissenschaftlichen-, technischen und<br />
wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtungen, haben wir uns überlegt, dass wir<br />
das Wort einfach rauslassen. Es geht um Nachwuchsförderung und auch um das<br />
Geschlecht nicht immer so in den Vordergrund zu spielen.<br />
Unser Projekt basiert auch vom Ansatz her auf einer one-to-one Förderbeziehung<br />
und soll so angelegt sein, dass sie weniger Austausch über persönliche<br />
Schwierigkeiten und Probleme während der Karriereplanung, mit<br />
dementsprechenden Karrieretipps von MentorInnenseite, sein sollen, sondern liegt<br />
der Focus auf den inhaltlichen, forschungsrelevanten Austausch von Wissen und der<br />
bereitwilligen Weitergabe dieses Wissens. Und uniübergreifend auch vor allem, dass<br />
in den spezifischen Forschungen der Naturwissenschaften und Technik ein Einblick<br />
in die Forschungsgebiete anderer Universitäten Kooperationsmöglichkeiten und<br />
134
Netzwerkerweiterungen ermöglicht werden können, für die Mentées und für die<br />
Mentoren.<br />
Das Projekt ist meiner Meinung nach ein sehr exklusives Projekt durch das<br />
universitätsübergreifenden Konzept. Durch das Programm kann für die Mentées ein<br />
Zugang in andere Forschungskulturen geschaffen werden und Netzwerke geöffnet<br />
werden, die gerade in den spezifischen naturwissenschaftlichen und technischen<br />
Forschungsgebieten durch ihre Spezifikationen schwer zugänglich sind.<br />
Wie sind Sie zu dem Projekt gekommen?<br />
Es wurde schon sehr lange im gendup versucht, ein Mentoring-Projekt auf die Beine<br />
zu stellen. Das ist bis jetzt wegen der fehlenden Finanzierung nicht gelungen. Wir<br />
haben es dann so angelegt, dass es innerhalb eine bereits bestehenden<br />
Frauenförderungsprojektes, nämlich innerhalb von karriere_links, als dritte und<br />
höchste Stufe eingebaut wird.<br />
Was waren die Motive für die Initiierung des Projektes?<br />
Also einerseits haben wir eine Lücke gesehen, weil im karriere_links haben wir<br />
zuletzt eine Förderung für Habilitandinnen gehabt und in Gesprächen mit diesen<br />
Habilitandinnen an der Universität Salzburg und Linz haben wir erkannt, dass es da<br />
auf dem Weg zur Professur noch sehr mangelt, auch an Bewusstsein, aber auch an<br />
den Netzwerken, dass es sehr viele Frauen bzw. Wissenschafterinnen es absolut<br />
nicht bewusst ist, wie wichtig Netzwerke sind. Und dass sie hier eine Förderung<br />
brauchen. Das war mal das eine Motiv, die andere Motivation war die<br />
Frauenförderung noch stärker beim Rektorat zu etablieren. Wir haben uns gedacht,<br />
am besten geht das dann mit einem doch exklusivem Programm, dass MentorInnen<br />
von den Unis, also ProfessorInnen aktiv involviert.<br />
Was ist aus Ihrer Sicht generell das Motiv von Mentoring? Welches Motiv verbindet<br />
man speziell mit Mentoring an Universitäten?<br />
Also, Mentoring ist für mich ganz klar für die Universitäten nicht nur als<br />
frauenfördernde Maßnahme gesehen. Inoffizielles Mentoring, so nenne ich das, das<br />
135
ja besteht, wird so nicht benannt. Das ist auch eine Schwierigkeit, deshalb haben wir<br />
in unserem Titel das Wort Mentoring auch nicht mit hineingenommen, weil es von<br />
sehr vielen gleichgesetzt wird mit Frauenförderung. Und das soll es einerseits schon<br />
sein, aber vor allem eine Wissenschafterinnenförderung und ein Ausgleichen der<br />
„inoffiziellen“ Mentoring-Projekte die es doch meistens zwischen männlichen<br />
Professoren und männlichen Nachwuchswissenschafter gibt.<br />
Welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt mit dem Projekt gemacht?<br />
Erfahrungen die wir gemacht haben sind, dass die Hemmschwelle sich zu bewerben<br />
von Mentées doch hoch ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir wirklich auch<br />
ganz dezidiert hineingeschrieben haben, wer sich bewirbt als Mentée, muss zum Ziel<br />
eine Professur oder eine leitende Position in einer Forschungseinrichtung haben.<br />
Das war ganz klar unsere Zielvorgabe und dadurch haben wir die Latte sehr hoch<br />
gelegt – das ist bis jetzt unsere Erfahrung – und hatten auch genauso viele<br />
Bewerbungen wir Plätze, nämlich zwei an jeder Universität. Es gibt auch, das<br />
können wir beobachten, in den technischen-naturwissenschaftlichen Fächern<br />
Lücken. D.h. es gibt Nachwuchswissenschafterinnen, die sehr gerne teilgenommen<br />
hätten, allerdings noch nicht in der Qualifikation drin sind, d.h. noch keine post-docs<br />
sind und nicht habilitiert sind. Und dann gibt es welche, die sogenannte „alte“<br />
Assistentinnenposten haben, die sich davon nicht mehr weg bewerben wollen auf<br />
eine Professur, wo sie dann auch finanziell schlechter gestellt sind. Dazwischen gibt<br />
es eine Lücke. Das ist uns jetzt aufgefallen. Es gibt natürlich auch Studienrichtungen<br />
gerade auch an der Universität Salzburg, da gibt es keine Frauen, die in dieser<br />
Qualifikationsphase drinnen sind. Das war ja auch dann der Versuch, das Projekt<br />
universitätsübergreifend zu machen, das wir z.B. eine Person von der Uni Linz haben<br />
und dann einen Mentor aus einem Fachbereich von der Uni Salzburg nehmen, wo es<br />
an der Uni Salzburg noch keine Frauen gibt. Das dieser Mentor dann aber eine<br />
Mentée betreut und dann vielleicht auch als Mehrwert erkennt.<br />
Ein weiteres Motiv für die uniübergreifende Idee war eben eine größere<br />
Auswahlmöglichkeiten und auch Lernprozesse bei ProfessorInnen und<br />
Bewusstseinsbildung, aber auch natürlich die Größe der beiden Unis. Also es wäre in<br />
machen Fachbereichen wirklich nicht gut, wenn ein Mentée aus dem gleichen<br />
136
Fachbereich kommt wie der Mentor. Das sind die Unis einfach nicht groß genug, um<br />
da auch eine Distanz zu schaffen.<br />
Was sind Ihrer Meinung nach die Erfolgsfaktoren für ein effektives Mentoring?<br />
Es muss auf jeden Fall Geld zur Verfügung gestellt werden von der Unileitung. Das<br />
sage ich jetzt als erstes, weil es wirklich ganz wichtig ist, damit man ein ordentliches<br />
Programm machen kann, sowohl für die MentorInnen als auch für die Mentées. Man<br />
muss für die MentorInnen ein Anreizsystem entwickeln. Das sind ja<br />
WunschmentorInnen, erfolgreiche WissenschafterInnen, die ja auch sehr viel zu tun<br />
haben, in sehr viele Gremien drin sind und Positionen innehaben. Denen muss man<br />
einen Anreiz geben, damit sie bei so einem Programm auch mitmachen. Und es ist<br />
auch in der österreichischen Tradition Mentoring noch nicht so bekannt, das merke<br />
ich auch immer wieder, dass ProfessorInnen, die aus Deutschland kommen,<br />
Mentoring auch offener gegenüberstehen. Daher ist auch das Geld sehr wichtig, weil<br />
man auch interessante Personen einladen möchte, muss, soll und kann zu<br />
Auftaktveranstaltungen, und das Ganze professionell umsetzen kann, weil es ja auch<br />
Arbeitskraft braucht. Dann würde ich schon sagen, dass das gebündelte Wissen um<br />
Mentoringprogramme, die es schon gegeben hat im deutschsprachigen Raum sehr<br />
wichtig ist und man auf diesen Erfahrung jetzt schon aufbauen kann und auf die<br />
jeweiligen Verhältnisse adaptieren kann. Ohne die Vorarbeiten der Kolleginnen in<br />
Wien, aber auch an den deutschsprachigen Unis wäre es dann doch schwieriger<br />
gewesen, so etwas in der kurzen Zeit umzusetzen. Und dann ganz wichtig ist<br />
natürlich, dass das unterstützt wird von der Universitätsleitung.<br />
Das ist ein Um und Auf.<br />
Ist Ihrer Meinung nach die Implementierung von Mentoringprojekten ein Ziel zur<br />
Strukturveränderung und wie könnte diese Implementierung ausschauen?<br />
Naja, wir haben so eine halbe Implementierung jetzt, dadurch dass wir es schon an<br />
eine bestehende Struktur angehängt haben, ich glaube das war relativ geschickt,<br />
wenn man nicht ganz frei schwebend agiert. Das ist auf jeden Fall eine Anbindung,<br />
die einer Implementierung gleich kommt. Eine Implementierung ist auf jeden Fall<br />
erstrebenswert, weil sonst wird es wieder unter irgendeinem Projekt „Nummer<br />
137
sowieso“ abgehandelt wird, das ist dann auch das Prestige nach außen. Wenn man<br />
schon Frauenförderungsprogramme hat an Universitäten, dann ist es meiner<br />
Meinung nach schon empfehlenswert, an die anzudocken, damit dass ein Bündel<br />
wird. Es ist glaube ich nicht gut, wenn man jedem Frauenförderungsprogramm ein<br />
anderes Mascherl gibt, einen anderen Namen und dann ist das wieder total<br />
zergliedert. Das das an einem Ort passiert, ist meiner Meinung nach schon gut, wo<br />
man auch sagt, da ist eine AnsprechpartnerIn.<br />
Wo liegen Ihrer Meinung nach strukturelle Effekte und Veränderungspotenzial in der<br />
Hierarchie einer Universität durch Mentoring? Inwieweit ist Mentoring Ihrer<br />
Einschätzung nach eine Möglichkeit zur strukturellen und kulturellen Veränderung an<br />
der Universität?<br />
Ja, schwierig zu beantworten. Auf jeden Fall glaube ich, fast noch wichtiger als der<br />
Prozess für die Mentées ist der Prozess, den die MentorInnen durchlaufen. Das ist<br />
unsere Erfahrung. Dadurch wird das Bewusstsein geschaffen, dass Ungleichheiten<br />
zwischen den Geschlechtern herrschen, das ist einfach so, die werden auch nicht<br />
unbedingt aus Böswilligkeit bewusst herbeigeführt, sondern das sind Mechanismen,<br />
das weiß man ja auch aus der Psychologie, der „Mini me“, man will halt auch einen<br />
haben, der einem ein bisschen ähnlich ist, ich glaube das ist jetzt ganz wichtig auf<br />
der Ebene von Personen, die jetzt in Führungspositionen sind, dass sie einen<br />
Bewusstseinsprozess durchlaufen und sehen, es gibt Frauen die das können, man<br />
muss da wirklich auch auf dieser Stufe anfangen. Für die Mentées würde ich mir<br />
wünschen, dass sie erkennen, dass Netzwerke ganz wichtig sind und dass sie sich<br />
auch Ziele höher stecken sollen – möglichst hoch. Und ich glaube dadurch kann man<br />
dann schon strukturelle Veränderungen bewirken. Was jetzt die ganze Uni betrifft,<br />
das ist es jetzt meine Meinung, dass man da die Geschlechterverhältnisse auf allen<br />
Ebenen ausgleichen sollte. Solange es immer noch so abläuft, die Sekretärin ist<br />
automatisch eine Frau, werden auch ein paar Frauen in höheren Positionen<br />
strukturell nichts ändern. Die ganze Unikultur müsste sich meiner Meinung nach<br />
öffnen und da ist sicher das Mentoringprogramm ein kleiner Stein, aber allein zu<br />
wenig. Weil es da ja auch noch um andere Faktoren der Ungleichheit geht, wie<br />
ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, etc. Das Geschlecht oder das Frau-Sein<br />
138
ist zwar der offensichtlichste Faktor. Dass dabei ein Mentoring-Programm allein<br />
große Strukturveränderungen herbeiführt, glaube ich nicht.<br />
Eine große Chance besteht auch darin, dass Frauen, die ein Mentoring-Programm<br />
erfolgreich durchlaufen haben, sich auch selbst als Mentorinnen zur Verfügung<br />
stellen und durch Vorbildwirkung und Rolle als Multiplikatorinnen ein<br />
Schneeballeffekt entsteht, der die Anzahl der weiblichen Wissenschafterinnen in<br />
Leitungsfunktionen steigen lässt. Ob allerdings die quantitative Erhöhung weiblicher<br />
Leitungsfunktionen strukturelle Änderungen mit sich bringt, bleibt umstritten, ist zwar<br />
wahnsinnig wünschenswert, aber doch etwas realistischer zu sehen.<br />
In der Literatur ist immer wieder vom „widersprüchlichen Konzept“ die Rede. Wie<br />
sehen Sie die Gefahr einer Reproduktion bestehender Verhältnisse durch<br />
Förderbeziehungen?<br />
Naja, das ist immer die Crux. Will man das System ändern oder will man Personen in<br />
dem System erfolgreich machen. Ich glaube das ist ein Spannungsfeld in dem man<br />
sich immer bewegt. Ich habe grad gestern im „Standard“ (19.09.2008, Der Standard,<br />
Anm. d. Verf.) ein Interview gelesen mit einem Forscher, der die<br />
Evaluierungstendenz an Unis kritisiert, aber trotzdem den jungen<br />
WissenschafterInnen rät, „macht´s da mit, tut´s möglichst viel publizieren“, und so<br />
ähnlich sehe ich das bei Mentoring. Es bringt nichts, wenn ich im Büro für<br />
Frauenförderung sitze und den Frauen sage, ja da werden aber Eliten und<br />
Hierarchien reproduziert und mach da nicht mit! Weil für die Einzelne läuft es dann<br />
drauf raus, dass sie dann keine Stelle kriegt. Ich finde eine ausgewogene Balance<br />
schon wichtig, aber ich halte ein Mentoring-Programm trotzdem in seinen<br />
Auswirkungen für positiver als negativ. Die Effekte sind sicher positiv.<br />
Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach das Geschlecht in Förderbeziehungen?<br />
Ja, in vielen Bereichen kommt man ja gar nicht drum herum, das ein Mann ein<br />
Mentor ist. Ich glaube es hängt auch sehr stark von der Einstellung der Mentée ab.<br />
Das haben wir auch bei den Bewerbungen gesehen, manche wollen ja ganz dezidiert<br />
eine Frau als Mentorin. Das ist vielleicht, wenn sie aus Fachbereichen kommen, die<br />
sehr männerorientiert sind oder es ist einfach typabhängig, welche Paarung man<br />
139
vorzieht. Das ist individuell. Ob ein Mentée jetzt mehr von einem Mentor hat, kann<br />
man auch nicht so generell sagen, weil es da auch drauf ankommt, wie stark sich die<br />
Mentoren um ihr Mentée kümmern, wie intensiv dies betrieben wird und natürlich wie<br />
sie selber auch verankert sind.<br />
Unser Projekt ist als Cross-Gender-Projekt angelegt, einfach auch aus dem Grund<br />
des größeren Auswahlpools und es soll auch nicht der Eindruck verstärkt werden, es<br />
handle sich um ein Projekt von „Outsiderin“ zu „Outsiderin“. Auch wenn Mentorinnen<br />
wegen ihres Geschlechts, auch die wichtige Funktion eines role models zukommt,<br />
lernen – das glaube ich schon – männliche Mentoren durch den Prozess ihre eigene<br />
Rolle als Vorbild zu überdenken und als Multiplikatoren für zukünftige<br />
geschlechtergerechtere Strukturen einzutreten.<br />
Wie sehen Sie Mentoring im Verhältnis zu anderen Frauenförderungsmaßnahmen?<br />
Ich sehe Mentoring als eine Möglichkeit, wirklich schon innerhalb der universitären<br />
Strukturen Veränderungen herbeizuführen. Ich sehe Mentoring nicht als Programm<br />
Frauen in bestimmte Bereiche reinzubringen, da glaube ich ist es nicht<br />
niederschwellig genug. Ich glaube, ein Fachbereich, der keine Frauen hat, der<br />
braucht nicht unbedingt ein Mentoring-Programm, sondern etwas, dass die<br />
Studentinnen bleiben bzw. kommen. Ich sehe das wirklich als interne Maßnahme,<br />
zumindest so wie wir das jetzt machen. Es gibt auch noch andere Mentoringprojekte,<br />
z.B. die an der Schnittstelle Uni und Wirtschaft agieren, das ist dann auch wieder<br />
was anderes. Mentoringprojekte sehe ich wirklich als ganz gezielte Maßnahmen, die<br />
aber andere Maßnahmen nicht ersetzten können und sollen. Für<br />
Studienanfängerinnen ist ein Mentoring überfordernd. Weil ich glaube, man muss bei<br />
Mentoring schon sehr bewusst dran arbeiten und zielorientiert ansetzen. Ob diese<br />
Ziele dann erreicht werden, ist wieder etwas anderes.<br />
Ist Mentoring ein feministisches Projekt?<br />
Wir haben uns schon bemüht, das Projekt als feministisches Projekt zu machen, ja<br />
ich sehe jegliche Frauenförderungsmaßnahme als feministisches Projekt. Wenn man<br />
sagt, Feminismus ist sehr stark mit politisch linker Einstellung verbunden, dann ist<br />
das natürlich schon die Frage, ob Mentoring ein feministisches Projekt ist. Frauen die<br />
140
da mitmachen, werden ja auch nicht nach ihrer Einstellung gefragt. Aber ein<br />
feministisches Projekt im Sinne, dass es an den bestehenden Strukturen rüttelt, ist es<br />
meiner Meinung nach schon.<br />
141
Interview mit Mag. a Waltraud SCHLÖGL, Projektkoordinatorin von m:uv der<br />
Universität Wien, Büro des Referats für Frauenförderung und Gleichstellung der<br />
Universität Wien, durchgeführt am 02.07.2008.<br />
Welche Funktion haben Sie und welche Tätigkeiten üben Sie beim Mentoringprojekt<br />
m:uv aus?<br />
Also, meine Funktion ist die der Projektkoordinatorin. Es ist bei uns so aufgeteilt,<br />
dass die Frau Mag. a Genetti interne Projektleiterin ist. Früher war es so, dass die<br />
Vizerektorin für Frauenförderung die formale Leitung gehabt hat, Frau Mag. a Genetti<br />
die operative Leitung und eine Kollegin und ich die Projektkoordinatorinnen waren.<br />
Jetzt ist es so ich mache zurzeit alleine die Projektkoordination und Frau Mag. a<br />
Genetti ist die Projektleiterin.<br />
Wie sind Sie zu dem Projekt gekommen?<br />
Begonnen hat alles 2001 mit dem Pilotprogramm, das war ein Drittmittelprogramm,<br />
gefördert vom ESF (Europäischer Sozialfonds) und bmwk, natürlich auch mit<br />
Eigenmitteln der Universität Wien. Ursprünglich ist es auf eine Initiative der<br />
damaligen Koordinationsstelle für Frauen und Geschlechterforschung<br />
zurückgegangen und es gibt einen Konnex zur der Studie von Strasser/<br />
Schliesselberger die vom bmwk in Auftrag gegeben worden ist, wo zum ersten Mal<br />
darum ging, sich Mentoringprozesse an den österreichischen Universitäten<br />
anzuschauen. Gemeinsam mit der Initiative der interuniversitären Koordinationsstelle<br />
hat das dann dazu geführt, dass seitens des bmwk, die Roberta Schaller-Steidl war<br />
da federführend, ja so der Wunsch entstanden ist, ein Pilotprojekt an der Uni Wien zu<br />
initiieren. Das ist dann von der Frau Mag. a Genetti und von der Frau Mag. a<br />
Bukowska, von dem neu eingerichteten Referat für Frauenförderung und<br />
Gleichstellung in die Wege geleitet worden. Als Projektkoordinatorinnen sind die Frau<br />
Mag. a Nöbauer und ich bestellt worden.<br />
142
Was waren die Motive für die Initiierung des Projektes muv?<br />
Es ging zuerst einmal darum, dass bis dorthin an österreichischen Universitäten noch<br />
gar keine Erfahrungen mit Mentoring-Programmen gegeben hat, international schon<br />
sehr viele und man vor allem auch aufgrund der Studie von<br />
Schliesselberger/Strasser 44 erkannt hat, was für ein wichtiges Potenzial in Mentoring<br />
steckt und das einfach auch nutzbar machen wollte.<br />
Welches Ziel steht bei Ihrem Projekt m:uv im Vordergrund?<br />
Es war aber von Anfang an so, dass man aufgrund dieser Studie nicht von einem<br />
klassischen Mentoringansatz ausgegangen ist, sondern immer schon auch<br />
mitgedacht haben im Konzept, dass Mentoring durchaus, ja, ein sehr traditioneller<br />
Ansatz sein kann, also, herkömmliche Strukturen auch verfestigen kann in diesen<br />
one-to-one Beziehungen und das wollten wir von Beginn an vermeiden und auch<br />
konterkarieren und aufbrechen und haben von Beginn an ein recht innovatives<br />
Konzept gefahren, nämlich fächerübergreifendes Gruppenmentoring. Wo eben die<br />
Idee war, dass hier Räume geschaffen werden, die natürlich nicht hierarchiefrei sind,<br />
dass ist schon klar, aber die erstens nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen,<br />
die Mentees und die MentorInnen, und auf der anderen Seite es auch diese Peer-<br />
Ebene gibt, in der Kleingruppe, wo eine zusätzliche Vernetzungsebene und<br />
Förderebene auch da ist, die auch ein bisschen die hierarchische Beziehung zur<br />
Mentorin oder zum Mentor konterkarieren soll.<br />
Nachfrage Gruppenmentoring, Wie sieht das aus?<br />
Wir arbeiten in der Regel mit Kleingruppen mit vier Mentées und einer MentorIn.<br />
44<br />
Anm.: Schliesselberger, Eva/Strasser, Sabine (1998): In den Fußstapfen der Pallas Athen?<br />
Möglichkeiten und Grenzen des Mentoring von unterrepräsentierten Gruppen im universitären Feld. Materialien<br />
zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft, Band 7. Wien.<br />
143
Was ist aus Ihrer Sicht generell das Motiv von Mentoring?<br />
Welches Motiv verbindet man speziell mit Mentoring an Universitäten?<br />
Das ist so die Grundidee - ich meine, die Grundidee hinter den Mentoring-<br />
Programmen ist sicher natürlich Nachwuchswissenschafterinnen Zugang zu<br />
Förderbeziehungen zu verschaffen, ein bisschen ein Gegengewicht zu den<br />
informellen Beförderungsmechanismen zu schaffen, da eben Frauen in der Regel<br />
weniger Zugang zu fördernden Personen haben und hier einfach eine Parallelstruktur<br />
zu schaffen, die aber hier nicht so intransparent und hierarchisch angelegt werden<br />
soll, wie eben im informellen Mentoring, sondern eben formalisiert ist und eine<br />
bestimmte Rahmenstruktur und Transparenz auch hat.<br />
Welche Erfahrungen haben Sie mit ihrem Projekt gemacht?<br />
Welche Erfahrungen würden Sie als besonders positiv im Hinblick auf Ihr Ziel<br />
einschätzen? Welche negativ?<br />
Wir haben jede Programmperiode evaluieren lassen und dann auch versucht, die<br />
Ergebnisse und Erzählungen einzubauen in die nächsten Programme. Von Anfang<br />
an sehr positiv angekommen ist dieses Gruppensetting, das wird einhellig gewünscht<br />
und begrüßt und bringt auch diesen gewünschten Effekt, dass nicht nur diese one-toone<br />
Beziehung da ist, sondern dass einfach ein größeres Netzwerk entsteht und mit<br />
diesem peer-Netzwerk auch sehr viel Dynamik reinkommt, dass sich dadurch oft<br />
gleichwertige oder wichtigere Fördereffekte ergeben, als durch die Beziehung zu<br />
einer Mentorin oder einem Mentor, also das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Was<br />
ebenfalls sehr positiv angekommen ist, ist dass wir von Anfang an mit Mentorinnen<br />
und Mentoren arbeiten, also beide Geschlechter einbinden und hier einfach auch<br />
versuchen, die Potenziale der Professorinnen und Professoren nutzbar zu machen.<br />
Auf struktureller Ebene gesprochen, was nach wie vor ein bisschen ein Problem ist,<br />
dies aber zunehmend weniger wird – bis hin sich auflöst, ist das sich offenbar in<br />
manchen Fachbereichen, die Teilnahme am Mentoring Programm, seitens der<br />
Mentées, zum Beispiel nicht offen gelegt wurde, weil sie gefürchtet haben, dass sie<br />
sich damit irgendwie negativ zu markieren, weil eben das ganze Umfeld eine<br />
negative Haltung hat gegenüber Frauenfördermaßnahmen oder gegenüber diesem<br />
144
vermeintlichen Defizitansatz, dass man als Frau eine verstärkte Förderung braucht,<br />
gerade in den Fachbereichen, wo diese Haltung sehr stark vertreten ist, hat dies<br />
natürlich wiederum Auswirkungen auf die Mentées, dass sie sich eher quasi nicht<br />
ertappen lassen wollen. Das war beim ersten Programm noch wesentlich stärker,<br />
mittlerweile habe ich eher das Gefühl, dass sich das zunehmend auflöst, einfach<br />
auch deswegen, weil das Programm mittlerweile eine gute Reputation hat und einen<br />
hohen Bekanntheitsgrad und es da offensichtlich doch eine strukturelle Dynamik<br />
gegeben hat in der Hinsicht.<br />
Auf das Programm selber bezogen, gibt es halt schon auch den Aspekt, dass dieses<br />
Gruppensetting eine gewisse Dynamik mit sich bringt und das es halt nicht<br />
auszuschließen ist, dass die eine oder andere Gruppe, dass dann doch, z.B.<br />
Konkurrenzsituationen auftreten, oder ein gewisses Konfliktpotenzial da ist. Das<br />
bringt das Gruppenmentoring auch mit sich. Da muss man schauen, erstens einmal<br />
bei der Auswahl beim Matching sehr genau darauf zu achten, welche Konstellationen<br />
eben günstig sind oder weniger günstig, da haben wir sehr viel gelernt mit den<br />
Evaluierungen auch, ja und auch eine Unterstützung zu bieten, was wir mit<br />
Supervision machen. Wir bieten den Gruppen Supervision an, es ist auch ein Termin<br />
auf jeden Fall verpflichtend und darüber hinaus können auch wir sie in Anspruch<br />
nehmen, um auch die Gruppe selber ein bisschen zu reflektieren und<br />
Steuerungsmechanismen zu haben.<br />
Ist Ihrer Meinung nach die Implementierung von Mentoring-Projekten ein Ziel zur<br />
Strukturveränderung und wie könnte diese Implementierung ausschauen?<br />
Die Implementierung von Mentoring in die Universitätsstruktur ist absolut Ziel des<br />
Projekts. Wobei bei unserem Programm diese Implementierung weitgehend passiert<br />
ist und funktioniert. Also wir starten jetzt mit der 4. Periode, die ersten beiden sind<br />
drittmittelfinanziert und seit der 3. Periode ist die Uni Wien alleiniger Träger des<br />
Programms. Natürlich kann man da jetzt nicht weit in die Zukunft fantasieren, weil<br />
das ja auch immer von der Universitätsleitung abhängt, aber die jetzige<br />
Universitätsleitung steht dahinter, und wird das Programm nach wie vor unterstützen.<br />
145
Wo liegen Ihrer Meinung nach strukturelle Effekte und Veränderungspotenziale in der<br />
Hierarchie einer Universität durch Mentoring?<br />
Inwieweit ist Mentoring Ihrer Einschätzung nach einer Möglichkeit zur strukturellen<br />
und kulturellen Veränderung der Universität?<br />
Naja, dass ist die Gretchenfrage.<br />
Längerfristig gesehen sind wir natürlich nach wie vor und sehr davon überzeugt, dass<br />
das Programm oder der Mentoringansatz zu einer Veränderung beitragen kann. Es<br />
ist natürlich nicht so, man kann sich nicht der Illusion hingeben, dass das Programm<br />
alleine jetzt die ganzen Strukturen umkrempelt, aber ich habe schon den Eindruck,<br />
dass es doch einen recht wichtigen Beitrag leisten kann. Was offenbar auch mit so<br />
einer gewissen Veränderung korrespondiert ist – ich nenne jetzt einfach einmal ein<br />
Beispiel – was dieses Gruppensetting oder dieses fächerübergreifende<br />
Gruppensetting anbelangt, da habe ich jetzt gerade eine Reihe von Mentorinnen und<br />
Mentoren für die neue Runde angeworben, und ich habe so den Eindruck gehabt,<br />
dass das auf irrsinnige Zustimmung stößt, mittlerweile, also diese Idee hier eine<br />
fächerübergreifende Kleingruppe zusammenzusetzen und hier Förderung zu<br />
betreiben, weil offenbar eben auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften immer<br />
wichtiger wird, dass man in Teams zusammenarbeitet, dass man eben in allen<br />
möglichen Drittmittelprojekten so interdisziplinäre Teams zusammenstellt und das ist<br />
wirklich ein Modell dafür, sich hier in so einer Struktur zusammenzufinden. Und<br />
natürlich geht’s auch darum, dass hier auch eine prinzipielle Affirmation für diese<br />
Idee, dass hier Nachwuchswissenschafterinnen einen privilegierten Zugang zu den<br />
Förderbeziehungen haben sollen, dass das mittlerweile als sehr selbstverständlich<br />
aufgenommen wird, also von den MentorInnen die wir anfragen.<br />
Ein wichtiger Aspekt der Strukturveränderung ist, dass wir hier an der Uni Wien<br />
erreicht haben, dass alle MentorInnen für den Zeitraum der Tätigkeit im Programm<br />
eine Kompensation für ihren Zeitaufwand erhalten, und zwar in Form einer<br />
zusätzlichen Tutorin für den Programmablauf. Dieser Aspekt ist in doppelter Weise<br />
wichtig, einerseits, weil er genau beim größten Problem aller potenziellen<br />
MentorInnen ansetzt, nämlich beim Zeitproblem, und ihnen andererseits zeigt, dass<br />
der Universität diese Tätigkeit wichtig ist und sie auch bereit ist, dafür zu zahlen.<br />
146
Insgesamt habe ich gerade bei der diesmaligen Anwerbung der Mentorinnen für den<br />
4. Programmdurchlauf ab Herbst gemerkt, dass die Bekanntheit und Akzeptanz des<br />
Programms gegenüber vorigen Perioden deutlich gestiegen ist und damit die<br />
Bereitschaft auch fachfremde Mentées zu fördern. Hier dürfte sich tatsächlich etwas<br />
bewegen.<br />
Das Fächer übergreifende hat aber schon auch seine Grenzen. Unserer Erfahrung<br />
nach ist es so, dass es am besten ist, wenn die Mentées schon eine gemeinsame<br />
Ebene haben, Berührungspunkte in ihrer thematischen und sicher auch<br />
methodischen Herangehensweise. Wir glauben, und unsere Erfahrung zeigt auch,<br />
dass es nicht sinnvoll ist, ganz weit auseinander liegende Fächer in so einer Gruppe<br />
zusammenzustellen, weil da einfach so viele Unterschiede in der Wissenschaftskultur<br />
bestehen und auch zum Teil in den Anforderungen an eine wissenschaftliche<br />
Karriere, dass es hier schon sehr schwierig wird und auch für eine Mentorin sehr<br />
schwierig wird, hier so eine Klammer zu finden. Wichtig ist schon, dass hier eine<br />
gewisse Nähe und eine gemeinsame Sprache gemeinsame Grundlage sind, damit<br />
diese Gruppen gut funktionieren, d.h. wir stellen fächerübergreifend zusammen, aber<br />
nicht jetzt z.B. eine Technikerin mit einer Geisteswissenschafterin, wenn die beiden<br />
nicht irgendein gemeinsames Interesse haben, was ja durchaus auch sein kann.<br />
In der Literatur ist immer wieder vom „widersprüchlichen Konzept“ die Rede. Wie<br />
sehen Sie die Gefahr einer Reproduktion bestehender Verhältnisse durch<br />
Förderbeziehungen?<br />
Wir sind hier sicher der Meinung, dass man mit Transparenz tatsächlich eine Menge<br />
aufweichen kann oder zumindest Bewusstsein schaffen kann und das versuchen wir<br />
eben auch. Wichtig ist da auch, immer wieder ganz viel Öffentlichkeitsarbeit auch zu<br />
machen und das Programm sichtbar zu machen, die Teilnehmerinnen sichtbar zu<br />
machen, und versuchen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es hier nicht um<br />
einen Defizitansatz geht, sondern darum geht, die Strukturen, die einfach, ja, in einer<br />
Jahrhunderte langen Tradition in einer gewissen Weise geprägt worden sind und<br />
sehr patriarchal geprägt worden sind, dass es da einfach darum geht, schön langsam<br />
eine andere Kultur auch zu etablieren. Und da versuchen wir eben einen Beitrag zu<br />
leisten. Wir möchten ein alternatives Modell einer Förderkultur sichtbar machen, und<br />
147
in immer weitere Kreise an der Uni implementieren. Wichtig ist dabei natürlich auch,<br />
dass die Mentorinnen und Mentoren ja auch als MultiplikatorInnen fungieren und wir<br />
arbeiten auch immer mit neuen Mentorinnen und Mentoren, es sind mittlerweile<br />
schon über 40, die am Programm bisher teilgenommen haben und natürlich auch<br />
sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen in ihre Betreuungsarbeit und auch in ihre<br />
universitäre Lehre. Da ist sicherlich auch ein Moment dieser strukturellen<br />
Veränderung, dass durch die Menge dieser ausgebildeten MentorInnen sich schön<br />
langsam diese Kultur auch verbreiten kann innerhalb der Universitäten.<br />
Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach das Geschlecht in Förderbeziehungen?<br />
Wir haben beide Extreme. Extrem renommierte Frauen, wo allein schon der Name so<br />
eine Bedeutung hat, dass sowieso jeder mit denen arbeiten will, egal ob sie dann<br />
Zeit hat oder nicht und wir haben auch Männer die durchaus nicht so ein tolles<br />
Setting haben innerhalb der Universität Wien, die aber sehr engagiert sind und sehr<br />
motiviert. Wir haben überhaupt die Erfahrung gemacht, dass was die Zufriedenheit<br />
der Mentées und auch was den Output betrifft, dass es da nicht so sehr darauf<br />
ankommt, ob der Mentor oder die Mentorin ganz toll renommiert und international<br />
bekannt ist, sondern dass es vielmehr auch auf die Biographien der MentorInnen<br />
ankommt. Also sprich, wenn jemand aus seiner eigenen Biographie heraus die<br />
jetzigen Anforderungen an WissenschafterInnen gut kennt und am eigenen Leib<br />
erlebt hat, dass er/sie nicht eine komplett lineare und ungefährdete Karriere hat,<br />
dann verstehen die viel besser wie es den Mentées geht und sie können natürlich<br />
auch mehr aus ihrer eigenen Erfahrung weitergeben in dieser Hinsicht. Ich will da<br />
jetzt nicht über Generationen sprechen, aber es deckt sich manchmal bis zu einem<br />
gewissen Grad, dass MentorInnen aus einer jüngeren Generation oder<br />
Erfahrungsgeneration, mehr geben können und mehr Substanz dann da ist für diese<br />
Mentoringbeziehungen, als bei denen die eine tolle lineare Karriere hingelegt haben<br />
und eigentlich aus ihrer eigenen Erfahrung nicht wissen um was es geht derzeit. Und<br />
das ist wirklich sehr unabhängig vom Geschlecht. Aber natürlich gibt’s schon<br />
geschlechtsspezifische Aspekte, sicherlich in dem sich Frauen manchmal sich mehr<br />
gefährdet fühlen in ihrer eigenen Karriere und daher auch nicht diese Leichtigkeit und<br />
Lockerheit haben, einfach zu geben und diese Haltung einfach einzunehmen – das<br />
kann durchaus als geschlechtsspezifischer Aspekt gesehen werden. Und natürlich<br />
148
auch diese Zeitthematik, alle die wir anfragen, haben zuerst einmal Bedenken, nimmt<br />
das zuviel Zeit weg, oder belastet mich das zeitlich sehr, und es sind halt tendenziell<br />
die Frauen die dann länger überlegen, wo man merkt, die sind an sich mehr belastet,<br />
was aber auch wiederum leicht erklärbar ist, weil eben – wie wir wissen – Frauen<br />
meistens mit mehr Arbeit überhäuft werden an den Instituten und bestimmte Dinge,<br />
sei es jetzt Studienprogrammleitung oder bei anderen administrative Dinge, mehr<br />
machen als Männer und dadurch einfach mehr unter Druck sind, dass ist sicherlich<br />
eine gewisse Tendenz. Andererseits gibt es viele Frauen, die sich extrem<br />
engagieren, und die einfach sehr sehr tolle Mentorinnen sind. Ich kann das wirklich<br />
nicht werten, das ist sehr ausgeglichen.<br />
Wie sehen Sie Mentoring im Verhältnis zu anderen Frauenförderungsmaßnahmen?<br />
Stipendien müssten auf jeden Fall ausgeweitet werden. Mentoring kann auf keinen<br />
Fall Stipendien ersetzen. Die Finanzierungsmöglichkeiten sind einfach viel zu gering,<br />
gerade bei Dissertantinnen ist das ein eklatanter Mangel. Mentoring kann das nicht<br />
ersetzten, sondern mehr eine zusätzliche Förderebene sein, und es hier einfach viel<br />
zu wenig Finanzierungsmöglichkeiten gibt für Nachwuchswissenschafterinnen,<br />
gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Stipendienprogramme müssten<br />
extrem ausgeweitet werden. Bei den Stipendien muss man allerdings auch ein<br />
bisschen kritisch sein und aufpassen. Diese sogenannten Frauenstipendien, die<br />
werden oft auch von den Instituten dazu genutzt, dass man Frauen in Projekte<br />
reinholt, die dann schon ihre eigene Finanzierung mitbringen und die man dann nicht<br />
mehr in die Budgetierung hinein nehmen muss, diese Frauenstipendien sind sicher<br />
auch zweischneidig.<br />
Es haben sicher alle Frauenfördermaßnahmen nach wie vor große Bedeutung, sind<br />
nach wie vor wichtig, solange sie nicht so einen Defizitansatz fortsetzen. Also ich<br />
denke mir, das kommt dann von Programm zu Programm darauf an. Wenn es nicht<br />
gelingt aus diesem Defizitansatz herauszukommen, dann finde ich, muss man das<br />
sehr überdenken.<br />
149
Ist Mentoring Ihrer Meinung nach ein feministisches Projekt?<br />
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ja, Ja sicherlich. Also in der Hinsicht, dass wir eben<br />
davon ausgehen, dass es ein strukturelles Problem gibt in der wissenschaftlichen<br />
oder universitären Landschaft und das es hier einfach gilt, schrittweise zu versuchen,<br />
diese Strukturen zu verändern. Wobei es hier nicht nur um Strukturen, sondern auch<br />
sehr viel um Kultur geht, um Wissenschaftskultur an sich, da ist irrsinnig viel an<br />
Geschlechter bias drinnen, zwar auch unterschiedlich in den einzelnen<br />
Fachbereichen, aber prinzipiell ist er überall da. Und da gilt es eben auf<br />
unterschiedlichsten Ebenen, das langsam zu verändern und aufzubrechen. Ziel und<br />
die Vision wäre, dass diese Mentoring-Programme dann für alle<br />
NachwuchswissenschafterInnen offen sein sollte, nämlich mit großem I, ab dem<br />
Zeitpunkt, wo das alles (Lachen) geschlechtergerecht geändert wurde und sich<br />
entwickelt hat, weil es ja prinzipiell kein Frauenproblem ist, sondern überhaupt des<br />
wissenschaftlichen Nachwuchses. Aber so wie es ausschaut wird das sicherlich noch<br />
recht lange dauern.<br />
150
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1 Gender-Schere – Anteil nach Geschlecht Universitäten 2006 26<br />
Abb. 2 Studienabschlüsse Universitäten nach Studienjahr / 51<br />
Universitäten gesamt<br />
Abb. 3 Gender Schere – horizontale Segregation 52<br />
Abb. 4 leaky pipeline an der Universität Salzburg – Frauen und Männer in 54<br />
unterschiedlichen Qualifikationsstufen in Prozent<br />
Abb. 5 Gender Monitoring Ordentliche Studierende nach Geschlecht 55<br />
WS 2007 Universität Salzburg<br />
Abb. 6 Gender Monitoring Studienabschlüsse gesamt 56<br />
Universität Salzburg<br />
Abb. 7 Studienabschlüsse Universitäten 56<br />
Studienabschlüsse nach Studienart<br />
Abb. 8 Gender Monitoring Studienabschlüsse 57<br />
Geisteswissenschaft und Künste Universität Salzburg<br />
Abb. 9 Gender Monitoring Studienabschlüsse Sozialwissenschaften 58<br />
Wirtschaft und Recht Universität Salzburg<br />
Abb. 10 Gender Monitoring Studienabschlüsse in Naturwissenschaften und 59<br />
Technik (Naturwissenschaften & Ingenieurwesen) Universität Salzburg<br />
Abb. 11 Gender Monitoring Studienabschlüsse Universität Salzburg 60<br />
Doktoratsstudien in Naturwissenschaften und Technik<br />
Abb. 12 Wissenschaftliches Personal, allgemeines Personal 61<br />
WS 2005/WS 2006 Universität Salzburg<br />
Abb 13 Allgemeines Universitätspersonal / Universität Salzburg 2006 62<br />
151
Code of Honour<br />
Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne<br />
fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die<br />
benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich<br />
gemacht habe.<br />
Salzburg, am 21. September 2008<br />
Marietta Bauernberger<br />
152