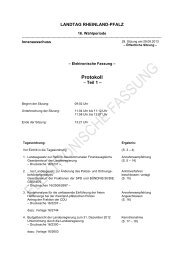14/2447 - Landtag Rheinland-Pfalz
14/2447 - Landtag Rheinland-Pfalz
14/2447 - Landtag Rheinland-Pfalz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Drucksache <strong>14</strong>/<strong>2447</strong><br />
<strong>Landtag</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> – <strong>14</strong>. Wahlperiode<br />
Der Betroffene wird nicht in seinen Rechten beschränkt. Das Betreuungsrecht gewährleistet vielmehr das Selbstbestimmungsrecht<br />
dadurch, dass die Bestellung einer Betreuerin oder eines Betreuers keine Auswirkungen auf die rechtliche Handlungsfähigkeit der<br />
oder des Betreuten hat. Es bleibt für die Betroffenen – ebenso wie für nicht betreute Personen – bei dem Grundsatz, dass die Geschäftsfähigkeit<br />
sich nach den allgemeinen Regeln über die „natürliche Geschäftsfähigkeit“ (§ 104 Nr. 2 BGB) bestimmt, also allein<br />
vom tatsächlichen Geisteszustand abhängig ist. Nur dort, wo es im Einzelfall notwendig ist, ordnet das Gericht einen Einwilligungsvorbehalt<br />
an; dann benötigt die oder der Betroffene in dem entsprechenden Bereich die Einwilligung seiner Betreuerin oder<br />
seines Betreuers (§ 1903 BGB).<br />
Die Betreuung ist nicht umfassend. Die Bestellung der Betreuerin oder des Betreuers erfolgt nur für Aufgabenkreise, in denen der<br />
Betroffene selbst nicht handeln kann. Der Erforderlichkeitsgrundsatz ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt (§ 1896 Abs. 2 Satz 1<br />
BGB). Die umfassende Übertragung aller Aufgabenkreise soll nach Möglichkeit nicht erfolgen. Dem zu Betreuenden sollen die<br />
Freiräume bleiben, die er selbst noch ausfüllen kann.<br />
Aus dem Erforderlichkeitsgrundsatz folgt zudem die Subsidiarität der Betreuung gegenüber anderen Hilfen. Insbesondere kann eine<br />
zuvor erteilte Vollmacht die Anordnung einer Betreuung entbehrlich machen (§ 1896 Abs. 2 Satz 2 BGB). Die Vollmacht als Ausdruck<br />
der Selbstbestimmung erhält Vorrang vor der staatlichen Fürsorge eines Betreuungsverfahrens.<br />
Entsprechend dem Anliegen, die Betroffenen in ihrer Eigenschaft als kranke oder behinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger ernst<br />
zu nehmen, wurde festgelegt, dass Wünsche der Betreuten verbindlich sind, soweit dies verantwortet werden kann (§ 1901 Abs. 2<br />
Satz 1 BGB i. d. F. d. BtG). Dies gilt auch für Wünsche, die die oder der Betreute zu einem früheren Zeitpunkt geäußert hat (§ 1901<br />
Abs. 3 Satz 2 BGB i. d. F. d. BtG). Die so genannte Betreuungsverfügung ist ebenso wie die oben erwähnte Vorsorgevollmacht Ausdruck<br />
der Beachtung des Selbstbestimmungsrechts der betroffenen Menschen. Mit dieser Willensäußerung „in gesunden Tagen“<br />
kann jeder für den Fall einer späteren Betreuungsbedürftigkeit seine Vorstellungen und Wünsche zur Wahrnehmung der Aufgaben<br />
durch die Betreuerin oder den Betreuer äußern. Auch Wünsche für die Betreuerauswahl können auf diese Weise im Voraus verbindlich<br />
festgelegt werden (§ 1897 Abs. 4 Satz 3 BGB).<br />
Allgemeine Richtschnur für das Handeln der Betreuerin oder des Betreuers ist die Orientierung am Wohl des Betreuten (§ 1901<br />
Abs. 1 Satz 1 BGB i. d. F. d BtG, heute § 1901 Abs. 2 Satz 1 BGB). Eine nähere Konkretisierung erschien nicht möglich. Klargestellt<br />
wurde allerdings, dass zum Wohl der Betreuten auch die Möglichkeit gehört, im Rahmen der verbliebenen Fähigkeiten das<br />
Leben nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten (§ 1901 Abs. 1 Satz 2 BGB i. d. F. d. BtG, heute § 1901 Abs. 2 Satz 2<br />
BGB).<br />
Ein großes Anliegen des Reformgesetzes war, dass der Betreute künftig stärker als früher persönlich betreut wird. Betreuerinnen<br />
und Betreuer sollen den persönlichen Kontakt mit den Betreuten suchen und durch persönliche Gespräche ihre Wünsche herausfinden.<br />
Der früher häufig anzutreffenden anonymen Verwaltung von Fällen vom Schreibtisch aus wurde eine klare Absage erteilt.<br />
Zur Betreuerin oder zum Betreuer wird deshalb in erster Linie eine natürliche Person bestellt, die zu einem solchen persönlichen<br />
Kontakt in der Lage ist (§ 1897 Abs. 1 BGB).<br />
Erstmals wurden für besonders wichtige Angelegenheiten der Personensorge eigene Regelungen geschaffen. Die Einwilligung einer<br />
Betreuerin oder eines Betreuers in schwerwiegende ärztliche Eingriffe erfordert nunmehr die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts<br />
(§ 1904 BGB). Die für eine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt schon früher festgelegte Erfordernis einer gerichtlichen<br />
Genehmigung wurde auf so genannte unterbringungsähnliche Maßnahmen ausgedehnt (§ 1906 Abs. 4 BGB). Darunter<br />
sind Maßnahmen wie etwa Fixierung am Stuhl, Bettgitter, sedierende Medikamente und Ähnliches zu verstehen, die die betroffenen<br />
Menschen nicht selten noch einschneidender in ihrer Freiheit beschränken, als es eine Unterbringung selbst mit sich bringt. Alle<br />
Maßnahmen mit dem Ziel einer Wohnraumaufgabe sind nunmehr ebenfalls vom Vormundschaftsgericht zu genehmigen (§ 1907<br />
BGB). Damit trug das Gesetz dem Gedanken Rechnung, dass die Wohnung als räumlicher Mittelpunkt des Lebens von überragender<br />
Bedeutung ist.<br />
Die Voraussetzungen für eine Einwilligung des Betreuers zu einer Sterilisation wurden detailliert geregelt (§§ 1631 c, 1899 Abs. 2,<br />
1905 BGB, §§ 67 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 69 d Abs. 3 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FGG).<br />
Die Betreuung soll keine Dauereinrichtung sein. Sie bleibt vielmehr nur so weit und so lange aufrechterhalten, wie dies erforderlich<br />
ist (§ 1908 d Abs. 1 Satz 1 BGB). Betreuerbestellungen enden nach einer Höchstdauer von fünf Jahren, wenn sie nicht verlängert<br />
werden (§ 69 Abs. 1 Nr. 5 FGG).<br />
Die verfahrensrechtlichen Regelungen stellen sicher, dass die Grundgedanken des materiellen Rechts umgesetzt werden. Entsprechend<br />
wurde die verfahrensrechtliche Position der Betreuten deutlich gestärkt. Die Bestellung einer Betreuerin oder eines Betreuers<br />
setzt die persönliche Anhörung des Betroffenen (§ 68 FGG) und eine genaue Sachaufklärung voraus. Hier ist insbesondere<br />
die Einholung eines Sachverständigengutachtens zu nennen (§ 68 b FGG). Soweit es erforderlich ist, wird dem Betroffenen eine<br />
Verfahrenspflegerin oder ein Verfahrenspfleger zur Seite gestellt, die die Wahrung seiner Belange gewährleisten und ihn in Verfahren<br />
unterstützen sollen (§ 67 FGG).<br />
Im Zusammenhang mit der Reform des Betreuungsrechts erfolgte die vom Bundesverfassungsgericht schon im Jahre 1980 geforderte<br />
gesetzliche Regelung der Vergütung von Berufsvormündern. Die Bestimmungen über die Vormundschaft sind auch für die<br />
Betreuung anwendbar (§ 1908 i Abs. 1 Satz 1 BGB). In Anlehnung an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde fest-<br />
4