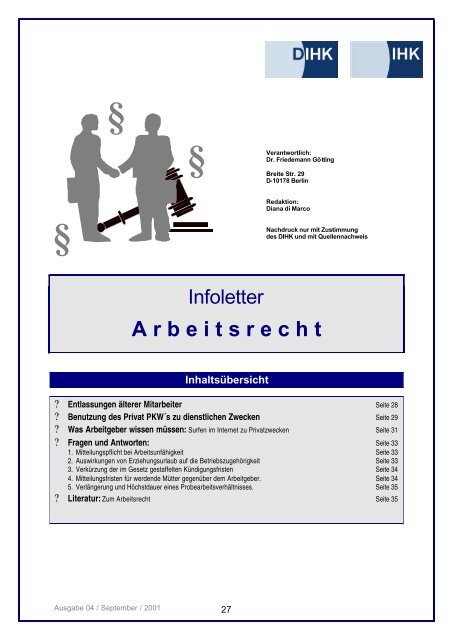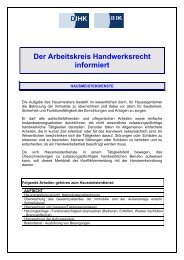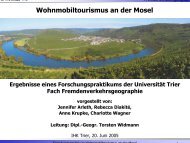Ausgabe 04 / September / 2001 - IHK Trier
Ausgabe 04 / September / 2001 - IHK Trier
Ausgabe 04 / September / 2001 - IHK Trier
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
§<br />
§<br />
Verantwortlich:<br />
Dr. Friedemann Götting<br />
Breite Str. 29<br />
D-10178 Berlin<br />
Redaktion:<br />
Diana di Marco<br />
§<br />
Nachdruck nur mit Zustimmung<br />
des D<strong>IHK</strong> und mit Quellennachweis<br />
Infoletter<br />
A r b e i t s r e c h t<br />
Inhaltsübersicht<br />
? Entlassungen älterer Mitarbeiter Seite 28<br />
? Benutzung des Privat PKW´s zu dienstlichen Zwecken Seite 29<br />
? Was Arbeitgeber wissen müssen: Surfen im Internet zu Privatzwecken Seite 31<br />
? Fragen und Antworten: Seite 33<br />
1. Mitteilungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit Seite 33<br />
2. Auswirkungen von Erziehungsurlaub auf die Betriebszugehörigkeit Seite 33<br />
3. Verkürzung der im Gesetz gestaffelten Kündigungsfristen Seite 34<br />
4. Mitteilungsfristen für werdende Mütter gegenüber dem Arbeitgeber. Seite 34<br />
5. Verlängerung und Höchstdauer eines Probearbeitsverhältnisses. Seite 35<br />
? Literatur: Zum Arbeitsrecht Seite 35<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong> / <strong>September</strong> / <strong>2001</strong> 27
Entlassungen:<br />
Entlassung älterer Arbeitnehmer.<br />
Wenn Sie sich von einem Mitarbeiter trennen<br />
wollen, der älter als 56 Jahre ist und der im<br />
Zeitraum von 4 Jahren vor Eintritt der<br />
Arbeitslosigkeit mindestens 24 Monate in Ihrem<br />
Unternehmen beschäftigt war, kann folgende<br />
Pro-blematik auftreten:<br />
Erste Fallkonstellation<br />
Sie wollen sich als Unternehmer von einem<br />
Mitarbeiter trennen, der bereits das 56.<br />
Lebensjahr vollendet hat. Zu diesem Zweck<br />
schließen sie mit dem Mitarbeiter einen<br />
Aufhebungsvertrag, der das<br />
Arbeitsverhältnis zu einem festgelegten<br />
Zeitpunkt einvernehmlich beendet.<br />
Anschließend meldet sich der ehemalige<br />
Arbeitnehmer arbeitslos und er erhält von<br />
der Bundesanstalt für Arbeit (ausführende<br />
Behörde ist das zuständige Arbeitsamt)<br />
Arbeitslosengeld.<br />
Lösung:<br />
Aufhebungsverträge führen grundsätzlich zu<br />
einer Erstattungspflicht des Arbeitgebers, da<br />
es sich dabei um einen Vertrag zu Lasten<br />
der Solidargemeinschaft handelt. Der<br />
Arbeitgeber schließt nämlich den<br />
Aufhebungsvertrag mit einem Arbeitnehmer<br />
zu Lasten des Arbeitsamts und somit der<br />
Allgemeinheit, was nach der<br />
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts<br />
nicht hingenommen werden kann. Dies gilt<br />
auch für den Fall, dass der<br />
Aufhebungsvertrag auf Wunsch des<br />
Arbeitnehmers abgeschlossen wird.<br />
Zweite Fallkonstellation<br />
Das Gleiche wie oben, nur jetzt erfolgt eine<br />
arbeitgeberseitige, betriebsbedingte, sozial<br />
gerechtfertigte Kündigung.<br />
Lösung:<br />
Nur wenn die Kündigung den o. g<br />
Voraussetzungen genau entspricht, d. h.,<br />
„betriebsbedingt“ und „sozial gerechtfertigt“<br />
ist, entfällt eine Erstattungspflicht des<br />
Arbeitgebers, da der Arbeitnehmer dann<br />
ohne weiteres zum Arbeitsamt gehen kann<br />
und Leistungen erhält. Es droht dem<br />
Arbeitnehmer auch keine Sperrfrist. Bei<br />
komplizierteren Fällen bitte einen<br />
Fachanwalt aufsuchen.<br />
Dritte Fallkonstellation<br />
Das Gleiche wie oben, nur jetzt erfolgt eine<br />
arbeitnehmerseitige Kündigung (ohne<br />
Abfindung oder ähnliche Leistung des<br />
Arbeitgebers).<br />
Lösung:<br />
Nur wenn Sie als Arbeitgeber keine<br />
Abfindung oder ähnliche Leistung zahlen,<br />
entfällt eine Erstattungspflicht bei<br />
arbeitnehmerseitiger<br />
Kündigung.<br />
Einzelheiten sind auch hier schwierig und<br />
bedürfen anwaltlicher Beratung.<br />
§ 147 a Abs. 1 Satz 1 SGB III enthält die<br />
Grundvoraussetzungen für den Eintritt einer<br />
Erstattungspflicht. Die Vorschrift besagt, dass<br />
eine Erstattungspflicht nur den Arbeitgeber trifft,<br />
bei dem der Arbeitslose in den letzten 4 Jahren<br />
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 24<br />
Monate beschäftigt war. D. h., § 147 a SGB III<br />
stellt nicht darauf ab, bei welchem Arbeitgeber<br />
der Arbeitslose zuletzt beschäftigt war, sondern<br />
vielmehr bei welchem Arbeitgeber der<br />
Arbeitslose vor Eintritt der Arbeitslosigkeit<br />
mindestens 24 Monate innerhalb einer<br />
Rahmenfrist von 4 Jahren in einem<br />
Beschäftigungsverhältnis gestanden hat.<br />
Beispiel:<br />
Ein Mitarbeiter war 12 Jahre in einem Betrieb<br />
„X“ tätig. Der Mitarbeiter wechselte zum<br />
Arbeitgeber „Y“ und wird kurze Zeit später<br />
arbeitslos. In einem solchen Fall kann eine<br />
Erstattungspflicht den Arbeitgeber „X“ treffen,<br />
obwohl kurz vor dem Zeitpunkt der<br />
Arbeitslosigkeit ein Beschäftigungsverhältnis<br />
mit einem anderen Arbeitgeber nämlich „Y“<br />
bestand. Da sich die Erstattungspflicht über<br />
einen Zeitraum von maximal 24 Monaten<br />
erstreckt, wobei das Arbeitsamt vierteljährlich<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong> / <strong>September</strong> / <strong>2001</strong> 28
abrechnet, kann eine Erstattung seitens des<br />
Arbeitgebers „X“ nur vermieden werden, wenn<br />
zwischen der Beendigung des<br />
Arbeitsverhältnisses bei „X“ und dem Eintritt der<br />
Arbeitslosigkeit mindestens 24 Monate liegen.<br />
Es gibt im Gesetz - wie üblich - natürlich eine<br />
Reihe von Befreiungstatbeständen, mit der<br />
Folge, dass der Arbeitgeber keine Erstattung zu<br />
leisten hat. Die Konstruktion dieser<br />
Befreiungsmöglichkeiten ist jedoch für einen<br />
juristischen Laien nur schwer nachvollziehbar<br />
und kann daher schnell zu Fehleinschätzungen<br />
führen. Daher solten alle Unternehmen, die<br />
sich von einem älteren Mitarbeiter trennen<br />
wollen, vor Aussprache einer Kündigung oder<br />
Abschluss eines Aufhebungsvertrages<br />
unbedingt den Rat eines Fachanwaltes für<br />
Arbeitsrecht einholen. Anderenfalls können<br />
ohne weiteres Beträge im fünf- bzw.<br />
sechsstelligen Bereich auf das Unternehmen<br />
zukommen.<br />
Beispiel:<br />
Der Arbeitslose erhält wöchentlich vom<br />
Arbeitsamt Leistungen in Höhe von 900, -- DM.<br />
Dies macht im Monat durchschnittlich<br />
3.600, -- DM. Über einen Zeitraum von 24<br />
Monaten gerechnet, stellt dies einen Betrag von<br />
86.400, -- DM dar. Dieses Beispiel verdeutlicht,<br />
welche Forderungen auf ein Unternehmen<br />
zukommen können.<br />
Wichtig:<br />
Es kommt nicht auf den Zeitpunkt an, in dem<br />
eine künftige Beendigung des<br />
Arbeitsverhältnisses beschlossen wird;<br />
entscheidend ist vie lmehr der Zeitpunkt der<br />
tatsächlichen Beendigung. Eine<br />
Erstattungsverpflichtung kann damit<br />
grundsätzlich auch dann eintreten, wenn mit<br />
einem 55-jährigen Arbeitnehmer vereinbart<br />
wird, dass das Arbeitsverhältnis am Tag der<br />
Vollendung des 56. Lebensjahres enden soll.<br />
Das Arbeitsverhältnis müsste vielmehr<br />
spätestens 1 Tag vor Vollendung des 56.<br />
Lebensjahres enden, damit eine<br />
Erstattungsverpflichtung ausscheiden kann.<br />
Zwei Befreiungstatbestände wollen wir dennoch<br />
erwähnen, die das Ge setz klar geregelt hat, so<br />
dass hier die o. g. Schwierigkeiten nicht<br />
auftreten.<br />
Da ist zum einen die<br />
„Kleinunternehmerklausel“. Hat ein Betrieb in<br />
der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer,<br />
(Auszubildende und Schwerbehinderte zählen<br />
zugunsten des Arbeitgebers nicht mit;<br />
Teilzeitbeschäftigte werden nach der Dauer<br />
ihrer Beschäftigung berechnet, z. B.<br />
Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen<br />
Arbeitszeit zwischen 10 und 20 Stunden<br />
werden mit 0,5 angesetzt. Teilzeitbeschäftigte<br />
mit einer regelmäßigen Arbeitszeit zwischen 20<br />
und 30 Stunden werden mit 0,75 angesetzt)<br />
entfällt die Erstattungspflicht.<br />
Eine Erstattungspflicht entfällt zudem, wenn die<br />
Erstattung für den Arbeitgeber eine<br />
unzumutbare wirtschaftliche Belastung<br />
bedeuten würde. Hierzu ist allerdings der<br />
Nachweis einer fachkundigen Stelle (z. B.<br />
Industrie- und Handelskammern oder<br />
Handwerkskammern) erforderlich.<br />
Fazit:<br />
Jedes Unternehmen sollte sich im Falle einer<br />
beabsichtigten Trennung von einem älteren<br />
Mitarbeiter unbedingt den fachkundigen Rat<br />
eines Rechtsanwaltes einholen!<br />
Andreas Weigelt<br />
<strong>IHK</strong> Frankfurt / Main<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong>/<strong>2001</strong> 29
Benutzung des Privat Pkw´s zu<br />
dienstlichen Zwecken<br />
1) Dienstreisen werden von Arbeitnehmern<br />
häufig nicht in einem vom Arbeitg eber zur<br />
Verfügung gestellten Firmenfahrzeug<br />
unternommen, vielmehr benutzen sie in der<br />
Regel ihren Privat-Pkw. Daher stellt sich in<br />
der alltäglichen Praxis die Frage, ob und<br />
inwieweit der Arbeitgeber für unfallbedingte<br />
Schäden haftet, die einem Arbeitnehmer<br />
anlässlich einer Dienstreise mit seinem<br />
Privat-Pkw entstehen. Nach der<br />
Rechtsprechung hat der Arbeitnehmer<br />
gegen den Arbeitgeber in entsprechender<br />
Anwendung des § 670 BGB einen Anspruch<br />
auf Ersatz des Sachschadens, der im<br />
aufgrund einer Dienstfahrt mit seinem<br />
Privat-Pkw entstanden ist. Für den sog.<br />
Rückstufungsschaden (Kfz-Versicherung)<br />
hat der Arbeitgeber dann, wenn er die nach<br />
dem Steuerrecht anerkannte<br />
Kilometerpauschale (derzeit 0,58 DM) zahlt,<br />
grundsätzlich nicht einzutreten. Etwas<br />
anderes gilt natürlich dann, wenn die<br />
Erstattung eines etwaigen<br />
Rückstufungsschadens mit dem<br />
Arbeitnehmer vereinbart ist.<br />
2) Beschädigung von Kraftfahrzeugen der<br />
Arbeitnehmer<br />
In der nachfolgenden Übersicht haben wir<br />
Haftungsvoraussetzungen und Rechtsfolgen für<br />
einige Fallkonstellationen zusammengestellt:<br />
Kein Ersatzanspruch gegen den Arbeitgeber Ersatzanspruch gegen den Arbeitgeber<br />
Kfz-Benutzung gehört zum allgemeinen<br />
Lebensrisiko. Dazu zählt im einzelnen:<br />
a) Benutzung des PKW auf der Fahrt zwischen<br />
Wohnung und Arbeitsstelle.<br />
b) Das Abstellen des PKW auf dem<br />
Firmenparkplatz.<br />
c) Benutzung des PKW auf Dienstreisen oder<br />
Fahrten zu auswärtigen Arbeits- oder<br />
Lehrgangsorten, soweit der PKW jeweils nur<br />
zur persönlichen Erleichterung oder mit der<br />
Absicht der Zeitersparnis eingesetzt wird.<br />
Betriebliche Risikosphäre und damit Haftung<br />
des Arbeitgebers ist begründet, wenn:<br />
a) Benutzung des PKW erfolgt auf Weisung<br />
des Arbeitgebers oder ist aufgrund<br />
betrieblicher Veranlassung zwingend<br />
erforderlich.<br />
b) Zwingend erforderlich ist der Einsatz des<br />
Privat Pkw´s wenn:<br />
aa) Der Arbeitgeber, ohne Einsatz des<br />
Privat Pkw´s, dem Arbeitnehmer ein<br />
Betriebsfahrzeug zur Verfügung stellen<br />
und das damit verbundene Unfallrisiko<br />
tragen müsste.<br />
bb) Der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung<br />
anderweitig nicht erbringen könnte (z.B.<br />
Vertriebsbeauftragter im Außendienst).<br />
cc) Der Privat PKW für Transportleistungen<br />
eingesetzt wird, die mit öffentlichen<br />
Verkehrsmitteln nicht möglich sind.<br />
Wenn ein Haftungsanspruch des<br />
Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber besteht,<br />
bleibt die Frage zu klären, inwieweit den<br />
Arbeitnehmer ein Mitverschulden am<br />
Verkehrsunfall trifft mit der Folge, dass der<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong> / <strong>September</strong> / <strong>2001</strong> 30
Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers<br />
gemindert wird oder gar entfällt.<br />
Andreas Weigelt<br />
<strong>IHK</strong> Frankfurt / Main<br />
3) Mitverschulden des Arbeitnehmers<br />
Derzeit gilt ein dreistufiges Haftungsmodell:<br />
a) Keine Haftung des Arbeitnehmers bei<br />
„leichtester Fahrlässigkeit“.<br />
Definition: Leichteste Fahrlässigkeit liegt<br />
vor, wenn es sich um geringfügige und<br />
leicht entschuldbare Pflichtwidrigkeiten<br />
handelt, die jedem Arbeitnehmer<br />
unterlaufen können.<br />
b) Anteilige Haftung des Arbeitnehmers<br />
bei „mittlerer Fahrlässigkeit“.<br />
Definition: Bei der mittleren<br />
Fahrlässigkeit ist der Haftungsanteil des<br />
Arbeitnehmers unter Berücksichtigung<br />
aller Umstände zu bestimmen,<br />
insbesondere auch nach der<br />
Versicherbarkeit durch den Arbeitgeber,<br />
nach der Höhe des Verdienstes, dem<br />
Vorverhalten des Arbeitnehmers und<br />
seinen sozialen Verhältnissen, so dass<br />
anteilige Haftung keineswegs<br />
automatisch hälftige Haftung bedeutet,<br />
sondern meistens erheblich weniger.<br />
c) Grundsätzlich volle Haftung des<br />
Arbeitnehmers im Falle „grober<br />
Fahrlässigkeit und Vorsatz“.<br />
Definition grobe Fahrlässigkeit: Grob<br />
fahrlässiges Handeln des Arbeitnehmers<br />
ist anzunehmen, wenn eine besonders<br />
schwerwiegende und auch subjektiv<br />
unentschuldbare Pflichtverletzung<br />
vorliegt, wenn nämlich der Arbeitnehmer<br />
diejenige Sorgfalt außer Acht gelassen<br />
hat, die jedem eingeleuchtet hätte.<br />
Definition Vorsatz: Vorsatz setzt das<br />
Wissen und Wollen des Schadens<br />
voraus. Nicht ausreichend ist der<br />
vorsätzliche Verstoß gegen Weisungen,<br />
solange nicht zusätzlich Vorsatz<br />
hinsichtlich des Schädigungserfolges<br />
gegeben ist.<br />
Was Arbeitgeber wissen<br />
müssen<br />
Surfen im Internet zu Privatzwecken.<br />
Das Arbeitsgericht Wesel (Urteil vom<br />
21.03.<strong>2001</strong>, Az.: 4021/00, NJW <strong>2001</strong>, 2490-<br />
2492) hat eine außerordentliche Kündigung<br />
wegen des Surfens im Internet zu privaten<br />
Zwecken für unwirksam erklärt.<br />
In dem Verfahren wurde der Arbeitnehmerin<br />
vorgeworfen, in dem ersten Jahr nach<br />
Einrichtung eines Internetanschlusses an ihrem<br />
Arbeitsplatz circa 80 bis 100 Stunden privat im<br />
Internet „gesurft“ zu haben. Ein ausdrückliches<br />
Verbot, privat im Internet zu surfen, war vom<br />
Arbeitgeber nicht erklärt worden. Nach einer<br />
fristgerechten Kündigung, die nicht Gegenstand<br />
dieses Verfahrens war, hat der Arbeitgeber die<br />
Angestellte ohne Abmahnung fristlos gekündigt.<br />
Hiergegen wehrte sich die Angestellte mit<br />
Erfolg.<br />
Eine fristlose Kündigung kann nach § 626<br />
Absatz 1 BGB nur ausgesprochen werden,<br />
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ob das<br />
private Surfen eine arbeitsrechtliche<br />
Pflichtverletzung darstellt, die eine Kündigung<br />
rechtfertigt, war bisher von der Rechtsprechung<br />
noch nicht geklärt. Das Gericht hat deshalb die<br />
ständige Rechtsprechung zu dem<br />
vergleichbaren Fall der privaten Telefonate am<br />
Arbeitsplatz zur Entscheidung des Falles<br />
herangezogen. Danach stellt das private Surfen<br />
im Internet am Arbeitsplatz keinen wichtigen<br />
Grund dar, der eine außerordentliche<br />
Kündigung rechtfertigt.<br />
Nach der Entscheidung des Gerichts, die<br />
Rechtsprechung zur Führung von privaten<br />
Telefonaten am Arbeitsplatz heranzuziehen,<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong> / <strong>September</strong> / <strong>2001</strong> 31
gilt nunmehr auch für die private Nutzung<br />
des Internets am Arbeitsplatz folgendes:<br />
1) Die Kündigung ist wegen einer<br />
arbeitsvertraglichen Pflichtverletzung<br />
gerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber das<br />
Surfen im Internet zu privaten Zwecken<br />
ausdrückliches verboten hat und der<br />
Arbeitnehmer seinen Internetanschluss am<br />
Arbeitsplatz trotz einer entsprechenden<br />
Abmahnung weiterhin nutzt.<br />
2) Fehlt dieses ausdrückliche Verbot des<br />
Arbeitgebers, oder ist die private Nutzung<br />
erlaubt bzw. längere Zeit widerspruchslos<br />
geduldet worden, kommt eine Kündigung<br />
nur in Ausnahmefällen in Betracht, nämlich<br />
wenn die private Nutzung Ausmaße<br />
annimmt, von denen der Arbeitnehmer nicht<br />
mehr annehmen konnte, das sie noch vom<br />
Einverständnis des Arbeitgebers gedeckt<br />
sein würde.<br />
3) Nach der neueren Rechtsprechung des<br />
Bundesarbeitsgerichts, der das<br />
Arbeitsgericht Wesel folgt, ist bei Störungen<br />
im Vertrauensbereich aber immer eine<br />
Abmahnung erforderlich, wenn es sich um<br />
ein steuerbares Verhalten des<br />
Arbeitnehmers handelt, dieser also sein<br />
Verhalten ändern und das Vertrauen<br />
wiederhergestellt werden kann.<br />
Die Abmahnung ist also nur entbehrlich,<br />
wenn die Pflichtverletzung so<br />
schwerwiegend ist, dass dieses für den<br />
Arbeitnehmer offensichtlich erkennbar und<br />
die Hinnahme des Arbeitgebers ganz<br />
offensichtlich ausgeschlossen ist.<br />
Das Arbeitsgericht Wesel hält die<br />
Pflichtverletzung im oben geschilderten Fall<br />
nicht für so schwerwiegend, dass die<br />
Abmahnung entbehrlich wurde. Davon<br />
abgesehen, dass der Arbeitgeber seiner<br />
Angestellten die Dauer der privaten<br />
Internetnutzung von 80 bis 100 Stunden nicht<br />
nachweisen konnte, sei die Schwere der<br />
arbeitsvertraglichen Pflichtverletzung bei 80 bis<br />
100 Stunden pro Jahr für die Arbeitnehmerin<br />
nicht ohne weiteres erkennbar gewesen.<br />
Ein Arbeitgeber müsse in der ersten Zeit nach<br />
der Neueinrichtung eines Internetanschlusses<br />
damit rechnen, dass in der Anlernphase eine<br />
intensivere Nutzung des Internets erfolge. Falle<br />
die Nutzungszeit überwiegend in die<br />
Anlernphase, spreche vieles dafür, dass keine<br />
Privatnutzung vorlag. In diesem Fall könnten<br />
Bereiche des Internets aus privaten<br />
Themengebieten durchaus zu „Lernzwecken“<br />
angeklickt worden sein.<br />
Die Arbeitnehmerin konnte zudem davon<br />
ausgehen, dass eine private Nutzung des<br />
Internets in gewissem Umfang erlaubt war. Ein<br />
ausdrückliches Verbot bestand nicht, die<br />
Telefonrechnungen wurden vom<br />
Geschäftsführer abgezeichnet und die<br />
Arbeitnehmerin musste keine Rechenschaft<br />
über die Nutzung des Internets abgeben.<br />
Folgen des Urteils für Unternehmen<br />
1) Sofern die private Nutzung des Internets im<br />
Betrieb verboten ist, muss dieses Verbot<br />
den Arbeitnehmern nachweisbar mitgeteilt<br />
werden, da ansonsten von einer<br />
stillschweigenden Duldung ausgegangen<br />
werden kann, wenn die private Nutzung im<br />
Betrieb verbreitet ist. Bei einem Verstoß der<br />
Arbeitnehmer ist eine Abmahnung<br />
auszusprechen. Erst nach weiteren<br />
nachhaltigen Verstößen liegt ein<br />
Kündigungsgrund vor.<br />
2) Liegt kein Verbot der privaten Nutzung des<br />
Internets vor, ist eine private Nutzung des<br />
Internets am Arbeitsplatz kein wichtiger<br />
Grund für eine außerordentliche Kündigung.<br />
Der Arbeitnehmer muss erst durch eine<br />
Abmahnung darauf hingewiesen werden<br />
und danach weiter nachhaltig gegen<br />
entsprechende Anweisungen verstoßen,<br />
bevor eine wirksame Kündigung<br />
ausgesprochen werden kann.<br />
3) Die Abmahnung ist nur entbehrlich, wenn<br />
dem Arbeitnehmer bewusst sein muss, dass<br />
der Arbeitgeber seine Handlungen<br />
offensichtlich nicht tolerieren wird. Das<br />
dürfte erst bei einer besonders intensiven<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong> / <strong>September</strong> / <strong>2001</strong> 32
privaten Nutzung des Internets der Fall sein,<br />
wenn kein Verbot ausgesprochen wurde.<br />
4) Wenn der Arbeitnehmer erstmals einen<br />
Internetanschluss erhält und sich die<br />
Anwenderkenntnisse noch aneignen muss,<br />
ist eine häufigere private Nutzung des<br />
Internets zu Übungszwecken zu<br />
akzeptieren.<br />
5) Der Arbeitnehmer darf von einer zumindest<br />
in gewissem Umfang erlaubten<br />
Privatnutzung des Internets ausgehen,<br />
wenn der Internetanschluss bekannt ist, kein<br />
Verbot für die private Nutzung erfolgt ist, die<br />
Telefonrechnung ohne Kommentar<br />
abgezeichnet wurde und kein<br />
Nutzungsnachweis verlangt wurde.<br />
Petra Sandfoss<br />
Dr. Friedemann Götting<br />
D<strong>IHK</strong><br />
ununterbrochener Dauer des<br />
Arbeitsverhältnisses. Trotzdem legt § 5 des<br />
Entgeltfortzahlungsgesetz fest, dass die<br />
Mitteilungs- und Bescheinigungspflicht allen<br />
Arbeitnehmern obliegen, auf deren<br />
Arbeitsverhältnis das Gesetz anzuwenden<br />
ist und bei denen eine zu einer<br />
Arbeitsunfähigkeit führenden Krankheit<br />
vorliegt. Es kommt nicht darauf an, ob der<br />
Kranke einen Entgeltfortzahlungsanspruch<br />
hat. Die Mitteilungspflicht dient der<br />
Dispositionsfähigkeit des Arbeitgebers, die<br />
unabhängig von Zahlungspflichten betroffen<br />
ist. Die Bescheinigungspflicht soll eine<br />
unkontrollierte Selbstbefreiung des<br />
Arbeitnehmers von der Arbeitspflicht auch<br />
dann verhindern, wenn er keinen<br />
Entgeltanspruch geltend machen kann,<br />
zumal die ärztliche Bescheinigung zur<br />
Erhaltung<br />
des<br />
sozialversicherungsrechtlichen<br />
Krankengeldanspruchs ohnehin ausgestellt<br />
werden muss.<br />
zurück zum Inhalt -> Seite 27<br />
Fragen und Antworten:<br />
Arbeitsunfähigkeit, Betriebszugehörigkeit<br />
und<br />
Erziehungsurlaub,<br />
Kündigungsfristen, Mitteilungsfristen für<br />
werdende Mütter, Verlängerung von<br />
Probearbeitsverhältnisse<br />
1. Mitteilungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit<br />
Frage:<br />
Bestehen die Anzeige- und<br />
Nachweispflichten eines arbeitsunfähigen<br />
Arbeitnehmers auch in den ersten vier<br />
Wochen des Bestehen eines<br />
Arbeitsverhältnisses?<br />
Antwort:<br />
Nach § 3 Abs. 3 Entgeltfortzahlungsgesetz<br />
entsteht der Anspruch auf<br />
Entgeltfortzahlung des arbeitsunfähigen<br />
Arbeitnehmers erst nach vierwöchiger<br />
2. Auswirkungen von Erziehungsurlaub auf<br />
die Betriebszugehörigkeit<br />
Frage:<br />
Welche Auswirkungen hat die Elternzeit auf<br />
die Dauer der Kündigungsfrist und der<br />
entsprechenden Betriebszugehörigkeit?<br />
Antwort<br />
Während der Elternzeit (früher:<br />
Erziehungsurlaub) bleibt das<br />
Arbeitsverhältnis bestehen. Es ruht lediglich<br />
während dieser Zeit. D. h, Arbeitnehmer und<br />
Arbeitgeber sind lediglich von den<br />
beiderseitigen Hauptpflichten (der<br />
Entgeltzahlungs- und der Arbeitspflicht)<br />
freigestellt, während die Nebenpflichten<br />
angepasst an die jeweiligen tatsächlichen<br />
Umständen fortbestehen. Der Zeitraum, in<br />
dem sich ein Arbeitnehmer in Elternzeit<br />
befindet, wird damit auf die<br />
Betriebszugehörigkeit angerechnet, so dass<br />
es zu keiner Verkürzung der gesetzlich<br />
gestaffelten Kündigungsfristen kommt. Eine<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong> / <strong>September</strong> / <strong>2001</strong> 33
ausdrückliche Regelung wurde leider auch<br />
bei der letzten Novellierung des<br />
Bundeserziehungsgeldgesetzes nicht mit<br />
aufgenommen. Für die Zeit des<br />
Grundwehrdienstes und von Wehrübungen<br />
hingegen legt § 6 Abs. 1<br />
Arbeitsschutzgesetz fest, dass die Zeit auf<br />
die Betriebszugehörigkeit angerechnet wird.<br />
zurück zum Inhalt -> Seite 27<br />
3. Verkürzung der im Gesetz gestaffelten<br />
Kündigungsfristen<br />
Frage:<br />
Inwieweit dürfen die im § 622 Abs. 2<br />
Kündigungsschutzgesetz genannten<br />
Kündigungsfristen in kleinen Betrieben<br />
einzelvertraglich verkürzt werden?<br />
Antwort:<br />
Arbeitgeber, die in der Regel nicht mehr als<br />
20 Arbeitnehmer beschäftigen, können<br />
grundsätzlich einzelvertraglich die<br />
gesetzliche Grundkündigungsfrist von 4<br />
Wochen zum 15. oder zum Ende eines<br />
Kalendermonats verkürzen. § 622 Abs. 5<br />
Kündigungsschutzgesetz beschränkt diese<br />
Verkürzungsmöglichkeit jedoch ausdrücklich<br />
auf die Grundkündigungsfrist des § 622 Abs.<br />
1. Diese Vorschrift legt darüber hinaus fest,<br />
dass die Kündigungsfrist zwar ohne Bindung<br />
an die festen Kündigungstermine des § 622<br />
Abs.1 Kündigungsschutzgesetz vereinbart<br />
werden darf, die Kündigungsfrist 4 Wochen<br />
aber nicht unterschreiten darf. Von den<br />
verlängerten bzw. gestaffelten Fristen bei<br />
einer Betriebszugehörigkeit von mindestens<br />
2 Jahren nach § 622 Abs. 2<br />
Kündigungsschutzgesetz darf nach dem<br />
unzweideutigen Wortlaut der Norm jedoch<br />
nicht abgewichen werden.<br />
Martin Bonelli<br />
<strong>IHK</strong> Darmstadt<br />
zurück zum Inhalt -> Seite 27<br />
4. Mitteilungsfristen für werdende Mütter<br />
gegenüber dem Arbeitgeber<br />
Frage:<br />
Welche Mitteilungsfristen gibt es für<br />
werdende Mütter gegenüber dem<br />
Arbeitgeber?<br />
Antwort:<br />
Gemäß § 5 MuSchG sollen werdende<br />
Mütter ihrem Arbeitgeber ihre<br />
Schwangerschaft und den mutmaßlichen<br />
Termin der Entbindung mitteilen, sobald<br />
ihnen ihr Zustand bekannt ist. Eine Pflicht<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong> / <strong>September</strong> / <strong>2001</strong> 34
zur Mitteilung kann also nur aus den<br />
arbeitsrechtlichen Treuepflichten abgeleitet<br />
werden. Dies bezieht sich vor allem auf<br />
notwendige Dispositionen des Arbeitgeber,<br />
z.B. Gesundheitsschutz, Meldepflichten,<br />
Ersatzarbeitskräfte. Wird die Mitteilung<br />
schuldhaft unterlassen und dem Arbeitgeber<br />
entsteht dadurch ein Schaden, so macht<br />
sich die Arbeitnehmer ersatzpflichtig.<br />
Bezüglich des besonderen<br />
Kündigungsschutzes i.S.d. § 9 MuSchG<br />
ergibt sich eine zweiwöchige Frist zur<br />
Mitteilung der Schwangerschaft, sollte der<br />
Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung<br />
noch keine Kenntnis von der<br />
Schwangerschaft haben. Sollte die<br />
Schwangere unverschuldet erst nach Ablauf<br />
der zweiwöchigen Mitteilungsfrist Kenntnis<br />
von ihrer Schwangerschaft erhalten, so ist<br />
die Fristüberschreitung dann unschädlich,<br />
wenn sie die Mitteilung an ihren Arbeitgeber<br />
unverzüglich nachholt.<br />
zurück zum Inhalt -> Seite 27<br />
5. Verlängerung und Höchstdauer eines<br />
Probearbeitsverhältnisses<br />
Frage:<br />
Was ist die zulässige Höchstdauer eines<br />
Probearbeitsverhältnisses und unter<br />
welchen Voraussetzungen lässt sie sich<br />
verlängern?<br />
Antwort:<br />
Zwingend vorgeschrieben ist eine<br />
Probearbeitszeit von mindestens 1 Monat<br />
und höchstens 3 Monaten nur im Rahmen<br />
eines Berufsausbildungsverhältnisses. Im<br />
übrigen richtet sich die Dauer nach<br />
Schwierigkeit und Komplexität der Tätigkeit,<br />
immer im Blickwinkel der<br />
Verhältnismäßigkeit. Der Gesetzgeber<br />
räumt jedoch für die maximale Dauer von 6<br />
Monaten eine erleichterte<br />
Kündigungsmöglichkeit in Form einer<br />
zweiwöchigen Kündigungsfrist ein. Ist eine<br />
längere Probezeit vereinbart, greifen<br />
grundsätzlich nach Ablauf der 6 Monate die<br />
normalen Kündigungsfristen des § 622<br />
BGB. Kann der Arbeitnehmer nach Ablauf<br />
der Probearbeitszeit noch nicht zuverlässig<br />
beurteilt werden, kann die Probearbeitszeit<br />
einmalig - jedoch nur mit der Zustimmung<br />
des Arbeitnehmers - verlängert werden. Bei<br />
Fehlzeiten während der Probezeit ist jedoch<br />
zu unterscheiden: Bei atypischen<br />
Unterbrechungen, z.B. sehr lange<br />
Erkrankung, ist eine automatische<br />
Verlängerung<br />
anzunehmen.<br />
Sicherheitshalber sollte dies jedoch<br />
ausdrücklich im Arbeitsvertrag vereinbart<br />
werden. Fehlt eine solche Vereinbarung,<br />
dann bewirken kürzere (krankheitsbedingte)<br />
Abwesenheiten keine Verlängerung der<br />
Probezeit.<br />
Franziska Dannehl<br />
<strong>IHK</strong> Dresden<br />
Literatur:<br />
Zum Arbeitsrecht<br />
Das neue Arbeitsrecht:<br />
Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete<br />
Arbeitsverhältnisse, Gesetz zur Neuregelung der<br />
sozialversicherungsrechtliche Behandlung von<br />
einmalig gezahltem Arbeitsentgelt<br />
Uwe Hegner - Neuwied: Luchterhand, <strong>2001</strong><br />
116 Seiten<br />
32,00 D-Mark<br />
ISBN 3-472-<strong>04</strong>647-3<br />
Aufbewahrungsnormen und -fristen im<br />
Personalbereich:<br />
Rechts- und Organisationsdokumentation der<br />
Aufbewahrungspflichten und -fristen zu den<br />
Bereichen<br />
Personalaktenführung,<br />
Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst<br />
Rolf Bolten; Peter Pulte<br />
4., überarbeitete Auflage<br />
Frechen: Datakontext-Verlag, 1999<br />
3<strong>04</strong> Seiten<br />
89,00 D-Mark<br />
ISBN 3-89577-096-5<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong> / <strong>September</strong> / <strong>2001</strong> 35
Arbeitsrechtliche Formularsammlung<br />
und Arbeitsgerichtsverfahren<br />
Günter Schaub<br />
7., neubearbeitete Auflage<br />
München: Beck, 1999 - XXXVIII,<br />
618 Seiten<br />
138,00 D-Mark<br />
ISBN 3-406-44063-0<br />
Einzelne Vertragsmuster erscheinen u.a. in<br />
folgenden Reihen:<br />
Heidelberger Musterverträge<br />
Verlag Recht und Praxis<br />
Beck’sche Musterverträge<br />
Beck Verlag<br />
WRS Musterverträge<br />
WRS, Verlag Wirtschaft, Recht und Steuern<br />
Arbeitsgesetze:<br />
mit den wichtigsten Bestimmungen zum<br />
Arbeitsverhältnis,<br />
Kündigungsrecht,<br />
Arbeitsschutzrecht, Berufsbildungsrecht,<br />
Tarifrecht,<br />
Betriebsverfassungsrecht,<br />
Mitbestimmungsrecht und Verfahrensrecht ;<br />
Textausgabe / mit einer Einführung von<br />
Reinhard Richardi<br />
58. Auflage, Stand 1. Februar 2000<br />
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2000 - XLII,<br />
703 Seiten<br />
(dtv ; 5006 : Beck-Texte im dtv)<br />
10,90 D-Mark<br />
ISBN 3-423-05006-3 = 3-406-46436-X<br />
Arbeitsrecht:<br />
Sammlung aller wichtigen in der Bundesrepublik<br />
geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften<br />
begr. von Hans C. Nipperdey<br />
München : Beck<br />
Ergänzbare Loseblatt-<strong>Ausgabe</strong> - Grundwerk:<br />
64,00 D-Mark<br />
ISBN 3-406-44330-3<br />
Arbeitsschutzgesetze:<br />
alle wichtigen aushangpflichtigen Vorschriften ;<br />
Arbeitszeit, Ladenschluss, Sonntagsarbeit,<br />
Jugendarbeitsschutz,<br />
Mutterschutz,<br />
Erziehungsurlaub, Schwerbehinderte,<br />
Beschäftigtenschutz, Arbeitssicherheit,<br />
Arbeitsstätten, Gefahrstoffe, Gleichbehandlung,<br />
Entgeltfortzahlung, Urlaub, Kündigungsschutz,<br />
Gesetzliche Unfallversicherung ;<br />
Textausgabe mit Verweisungen,<br />
Sachverzeichnis und einer Einführung<br />
42., neubearb. Aufl. - München : Beck, 2000<br />
402 Seiten<br />
16,50 D-Mark<br />
ISBN 3-406-47505-1<br />
Wie finde ich mich im Arbeitsrecht zurecht?<br />
Wegweiser mit Musterverträgen /<br />
Arbeitsgemeinschaft Hessischer Industrie- und<br />
Handelskammern<br />
Verfasser: Martin Bonelli, <strong>IHK</strong> Darmstadt<br />
Frankfurt am Main, 2000<br />
10,00 D-Mark<br />
Bezug über die <strong>IHK</strong> Darmstadt<br />
Arbeitsrechtliches Taschenbuch für<br />
Vorgesetze<br />
begr. von Ferdinand Grüll<br />
16., neubearbeitete Auflage<br />
Heidelberg: Sauer, <strong>2001</strong><br />
182 Seiten<br />
(Taschenbücher für die Wirtschaft ; 1)<br />
30,00 D-Mark<br />
Praxis für den Personalprofi, mit Checklisten,<br />
Formularen, Vertragsmustern. - München :<br />
Beck. - 1 Bd. + 1 CD-ROM<br />
188,00 D-Mark<br />
Erscheint jährlich<br />
Arbeitsrechts-Handbuch:<br />
systematische Darstellung und<br />
Nachschlagewerk für die Praxis ;<br />
Kommentar / von Günter Schaub<br />
9., überarbeitete Auflage - München : Beck,<br />
2000 - LXIX,<br />
2597 Seiten + Nachtr. (4 S.)<br />
196,00 D-Mark<br />
ISBN 3-406-45392-9<br />
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht<br />
Hrsg. Thomas Dieterich<br />
2. Auflage - München: Beck, <strong>2001</strong>. - XXXIV,<br />
2728 Seiten<br />
(Beck'sche Kurz-Kommentare ; 51)<br />
298,00 D-Mark<br />
ISBN 3-406-46807-1<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong> / <strong>September</strong> / <strong>2001</strong> 36
Arbeitszeugnisse in Textbausteinen:<br />
rationelle Erstellung, Analyse, Rechtsfragen<br />
Arnulf Weuster; Brigitte Scheer<br />
8., überarbeitete und erweiterte Auflage - Stuttgart<br />
[u.a.]: Boorberg, 2000<br />
400 Seiten<br />
graph. Darst.<br />
39,00 D-Mark<br />
ISBN 3-415-02703-1<br />
Scheinselbständigkeit:<br />
Arbeitsrecht, Sozialrecht<br />
Bettina Schmidt; Peter Schwerdtner<br />
2. Auflage - München [u.a.]: Rehm, 2000. - XXXIII,<br />
373 Seiten<br />
78,00 D-Mark<br />
ISBN 3-8073-1645-0<br />
So weit nicht anders vermerkt, können die<br />
Bücher über den örtlichen Buchhandel bezogen<br />
werden.<br />
Martin Bonelli<br />
<strong>IHK</strong> Darmstadt<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>04</strong> / <strong>September</strong> / <strong>2001</strong> 37