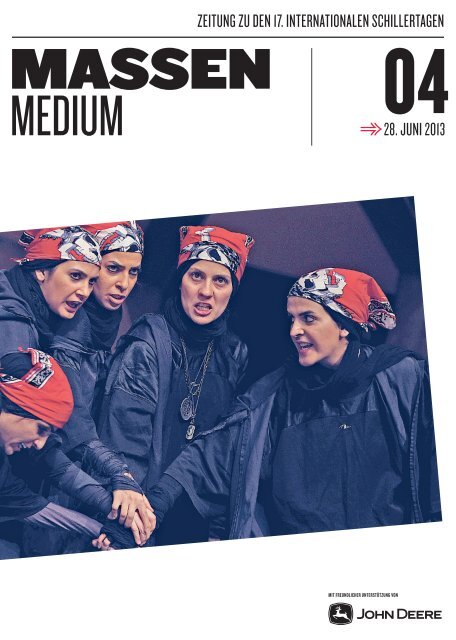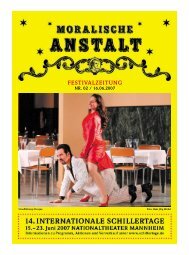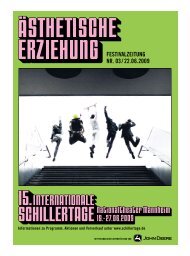festivalzeitung ausgabe 4 vom 28. juni 2013 - 17. Internationale ...
festivalzeitung ausgabe 4 vom 28. juni 2013 - 17. Internationale ...
festivalzeitung ausgabe 4 vom 28. juni 2013 - 17. Internationale ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zeitung zu den <strong>17.</strong> internationalen schillertagen<br />
massen<br />
medium<br />
04<br />
<strong>28.</strong> <strong>juni</strong> <strong>2013</strong><br />
mit freundlicher Unterstützung von
inhalt<br />
03 eS KnacKt unD Knarzt, zWicKt unD KneiFt<br />
waSili BarchatowS teeNie-tragödie „KaBale uNd lieBe“ auS St. peterSBurg<br />
04 rumSpinnen unD iDeen Sammeln<br />
eiN geSprÄch Mit BurKhard c. KoSMiNSKi<br />
05 ein SchWeizer im platten lanD<br />
rafael SaNcheZ’ Sci-fi-„wilhelM tell“<br />
06 Wir SinD ein SpontaneS VolK eiN geSprÄch Mit ali Jalaly<br />
ÜBer SeiNe „rÄuBer“ iN teheraN uNd SeiN leBeN ZwiScheN deN KultureN<br />
07 arm SchWenKen, Dumm WerDen<br />
JoNathaN MeeSe taNZt deN Schiller<br />
08 thereSia WalSer eNtflaMMt<br />
09 eine maKrele macht noch Keine reVolution!<br />
ÜBer KolleKtive deS proteStS<br />
10 in Der heimat arbeiten Zwei StipeNdiateN auS togo erZÄhleN<br />
11 Kahler König eWigKeit<br />
Zu ewald palMetShoferS „rÄuBer.SchuldeNgeNital“<br />
impreSSum<br />
Veranstalter Zeitung zu den <strong>17.</strong> <strong>Internationale</strong>n<br />
Schillertagen | Ein Projekt zur Förderung des<br />
kulturjournalistischen Nachwuchses<br />
herausGeber Nationaltheater Mannheim<br />
intendant schauspiel und künstlerischer leiter<br />
der <strong>17.</strong> internatiOnalen schillertaGe<br />
Burkhard C. Kosminski<br />
GeschÄFtsFührender intendant natiOnaltheater MannheiM<br />
Dr. Ralf Klöter<br />
redaktiOn Carmen Bauer, Judith Engel, Lena Fiedler,<br />
Carolin Meyer, Florian Naumann, Kristina Petzold,<br />
Franziska Schurr, Laura Strack, Franziska Weber<br />
redaktiOnsassistenZ Katharina Liedtke<br />
12 anDerS, um DieSeS Wort muSS eS Sich Drehen<br />
eiN geSprÄch Mit haNS KreMer, der aM haNdy durch „agoraphoBia“ fÜhrt<br />
13 mitmachen erlaubt!<br />
die filMreihe „SchMeiSS deiN ego weg!“ iM ciNeMa Quadrat<br />
14 SchillerS magenmeDizin daS Schiller-hauS iN oggerSheiM<br />
15 VerSchmelzungSVerSuch #04<br />
16 programm, SpielStÄtteN, KarteN<br />
editORiAl<br />
redaktiOnsleitunG Jürgen Berger, Barbara Burckhardt<br />
layOut Angela Aumann<br />
prOjektleitunG Sandra Strahonja<br />
GestaltunG formdusche, Berlin<br />
FOtO Hans Jörg Michel, Christian Kleiner<br />
bildnachWeis Titel Die Räuber, Schauspielhaus Teheran<br />
© Ehsan Neghabat | S.3 © Daria Pichugina | S.4 ©<br />
Lea Katharina Kroeger | S.5 © Philipp Ottendoerfer<br />
| S.6 © Christian Kleiner | S.7 © Hans Jörg Michel |<br />
S.8 © Christian Kleiner | S.9 © Lena Fiedler | S.10 ©<br />
Franziska Weber | S.11 © Georg Soulek | S.12 © Lena<br />
Fiedler | S.13 © navigator-film | S.14/15 © Christian<br />
Kleiner<br />
Fertig! Wir haben Meese überstanden, und Sie halten unsere letzte Nummer in der Hand.<br />
Jetzt kann alles nur noch besser werden. Denn Intendant Burkhard Kosminski hat uns im<br />
Gespräch erklärt, dass aus Erschöpfung kreativer Wahnsinn wird (siehe S. 4). So also werden<br />
wir Mannheim verlassen, um in Bochum und Stuttgart, Essen, Hildesheim, München<br />
und Berlin all das weiterzuspinnen, was wir hier gesehen, diskutiert, erfahren haben in<br />
engen Theaterräumen und luftig auf Schiller-Rädern. Was wir zu Text verdichtet haben,<br />
zu Kritiken, Reportagen, Interviews, von denen Sie in dieser Nummer noch drei weitere<br />
lesen können: mit den togolesischen Stipendiaten Feïçal Bang’Na und Seyram Agbalekpor-Doudjih,<br />
dem iranischen Regisseur Ali Jalaly und dem deutschen Schauspieler Hans<br />
Kremer. Wir verabschieden uns, erschöpft aber inspiriert.<br />
spOnsOrinG Morticia Zschiesche, Nina Bernges<br />
druck & anZeiGen Mannheimer Morgen Großdruckerei<br />
GmbH<br />
herzlichen DanK !<br />
die <strong>17.</strong> internationalen Schillertage wurden ermöglicht und gefördert durch<br />
förderer hauptsponsoren co-Sponsoren<br />
Mediepartner festivalhotels Kooperationspartner<br />
2 maSSenmeDium # 04/ <strong>28.</strong> <strong>juni</strong> <strong>2013</strong>
Es knackt und knarzt,<br />
zwickt und kneift<br />
Wasili Barchatows „Kabale und Liebe“,<br />
eine Teenie-Tragödie des Sankt Petersburger Theater Prijut Komedianta<br />
Sympathisch gründlich<br />
In der Sankt Petersburger Inszenierung von „Kabale<br />
und Liebe“ saß Oliver Stoltz (Lehrer) auf dem Platz,<br />
den während der Proben der Regisseur einnimmt.<br />
Was haben Sie gesehen?<br />
Maximale Konzentration und Fokussierung.<br />
Könnten Sie Ihre Eindrücke mit drei Adjektiven beschreiben?<br />
Sympathisch, nicht aufregend, aber gründlich<br />
Was hätten Sie anders gemacht?<br />
Andere Musik gewählt! Die Leitmusik „Silence is<br />
sexy“ von den Einstürzenden Neubauten hätte ich<br />
beibehalten, Gainsbourgs „Je t’aime … moi non<br />
plus“ war mir zu plakativ.<br />
Notiert von Carmen Bauer und Kristina Petzold<br />
Polina Tolstun<br />
„Silence is sexy“ wird dem Publikum aus der Dunkelheit<br />
sanft entgegengehaucht. Hinter einer Glaswand<br />
steht der Sänger, der sich eben noch direkt vor dem<br />
Mikro eine Zigarette angezündet hat und jetzt zwischen<br />
den Tönen mit lautstarkem Knistern die Kippe<br />
weginhaliert. Den Spruch könnte man als Zuschauer<br />
zuallererst auf die Tatsache beziehen, dass die<br />
russische Inszenierung von „Kabale und Liebe“ mit<br />
deutschen Übertiteln das Geschehen auf der Bühne<br />
verbal kaum voranbringen kann. Aber deshalb mit<br />
Ohrstöpseln zuschauen?<br />
Nach dem rätselhaften Prolog im Schatten lebt die<br />
Bühne im Flowerpower-Stil auf. Mutter Miller mit<br />
Sonnenbrille und Lederstiefeln im sexy Hippie-Look<br />
verscheucht die Tristesse der schwarzen Guckkastenbühne<br />
mit üppigen Blumensträußen. Aus dem<br />
mattschwarzen Verhörraum mit venezianischem<br />
Spiegel wird ein Tonstudio mit Retro-Charme. In<br />
der vorderen Kastenhälfte sitzt Miller, Luises Vater<br />
und bei Schiller ein Geiger aus der Unterschicht, im<br />
John-Lennon-Look vor seinem Mischpult.<br />
Luise (Polina Tolstun) stolpert in die Einraumwohnung<br />
und wirkt rotzig, singt „Love you Babe“, spielt<br />
Luftgitarre. Nachdem sie einmal über die Bühne gerockt<br />
ist, hüpft sie auf den Schoß ihres Vaters. Seine<br />
Prinzessin. Bis der schmale Ferdinand (Ilja Dell) die<br />
Bühne und Luise bestürmt: grüne Haare, Lederjacke<br />
und die obligatorische Gitarre. Hier zeigt sich,<br />
welches Publikum der dreißigjährige russische Regisseur<br />
Wasili Barchatow im Kopf hat. Es soll jung<br />
und im Rebellionsalter sein. Sonst bleibt alles beim<br />
Alten: deutsche – beziehungsweise russische – Romeo-und-Julia-Tragödie<br />
inklusive Gesellschaftskritik.<br />
Die Eltern sind natürlich problematisch und der<br />
Selbstmord eine Flucht.<br />
Weder die Millers noch Herr von Walter bieten den<br />
Schutz oder die moralische Integrität, die sich die<br />
Liebenden wünschen. Das zeigt eine Szene, in der die<br />
beiden Väter aufeinandertreffen: Miller schlägt erst<br />
hilflos zu und verkriecht sich dann im Kühlschrank,<br />
während Ferdinands Vater sich heiser schreit. Die<br />
Intrige beginnt mit einer SMS. Luise schreibt unter<br />
Zwang an den angeblichen Liebhaber Wurm, um<br />
Ferdinand in die Trennung zu treiben.<br />
Mit der SMS springt das Stück aus den Siebzigern<br />
mehr in die Gegenwart. Nach und nach verschwinden<br />
die komischen Momente. Ferdinand versucht<br />
schon im dritten Akt, sich zu erhängen, und Luise<br />
klettert zwischendurch mal probeweise in den Gitarrenkoffer-Sarg.<br />
Bevor die schwärmerische Teenagermelancholie<br />
dominierend wird, macht das Stück<br />
richtig Spaß, vorausgesetzt man mag Grunge, Nick<br />
Cave, die Beatles und den Look der Siebziger.<br />
Eine Unmenge Requisiten ermöglichen Slapstick-<br />
Einlagen, Wutausbrüche und die Visualisierung von<br />
Seelenzuständen. Das Licht schafft brillante atmosphärische<br />
Räume. Das ist ideal für Zuschauer, denen<br />
das Mitlesen irgendwann auf die Nerven geht.<br />
Manchmal kippt die Bemühung um Eingängigkeit<br />
der Schillerworte aber auch in Pantomime-Exzesse<br />
oder skurrile Gebärdensprache.<br />
Trägt Ferdinand seine Liebesschwüre mit spärlich<br />
gesetzten E-Gitarrenriffs vor, zeigt sich, wie gut<br />
Schillers Text auch als Grunge-Lyric funktioniert.<br />
Auf dieser Ebene versteht man sofort: Das ist ein<br />
Kunst- und Distanzierungsmittel zwischen den<br />
Schillerworten und der Figur. Ansonsten aber kommen<br />
sich in diesem Bühnendrama mit realistischem<br />
Anspruch der Text und die Figuren zu nah. Es zwickt<br />
und kneift, wenn zum Beispiel Ferdinand und Luise<br />
im Kapuzenpulli als perfekte rebellische Ausreißer<br />
inszeniert werden und Luise plötzlich sagt: „Deine<br />
Zufriedenheit ist meine heiligste Pflicht.“<br />
Es knackt und knarzt. Der Text bleibt der Szenerie<br />
fremd, und das liegt weder an den 2000 Kilometern<br />
Luftlinie zwischen St. Petersburg und Mannheim<br />
noch an den überzeugenden Darstellern. Wasili Barchatow<br />
hat sich und seiner Inszenierung einfach zu<br />
wenig Raum gegeben, den Schillerstoff kritisch zu<br />
erneuern. Oder hat es nicht gewagt. Die Übertragung<br />
in die Siebziger der westlichen Welt ist ein Weichzeichner,<br />
der die von Schiller so scharf konturierte<br />
Kritik gegen die Intrigen der herrschenden Klasse<br />
verwischt. Ein so potentiell politisches Stück explizit<br />
aus der Gegenwart herauszunehmen, ist auch ein<br />
Statement. Genau wie „silence is as sexy as death.“<br />
Kristina Petzold<br />
massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong><br />
3
Rumspinnen<br />
und Ideen sammeln<br />
Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski über sein Verständnis von<br />
Theater, das Feuer der Schillertage und die Produktivkraft Erschöpfung<br />
Warum braucht man eine unabhängige Zeitung bei den Schillertagen?<br />
Für mich sind die Seminare ein Kernpunkt des Festivals.<br />
Beziehungsweise diese sechzig Menschen, die<br />
da in allen Bereichen eine Fortbildung machen. Die<br />
aus dem Festival heraus als kreative Teams eigene<br />
Dinge machen, die Theater infrage stellen, aber auch<br />
Antworten geben oder uns einfach mal sagen, was<br />
wir besser machen sollen.<br />
Wie wichtig ist die Print<strong>ausgabe</strong> in Zeiten des Internets?<br />
Ich bin da sehr traditionell. Ich bin gelernter Buchhändler<br />
und habe einfach gern Bücher und Zeitungen<br />
in der Hand. Ich glaube aber auch, dass es für die<br />
Stadt wichtig ist, dass ein Festivalheft ausliegt, mit<br />
dem die Leute in den Liegestühlen liegen und lesen.<br />
Die Diskussion wird es sicher geben, ob man irgendwann<br />
auch noch einen Blog machen muss. Wir müssen<br />
überlegen, wie wir das angehen. Aber indem ihr<br />
Print macht, kriegt ihr echte Redaktionsarbeit mit,<br />
bei der es ja nicht nur ums Schreiben geht, sondern<br />
auch ums Layout und um pünktliche Abgabe. Ihr erlebt<br />
den Druck, der da entsteht.<br />
Man hört heraus, dass Ihnen die Nachwuchsförderung sehr<br />
wichtig ist. Wichtiger als das Produkt?<br />
Naja, es ist doch immer beides. Das eine ist der kreative<br />
Weg, den ihr als Gruppe mit zwei betreuenden<br />
Profis geht, und das andere ist, wie immer, wie auch<br />
im Theater: das Endprodukt. Im Theater ist die Probenarbeit<br />
eigentlich auch wichtiger. Natürlich freut<br />
man sich über ein hochklassiges Endprodukt, aber<br />
der Weg dahin ist ja vielleicht viel entscheidender.<br />
Für Journalisten, für Künstler, für alle.<br />
Wie ist Ihr Verhältnis zur Theaterkritik?<br />
Ich lese sie, und manchmal bin ich verblüfft, weil die<br />
was gesehen haben, worüber ich gar nicht nachgedacht<br />
habe. Manchmal ärgert man sich. Manchmal<br />
freut man sich. Ich finde Journalismus für die Arbeit<br />
extrem wichtig, weil es ein Spiegel ist. Es ist nicht<br />
entscheidend, ob es eine gute oder eine schlechte<br />
Kritik ist, sondern dass es eine inhaltliche Kritik ist.<br />
Wo ist sie, die kritische Masse?<br />
Theater ist der älteste Ort, an dem sich Kunst und<br />
Publikum treffen. Ohne Publikum gibt’s kein Theater.<br />
Im besten Fall ist das Publikum eine kritische<br />
Masse. Das bedeutet ja nicht nur den Wutbürger. Es<br />
bedeutet, eine Meinung zu haben, die jubelnd, vernichtend,<br />
gleichgültig oder verärgert sein kann. Wo<br />
Meinung ist, beginnt die kritische Masse.<br />
Wie kritisch oder politisch ist Theater denn heute?<br />
Ich würde sagen: extrem. Zum Beispiel die „Räuber“<br />
<strong>vom</strong> Gorki Theater, die wir jetzt gerade hier<br />
gesehen haben. Das finde ich einen sehr politischen,<br />
auch sehr mutigen Abend, der sehr viele Reaktionen<br />
auslöst. Da war eine kritische Masse, die total zugestimmt<br />
oder es abgelehnt und auf die Bühne hinunter<br />
geschrien hat. Das geht nicht mit jedem Stoff,<br />
aber wenn man Lust hat, am Zünder zu ziehen, kann<br />
Theater oder Oper sehr viel.<br />
Was würden Sie beim nächsten Mal anders machen?<br />
Das kann ich noch gar nicht sagen, wir stecken ja<br />
noch mittendrin. Man bereitet zwei Jahre was vor,<br />
und es gibt Konzeptionen, die sich ändern. Ursprünglich<br />
waren die Schillertage so geplant, dass<br />
das ganze Festival nur auf öffentlichen Plätzen stattfindet.<br />
Das war der Ausgangspunkt der „kritischen<br />
Masse“. Dann stellt man aber fest, dass man eigentlich<br />
gar nicht die Produktionen hat. Das heißt, man<br />
hätte alles eigenproduzieren müssen. Das konnten<br />
wir logistisch gar nicht leisten. Und dann fängt man<br />
an: Was produzieren wir, was sind die Eigenanteile,<br />
was ist uns wichtig? Welche Regisseure interessieren<br />
uns? Wir wollen viele verschiedene Regiehandschriften<br />
zeigen. Die Schillertage gibt es seit 78, und<br />
alle bedeutenden Regisseure, die Schiller gemacht<br />
haben, waren hier: Stemann, Castorf, Thalheimer,<br />
jetzt Bachmann. Es gibt die Gastspiele und Eigenproduktionen,<br />
wie Machina eX oder „Der Parasit“ oder<br />
der Wengenroth-Abend. So fügt es sich langsam<br />
zusammen, und dann kommt dazu, was im Ausland<br />
passiert. Dann geht die Umsetzung los, und jetzt<br />
machen wir jeden Abend eine andere Erfahrung.<br />
Wie funktioniert die Übertragung nach Mannheim?<br />
Von einer kleinen auf eine große Bühne wie bei den<br />
„Räubern“ <strong>vom</strong> Maxim Gorki Theater? Man fiebert<br />
mit, und am Ende des Festivals sind wir erschöpft.<br />
Erst vier Wochen später sehen wir uns dann erstmals<br />
in die Augen und fragen: Wie war’s denn? Unabhängig<br />
davon, wie viele Zuschauer wir hatten oder wie<br />
viele Einnahmen. Und dann beginnen wir, rumzuspinnen<br />
und Ideen zu sammeln. Und so bahnen sich<br />
dann in einer der letzten Leitungssitzungen vor der<br />
Sommerpause schon die Schillertage 2015 an.<br />
Welche Vorstellung haben Sie verpasst, obwohl Sie sie gerne<br />
gesehen hätten?<br />
Im Prinzip versuche ich, die ganze Strecke zu gehen.<br />
Aber es ist einfach so, dass ich mir nur etwa<br />
zwei Drittel ansehen kann. Wir teilen uns das im<br />
Team auf, zu dem Christine Klotmann und Holger<br />
Schulze gehören, die Fulminantes leisten. Die machen<br />
die ganze Logistik, schauen, dass alles läuft.<br />
Und natürlich die Dramaturgie. Das Verständnis<br />
im Haus ist ja mittlerweile, dass wir nicht mehr ’ne<br />
Generalintendanz haben, sondern ein Leitungsteam<br />
sind. Mein Verständnis von Theater ist, dass man als<br />
gleichberechtigtes Team arbeitet, und natürlich gibt<br />
es viele Fälle, wo ein Einzelner eine Entscheidung<br />
treffen muss, aber die meisten Entscheidungen fallen<br />
in der Diskussion. Die Schillertage machen wir ja<br />
neben unserem normalen Job. Das ist immer on top<br />
und kostet sehr viel Zeit. Das ganze Haus arbeitet<br />
Nachtschichten und lebt und bebt für das Festival.<br />
Wir können nicht alle alles sehen, aber das ist ja auch<br />
egal. Dann erzählt ihr uns, wie’s war.<br />
Was machen Sie, wenn die Schillertage vorbei sind?<br />
Am Dienstag fange ich mit Proben an. Felicitas Zeller<br />
hat ein neues Stück geschrieben, dafür beginnen<br />
am Dienstag die Vorproben. Das kann sehr produktiv<br />
sein, in so einem Erschöpfungszustand zu arbeiten,<br />
mit dieser leichten Müdigkeit. Da entsteht so eine<br />
Anarchie, ein Wahnsinn, den man komplett ausgeruht<br />
nicht hat. Diese Vorproben sind von daher ganz<br />
wichtig. Wenn man dann zurück kommt und sich<br />
anguckt, was man erarbeitet hat, dann wundert man<br />
sich manchmal schon, aber auch im positiven Sinne:<br />
Das ist ja echt geil, dass uns das eingefallen ist. Wie<br />
kamen wir denn da drauf?<br />
Das Gespräch führten Carolin Meyer, Kristina Petzold und<br />
Franziska Weber<br />
4 massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong>
Ein Schweizer<br />
im platten Land<br />
Rafael Sanchez hat Jens Rachuts satirische Science-Fiction-Version<br />
des „Wilhelm Tell“ inszeniert<br />
Ein bisschen Stroh, ein bisschen Wasser, eine angedeutete<br />
Almhütte und ein kleiner Edelstahlcontainer.<br />
So sieht die Schweiz in Rafael Sanchez’ Züricher<br />
„Wilhelm Tell“-Inszenierung aus. Sanchez erzählt<br />
den eidgenössischen Gründungsmythos in der Bearbeitung<br />
von Jens Rachut aus einer dystopischen<br />
Science-Fiction-Perspektive. Im dreiundzwanzigsten<br />
Jahrhundert ist Deutschland wieder einmal Europas<br />
Großmacht und in das kleine Nachbarland eingefallen.<br />
Die Schweizer sind verarmt, die Bienenvölker<br />
ausgestorben, und die deutsche Großmacht der Fahrlehrer<br />
donnert über die Alpen, um der Schweiz mit<br />
einem Bienenrettungsprogramm zu helfen.<br />
Jens Rachut selbst spielt den Deutschen Erwin<br />
Rohmmel (mit h!), der den Verlust des Rollmopses,<br />
dieses „Titans des Gourmethimmels“, nur schwer<br />
verschmerzen kann. Zusammen mit der strengen<br />
Lise-Lotte Hidler (mit d!, Tabea Bettin) bezieht er<br />
die kuschelige Almhütte, während die Tells in ständiger<br />
Angst vor der totalen Überwachung in dem viel<br />
zu kleinen Container hausen. Die Deutschen bilden<br />
eine Großmacht von besserwisserischen „Fahrlehrern“<br />
(Merkel, ick hör Dir trapsen!), oder, um es mit<br />
Stauffacher (Alexander Seibt) zu sagen: „Die Deutschen<br />
haben alle Krisen überstanden, weil sie selber<br />
keine hatten.“<br />
Über Deutschland<br />
darf gelacht werden<br />
Hedwig Tell (Rahel Hubacher) wird im Gegensatz<br />
zum schillerschen Original zur treibenden Figur im<br />
Widerstandskampf. Wilhelm Tell (Jakob Leo Stark)<br />
hat nur genug Mut, den Aufstand zu fordern, wenn<br />
die bösen Fahrlehrer gerade nicht in der Nähe sind,<br />
und Wilhelm Junior (Malte Sundermann) spricht am<br />
liebsten über Impotenz und Onanie. Hedwigs Waffe<br />
der Wahl ist eine selbstgebastelte Zeitmaschine, mit<br />
Tabea Bettin, Rahel Hubacher und Jens Rachut<br />
der sie ins Jahr 1307 reist, zum Ursprung des Tell-<br />
Mythos. Auf ihrem Weg trifft sie nicht nur die Zeit<br />
höchstpersönlich, sondern auch einen Indianer, der<br />
per Anhalter durch die Jahrhunderte reist und der<br />
zeitverwirrten Hedwig durch die Kunst des Spurenlesens<br />
in das richtige Jahr verhilft. Ab und zu fängt<br />
dann jemand an zu singen.<br />
Das lose Potpourri musikalischer Genres aus Elektropop,<br />
Musicalsong und melancholischem Chanson<br />
wird mit Projektionen der finnischen Videokünstlerin<br />
Heta Multanen ergänzt, die einer Art Tarantino-Ästhetik<br />
folgen. Es überwiegen schwarzweiße<br />
Bilder, in denen nur das Blut rot spritzt. Wie die<br />
Gesangseinlagen wirken die Projektionen meist eher<br />
unterbrechend als kommentierend. Die Geschichte<br />
wird im Verlauf des Abends dadurch weder sinnvoller<br />
noch lustiger.<br />
Um den Tell-Mythos überhaupt Realität werden zu<br />
lassen, drückt die zeitreisende Hedwig im Jahr 1307<br />
schließlich den Stop-Button und korrigiert die Pfeilausrichtung<br />
ihres unfähigen Tells, auf dass sein Pfeil<br />
nicht so ins Leere schießt wie der Humor der Inszenierung.<br />
Über Deutschland darf gelacht werden.<br />
Gäbe es in all dem willkürlichen Trash bloß was zu<br />
lachen.<br />
Carolin Meyer<br />
Das Zitat im Kopf erspart den Tell<br />
Beim Schiffbruch hilft der Einzelne sich leichter. Das<br />
schwere Herz wird nicht durch Worte leicht. Wer<br />
Tränen ernten will, muss Liebe säen. Das Alte stürzt,<br />
es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus<br />
den Ruinen. Dem Friedlichen gewährt man gern den<br />
Frieden. Was Hände bauten, können Hände stürzen.<br />
Dem Mutigen hilft Gott. Der Starke ist am mächtigsten<br />
allein. Dem Schwachen ist sein Stachel auch gegeben.<br />
Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt.<br />
Der kluge Mann baut vor. Der fremde Zauber reißt<br />
die Jugend fort. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.<br />
Die letzte Wahl steht auch dem Schwächsten<br />
offen. Die Schlange sticht nicht ungereizt. Die<br />
Unschuld hat im Himmel einen Freund. Durch diese<br />
hohle Gasse muss er kommen. Ein jeder wird besteuert<br />
nach Vermögen. Es kann der Frommste nicht in<br />
Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht<br />
gefällt. Früh übt sich, was ein Meister werden will.<br />
Rache trägt keine Frucht. Redlichkeit gedeiht in jedem<br />
Stande. Unbilliges erträgt kein edles Herz. Verbunden<br />
werden auch die Schwachen mächtig. Wer<br />
gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.<br />
notiert von carmen bauer<br />
massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong><br />
5
Wir sind ein<br />
spontanes Volk<br />
Ali Jalaly inszeniert am Schauspiel Köln, aber auch im Iran. In Mannheim ist nun seine<br />
„Räuber“-Inszenierung <strong>vom</strong> Schauspielhaus Teheran zu sehen<br />
Sie leben hauptsächlich in Deutschland. Welches Verhältnis<br />
haben Sie zu ihrer Heimat?<br />
Wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich den Iran,<br />
werde aber immer wieder an meine Wurzeln erinnert.<br />
Über mein Stück „Barfuß Nackt Herz in der<br />
Hand“ schrieb eine Kritikerin, im Text würden sich<br />
iranische Theaterformen mit deutschen mischen.<br />
Ich war verwundert und habe sie gefragt, was das<br />
Iranische dabei ist. Sie hat mir erklärt, sie habe ihre<br />
Doktorarbeit über Tasir geschrieben, das traditionelle<br />
Mysterienspiel. Ich erinnerte mich, dass ich Tasir-<br />
Stücke als Kind gerne mochte, das sind meine Wurzeln.<br />
Daraufhin bin ich nach achtzehn Jahren zum<br />
ersten Mal wieder zurück in den Iran gefahren. Inzwischen<br />
inszeniere ich ein bis zwei Stücke im Jahr<br />
in Deutschland, dann wieder in Teheran.<br />
Was fehlt Ihnen in Deutschland?<br />
Die Geselligkeit. Wir Iraner sind ein spontanes Volk<br />
der Großfamilien. Du bist fast nie allein. Ich habe<br />
sechs Brüder und erinnere mich, dass wir zum Schlafen<br />
alle sieben nebeneinander unter einer riesigen<br />
großen Decke lagen. Toll ist, das immer jemand da<br />
ist. Die Gefahr ist, dass die Frage nach der Identität<br />
zu kurz kommt. In Deutschland lernen die Kinder<br />
Selbstbewusstsein. Wenn man die Vorteile beider<br />
Kulturen sammeln kann, ist das ein Reichtum.<br />
Wo lebt ihre Familie heute?<br />
Drei Brüder in Deutschland, einer in England, zwei<br />
in Teheran. Ich bin der Einzige, der pendelt. Manchmal<br />
denke ich, meine Heimat ist im Flugzeug zwischen<br />
dem Iran und Deutschland. In der Luft.<br />
Sie haben Schillers „Räuber“ in Teheran inszeniert. Ist das<br />
Stück im Iran bekannt?<br />
Schiller und Shakespeare sind Klassiker, meine<br />
„Räuber“-Inszenierung war aber die iranische Erstaufführung.<br />
Ich habe den Text neu ins Persische<br />
übersetzt und bin wie ein Student rangegangen, sehr<br />
experimentell, stark gekürzt und mit einer modernisierten<br />
Sprache.<br />
Gibt es Unterschiede in den Theatertraditionen?<br />
Oh ja. In Deutschland habe ich eine sachliche Herangehensweise<br />
beim Inszenieren gelernt. Im Iran ist<br />
alles sehr poetisch. Übersetze ich zum Beispiel ins<br />
Persische, ist der Text fast anderthalb Mal so lang<br />
wie im Deutschen. Da muss man Sachlichkeit reinbringen.<br />
Leider haben wir im Iran nicht so viel Möglichkeiten,<br />
Theater zu zeigen. Es gibt wenig Räume.<br />
Teheran ist ein Vierzehnmillionen-Stadt und hat weniger<br />
Theaterräume als die Einmillionen-Stadt Köln.<br />
6 massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong><br />
Welche Theaterformen gibt es im Iran?<br />
Zwei Kategorien. Zum einen für die Intellektuellen<br />
und Superintellektuellen. Das verstehen viele nicht.<br />
Oder das sehr einfache Theater, das das intellektuelle<br />
Publikum nicht besucht. Theater für die Masse,<br />
so wie hier in Deutschland, in Frankreich und England,<br />
dafür brauchen wir noch Zeit. Stücke, die alle<br />
Schichten ansprechen, gibt es zu wenige. Yasmina<br />
Reza, deren „Gott des Gemetzels“ ich letztes Jahr<br />
in Teheran inszeniert habe, wurde zum meist gesehenen<br />
Stück. Das haben ungefähr <strong>17.</strong>000 Zuschauer<br />
gesehen. Solche Stücke gibt es aber selten. Vor kurzem<br />
habe ich in der Kölner Oper Verdis „Rigoletto“<br />
gesehen. Da saßen drei Generationen neben mir:<br />
ein Großvater, ein Vater und eine etwa neunjährige<br />
Tochter. Die haben sich drei Stunden „Rigoletto“<br />
angesehen. So was fehlt im Iran. Es gibt aber auch<br />
Überraschungen. Manchmal sitze ich in Teheran im<br />
Theater und glaube, dass ich in New York bin. Dann<br />
frag ich mich: Woher kommt das?<br />
Und woher kommt es?<br />
Es gibt junge ambitionierte Regisseure, die aber das<br />
Problem haben, dass Regisseur im Iran kein Beruf<br />
ist. Ich hatte Glück, in Deutschland Regie zu lernen,<br />
und für mich ist es die Aufgabe meiner letzten Lebensphase,<br />
das, was ich in Deutschland gelernt habe,<br />
weiterzugeben. Und die Studenten im Iran sind sehr<br />
dankbar. Denn es gibt dort keine Regieschulen, keine<br />
Schauspielschulen. Wenn du Glück hast, kannst<br />
du ein Mal im Jahr inszenieren. Es gibt sehr viele,<br />
die aufgrund der räumlichen Situation lange warten.<br />
Und die wundern sich dann, wenn ich in Teheran<br />
inszeniere und nach der Premiere sofort abhaue. Im<br />
Iran bleibt der Regisseur immer bei der Aufführung<br />
und sieht sich alle fünfzig Vorstellungen an. „Du<br />
musst hier bleiben“, sagen sie, und ich frage zurück:<br />
„Wozu?“ Ich habe doch meine Arbeit bis zur Premiere<br />
getan, danach muss ich zum nächsten Projekt.<br />
Wenn ich beschreibe, wie das in Deutschland funktioniert,<br />
dass man innerhalb einer Woche drei Stücke<br />
zeigt, „Nora“, Abbau, dann „Macbeth“, Abbau, dann<br />
Beckett, Abbau, und am nächsten Tag wieder „Nora“,<br />
da wundern die sich. Repertoire gibt es bei uns nicht,<br />
weil in Kultur nicht langfristig investiert wird. Wer<br />
im Iran Theater macht ist ein Idealist, genau wie<br />
Karl Moor.<br />
War es einfach für Sie, mit ihrer „Räuber“- Inszenierung nach<br />
Deutschland zu kommen?<br />
Es war eher schwierig. Das Ensemble ist sehr jung,<br />
und am Anfang habe ich gedacht, es sei unmöglich,<br />
dass so viele junge Menschen ein Visum bekommen.<br />
In letzter Sekunde hat aber doch alles geklappt,<br />
gestern erst, und nun kommen sie und freuen sich.<br />
Deutschland hat ja zwei Kennzeichen: Fußball und<br />
Theater.<br />
Mussten Sie an der Inszenierung etwas ändern?<br />
Ich musste sie umbauen. Wir haben das Stück im<br />
Schauspielhaus Teheran inszeniert, dort gab es ganz<br />
andere Maße. Also hat mein Bühnenbildner ein<br />
neues Bühnenbild entworfen, und ich habe mit den<br />
Schauspielern noch einmal drei Wochen geprobt. Ich<br />
bin sehr gespannt, wie das hier aussieht.<br />
Können Sie die „Räuber“ in einem Wort zusammenfassen?<br />
Würde man mich fragen, was Schiller will, würde<br />
ich sagen: Protest. Den Karl habe ich mit sechs<br />
Frauen besetzt. Das ist auch eine Form des Protests,<br />
besonders in dem Land, aus dem ich komme. Die<br />
iranischen Frauen stehen bei Demonstrationen und<br />
anderen Protestformen fast immer in der ersten Reihe.<br />
Frauen müssen viel ertragen in der iranischen<br />
Gesellschaft und versuchen trotzdem, sich nicht zu<br />
verstecken. Bei Schiller ist Karl ja wie Robin Hood,<br />
während Spiegelberg und die anderen die Gelegenheit<br />
nutzen, um auszurauben. Das findet man in<br />
jeder Bewegung, in jedem Protest. Es gibt nicht nur<br />
Idealisten, und ein bisschen Spiegelberg steckt auch<br />
in Karl. Deshalb habe ich sechs Karls inszeniert,<br />
sechs Teile von Karl. Ein Teil will ausrauben, einer<br />
denkt an die Masse, einer ist Idealist, einer Opfer.<br />
War es schwierig, „Die Räuber“ in Teheran zu inszenieren?<br />
Wir haben ja vor der Präsidentschaftswahl begonnen,<br />
und da war alles etwas lockerer. Ich hätte nie<br />
gedacht, dass ich das Stück im Iran machen darf. Und<br />
plötzlich habe ich zwei Stücke parallel inszeniert,<br />
„Der Gott des Gemetzels“ und „Die Räuber“.<br />
Das Gespräch führten Franziska Schurr<br />
Aufführungen<br />
27. und <strong>28.</strong> Juni<br />
ort<br />
Alte Feuerwache
Arm schwenken,<br />
dumm werden<br />
Jonathan Meese ist so scheiSSlangweilig wie die Demokratie<br />
Was willst du hören?<br />
Der Stipendiat Tobias (um die 20) saß in Meeses<br />
„Generaltanz“ auf dem Platz, den während der<br />
Proben der Regisseur einnimmt. Was hat er erlebt?<br />
Beschreibe deinen Eindruck in drei Adjektiven.<br />
Gelangweilt, angeekelt und abgestoßen.<br />
Was hättest du als Regisseur anders gemacht?<br />
Alles. Was willst du hören? Es gab ja keinen<br />
Regisseur.<br />
Würdest du wiederkommen?<br />
Nein, ich habe jetzt, glaube ich, ein Bild davon. Es<br />
war gut, dass ich das gesehen habe, aber ich glaube,<br />
da wird nicht viel Neues passieren.<br />
Notiert von Lena Fiedler<br />
Jonathan Meese als Einhorn<br />
Ich habe die undankbare Aufgabe, eine Aufführung<br />
zu kritisieren, die sich jeder Kritik entzieht, jeder<br />
Kritik entziehen sollte. Das „sollen“ versteht sich<br />
hier nicht als moralische Order, sondern als ideologische<br />
Aussage. Ich müsste eine Entscheidung treffen,<br />
sie für gut oder schlecht befinden, entziehe mich<br />
aber der Entscheidung, verweigere mich der Wahl,<br />
denn Meese ist „UNWÄHLBARKEIT“. Diesen und<br />
anderen Unsinn verzapfte der Adidassi Jonathan<br />
Meese am Mittwoch in öden zweidreiviertel Stunden<br />
am Nationaltheater Mannheim.<br />
Im Vorab kursierten ahnungslose Gerüchte in den<br />
ehrwürdigen Mannheimer Hallen. Was wird Meese<br />
machen? Wer ihn kennt, weiß, dass er dasselbe<br />
machen wird wie immer. Nämlich nichts. Nichts von<br />
Bedeutung oder Relevanz. Die Handlung des Abends<br />
ist schnell zusammengefasst: Meese geht, läuft und<br />
stolpert über eine Bühne voller Gerümpel, die sich<br />
ausnimmt wie eine Mischung aus Kinderzimmer, Naturalienkabinett<br />
und Freakshow-Asservatenkammer<br />
(Reh, Alien, Würste und Wurstketten, diverse Masken<br />
und Pickelhauben, rote Stühle, ein Rednerpult).<br />
In ewiger Schleife tönt „You“ von der 80er Jahre<br />
New-Wave-Band Boytronic, während Meese auf der<br />
Bühne seine Runden dreht. Sein Tanz ist der Stechschritt<br />
der Totalitarität.<br />
Denkt er. Demokratie und Ideologie werden von<br />
ihm verdammt. Dass seine Anti-Ideologie im gleichen<br />
Atemzug zur Diktatur wird, ist künstlerisches<br />
Konzept. Kunst wird zur höchsten und heiligsten<br />
Befehlsstruktur, denn nur „die Würde der Kunst ist<br />
unantastbar“. Schiller und Wagner sind die Coolsten<br />
und irgendwie auch dasselbe, wenn auch Wagner ein<br />
wenig cooler war, denn „erst kam Wagner, dann kam<br />
Schiller und dann die Stumpfen“.<br />
Die Stumpfen, das sind wir, die Zuschauer und Kulturpissnelken,<br />
die „demokratisierten Klone“ eben.<br />
Heavy Petting mit Jonathan Meese. Es ist ja nicht<br />
so, als würde Meese nur nehmen. Nein, er befriedigt<br />
den Alien und das Reich. Diesem aufblasbaren Plastik-Alien<br />
wird kurzerhand Hitlerbart und Hakenkreuz<br />
aufgemalt, dann wird er gefingert und geleckt,<br />
von Meese und für die Kunst.<br />
Meese kann uns mal<br />
Warum interessiert uns dieser Rüpelkünstler aus<br />
dem fernen Berlin überhaupt? Die Grenzen der<br />
theatralen Bedeutungserzeugung waren schnell erreicht.<br />
Er bot weder von kunsttheoretischer Seite<br />
irgendetwas, dass uns überrascht hätte, noch boten<br />
seine Darstellungen auf der Bühne eine Ablenkung<br />
<strong>vom</strong> ewigen Trott der Gleichförmigkeit, den er als<br />
Kunst verkauft. Es ist also nur natürlich, dass wir<br />
ein paar Beweisfotos von ihm schießen, uns mit<br />
gewichtiger Miene unserem Nachbarn zuwenden<br />
oder eine SMS mit Inhalt à la „Ich war da dabei“ an<br />
Freunde und Familie schicken. Nicht die Kunstfigur<br />
Meese interessiert, sondern was die Medien aus<br />
ihm machen.<br />
Wir ergötzen uns an den skandalumwitterten Auftritten<br />
dieses Enfant terrible. Meeses Wolfspelz hat<br />
weiße Streifen und ist von Adidas. Und scheint ihm<br />
in den vergangen Jahren zu eng geworden zu sein.<br />
Er passt nämlich nicht mehr rein in diesen Pelz.<br />
Vielleicht wird er noch einmal in Bayreuth ausgeführt,<br />
wo Meese 2016 den „Parsifal“ inszeniert. Da<br />
wird er dann vermutlich noch um einiges abgetragener<br />
wirken.<br />
Für die „Bild“ reicht es vielleicht noch. Ein Hitlergruß<br />
ist ein Hitlergruß und keine Kritik an der „Ichverseuchten“<br />
Gesellschaft. Arm schwenken, dumm<br />
werden, ist seine Devise. Irgendwann stellt sich ein<br />
Unmut ein, der nur durch eine widerspenstige Trotzhaltung<br />
kompensiert werden kann. Wir harren hier<br />
aus bis zum Schluss. Meese kann uns mal.<br />
Meese. Manchmal sind Leute auch einfach notwendig,<br />
die meilenweit über das Ziel hinausschießen<br />
und klarstellen, dass Kunst mehr ist als ein schillerndes<br />
Drama in fünf Akten. Aber in einem wachen<br />
Augenblick sollte Meese sich mal die Frage stellen:<br />
Braucht es mich? Wir haben jede Meinung verloren.<br />
Er interessiert uns nicht. Wir halten es wie der Sänger<br />
von „The Bianca Story“, der im anschließenden<br />
Schill-out die passenden Worte fanden: Fuck you,<br />
Jonathan.<br />
Lena Fiedler und Kristina Petzold<br />
massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong><br />
7
Theresia Walser:<br />
Entflammt<br />
Die schillersche Sprache ist ein Zustand<br />
Vor einigen Jahren saß ich einmal in einer Schultheateraufführung<br />
von Schillers „Jungfrau“, mehr zufällig,<br />
weil die Tochter einer Freundin mitspielte. Man<br />
schreckt ja immer ein wenig zurück bei der Vorstellung,<br />
wie sich Schüler mit der schillerschen Sprache<br />
herumschlagen, wie sie auf einer Bühne stehen wie<br />
in zu schweren Schuhen, in denen sie kaum laufen<br />
können. Selbst von sogenannten professionellen<br />
Theatern weiß man, wie schnell diese schillersche<br />
Sprache kalenderspruchstarr daherdekliniert werden<br />
kann, so dass diese Verse zum leblos-erbaulichen<br />
Wunschkonzertkitsch verkommen.<br />
Diese Schulaufführung war in allem etwa so, wie<br />
man es wahrscheinlich von einer Schulaufführung<br />
erwartet. Man war schon von vorneherein gerührt<br />
über den Mut, dass sich diese 13-, 14-Jährigen einen<br />
solchen schillerschen Brocken ausgesucht hatten.<br />
Und trotzdem gab es etwas, was ich so noch nie in einer<br />
Schilleraufführung gesehen habe: Diese Schauspieler<br />
wurden beim Schillersprechen rot. Sicherlich<br />
war das auch Lampenfieberröte. Immerhin standen<br />
sie mit so einem Text zum ersten Mal vor Publikum,<br />
einem Publikum, das aus nichts als Verwandten, Eltern<br />
und Lehrern bestand.<br />
Und trotzdem hatte man das Gefühl, so, wie diese<br />
Jungen- und Mädchengesichter beim Schillersprechen<br />
erröteten, hatte das mit Schillers Sprache selbst<br />
zu tun, diesen so vollgepackten, sich in hin- und herwindenden<br />
Gedanken und überschlagenden Schillersätzen,<br />
die nur selten einmal mit Leichtigkeit<br />
daherkommen, die getränkt sind mit Überforderungen,<br />
denen immer ein Ringen, ja auch ein gewisses<br />
Angestrengtsein innewohnt. Nie kann man sich bei<br />
einem Schillersatz so zurücklehnen, wie man das<br />
zum Beispiel bei einem Goethesatz kann. Schillers<br />
Erhabenheit ist nicht umsonst zu haben.<br />
Das konnte man diesen 13-, 14-Jährigen auf die<br />
wunderbarste Weise ansehen. Wie gut es der schillerschen<br />
Sprache steht, wenn man dabei so erröten<br />
kann! Als entflamme diese Sprache die Gesichter der<br />
Sprechenden. Diese schillersche Sprache ist ja immer<br />
mehr als Sprache, sie ist ein Zustand, ein Zustand,<br />
der sich nie zur Eindeutigkeit einebnen lässt. In<br />
Schillers Sätzen spreizen sich oft mehrere Gefühle<br />
gleichzeitig in verschiedene Richtungen.<br />
Insgeheim freue ich mich bei jeder „Jungfrau“ immer<br />
schon auf ihren frühen Abschiedsmonolog.<br />
Er ist eine meiner Lieblingsarien. Ob ich will oder<br />
nicht, komme ich dabei immer in so eine Art Wehmutswippen:<br />
„Lebt wohl ihr Berge, ihr geliebten<br />
Triften, ihr traulich stillen Täler ...“, diesem vor innigem<br />
Trotz glühenden Text. Auf der Schulaulabühne<br />
steht ein Mädchen und fängt mit einer Stimme an zu<br />
sprechen, die so leise ist, dass sie uns alle im Saal von<br />
jetzt auf gleich zwingt, den Atem anzuhalten, damit<br />
wir sie überhaupt hören können: „Lebt wohl ihr Berge,<br />
ihr geliebten Triften, ihr traulich stillen Täler,<br />
lebet wohl ...“ Ihre Stimme zittert, dass ich fürchte,<br />
sie werde im nächsten Moment stocken, stolpern<br />
oder gleich ganz wegbleiben. Ich fürchte, sie schafft<br />
es nicht bis zum Ende. Dabei beeilt sie sich nicht<br />
einmal, durch den Text zu kommen, im Gegenteil,<br />
sie spricht mit einer ungeheuren Langsamkeit, als<br />
gäbe es eine Angst, die einen derart langsam macht,<br />
dass man es schon wieder für eine große Ruhe hal-<br />
Wie gut<br />
es der schillerschen<br />
Sprache<br />
steht,<br />
wenn man dabei so<br />
erröten<br />
kann<br />
!<br />
ten könnte. Ich habe das Gefühl, ich muss ihr helfen,<br />
so ausgesetzt wie sie dasteht, andrerseits merke ich,<br />
wie ich auf einmal, je länger dieses Mädchen auf<br />
der Bühne ihr langsames Leisesein durchhält, Angst<br />
vor mir selbst kriege, Angst, ich könnte jetzt gleich<br />
in dieser Schulaula vor allen in ein irres Gelächter<br />
ausbrechen, weil ich es kaum aushalte, wie schutzlos<br />
die da vorne steht und sich nicht einmal beeilt,<br />
nein, sie hält geradezu die Zeit an, mit ihrer die Stille<br />
drangsalierenden Stimme, während mir gleichzeitig<br />
zum Heulen ist, ein Heulen, das, wenn es herauskäme,<br />
weit schlimmer wäre als das Gelächter, weil es<br />
am Ende gar nicht mehr zu unterscheiden wäre, ob<br />
Heulen oder Lachen, in jedem Fall bodenlos, so, als<br />
wollte ich dieses Mädchen retten, indem ich die viel<br />
schlimmere Katastrophe anrichte. In meinem Mund,<br />
an der Innenseite meiner Backe, gibt es für solche<br />
Momente eine Stelle. In meinem Leben habe ich<br />
mich immer wieder in die Innenseite meiner Backe<br />
verbeißen müssen, als Kind in der Kirche, bei Beerdigungen<br />
etc. etc.<br />
Am Ende dieser Aufführung komme ich wie nur<br />
selten euphorisch, aufgekratzt vor lauter Erleichterung<br />
aus dem Theater heraus, als hätte ich etwas<br />
überstanden, was nicht alltäglich ist. Und je weiter<br />
dieser Abend zurückliegt, desto mehr will mir scheinen,<br />
dass ich kaum einmal einer Theaterfigur derart<br />
schutzlos ausgesetzt gewesen bin wie diesem Schillermädchen<br />
auf der Schulaulabühne.<br />
Theresia Walser, 1967 in Friedrichshafen geboren, ist<br />
ausgebildete Schauspielerin und schreibt seit 1997<br />
Theaterstücke, von denen fünf in Mannheim uraufgeführt<br />
wurden, zuletzt die Diktatorengattinnen-Talkshow<br />
„Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“. In der kommenden<br />
Spielzeit ist sie Hausautorin am Nationaltheater<br />
Mannheim.<br />
8 massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong>
eine maKrele macht<br />
nOch keine reVolution!<br />
ÜBer die temporÄre DaSeinSForm deS groSSStadtdeMoNStraNteN<br />
„Wat woll’n die machen!?“, brüllte ich fragend in<br />
den Bildschirm meines Laptops. Teile der East Side<br />
Gallery, des längsten noch verbliebenen Stücks der<br />
Berliner Mauer, sollten umgesetzt werden? Für eines<br />
dieser unnützen Bauvorhaben? „So geht das<br />
aber nicht!“ Ich folgte dem empörten Ruf, der laut<br />
durch alle Social-Media-Kanäle hallte, und fand<br />
mich plötzlich an der East Side Gallery wieder. Von<br />
überall kamen unzählige Großstadtdemonstranten<br />
im Strom des urbanen Mitbestimmungsbestrebens<br />
herbeigeschwommen. Ich gesellte mich zu ihnen<br />
und badete genussvoll in der kollektiven Entschlossenheit<br />
innerhalb dieses wunderschönen, glitzernden<br />
Schwarms.<br />
Mit Flatterband von der Berliner Polizei zusammengehalten,<br />
blickten wir auf die andere Seite der Straße,<br />
wo sich ein Bauarbeiter unter der permanenten<br />
Beobachtung der Anwesenden mit seinem schweren<br />
Gerät abmühte. Aber warum standen wir hier<br />
und nicht dort, wo das passierte, was uns so wütend<br />
machte? Ein Blick nach links. Ein Blick nach rechts.<br />
Ein Griff zum Flatterband. Und schon rannte ich mit<br />
meinen Protest-Freunden an den verdutzten Polizeibeamten<br />
vorbei über die stark befahrene Mühlenstraße.<br />
„Für einen anderen Umgang Berlins mit<br />
der eigenen Geschichte! Für mehr Beteiligungsmöglichkeiten<br />
bei der Gestaltung der Stadt! Für mehr<br />
Freiräume! Für gerechtere Mieten!“, so schallte es<br />
durch den Schwarm. Ich genoss dieses Gefühl einer<br />
diffusen Zusammengehörigkeit. Wir trillerten, wir<br />
pfiffen, tanzend vertrieben wir uns die Zeit. Oh, ich<br />
freudestrahlende Makrele im erfrischenden Ozean<br />
urbaner Proteste!<br />
Doch bei aller kollektiven Fröhlichkeit, die den<br />
Schwarm umgab, es blieb ein fader Nachgeschmack.<br />
Da gab es diese kleine Spießbürgerin in mir, die bei<br />
jedem Regelbruch laut aufschrie. Über zweieinhalb<br />
Jahrzehnte wurde ich gedrillt, so unauffällig wie<br />
möglich zu sein und ein solches Verhalten zu vermeiden.<br />
Ich haderte mit mir und meinem Dasein als<br />
aufrührerische Großstadtmakrele. Was mache ich<br />
hier eigentlich? Warum renne ich über eine befahrene<br />
Straße, schreie Polizisten an und wedle wütend<br />
mit der Faust? Das subversive Potential meines Handelns<br />
erschien mir eher als Moment der Störung in<br />
Bezug auf mein anerzogenes Verständnis von gesellschaftlichem<br />
Miteinander und Regelkonformität.<br />
Aber die Kraft der Vielen, die Macht des Schwarms<br />
hatte mich irgendwie dazu verführt, meine Ängste<br />
zu besiegen, Flatterbänder zu durchreißen und Gehwege<br />
zu besetzen. Ein verheißungsvolles Versprechen<br />
der Sicherheit und der Solidarität umhüllte das<br />
protestierende Schwarmkollektiv im Moment des<br />
zivilen Ungehorsams. Sanft wiegte ich in der Bewegung<br />
des Schwarms hin und her und genoss im Kreis<br />
der Vielen den Rausch der eigenen Courage.<br />
Die FaSzination bleibt<br />
Doch da war auch so ein dumpfes Gefühl, nicht<br />
Frau der eigenen Entscheidungen gewesen zu sein.<br />
Wer oder was bestimmte hier eigentlich? Dachte<br />
ich überhaupt über die mögliche Tragweite meines<br />
Tuns nach? Hatte sich nicht in der Vergangenheit<br />
häufig gezeigt, was <strong>vom</strong> Denken befreite Menschen<br />
in Schwärmen zu tun in der Lage sind? Würde ich<br />
bereit sein, wesentlich gröbere Regelbrüche zu begehen?<br />
Würde es einen Zeitpunkt geben, an dem sich<br />
mein Verstand nicht mehr mahnend einmischte und<br />
ich meine Entscheidungsfähigkeit komplett an den<br />
Schwarm delegierte?<br />
Noch bevor ich mir Klarheit über mein Dasein als<br />
Protest-Makrele verschaffen konnte, verkündete die<br />
„freundliche Berliner Polizei“ aus dem Wagen heraus,<br />
dass die Bauarbeiten vorerst gestoppt seien. Auf<br />
dieses Signal hin zerstoben meine neu gewonnenen<br />
Freunde wieder in alle Himmelsrichtungen. Der<br />
zeitgenössische Protest-Schwarm<br />
zeichnet sich anscheinend<br />
durch einen schnellen Zerfall<br />
und ein hohes Maß an<br />
Instabilität aus. In diesen<br />
Augenblicken erscheint<br />
die Verlockung des unverbindlichen<br />
Zusammengehörigkeitsgefühls<br />
und der<br />
kollektiven Solidarität beinahe<br />
als trügerische Fata<br />
Morgana. Doch ungeachtet<br />
aller Zweifel und der Erinnerung<br />
an diese unheimliche,<br />
geradezu gefährliche Kraft, die<br />
den Schwarm zum Handeln bewegen<br />
kann: Die Faszination für dieses temporäre Dasein<br />
als Protest-Makrele, für den Schwarm, bleibt.<br />
Doch eine Makrele macht noch keine Revolution.<br />
Und so lohnt es sich, mit offenen Augen weiterzuschwimmen.<br />
Denn es könnte, wenn wieder jene kritische<br />
Masse erreicht ist, jeden Moment ein neuer<br />
kraftvoller Schwarm entstehen, dessen Glitzerkraft<br />
diese Welt zu einer besseren machen kann. Wenigstens<br />
für einen kurzen Moment.<br />
Carolin meyer<br />
ich<br />
GenOss dieses<br />
geFÜhl<br />
eineR<br />
DiFFuSen<br />
zusAMMenGehöRiGkeit.<br />
maSSenmeDium # 04/ <strong>28.</strong> <strong>juni</strong> <strong>2013</strong><br />
9
in der Heimat arbeiten<br />
Sie sind Schauspieler, Performer und Regisseure. Feïçal Bang’Na und Seyram<br />
Agbalekpor-Doudjih kommen aus dem westafrikanischen Togo, studieren dort<br />
Germanistik und nehmen am Stipendiatenprogramm der Schillertage teil<br />
Seyram Agbalekpor-Doudjih und Feïçal Bang’Na<br />
Kann man von der Kunst bzw. der Schauspielkunst leben?<br />
FB: Von traditioneller togolesischer Kunst kann man<br />
das ganz gut, aber Theaterleute müssen nebenher<br />
Geld verdienen.<br />
SD: Deshalb gehen auch so viele Künstler erst einmal<br />
ins Ausland. Es gibt wenig Zuschüsse für das Theater.<br />
Wenn man sich schon einen Namen gemacht hat, ist<br />
es leichter, Sponsoren zu finden. Viele Unternehmer<br />
nutzen so ein Theaterstück, um in eigener Sache Werbung<br />
zu machen. Anfänger haben kaum eine Chance.<br />
Wie steht es in der Republik Togo mit der Redefreiheit? Dürfte<br />
ein „Wilhelm Tell“ zum Beispiel regierungskritisch sein?<br />
FB: Heute auf jeden Fall. Togo ist eine demokratische<br />
Republik, und man spricht auch über heikle Themen,<br />
demonstriert. Vor zehn Jahren sah das anders aus. Da<br />
war das tabu. Es stand unter Strafe, die Regierung zu<br />
kritisieren.<br />
SD: Das nennt sich dann Demokratur. Unser jetziger<br />
Präsident, Faure Gnassingbé, hat sein Amt <strong>vom</strong> Vater<br />
geerbt.<br />
Das Gespräch führten Carmen Bauer und Franziska Weber<br />
Togo stand nach dem ersten Weltkrieg unter französischem<br />
Protektorat, Französisch ist auch heute noch Amtssprache.<br />
Wie kommt man da auf die Idee, Germanistik zu studieren?<br />
Feïçal Bang’Na: Ich habe bereits in der Schule<br />
angefangen, Deutsch zu lernen. 2008 konnte ich<br />
mit einem DAAD-Stipendium schon einmal nach<br />
Deutschland kommen und habe vor allem sprachlich<br />
profitiert. Nach dem Abitur hätte mein Vater sich gewünscht,<br />
dass ich Jura studiere, aber mit meinen guten<br />
Deutschkenntnissen konnte ich ihn von meinem<br />
Wunschstudium Germanistik überzeugen. An der<br />
Uni liegt mein Fokus allerdings auf Kulturwissenschaft.<br />
Wir lesen natürlich auch ein bisschen Schiller,<br />
ein bisschen Goethe, aber die tatsächliche Analyse ist<br />
den Literaturwissenschaftlern vorbehalten. Außerdem<br />
helfe ich manchmal im Goethe-Institut in Lomé<br />
aus. Dort habe ich zufällig auch erfahren, dass es am<br />
Mannheimer Nationaltheater die Schillertage gibt.<br />
Was fasziniert euch an einem Klassiker wie Schiller?<br />
FB: Ich interessiere mich vor allem für sein Leben,<br />
seine Schriften. Seine Literatur ist so vielschichtig.<br />
Mein Lieblingsstück ist „Die Räuber“. Bei den Schillertagen<br />
habe ich nun das erste Mal die Gelegenheit,<br />
es auf der Bühne zu sehen. Es würde mich reizen, das<br />
Stück in Afrika zu inszenieren, obwohl die Sprachbarriere<br />
ein Hindernis ist. Aber mit einer guten<br />
Inszenierung könnte man Interesse wecken. Möglicherweise<br />
müsste man sich einer französischen<br />
Übersetzung bedienen und einheimische Tänze und<br />
Lieder einbauen, es afrikanisieren.<br />
Es ist heute euer zweiter Tag beim Schiller-Festival. Wie waren<br />
eure Eindrücke? Was erhofft ihr euch von eurem Stipendium?<br />
FB: Es ist sehr interessant. Allerdings sind die anderen<br />
Teilnehmer in meinem Seminar alle Deutsche. Wenn<br />
Dr. Setton in seinem Seminar „Politik der Imagination“<br />
etwas erklärt, geht mir das noch zu schnell. Auf<br />
jeden Fall ist es eine gute Gelegenheit, mein Deutsch<br />
zu verbessern. Ich hoffe, in Zukunft in meiner Heimat<br />
arbeiten zu können und dort die Theaterlandschaft<br />
mit dem hier Gelernten auszubauen. Vielleicht<br />
würde dann die Regierung Geld investieren, und das<br />
Theater würde endlich vorankommen.<br />
Wie sieht die Theaterlandschaft in Togo aus?<br />
FB: Es gibt ein Nationaltheater. Allerdings ist es mit<br />
nur fünfzig Mitarbeitern ziemlich klein. Die erste<br />
Anlaufstelle für Theaterprojekte ist das Kultusministerium,<br />
aber mehr als moralische Unterstützung<br />
können sie dort oft nicht leisten. Erklärte Förderer<br />
des Theaters sind vor allem das Goethe-Institut, das<br />
Institut Français und viele kleinere private Förderer.<br />
Meistens funktioniert Theater überhaupt nur durch<br />
Mundpropaganda. Bevor ein Stück mehrmals aufgeführt<br />
werden kann, braucht man die Unterstützung<br />
der Masse. Aber dazu kann Seyram mehr sagen. Er<br />
war mein Regisseur, als ich zum ersten Mal auf der<br />
Bühne stand.<br />
Seyram Agbalekpor-Doudjih: Ich arbeite eigentlich<br />
als Schauspieler am Nationaltheater. Anders als hier<br />
gibt es keine fest angestellten Autoren oder Dramaturgen.<br />
Erst vor Kurzem brachten wir ein Stück von<br />
Kevin Rittberger auf die Bühne. Für solche Produktionen<br />
haben wir aber kein festes Schauspielhaus.<br />
Wir hatten Glück und konnten es zweimal aufführen.<br />
Wenn wir es finanzieren können, gehen wir auf<br />
Tour durch Togo und ins angrenzende Benin.<br />
zwei<br />
Welten<br />
Ich heiße Carmen. Das<br />
kann man übersetzen mit:<br />
Gedicht. Als Gedicht in<br />
einer Familie von Kriegern<br />
und Heiligen machte mich meine literarische<br />
Neigung zu einer unberechenbaren Fremden. Als<br />
ich aus der bunt schillernden Welt der Literatur<br />
trat und umringt von schwarzen und weißen<br />
Figuren ins grelle Licht der Realität blickte, begann<br />
ich, in zwei Welten zu leben. Während ich Anna<br />
Karenina zum Bahnhof begleitete oder mich auf die<br />
Suche nach der verlorenen Zeit begab, schlüpfte ich<br />
in der echten Welt in immer andere Rollen: die<br />
Tochter, die Freundin, die Studentin, die Praktikantin,<br />
die Zuschauerin. So gehörte ich immer einer<br />
Gruppe an; je nach Rollenbeschreibung und Label<br />
wurde ich entweder in diesen Club aufgenommen<br />
oder ausgeschlossen. Wann hat man aufgehört, den<br />
Menschen zu sehen, und begonnen, nur seine Rolle,<br />
seine gesellschaftliche Funktion, seine Nützlichkeit<br />
wichtig zu nehmen? Mein Fluchtort wurde das<br />
Theater. Es hob die Grenzen von Realität und<br />
Illusion für kurze Zeit auf und machte mich zum<br />
Menschen.<br />
Carmen Bauer<br />
10 massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong>
Kahler König Ewigkeit<br />
Ewald Palmetshofers „räuber.schuldengenital“<br />
Therese Affolter, Sarah Viktoria Frick und Philipp Hauß<br />
Irgendwann hat die Sache einen Knacks gekriegt. Da<br />
war plötzlich ein Sprung in der Schüssel, der Wurm<br />
in der Frucht, das Haar in der Suppe, das Rad lief<br />
nicht mehr rund. Ins gemütliche Leiern des Wirhatten-ja-nichts-es-gab-ja-nichts<br />
und Ihr-habt-dochalle-Möglichkeiten<br />
und Ihr-seid-in-Frieden-aufgewachsen<br />
hat sich ganz unmerklich ein schleichendes<br />
Kratzen eingeschrieben, ein Unbehagen; das war<br />
erst ganz leise, man konnte es gar nicht verstehen.<br />
Ich-kann-mich-nicht-entscheiden glaubte man zu<br />
hören, ich-will-mich-nicht-entscheiden hat es wohl<br />
gemurmelt, es-ist-egal-wofür-ich-mich-entscheide<br />
wurde es laut und lauter, schließlich hat es WOHIN?<br />
WOHIN? WOHIN? UND DANN? geschrien. Da hat<br />
der Chor eingesetzt, ein riesiger, mächtiger, gewaltiger<br />
Chor, ein Chor der lebenden Ahnen, der faltigen<br />
Alten, der reichen Kranken, der Alzheimer-, Windel-,<br />
Rollatorsoldaten, und gemurmelt haben die,<br />
aber ihr Gemurmel war viel lauter als das Gezeter<br />
nach der verlorenen Zukunft. Und die Jungen, die<br />
nicht wussten, wohin mit sich und ihren Talenten,<br />
die jeder hat, und ihren Möglichkeiten, die jeder hat,<br />
und ihren Chancen, die keine mehr sind, sind einfach<br />
untergegangen, sang- und klanglos abgetaucht<br />
im schreienden Gemurmel des riesigen Chors, und<br />
da sind sie nun und rödeln und schieben Rollstühle<br />
und Nachttöpfe und wissen, dass sie eigentlich alles<br />
haben und nichts mehr kriegen wollen können. Ganz<br />
ohne Pauken und Trompeten haben sie sich verloren,<br />
sind einfach durchsichtig und leer geworden, und ihre<br />
Stimme ist verpufft, und sie wuseln jetzt da irgendwo<br />
rum. Kein Stürmen und Drängen, kein Schwören und<br />
Fluchen, keine Rebellion gegen die schlappen Kastraten<br />
oder gegen Konvention und Gesetz, sondern einfach<br />
nur verhallt, eingemeindet, zu Brei püriert.<br />
Konturlose<br />
Katastrophe<br />
Was für ein Vorgang. Eine Tragödie. Ohne Intrige,<br />
ohne Peripetie zwar, dafür umso schmerzlicher: konturlose<br />
Katastrophe ohne Anfang, ohne Ende, ohne<br />
Ziel, ohne Held. Ich kann nicht verstehen, warum einige<br />
Kritiken zur Uraufführung von Ewald Palmetshofers<br />
„räuber.schuldengenital“ am Wiener Burgtheater<br />
bekunden, mit Schillers Räubern habe der<br />
Text des österreichischen Dramatikers „allenfalls<br />
auf abstrakter, fernster Ebene“ zu tun. Kameraden!<br />
Was erzählen sie denn, diese räubernden Brüder, die<br />
von ihren misstrauisch verbarrikadierten Erzeugern<br />
„heut’ das Geld der Zukunft schon“ fordern, um das<br />
man sie, wie um die Hoffnung und die Liebe („die is<br />
schon lange tot, die blöde Sau“), gebracht hat? Was<br />
heißt es denn, wenn Franz und Karl vor ihrem notgeilen<br />
Thronhocker von Vater bekennen: „wir glauben<br />
euren Zahlen, Resultaten, eurer Rechnung“ und<br />
resigniert ihre Namen ins morsche Holz ritzen? Und<br />
was geschieht da, wenn der ach so siegessichre Alte<br />
in einem gespenstischen Monolog den „kahlen König<br />
Ewigkeit“ beschwört, der „sitzt und sitzt und sitzt<br />
und sitzt“? Kaum eine andere Sprache, mag sie noch<br />
so archaisch, naiv und grob daherstolzieren, könnte<br />
Schillers pathosgeladenem Versuch näherkommen,<br />
das Drängen der Jugend, ihr Sehnen nach Achtung<br />
und Liebe, ihr Aufbegehren gegen die Ordnung in<br />
revolutionär zeitgemäße Diktion zu überführen.<br />
Und kaum eine Erzählung könnte erschreckender<br />
zeigen, wie merkwürdig dieses schillersche Drängen,<br />
wie obsolet der selbstgerechte Idealismus, wie<br />
fehl am Platz der aufopfernde Glaube an das Gute<br />
heute wirken, in einer Zeit, deren „bestimmender<br />
Imperativ lautet: Lebe ohne Idee!“ Diese Epochendiagnose<br />
von Alain Badiou hat Palmetshofer seinem<br />
Stück vorangestellt. Am Samstag ist die Wiener Uraufführung<br />
von Stephan Kimmig im Mannheimer<br />
Schauspielhaus zu Gast.<br />
Laura Strack<br />
Wenn ich das gewusst hätte<br />
40 Minuten Selbstbetrachtung mit „WE“ <strong>vom</strong> Wiener Kollektiv nadaproductions<br />
Erste Reihe ist meistens kacke. Ich hatte aber keine<br />
Wahl. Jetzt sitze ich in der Performance „WE“ von<br />
„nadaproductions“ (Amanda Piña und Daniel Zimmermann)<br />
und starre auf mich selbst. Beziehungsweise<br />
auf eine Leinwand, auf die ein Live-Bild des<br />
etwa zwanzigköpfigen Publikums projiziert wird. Die<br />
Leute, die hinten sitzen, sind klein, und man sieht nur<br />
ihre Köpfe. Wir hier vorne sind mit unserem Abbild<br />
in voller Lebensgröße konfrontiert. Das Bild ist verschwommen,<br />
was die Sache aber nicht besser macht.<br />
Ich sehe gar nicht aus wie ich, denke ich. Die Frau in<br />
Rot schräg hinter mir hat dank schlechter Bildqualität<br />
einen Schatten-Schnurrbart. Es ist unangenehm. Jetzt<br />
schon. Halte ich das vierzig Minuten lang aus? Meine<br />
Nase beginnt zu jucken. Kratzen? Lieber nicht. Bloß<br />
nicht bewegen, bloß nicht auffallen. Verkrampft sitze<br />
ich da und warte, was passiert.<br />
Über einzelnen Köpfen tauchen vorgefertigte Denkblasen<br />
auf. Von wegen spontane Interaktion. „Did I<br />
turn off my phone?“ Oder: “Wenn ich das gewusst<br />
hätte …” Manche Leute lachen. Ich verziehe einen<br />
Mundwinkel. Über meinem Kopf steht: „I love it!“<br />
Ich denke: Geht so.<br />
Es gibt offenbar Engländer, Franzosen und Holländer<br />
im Publikum – zumindest soll es so aussehen.<br />
Schreibt man „difus“ nicht mit zwei f? Nach und<br />
nach bekommt jeder Zuschauer Gedankenblasen zugeordnet.<br />
Ein Bayer hat Hunger. Eine Frau fragt sich,<br />
wann die Tänzer endlich auftreten. Ein junger Mann<br />
steht auf und geht. Ich bin die, die alles geil findet.<br />
Langsam entspanne ich mich. Die Idee an sich finde<br />
ich gut. Mal mit sich selbst konfrontiert sein. Sich<br />
nicht verstecken können. Kunst ist ja auch dazu da,<br />
dass man sich aus der Komfortzone bewegt, oder?<br />
Blaues Licht geht an. Wir werden zu unscharfen<br />
Gestalten, die ein bisschen an Avatare erinnern und<br />
sehr krank aussehen. Die Scheinwerfer strahlen<br />
Hitze aus. Das Licht verschwindet wieder. Gott sei<br />
Dank. Dafür gibt es jetzt Musik. Spanische Gute-<br />
Laune-Melodien. Ich glaube, wir sollen tanzen. Ein<br />
paar Leute wippen ungeschickt hin und her. Der<br />
Herr neben mir stellt seltsame Dinge mit seinen Fingern<br />
an und freut sich – in seinen Gedankenblasen<br />
– über seine gelungene Darbietung.<br />
Dann eine Pause. Ist das nicht inkonsequent? Ein junger<br />
Mann taucht auf und versucht, Wodka und Popcorn<br />
unter die Leute zu bringen. Was soll das jetzt?<br />
Geht’s um die Kinoatmosphäre? Dass das hier kein<br />
klassisches Theater ist, hatte ich schon vorher verstanden.<br />
Irgendwie passt das alles nicht zusammen.<br />
Und vor allem: Was sagt mir das alles über das Verhältnis<br />
zwischen Individuum und Kollektiv? Wie<br />
kann ich Teil eines „WE“ werden, wenn ich mir verarscht<br />
vorkomme, weil ich nicht einmal weiß, ob<br />
die Zuschauer neben mir nicht vielleicht Performer<br />
sind? Ein Gemeinschaftsgefühl macht sich jedenfalls<br />
nicht breit. Sicher: Wir sitzen in einem Raum. Wir<br />
hören Musik. Wir werden angeleuchtet. Aber: Ich<br />
sehe mich. Und ich bin genervt.<br />
Franziska Weber<br />
massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong><br />
11
Anders, um dieses Wort muss es<br />
sich drehen<br />
Ein Gespräch mit Hans Kremer, der bei den Schillertagen König Philipp war<br />
und in „Agoraphobia“ im Freien telefoniert<br />
Hans Kremer steht seit mehr als einem Vierteljahrhundert<br />
auf der Bühne. Während der Schillertage<br />
ist der 59-Jährige in zwei sehr unterschiedlichen Produktionen<br />
zu sehen: als König Philipp im Hamburger<br />
„Don Carlos“ und in Lotte van den Bergs Produktion<br />
„Agoraphobia“. Für die Performance tauscht der<br />
Rollenschauspieler die Bühne gegen das Getümmel<br />
innerstädtischer Plätze, trifft dort auf Passanten und<br />
Zuschauer. Wer an diesem Stück teilnehmen will,<br />
ruft eine Nummer an, hört dann die Stimme Kremers.<br />
Für „Agoraphobia“ verlassen Sie den schützenden Rahmen der<br />
Bühne. Wie empfinden Sie den Wechsel?<br />
„Agoraphobia“ ist der Versuch, das Theater wieder<br />
an einen öffentlichen Versammlungsort zurückzubringen,<br />
der heute eher zum Zerstreuungsort geworden<br />
ist. Da begegnet man Menschen, die erstmal<br />
Ich bin ich, bin ich, bin<br />
ich?<br />
Ich bin ein Jedermann<br />
und ein Überall, man kann<br />
mich nicht erkennen. Ich habe irgendwann ein<br />
Gesicht gewonnen. Mein Ich und mein Gesicht<br />
beginnen langsam auszusehen. Man hat einen<br />
Namen und ein Gesicht, das sich verbürgt für mein<br />
Ich. Wer erst ein Gesicht hat, wird in die Pflicht<br />
genommen. „Nehmen Sie eine Identität an.“<br />
SOFORT, sagt Er zum Gesicht. Zu Ihrer eigenen<br />
Sicherheit wird dieser Bahnhof videoüberwacht.<br />
Anonymität ist die Maske von Tätern. Nein, ich bin<br />
keine Person, ich bin ein Land, ein Volk, eine<br />
Identität in vielen. In der Gemeinschaft beheimatet.<br />
nichts davon wissen und auch gar nichts damit zu tun<br />
haben wollen. Jemanden, den man nicht kennt, anzusprechen,<br />
erfordert Mut. Das ging mir auch so. Es ist<br />
nicht einfach, mit Ablehnung oder mit einer „Bleib<br />
mir <strong>vom</strong> Leib“-Einstellung umzugehen. Auf der Bühne<br />
ist die Herausforderung dagegen, zum Beispiel einen<br />
großen Denkraum mit der Sprache von Schiller<br />
so zu denken, dass der Zuschauer in seinem Kopf die<br />
Verbindung für sich selber knüpfen kann.<br />
„Agoraphobia“ ist schon sieben Mal in München aufgeführt<br />
worden. Was für Reaktionen haben Sie konkret erlebt?<br />
Es gibt Leute, die stehen bleiben und sich das anhören.<br />
Da war auch einmal ein wunderbarer alter<br />
Mann, der hat mir zugehört und genickt, da gab es<br />
dann den Text: „Manchmal brauchst du jemanden,<br />
der dich an das erinnert, was du schon wusstest.“<br />
Der alte Mann nickte, und ich hab mich vor ihm verbeugt.<br />
Das war mal eine Zustimmung!<br />
Was sind die Vorteile der Perfomance auf öffentlichen Plätzen?<br />
Auf den Plätzen treffe ich sicher Menschen, die nicht<br />
mehr ins Theater gehen. Die begegnen dann jemandem,<br />
der sie in ihrem normalen Leben anspricht. Da<br />
wird der eine oder andere konfrontiert mit etwas,<br />
das ihn vielleicht bewegt. Selbst, wenn es nur einer<br />
ist, glaube ich auch im positiven Sinne: Der Flügelschlag<br />
eines Schmetterlings kann einen Tsunami<br />
hervorrufen. Jede Handlung, die du tust, jeder Gedanke,<br />
den du denkst, ist verknüpft mit einem Willen.<br />
Mit uns muss es beginnen. Was wir tun, was wir<br />
denken und ob wir es im Einklang mit der Welt tun,<br />
Ich und Wir und Du und Ich, Er kann mir nichts, ich<br />
bin in der Überzahl. Mitten drin, mein Ich ohne<br />
Anker, ohne Sinn. Kein Boden um zu stehen. Ich<br />
vergebe meinen Kopf an die vielköpfige Hydra. Ich<br />
stolperte durch den Bauch dieses Untiers, das mich<br />
verschlang mit Haut und Haar, als ich Ausschau<br />
nach mir hielt. Sie ist omnipräsent, aber unsichtbar.<br />
Es ist da etwas, das durchdringt alles, und alles<br />
durchdringt es, das unsterbliche Etwas, das jeden<br />
Tag stirbt, das jeden Tag reift, nach allem greift,<br />
dass mit jedem neuen Etwas alle anderen begreift.<br />
So ist das in Gruppen, man beeinflusst sich.<br />
Irgendwann weiß ich nicht mehr, ist das mein<br />
Gesicht? „Es sind zu viele.“ Ich muss einhalten,<br />
verschwinden, stehenbleiben. Wer stehenbleibt,<br />
macht wie ein fester Punkt die Bewegungen der<br />
anderen sichtbar. Anonymität ist die Maske von<br />
Tätern.Siehst du in mein Gesicht, siehst du nur dein<br />
Gesicht.<br />
Lena Fiedler<br />
kann etwas bewirken, das die Welt ändert.<br />
Macht die Performance das klassische Theater überflüssig?<br />
Das glaube ich auf keinen Fall! Theater muss nichts<br />
leisten. Es ist immer Teil des Ganzen und der Gesellschaft.<br />
Als Versammlungsort reflektiert es Strömungen<br />
und Bewegungen, die in der Gesellschaft<br />
passieren. Da gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten,<br />
Geschichten zu erzählen; über Geschichte zu erzählen,<br />
um unsere heutige Zeit durchschaubarer zu<br />
machen. Geschichte besteht aus Schichten, die übereinander<br />
liegen, wo sich die eine aus der anderen entwickelt<br />
hat. Es gilt, in den Texten aus der Geschichte,<br />
die aufgehoben sind, also dem, was Schiller oder<br />
Büchner notiert haben, die Partitur oder Notatur zum<br />
Klingen zu bringen. Sie ernst zu nehmen und daraus<br />
im Austausch mit dem Publikum für das eigene Handeln<br />
im Jetzt Erkenntnisse zu gewinnen. Um dann zu<br />
sagen: Ich sehe, dass alles auch anders sein kann.<br />
Gibt es etwas in ihrem Rollentext, mit dem sie sich besonders<br />
identifizieren können?<br />
Zunächst gehört es zu meinem Beruf, Figuren glaubhaft<br />
zu machen, auch wenn ich mich nicht inhaltlich<br />
hinter sie stellen kann. Aber es gibt eine Stelle in<br />
„Agoraphobia“, da fängt der Protagonist an, Leute<br />
anzusprechen. „Stimmt es, dass man Zorn immer<br />
mit Zorn heimzahlt?“ Das ist etwas, wovon ich völlig<br />
überzeugt bin: dass Aggression und Gewalt in jeglicher<br />
Form nur Gegengewalt evozieren. So schaukelt<br />
es sich hoch. Ich denke, die einzige Lösung in einem<br />
Zeitalter des Materialismus, der mehr und mehr zu<br />
einem Ende kommen muss und wird, ist, die Gewaltlosigkeit<br />
in jeder Beziehung zu suchen. Ein zentraler<br />
Satz im Stück ist auch: „Was wir brauchen, ist eine<br />
Revolution, eine Revolution des Gefühls, eine geistige<br />
Revolution. Eine Involution. Anders. Anders denken.<br />
Anders, um dieses Wort muss es sich drehen.“<br />
Am Montag sind Sie hier bei den Schillertagen in „Don Carlos“<br />
als Karls Vater Philipp aufgetreten – vor langer Zeit waren sie<br />
schon mal in Mannheim in dem Stück zu sehen, richtig?<br />
Ja, lustigerweise bin ich hier schon mal gewesen, das<br />
war im Januar 1985. Da gab es eine „Don Carlos“-Inszenierung<br />
von Alexander Lang aus den Münchner<br />
Kammerspielen, in der ich noch Carlos gespielt habe.<br />
Das ist der Lauf der Zeit. Man durchläuft verschiedene<br />
Phasen. Das entspricht dann den Erfahrungen<br />
und dem Leben, das ich einbringen kann. Aber es<br />
gibt immer wieder neue Erfahrungen, wie „Agoraphobia“.<br />
Ich freue mich, dass ich geistig und körperlich<br />
so offen sein kann, mich darauf einzulassen.<br />
Und so soll es auch bleiben.<br />
Das Gespräch führten Lena Fiedler und Florian Naumann.<br />
12 massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong>
Mitmachen<br />
erlaubt!<br />
Die Filmreihe „SchmeiSS dein Ego weg!“ im Cinema<br />
Quadrat reflektiert die Idee des individuellen Lebensentwurfs<br />
und die Gründung von Gegengesellschaften<br />
Spielfeldrand<br />
Sportunterricht. Völkerball.<br />
Jede Mannschaft wählt ihre<br />
Spieler, bis nur noch eine<br />
Person übrig ist: Ich,<br />
zwölfeinhalb, übergewichtig,<br />
unkoordiniert, plump. Die Anderen, interessiert<br />
am Mannschaftssieg. Kurz waren wir alle gemeinsam<br />
auf dem Spielfeld, dann habe ich mich absichtlich<br />
vor den Ball geworfen, was den Superlativ<br />
meiner Sportlichkeit erforderte. Glücklicherweise<br />
konnten die anderen ganz gut zielen. Den weiteren<br />
Spielverlauf verfolgte ich <strong>vom</strong> Spielfeldrand und<br />
stellte mir vor, wie es wäre, teilnehmen zu können.<br />
Schnittig dem Ball ausweichen, im Ballbesitz die<br />
Verantwortung für den Sieg der Mannschaft<br />
aushalten und dann den Ball über Körpersprache<br />
kommunizierend an einen anderen Mitspieler<br />
abgeben. Sich seiner Position im Spielfeld und des<br />
Bezugs zu den Anderen bewusst zu sein. Mitspielen<br />
zu können. Paradoxerweise war ich gefühlt mehr<br />
Teil des Teams, wenn ich völlig funktionslos am<br />
Rand stand. Nur noch für mich selbst verantwortlich<br />
und sehr darauf konzentriert, nicht durch einen<br />
dummen Zufall wieder Teil des Spielgeschehens<br />
und einer Mannschaft zu werden, die sich über<br />
Eigenschaften definiert, die in meiner Person total<br />
negiert werden. Zweimal in meiner gesamten Schulsportmisere<br />
habe ich den Ball gefangen. Einmal<br />
getroffen – den Kopf eines hoch qualifizierten<br />
Mitspielers. Die Reaktion auf diesen Jackpot war,<br />
dass mir das Recht auf menschliche Mitspieler<br />
entzogen wurde und ich von da an alleine gegen die<br />
Hallenwand spielen musste. Gewonnen habe ich<br />
nie.<br />
Judith Engel<br />
Empire me<br />
Eine Bohrinsel, unfruchtbares Land im Outback<br />
Australiens, phantastische Schiffsburgen im Canale<br />
Grande und ein anarchischer Kleinstaat am tristen<br />
Stadtrand Kopenhagens. Settings für Sealand, Hutt<br />
River, Damanhur, ZeGG, Christiania und Swimming<br />
Cities. Fünf sehr verschiedene Mikronationen, eine<br />
Idee. Was geschieht, wenn Menschen sich nicht<br />
mehr bestehenden Systemen unterwerfen möchten,<br />
sich selbst verwalten und einen Staat gründen?<br />
Muscheln fischende Prinzen, Liebesjünger, antikapitalistische<br />
Clowns und indirekt auch Schiller. Die<br />
Frage nach dem besseren Staat und der Wunsch nach<br />
Freiheit sind zentrale Themen seines Werks.<br />
Was aber, wenn alle Wilhelm Tells die Armbrust<br />
hinwerfen und die Bühne verlassen, genug davon haben,<br />
das Nachdenken über Freiheit auf der Bühne zu<br />
verhandeln? Was, wenn aus Spiel Realität wird? Die<br />
Dokumentation „Empire me – der Staat bin ich“ von<br />
Paul Poet ist der letzte Film in der Reihe „Schmeiß<br />
dein Ego weg“, mit der das Cinema Quadrat die<br />
Schillertage begleitet. „Empire me“ zeigt fünf der<br />
zahlreichen Möglichkeiten, über einen optimalen<br />
Staat nachzudenken. So unterschiedlich die Herangehensweisen<br />
auch sind, sie teilen alle die Aura des<br />
menschlichen Unvermögens, dieser gewaltigen Aufgabe<br />
gerecht zu werden.<br />
Es sind kurze Sequenzen, die einen immer tiefer in<br />
den Kinosessel rutschen lassen. Verantwortlich ist<br />
nicht zuletzt die musikalische Dramatik. Theatralisches<br />
Orchesterbrausen, wenn der Prinz des Bohrinselfürstentums<br />
auf Muschelfang alleine übers graue<br />
Meer schaukelt und Freiheit plötzlich nach Einsamkeit<br />
aussieht. Dumpfes Schwappen des Ozeans, das<br />
wie eine akustische Analogie zum kalten Neonlicht<br />
ins Innere des Kraftraums von Sealand dringt. Einem<br />
heruntergekommenen Ort mit speckig glänzenden<br />
Wänden und dem Geruch von Öl und Fisch. „Isn’t it<br />
beautiful?“ fragt sich der Fürst des Drei-Mann-Staates<br />
mehr selbst als den Zuschauer.<br />
esoterisches<br />
Disneyland<br />
Marschmusik für den Präsidenten von Hutt River,<br />
dessen einzige Utopie darin besteht, Monarchie mit<br />
sich selbst als Gekröntem zu leben. Inklusive königlicher<br />
Briefmarke und Nationalhymne. Pflanzengesänge<br />
untermalen den Exkurs ins „esoterische Disneyland“<br />
Damanhur, wie es von einer der tausend<br />
Bewohnerinnen bezeichnet wird. Sie hat sich aus<br />
der Wüste Nevadas hergependelt, ist Feuerzeichen<br />
gefolgt und jetzt zufriedenes Mitglied der Klasse C.<br />
An diesem Punkt schwindet die kunterbunte, selbstgetöpferte<br />
Kulisse. In Damanhur wurden nicht die<br />
Spielregeln, sondern nur die Kostüme geändert.<br />
Man muss sich qualifizieren, um aufzusteigen. Bildungsprogramme<br />
zur Einswerdung mit dem Kosmos<br />
durchlaufen, und wenn einem das reaktionäre Prin-<br />
zip von Kategorisierung aufstößt, eine Chakrenreinigung<br />
durchführen lassen. Wem das nicht hilft, der<br />
ist vielleicht in ZeGG, einem ehemaligen Stasistützpunkt,<br />
an dem heute die Liebe regiert, besser aufgehoben.<br />
Liebe im Sinne einer alles umschlingenden<br />
Sexualität. Eine Liebe, die mit säuselnder Stimme<br />
von der Ursuppe, der Sehnsucht nach der orgastischen<br />
Auflösung des Selbst erzählt, während sich<br />
die Mitglieder wie kringelnde Maden nackt und ölig<br />
dem kollektiven Höhepunkt nähern.<br />
Da sind aber nicht nur Makroaufnahmen nackter<br />
Haut, die Masse stöhnender Körper, sondern auch<br />
die Frage danach, was wirklich anders ist in dieser<br />
utopischen Gesellschaft, in der das Diktat der Liebe<br />
so abstoßend wirkt wie der kapitalistische Befehl zu<br />
konsumieren. Zwang zur Funktion hat viele Gesichter.<br />
In einer letzten Szene schwimmen futuristische<br />
Floßburgen durchs nächtlich erleuchtete Venedig.<br />
Es ist der Endpunkt der Reise von „Swimming Cities<br />
of Seremissima“, die als Utopie auf Zeit konzipiert<br />
waren. Die bunte Besatzung, Künstler und selbsternannte<br />
Entdecker im Neuzeitpiratenlook, haben<br />
ihre Ray-Ban- Brillen abgenommen und schauen ratlos<br />
auf die vorbeiziehenden historischen Fassaden.<br />
Kann man ablegen, was einen Jahrhunderte lang geprägt<br />
hat? Morgen betreten sie wieder festen Boden.<br />
Die Frage nach der Möglichkeit einer besseren Welt<br />
bleibt unbeantwortet.<br />
Judith Engel<br />
massenmedium # 04/ <strong>28.</strong> Juni <strong>2013</strong> 13
schilleRs magenmeDizin<br />
MaNNheiM iSt verdaMMt Stolz auf ihN. daS theater richtet ihM eiN feStival auS uNd BedrucKt<br />
Zu SeiNeN ehreN ZahlloSe t-ShirtS Mit FragWÜrDigen Fragen. will MaN aBer die wahre<br />
geSchichte ÜBer Schiller uNd MaNNheiM erfahreN, MuSS MaN weit geN weSteN fahreN<br />
Nach, ja genau, Ludwigshafen. In den rheinfernen<br />
Ortsteil Oggersheim, genauer gesagt. Eine gute<br />
halbe Stunde Fahrt auf einem weiß auf schwarz<br />
bedruckten Schillerrad. Auf dem brachialen Betonkonstrukt<br />
der Konrad-Adenauer-Brücke über den<br />
Mannheimer Hafen und den Rhein hinweg und<br />
dann durch die Ludwigshafener Innenstadt. Über<br />
aufgeplatzten Asphalt, vorbei an Schrottplätzen und<br />
krautumwucherten Plattenbauten.<br />
Bis in den Oggersheimer Ortskern. Dort steht ein<br />
Schillerhaus, in dem Schiller wirklich gewohnt hat.<br />
Was in Mannheim „Schillerhaus“ heißt, ist nämlich<br />
nur ein ehemaliges Nachbarhaus. In Oggersheim<br />
trägt den Namen ein zweistöckiges ehemaliges Gasthaus,<br />
das heute auch die Bücherei beherbergt, die<br />
„Bischerei“, wie die Einheimischen den Weg weisen.<br />
Im kleinen Museum empfangen Senioren <strong>vom</strong> Heimatkundlichen<br />
Arbeitskreis Oggersheim den Besucher.<br />
„Sie kennen die Geschichte von Schiller, nehme<br />
ich an?“, sagt Klaudia Göbel.<br />
Dann legt sie doch los. Schiller, so in etwa lautet die<br />
Geschichte, war 1782 auf der Flucht vor dem Herzog<br />
von Württemberg und hoffte auf Geschäfte mit dem<br />
Mannheimer Nationaltheater. Der vielgepriesene<br />
Intendant Dalberg aber dachte gar nicht daran, den<br />
verarmten Dichter generös zu unterstützen. Also<br />
tauchte der enttäuschte Schiller zusammen mit seinem<br />
Freund Streicher sieben Wochen im Oggersheimer<br />
„Viehhof“ unter. Wirklich verbunden fühlte er<br />
sich dem Schauspielhaus damals nicht: „Mannheim<br />
ist schlechterdings keine Atmosphäre für mich“ und<br />
„beim Theater Dienst zu nehmen ist nicht nur unter<br />
meinem Plan, sondern auch wirklich schwer, weil es<br />
sehr erschöpft ist, verarmt und sinkt“, schrieb Schiller<br />
an einen Freund.<br />
Schillers Stube im Viehhof gibt es heute noch zu sehen.<br />
Knapp zwölf Quadratmeter, mittlerweile allerdings<br />
mit Schaukästen und Neonlicht ausgestattet.<br />
„Die originalen Möbel sind weggegeben worden,<br />
aber das Zimmer ist das gleiche“, berichtet Göbel.<br />
„In einem blauen Bett haben Schiller und Streicher<br />
gemeinsam geschlafen. Wenn ich das erzähle, lachen<br />
die Schulklassen. Aber so war das eben damals.“<br />
Von FremDen leuten<br />
nicht VergeSSen<br />
Schiller hat Spuren in Oggersheim hinterlassen. An<br />
„Fiesco“ und „Kabale und Liebe“ hat er hier gearbeitet.<br />
Und das kleine Schillerhaus besitzt „mindestens<br />
genauso viele Erst<strong>ausgabe</strong>n wie Marbach und Weimar“,<br />
betont Göbels Kollege Manfred Wendel. Der<br />
lokale Sammler Karl Schenkel habe sie 1949 erstanden.<br />
Einen handgeschriebenen Brief Schillers gibt es<br />
zu bestaunen, und, man höre und staune, ein Originalrezept<br />
für die Magenmedizin des Dichters. Alles<br />
fein säuberlich in Vitrinen verwahrt. Nach ein paar<br />
Wochen reiste Schiller ins Thüringische Bauerbach<br />
ab. Oggersheim behielt er in guter Erinnerung: „In<br />
dem Wirtshaus, wo ich im vorigen Jahr 7 Wochen gewohnt<br />
habe, bin ich auf eine Art empfangen worden,<br />
die mich recht sehr gerührt hat. Es ist etwas freudiges<br />
von fremden Leuten nicht vergessen zu werden“,<br />
schreibt er 1783 an Henriette von Wolzogen.<br />
Den Brief hat Bayerns König Ludwig I. in eine Gedenktafel<br />
am Haus meißeln lassen. Eine andere<br />
Straße zwischen Oggersheim und Mannheim ist<br />
die Mannheimer Allee. „Das war schon damals eine<br />
Allee, da ist Schiller im Schutz der Dunkelheit zum<br />
Nationaltheater marschiert“, berichtet Göbel. Erfolg<br />
habe ihm der Fußmarsch allerdings nicht gebracht:<br />
„Die Schauspieler haben bei Schillers Präsentation<br />
reihenweise den Saal verlassen. Und warum? Weil<br />
er schwäbisch geschwätzt und ihn keiner verstanden<br />
hat.“<br />
Die Oggersheimer aber verstehen die Bedürfnisse<br />
von Besuchern aus fernen Landesteilen. „Wenn Sie<br />
eine Führung durch Oggersheim wollen, melden Sie<br />
sich einfach“, sagt Wendel. „Und jetzt gehen Sie am<br />
besten ein Bier trinken.“ Nebenan steht eine Brauerei.<br />
Die habe es zwar zu Schillers Zeiten noch nicht<br />
gegeben, braue aber gutes Bier.<br />
florian naumann<br />
Mein<br />
beDÜrFniS<br />
und stReben ist, Aus<br />
weniGeM<br />
Viel<br />
zu machen<br />
SCHILLER, „ÜBER DAS ERHABENE“<br />
14 maSSenmeDium # 04/ <strong>28.</strong> <strong>juni</strong> <strong>2013</strong>
veRschMelzunGsVerSuch # 04<br />
Die Suche nach anziehungSKrÄFten<br />
ZwiScheN deN teilcheN<br />
Wir sind neun Massepunkte, neun Menschen, die<br />
sich unabhängig voneinander durch die Welt bewegen.<br />
Normalerweise. Während der <strong>17.</strong> <strong>Internationale</strong>n<br />
Schillertage verschmelzen wir für die Leser der Festivalzeitung<br />
zur kritischen Masse, zum Kollektiv, zur<br />
Redaktion. Deshalb stellen wir uns in einem gemeinschaftlich<br />
verfassten Prolog vor. Das ist ein Experiment<br />
– genau wie die Formung eines „Wir“. Beginnen<br />
wir mit der Suche nach Anziehungskräften zwischen<br />
den Teilchen: das Theater, Friedrich Schiller, die Lust<br />
am Schreiben. Für den Prolog haben wir uns Schlüsselworte<br />
und Zitate von Friedrich Schiller ausgewählt,<br />
um die wir unsere Gedanken kreisen lassen.<br />
Die Frage, wer das „Selbst“ ist, das da gerade schreibt,<br />
bleibt offen – irgendwo zwischen Ich und Wir.<br />
...<br />
Wer erinnert sich nicht manchmal an die herrliche<br />
Unbeschwertheit der Kindertage, an ausgelassene<br />
Fröhlichkeit? Wer sehnt sich nicht nach dieser unkomplizierten<br />
Welt, die nach frisch gemähtem Gras<br />
riecht und grenzenlose Freiheit bedeutet – zumindest<br />
bis die Mutter zum Abendessen ruft?<br />
Gerade in Zeiten, in denen Stress und Zukunftsängste<br />
mich zu erdrücken scheinen, bin ich auf der<br />
Suche nach Momenten, die mir diese Sorglosigkeit,<br />
den Duft der Kindheit zurückbringen. Ich finde sie<br />
im Theater, und zwar nicht nur, weil das Smartphone<br />
dort mal ausgeschaltet bleibt.<br />
„Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst“, schreibt<br />
Schiller im Prolog des „Wallenstein“. Ich liebe es,<br />
wenn ich auch mal herzhaft lachen kann, aber entscheidend<br />
ist für mich etwas anderes: Im Theater<br />
kann ich alles um mich herum vergessen. Die Sorgen<br />
des Alltags, das Rascheln in der Reihe hinter mir. Ich<br />
kann ganz da sein, das Jetzt erleben und alles andere<br />
warten lassen.<br />
Wenn ich mich dabei selbst im Stück wiedererkenne<br />
oder Impulse bekomme, die über die Vorstellung hinauswirken,<br />
umso besser. Schiller zeigt uns, wie man<br />
„das düstre Bild der Wahrheit in das heitre Reich der<br />
Kunst hinüberspielt“. Er behandelt wichtige politische<br />
und gesellschaftliche Themen und verknüpft<br />
dabei Spiel mit Ernst, Unterhaltung mit Bildung. Ich<br />
hoffe, dass auch die Schillertage eine gute Mischung<br />
aus beidem für uns bereithalten.<br />
...<br />
Ohne Zweifel, es werden diese schönen Momente<br />
kommen, in denen ich mich in der vermeintlichen<br />
Sorglosigkeit des Jetzt verlieren kann. Aber wenn<br />
der sterbende Attinghausen im „Wilhelm Tell“ seine<br />
letzten Worte spricht und prophezeit „Es hebt die<br />
Freiheit siegend ihre Fahne“, dann beginnt in mir etwas<br />
zu schwingen. Dann findet der Schiller den Weg<br />
in mein heutiges Herz, und die unerfüllte Sehnsucht<br />
nach dem ewigen Traum der Freiheit kriecht in mir<br />
wieder empor. Was uns unterschiedliche Menschen,<br />
so zumindest mein Eindruck, zu vereinen mag, ist<br />
das beklemmende, immer stärker werdende Gefühl,<br />
dass diese Welt aus den Fugen geraten ist. Es<br />
scheint, dass eine obskure Maschinerie uns bewegt,<br />
ohne dass wir einen Einfluss darauf haben können.<br />
Es wäre vermessen, für andere oder gar (m)eine ganze<br />
Generation sprechen zu wollen. Ich aber verspüre<br />
den Drang nach Veränderung, den Wunsch, die verheißungsvolle<br />
Fahne der Freiheit zu schwingen. Wo<br />
anzufangen ist, wie dabei vorzugehen ist, was überhaupt<br />
zu tun ist, ich weiß es nicht. Doch das Theater<br />
kann in den eitrigen Wunden unserer Zeit wühlen.<br />
Es kann, mit ein bisschen Mut, entlang der längst<br />
ausgetretenen Pfade stolpern, um Zukunfts(t)räume<br />
zu erproben. Es ist Zeit zu experimentieren.<br />
In den Theatern. In den Köpfen. Auf den Straßen.<br />
Lasst es uns wagen! Denn „verbunden werden auch<br />
die Schwachen mächtig“. (Wilhelm Tell I,3) Und so<br />
werde ich nicht aufhören zu hoffen. Auf einen Akt<br />
der Solidarität. Auf ein widerständiges Wir. Auf<br />
den (kommenden) Aufstand. Die Sehnsucht nach<br />
Freiheit lodert in unseren Herzen. Doch die Realität<br />
brennt in unseren Augen. Überall auf den Plätzen<br />
dieser Welt.<br />
ende<br />
deR<br />
Die<br />
duldende MAsse<br />
unteR seine<br />
zWecKe<br />
GewAltthätiG beuGt,<br />
Muss sie hieR uM ihRe<br />
beistiMMunG<br />
Fragen.<br />
SCHILLER,<br />
„ÜBER DIE ÄSTHETISCHE ERZIEHUNG“<br />
maSSenmeDium # 04/ <strong>28.</strong> <strong>juni</strong> <strong>2013</strong><br />
15
PROGRAMM<br />
Freitag <strong>28.</strong>06.<br />
09.30 Schnawwl | € 12,– / € 6,–<br />
Tahrir Tell (UA)*<br />
National theater Mannheim, Schnawwl<br />
11.00 – 12.30 Alte Feuerwache | € 14,– / € 8,50<br />
Die RÄuber*<br />
Schauspielhaus Teheran<br />
18.00 – 19.00 Lobby Werkhaus | € 5,– / € 2,50 / Eintritt frei mit Vorstellungsbesuch und für<br />
SWR2-Clubmitglieder<br />
SWR2 Forum Sind autoritÄre Regime erfolgreicher?<br />
18.00 – 19.00 Stadt | 30 min Ortsgespräch laut Tarif Ihres Telefonanbieters<br />
Agoraphobia<br />
OMSK/Lotte van den Berg<br />
18.00 – 18.50 zeitraumexit | € 14,– / € 8,50<br />
BLIND VARIATION #3 (UA)<br />
machina eX<br />
19.00 – 21.00 Schauspielhaus | Preise G<br />
Wilhelm Tell*<br />
Schauspielhaus ZÜrich<br />
19.30 – 21.00 Alte Feuerwache | € 14,– / € 8,50<br />
Die RÄuber*<br />
Schauspielhaus Teheran<br />
20.00 Premiere | Community art Center | € 8,50<br />
Heimat-TrÄume? (UA)*<br />
Community art Center<br />
20.00 – 20.50 zeitraumexit | € 14,– / € 8,50<br />
BLIND VARIATION #3 (UA)<br />
machina eX<br />
21.00 Premiere | Studio | € 14,– / € 8,50<br />
The Earthaluja! Extinction Revival (UA)<br />
Reverend Billy & the Stop Shopping choir<br />
21.30 – 22.20 zeitraumexit | € 14,– / € 8,50<br />
BLIND VARIATION #3 (UA)*<br />
machina eX<br />
22.30 Unteres Foyer / Theatercafé | Eintritt frei !<br />
Schill-Out<br />
mit I Heart Sharks | DJ Polymux<br />
Spielstätten | Kartenerwerb<br />
Opernhaus, Schauspielhaus, Unteres Foyer, Theatercafé Am Goetheplatz, Mannheim | Zentraler Vorverkauf | Abendkasse 1 h vor Veranstaltungsbeginn<br />
Studio und Lobby Werkhaus Mozartstraße 9 – 11, Mannheim | Zentraler Vorverkauf | Abendkasse 1/2 h vor Veranstaltungsbeginn<br />
PROBENZENTRUM NECKARAU Eisenbahnstraße 2, Mannheim | Shuttle <strong>vom</strong> Nationaltheater zum Veranstaltungsort Schnawwl – Theater für junges<br />
Publikum am Nationaltheater Mannheim Am Alten Messplatz, Brückenstraße 2, Mannheim | Vorverkauf telefonisch unter + 49 (0)621 1680<br />
302 | Mo, Mi, Do, Fr 9.00 bis 12.00 Uhr | Mo – Fr 14.00 bis <strong>17.</strong>00 Uhr | Kasse 1 h vor Veranstaltungsbeginn UNTERER LUISENPARK Renzstraße, Mannheim<br />
| Eintritt frei Theaterhaus TiG7 G7, 4b, Mannheim | Zentraler Vorverkauf | Abendkasse vor Ort | www.tig7.de zeitraumexit Hafenstraße 68,<br />
Mannheim | Zentraler Vorverkauf | Abendkasse vor Ort | www.zeitraumexit.de Community art Center Mittelstraße 17, Mannheim | Zentraler Vorverkauf<br />
| Abendkasse vor Ort Alte Feuerwache Am Alten Messplatz, Brückenstraße 2, Mannheim | Zentraler Vorverkauf | Abendkasse vor Ort |<br />
www.altefeuerwache.com Cinema Quadrat Collini-Center / Foyer, Collinistr. 1, Mannheim | Vorverkauf telefonisch unter +49 (0)621 2 12 42 |<br />
www.cinema-quadrat.de AGORAPHOBIA, OMSK / Lotte van den Berg Preis 30 min. Ortsgespräch laut Tarif Ihres Telefonanbieters | Registrierung<br />
unter www.schillertage.de oder an der Theaterkasse | Ort wird nach der Registrierung per E-Mail oder an der Theaterkasse mitgeteilt<br />
Samstag 29.06.<br />
18.00 – 18.50 zeitraumexit | € 14,– / € 8,50<br />
BLIND VARIATION #3 (UA)<br />
machina eX<br />
18.00 Schnawwl | € 12,– / € 6,–<br />
Tahrir Tell (UA)*<br />
National theater Mannheim, Schnawwl<br />
19.30 – 21.10 Cinema Quadrat | € 7,– / € 6,– / Mitglieder € 5,–<br />
Filmreihe Empire me – Der Staat bin ich!<br />
20.00 – 22.00 Schauspielhaus | Preise G<br />
RÄuber. schuldengenital*<br />
Burgtheater Wien<br />
20.00 Community art Center | € 8,50<br />
Heimat-TrÄume? (UA)<br />
Community art Center<br />
20.00 – 20.50 zeitraumexit | € 14,– / € 8,50<br />
BLIND VARIATION #3 (UA)<br />
machina eX<br />
21.00 Studio | € 14,– / € 8,50<br />
The Earthaluja! Extinction Revival (UA)*<br />
Reverend Billy & the Stop Shopping choir<br />
21.30 – 22.20 zeitraumexit | € 14,– / € 8,50<br />
BLIND VARIATION #3 (UA)<br />
machina eX<br />
22.30 Unteres Foyer / Theatercafé | Eintritt frei !<br />
Schill-Out & La Nuit BohËme präsentieren:<br />
Dirty Honkers | Costa Le Gitan feat. Patrrice<br />
* Publikumsgespräch im Anschluss