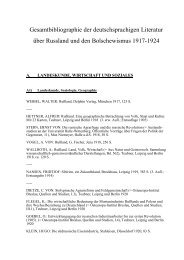Mein 1968 - Gerd Koenen
Mein 1968 - Gerd Koenen
Mein 1968 - Gerd Koenen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Gerd</strong> <strong>Koenen</strong><br />
<strong>Mein</strong> <strong>1968</strong><br />
Unter den historischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts bleibt <strong>1968</strong><br />
das am wenigsten greifbare. Alle, die irgendwie dabei waren, hatten<br />
ihr eigenes „68“. Zu einem historischen Datum ist „68“ erst in der<br />
Erinnerung geworden, mehr als ein Jahrzehnt später.<br />
Natürlich war es ein bewegtes und ein bewegendes Jahr. Unsere<br />
„Bildspur“ zeigt eine atemlose Folge dramatischer Ereignisse: die<br />
Tĕt-Offensive des Vietcong; das Attentat auf Martin Luther King, und<br />
wenig später das auf Rudi Dutschke; die anschließenden<br />
Osterunruhen und die Barrikaden des Pariser Mai; den Einmarsch<br />
sowjetischer Truppen in der CSSR, die herausfordernde Geste der<br />
schwarzen Sportler bei der Olympiade in Mexico; die<br />
Straßenschlachten in Chicago und Westberlin. Und doch wäre es<br />
schwierig, genau zu sagen, inwieweit <strong>1968</strong> dramatischer gewesen<br />
ist als irgendein anderes Jahr des letzten Jahrhunderts.<br />
Was also war dann „<strong>1968</strong>“? Warum hat es sich im kulturellen<br />
Gedächtnis so vieler – vor allem westlicher – Gesellschaften derart<br />
tief eingekerbt, und wieso erhitzt es die Gemüter gerade in der alten<br />
Bundesrepublik bis heute? Welchen Sinn macht es, dieses<br />
magische Datum mal als die Quelle aller möglichen<br />
gesellschaftlichen Fehlentwicklungen zu denunzieren, und mal wie<br />
einen Talisman mit Zähnen und Klauen zu verteidigen?<br />
Diese Fragen stellen, heißt, sie teilweise schon zu beantworten. Die<br />
Rede ist von einem Ereignis, das sich eben nur als Kulminationsoder<br />
Schnittpunkt vieler längerer Entwicklungslinien beschreiben
2<br />
lässt, als jähe Springflut einer „Revolution steigender Erwartungen“,<br />
als Ausbruch erotischer Lebensenergien und hallizunatorischer<br />
Weltgefühle, aber auch apokalyptischer Stimmungen. <strong>1968</strong> war<br />
jedenfalls ein hochgradig subjektiver historischer Moment; allerdings<br />
für so viele in solcher Intensität und etwa zur gleichen Zeit, dass sich<br />
aus dieser Erfahrung eine politische Generation formte, und mit ihr<br />
ein Generationsstil und eine Lebenshaltung, die bald auf die<br />
Gesellschaften im Ganzen abfärbten.<br />
Das gilt nicht nur für die alte Bundesrepublik, sondern für eine<br />
Vielzahl von Ländern dieser Erde – vor allem für die Länder, in<br />
denen die Verheerungen des Weltkriegs noch frisch und präsent<br />
waren. <strong>1968</strong> war eben auch ein Nachhall oder Nachspiel dieser<br />
traumatischen Erfahrungen, in die die „Nachgeborenen“, von denen<br />
Brecht 1947 im Futurum gesprochen hatte („Ihr, die ihr auftauchen<br />
werdet aus der Flut“), psychisch tief eingebunden und verstrickt<br />
waren.<br />
Die Entwicklungen, die um <strong>1968</strong> kulminierten, hatten etwa ein<br />
Jahrzehnt zuvor Fahrt aufgenommen. Man hat nicht zu Unrecht auch<br />
von einer „58er-Bewegung“ gesprochen. In der Bundesrepublik wie<br />
in anderen westlichen Ländern war der drohende „Atomtod“ das<br />
Schreckensbild, hinter dem sich eine neue, die hergebrachten<br />
politischen Einteilungen velfach überschreitende Protestbewegung<br />
sammelte. In der Bundesrepublik trat diese Bewegung in die<br />
Fußstapfen der Opposition gegen die Wiederbewaffnung im Rahmen<br />
der NATO und die damit verbundene Zementierung der deutschen<br />
Teilung.<br />
Hier stößt man auf ein erstes Grundmotiv der anschließenden „68er“-<br />
Bewegungen: den Impuls, das Erbe eines Zeitalters der Weltkriege hinter
3<br />
sich zu lassen und aus der in atomaren Vernichtungsdrohungen<br />
erstarrten Ost-West-Konfrontation auszusteigen. Diese Gefühle<br />
transzendentaler Verunsicherung verdichteten sich in der Kubakrise des<br />
Oktober 1962 zur akuten Panik. Am Morgen des Tages, an dem die Welt<br />
den Atem anhielt, als sowjetische Frachter sich der amerikanischen<br />
Blockadelinie vor der Karibikinsel näherten, saß ich in der Schule und sah<br />
aus dem grauen Himmel über der Ruhr Atomraketen wie Zeppeline sich<br />
zeitlupenhaft herabsenken. Gleich würden wir uns unter die Bänke werfen<br />
und auf Kommando die Aktentaschen über den Kopf stülpen, wie es in<br />
idiotischen Lehrfilmen vorgeführt worden war. Aber der Blitz, in dem wir<br />
alle verglühen sollten, blieb aus, und in den Nachrichten hieß es, die<br />
sowjetischen Schiffe hätten abgedreht und die Raketen würden wieder<br />
abgezogen. Zurück blieb ein taubes Gefühl der Unwirklichkeit – ein horror<br />
vacui, der gewaltsame Sinnstiftungen magisch anzog.<br />
Die frommen Ostermärsche unter der pazifistischen Friedensrune legten<br />
jedenfalls plötzlich an Masse, Tempo und Schärfe zu. Bis dahin hatten sie<br />
eher gewerkschaftlichen Sonntagsdemonstrationen geglichen, zu denen<br />
die alten und jungen Männer (es waren fast nur Männer) im guten Anzug<br />
mit Krawatte und Nelke im Knopfloch gingen. Hatten Parolen wie „Mutter,<br />
denk an Dein Kind. Atomtod droht“ vor allem an die noch frischen<br />
Katastrophenerfahrungen der Älteren und der (daheim gebliebenen)<br />
Frauen appelliert, so füllten sich jetzt die Reihen der Ostermarschierer mit<br />
allerhand jungem Gemüse beiderlei Geschlechts, und die Marsch- und<br />
Kleiderordnungen änderten sich. Als ich 1963 das erste Mal auf einen<br />
Ostermarsch ging, trugen wir Jeans und ausgemusterte Armee-Parkas,<br />
von denen die militärischen Zeichen abgetrennt waren, eine Art Anti-<br />
Uniform. Die Lieder der US-amerikanischen Bürgerrechts-Bewegung mit<br />
der Hymne „We shall overcome“ gaben einen neuen Gospel-Ton vor, der<br />
sich von dem Wandervogel-Geklampfe der alten Anti-Atom-Bewegung<br />
deutlich abhob.
4<br />
Überhaupt waren Sprache, Stil und Sound des jugendlichen<br />
Nonkonformismus in diesen Jahren noch überwiegend der<br />
amerikanischen Folk-, Rock- und Popkultur entlehnt, die mit Macht in<br />
die künstlich heile Welt der Gründerväter der Europäischen Einigung<br />
mit ihrer christlich-konservativen Abendländerei eingebrochen war.<br />
Die Konzerte von Elvis Presley und Bill Healey, und wenig später die<br />
der Beatles oder Stones, wurden in Deutschland wie überall zum<br />
Fokus einer hedonistisch-widerborstigen Jugendszene mit<br />
Röhrenhosen und Elvistolle, Parka und Pilzkopf, in die sich (auch<br />
das ein Novum) die jungen Mädchen mit hochgetürmten Haaren und<br />
Pettycoats oder kurzgeschnittenen Ponies und Hosen in<br />
„entfesselter“ Weise hineinmischten. Von einer „Verwahrlosung“ der<br />
Jugend war in den besorgten Erklärungen konservativer<br />
Familienminister und Medien jetzt dauernd die Rede, obwohl bis auf<br />
ein paar frühe „Gammler“, Tramps oder Beatniks die meisten noch<br />
ganz brav ihren Weg in Ausbildung und Beruf gingen.<br />
Diese aufgestauten lebenskulturellen Konflikte kulminierten in der<br />
Bundesrepublik in den „Schwabinger Krawallen“ vom Sommer 1962,<br />
als Hundertschaften der Polizei eine Woche lang mit gezogenem<br />
Knüppel auf Scharen jugendlicher Nachtschwärmer losgingen, die<br />
als „halbstarke Randalierer“ oder „Rowdys“ beschimpft wurden. Zwei<br />
Dinge heizten die Szenerie zusätzlich auf: Eine neue Boulevard-<br />
Presse, damals eher noch lokal orientiert, ergötzte sich mit<br />
heuchlerischer Empörung an diesen Jagdszenen, so wie es BILD<br />
1967/68 in Westberlin tun würde. Nur dass diese Stimmungsmache<br />
zur allgemeinen Verblüffung den umgekehrten Effekt hatte: Die<br />
Schwabinger standen angesichts der physischen und verbalen<br />
Knüppelorgien bald eher auf der Seite der Jugendlichen.
5<br />
Dass der Schritt zum politischen Protest nicht allzu groß war, zeigten<br />
die überwiegend von Studenten und Schülern getragenen<br />
Demonstrationen während der „Spiegel“-Affäre im Oktober<br />
desselben Jahres. Die Forderungen waren freilich noch ganz<br />
demokratisch und defensiv: Freiheit der Medien, Unabhängigkeit der<br />
Justiz und parlamentarische Kontrolle der Regierung.<br />
Noch war der jugendliche US-Präsident John F. Kennedy, der einen<br />
Aufbruch zu „new frontiers“ (neuen Grenzen) versprach und im Juni<br />
1963 Westberlin besuchte, ein Held dieser angehenden<br />
Protestgeneration. Als er im November in den Straßen von<br />
Dallas/Texas ermordet wurde, strömten in der Bundesrepublik<br />
Schüler und Studenten in zeremoniellen, stummen Fackelmärschen<br />
auf die Straße. Viele, die den ermordeten Präsidenten mit Tränen in<br />
den Augen betrauerten, würden nur ein paar Jahre später „USA-SA-<br />
SS“ skandieren<br />
Dazwischen lag der Prozess einer rasenden Entidealisierung der<br />
Vormacht der „freien Welt“. Die schockierenden Bilder des Kennedy-<br />
Attentats verschwammen mit anderen aus den Südstaaten der USA,<br />
in denen die nächtlichen Kreuze des Ku-Klux-Klan brannten und<br />
weiße wie schwarze Bürgerrechtsaktivisten bespuckt, gejagt und<br />
ermordet wurden, und immer zunehmend dann mit den Bildern des<br />
Kriegs in Vietnam, der 1965 nach der militärischen Intervention der<br />
US-Armee mit ihrer Politik der gnadenlosen Bombardements<br />
unaufhaltsam eskalierte.<br />
Dieselben Prozesse einer Entidealisierung hatten freilich auch die<br />
„Rebellen von Berkeley“ durchlaufen, Studenten einer der<br />
amerikanischen Eliteuniversitäten, deren Proteste (auch gegen die<br />
Rede- und Versammlungsverbote auf dem Campus) den Anstoß zur<br />
immer ausgedehnteren Antikriegsbewegung in den USA wie bald
6<br />
schon in der ganzen Welt gaben. Für sie, die Dissidenten aus der<br />
weißen Mittelklasse, hatte sich der „amerikanische Traum“ in einen<br />
Alptraum verwandelt. Dagegen beschwor der schwarze Pfarrer<br />
Martin Luther King, der in diesen Jahren eine friedliche, aber<br />
machtvolle und hartnäckige Bürgerrechtsbewegung vor die Tore des<br />
Weißen Hauses führte, mit klingender Stimme seinen eigenen<br />
„amerikanischen Traum“ von einer Gesllschaft der gleichen Rechte<br />
und der gleichen Chancen – bevor er ihn <strong>1968</strong> mit dem Tod<br />
bezahlte.<br />
Währenddessen waren die Länder Europas verstärkt mit ihrer<br />
eigenen „unbewältigen“ Geschichte konfrontiert, die vielfach noch<br />
unmittelbare Gegenwart war. So stand Frankreich zu Beginn der<br />
sechziger Jahre ganz im Bann des Krieges in und um Algerien, der<br />
in seiner letzten Phase mit äußerster Brutalität geführt wurde. Und<br />
der neu entbrannte Vietnamkrieg der USA musste die Franzosen an<br />
ihren eigenen, langjährigen Kolonialkrieg in Indochina erinnern, der<br />
erst 1954 durch ihre eklatante Niederlage in Dien Bien-Phu gegen<br />
die Vietminh des KP-Führers Ho Chi-Minh beendet worden war –<br />
eine Art Stalingrad im Kleinen.<br />
In der Bundesrepublik waren es, inmitten der Spannungen um<br />
Berlin, die 1961 im Mauerbau mündeten, vor allem die Gespenster<br />
einer „jüngsten Vergangenheit“, die unaufhaltsam zurückkehrten und<br />
gerade die Jüngeren zunehmend bewegten. In den langen 50er<br />
Jahren, der „Adenauer-Ära“, war nach einer stillschweigenden<br />
gesellschaftlichen Vereinbarung der Mantel des Vergessens (oder<br />
eines „kommunikativen Beschweigens“, so der Philosoph Hermann<br />
Lübbe) über die Massenverbrechen der NS-Zeit gebreitet worden.<br />
Man war jetzt Teil eines demokratischen Westens, der gegen den
7<br />
„totalitären“ Osten stand, und strebte eifrig neuen Ufern zu. Der<br />
Versuch der Regierung Adenauer, 1958 durch eine generelle<br />
Verjährung aller nicht geahndeten NS-Verbrechen einen<br />
Schlussstrich zu ziehen, scheiterte allerdings nach einem Aufschrei<br />
der Empörung sowohl unter den ehemaligen Kriegsgegnern wie im<br />
eigenen Land.<br />
Stattdessen wurde die Aufarbeitung des Nationalsozialismus zu<br />
einem zentralen, nicht mehr zu verdrängenden Thema der<br />
bundesdeutschen Öffentlichkeit. Aktive Staatsanwälte wie Fritz<br />
Bauer in Hessen eröffneten eine Reihe neuer NS-Verfahren, unter<br />
denen der Frankfurter Auschwitzprozess von 1963-65 herausragte.<br />
Ihm vorangegangen war mit einem weltweiten medialen Echo der<br />
Prozess in Jerusalem gegen den SS-Obersturmbannführer Adolf<br />
Eichmann, den Organisator der Vernichtungstransporte. Hannah<br />
Arendts auf die jämmerliche Figur und Selbstverteidigung<br />
Eichmanns gemünztes Wort von der „Banalität des Bösen“<br />
inspirierte mich damals zu einer Abitursrede, in der ich einem<br />
konsternierten Auditorium eröffnete, dass gerade die braven,<br />
unauffälligen Bürger und Dackelführer „unter uns“ ebenso gut<br />
bürokratische Exekutoren eines Massenmordes gewesen oder<br />
jederzeit wieder sein könnten.<br />
Damit meinte ich natürlich „sie“, die Angehörigen der<br />
Kriegsgeneration, der gegenüber „wir“ als junge Nachkriegsdeutsche<br />
uns in einer unüberbrückbaren, abstrakten Kluft zu sehen begannen.<br />
Das war unabhängig von allen guten oder schlechten Erfahrungen<br />
mit den eigenen Eltern oder im Alltag. Auch wenn es sie natürlich<br />
noch gab: die Sportlehrer, die uns „zäh wie Leder, flink wie<br />
Windhunde und hart wie Kruppstahl“ sehen wollten, oder die
8<br />
Passanten, die jugendlichen Demonstranten zuriefen, dass man<br />
„wohl vergessen hat, euch zu vergasen“. Und das waren dieselben,<br />
die „von allem nichts gewusst“ haben wollten! Es war diese<br />
unheimliche Döppelbödigkeit der eigenen Gesellschaft, worin die<br />
blonden Herrenmenschen und Weltbrandstifter von gestern zu<br />
Biedermännern mutiert waren, die zu einer elementaren<br />
Erschütterung des sozialen Urvertrauens führte.<br />
Die notwendige und legitime Distanzierung von einer bedrängenden<br />
und beschämenden Vergangenheit konnte allerdings sehr schnell<br />
auf Holzwege führen, solbald man aus seiner „kritischen Haltung“<br />
eine Pose machte und sich angewöhnte, die eigene Lebenswelt<br />
grundsätzlich in den schwärzesten Farben zu malen – vor der der<br />
eigene jugendliche Gratismut umso heller leuchtete. So wurde die<br />
Bundesrepublik unter den jungen Linksintellektuellen pauschal als<br />
„Nachfolgestaat des Dritten Reichs“ abgetan, so als hätte es nach<br />
1945 nur Kontinuität und „Restauration“ und nicht auch einen tiefen<br />
Bruch und grundlegenden Neubeginn gegeben. Ja, wir<br />
Nachgeborenen, die wir in dieser düsteren „Adenauer-Republik“<br />
aufgewachsen waren, waren dann auch so etwas wie „Verfolgte des<br />
Naziregimes“!<br />
Ich könnte die Litanei unserer angeblichen oder tatsächlichen<br />
Bedrückungen, die später als Erklärung für alle Umwege und<br />
Irrwege der 68er-Generation dienen sollte, bis heute auswendig<br />
hersagen. Also: Man durfte mit dem oder der „Verlobten“ nicht im<br />
elterlichen Haus oder in einem Hotelzimmer übernachten, weil der<br />
„Kuppelei“-Paragraph drohte! Es gab für Homosexuelle noch immer<br />
den § 175! Es gab für dissoziale Jugendliche noch immer<br />
Erziehungsheime mit harschem Regiment, von Nonnen oder
9<br />
Erziehern geführt, die das sicher auch in der Nazizeit getan hatten!<br />
Und so weiter und so fort.<br />
Alles richtig. Nur waren das ganz einfach die juristischen und<br />
kulturellen Standards dieser Zeit, wie sie in sämtlichen<br />
vergleichbaren Ländern herrschten. In der Kritik, die sich vor und<br />
nach <strong>1968</strong> in der Bundesrepublik daran entzündete, wurden diese<br />
überkommenen Moral- und Rechtsnormen aber zwangsläufig in das<br />
Gewitterlicht einer vom Nazismus durch und durch kontaminierten<br />
Gesellschaft gestellt – obwohl sie eher in Weimarer oder<br />
Wilhelminische Zeiten zurückreichten; und obwohl ihre Übernahme<br />
in den Rechtskanon der Bundesrepublik aus dem konservativen<br />
Impuls der Verfassungsgeber gespeist war, die nationalsozialistische<br />
„Entsittlichung“ des Familien- und Alltagslebens und die<br />
„Verwahrlosung“ einer vielfach vaterlos aufgewachsenen Jugend<br />
durch Krieg und Nachkriegszeit wieder in den Griff zu bekommen.<br />
Kurzum, vieles, was eher zum spießerhaften und kleinkarierten<br />
Zuschnitt der bundesdeutschen Nachkriegsrepublik zu rechnen war,<br />
verfiel einer fundamentalen Kritik, die (auch) aus dem Narzissmus<br />
des eigenen Oppositionsgestus lebte. Als der Dramatiker Rolf<br />
Hochhuth 1965 im „Spiegel“ erklärte, die vom Adenauer-Nachfolger<br />
und Kurzzeit-Kanzler Ludwig Erhard propagierte<br />
„Sozialpartnerschaft“ sei nichts als ein Schirm, hinter dem „die<br />
reichen Asozialen die totale Machtergreifung vollziehen“, antwortete<br />
der Vater des Wirtschaftswunders auf dem CDU-Wirtschaftstag<br />
gereizt: „Da hört bei mir der Dichter auf, da fängt der ganz kleine<br />
Pinscher an.“ Eine Äußerung, die einen Sturm der Empörung erntete<br />
und reflexhaft Assoziationen an die Bücherverbrennung von 1933<br />
weckte – wofür Hochhuth mit seinem Wort von der „totalen<br />
Machtergreifung“ natürlich die Vorlage geliefert hatte.
10<br />
Das Moment authentischer Erschütterung und eines Gefühls<br />
moralischer Leere, das sich für uns als die ungefragten Erben des<br />
NS-Regimes auftat, soll dabei nicht verkannt werden. In Wirklichkeit<br />
hatte es aber weder mit reinem Edelmut noch mit Masochismus zu<br />
tun, wenn man sich „mit der eigenen Geschichte auseinandersetzte“,<br />
die ja auch eine Kränkung des eigenen Selbstbildes war. Zum<br />
jungen, anderen Deutschland zu gehören, das sich aus der Asche<br />
einer dunklen Vergangenheit erhob, war auch ein Adelstitel und ein<br />
moralisches Kapital, mit dem man wuchern konnte. Ach, auch wir<br />
lebten (nach den Sinnsprüchen aus Brechts lyrischer Hausapotheke)<br />
„in finsteren Zeiten“, und „der Schoß war fruchtbar noch“, aus dem<br />
wir selbst gekrochen waren. Umso mehr kam es auf uns jetzt an!<br />
Zumal jetzt von einer „Bildungskatastrophe“ die Rede war und von<br />
der Notwendigkeit, in weitaus größerem Umfang als bisher junge<br />
Leute auf die Gymnasien und Universitäten zu schicken. „Bildung“<br />
schien in politischer wie in gesellschaftlicher Hinsicht das<br />
Allheilmittel zu sein. Wer zur „gebildeten Jugend“ gehörte, von der<br />
die Soziologen jetzt als einem Schlüsselfaktor sprachen, war also<br />
Mitglied einer designierten Elite, die einer in stumpfer Unwissenheit<br />
gehaltenen „Masse“ das Licht der Aufklärung zu bringen hatte.<br />
Das alles waren vorpolitische Prägungen und Aufladungen der<br />
späteren 68er-Generation – einer Generation, die allerdings nach<br />
den übereinstimmenden Befunden der Jugendforscher bis ins Jahr<br />
1967 überwiegend karriereorientiert und auf Pflege der eigenen<br />
Individualität ausgerichtet war. Äußerlich gesehen, gab es nur wenig,<br />
was einen derartigen Ausbruch an Protestenergien,<br />
Gemeinschaftsbedürfnissen und Fundamentalkritiken hätte erwarten<br />
lassen.
11<br />
Allerdings braute sich Mitte der sechziger Jahre in Westberlin etwas<br />
zusammen, das zumindest die Frontstadtpolitiker zu beschäftigen<br />
begann, zu denen auch der sozialdemokratische Bürgermeister und<br />
Kanzlerkandidat Willy Brandt gehörte. Ein „Wahlkontor“ prominenter<br />
Autoren, vorwiegend aus Berlin, hatte 1965 seine Kanzlerkandidatur<br />
unterstützt. Umso größer war die Enttäuschung, als der ehemalige<br />
sozialistische Emigrant Brandt im Herbst 1966 als Vizekanzler in<br />
eine Große Koalition unter der Kanzlerschaft des Christdemokraten<br />
Kurt Georg Kiesinger eintrat, eines liberalkonservativen<br />
Württembergers, von dem bekannt war, dass er langjähriges<br />
NSDAP-Mitglied gewesen war. Als Beate Klarsfeld (die deutsche<br />
Frau eines Sohnes jüdischer Deportierter) ihn 1969 ohrfeigte, war<br />
das von fast peinlich überdeutlicher Symbolik.<br />
Zu den zentralen Vorhaben der Großen Koalition gehörte die<br />
Verabschiedung einer Notstands-Verfassung, die die Ablösung der<br />
„alliierten Vorbehaltsrechte“ im Krisenfall bringen sollte und als<br />
entscheidender Schritt auf dem Weg zur vollen Souveränität der<br />
Bundesrepublik galt. Dieses Paket von Gesetzen, die in der<br />
entstehenden Außerparlamentarischen Opposition bald nur noch als<br />
„NS-Gesetze“ firmierten, wurde zu einem weiteren<br />
Kristallisationspunkt aller Vorbehalte gegen die eigene Gesellschaft.<br />
In Westberlin nahm diese, vorwiegend intellektuell geprägte<br />
Protestbewegung erstmals die Züge einer Studentenbewegung an,<br />
deren Stoßrichtung sich im Zeichen des immer weiter eskalierenden<br />
Vietnamkriegs zunehmend auch gegen die USA als die Vormacht<br />
der bundesdeutschen Nachkriegsrepublik und Schutzmacht von<br />
Westberlin richtete. Dabei hatte dieser Protest seine eigene<br />
Mechanik der Eskalation. Ein früher Wachruf war die Empörung,<br />
welche sich im Februar 1966 über ein Häuflein von Vietnam-
12<br />
Demonstranten ergoss, die ein paar Eier auf die Fassade des<br />
Berliner Amerikahauses geschleudert hatten. Politik und<br />
Frontstadtpresse, allen voran das neue Zentralorgan des gesunden<br />
Volksempfindens, die BILD-Zeitung, behandelten diesen<br />
vergleichsweise harmlosen Vorfall wie einen teroristischen Anschlag.<br />
Es dauerte nicht lange, und die demonstrierenden Studenten sahen<br />
sich an die Seite des „Vietcong“ gerückt, oder sie wurden als<br />
„Rotgardisten“ und „FU-Chinesen“ den Kampfbünden der<br />
maoistischen Kulturrevolution eingemeindet.<br />
Das war freilich eine Einladung zur Identifikation, die sich die<br />
Avantgardisten dieser entstehenden Protestbewegung nicht<br />
entgehen ließen, so wie sie die unbegrenzte Empörungsbereitschaft<br />
der Westberliner Politik und Presse schon bald in eine bewusste<br />
„Provokationsstrategie“ ummünzten, die in halb bewusster, halb<br />
unbewusster Weise auf die Verbreiterung wie die Radikalisierung<br />
der eigenen Bewegung zielte. Man warf sich blindlings in eine Serie<br />
von Konfrontationen und Mutproben, die sich in einem endlosen<br />
Reiz-Reaktions-Spiel an den Restriktionen oder Verboten<br />
entzündeten, die auch mit großer Zuverlässigkeit ausgesprochen<br />
wurden.<br />
Ein Focus der Auseinandersetzung war der Streit über das<br />
„politische Mandat“, das die zunehmend links orientierten<br />
Allgemeinen Studentenausschüsse der Universitäten für sich in<br />
Anspruch nahmen, im Paket mit Forderungen nach einer<br />
„Studienreform“, die unter der zentralen Maxime einer Öffnung und<br />
Demokratisierung der Hochschulen standen. Schließlich waren die<br />
Universitäten einmal Horte des obrigkeitsstaatlichen und<br />
reaktionären Denkens gewesen, und lange vor 1933 auch die<br />
Sturmvögel der nationalsozialistischen Machtergreifung. Wir wollten
13<br />
jetzt die Sturmvögel einer historischen Gegenbewegung sein, mit<br />
allem avantgardistischen und missionarischen Bewusstsein, das<br />
dazugehörte.<br />
Die Bilder dieser frühen Berliner Studentenproteste sind interessante<br />
Dokumente eigener Art. Der Habitus der Studenten ist noch<br />
überwiegend bürgerlich. Rollkragen oder T-Shirt unter dem Sakko<br />
waren der Inbegriff des intellektuellen Nonkonformismus, so wie das<br />
Vokabular der Parolen noch rein demokratisch und pazifistisch war.<br />
Nur wenige junge Frauen (Mädchen, sagte man damals) sind mit im<br />
Bild. Die Protestformen waren großteils den Rebellen von Berkeley<br />
entlehnt, denen sich die Studenten der von den Amerikanern<br />
gegründeten „Freien Univeristät“ besonders verbunden fühlten. Aus<br />
Diskussionsveranstaltungen wurden jetzt obligatorisch „Teach-ins“,<br />
während man sich noch ganz akademisch-korrekt mit „Kommilitone“<br />
anredete. Und das erste „Sit-in“ im Henry-Ford-Bau im April 1967 –<br />
als alle sich wie auf ein unsichtbares Signal hin auf den Boden<br />
setzten, nachdem der Rektor die Polizei gerufen hatte – könnte wohl<br />
als der Beginn der eigentlichen Studentenbewegung gelten.<br />
Und dann war da einer, der in diese Protestversammlungen einen<br />
anderen Stil und neuen Ton hineinbrachte. Er war in den Zirkeln der<br />
Berliner Linksoppositionellen kein Unbekannter, aber ein völlig<br />
Ungebundener, ohne Amt und Mandat – außer dem, das er nun als<br />
Tribun einer neuen, „anti-autoritären“ Bewegung an sich zog: Rudi<br />
Dutschke. Er war eine ungewöhnliche und ganz unrepräsentative<br />
Figur: Ein Abhauer aus der DDR und protestantischer Dissident, der<br />
das Neue Testament ebenso intensiv studiert hatte wie die Schriften<br />
von Heidegger und Sartre, von Marx und Lukács. Ein Puritaner eher<br />
als ein Hedonist, kein Angehöriger der Rock’n Roll-Generation
14<br />
jedenfalls. Die Züge eines pfingstlich durchglühten Eiferers wurden<br />
durch seine hohe, singende Stimme gemildert, die ihm doch etwas<br />
von einem sanften Rebellen verlieh, der er wohl auch war.<br />
Verglichen mit dem Gros der Bewegung, als deren Sprecher er nun<br />
die Bühne betrat, schien Dutschke ein eher unzeitgemäßer Mensch,<br />
jemand, der in der Welt der historischen sozialistischen Doktrinen<br />
(die er auf neue Weise fusionieren wollte) mehr zuhause war als in<br />
der profanen Gegenwart. Genau darin erwies er sich freilich als ein<br />
Trendsetter. Bald stürzten sich Scharen der in den Bewegungsstrom<br />
hineingerissenen Aktivisten in die Lektüre all dieser auf den<br />
Büchertischen ausgebreiteten, weithin esoterischen Schriften aus<br />
einer vergangenen Revolutionsepoche. Man suchte in ihnen so<br />
etwas wie das Bewegungsgesetz der menschlichen Geschichte oder<br />
das, was die Welt im Innersten zusammenhält.<br />
In diesem faustischen Impuls lag der Zauber dieser Lesebewegung,<br />
die irgendwann 1967 begann und mehr als ein Jahrzehnt anhielt. In<br />
ihrem Verlauf wurden heute längst unvorstellbar gewordene Mengen<br />
an Lektüren, vielfach in Form von Raubdrucken, verschlungen oder<br />
systematisch „geschult“ – ein Wort, das es bis dahin gar nicht<br />
gegeben hatte, nun aber zur selbstverständlichsten Sache der Welt<br />
wurde. In scholastischen Disputationen wurden alle Windungen und<br />
Wendungen einer jeweiligen theoretischen Argumentation<br />
ausgeleuchtet, überprüft und verglichen. Es lag in der Logik der<br />
Sache, dass man bald begann, Präferenzen zu entwickeln. So<br />
wurde man vom Radikaldemokraten und „Anti-Autoritären“ erst zum<br />
Marxisten, dann zum Leninisten, schließlich zum Trotzkisten und<br />
Maoisten oder auch zum Anarchisten, Syndikalisten usw.<br />
Diese Lektüren und Studien überschritten von vornherein alle<br />
Zwecke einer gegenwartsbezogenen Erkenntnis. Fast im Gegenteil:
15<br />
Sie kündeten von einem geschichtlichen Kontinuum, das uns<br />
frischgebackenen Revolutionäre, meist aus bürgerlichem Haus, weit<br />
realer erschien als unsere eigene, trügerische Lebenswelt. Man<br />
könnte es einen Akt historischer Rückversicherung nennen: Indem<br />
ich Marxist wurde, war ich Teil einer historischen Tendenz, die in<br />
Deutschland wie in anderen Ländern der kapitalistischen<br />
Metropolenwelt zwar Niederlagen erlitten oder faschistisch<br />
unterdrückt worden war, im sowjetischen Osten auch „bürokratisch<br />
deformiert“ erschien, aber die vor allem draußen in den Ländern der<br />
„Dritten Welt“ nun von Neuem den Vormarsch angetreten hatte.<br />
Dazwischen lag das Schlüsselereignis des 2. Juni 1967, das alle<br />
diese Themen und Motive bündelte und suggestiv miteinander<br />
verschmolz. Die Erschießung eines Studenten bei den Treibjagden<br />
der Berliner Bereitschaftspolizei auf die Demonstranten, die den<br />
Staatsbesuch des Schahs von Persien frech, fröhlich und lautstark<br />
begleitet hatten, wurde zum Erweckungserlebnis einer ganzen, sich<br />
blitzartig herausbildenden politischen Generation.<br />
Alles, was man vermutet oder schon mal verkündet hatte, schien<br />
sich plötzlich wie in einem kruden Lehrstück zu bewahrheiten. Der<br />
„Notstandsstaat“ zeigte seine faschistische Fratze. Ein keineswegs<br />
militanter Demonstrant, ein Germanist, der wie in einer zynischen<br />
Laune des Schicksals auch noch Ohnesorg hieß, war kaltblütig<br />
abgeknallt worden. Geschützt wurde so die freundschaftliche<br />
Beziehung der demokratischen Bundesrepublik zur orientalischen<br />
Ölmonarchie eines Schahs auf dem Pfauenthron, der seine erste<br />
(deutsche) Frau Soraya Jahre wegen Kinderlosigkeit verstoßen und<br />
sich eine junge Schönheit der Teheraner Aristokratie, Farah Diba,<br />
zur Zweitgattin erkoren hatte – während im Land schreiende Armut
16<br />
herrschte und ein berüchtigter Geheimdienst namens SAVAK alle<br />
Gegner drangsalierte. Dessen Agenten hatten sich als „Jubelperser“<br />
unter den Augen der Berliner Polizei als erste mit Knüppeln und<br />
Totschlägern auf die schutzlosen Demonstranten vor der Oper<br />
geworfen, bis wenig später dann die Schüsse fielen. War das die<br />
„freie Welt“, die in Vietnam wie in Berlin verteidigt wurde?<br />
Binnen Stunden und Tagen formte sich eine zuvor nur in Ansätzen,<br />
Latenzen und Stimmungen bestehende Außerparlamentarische<br />
Bewegung, deren Kern die Studenten waren und die in sehr kurzer<br />
Zeit Züge einer Fundamentalopposition annahm. Ich habe<br />
prototypisch am eigenen Leib erlebt, wie der flashartige Eindruck,<br />
dass „sie“ auf „uns“ geschossen hatten, zu dem Gefühl führte, dass<br />
nun alles glasklar geworden sei – und wie sich buchstäblich über<br />
Nacht das eigene Weltbild radikal nach links verschob. Als<br />
Wehrdienstverweigerer, der erst nach der Einziehung als<br />
Zwangsrekrut zur Bundeswehr in letzter Instanz anerkannt und ein<br />
Jahr zivilen Ersatzdienst in einer Nervenklinik geleistet hatte, war ich<br />
mit Studienbeginn in Tübingen Mitglied der Humanistischen<br />
Studenten-Union geworden.<br />
Jetzt, fast über Nacht, begannen wir eine völlig andere Sprache zu<br />
sprechen. Aus dem „Establishment“ wurden „die Herrschenden“, die<br />
früher mittels faschistischer Unterdrückung und heute hinter einer<br />
brüchigen demokratischen Fassade ihre „kapitalistische<br />
Ausbeuterordnung“ verteidigten. Die Arbeiter im eigenen Land<br />
hatten sie mittels eines „autoritären Wohlstandsstaates“ (wie Herbert<br />
Marcuse diagnostiziert hatte) stillgestellt, um sie desto reibungsloser<br />
auspressen zu können. Sie betäubten die Massen durch ihre<br />
zynische Pressepropaganda, vorneweg die Blätter aus dem Hause<br />
Springer. Sie zogen sich in universitären „Untertanenfabriken“ willige
17<br />
Funktionäre und Helfer heran. Und für den Fall, dass jemand<br />
aufmuckte, standen die neuen „NS-Gesetze“ und ihre zu jeder Untat<br />
fähigen Repressionsorgane bereit. Eben das hatten sie uns gerade<br />
eingebläut.<br />
Aber das eigentliche, globale Proletariat waren jetzt die<br />
Ausgebeuteten der „Dritten Welt“, die kolonial oder neo-kolonial<br />
Unterdrückten. Sie alle waren nach einer berühmten Schrift des<br />
algerischen Arztes Frantz Fanon die „Verdammten dieser Erde“,<br />
denen die Kolonialisten und Imperialisten neben ihrem Land und<br />
ihrem Besitz auch noch ihre Kultur, ihren Stolz und ihr<br />
Selbstbewusstsein geraubt hatten. Und wie der Philosoph Jean-Paul<br />
Sartre im Vorwort zur Schrift Fanons (die 1966 auf Deutsch<br />
erschien) geschrieben hatte, konnten sich die Kolonialsklaven nur<br />
dadurch wieder zu Menschen machen, dass sie die Kolonisatoren in<br />
einem blutigen Akt der Befreiung erschlugen – und damit auch den<br />
Sklaven in sich selbst töteten.<br />
So hatten es die Algerier gemacht, und so machten es jetzt die<br />
Vietnamesen in einer exemplarischen Befreiungsschlacht gegen die<br />
bis an die Zähne gerüstete Vormacht des Weltimperialismus, die<br />
USA. Deren einseitig und willkürlich entfesselter Aggressionskrieg<br />
(so sahen wir es, halb zu Recht und halb zu Unrecht) war auf dem<br />
besten Wege, dieses Land in eine einzige, mit Entlaubungsmitteln<br />
vergiftete, mit Napalm verbrannte Wüste zu verwandeln und (nach<br />
dem bekannten Wort eines US-Strategen) „in die Steinzeit zurück zu<br />
bombardieren“. Aber in den Höhlen und Katakomben überlebte ein<br />
mythischer „Vietcong“ und führte einen Guerillakrieg, der den<br />
überlegenen Invasoren trotz Ungleichheit der Waffen schwere<br />
Verluste zufügte und sie an den Rand des Wahnsinns trieb.
18<br />
Dieser ferne Krieg in Vietnam war allerdings auch der erste moderne<br />
Krieg, den man im gerade angebrochenen Fernsehzeitalter nun fast<br />
„live“ verfolgen konnte. Erstmals konnten Filmaufnahmen per Funk<br />
übermittelt und in allen Ländern der Welt binnen kürzester Zeit<br />
ausgestrahlt und gesehen werden. Mehr als uns bewusst war, trug<br />
dies dazu bei, den Vietnam-Krieg als eine globale<br />
Entscheidungsschlacht zu sehen, die uns suggestiv mahnte, Partei<br />
zu nehmen. Binnen kürzester Zeit änderten sich die Parolen: Aus<br />
„Friede für Vietnam“ wurde „Amis raus aus Vietnam“, dann „Waffen<br />
für den Vietcong“, und schließlich „Sieg im Volkskrieg“. Wir wollten,<br />
aus sicherer Entfernung, diesen Krieg nicht mehr beendet, sondern<br />
gewonnen sehen.<br />
Das entsprach schließlich auch der testamentarischen Botschaft, die<br />
der argentinische Weltrevolutionär Che Guevara dem in Havanna<br />
tagenden Kongress einer „Trikontinentale“ der kämpfenden Völker<br />
hatte zukommen lassen: „Schafft zwei, drei, viele Vietnams!“ Er<br />
selbst hatte währenddessen im Dschungel Boliviens diesen Kampf<br />
mit einer kleinen Schar Getreuer aufgenommen. Dass er im Oktober<br />
1967 durch von US-Beratern instruierte Rangertruppen aufgespürt<br />
und ermordet worden war, machte seinen Nimbus nur noch<br />
symbolkräftiger und strahlender. Zumal das Bildnis des<br />
aufgebahrten, den Blitzlichtern der Fotografen preisgegebenen,<br />
schönenToten in einem unglaublichen Akt ikonographischer<br />
Überhöhung denen des für die Sünden der Welt gestorbenen Jesus<br />
Christus glichen. „Che lebt!“, stand an den Wänden vieler, fast aller<br />
Universitätsviertel der Welt. Und das vom Mailänder Verleger<br />
Feltrinelli verbreitete Bildnis des Che wurde zur berühmtesten und<br />
dauerhaftesten Ikone einer unbestimmten Sehnsucht nach einer<br />
großen, alles umfassenden, revolutionären Veränderung der Welt.
19<br />
Unter der Che-Parole „Die Pflicht des Revolutionärs ist es, die<br />
Revolution zu machen“, tagte im Februar <strong>1968</strong> ein Internationaler<br />
Vietnam-Kongress in Berlin. Wir vom Tübinger Sozialistischen<br />
Deutschen Studentenbund (dem ich inzwischen beigetreten war)<br />
waren in mehreren Autos nach Berlin gefahren, voller insgeheimer<br />
Angst, in ein Frontstadt-Pogrom blutigeren Ausmaßes als am 2. Juni<br />
hineinzugeraten – nur um festzustellen, dass die Tribüne und die<br />
Straße in ungeahnter Weise uns gehörte, den jungen Rebellen.<br />
Unter den Lichtern der Weltpresse war da leibhaftig Rudi Dutschke,<br />
wie er auf der Tribüne sein Haupt zum ersten seiner Jünger, dem<br />
Chilenen Gaston Salvatore, neigte. Da war der illustre Freund Fidel<br />
Castros, Feltrinelli, der (was niemand wusste) die ganze<br />
Veranstaltung aus dem Geldkoffer finanziert und ein paar Stangen<br />
Dynamit mitgebracht hatte, um einen Anschlag gegen die<br />
Kriegsmaschine der USA zu unternehmen. Da waren berühmte<br />
Schriftsteller wie Peter Weiss und Erich Fried. Und da waren<br />
Studentenführer wie Tariq Ali aus London und Alain Krivine aus<br />
Paris. Die Franzosen waren in Samurai-artiger Lederkluft und, wie<br />
geflüstert wurde, mit Knüppeln, Helmen und authentischer<br />
Straßenkampferfahrung angereist. Von irgendwoher (manche<br />
behaupten, aus DDR-Beständen) waren plötzlich Bauarbeiter-Helme<br />
aufgetaucht, die viele Demonstranten als Ausweis ihrer<br />
„proletarischen“ Militanzbereitschaft aufsetzten. Im Foyer verkauften<br />
die Kommunarden der K1, Kunzelmann und Teufel, die mit ihren<br />
permanenten Provokationen und Happenings schon eine Art Pop-<br />
Stars der Bewegung geworden waren, ihre eigenen<br />
Flugblattsammlungen sowie das Rote Buch des Vorsitzenden Mao<br />
und die „Peking-Rundschau“.
20<br />
Aber vielleicht verwischen sich hier die Bilder mit denen späterer<br />
SDS-Kongresse. Jedenfalls war gerade für uns Provinzler ein<br />
beherrschender Eindruck all dieser Bewegungs-Events, dass wir in<br />
ein Meer der Prominenz eintauchten. „Wir“, die jungen APO-<br />
Rebellen, schmückten ja jetzt eins ums andere mal auch die<br />
Titelseiten von „Spiegel“ und „Stern“, und es hatte schon etwas<br />
Beschwörendes und zugleich Kokettes, wenn wir auf den<br />
Demonstrationen begeistert skandierten: „Wir - sind - eine - kleine -<br />
radikale - Minderheit!“<br />
Das waren wir, zweifellos, aber zugleich auch viel mehr. Wir hatten<br />
das wohlbegründete Gefühl, die Verhältnisse zum Tanzen gebracht<br />
zu haben. So zahlenmäßig klein – gemessen an den siebziger und<br />
achtziger Jahren, aber auch an entsprechenden Großaktionen der<br />
heutigen Zeit – die Demonstrationen von <strong>1968</strong> waren, so ungeheuer<br />
war die Aufregung, die sie durch ihre ständig gesteigerte verbale<br />
Radikalität und ihre provokativen Auftritte im Karpfenteich dieser auf<br />
Konsens gestimmten Republik erzeugten, bei Sozialdemokraten<br />
kaum weniger als bei den Christdemokraten und Liberalen. Und je<br />
mehr wohlmeinende Angehörige des „Establishments“, Professoren,<br />
Verleger oder Industrielle, sich um einen Dialog mit den Köpfen<br />
dieser neuen Außerparlamentarischen Opposition bemühten, umso<br />
schroffer wurden sie als „Scheißliberale“, „Pseudodemokraten“ und<br />
„Ausbeuter“ abgefertigt.<br />
Denn das große Schreckenswort neben der „Repression“ war die<br />
„Integration“. Man wollte uns wieder integrieren! Wir aber hatten zu<br />
beweisen, dass wir nicht mehr integrierbar waren. Die erste Aufgabe<br />
der Revolutionäre in den Metropolenländern wie der Bundesrepublik<br />
Deutschland sei es, „sich selbst zu revolutionieren“. Mit diesen<br />
Worten hatte Rudi Dutschke uns in seiner Abschiedsrede auf dem
21<br />
Vietnam-Kongress entlassen. Sie wirkten lange nach, in mir<br />
jedenfalls.<br />
Dieser Kongress hatte im Widerschein der Tet-Offensive<br />
stattgefunden, eines vorzeitigen Versuchs der von Nordvietnam mit<br />
regulären, modern ausgerüsteten Divisionen aufgefüllten<br />
Revolutionsstreitkräfte, der US-Armee und ihren<br />
südvietnamesischen Verbündeten eine entscheidene Niederlage<br />
beizubringen. Nur ein monströses Bombardement der vom Vietcong<br />
besetzten Städte, die unter den Augen der Weltpresse in<br />
Trümmerhaufen verwandelt wurden, verhinderte das – und brachte<br />
dem Regime Ho Chi-Minhs am Ende einen propagandistischen Sieg.<br />
Wenig später wurde in den USA der schwarze Bürgerrechtler Martin<br />
Luther King ermordet, brannten die Ghettos, rückte Nationalgarde<br />
mit aufgepflanztem Bajonett in die eigenen Großstädte ein. Die<br />
Vormacht des freien Westens lieferte nicht nur ein abstoßendes Bild,<br />
sondern sei zeigte auch Zeichen eines dramatischen Verfalls.<br />
Auf dem Gegenpol konnte man in diesem Frühjahr <strong>1968</strong> ernsthaft<br />
glauben, Teil einer globalen Aufbruchsbewegung der Jugend aller<br />
Länder zu sein. Überall, so schien es, gärte es, von den USA<br />
angefangen über halb Europa bis nach Asien und Lateinamerika.<br />
Dieser Eindruck war auch nicht völlig falsch – und doch eine<br />
Halluzination. Denn in Wirklichkeit lebten die jugendlichen Radikalen<br />
der verschiedenen Länder in vollkommen getrennten Welten. Und<br />
die entschlossenste „Solidarität“ war oft nur eine Form des<br />
offensiven Desinteresses und der praktischen Entsolidarisierung.<br />
So sympathisierten viele der jugendlichen Radikalen in der<br />
Bundesrepublik wie in anderen westlichen Ländern mit den Roten<br />
Garden der chinesischen Kulturrevolution, die – so meinte man zu
22<br />
wissen – das verknöcherte, „revisionistische“ Regime der alten<br />
Parteigarde durch einen wiiederaufgefrischten Geist der direkten,<br />
revolutionären Massendemokratie gestürzt und ersetzt hatten. Das<br />
ursprünglich für die Rekruten der Volksarmee kompilierte „Rote<br />
Buch“, ein in alle Sprachen übersetzter Katechismus aus Sprüchen<br />
Maos, avancierte zu einem hunderttausendfach vertriebenen<br />
Kultobjekt, halb modisches Gadget, halb ernsthafte<br />
Schulungsbroschüre. Mao-Buttons tauchten an tausenden Mützen<br />
und Revers auf. Und neben dem würdigen Bild von Onkel Ho,<br />
dessen Name die Springprozessionen der Antikriegsdemonstranten<br />
aller Länder beflügelte („Ho-Ho-Ho-Chi-Minh“) und der schon<br />
vertrauten Ikone von Bruder Che wurde das lächelnde Ölporträt des<br />
Vorsitzenden Mao zur Mona Lisa dieser imaginären Weltrevolution.<br />
Dabei hätten uns doch auch die wenigen, verfügbaren Bilder dieser<br />
chinesischen Kulturrevolution misstrauisch stimmen müssen, voller<br />
aufgeputscher Massen, die alle dieselben roten Büchlein<br />
schwenkten, um wie in einem Hexensabbath die „Schlangengeister<br />
und Schweinsteufel“ (in Maos blumig-mythischer Redeweise)<br />
auszutreiben. Man konnte ja durchaus ahnen oder aus verstreuten<br />
Informationen erschließen, dass es sich dabei um eine von oben<br />
orchestrierte „Spontaneität“ handelte, die in einem Kampf aller<br />
gegen alle Hunderttausenden das Leben kostete. Und die traurige<br />
Wahrheit war, dass schon mitten im Jahr <strong>1968</strong> das Gros der<br />
Rotgardisten (unsere imaginären Generationsgenossen also) in<br />
einem langen Marsch in entlegene „Kaderschulen“ abkommandiert<br />
wurden, in Wirklichkeit Zwangsarbeitslager, in denen sie oft mehr als<br />
ein Jahrzehnt voller Entbehrungen und Stumpfsinn verbrachten.<br />
Aber das alles wollten wir ja gar nicht wissen, im Gegenteil. Wir<br />
wollten uns eine Welt voller Freunde und Feinde zurechtschnitzen,
23<br />
eine weltweite Befreiungsbewegung, deren Teil wir sein würden –<br />
wir, die nach dem Wort des Che den „Kampf in der Brust der Bestie“<br />
selbst aufgenommen hatten, in den Metropolenländern des<br />
Kapitalismus und Imperialismus also.<br />
Von solchen, ebenso beklemmenden wie faszinierenden<br />
Vorstellungen, die mehr einem rasenden Existenzialismus als einem<br />
radikalen Marxismus entsprangen, waren auch diejenigen getrieben,<br />
die Anfang April <strong>1968</strong> die riskanten Parolen („burn, warehouse,<br />
burn“) der Berliner Spaßguerilla um die „Kommune 1“ in eine<br />
wirkliche herostratische Tat überführten: Sie zündeten zwei<br />
Frankfurter Kaufhäuser an. Noch war allerdings nicht zu ahnen,<br />
dass aus den beiden Hauptbrandstiftern Andreas Baader und<br />
Gudrun Ensslin zwei Jahre später das Gründungspaar eines<br />
bundesdeutschen Terrorismus werden würde. Und noch weniger<br />
hätte man ahnen können, dass auch einige der Kommunarden<br />
selbst, allen voran der Provokationsspezialist Dieter Kunzelmann<br />
und der lustige Fritz Teufel, sich kaum ein Jahr später in den<br />
bewaffneten Untergrund verabschieden würden. Noch waren wir<br />
weit entfernt von der bleiernen Zeit, mit der das „Rote Jahrzehnt“<br />
1977 in den „deutschen Herbst“ von 1977 münden würde.<br />
Vielmehr war das Doppeljahr 1967/68 bei allem apokalyptischen<br />
Wetterleuchten eher zunächst eine traumhafte Situation der<br />
Entgrenzung, ein magischer Moment des aus sich Herausgehens<br />
und Heraustretens; und darin lag der Vorschein von etwas<br />
Künftigem, Möglichem, dessen Erinnerung unverlierbar bleibt. Wir<br />
fühlten uns unmittelbar zu allen Ereignissen in der Welt, und diese<br />
waren unmittelbar zu uns. Alles ging uns an. Nicht anders verhielt es<br />
sich mit der Geschichte, die man sich als ein Kontinuum von
24<br />
revolutionären Ausbrüchen und Aufbrüchen neu erfand. Das zu<br />
Herzen gehende Lied von Sacco und Vanzetti, den (so hieß es) zu<br />
Unrecht zum Tode verurteilten Anarchisten der späten zwanziger<br />
Jahre, oder die aufwühlenden Bilder und aufrüttelnden Gesänge des<br />
spanischen Bürgerkriegs wurden in einer Intensität gehört, gesungen<br />
und betrachtet, als geschähe das alles hier und heute.<br />
<strong>1968</strong> war in Wirklichkeit schon eine post-moderne Bewegung, und<br />
ihr Subjekt eine Neue Linke, die in all ihrer auschweifenden<br />
Textversessenheit und Theoriewut vor allem in Bildern und Musiken<br />
lebte und schwelgte. Die Welt war Zeichen und Klang – ein riesiger,<br />
symphonischer Raum unterschiedlicher Sounds und Signale,<br />
Rhythmen und Gesänge, von den alten Arbeiterliedern über die<br />
Folklore aller Kontinente bis zu den Heartbeats des Rock’n Roll.<br />
Auch die Götter des Pop, die Jimi Hendrix, Janis Joplin oder Mike<br />
Jagger, traten ja jetzt im obligatorischen Gestus der Rebellen auf.<br />
The time is ripe for fighting in the street, boys, hieß es in einem Lied<br />
der Stones. Und die Bilder dieses Jahres schienen das auch wirklich<br />
zu bestätigen.<br />
Eine Jugendbewegung ist, fast naturgemäß, auch eine Sphäre<br />
entgrenzter Erotik, die aus ihrem sinnlichen Appeal lebt und sich<br />
daraus nährt – einem Appeal, von dem sich auch die lüsterngeifernde<br />
Boulevardpresse und die empörte Spießerwelt ständig ihre<br />
Scheibe abschnitt. Pfui Teufel, war das interessant, was diese Ferkel<br />
da hinter ihren kaum verhängten Fenstern trieben!<br />
In Wirklichkeit kämpfte die „sexuelle Revolution“, von der bald die<br />
Rede war, längst an zwei völlig gegensätzlichen Fronten: Auf der<br />
einen Seite gegen eine nur noch mühsam und „autoritär“ behauptete<br />
Prüderie und anachronistische Wohlanständigkeit – und auf der<br />
anderen Seite schon gegen eine durch die Medien schwappende,
25<br />
kommerzialisierte „Sexwelle“, die jedenfalls ungleich hemmungsloser<br />
war als alles, was sich genuin mit !968 verbindet.<br />
Wer die ungestylte, fast unschuldige Nacktheit der Protestanten von<br />
Woodstock mit den raffinierten Entblößungsstrategien der Werbung<br />
oder den geilen Erregungen der Boulevardpresse von damals<br />
vergleicht, ahnt in etwa, was einige Köpfe der 68er-Bewegung mit<br />
Herbert Marcuse als „repressive Entsublimierung“ anprangerten:<br />
eine Kommerzialisierung der Körper und der Sinnlichkeit, deren<br />
erstes Resultat die Abstumpfung und völlige Austauschbarkeit war.<br />
Der Tod des Eros mithin, kaum dass er sich ungeschützt gezeigt<br />
hatte.<br />
Und so gab es eine dritte, damals noch kaum bewusst registrierte<br />
Frontlinie, die von dem theoretischen Kronzeugen der „sexuellen<br />
Revolution“, dem lange verstorbenenen, kommunistischen<br />
Sexualtherapeuten Wilhelm Reich, markiert wurde. Von jedem<br />
fröhlichen Hedonismus weit entfernt, ging es in dessen Schriften um<br />
die Destruktion des eigenen bourgeoisen, autoritären, latent<br />
faschistischen „Charakterpanzers“ und um die Produktion befreiter,<br />
mit vitaler Lebensenergie aufgeladener proletarischer Kader, Männer<br />
und Frauen.<br />
Tatsächlich trugen die Experimente mit Drugs & Sex, die in den aus<br />
dem Boden schießenden Kommunen unter den Postern von Mao<br />
und Che oder auch Lenin und Stalin betrieben wurden, nicht selten<br />
Züge eines gewaltsamen Selbstexperiments. Und gerade hier, in<br />
denen Zonen der radikalsten Entbindung, gab es vielfach auch<br />
schon den Drang nach neuer Bindung: sei es in den rigoros<br />
disziplinierten marxistisch-leninistischen Parteiklonen und<br />
Kampfbünden der anbrechenden siebziger Jahre, oder eben in den<br />
entstehenden terroristischen Gruppen, die sich (wie willig oder
26<br />
unwillig auch immer) der Disziplin des Untergrunds unterwerfen<br />
mussten.<br />
Das alles waren nicht zuletzt Fluchtbewegungen aus dem sich<br />
steigernden, immer unübersichtlicheren Chaos dieses Jahres <strong>1968</strong>.<br />
Wer sich einmal zur „Bewegung“ dazuzählte, der fühlte sich in einem<br />
reißenden Strom der Ereignisse, der auf irgendeinen im Dunkeln<br />
liegenden Punkt der Entscheidung oder auch der Erfüllung<br />
hinauslief. Alles schien sich tatsächlich mit allem in der Welt zu<br />
verknüpfen.<br />
Der junge DDR-Flüchtling und Hilfsarbeiter Josef Bachmann las die<br />
Meldung über das erfolgreiche Attentat gegen den schwarzen<br />
Prediger Martin Luther King, und beschloss, diesen roten Agitator<br />
Rudi Dutschke, der bestimmt von der SED oder Stasi gesteuert war,<br />
seinerseits durch ein Attentat zu eliminieren. (Und zehn Jahre später<br />
würde Rudi Dutschke, kurz vor seinem Tod, überzeugt sein, dass es<br />
gerade die Stasi war, die ihm diesen jungen Flüchtling Bachmann<br />
auf den Hals gehetzt hatte.)<br />
Das Attentat auf Dutschke am 11. April wirkte buchstäblich wie der<br />
Funke, der einen Steppenbrand auslöste. Die spontanen Versuche<br />
tausender, vielleicht zehntausender Demonstranten, die<br />
Auslieferung der Springer-Blätter zu verhindern, sind unter der<br />
Chiffre „Osterunruhen“ in die Geschichte der Republik eingegangen<br />
und markieren darin einen bis dahin unerhörten Fall eines<br />
gewaltsamen zivilen Ungehorsams, der das vielzitierte<br />
„Establishment“ vollends aufscheuchte. Jetzt war diese linksradikale<br />
„APO“ ein politischer Faktor eigener Art geworden; und wieder hatte<br />
es Tote gegeben, diesmal in München und durch Wurfgeschosse<br />
aus den Reihen der Demonstranten. Dass auf dem rechten Flügel
27<br />
auch die NPD mit wachsendem Zulauf und hohen Wählerziffern (bis<br />
über 10%) Züge einer militanten Gegenbewegung annahm, machte<br />
das politische Tableau nur noch alarmierender. War Bonn doch<br />
Weimar?<br />
Das schien allerdings fast noch harmlos, verglichen mit dem, was<br />
sich einen Monat später in Frankreich abspielte, als<br />
Studentendemonstrationen in Paris in tagelangen<br />
Barrikadenschlachten klassischen Zuschnitts mündeten und bald<br />
darauf ein politischer Generalstreiks das ganze Land lahmlegte –<br />
wie man das seit Jahrzehnten in Europa nicht gesehen hatte. Der<br />
Staatschef General de Gaulle eilte (oder flüchtete?) zu den<br />
Fallschirmjägertruppen nach Baden-Baden, die womöglich Paris<br />
wieder einnehmen sollten. Aber der General und Vater der IV.<br />
Republik trug sich auch mit Rücktrittsgedanken. So mündete der<br />
„Pariser Mai“ in einer Staatskrise, die erst durch eine gewaltige<br />
Gegenmobilisierung der Gaullisten beendet wurde, als eine Million<br />
sich unter der Trikolore auf den Champs Elysées versammelte. Und<br />
plötzlich war alles wie ein Spuk vergangen – und doch wirklich<br />
passiert! In der historischen Erinnerung war es gerade dieser Pariser<br />
„Mai 68“ mit seinen etwas karnevalistischen Zügen eines kurzen<br />
Sommers der Anarchie, das Bild der Zeit nachträglich prägte. Wenn<br />
wir heute von „<strong>1968</strong>“ sprechen, dann bildet der Pariser Mai die<br />
geheime, stille Achse dieser Erinnerung.<br />
Als eine Achterbahn der Hochgefühle und Enttäuschungen erwies<br />
sich dieses ganze Jahr <strong>1968</strong> für alle, die sich als Teil dieser<br />
radikalen Jugendbewegung aller Länder sahen. Trotz aller Proteste,<br />
und wohl auch aus diesem Grunde, gingen die Notstandsgesetze im<br />
Mai <strong>1968</strong> mit übergroßer Mehrheit durch den Bundestag. Ein
28<br />
„Sternmarsch“ nach Bonn war bereits von einer gewissen Ermüdung<br />
gezeichnet, aber auch von der wachsenden Unvereinbarkeit der<br />
traditionellen und der neuen, „antiautoritären“ Linken. Nicht wenige<br />
APO-Aktivisten suchten jetzt verstärkt eine politische Heimat und<br />
fanden sie am Ende doch auf dem linken Flügel der SPD, vor allem<br />
bei den Jungsozialisten, oder in der neu entstehenden, wieder<br />
zugelassenen Kommunistischen Partei, die jetzt DKP hieß.<br />
Aber auch die Antiautoritären verstrickten sich in eine Diskussion<br />
über die Notwendigkeit einer revolutionären Organisation, die eine<br />
wissenschaftliche revolutionäre Theorie und ein klares Programm<br />
brauchte; und gleichzeitig in eine Diskussion über die Bereitschaft<br />
zur Anwendung revolutionärer Gewalt gegenüber einer staatlichen<br />
Repression, die sich in zehntausenden von Strafverfahren und einer<br />
demonstrativen Aufrüstung der Polizei zeigte.<br />
Die Lage schien sich weltweit zuzuspitzen. War das 1967 in<br />
Griechenland installierte Militärregime vielleicht nur die erste Etappe<br />
einer Rückkehr Westeuropas zum Faschismus? Und wie sollte man<br />
die Entwicklungen in den USA beurteilen, wo im Juni auch Robert<br />
Kennedy, der aussichtsreiche Kandidat des linken Flügels der<br />
Demokraten, durch ein Attentat starb – und wieder (angeblich) durch<br />
einen verwirrten Einzeltäter? Kein Wunder, dass der Wahlkongress<br />
der Demokraten im August von tagelangen Straßenschlachten<br />
begleitet war, denen im Oktober noch einmal die „Days of rage“ (die<br />
Tage der Wut) eines militanten Kerns von Demonstranten folgten –<br />
während der Krieg in Vietnam nach vergeblichen<br />
Friedensgesprächen immer verheerendere Ausmaße annahm und<br />
auch immer größere Opfer auf amerikanischer Seite forderte (allein<br />
im Mai <strong>1968</strong> waren es 2000 Gefallene).
29<br />
Eine eigene, faszinierende Facette dieser Bewegungen in den USA<br />
waren die Black Panther, eine bewaffnete, in schwarzes Leder<br />
gekleidete Organisation von Afro-Amerikanern, die auch innerhalb<br />
der US-Armee agitierte. Angeführt von militanten Agitatoren und<br />
Literaten wie Bobby Seale, Huy Newton und Eldrige Cleaver (dessen<br />
Autobiographie „Seele auf Eis“ auch auf Deutsch Furore machte),<br />
entwickelten sie einen Gospel der „befreienden Gewalt“, der sich mit<br />
dem verdüsterten Weltbild vieler 68er-Aktivisten in der<br />
Bundesrepublik wie in anderen Ländern verband.<br />
Als die schwarzen Sprinter und Weitspringer auf den<br />
Siegertreppchen der Olympiade von Mexico im Herbst <strong>1968</strong> die<br />
schwarze Faust mit einem Lederhandschuh reckten, wirkte das wie<br />
ein weltweites Fanal. Umso mehr, als diese Olympischen Spiele mit<br />
einem regelrechten Massaker der Armee an den protestierenden<br />
Studenten von Mexico City eröffnet worden waren – an unseren<br />
Brüdern und Schwestern, den „sisters and brothers“ also, als die die<br />
Black Panther-Prediger ihre Zuhörer ansprachen.<br />
Nicht nur dieser Gospel einer „befreienden Gewalt“ war es, der die<br />
Demonstranten bei der „Schlacht am Tegeler Weg“ im November<br />
<strong>1968</strong> in Berlin antrieb. Sondern es war auch eine fixe Idee (wie sie<br />
unter anderem der angeschossene Dutschke vom Krankenbett aus<br />
formuliert hatte): dass die Arbeiter es nicht verstünden, wenn die<br />
Studente sich wehrlos zusammenschlagen ließen, ohne<br />
zurückzuschlagen. War Gewalt also das Medium, mit dem der<br />
Brückenschlag zum mythischen Proletariat vollzogen werden<br />
konnte? Wie eine Bestätigung konnte es da erscheinen, dass sich in<br />
die Bataillen mit der Berliner Polizei jetzt zunehmend auch die<br />
„proletarische“ Vorstadtjugend mischte – und in der zitierten<br />
„Schlacht am Tegeler Weg“ wie in einer mittelalterlichen
30<br />
Sporenschlacht ein Dutzend Tschakos und Schilde auf der mit<br />
Steinen übersäten Walstatt zurückließen, von der die Polizei sich<br />
zurückgezogen hatte.<br />
In diesem scheinbar homogenen Bild dieses Jahres der Revolten lag<br />
ein politisches Ereignis quer – fast wie eine Gräte im Hals: der<br />
Einmarsch der sowjetische geführten Truppen des Warschauer<br />
Paktes in die sozialistische Tschechoslowakei am 21. August.<br />
Tatsächlich hatte es ja auch im östlichen Europa eine gärende<br />
Unruhe unter der Jugend gegeben und Ansätze einer neuen<br />
intellektuellen Opposition. In unserem übermütigen Egozentrismus<br />
hatten wir neugetauften Westlinken die (rasch niedergeschlagenen)<br />
Studentendemonstrationen in Warschau im März und den parallelen,<br />
vielversprechenden Ausbruch des „Prager Frühlings“ für mehr oder<br />
weniger gleichgerichtete Bewegungen gehalten. Und das war ja<br />
auch nicht völlig falsch. In Warschau wie in Prag oder Budapest, in<br />
Belgrad und Zabreb, und selbst in Moskau und Leningrad, war ein<br />
wiederaufgefrischter Marxismus das erste Medium einer<br />
intellektuellen Dissidenz gewesen.<br />
<strong>Mein</strong>e erste Berührung damit auf einem Studentenseminar in<br />
Bratislava Ende März <strong>1968</strong> war allerdings höchst verwirrend<br />
verlaufen. Die Mitglieder des Kommunistischen Jugendverbandes<br />
dort interessierten sich pluralistischer Weise auch für jene<br />
„bürgerlichen“ Theorien, von Popper bis Dahrendorf, die wir gerade<br />
hinter uns gelassen hatten. Entsprechend hochmütig fertigten wir sie<br />
mit Marx, Lenin und Marcuse ab. Zur gleichen Zeit war im übrigen<br />
Rudi Dutschke in Prag gewesen und hatte den neugierigen, aber<br />
dann verwirrten Studenten der Universität die Notwendigkeit des<br />
Aufbaus einer wahrhaft „revolutionären Partei“ vor Augen geführt.
31<br />
Zur Verwirrung der Fronten bei unserem Bratislavaer Seminar trug<br />
wiederum eine Delegierte der Universität Budapest bei, die sich mit<br />
uns Westlinken alliierte und, wie sich herausstellte, Mitglied eines<br />
„Vietnam-Komitees“ war, hinter dem sich eine „Gruppe<br />
revolutionärer Kommunisten“ mit maoistischen Neigungen verbarg.<br />
Maoisten aus Budapest! Das alles gab es ja durchaus.<br />
Wie so oft, gingen Eros und Verblendung auch in unserem Falle eine<br />
intime Verbindung ein. Als ich die Budapester Genossin im August<br />
<strong>1968</strong> besuchen fuhr, kreuzte die Geschichte spätnachts meinen<br />
Weg – in Gestalt riesiger sowjetischer Amphibienpanzer, die gleich<br />
links im Dunkel der Donauauen verschwanden. Am nächsten<br />
Morgen war Prag von ihnen okkupiert. Wir fuhren weiter über<br />
Belgrad nach Sofia, wo es auf den Weltjugendfestspielen zu<br />
lebhaften Scharmützeln zwischen SDS-Delegierten aus Frankfurt<br />
und der bulgarischen Polizei gekommen war. Überall auf den<br />
Campingplätzen sammelten sich die tschechoslowakischen<br />
Flüchtlinge, das Ohr am Transistor. Wir fühlten aufrichtig mit ihnen.<br />
Aber als nach ein, zwei Wochen alles vorbei war und die Bilder der<br />
Demonstranten und der Panzer in den Straßen von Prag verweht<br />
waren, schwenkten wir auf eine Linie der Interpretation ein, wie sie<br />
etwa Fidel Castro formuliert hatte: Der „Prager Frühling“ war eben<br />
doch allzu bürgerlich-reformerisch gewesen, und eben deshalb hatte<br />
es auch keinen echten, revolutionären Widerstand gegeben. Somit<br />
war die Okkupation die zwangläufige Strafe für den Liberalismus der<br />
Reformer gewesen.<br />
Auf dieser Linie bewegte sich auch eine Protestdemonstration in<br />
Westberlin, zu der – in betonter Abgrenzung zu allen „reaktionären“<br />
Solidaritätsaktionen – die linken Gruppen des AStA der Freien<br />
Universität aufgerufen hatte. Ihrem Aufruf zufolge war der
32<br />
sowjetische Einmarsch in Prag ohnehin eine abgekartete Sache mit<br />
den USA, die sich im Gegenzug noch freiere Hand in Vietnam geben<br />
ließen. Der Aufruf endete mit der Parole: „Es lebe die<br />
Weltrevolution!“ Kleiner hatten wir es nicht mehr. Und das war der<br />
große verbale Paravent, hinter dem man aus einer vermeintlichen<br />
Solidarität einen Akt der betonten Ignoranz und letztlich Indifferenz<br />
machen konnte.<br />
Von „drüben gesteuert“ war das alles gleichwohl nicht, wie einige<br />
schon damals und später immer wieder behauptet haben. So aktiv<br />
die Stasi- und SED-Kader gerade in Westberlin an der Suppe<br />
mitköchelten, so sehr diente das auch dazu, diese brodelnde<br />
Szenerie im Blick zu halten. Ein Abhauer und Schwarmgeist wie<br />
Dutschke war aus der Sicht der Ostberliner Politbürokraten<br />
brandgefährlich, so wie die Bewegung insgesamt, die er vertrat.<br />
So schwankt das Bild des Jahres <strong>1968</strong> im Magnetfeld der<br />
Widersprüche, die diese – nur scheinbar miteinander verbundenen –<br />
radikalen Jugendbewegungen geprägt haben. Und man erlebte<br />
diese Widersprüche am eigenen Leib, befand sich in einer Drift voller<br />
Strömungen und Gegenströmungen, die man selbst nicht<br />
kontrollierte, obwohl man sich doch gerade einer theoretisch<br />
vertieften „Bewusstheit“ und einer unbedingten Autonomie der<br />
eigenen Entscheidungen verschrieben hatte. Aber aus vergnügtem<br />
Hedonismus konnte in diesem Prozess – fast über Nacht –<br />
puritanischer Ernst werden, aus Egalitarismus Elitismus, aus einer<br />
antiautoritären Haltung ein neuer Autoritarismus, aus der Suche<br />
nach Individualität ein Bedürfnis nach Gemeinschaft und<br />
Einordnung, aus pazifistischem Antimilitarismus ein Kult
33<br />
revolutionärer Gewalt, aus Zärtlichkeit und Partnerschaft emotionaler<br />
Autismus und erotische Segregation.<br />
Die Anfänge der Frauenbewegung, die mit den Tomaten auf den<br />
Frankfurter SDS-Matador Hans-Jürgen Krahl begannen, waren<br />
jedenfalls zunächst einmal Sezessionen und Rückzüge aus den<br />
Zentren dieser politischen Bewegung, in denen – gerade in der<br />
informellen Offenheit aller Gremien und Meetings – sich faktisch eine<br />
machistische Hackordnung durchsetzte. So entsprang die<br />
Frauenbewegung wie viele andere Entwicklungen der siebziger<br />
Jahre, von den Bürgerinitiativen bis zur Ökologie, zwar dem Energieund<br />
Bewegungsstrom, der von <strong>1968</strong> ausging, aber gehört doch<br />
eigentlich nicht in den Kontext dieses Jahres, wie die von uns<br />
zusammengestellte „Bildspur“ deutlich zeigt. Vieles hat sich später<br />
unter der Chiffre „68“ eingeloggt, das in Wirklichkeit nicht hierhin<br />
gehört.<br />
Vieles war ja auch eine Komödie der Irrungen und Wirrungen. Als<br />
die Studentenbewegung an ihre Schranken stieß, wurde der Drang,<br />
in die „proletarischen“ Wohnviertel und Fabriken zu ziehen,<br />
übermächtig. Die „Wilden Streiks“ im September 1969 schienen<br />
Anlass zu den wildesten Hoffnungen zu bieten; und tatsächlich trat<br />
auch eine junge Generation aktiver Streikführer und Gewerkschafter<br />
auf den Plan. Aber es waren eben doch Streiks und Kämpfe, die sich<br />
im Kern darum drehten, in Zeiten der Hochkonjunktur einen<br />
ordentlichen „Schluck aus der Pulle“ zu nehmen. Überhaupt<br />
orientierten wir uns aus der Logik unseres radikalen Antikapitalismus<br />
heraus auf ein historisches Subjekt, eine Arbeiterbewegung, die<br />
tatsächlich als gesellschaftliche Größe schmolz und fast schon in<br />
Abwicklung war.
34<br />
Ähnlich verhielt es sich mit dem gerade erst entdeckten, neuen<br />
Subjekt der „Dritten Welt“. Der halluzinatorische Moment dieses<br />
Jahres <strong>1968</strong>, als alle Weltereignisse plötzlich einen Kontext zu<br />
bilden und eine geschichtliche Strömung zu ergeben schienen, war<br />
schon verflogen, bevor man ihn so recht zu fassen bekommen hatte.<br />
Am Ussuri standen sich sowjetische und chinesische Truppen<br />
gegenüber, um Grenzkämpfe ältesten Stils auszukämpfen. Wenig<br />
später stürzte der „kleine General“ der Kulturrevolution und<br />
designierte Mao-Nachfolger Lin Piao bei der Flucht in die Mongolei<br />
ab und galt plötzlich als „Faschist“. Im Jahr darauf toastete Nixon in<br />
Peking Tschou En-lai zu. Verschiedene Befreiungsbewegungen<br />
zeigten ihre düsteren und chauvinistischen Seiten. Die<br />
Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) glitt sehr schnell in<br />
blanken Terrorismus ab; und die lateinamerikanischen<br />
Stadtguerilleros konnten zwar spektakuläre Aktionen machen, die für<br />
die Militärdiktatoren des Kontinents aber eher ein willkommener<br />
Vorwand waren als eine ernsthafte Bedrohung.<br />
Aber auch die politischen, technischen und ökonomischen<br />
Entwicklungen überholten uns eins ums andere mal, während wir<br />
uns doch per Definition an der Spitze des Fortschritts sahen. Der<br />
beispiellose sozialökonomische Entwicklungszyklus der<br />
Nachkriegsperiode hielt an, statt in die immer progrnostizierte,<br />
fundamentale Krise zu münden. Der erste Mensch landete auf dem<br />
Mond. Und statt des massiven Rechtsrutsches in Richtung Franz<br />
Josef Strauß, den alle Welt erwartete, war es stattdessen die SPD<br />
Willy Brandts und eine runderneuerte FDP, die die Wahlen<br />
gewannen und durch eine sozialliberale Koalition die scheinbar<br />
„ewige“ Ära christdemokratisch geführter Regierungen beendeten.
35<br />
Nicht nur diejenigen, die im Winter 1969/70 den Gang in einen<br />
bewaffneten Untergrund antraten, begaben sich damit ins Abseits.<br />
Viele andere 68er-Aktivisten (darunter der Autor dieser Zeilen) und<br />
zehntausende Jüngerer, die zum großen Fest der Bewegung von<br />
<strong>1968</strong> zu spät gekommen und umso radikaler waren, taten es auf<br />
andere, weniger gravierende Weise, indem sie sich ein ganzes<br />
„rotes Jahrzehnt“ lang in eine brodelnde Szenerie linksradikaler und<br />
neokommunistischer Gruppen einkapselten. Der<br />
„Erfahrungshunger“, den Michael Rutschky einmal als<br />
Charakteristikum der siebziger Jahre beschrieben hat, blieb über<br />
weite Strecken selektiv und ließe sich ebenso auch als<br />
Erfahrungsverweigerung beschreiben.<br />
Nichts lässt sich auf einen Nenner bringen. Und insofern ist es auch<br />
völlig sinnlos und verfehlt, von heute aus „für“ oder „gegen“ <strong>1968</strong> zu<br />
optieren. Alles war, wie es war – so vieldeutig nämlich, wie es solche<br />
historischen Kulminationspunkte nun einmal sind.