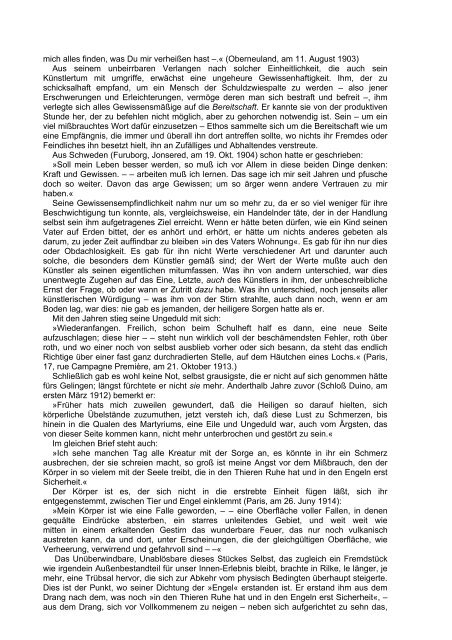RAINER MARIA RILKE - Kaleidophon-verlag.com
RAINER MARIA RILKE - Kaleidophon-verlag.com
RAINER MARIA RILKE - Kaleidophon-verlag.com
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
mich alles finden, was Du mir verheißen hast –.« (Oberneuland, am 11. August 1903)<br />
Aus seinem unbeirrbaren Verlangen nach solcher Einheitlichkeit, die auch sein<br />
Künstlertum mit umgriffe, erwächst eine ungeheure Gewissenhaftigkeit. Ihm, der zu<br />
schicksalhaft empfand, um ein Mensch der Schuldzwiespalte zu werden – also jener<br />
Erschwerungen und Erleichterungen, vermöge deren man sich bestraft und befreit –, ihm<br />
verlegte sich alles Gewissensmäßige auf die Bereitschaft. Er kannte sie von der produktiven<br />
Stunde her, der zu befehlen nicht möglich, aber zu gehorchen notwendig ist. Sein – um ein<br />
viel mißbrauchtes Wort dafür einzusetzen – Ethos sammelte sich um die Bereitschaft wie um<br />
eine Empfängnis, die immer und überall ihn dort antreffen sollte, wo nichts ihr Fremdes oder<br />
Feindliches ihn besetzt hielt, ihn an Zufälliges und Abhaltendes verstreute.<br />
Aus Schweden (Furuborg, Jonsered, am 19. Okt. 1904) schon hatte er geschrieben:<br />
»Soll mein Leben besser werden, so muß ich vor Allem in diese beiden Dinge denken:<br />
Kraft und Gewissen. – – arbeiten muß ich lernen. Das sage ich mir seit Jahren und pfusche<br />
doch so weiter. Davon das arge Gewissen; um so ärger wenn andere Vertrauen zu mir<br />
haben.«<br />
Seine Gewissensempfindlichkeit nahm nur um so mehr zu, da er so viel weniger für ihre<br />
Beschwichtigung tun konnte, als, vergleichsweise, ein Handelnder täte, der in der Handlung<br />
selbst sein ihm aufgetragenes Ziel erreicht. Wenn er hätte beten dürfen, wie ein Kind seinen<br />
Vater auf Erden bittet, der es anhört und erhört, er hätte um nichts anderes gebeten als<br />
darum, zu jeder Zeit auffindbar zu bleiben »in des Vaters Wohnung«. Es gab für ihn nur dies<br />
oder Obdachlosigkeit. Es gab für ihn nicht Werte verschiedener Art und darunter auch<br />
solche, die besonders dem Künstler gemäß sind; der Wert der Werte mußte auch den<br />
Künstler als seinen eigentlichen mitumfassen. Was ihn von andern unterschied, war dies<br />
unentwegte Zugehen auf das Eine, Letzte, auch des Künstlers in ihm, der unbeschreibliche<br />
Ernst der Frage, ob oder wann er Zutritt dazu habe. Was ihn unterschied, noch jenseits aller<br />
künstlerischen Würdigung – was ihm von der Stirn strahlte, auch dann noch, wenn er am<br />
Boden lag, war dies: nie gab es jemanden, der heiligere Sorgen hatte als er.<br />
Mit den Jahren stieg seine Ungeduld mit sich:<br />
»Wiederanfangen. Freilich, schon beim Schulheft half es dann, eine neue Seite<br />
aufzuschlagen; diese hier – – steht nun wirklich voll der beschämendsten Fehler, roth über<br />
roth, und wo einer noch von selbst ausblieb vorher oder sich besann, da steht das endlich<br />
Richtige über einer fast ganz durchradierten Stelle, auf dem Häutchen eines Lochs.« (Paris,<br />
17, rue Campagne Première, am 21. Oktober 1913.)<br />
Schließlich gab es wohl keine Not, selbst grausigste, die er nicht auf sich genommen hätte<br />
fürs Gelingen; längst fürchtete er nicht sie mehr. Anderthalb Jahre zuvor (Schloß Duino, am<br />
ersten März 1912) bemerkt er:<br />
»Früher hats mich zuweilen gewundert, daß die Heiligen so darauf hielten, sich<br />
körperliche Übelstände zuzumuthen, jetzt versteh ich, daß diese Lust zu Schmerzen, bis<br />
hinein in die Qualen des Martyriums, eine Eile und Ungeduld war, auch vom Ärgsten, das<br />
von dieser Seite kommen kann, nicht mehr unterbrochen und gestört zu sein.«<br />
Im gleichen Brief steht auch:<br />
»Ich sehe manchen Tag alle Kreatur mit der Sorge an, es könnte in ihr ein Schmerz<br />
ausbrechen, der sie schreien macht, so groß ist meine Angst vor dem Mißbrauch, den der<br />
Körper in so vielem mit der Seele treibt, die in den Thieren Ruhe hat und in den Engeln erst<br />
Sicherheit.«<br />
Der Körper ist es, der sich nicht in die erstrebte Einheit fügen läßt, sich ihr<br />
entgegenstemmt, zwischen Tier und Engel einklemmt (Paris, am 26. Juny 1914):<br />
»Mein Körper ist wie eine Falle geworden, – – eine Oberfläche voller Fallen, in denen<br />
gequälte Eindrücke absterben, ein starres unleitendes Gebiet, und weit weit wie<br />
mitten in einem erkaltenden Gestirn das wunderbare Feuer, das nur noch vulkanisch<br />
austreten kann, da und dort, unter Erscheinungen, die der gleichgültigen Oberfläche, wie<br />
Verheerung, verwirrend und gefahrvoll sind – –«<br />
Das Unüberwindbare, Unablösbare dieses Stückes Selbst, das zugleich ein Fremdstück<br />
wie irgendein Außenbestandteil für unser Innen-Erlebnis bleibt, brachte in Rilke, le länger, je<br />
mehr, eine Trübsal hervor, die sich zur Abkehr vom physisch Bedingten überhaupt steigerte.<br />
Dies ist der Punkt, wo seiner Dichtung der »Engel« erstanden ist. Er erstand ihm aus dem<br />
Drang nach dem, was noch »in den Thieren Ruhe hat und in den Engeln erst Sicherheit«, –<br />
aus dem Drang, sich vor Vollkommenem zu neigen – neben sich aufgerichtet zu sehn das,