15. MainzerMedienDisput vom 25. November 2010.pdf - Talk-Republik
15. MainzerMedienDisput vom 25. November 2010.pdf - Talk-Republik
15. MainzerMedienDisput vom 25. November 2010.pdf - Talk-Republik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
© Illustration: Gerhard Mester<br />
INTERESSANT VOR RELEVANT?<br />
ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT UND IDENTITÄTSVERLUSTE –<br />
WOHIN STEUERT DER JOURNALISMUS?<br />
Dokumentation<br />
<strong>15.</strong> <strong>MainzerMedienDisput</strong><br />
und Vorschau 2011
Das Trainingsbuch zur professionellen<br />
Informationsbeschaffung<br />
> Erfolgreich recherchieren mit der richtigen Technik!<br />
Thomas Leif (Hrsg.)<br />
Trainingshandbuch<br />
Recherche<br />
Informationsbeschaffung<br />
professionell<br />
2., erweiterte Auflage<br />
ÖFFENTLICHE KOMMUNIKATION MEDIEN KOMMUNIKATORFORSCHUNG MEDIEN<br />
SYSTEM JOURNALISMUS WERBUNG MEDIENWIRTSCHAFT ONLINEKOMMUNIKA<br />
TION MEDIENRECHT PUBLIC RELATIONS MEDIENMANAGEMENT POLITISCHE<br />
KOMMUNIKATION PRINTMEDIEN HÖRFUNK FERNSEHEN MEDIENWIRKUNG<br />
MEDIENINHALTE LOKALE KOMMUNIKATION MEDIENÖKONOMIE ELEKTRO<br />
Thomas Leif (Hrsg.)<br />
Trainingshandbuch Recherche<br />
Informationsbeschaffung professionell<br />
2., erw. Aufl. 2010. 232 S. Mit 23 Abb. u. 2 Tab. Br.<br />
ca. EUR 29,95<br />
ISBN 978-3-531-17427-3<br />
Erfahrene Recherche-Trainer haben ein Team gebildet und<br />
zahlreiche Modellkurse, Fallbeispiele, Übungen, Tipps und<br />
Tricks zur Optimierung der Recherche-Techniken zusammengestellt.<br />
Eine Fundgrube für alle, die Recherche besser<br />
vermitteln wollen und all diejenigen, die sich beruflich der<br />
Informationsbeschaffung widmen.<br />
Das Trainingsbuch wird von der Journalistenvereinigung<br />
Netzwerk Recherche herausgegeben.<br />
Stimmen zur 1. Auflage<br />
„Das Trainingsbuch ist mit seinen Lehrbeispielen und Übungen<br />
insbesondere für Ausbilder und Seminarleiter attraktiv.“<br />
journalist<br />
„ (...) ein nützliches Kompendium, das Journalisten ebenso<br />
hilft wie denjenigen, die Journalisten ausbilden.“<br />
WDR (Die Story)<br />
Erhältlich im Buchhandel oder beim Verlag.<br />
Änderungen vorbehalten. Stand: 3/2010.<br />
VS Verlag für Sozialwissenschaften<br />
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH<br />
Abraham-Lincoln-Straße 46<br />
65189 Wiesbaden<br />
tel +49 (0)611 / 78 78 - 285<br />
fax +49 (0)611 / 78 78 - 420<br />
www.vs-verlag.de<br />
Wissen entscheidet
INTERESSANT VOR RELEVANT?<br />
ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT UND IDENTITÄTSVERLUSTE –<br />
WOHIN STEUERT DER JOURNALISMUS?<br />
Dokumentation 2010 und Vorschau 2011<br />
Medienpartner des <strong>MainzerMedienDisput</strong>s:<br />
Unsere Sponsoren und Wirtschaftspartner:
„Man glaubt gar nicht, wie schwer es oft ist, eine Tat in einen Gedanken umzusetzen.“<br />
Karl Kraus<br />
Der Kulturkampf um das „Wirtschaftsgut“ oder „Kulturgut“ Medien –<br />
Medienpolitik und Medienkritik muss wieder öffentlich verhandelt werden.<br />
Das „Handelsblatt“ hat jüngst wieder einmal einen „Realitätsverlust der Nimmersatten“<br />
festgestellt. Die Diagnose des „Medienexperten“ ist wie immer furios: „Das öffentlichrechtliche<br />
System in Deutschland ist krank. Es ist finanziell außer Rand und Band. Es ist<br />
aufgeblasen und ineffizient.“<br />
Die Kanzlerin assistierte zeitgleich auf dem Kongress des Bundesverbandes der Deutschen<br />
Zeitungsverleger (BDZV) Mitte September: „Private Medienunternehmer brauchen ge -<br />
nügend Spielraum, ihre Investitionen müssen sich rechnen.“ ARD und ZDF sollten deshalb<br />
prüfen, ob ihre Internet-Angebote auch ihrem gesetzlichen Anspruch entsprächen.<br />
„Das ist auch bei den Smartphone-Applikationen immer wieder abzuwägen.“ Damit<br />
ergriff die Kanzlerin Partei für die Verleger, die sich mit aller Wucht gegen die öffentlichrechtlichen<br />
werbefreien Wettbewerber wenden. Nur weil sie einen sehr überschaubaren<br />
Teil ihrer bereits von den Gebührenzahlern finanzierten Angebote auch über Smartphones<br />
anbieten und damit angeblich ein Wachstumsmodell der Verleger gefährden.<br />
Warum hat sich die Kanzlerin, warum haben sich die Verleger nicht – ihren sonst selbstverständlichen<br />
Credo folgend – für mehr Wettbewerb und publizistische Gegengewichte<br />
zur Wahrung der Presse- und Meinungsfreiheit eingesetzt? Warum sagen sie nicht:<br />
Konkurrenz belebt das Geschäft, ganz besonders wenn es um die Garantie von Pluralismus<br />
und hochwertigen Journalismus geht? Warum haben Sie nicht auf die ansehnlichen<br />
Bilanzen der großen Verlage im vergangenen Jahr verwiesen und Investitionen in mehr<br />
und besseren Journalismus gefordert?<br />
Auf diese Fragen haben sie keine Antwort, weil sie den „Realitätsverlust der Nimmersatten“<br />
bedienen und das Geschäftsmodell „Medien“ für sie längst den unregulierten Markt -<br />
gesetzen eines reinen Wirtschaftsgutes folgt. Das Kulturgut „Medien“, das auf der Basis<br />
von Wettbewerb und Konkurrenz umfassende Information, Orientierung und Aufklärung<br />
bietet, kommt dabei unter die Räder.<br />
Dabei nutzt der beklagte Wettbewerb dem Souverän, den Mediennutzern und Verbrauchern.<br />
Gäbe es die Tagesschau in der ARD, heute im ZDF und weitere hochwertige Produktionen<br />
nicht, würde RTL keine solide Hauptnachrichten-Sendung und kein an spruchs volles<br />
Nachtmagazin senden. Der Konkurrenzdruck der „nimmersatten“ öffentlich-rechtlichen<br />
Programmanbieter bewahrt die „Privaten“ vor dem Absinken in die publizistische Be deu -<br />
tungslosigkeit ihrer Scripted-Reality-Welt, die Sozial-Pornos als Wirklichkeit ausgibt.<br />
Ursprünglich war genau dies die Idee der Pioniere einer neuen Medienpolitik, die mit<br />
der Forcierung des kommerziellen Rundfunks mehr Programm-Pluralität, mehr Qualitäts-<br />
Konkurrenz und mehr journalistischen Wettbewerb wollten. Der Medien-Machtpolitiker<br />
Edmund Stoiber hat in einem bemerkenswerten „Plädoyer für eine aktive Medienpolitik“*<br />
2
diese „Ent-Authorisierung der Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (als) ein<br />
gewünschte(n) Begleiteffekt“ bezeichnet. „Es ist ermutigend, dass inzwischen die privaten<br />
Anbieter vor allem RTL und auch ProSiebenSat1, im Nachrichtenmarkt ein wichtiges<br />
Feld sehen. Insgesamt aber überwiegt die Enttäuschung auf konservativer Seite, dass<br />
die fundierte politische Berichterstattung zurückgeht und von Unterhaltung ersetzt<br />
wird.“ Eine Bilanz, die sich die Medienkommissionen aller Parteien einmal vorlegen sollten.<br />
Doch hier geben Politiker wie der Chef der sächsischen Staatskanzlei, Johannes<br />
Beermann (CDU), den Ton an. In einem „vertraulichen Zielpapier“ formuliert er bereits<br />
im Frühjahr eine scharfe Kritik am gesamten Kurs von ARD und ZDF und sieht hier einen<br />
„schleichenden Prozess der Selbstkommerzialisierung.“<br />
Von diesen Privatisierungs-Pionieren ist jedoch nur noch lautes Schweigen zu vernehmen,<br />
wenn immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Versammlungen, Konferenzen und Tagungen<br />
den Stil- und Sittenverfall sowie den Realitätsverlust der kommerziellen (elektronischen)<br />
Medien kritisieren. Nur diese Bürger-Kritik findet in der Öffentlichkeit keinen Resonanzboden,<br />
keine aufmerksamen Medienpolitiker, die ihren Gremienauftrag als Bürger-Verpflichtung<br />
wahrnehmen. Die vielzitierte ‘kritische Masse der Zivilgesellschaft‘ ist ein<br />
Wunschtraum.<br />
„Medienpolitik ist Machtpolitik“ – dieses Vermächtnis des früheren NRW-Ministerpräsidenten<br />
Heinz Kühn – gewinnt in einer Zeit zunehmender Legitimitäts-Auszehrung von<br />
Parlamenten und Institutionen sowie bedenklicher politischer Apathie an Bedeutung.<br />
Nicht nur Bundestagspräsident Norbert Lammert weist unermüdlich auf diesen Zusammenhang<br />
hin. Deshalb sind Foren und Plattformen für medienpolitischen Streit über<br />
wichtige Fragen unersetzlich. Argumente und Positionen, Begründungen und Erklärungen<br />
für Programm-Prioritäten, Defizite und Fehlentwicklungen müssen auf offener Bühne in<br />
Rede und Gegenrede ausgetragen werden. Solche Debatten sind das Salz einer gesunden<br />
journalistischen Erde. Für den Essener Politikwissenschaftler Claus Leggewie bestehen<br />
die Trendmuster der medienzentrierten Demokratie aus Personalisierung, Entsachlichung,<br />
Spielcharakter und konfrontativem Negativismus. Der frühere ZDF-Intendant<br />
Dieter Stolte formuliert vorsichtiger, wenn er die Trivialisierung und Verflachung der<br />
Medieninhalte und negative Programmentwicklungen diagnostiziert. Beide Positionen<br />
fordern aber medienpolitische und journalismuskritische Grundsatzdebatten heraus.<br />
Seit 15 Jahren bemüht sich der <strong>MainzerMedienDisput</strong> darum, einen kleinen (Diskussions)-Beitrag<br />
zu dieser verschütteten Debatte zu leisten. Auch wenn solche Diskurse für<br />
manche ein „Realitätsverlust der Nimmersatten“ sein mögen. Hermann Hesse ist bei<br />
diesem Unterfangen ein guter Begleiter: „Damit das Mögliche entsteht, muss immer<br />
wieder das Unmögliche versucht werden.“<br />
Thomas Leif<br />
* in: Siegfried Schneider / Hans Zehetmair (Hrsg.), Perspektiven einer wertorientierten Medienpolitik,<br />
München 2011 : 44 ff. (Schriftenreihe der Hans-Seidel-Stiftung)<br />
Die Aufsätze vorwiegend von führenden CSU-Politikern sind eine fulminante Quelle für den praktischen<br />
Nachweis einer machtzentrierten Medienpolitik. (www.hss.de)<br />
3
4<br />
† Manfred Helmes
Wir trauern um Manfred Helmes<br />
Am 6. September 2011 verstarb im Alter von 61 Jahren Manfred Helmes nach kurzer,<br />
schwerer Krankheit überraschend. Der <strong>MainzerMedienDisput</strong> verliert mit Manfred<br />
Helmes einen engagierten Förderer der ersten Stunde. Mit Leidenschaft und Tatkraft<br />
hat er den Aufbau und die Entwicklung des Mainzer Medienkongresses vorangetrieben.<br />
Sein Schaffen war dem Medienstandort Rheinland-Pfalz und der Förderung<br />
eines kritischen, unabhängigen Journalismus gewidmet. Die Mitglieder der Projektgruppe,<br />
Gesellschafter und Veranstalter schätzten sein fachliches Engagement und<br />
seinen kompetenten Rat. Seine Kollegialität, Freundschaft und menschliche Wärme<br />
wird schmerzhaft vermisst.<br />
Manfred Helmes war seit dem 30. Oktober 2000 Direktor der Landeszentrale für<br />
Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK). Der studierte Jurist war zwischen<br />
1976 und 1997 für den DGB, zunächst als Gewerkschaftssekretär für Arbeits- und<br />
Sozialrecht, dann als Abteilungsleiter für Beamtenrecht und öffentlicher Dienst<br />
tätig. Bereits seit 1979 befasste sich Helmes mit den Spezialgebieten Medienrecht,<br />
Medienpolitik und neue Technologien. Über viele Jahre prägte er als Mitglied der<br />
Versammlung der LPR die Mediendiskussion in Rheinland-Pfalz. Helmes trat im<br />
Frühjahr 1999 in den Dienst der LMK und übernahm nach der Einrichtung der<br />
Abteilung „Medienkompetenz und Medienpädagogik“ die Leitung dieses neuen<br />
Schwerpunktbereiches.<br />
Manfred Helmes war ein leidenschaftlicher Medienpolitiker. Als Stellvertretender<br />
Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM), als Stellvertretender<br />
Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) und in<br />
zahlreichen anderen Funktionen engagierte er sich nachhaltig in Fragen der Medienregulierung,<br />
des Jugendschutzes und der Medienkompetenz. Auch den Entwicklungsprozess<br />
der Medienanstalten und ihrer gemeinschaftlichen Arbeit prägte er<br />
maßgeblich. Für ihn bedeutete Medienpolitik, die wirtschaftlichen Interessen der<br />
Unternehmen und das gesellschaftspolitische Anliegen einer Bürgergesellschaft<br />
miteinander in Einklang zu bringen.<br />
Helmes war als Medienpolitiker mit klaren Positionen und weitblickenden Zielen in<br />
Rheinland-Pfalz und bundesweit geachtet. Sein unermüdlicher Einsatz für die<br />
Allgemeinheit und seine Fürsorge für die Mitarbeiter waren weithin geschätzt.<br />
„Ich habe Manfred Helmes als zuverlässigen Verhandlungspartner auf Seiten des<br />
DGB und auch als streitbaren und engagierten Medienpolitiker kennen und schätzen<br />
gelernt“, sagte Ministerpräsident Beck bei der Trauerfeier in Stromberg. Helmes<br />
habe sich stets für die Balance zwischen dem gebührenfinanzierten öffentlichrechtlichen<br />
Rundfunk und der wirtschaftlich orientiert arbeitenden Medienunter-<br />
5
nehmen stark gemacht. Zwar sei er am Anfang ein Gegner des privaten Rundfunks<br />
gewesen, habe aber früh erkannt, dass dieser nicht aufgehalten werden könne. So<br />
habe er als Medienrechtler dann schnell seinen Beruf und seine Berufung in der<br />
Medienaufsicht gefunden. Ministerpräsident Beck: „Die Medienlandschaft nicht<br />
nur in Rheinland-Pfalz hat Manfred Helmes viel zu verdanken. Dass er trotz seines<br />
vielfältigen und anstrengenden Wirkens nie seine angenehme menschliche Seite<br />
und seinen ihm eigenen Humor verloren hat, hält die Erinnerung an Manfred Helmes<br />
auch nach seinem plötzlichen Tod dauerhaft wach. Mit Manfred Helmes verliert<br />
Rheinland-Pfalz einen herausragenden Medienpolitiker und engagierten Gewerkschafter.<br />
Ich trauere um einen Weggefährten, dem ich in langjähriger Freundschaft<br />
verbunden war.“<br />
Mit großem Stolz hat Manfred Helmes das 20-jährige Jubiläum des privaten Rundfunks<br />
im Jahre 2004 in Mainz erfüllt. Was mit dem „Urknall“ des Kabelpilotprojektes<br />
in Ludwigshafen begann, wurde am 16. und 17. Juni mit zahlreichen Tagungen,<br />
Symposien und einer großen Open-Air-Veranstaltung im Kurfürstlichen Schloss,<br />
dem Staatstheater und dem Landtag Rheinland-Pfalz festlich begangen. Jürgen<br />
Doetz und Manfred Helmes ist es gemeinsam zu verdanken, dass diese Veranstaltung<br />
trotz aller Widerstände nicht in Berlin sondern in Mainz stattfinden konnte.<br />
In seinen Beiträgen zum <strong>MainzerMedienDisput</strong> hat Manfred Helmes immer wieder<br />
konsequent die Berechtigung des „kommerziellen Standbeins“ des dualen Systems<br />
vertreten. Dazu gehörte auch die Forderung nach einheitlichen Bewertungskriterien<br />
insbesondere im Jugendschutz, der Werbung und dem Sponsoring in beiden Systemen.<br />
Er wurde nicht müde, zur Funktionserfüllung der Medien im Sinne des<br />
Grundgesetzes, Art. 5, aufzurufen und Staatsferne, Sicherung der Meinungsvielfalt<br />
und die Verhinderung von Meinungsmacht einzufordern. Seine beruflichen Erfahrungen<br />
in der Medienkontrolle haben ihn gelehrt, dass die gesellschaftliche Aufsicht<br />
nie zur politischen Kontrolle entarten darf. Dieses Bewusstsein hat auch seine<br />
Tätigkeit für den <strong>MainzerMedienDisput</strong> geprägt.<br />
Die Unabhängigkeit der inhaltlichen Planung der MedienDispute durch eine journalistische<br />
Projektgruppe war für ihn ein festes Prinzip, dafür hat er sich im Gesellschafterausschuss<br />
mit seinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder eingesetzt.<br />
Manfred Helmes in seiner Eröffnungsrede zum 14. <strong>MainzerMedienDisput</strong> 2009:<br />
„Wir leisten uns mit dem MMD eine Veranstaltung die den Anspruch erhebt, dem<br />
kritischen und gesellschaftspolitisch verantwortlichen Journalismus eine Schneise<br />
zu schlagen mitten in einer Medienwelt, die geprägt von einer sich beschleunigender<br />
Konvergenz, einer damit einhergehenden Konzentration der Akteure und einer<br />
Verengung der Handlungsspielräume zur Realisierung dieses Anspruchs. Wir werden<br />
6
uns in Mainz nicht darauf beschränken, in Wehmut vermeintlich besserer Zeiten zu<br />
gedenken, sondern uns in den Gesprächsrunden zu Themenblöcken wie Finanzierung/Werbewirtschaft,<br />
europäische Entwicklungen, Technik/Digitalisierung und<br />
ethischen Fragen des Journalismus auseinandersetzen. Dafür steht der <strong>MainzerMedienDisput</strong>,<br />
sein Markenzeichen ist es die Rolle des Rundfunks in der demokratischen<br />
Gesellschaft zu hinterfragen und das kritische Gewissen im täglichen Stellungskampf<br />
zwischen Qualität und Quote zu sein.“<br />
Lieber Manfred Helmes, wir werden gemeinsam bemüht sein, diesem Anspruch<br />
gerecht zu werden und in Deinem Sinne weiterzuarbeiten.<br />
Die Projektgruppe, Gesellschafter und Veranstalter<br />
des <strong>MainzerMedienDisput</strong>s<br />
7
INHALT<br />
2 Vorwort von Thomas Leif<br />
4 Wir trauern um Manfred Helmes<br />
Begrüßungen<br />
11 Anke Fuchs, Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung<br />
17 Ines Pohl, taz-Chefredakteurin – Leuchtturm-Preisrede<br />
Eröffnungs-Rede<br />
25 Christian Bommarius, Berliner Zeitung<br />
32 TEIL I: DOKUMENTATION DER PANEL-ERGEBNISSE<br />
33 Auftakt: „Tatort Redaktion“<br />
35 Dr. Eva-Maria Schnurr<br />
41 Panel 1: „Ermittlungen in eigener Sache – Medien vor dem Kadi“<br />
43 Fritz Pleitgen<br />
45 Peter Limbourg<br />
47 Panel 2: „ Beim Rückzug ins Lokale: örtlich betäubt“<br />
49 Prof. Dr. Wiebke Möhring<br />
51 Dr. Wolfram Kiwit<br />
55 Panel 3: „Islamphobie & Missbrauchshysterie –<br />
wenn Medien nicht mehr funktionieren“<br />
56 Bruder Paulus Terwitte<br />
61 Panel 4: „David gegen Goliath – die digitale Steinschleuder“<br />
62 Thomas Mrazek<br />
68 Dr. Christian Stöcker<br />
71 Peter Schink<br />
73 Hardy Prothmann<br />
75 Stefan Plöchinger<br />
8
84 TEIL II: MEDIENPOLITISCHE ANALYSEN@JOURNALISTISCHE REFLEXIONEN<br />
85 Wofür stehen wir?<br />
Von Tom Schimmeck<br />
99 Wie viel Charisma braucht die Demokratie und<br />
wie viel Charisma verträgt die Demokratie?<br />
Von Ulrich Sarcinelli<br />
109 Die Symbiose der politischen und medialen Klasse in Deutschland<br />
Von Thomas Leif<br />
121 Die Steine des Sisyphos<br />
Von Günter Grass<br />
129 Von der Medien- zur Stimmungsdemokratie<br />
Von Thymian Bussemer<br />
136 Rede zur Lage des Journalismus<br />
Von Frank A. Meyer<br />
146 „ ... und unseren täglichen <strong>Talk</strong> gib’ uns heute!“<br />
Von Bernd Gäbler<br />
149 „Komplizierte Geschichten einfach erzählen.“<br />
Thomas Leif im Gespräch mit Seymour Hersh<br />
158 Wichtig und falsch<br />
Von Bernhard Pörksen<br />
162 Der Drang nach Aufmerksamkeit<br />
Interview mit Bernhard Pörksen<br />
166 Die „Erfolge“ der PR und die „Krisen“ der vierten Gewalt<br />
Von Michael Behrent<br />
178 Steuert Öffentlichkeitsarbeit die Medien?<br />
Von Klaus Kocks<br />
185 Zwischen Platon und Postmoderne –<br />
Glückwünsche zu 50 Jahren Panorama<br />
Von Olaf Scholz<br />
191 Der Stachel im Journalisten-Sitzfleisch<br />
Von Tom Schimmeck<br />
198 Programm <strong>MainzerMedienDisput</strong> 2011<br />
204 Impressum<br />
9
IMPRESSIONEN
Anke Fuchs, Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung<br />
Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren,<br />
ich freue mich sehr, anlässlich des <strong>15.</strong> <strong>MainzerMedienDisput</strong>es heute zu Ihnen zu<br />
sprechen.<br />
Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist fördernder Mitveranstalter des MMD – neben der<br />
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz.<br />
Vor 15 Jahren führte die FES erstmalig den MMD durch. Wir wollten hier in der Medienstadt<br />
Mainz eine Kommunikationsplattform für den kritischen Austausch von Ideen<br />
zwischen Medienschaffenden und Medienverantwortlichen ermöglichen. Der Mainzer<br />
MedienDisput sollte ein Forum für alle sein, denen eine funktionierende, demokratische<br />
Öffentlichkeit am Herzen liegt.<br />
Dieses Ziel gilt bis heute unverändert!<br />
Die im MMD strittig diskutierten Themen bezogen sich in den letzten Jahren:<br />
• auf die Kommerzialisierung der Medien und die daraus resultierenden Veränderungen<br />
in der Berichterstattung;<br />
• auf das Wechselverhältnis zwischen Politik, Wirtschaftseliten und Medienschaffenden<br />
und den damit verbundenen Einflussnahmen auf die Berichterstattung;<br />
• auf die Selbstreflexionen des Journalismus nach ethischen Maßstäben;<br />
• auf die Nachwuchsförderung und Personalrekrutierung in den Medien, sowie<br />
• die Struktur- und Richtungsdiskussionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk<br />
angesichts der Herausforderungen von privaten Anbietern und Digitalisierung.<br />
So ist der MMD im Laufe seines Bestehens zu einem Wächter und Mahner geworden:<br />
• Medienverantwortliche in Politik und Wirtschaft sowie Journalisten sollen immer<br />
11
wieder an ihre Verantwortung für eine demokratische Gesellschaft erinnert werden;<br />
• sollen sich immer wieder fragen, wie sie dieser Verantwortung angesichts<br />
eines ständigen gesellschaftlichen, ökonomischen, kulturellen und technologischen<br />
Wandels gerecht werden können.<br />
Die Wechselwirkung von Politik und Medien ist heute ganz besonders bestimmt<br />
durch Geschwindigkeit und Unterhaltung:<br />
Die Umschlaggeschwindigkeit von Informationen ist atemberaubend und das ‚storytelling’<br />
– der Unterhaltungswert oder die Dramatik einer Geschichte – ist für die<br />
Auswahl von Nachrichten oft wichtiger als der Inhalt selbst.<br />
Die Politik hat sich auf diese Veränderungen längst eingestellt: Professionelle Politiker<br />
wissen, dass die Inszenierung politischer Inhalte deren wahrgenommene<br />
Bedeutung steigert, man weiß um die Macht von Bildern und die strategische<br />
Bedeutung einer telegenen Präsentation im Fernsehen.<br />
Politik ist stärker auf Medien angewiesen als umgekehrt! Medien entscheiden<br />
darüber, was die Öffentlichkeit als relevantes Problem empfindet. Die politische<br />
Klasse verfügt über geringere Möglichkeiten politische Handlungsfelder zu thematisieren.<br />
Oftmals sind Politiker die Getriebenen:<br />
Medien fokussieren ein Problem – Politiker sollen die Lösung formulieren. Für den<br />
Transport ausgewogener Argumente bleibt wenig bis gar keine Zeit – so bleibt das<br />
eigentlich Politische in den Medien oftmals unsichtbar.<br />
Und nur scheinbar haben wir es mit einer Vervielfältigung der Medienkanäle zu<br />
tun: die sinkenden Personenzahlen in den Redaktionen verursachen in der Berichterstattung<br />
rechercheferne Oberflächlichkeit. Die zunehmende Boulevardisierung<br />
einst inhaltsreicher Leitmedien ist die daraus resultierende traurige Entwicklung.<br />
Der große Verlierer dieser Prozesse ist die aufgeklärte öffentliche Meinung.<br />
Politiker müssen in der Demokratie auch auf die Wähler achten. Politiker und Journalisten<br />
sollen politische Entscheidungen und Absichten transparent machen.<br />
Was bedeutet es jedoch für die politische Kommunikation, wenn ein einziges Statement<br />
eines Ministers ausreicht, um massive Spekulationsbewegungen zu Lasten<br />
ganzer Volkswirtschaften und Währungen in Gang zu setzen? –<br />
Ist hier nicht der Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft infrage gestellt?!<br />
12
Der <strong>15.</strong> MMD ist eine gute Möglichkeit, erneut das Wechselverhältnis von Politik<br />
und Medien zu diskutieren.<br />
Kritische Analyse gesellschaftlicher Machtstrukturen und Selbstreflexion im Mediensystem<br />
sind die Voraussetzungen für die Bewältigung neuer Herausforderungen<br />
angesichts eines wachsenden Verlustes von Ansehen und Vertrauen gegenüber<br />
den Eliten von Wirtschaft und Politik.<br />
Wenn allerdings auch Journalisten eher die Politikverachtung statt das Verstehen<br />
von Politik fördern, leidet unsere politische Kultur und der Akzeptanzverlust von<br />
Demokratie schreitet voran.<br />
Thema und Programm des diesjährigen Mainzer-Medien-Disputs bieten Rahmen<br />
und Inhalt darüber zu diskutieren.<br />
Meine Damen und Herren,<br />
bei aller kritischen Betrachtung will ich dennoch feststellen: wir haben in Deutschland<br />
eine gute Medienstruktur, um die uns viele in der Welt beneiden!<br />
Wir verfügen über eine große Anzahl von Journalistinnen und Journalisten, die für<br />
einen kritischen und unabhängigen Journalismus einstehen; dies dokumentieren<br />
eine Vielzahl von investigativen Beiträgen, besonders in den öffentlich-rechtlichen<br />
Sendeanstalten – auch wenn ich mir an der einen oder anderen Stelle einen besseren<br />
Sendeplatz wünschen würde!<br />
Wir haben Pressefreiheit und unabhängige Medien!<br />
Diese Errungenschaften dürfen wir nicht einbüßen.<br />
Wir in der Friedrich-Ebert-Stiftung sehen darin das Ziel unserer Arbeit: die Demokratie<br />
in unserer Gesellschaft und auch in anderen Gesellschaften weiter zu entwickeln,<br />
und mehr Menschen zum demokratischen Handeln zu ermutigen!<br />
Deshalb ist für uns in der Friedrich-Ebert-Stiftung die Förderung eines unabhängigen<br />
und qualitätsorientierten Journalismus eine herausragende Aufgabe.<br />
Meine Damen und Herren,<br />
bevor ich zum Abschluss komme, noch zwei Bemerkungen:<br />
1. Auch in diesem Jahr haben wir wieder 25 Nachwuchsjournalisten zum MMD<br />
eingeladen. Im Rahmen eines begleitenden Workshops lernen sie die Grundlagen<br />
des Interviews und der Recherche. Sie werden sich Interviewpartner aus<br />
13
dem Publikum oder von den Panels suchen und erproben mit ihnen erste<br />
Interviews!<br />
Diesen jungen Journalistinnen und Journalisten gilt von hier aus mein ganz<br />
besonderer Gruß!<br />
2. Unsere Gesellschaft braucht das Ehrenamt. Ich möchte ganz herzlich den Mitgliedern<br />
der unabhängigen Projektgruppe des MMD für ihre professionelle<br />
und unermüdliche Programmerarbeitung danken:<br />
• Herrn Prof. Dr. Thomas Leif (SWR),<br />
• Herrn Thomas Meyer (SWR4) und<br />
• Herrn Michael Grabenströer (Frankfurter Rundschau).<br />
Herzlichen Dank für Ihr Engagement!<br />
Ich wünsche uns allen ein wirkliches Disputieren, auf das wir klüger und orientierter<br />
aus dieser Konferenz hervorgehen.<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
14
IMPRESSIONEN
IMPRESSIONEN LEUCHTTURM
Ines Pohl, taz-Chefredakteurin<br />
Lieber Herr Dr. Geissler,<br />
Lieber Herr Dr. Zielcke<br />
Lieber Arno Luik<br />
Lieber Thomas Leif<br />
Sehr geehrte Herren und Damen!<br />
In Stuttgart ist nichts mehr wie es war. Langjährige Doppelkopfrunden zerbrechen<br />
an der Frage, ob lieber oben oder unten, Fahrgemeinschaften lösen sich auf, bei<br />
Familienfeiern bleiben ganze Stuhlreihen leer. In der baden-württembergischen<br />
Landeshauptstadt regieren Wut und Mißtrauen. Die ganze <strong>Republik</strong> beobachtet<br />
staunend dieses Wunder von Stuttgart, an dessen Ende das Undenkbare möglich<br />
scheint: Nach fast 60-jähriger CDU-Regentschaft kann es sein, dass das schwarze<br />
Ländle am Ende nicht nur in grüne, sondern womöglich sogar rot-grüne Hände fällt.<br />
Schuld daran sind Arno Luik und Andreas Zielke.<br />
Und dafür werden sie heute <strong>vom</strong> Netzwerk Recherche mit dem „Leuchtturm für<br />
besondere publizistische Leistungen“ ausgezeichnet.<br />
Sie haben mit ihrer Arbeit ein Beben ausgelöst, dass – so befürchten die einen und<br />
hoffen die anderen – bis ins ferne Berlin seine Spuren hinterlassen wird.<br />
Dabei haben Sie mit ihrer Arbeit nicht nur politische Grundfeste im Daimler-Land<br />
– und außerhalb! – erschüttert. Sie haben Fakten ans Licht der Öffentlichkeit<br />
gebracht, die wichtige Entscheidungsträger lieber mit einem Millionenaufwand für<br />
alle Zeiten ganz tief in der Erde verbuddelt hätten. Sie haben einmal mehr gezeigt,<br />
welche Rolle den klassischen Tugenden des Journalismus nach wie vor zukommt,<br />
auch in einer Welt von twitter, Bloggern und webcams. Und sie haben gezeigt, wie<br />
fatal es für die Glaubwürdigkeit der Entscheidungsträger in einer demokratischen<br />
Gesellschaft ist, wenn die Medien hier versagen.<br />
17
18<br />
Durch die journalistische Arbeit von Luik und Zielke mußte der Rest der <strong>Republik</strong><br />
allerdings auch erkennen, dass die vermeintlich braven Schwaben durchaus in der<br />
Lage zum Massenprotest sind und sogar bereit, Kastanien zu werfen, wenn sie<br />
merken, dass sie von Politik und Wirtschaft an der Nase herumgeführt werden. Und<br />
dass der Remstalrebell mehr ist, als nur der Vater eines prominenten Bürgermeisters.<br />
Von wegen unkritisches Wohlstandsländle!<br />
Den Anfang hat dabei Arno Luik gemacht, mit seiner Artikel-Serie im Stern, die im<br />
Juli diesen Jahres als erstes über die wahren Machenschaften der Tunnelplaner<br />
berichtet hat.<br />
Mit seinem Text „Ab in die Grube“, lenkte er die nationale Aufmerksamkeit auf das<br />
umstrittene Bahn- und Bauprojekt. Bis dahin war es allenfalls ein Thema von regionaler<br />
Bedeutung in Württemberg. Mittlerweile hält es immer wieder das ganze<br />
Land in Atem. Luik war der erste, der beweisbare Argumente gegen das Milliardenvorhaben<br />
vorlegte. Er lieferte den Gegnern Argumente, die sie wieder hoffen ließen<br />
zu einem Zeitpunkt als es so schien, als würde ihnen die Luft ausgehen, als wäre<br />
der Kampf gegen die Mächtigen hoffnungslos — in einer Medienwelt, die sie,<br />
die Gegner, entweder ignorierte oder gegen sie verschworen schien. Nach den ersten<br />
Berichten des Bahnexperten vervielfachte sich der Widerstand, in jedem Teil<br />
seiner insgesamt 6-teiligen Artikelserie legte er immer neue Beweise vor und<br />
Dokumente, an denen keiner mehr vorbei kommt. Entsprechend war es wenig verwunderlich,<br />
dass der SPD-Politiker Erhard Eppler ausgerechnet im Stern dazu aufrief,<br />
über die Zukunft des Stuttgarter Kopfbahnhofes in einem Volksentscheid<br />
abstimmen zu lassen.<br />
Ein Aufruf, der Menschen im ganzen Land darüber diskutieren läßt, wie sehr die<br />
Bevölkerung in die Entscheidung über Großprojekte einbezogen werden muss, wo<br />
die Grenzen der repräsentativen Demokratie erreicht sind, und wann das Volk ganz<br />
direkt beteiligt werden muss, damit sich vor allem bei Jahrzehnte währenden Großprojekten<br />
nicht fast zwangsläufig der politisch-wirtschaftliche Klüngel durchsetzt<br />
gegen das wirkliche Wohl der Allgemeinheit.<br />
Nach Arno Luik begaben sich auch andere Vertreter überregionaler Medien in die<br />
Mühen der Ebene. An ganz herausragender Stelle: Andreas Zielcke von der Süddeutschen<br />
Zeitung, der zweite Journalist, der heute Abend ausgezeichnet wird. In<br />
seinem Beitrag „Der unheilbare Mangel“, der im Oktober in der SZ erschien, analysiert<br />
er mit bewundernswerter Akribie und, wie die Jury in ihrer Begründung sagt,<br />
„chirurgischer Präzision“, die Widersprüche und Tricks, die im S21 Genehmigungsverfahren<br />
immer wieder angewandt wurden. Nach Zielcke kann keiner, der es ehrlich<br />
meint, noch behaupten, dass die Bürgerinnen und Bürger doch hätten wissen können<br />
und wissen müssen, was da auf sie zukommt. Zielcke belegt mit unglaublicher<br />
Detailkenntnis, dass die Bürgerinnen und Bürger ganz bewusst und über viele Jahre<br />
und viele Instanzen hinweg fehlinformiert wurden.
Bei einem Journalistenpreis ist es ja immer auch spannend, auf die ganz konkrete<br />
Arbeit der KollegInnen zu blicken. Beide, weder Luik noch Zielcke, haben im klassische<br />
Sinne investigative „Heldentaten“ vollbracht. Sie sind weder in Kriegsgebiete<br />
gereist, noch haben sie in spektakulären Aktionen geheime Dokumente besorgt<br />
oder ganze Netzwerke gekapert.<br />
Eigentlich haben sie nichts anderes getan, als die klassischen Tugenden des Journalismus<br />
zu verfolgen.<br />
Luik hat sich schlicht geweigert, den großen Wortblasen der Politik aufzusitzen.<br />
Sätze wie „Stuttgart wird zum Herz Europas“ lachte der Bahnexperte einfach weg<br />
und zeigte ganz konkret, wie widersinnig, wie teuer und gefährlich die Verlagerung<br />
eines Großbahnhofes in den Untergrund wirklich ist. Luik saß auch nicht der PR-<br />
Finte von der vermeintlichen Zukunftsfeindlichkeit auf, durch deren Schmähcharakter<br />
sich einige, eigentlich kritische Köpfe davon abhielten ließen, ihren gesunden<br />
Menschenverstand einzusetzen. Mit viel Energie und Beharrungsvermögen konzentrierte<br />
er sich auf das, was den Kern jeder investigativen Recherche ausmacht.<br />
Mit seiner Arbeit sorgte er für die grundlegenden Informationen, mit denen eine<br />
ehrliche und anständige Analyse der Sinnhaftigkeit des Projektes überhaupt erst<br />
möglich wurde.<br />
Zielckes Leistung besteht in einer enormen Fleißarbeit. Vielleicht nicht unbedingt<br />
das, was Leute die „irgendwas mit Medien machen wollen“, gerne tun. Eigentlich<br />
sollte aber genau das die Alltagtsarbeit sein, vor allem der Journalisten und Journalistinnen<br />
vor Ort: Ins Archiv zu gehen und die Erzählungen der Politiker mit den<br />
Fakten der Geschichte zu konfrontieren. Dass genau dieses, im wahrsten Sinne des<br />
Wortes Naheliegendste, vor Ort nicht passiert ist, ist ein Umstand, mit dem ich<br />
mich gleich noch beschäftigen will. Aber nicht, ohne davor eine Person zu würdigen,<br />
die ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, und die aufs erste auch nicht so recht<br />
ins Bild passen will, handelt es sich doch hier um einen Journalistenpreis.<br />
Mit seinem beherzten Eingreifen in den Bahnhofskampf erwarb Heiner Geißler sich<br />
<strong>vom</strong> Tag 1 seines Schlichtertums an Kultstatus. Ob vorschnell, unbedarft oder<br />
super ausgebufft: Wer mag die wahren Gründe kennen, warum er mit einem solchen<br />
Knall die Schlichter-Bühne betrat und, offensichtlich ohne Absprachen, das ver -<br />
kündete, was die S21-Gegner schon lange forderten: Einen Baustopp, zumindest<br />
während der Zeit der Verhandlungen. Damit machte der Mann mit dem ver -<br />
schmitzen Lächeln im <strong>vom</strong> Leben beschriebenen Gesicht in jedem Falle eins klar:<br />
Ich, Heiner Geißler, suche mir die Wege aus, die ich beschreiten will, um diesen<br />
Konflikt aufzulösen.<br />
Mit seinem Vorstoß, die Schlichtungsgespräche öffentlich zu machen, gelang ihm<br />
nicht nur ein Quotenerfolg bei Phoenix. Er erreichte damit genau das, was über Jahre<br />
verhindert wurde: Echte Transparenz. Die Live-Übertragung zu nutzen, um eine<br />
demokratische Beteiligung herbei zu führen, war schon jetzt, noch vor dem<br />
Schlichterspruch und seinen Folgen, ausgesprochen erfolgreich. Damit ist es Ihnen,<br />
19
IMPRESSIONEN LEUCHTTURM
Herr Dr Geißler, gelungen, schon jetzt in erheblichem Maße zur Deeskalation und<br />
Befriedung in Stuttgart beizutragen.<br />
Und erlauben sie mir als gebürtiger Mutlangerin an dieser Stelle noch eine persönliche<br />
Anmerkung: Nicht nur Sie selbst freut es über alle Maße, dass Sie in letzter<br />
Zeit so oft im Fernsehen Tunnellll sagen dürfen. Das wärmt nicht nur im fernen Berlin<br />
die zahlreichen Schwabenherzen.<br />
Eigentlich, so hätte man meinen können, sollte die Auseinandersetzung um das<br />
Riesenprojekt Stuttgart 21 eine Sternstunde des deutschen Journalismus sein. Im<br />
Stuttgarter Kessel ist das anders. Anstatt dass den Zeitungsverkäufern die Blätter<br />
noch druckfrisch aus den Händen gerissen worden wären, wurden Abos bei den<br />
beiden Regionalblätter gekündigt, der Kiosk-Verkauf läuft seit Wochen mies, jahrzehntelange<br />
LeserInnen wenden sich von ihren Heimatzeitungen ab, weil sie ihnen<br />
fremd geworden sind.<br />
Traditionell sind die lokalen und regionalen Presseorgane da besonders gut, wo es<br />
hilft, einen Skat-Bruder zu haben, der auf dem Rathaus arbeitet oder sich im Verkehrsausschuss<br />
engagiert. Das erleichtert den Nachrichtenfluß ungemein, und<br />
macht investigativen Journalismus auch für jene möglich, die ohne teure Rechercheteams<br />
auskommen müssen. In Stuttgart war das anders. Mit Luik und Zielcke<br />
mussten Kollegen von außen kommen, um das zu tun, was eigentlich Standard<br />
sein sollte für unsere Zunft: vorbehaltlos hinhören, hinterfragen, eigene Fakten<br />
sammeln und in Beziehung setzen — und dann darüber berichten.<br />
Die Stuttgarter Zeitungen haben das nicht getan.<br />
Beschämend offensichtlich haben sie sich von Anfang an ein Stück weit als Pressesprecher<br />
des Projekts begriffen. Laut Stern hat Uwe Vokötter, der einstige Chef -<br />
redakteur der Stuttgarter Zeitung — kurz StZ — der heute bei der „Berliner Zeitung“<br />
arbeitet, inzwischen ehrlicherweise zugegeben, es sei ein „Fehler gewesen S21 zu<br />
StZ 21 zu machen“. Von ihrem aussenpolitischen Ressortleiter Adrian Zielke<br />
stammt immerhin der Satz:<br />
„Ohne die Zustimmung der ‘Stuttgarter Zeitung’ zu diesem Großprojekt würde, so<br />
vermute ich einfach mal, Stuttgart 21 nie gebaut werden.“ Den hat er übrigens kurz<br />
vor seinem Rückzug in den Ruhestand gesagt.<br />
Noch im Sommer diesen Jahres, also auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung,<br />
schrieb der stellvertretende Chefredakteur Michael Maurer: „Die Stuttgarter<br />
Zeitung hat schon lange eine klare Haltung zu Stuttgart 21: Wir sehen das Vorhaben<br />
positiv.“<br />
Nun gibt es in Stuttgart ja eigentlich zwei Zeitungen, eben jene „Stuttgarter Zeitung“,<br />
aber eben auch die „Stuttgarter Nachrichten“.<br />
In diesem Falle aber half das der interessierten Öffentlichkeit wenig. Denn hinter<br />
beiden Zeitungen steht ein Verlag: Die Südwestdeutsche Medienholding, die ordent-<br />
22
lich bei der Landesbank in der Kreide steht, besitzt ein publizistisches Monopol.<br />
Kritiker sagen: die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft, die die Geschicke der Landesbank<br />
lenken, bestimmen auch die Blattlinie in Stuttgart.<br />
Nun könnte man hoffen, dass wenigstens der Öffentliche Rundfunk eingesprungen<br />
wäre und sich als unabhängigere Kraft profiliert hätte. Aber auch hier: Fehlanzeige:<br />
Auch er verschlief in weiten Teilen das Thema. Kritiker sagen: der politische Einfluss<br />
auf den Sender habe bewußt lange Zeit verhindert, dass das Thema offensiv<br />
in der Weise aufgegriffen wurde, wie es angemessen gewesen wäre.<br />
Ähnliches trifft für das SWR Fernsehen zu. Bevor Arno Luik als erster durch seine<br />
überregionale Berichterstattung die Verantwortlichen mit sauber recherchierten<br />
Fakten bombardierte, übte sich der Sender in sehr merkwürdiger journalistischer<br />
Zurückhaltung gegenüber dem Megathema Stuttgart 21. Bis dahin wurde das Thema<br />
praktisch nur in Form von Nachrichten- und Magazinbeiträgen aufgegriffen. Statt<br />
sich mit dem Thema vor der Haustür zu profilieren, regiert eher die Furcht, es allen<br />
Seiten recht zu machen. Recht machen zu wollen.<br />
Was also lernen wir von Stuttgart 21?<br />
Wir sollten erkennen, dass es in Wahrheit nicht das Internet ist, das den Qualitätsjournalismus<br />
bedroht. Wir lernen, dass die Qualität des Journalismus da am meisten<br />
gefährdet ist, wo sie am dringendsten gebracht wird: Direkt vor Ort. Ganz nah dran.<br />
Dort, wo sich zeigt, welches Demokratieverständnis und welches Menschenbild<br />
diejenigen haben, die die Macht in unserem Land ausüben.<br />
Wir lernen, dass zu große räumliche Nähe offenbar journalistische Qualität verhindern<br />
kann, allemal in Zeiten, in denen sich einige wenige Großverleger und Zusammenschlüsse<br />
den Markt der Fläche aufteilen.<br />
Wir lernen, dass die wirtschaftlichen Abhängigkeiten oft zu groß sind, als dass man<br />
es sich bei so einem teuren Projekt wie S 21 glaubt leisten zu können, grundlegende<br />
Kritik zu üben. Erst als das Interesse von überregionalen Medien geweckt wurde,<br />
die unabhängig <strong>vom</strong> lokalen und regionalen Beziehungsgeflecht arbeiten, kamen<br />
die brisanten Geschichten zu S21 ans Licht, die heute ausgezeichnet werden.<br />
Wir lernen aber auch, dass es die Bürger selbst waren, die ihre regionalen Medienorgane<br />
zu einer kritischen Berichterstattung gezwungen haben. Und hierbei klug<br />
und kreativ die Möglichkeiten des Internets nutzen.<br />
Weil sie sich verweigert haben und ihre teilweise jahrzehntelange Verbundenheit<br />
aufgekündigt haben.<br />
Auch das sollte und kann Mut machen.<br />
Und auch hierfür gilt den drei Ausgezeichneten heute Abend unser Dank.<br />
In diesem Sinne noch einmal:<br />
Herzlichen Glückwunsch. Und ich tät saga: Oba bleiba!<br />
23
Journalisten sind Götter<br />
Eröffnungs-Rede von Christian Bommarius, Berliner Zeitung<br />
Übrigens sind wir sterblich. Obwohl wir doch Götter sind. Dass wir Götter sind, wissen<br />
wir schon lange. Wir wissen es seit dem Tag, an dem der Leipziger Drucker und<br />
Buchhändler Timotheus Ritzsch die erste Tageszeitung der Welt auf den Markt warf,<br />
seit dem 1. Juli 1650, also seit 360 Jahren. Ritzschs „Einkommende Zeitungen“ erschien<br />
sechs mal wöchentlich, Auflage 200 Exemplare. Erschien? Bücher werden publiziert,<br />
Urteile verkündet, Schauspiele, Opern oder Liederabende werden aufgeführt,<br />
aber Tageszeitungen: ERSCHEINEN. Bis zum 1. Juli 1650 erschienen den Menschen<br />
nur Sonne und Sterne, Fürsten und Könige von Zeit zu Zeit vor ihren Völkern, schon<br />
seltener „Gott und seine Engel in Blitz, Licht und Glanz“ (Grimms Wörterbuch).<br />
Nun aber erschien Ritzschs Tageszeitung über Leipzig, ging sechsmal wöchentlich<br />
morgens auf und abends wieder unter und mit ihr die Welt, wie Ritzsch sie schuf. Es<br />
war die Welt, wie sie noch heute weltweit in allen Zeitungen steht, die Welt der „Neueinlauffenden<br />
Nachrichten von Kriegs- und Welt-Händeln“. Jeden Tag eine neue Welt,<br />
sechs mal in der Woche, Welt-Schöpfung im 24-Stunden-Takt. Was für eine Leistung.<br />
Die Bibel kennt nur eine Schöpfung, die dauerte sechs Tage, dann war und ist bis<br />
heute Feierabend. Anders Ritzsch, anders seine Nachfolger in den späteren Jahrhunderten,<br />
anders die Scribenten, das Schreiberpack, die Spulwürmer des Geistes,<br />
die Moderatoren, die Korrespondenten, die Kommentatoren, die Journalisten, also<br />
wir, die wir teilhaben an diesem täglichen, seit einigen Jahren stündlichen, inzwischen<br />
sogar ununter brochenen Schöpfungswerk, wir – SCHÖPFUNGSGÖTTER. Dass wir<br />
Götter sind, steht außer Frage. Wer daran zweifelt – ganz sicher niemand hier im<br />
Saal – , ist entweder Troglodyt, aber die gibt es nicht mehr, oder Medienkritiker, die<br />
es zwar gibt, die aber niemand braucht. Gäbe es nicht die Welt, wie wir sie unentwegt<br />
schöpfen, dann wären wir arbeitslos. Aber gäbe es uns nicht, dann gäbe es keine Welt,<br />
keine Terrorwarnungen und keine Terrorattentate, keine Serienmorde, keine Sex-<br />
25
Skandale und keine Wirtschaftsgipfel, keine Kriege und keine Friedensschlüsse.<br />
Denn nur, was wir erscheinen lassen, wirft seinen Schein – er ist das Licht der Welt.<br />
Göttern kann man vieles nachsagen. Dem Blitzlenker Zeus sagten die alten Griechen<br />
nach, schneller als die Blitze, die er werfe, sei er mit seinen Seitensprüngen unterwegs.<br />
Odin wurde unterstellt, dass er die Welt aus einem Leichnam formte, und<br />
auch der Gott Abrahams und Moses’ stand im Ruf, grausam zu sein. Ero tomanie,<br />
Bigamie, Jähzorn, Rachsucht, Blutrunst, Mordlust, Habgier – es gibt fast keine üble<br />
Nachrede, die die Menschen nicht für ihre Götter fanden, und dennoch glaubten<br />
sie an sie und beteten sie an. Nur eine üble Nachrede war noch nie zu hören – dass<br />
ein Gott irre. Aus gutem Grund. Denn ein irrender Gott ist ein schwarzer Schimmel,<br />
ein dreieckiges Viereck, eine blühende Wüste, also ein Widerspruch in sich. Ein<br />
Gott darf alles, irren darf er nicht. Mag er auch morden, huren oder saufen, das<br />
sehen ihm die Menschen nach und sehen dann in ihm einen mordenden, hurenden<br />
oder saufenden Gott, aber ein Gott, der einmal irrt, ist nicht länger Gott, sondern<br />
ein sehr menschlicher Simpel. Irren ist menschlich, göttlich ist es nicht.<br />
Journalisten sind Götter. Seit 360 Jahren lassen sie Welten auf- und wieder untergehen,<br />
ein einmaliges, nie endendes, alle menschlichen Schöpfungen überragendes<br />
Schöpfungswerk – ohne einen einzigen Irrtum.<br />
Meine Damen und Herren, wir treffen uns hier heute nicht, um uns selber zuzujubeln.<br />
Götter beten sich nicht gegenseitig an, demütig, klaglos und schweigend stellen sie<br />
sich in den Dienst ihres unendlichen Werks. Es ist also gar kein Eigenlob, sondern<br />
eine lapidare Feststellung: Journalisten arbeiten seit 360 Jahren komplett irrtumsfrei,<br />
eine kaum glaubliche Leistung, wenn man weiß, wie voll, wie übervoll doch die<br />
Welt von Irrtümern ist, über die sie täglich schreiben und reden und über die sie<br />
unermüdlich klagen. Irrtümer, wohin man schaut: Der Wirtschaftsminister, der mit<br />
keiner Bankenkrise rechnet, der Fußball-Bundesligatrainer, der törichterweise von<br />
einem Sieg seiner Mannschaft im nächsten Spiel ausgeht, der Sektenführer, der<br />
weiß, dass seine Welt in ein paar Tagen untergeht, der Firmenchef, der das nicht<br />
weiß entgegen allen Warnungen, die Irrtümer der Fachleute, der Experten, der Gutachter,<br />
der Staatschefs, der Wirtschaftsführer, der Hinter- und der Vorderbänkler –<br />
niemand zählt sie, niemand kann sie zählen, aber aufschreiben lassen sie sich und<br />
kritisieren lassen sie sich auch.<br />
Setzte sich ein Doktorand in den Kopf, eine Promotion über „Den Irrtum in den<br />
Medien“ zu schreiben, würde er zwei interessante Feststellungen machen. Erstens<br />
würde ihm alsbald klar, dass die Darstellung von und die Kritik an Irrtümern zu den<br />
Lieblingstätigkeiten aller Medien zählt, von der Apothekenumschau, die über den<br />
Irrtum der Großmütter klagt, gegen Nasenkribbeln helfe Naseputzen besser als ein<br />
26
Pharmamittel für 80 Euro, bis zum kompromisslosen öffentlich-rechtlichen Fernsehkommentar,<br />
der den Terrorismus für einen Irrtum hält, möglicherweise sogar für<br />
einen schlimmen Irrtum. Das Forschungsgebiet wäre für den Doktoranden unüberschaubar<br />
und sein Vorhaben, auch nur annähernd seine Dimensionen abzumessen,<br />
aussichtslos. Andererseits und zweitens fiele ihm sofort auf, dass hier offensichtlich<br />
zwei Welten aufeinanderprallen – die eine, zum Bersten angefüllt mit Irrtümern,<br />
die andere hingegen komplett irrtumsfrei. Und nicht nur das. Blickte der<br />
Doktorand etwas näher hin, könnte er unmöglich übersehen, dass die zweite Welt<br />
nicht nur frei von jeglichem Irrtum ist, sondern zugleich ein Hort des Selbstzweifels<br />
und der Selbstkritik. Wie das?<br />
Journalisten irren nicht, aber sie machen Fehler. Und niemand ist schneller bereit<br />
und ausdauernder dazu in der Lage, Fehler zuzugeben und über Abhilfe für die<br />
Zukunft nachzusinnen, als sie selbst. Üben sie sich nicht in Kritik, dann üben sie<br />
sich in Selbstkritik. Geht es darum, eigene Fehler zu geißeln, lassen sie nicht den<br />
kleinsten Fehler aus.<br />
Unterschlägt eine Zeitung fahrlässig beim Ortsnamen Ouagadougou ein o oder ein u,<br />
wird das Blatt anderntags mit ziemlicher Sicherheit reumütig vor seine Leser treten<br />
und zerknirscht im „Fehlerteufel“ eine Korrektur abdrucken. Zahlendreher, falsche<br />
Namen, ein Foto, das statt eines Prinzen dessen ihm sehr ähnlichen Terrier zeigt,<br />
das alles sind Fehler, die rücksichtslos von den Medien aufgegriffen und selbstanklagend<br />
angeprangert werden. Wie im Kleinen, so im Großen. Gibt es eine andere<br />
Branche, die so anhaltend und selbstquälerisch über Qualität nachdenkt, über<br />
Qualitätsstandards, Qualitätsanspruch, Qualitätsjournalismus? Welche andere<br />
Branche reflektiert so unverdrossen grüblerisch auf Tagungen wie dieser, in Akademien,<br />
in Fortbildungskursen, Journalistenschulen oder Workshops über Schreibfehler,<br />
Wahrnehmungsfehler, Stilfehler, Recherchefehler, Konzentrationsfehler und<br />
Fehlerkorrekturfehler? Von den Ethik-Fehlern gar nicht zu reden, das heißt, die<br />
Branche redet fortwährend davon.<br />
Niemals mehr, aber seitdem unablässig, als nach dem Gladbecker Geiseldrama vor<br />
22 Jahren. Bei diesem Drama starben drei Menschen, unter anderem ein Mädchen<br />
durch den Schuss eines Geiselnehmers. Unvergessen ist das Bild des Mädchens,<br />
dem der Mörder die Knarre an die Schläfe drückt, das Bild, das man abends, nach<br />
dem Mord, in den Nachrichten sah, unvergessen wie die Frage des Nachrichtensprechers:<br />
„Darf man so ein Bild zeigen?“ Soviel ehrliche, selbstkritische Nachdenklichkeit<br />
können sich übrigens nur öffentlich-rechtliche Sender leisten.<br />
Dem Doktoranden käme das alles sicher recht merkwürdig vor. Eine Branche, die<br />
nicht nur Fehler macht, sondern sogar einräumt und offen diskutiert, die alles Mögliche<br />
und Unmögliche falsch macht, diese Branche sollte tatsächlich niemals irren?<br />
Unterstellen wir, unser Doktorand wäre nicht nur skeptisch, sondern hartnäckig,<br />
27
also willens, der Sache auf den Grund zu gehen. In dem Fall würde er eine Bibliothek<br />
aufsuchen und dort in einem Zeitungsarchiv stöbern Möglicherweise stieße er<br />
zunächst auf Zeitungen <strong>vom</strong> Winter 1932, kurz vor der Machtübernahme Hitlers<br />
also. Er läse dann mit großer Sicherheit auch Texte, die damals der junge Rechtsreferendar<br />
Sebastian Haffner las. Das waren Texte von unvergleichlicher Leidenschaft<br />
für die demokratische, republikanische, freiheitliche Sache, aus den Federn<br />
von Schreibern, die kein Zögern kannten und kein Wanken im Kampf gegen die<br />
Nazis, die Menschenfeinde, die antirepublikanischen, antidemokratischen Schreihälse<br />
und Totschläger von SS und SA um Adolf Hitler, die ihre Federn, ihre Edelfedern<br />
als Waffen führten für den Frieden, im Krieg gegen den Krieg, mutig, aufrecht,<br />
mannhaft. Unser Doktorand blättert ein wenig weiter, und wirft einen Blick in die<br />
Ausgaben <strong>vom</strong> 31. Januar 1933. Seit einem Tag ist Hitler Reichskanzler. Wahrscheinlich<br />
wundert unseren Doktoranden zunächst, dass viele Zeitungen sich nun deutlich<br />
freundlicher zu Hitler äußern, wundert sich über die zahlreichen Glückwünsche für<br />
den neuen Reichskanzler, wundert sich auch über die lobenden Worte für die NSDAP<br />
und deren Sache. Aber immerhin gibt es auch Gegenstimmen an diesem 31. Januar<br />
1933, Zweifler und Mahner, die der Weimarer Demokratie nachtrauern, wenngleich<br />
die meisten nicht mehr allzu laut. Unser Doktorand blättert abermals weiter, nur<br />
wenige Wochen. Über das, was er nun feststellt, wird er sich nicht nur wundern, er<br />
wird es für ein Wunder halten – so wie damals Haffner, als er sich seine alten Zeitungen<br />
am Kiosk kaufte. Noch immer fand er dort die alten Namen, die Texte jener<br />
Redakteure, die er seit Jahren kannte, schätzte oder sogar liebte, schätzte oder<br />
liebte, weil sie dachten wie er und weil sie das, was sie und Haffner dachten, klar<br />
und deutlich schrieben. Noch immer die alten, würdigen Namen, aber nun unter<br />
Texten, die Adolf Hitler priesen, unter Texten, in denen sie schrieben wie Nazis, in<br />
denen sie schrieben als Nazis. Dieselben Namen, dieselben Köpfe. Haffner sprach<br />
damals von keinem Wunder. Er komme sich vor, schrieb er, wie in einem Irrenhaus.<br />
Und wie kommt es unserem Doktoranden wohl heute vor, wenn er das liest? Wie<br />
kommt es ihm vor, wenn er ein paar Jahre weiter blättert, bis zum Mai, Juni 1945<br />
und die Monate, die Jahre danach? Wieder die alten Namen, wieder die alten Köpfe,<br />
jetzt wieder mit den neu-alten Reflexionen über den Wert von Menschenrechten,<br />
demokratischer Rechtsstaatlichkeit und so fort. Vielleicht wird er denken: So war<br />
das damals, Tragik einer Generation, die in Brüchen lebte. Da war wohl mancher,<br />
der an diesen Brüchen brach. Von Irrtum, denkt er, lässt sich hier kaum reden, und<br />
wenn, dann lag der Irrtum in der Zeit. Wenn sich ein Volk irrt, wie 1933 , dann ist der<br />
Irrtum kollektiv, und wenn ein ganzes Volk von diesem Irrtum nichts mehr wissen<br />
will, muss er auch Journalisten nicht mehr gegenwärtig sein. So wird er denken,<br />
unser Doktorand. Möglicherweise.<br />
28
Also wird er weiterblättern, Jahrgang für Jahrgang. Und mit jedem Jahrgang nimmt<br />
die Meinungsfreude deutscher Medien zu, denn die Meinungsfreiheit, inklusive<br />
Pressefreiheit, ist ein hohes Gut in diesem Land. Eine Freiheit, wird er lesen, die<br />
niemand nutzt, ist eine tote Freiheit, die deutschen Medien aber, wird er lesen, nutzen<br />
ihre Freiheit und füllen sie mit Leben. Meinungsfreiheit gibt es in manchen anderen<br />
Ländern auch. Da und dort weiß man sogar, dass zur Meinungsfreiheit auch das<br />
Irren zählt, dass Meinungsfreiheit die Freiheit ist, irren zu dürfen, ohne mit seinem<br />
Leben oder mit seiner Freiheit oder sogar nur mit Geld dafür zahlen zu müssen.<br />
Unser Doktorand aber lernt, dass die Freiheit zu irren in Deutschland eine tote Freiheit<br />
ist, denn niemand, kein Medium und kein Autor nutzt sie. So viele Meinungen, so<br />
viele Tatsachenfeststellungen, so viele Kommentare, Mutmaßungen und Ansichten<br />
– doch weit und breit kein einziger Irrtum. Blättert er vor zum Frühjahr 89, dann<br />
wird er lesen: Die deutsche Teilung ist eine Tatsache, mit der sich die Deutschen<br />
abfinden sollten. So schreibt nicht nur einer, so schreiben fast alle. Ein Jahr später<br />
schreibt nicht nur dieser eine, sondern schreiben fast alle: Die deutsche Teilung ist<br />
eine Tatsache, mit der sich die Deutschen nie abfinden werden. So liest es sich im<br />
Westen, wo man schreiben darf, was man will. Wie liest es sich im Osten, wo man<br />
damals keineswegs schreiben darf, was man will? Im Frühjahr 89 liest es sich so:<br />
Die deutsche Teilung ist eine Tatsache, mit der sich die Deutschen abfinden sollten.<br />
Im Sommer 90 liest es sich dann so: Die deutsche Teilung ist eine Tatsache, mit der<br />
sich die Deutschen niemals abfinden werden. Von einem Irrtum liest man nirgends.<br />
Spätestens hier dürfte unseren Doktoranden eine Ahnung des Göttlichen streifen,<br />
das ihn in dieser Bibliothek umweht. Journalisten, spürt er, können alles, irren können<br />
sie nicht. Aber er will nicht spüren, er will – Wissenschaftler, der er ist – wissen.<br />
Also liest er weiter. Also liest er, dass einer, viele, fast alle heute schreiben können,<br />
Freiheit meine Freiheit der Wirtschaft <strong>vom</strong> Staat und Freiheit der Armen von staatlichen<br />
Leistungen. Also liest er, dass einer, viele, fast alle morgen schon schreiben,<br />
Freiheit könne wohl kaum die Freiheit der Wirtschaft <strong>vom</strong> Staat meinen und schon<br />
gar nicht die Freiheit der Armen von staatlichen Leistungen. Er liest in einem Jahr,<br />
dass es keine Zweifel an dem Absturz Deutschlands als Superstar geben könne,<br />
der nur aufzuhalten sei, wenn sich der Staat privatisiere. Er liest im nächsten Jahr,<br />
von demselben Autor, dass Deutschland vor einem herrlichen Aufschwung stehe,<br />
weil der Staat den Irrweg der Privatisierung meide. Er liest in einem Monat, dass<br />
die europäische Solidarität nicht grenzenlos sei und Mitgliedsstaaten der EU rausfliegen<br />
sollten, wenn sie nicht mehr zahlen könnten, im nächsten Monat liest er,<br />
Rauswurf sei immer ein Fehler und die europäische Solidarität im Prinzip unbegrenzt.<br />
Er liest, dass eine Wochenzeitschrift einen Herrn zum Volkshelden ausruft,<br />
der in Genen den Wohnsitz der Dummheit wittert, die dann sieben Tage später<br />
darüber klagt, dass so einer Volksheld werden konnte.<br />
29
Und je mehr er liest, desto mehr fragt er sich, ob er wirklich in einer Bibliothek sitze<br />
oder nicht doch eher in einem Irrenhaus. Aber weil er Geisteswissenschaftler ist<br />
und kein Psychiater, lässt er die Frage vorläufig offen. Statt eine Antwort zu suchen,<br />
wird er sich eine neue Frage stellen. Sie lautet: Wenn Journalisten wirklich niemals<br />
irren, weil sie Götter sind, und Götter sind, weil sie niemals irren: Welche Gottheit<br />
tritt uns dann in ihnen gegenüber? Vollkommen klar, es gibt nur eine, die sich dafür<br />
hergibt, eine, die fast alle Welt seit alters her anbetet, wenn auch nicht immer<br />
schätzt. Die alten Nordvölker nannten diesen Gott Forseti, in Japan betete man zu<br />
Susanoo, in Iran einst zu Vayu, die Römer nannten ihn Aeolus, die Griechen Zephyros.<br />
Wie auch immer ihn die Menschen rufen, stets ist Zephyr sowohl Gott des Windes<br />
als auch der Wind selbst, stets ist er der, der die Winde schaukeln lässt und stets<br />
auch der schaukelnde Wind. Er ist der, der dem Wind die Richtung weist und stets<br />
ist der Wind schon da. Der Gott des Windes kann die Windrichtung ändern, irren<br />
kann er sich darin nicht, der Wind kann eben noch von vorn, gleich schon von der<br />
Seite wehen – verirren kann er sich nicht. Journalist ist nur ein deutsches Wort für<br />
Zephyr.<br />
Ist das die Antwort? Es ist eine Antwort, von der wir hoffen, dass unser Doktorand<br />
sie nicht finden wird, und wenn er sie findet – dass er sich nicht mit ihr abfinden<br />
wird. Wir können nur wünschen, dass er weitersucht, hartnäckig, unverdrossen,<br />
immer angetrieben von dem Ziel, vielleicht eines Tages doch noch in der irrtumsfreien<br />
Welt der Medien auf einen Irrtum zu treffen, zumindest auf den Hinweis,<br />
dass es einmal einen gegeben hat, einen freien Autor vielleicht, einen Wirtschaftsredakteur,<br />
einen Auslandskorrespondenten, der nicht mehr Gott sein wollte, auch<br />
kein sterblicher Gott ,sondern ein schreibender und redender Mensch, der irrt von<br />
Zeit zu Zeit. Wenn es von diesem Menschen einen Nachlass gäbe, dann könnte sich<br />
ein Brief darin finden und in dem Brief die Worte: „Lieber Leser, hören Sie meine<br />
Beichte. Ob Sie sie mir glauben oder nicht glauben, das ist nicht mehr wichtig, aber<br />
wichtig ist, dass ich beichte. Was ich beichte? Nichts, was Sie nicht längst schon<br />
wüssten. Sie wissen sicher noch, dass ich vor ein paar Jahren schrieb, das die Kernenergie<br />
die Zukunft in Deutschland hinter sich habe, Schluss, Aus, Ende. Und wie<br />
gut das sei und wie schön für unsere Enkel. Dann wissen Sie auch, dass ich einige<br />
Jahre später schrieb – ich schätze, das war im Jahr 2010 –, Kernkraftwerke seien<br />
Deutschlands Zukunft für die nächsten 10, 20, 30 Jahre und wie gut das sei und wie<br />
günstig für uns. Ich denke auch an jenen Essay, in dem ich nachweisen konnte,<br />
dass die kleinen Tigerstaaten China unvermeidlich überholen würden, und auch an<br />
jenen Essay, lange Zeit später, mit dem wunderbar originellen, geistreich-ätzenden<br />
Titel: „Vormals Tigerstaaten – heute Bettvorleger“. Es gab eine Zeit, da wusste ich,<br />
Bushs Feldzug gegen Saddam Hussein wäre nach 100 Tagen vorbei, aber früher<br />
glaubte ich auch, Guido Westerwelle sei kein Synonym für Vakuum. Nun ja, ich war<br />
auch sicher, wenn ich nach Mainz käme, dann wäre Nikolaus Brender noch da ...<br />
30
Lassen wir das. Leser, was ich sagen will, ist dies: Dass ich durch mein Leben irre<br />
wie Sie auch, werfe ich mir nicht vor, das trüge keine Beichte. Aber dafür, dass ich<br />
von Durchblick sprach, wenn ich durch’s Dunkel tappte, dass ich den Seher gab, wo<br />
ich doch blind bin wie jeder, und dass ich nicht einmal hintrat und sagte: Ich irre<br />
wie jeder von euch, das, Leser, ist der Beichte wert und auch der Buße.“<br />
Was wäre, wenn unser Doktorand so einen Brief eines Tages wirklich finden sollte?<br />
Wäre das nicht eine große Sache? Es wäre der Nachweis, dass wir Menschen sind<br />
und keine Götter. Sterblich sind wir sowieso.<br />
Christian Bommarius wurde 1958 in Frankfurt am Main geboren. Nach dem Studium der Rechts wissen -<br />
schaften und der Germanistik wurde er Korrespondent der Deutschen Presseagentur unter anderem<br />
beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Seit 1997 ist er leitender Redakteur der „Berliner Zeitung“<br />
und Mitarbeiter beim „Kursbuch“.<br />
Ein Chefredakteur:<br />
„Wenn ein Meinungs -<br />
strom in eine Richtung<br />
geht – dem können Sie<br />
sich nicht verschließen“<br />
Zeit-Magazin 14. April 2011<br />
31
TEIL I<br />
DOKUMENTATION DER PANEL-ERGEBNISSE<br />
MAINZERMEDIENDISPUT 2010
Auftakt: „Tatort Redaktion“<br />
Revue und Diskussion über alles, was Journalisten anrichten ...<br />
Teilnehmer der Podiumsdiskussion:<br />
Dr. Alexander Kissler<br />
Sarah Lau<br />
Eva Zaher<br />
Thomas Wark<br />
Tom Schimmeck<br />
Dr. Eva-Maria Schnurr<br />
Themenstellung:<br />
Objektivität, Sorgfaltspflicht und Recherchegenauigkeit sind zweifellos die Heiligen<br />
Kühe des Journalismus. Wie oft allerdings werden sie doch geopfert ... Erfahrungen<br />
und Erlebnisberichte aus dem journalistischen Arbeitsalltag über Pannen, Aus -<br />
rutscher und Falschmeldungen sind auf den zweiten Blick oftmals weniger originell<br />
oder komisch als vielmehr peinlich und ärgerlich. Sie fußen entweder auf Nachlässigkeit,<br />
Desinteresse oder Stress. Selten wird redaktionsintern nach den Gründen<br />
dafür gefragt.<br />
Eine gewisse Wurschtigkeit macht sich breit in unseren Redaktionsstuben. Dabei<br />
sind Personal- und/oder Zeitmangel, der Verleger- und Intendantenrotstift sowie<br />
fehlende handwerkliche und/oder intellektuelle Voraussetzungen der Agierenden<br />
der Boden, auf dem mangelhafter Journalismus wächst.<br />
Gerade der Berufsnachwuchs wird von „alten Fuhrleuten“ belächelt, nicht aber<br />
besser ausgebildet. Das aber wäre ein lohnendes Ziel, oder etwa nicht?<br />
Panelbeschreibung:<br />
Den Teilnehmer/innen der Diskussion sollte es gelingen, den „Tatort Redaktion“<br />
erlebbar zu machen. Weniger im Anekdotischen als vielmehr durch die Schilderung<br />
des Arbeitsalltags, des Erlebens von Entscheidungen, die nachhaltig die journalistischen<br />
Leistungen beeinflussen, liegt hier der Weg zur Wahrheit. Aber weil ein<br />
Publikum nach Anekdoten, die oftmals sehr plastisch sind, lechzt, sollten auch sie<br />
Platz haben, – wenn sie gut sind.<br />
Ziel ist es, vor allem Anregungen zu geben, wie Qualitätsjournalismus gewährleistet<br />
werden kann und wie die journalistische Berufsausbildung aussehen könnte.<br />
33
Leitfragen<br />
1 Sind aus Ihrer Sicht die „Heiligen Kühe“ des Journalismus akut gefährdet –<br />
und damit die Qualität der Arbeit und in der Folge die Produkte?<br />
2 Was ist für den Verlust an handwerklich gut gemachter journalistischer<br />
Arbeit vor allem verantwortlich?<br />
3 Wie empfinden Sie persönlich die Qualität dessen, was in „Ihren“<br />
Redaktionen produziert wird (auch was Sie selber machen ...)?<br />
4 Wie ist es dort um die Diskussionskultur und die innere Mitbestimmung<br />
(„Redaktionsstatut“) bestellt?<br />
5 Ist eine demokratische Struktur in der Redaktion gleichbedeutend<br />
mit „besserem Journalismus“?<br />
6 Ist seriöses Arbeiten = langsam = langweilig = zu spät?<br />
7 Gibt es den Reiz des Verbotenen (s. Fake-Filme) –<br />
und wird der sogar belohnt?<br />
8 Welche Qualität hat der durchs Internet generierte Journalismus?<br />
9 Wie beeinflussen Blogs etc. den klassischen Journalismus?<br />
10 Was fehlt unserem Berufsnachwuchs? Wie schätzen Sie die universitäre<br />
und die redaktionelle Ausbildung im deutschsprachigen Raum<br />
(und sofern belegbar im anglo-amerikanischen) ein?<br />
34
Dr. Eva-Maria Schnurr<br />
Zu 1<br />
Nicht akut, aber latent durch Geldknappheit, durch Personaleinsparungen und den<br />
dadurch entstehenden Zeitmangel beim Journalisten. Durch Anteilseigner, Aktionäre<br />
und Werbekunden, die mitentscheiden, mitreden, notfalls auch erpressen.<br />
Die „heilige Kuh“ = journalistische Unabhängigkeit sowie seriöse Recherche orientieren<br />
sich an Fakten, Fakten und Hintergrundinfos und der eigenen Kompetenz,<br />
diese kritisch einordnen zu können. Der Trend, jeder muss alle Sparten bedienen<br />
können, führt zu weniger Kompetenz, um Informationen beurteilen zu können. Die<br />
unterschiedlichen Klientel-Befragungen führen zu eingeengter Themenbreite. Was<br />
interessiert und was nicht wird oft aus dem Bauch heraus entscheiden und damit<br />
dann auch wichtige Informationsbereiche getilgt. Lady Di’s Ring am Finger der Braut<br />
ihres Sohnes ist interessanter als die Terrorwarnungen des Bundes-Innenministers.<br />
Wird der Zeitdruck zu groß, wird angelieferte Information zu selten hinterfragt. Beiträge/Produkte<br />
spiegeln nur, bleiben oberflächig, wenig aussagekräftig, können<br />
nicht eingeordnet werden. Damit belügen und betrügen wir unsere Klientel, die<br />
gerade von ARD-Sendern kritische Distanz und die einordnende Stimme verlangt.<br />
Zu 2<br />
Druck Druck Druck – geboren aus Geldmangel und damit Personalmangel. Dem<br />
einzelnen wird zu viel Arbeit aufgebürdet .<br />
Aber auch neue hierarchische Strukturen, die Journalisten zu Befehlsempfänger<br />
macht und ihnen die kritische Haltung austreibt.<br />
Dass oft Werbeblatt-Schreiber einen höheren internen Rang einnehmen als<br />
„gestandene“ Journalisten.<br />
Der Irrglaube, man könne mit journalistischen Produkten Renditen wie in Banken<br />
erzielen. Umschichtungen von Geldtöpfen in große teure Projekte, während dem<br />
„normalen“ Auftrag Geld entzogen wird. Das erzeugt unnötige Hysterie.<br />
35
Zu 3<br />
Eigenlob stinkt – dennoch: gute seriöse und kritische Berichterstattung. Dennoch<br />
vieles könnte noch abgerundeter, weniger stereotyp, ausformulierter und liebevoller<br />
präsentiert sein.<br />
Zu 4<br />
Ganz gut. Ein Teammitglied meint: sehr gut. Ein anderer: comme-ci comme-ca. Im<br />
ARD-Börsenstudio Radio wird viel diskutiert – jeden Tag auf einer Konferenz (die<br />
keine Themensammlung ist) . Dort entscheiden wir gemeinsam über ein spezielles<br />
Beitragsthema, immer wieder auch gegen meine Stimme. Über Inhalte wird sich<br />
über den Tag hinweg immer wieder unter den Kollegen ausgetauscht und diskutiert.<br />
Wir reden auch über formale Bedingungen, über Geldtöpfe, über neue Strukturen,<br />
über neue Formen der Berichterstattung, über das, was nicht richtig läuft, über<br />
Fehler und deren Vermeidung und über Lob! Transparenz von oben in allem führt<br />
zu angstfreiem Arbeiten. Wir haben Leitlinien im hr, aber auch spezielle für unser<br />
Team gemeinsam entwickelt.<br />
Zu 5<br />
Was ist „besserer“ Journalismus. Heißt das, wir bemühen uns nicht um die „beste“<br />
Fassung ? Ich glaube doch.<br />
Demokratie ist gut, wenn eine klare Linie vorgegeben wird, an der jeder einzelne<br />
sich demokratisch fortbewegen kann. Auch Deutschland hat eine letzte Entscheiderin<br />
– das ist leider immer nötig. Dennoch: demokratische Strukturen heißt Meinungsvielfalt,<br />
viele Stimmen, die diskutieren, sich einbringen und dadurch erhält<br />
jedes Produkt eine tiefgehende Breite. Antwort: Ja !!!<br />
Demokratisch heißt auch, den anderen im Team ausreden zu lassen, ihm/ihr die<br />
Meinung zu lassen, zuzuhören, weil man immer noch etwas dazulernen kann = ich<br />
weiß mehr und mein Produkt wird besser.<br />
Zu 6<br />
Manchmal, aber nicht wenn es Tiefe und Mehrwert bedeutet, wenn damit Hintergrund<br />
erarbeitet wird. Seriöses Arbeiten heißt: so schnell wie möglich, aber auch<br />
so „langsam“ wie nötig. Oft erfährt man beim „langsamen“ Recherchieren Neues,<br />
wird überrascht von weiteren unvermuteten Sachverhalten. Spannung baut sich<br />
auf. So entstehen ungemein tolle Feature !<br />
Zu 7<br />
Manches Mal: JA! Vielleicht sollten alle Journalisten eine moralisch-ethische Schulung<br />
in Bezug auf Web-Infos und Webinhalte erhalten.<br />
36
Zu 8<br />
Exzellent bis grottenschlecht.<br />
Zu 9<br />
Weitere Quellen, Inspirationen, noch mehr an interessanten Meinungen und Einschätzungen,<br />
erweitert den Horizont – es gehört eine große Portion Disziplin dazu,<br />
dabei nicht im Meer der Daten/“Informationen“ unterzugehen und die „Quelle“<br />
einordnen zu können. Sie erhöhen die Meinungsvielfalt aber auch das „Nachrichten“-<br />
Aufkommen bis ins unerträglich-unsortierbare.<br />
Zu 10<br />
Erst mal Erfahrung. Dann geht während der Ausbildung oft der Mut zur kritischen<br />
Haltung besser einer eigenen Linie verloren. Die Programmierung durch die Meinung/Standpunkte/Haltungen<br />
der Ausbilder geht leider nicht verloren.<br />
Ich habe in den letzten Jahren überwiegend nur sehr gut ausgebildete Nachwuchskräfte/Volontäre<br />
erlebt. In Fachbereichen universitär gut ausgebildet, die journalistischen<br />
Volontariate in einigen Sendern sind gut bis hervorragend. Vor allem wenn<br />
die Sender die trimediale Ausbildung anbieten. Volontäre, die ich kennengelernt<br />
habe, haben sehr gute Arbeiten abgeliefert. (SWR und hr-Volontäre besuchen<br />
einen Tag die Börse. die erhalten einen Vortrag über das Unternehmen Deutsche<br />
Börse AG, über den Unterschied von Börse AG zu Börse, fragen und diskutieren mit<br />
Analysten und Börsianern und arbeiten einen Beitrag, den ich feedbacke.)<br />
Sowohl universitär als auch in den Sendern hat sich die Ausbildung deutlich<br />
verbessert.<br />
37
IMPRESSIONEN ZUM MONOLITH MIT<br />
MINISTERPRÄSIDENT KURT BECK
PANEL 1: „ERMITTLUNGEN IN EIGENER SACHE –<br />
MEDIEN VOR DEM KADI“<br />
Szenario: Der Journalismus und – speziell – das<br />
„Duale System“ stehen vor dem U-Ausschuss.<br />
Hauptanklagepunkt: Das System hat laut „Konvergenztheorie“ beim Publikum eine<br />
gefährliche Politikverachtung ausgelöst. Die Folge: alle lechzen nur nach seichter<br />
Ware und süßem Konfekt ...<br />
Es gibt nur „immer mehr von Demselben“ (N. Postman). Journalisten werden ihrer<br />
Wächterfunktion nicht mehr gerecht. Sie beanspruchen vielmehr, Partei und Akteure<br />
zu sein.<br />
Rollen im Kreuzverhör:<br />
FRAGER (Attorney):<br />
Dr. Christian Schertz, Medienanwalt<br />
... hebelt die Befragten nach allen Regeln der Kunst aus. Gnadenlos. Ausweichen<br />
wird nicht hingenommen. Bohrendes Nachfragen. – Aufklärungsziel ist<br />
die Antwort auf die Frage: Wer verschuldet vorsätzlich, dass das Publikum von<br />
Aufklärung verschont werden will – und tatsächlich dumm und uninformiert<br />
bleibt?<br />
ZEUGEN:<br />
Fritz Pleitgen, Journalist, ehem. WDR-Intendant, Vors. der Geschäftsführung<br />
„Ruhr 2010“<br />
Position laut „Aktenlage“: Alles ist flacher und seichter geworden, seit es die<br />
Privaten gibt. Sie leisten nichts für die Demokratie und sorgen für die allgemein<br />
wachsende „Volksverdummung“. Sie haben nur als Abspielplattformen<br />
billigster Massenware Bestand. Sie haben nichts mit wahrer Publizistik zu tun<br />
und diskreditieren den Informations- und Integrationsauftrag der Massenmedien.<br />
Wenn es nach den Privatsendern ginge, wäre das ÖR System nur noch für<br />
ein paar Nachrichten und kulturelle Schwerathletik da. Die Privaten wollen dem<br />
ÖR die Luft zum Atmen nehmen (Online, Sport, Werbeverbot). Dabei ist das ÖR<br />
das allein seligmachende Mediensystem mit seiner pluralen Verfassung und<br />
seinen gut eingespielten inneren Hierarchien.<br />
41
Peter Limbourg, Journalist, Senior Vice President Nachrichten der ProSiebenSat1<br />
Media AG<br />
Position laut „Aktenlage“: Bestes System der Welt, wenn da nicht die Benachteiligung<br />
privater Veranstalter gegenüber dem „subventionierten“ (Staats-)<br />
Rundfunk wäre. Absolute Bereicherung der deutschen Publizistik durch Private<br />
seit dem „Urknall“ 1984. Die ÖR sind nicht flexibel und hinken der Zeit hinterher.<br />
Sie sind nicht mehr zeitgemäß – und gehören bloß als Spartenkanäle (Nachrichten,<br />
Hochkultur) noch toleriert. Im Internet haben die ÖR schon gleich gar<br />
nichts verloren. Die Privaten strahlen Modernität aus und stehen mitten im<br />
Leben unserer Hartz-IV-Konsum-Gesellschaft ...<br />
Leitfragen<br />
1 Sind die klassischen Informationsmedien tatsächlich verflacht?<br />
2 Welche Medien sind besonders defizitär geworden?<br />
3 Bei welchen Ereignissen und Themen haben Journalisten insbesondere versagt?<br />
4 Wie ist das Verhältnis Medien – Politik/Staat/Wirtschaft heute?<br />
5 Wie ist das Verhältnis Medien – Publikum/Rezipient?<br />
6 Welche Aufgaben sollten Journalist(inn)en in der Informationsgesellschaft<br />
übernehmen – und wie ist die Wirklichkeit?<br />
7 Laufen „neue“ Medien (Internet, Blogs, etc.) den „klassischen“ den Rang ab?<br />
8 Woher rühren die beobachteten Defizite?<br />
9 Gibt es das „Duale System“ überhaupt noch?<br />
10 Hat der (teure) investigative Recherche-Journalismus als individuelle<br />
Leistung Zukunft?<br />
11 Übernehmen „Bürgerbewegungen“ die öffentliche Kommunikation von<br />
Medien und Politik?<br />
42
Fritz Pleitgen, ehem. Intendant des WDR, Vors. der Gf. Ruhr 2010<br />
Zu 1<br />
Nicht flacher als früher, aber weniger überschaubar.<br />
Zu 2<br />
Das Erste und ZDF sollten besser sein.<br />
Zu 3<br />
Finanzkrise, Stuttgart, Loveparade.<br />
Zu 4<br />
Undurchsichtig für das Publikum.<br />
Zu 5<br />
Indifferent! Die früheren „Leitwölfe“ (SPIEGEL, Das Erste, ZDF) haben an Autorität<br />
verloren.<br />
Zu 6<br />
Aufklärung, Durchblick, Sachlichkeit – unzureichend.<br />
Zu 7<br />
Noch nicht, kann aber kommen.<br />
Zu 8<br />
Aus dem verschärften Wettbewerb.<br />
Zu 9<br />
Ja, aber dual ist auf dem Weg zu multilateral.<br />
Zu 10<br />
Hoffentlich, sonst wird die Presse ihrem Auftrag nicht gerecht.<br />
Zu 11<br />
So weit sind wir noch nicht. Ausnahmesituationen hat es immer gegeben.<br />
43
Wissen, was hinter den<br />
Kulissen geschieht<br />
aktuelle Trends im Journalismus<br />
fundierte Analysen<br />
praxisorientierte Themen<br />
Sonderpreis für<br />
nr - Mitglieder:<br />
Statt 48,– Euro nur<br />
33,60 Euro pro Jahr!<br />
Sichern Sie sich jetzt Ihr Abo unter<br />
www.message-online.com oder Telefon 0711/60100 - 40<br />
nr - Mitglieder abonnieren Message direkt über die<br />
Redaktion: redaktion @ message-online.com
Peter Limbourg, Senior Vicepresident Nachrichten,<br />
ProSiebenSat1 Media AG<br />
Zu 1<br />
Nur einige<br />
Zu 2<br />
Das Problem ist doch, dass die öffentlich-rechtlichen Sender sehr viel Anspruchsvolles<br />
in die Sparte oder das Nachtprogramm geschoben haben.<br />
Zu 3<br />
Bei der Finanzkrise haben viele blank gezogen. Überhaupt kommen die Themen<br />
Wirtschaft und Europa in der Regel zu kurz.<br />
Zu 4<br />
Wie es sein sollte: angespannt.<br />
Zu 5<br />
Beide suchen sich in der digitalen Welt.<br />
Zu 6<br />
übernehmen – und wie ist die Wirklichkeit?<br />
Sie sollten Auf- und Erklärer sein – manchen gelingt das ganz gut.<br />
Zu 7<br />
Nicht unbedingt – Sie können sie auch ergänzen.<br />
Zu 8<br />
???<br />
Zu 9<br />
Ja, aber es ist in einer völligen Schieflage.<br />
Zu 10<br />
Natürlich hat gerade Qualitätsjournalismus Zukunft.<br />
Zu 11<br />
Sicher nicht.<br />
45
PANEL 2: „BEIM RÜCKZUG INS LOKALE:<br />
ÖRTLICH BETÄUBT“<br />
Leitfragen<br />
1a Wer kann eigentlich noch oder wieder Lokales (leisten)?<br />
Print, Fernsehen, Hörfunk, Private, Online, Blogs?<br />
b Versandet das Lokale in der Vielfalt?<br />
Und wer soll das alles lesen, gucken, hören(wollen)?<br />
Vom bezahlen lieber erst gar nicht reden?<br />
2a<br />
b<br />
c<br />
Gibt es ein Versagen des Lokalen, das auch ein Versagen des Journalismus ist?<br />
Grundsätzlich: Ist das Lokale überhaupt noch in der Lage (finanzielle Ausstattung,<br />
personelle Ausstattung ((wo)manpower), Finanzrahmen)<br />
journalistisch zu arbeiten?<br />
Fehlt das Niveau im Lokaljournalismus? Oder wird das Lokale nur noch<br />
als letzter halbwegs verlässlicher Geldbringer für Medien-Besitzer und<br />
-Veranstalter gesehen.<br />
3 Droht dem Lokalen der Rückfall in alte Zeiten, die noch längst nicht<br />
überwunden sind?<br />
Viele Zeilen/Minuten für möglichst wenig Geld?<br />
Das können doch unsere Freien auch, nur viel billiger?<br />
Warum brauchen wir noch Feste?<br />
4 Wo bleibt die Qualität – eher im großen Mantel oder im Lokalen –<br />
auf der Strecke?<br />
a Kaum noch Zeit(und Lust und Geld) für Recherche?<br />
b Wenn gründliches Nachfragen nichts am Honorar oder den Pauschalen<br />
ändert, warum dann nachfragen?<br />
5 Zeichnet sich ein (weiterer) Verfall der Qualität des Lokales, gehetzt<br />
von der(internen) Online Konkurrenz ab oder eher eine Verbesserung?<br />
• Nur schnell raus mit dem Text<br />
• Die Verlockung der schnellen Korrektur (oder haben Sie online schon<br />
einmal eine Berichtigung gesehen)<br />
• Das bisschen online schreiben wir doch auch noch selbst.<br />
47
6a<br />
b<br />
a<br />
Braucht es überhaupt noch Journalisten, die nur (immer zu viel)<br />
Geld kosten, fürs Lokale?<br />
Schreiben lokale Köche nicht besser über ihre eigene lokale Küche?<br />
Sind nicht Chorleiter, die idealen (Musik)Kritiker, weil sie wissen worüber<br />
sie schreiben – billiger und sogar über ihren eigenen Chor.<br />
Füllen nicht Vereinsberichte, <strong>vom</strong> Schriftführer verfasst, auch das Lokale<br />
(nicht nur die Anzeigenblätter, die wir als Konkurrenz auch kurz anreißen<br />
müssen)?<br />
7a Ist nicht die Nachschau (Nachberichterstattung) besser als jede<br />
Vor(aus)schau (Vorabberichterstattung) mit all der Mühe, den<br />
(Recherche)Kosten, dem Zeitaufwand?<br />
b Wussten wir nicht danach, schon immer besser was wir vorher hätten<br />
recherchieren und kritisieren wollen(Beispiel Love Parade Duisburg)?<br />
c Melden sich überhaupt/kommen noch die Bürger zu Wort<br />
d entfernt nicht die Nähe zur Lokal-Politik und Lokalpolitikern, die sich<br />
manchmal mehr recht als schlecht verkaufen, <strong>vom</strong> Bürger und werden<br />
dabei auch die Entwicklungen durch Ferne(siehe Stuttgart 21) im<br />
ach so nahen Lokalen übersehen?<br />
8 Wie müssen ich die Produktionsbedingungen ändern, damit es zu<br />
einer Rückkehr des Lokalen in welchem Medium kommt?<br />
9 Ist Online – so aktuell zu sein es vorgaukelt – das Ende des Lokalen?<br />
48
Prof. Dr. Wiebke Möhring, FH Hannover<br />
Zu 1<br />
Das Lokale kann sich jedes Medium leisten, wir haben in Deutschland allerdings<br />
bestimmte mediale Traditionen. Die Tageszeitung wäre mit Sicherheit schlecht<br />
be raten, auf das Lokale zu verzichten, lokales Fernsehen hat es schwerer. Sich zu<br />
etablieren, die lokalen Onlinemedien und netzbasierte Kommunikationsmöglichkeiten<br />
sind dabei, sich ihre Plätze zu suchen. Versanden ist die falsche Metapher und ob<br />
wir tatsächlich Vielfalt erhalten, ist noch völlig offen. Das Interesse der Leser an lokalen<br />
Themen ist da, durch alle Altersgruppen hinweg, wenn auch mit unterschiedlichen<br />
Schwerpunkten – und die Bezahlbereitschaft hat was mit der Qualität der Inhalte und<br />
der tatsächlich erreichten Befriedigung der lokalen Informationsbedürfnisse zu tun.<br />
Zu 2<br />
Die Strukturen und Berufsbiographien innerhalb des Journalismus sorgen dafür,<br />
dass das Lokale als ein manchmal belächeltes oder sogar verspottetes Ressort ist.<br />
Wenn das Lokale innerhalb der Ressorthierarchien eine Art Anfängerressort ist –<br />
wie soll sich dann journalistische Qualität und Professionalität einstellen? Gott sei<br />
Dank gibt es Gegenbewegung zu dem Trend durch hochprofessionelle und engagierte<br />
Lokaljournalisten und Chefredakteure, die erkannt haben, dass gerade das<br />
Lokale in der Lage ist, Zeitungen an den Leser zu bringen.<br />
Zu 3<br />
Freie Journalisten sind wichtig, das steht außer Frage. Nicht nur aus finanziellen<br />
Gründen. Sie können Impulse geben, sind nicht fest eingebunden in redaktionelle<br />
Abhängigkeiten, können Engpässe überbrücken. Eigentlich. Denn wenn sie allein für<br />
den Inhalt verantwortlich zeichnen, gilt diese Vorteile nicht mehr, da sie nur komplementär<br />
gelten. Auf feste Lokalredakteure zu verzichten bedeutet, dem Ressort Kontinuität<br />
und Professionalität zu entziehen und es journalistisch deutlich zu schwächen.<br />
Das ist genau der falsche Weg. Bindungen für Leser, Vertrauen lokaler Quellen und<br />
Kenntnisse des Lokalraums sind für einen guten Lokaljournalismus essentiell.<br />
49
50<br />
Zu 4<br />
Hier müssen die Redaktionsleitungen zusammen mit den Verlegern tatsächlich<br />
umdenken. Lokaljournalismus gewinnt an Qualität, wenn auch hier gründlich<br />
recherchiert werden kann. Eine zu enge Taktung der Lokaltermine, zu viel Arbeit am<br />
Redaktionsschreibtisch, das Übernehmen der verschiedensten Aufgabenbereiche,<br />
all das führt eher zu einer Qualitätsminderung und zu einer Arbeitsbelastung, die<br />
sich dann zusätzlich negativ auswirkt. Dass Recherche im Lokalen manchmal<br />
besonders schwer fällt, hat aber nicht nur etwas mit Zeit und Geld zu tun, sondern<br />
auch mit persönlichen Verbindungen und Bindungen. Lokaljournalisten arbeiten<br />
und leben häufig in der gleichen Region, dies kann sich positiv aber auch negativ<br />
auf die Berichterstattung auswirken. Die häufig geäußerten Kritikpunkte am Lokaljournalismus<br />
– Hofberichterstattung, Kritiklosigkeit, Trivialität – sind hier ja nicht<br />
neu, sondern eher ein systemimmanentes Problem.<br />
Zu 5<br />
In der Frage steckt, so meine Ansicht, das Grundproblem: Warum Konkurrenz? Es<br />
geht um Inhalte und die richtige mediale Aufbereitung – um mehr nicht.<br />
Zu 6<br />
Die Leser wollen professionelle Berichterstattung. Sie suchen in ihren lokalen Medien<br />
Orientierung – und dazu gehört auch das Selektieren und Filtern von Informationen,<br />
das Nachfragen und Recherchieren, die Aufbereitung mit Hintergründen und das kontinuierliche<br />
Dranbleiben an Geschichten. Das kann kein Koch und auch kein Chorleiter.<br />
Und das unterscheidet genau den professionellen Journalismus <strong>vom</strong> Laienoder<br />
Bürgerjournalismus. Wenn in den Verlagen die in der Frage skizzierte Haltung<br />
vorherrscht, wird sie zunehmend Schwierigkeiten haben, Leser an sich zu binden.<br />
Zu 7<br />
Lokaljournalismus geht nach vorne und nach hinten, alles andere macht für die Rezipienten<br />
keinen Sinn. Orientierung ist nachträgliche Einordnung und Interpretation<br />
und gleichzeitig Seismograph für Kommendes. Das sich Dinge anders entwickeln<br />
als vorher gedacht, ist dabei manchmal nicht zu vermeiden.<br />
Zu 8<br />
Rückkehr? Dieses Wort gilt nicht für das Lokale allgemein, sondern ist medien -<br />
abhängig, genau wie die Produktionsbedingungen.<br />
Zu 9<br />
Nein, überhaupt nicht. „Das Lokale“ ist ja in keiner Form mediengebunden, sondern<br />
bezeichnet einen originären Interessenbereich der Menschen. Wie soll ein<br />
neues Medium da ein Ende bedeuten? Ich würde sagen: Im Gegenteil, Online ist<br />
eine große Chance für das Lokale.
Dr. Wolfram Kiwit, Chefredakteur Ruhr-Nachrichten<br />
Zu 1 a<br />
Print, Hörfunk, Online (Blogs, SocialMedia).<br />
Zu 1 b<br />
Lokale Qualität versandet nicht in der Vielfalt, sie hebt sich aus ihr heraus. Am Rande:<br />
Vielfalt gilt selbst seit Jahrzehnten als Qualitätskriterium. Zurecht. Und: Leser, Hörer,<br />
Seher ist potenziell jeder, der sich für seine Umgebung, seine Nahwelt, interessiert.<br />
Zu 2 a<br />
Die Frage ist mir zu pauschal. Wo versagt das Lokale? Wie kann das Lokale versagen?<br />
Journalisten und Medienmacher können in einzelnen Märkten versagen.<br />
Das Interesse am Lokalen ist bei Lesern, Hörern, Usern konstant hoch.<br />
Zu 2 b<br />
Ja. Noch. Doch müssen sich Inhalte, Methoden, Arbeitsstrukturen, Einstellungen än -<br />
dern, wenn wir als lokale Content-Anbieter mit der Marktentwicklung mithalten wollen.<br />
Zu 2 c<br />
Das Niveau fehlt nicht. Wir haben noch nie so viel über Qualität im Lokalen nachgedacht<br />
wie in den letzten Jahren.<br />
Ich hoffe, dass das Lokale weiter ein verlässlicher Geldbringer bleibt. Denn diese<br />
In halte bezahlt kein Gebührenzahler. Und das sollte auch mit Blick auf die Freiheit<br />
der Presse so bleiben. Das Niveau des Lokaljournalismus bestimmen wesentlich<br />
dessen Macher.<br />
Zu 3<br />
Guter Lokaljournalismus braucht fest angestellte Profis und Freie Mitarbeiter.<br />
Zu 4 a<br />
Wer Erfolg mit einem „großen Mantel“ hat, muss sich um dessen Qualität kümmern,<br />
wer Erfolg mit lokalen Inhalten hat, wird einen Schwerpunkt dahin legen. Also mit<br />
Zeit und Lust und Ressourcen u. a. für gute lokale Recherche sorgen.<br />
Zu 4 b<br />
Gründliches Nachfragen hängt für mich mit sauberem journalistischem Handwerk und<br />
51
Best solutions for best printing<br />
ColorDruckLeimen<br />
Kontakt: Joachim Beigel, Tel.: 06224-7008-222, www.colordruck.com
Interesse am Thema zusammen – weniger mit einer Honorarsteigerung. Wer gründlich<br />
nachfragt, wird einen besseren Artikel schreiben. Wer einen besseren Artikel schreibt,<br />
wird damit mehr Erfolg haben. Insofern lohnt sich gründliche Arbeit immer.<br />
Zu 5<br />
Online und Print sollten wir zusammen denken. Und organisieren. Online ist keine<br />
Konkurrenz, sondern ein notwendiger zusätzlicher „Kanal“ für ein lokales Medienhaus.<br />
Und: Online ist eine Bereicherung. Denn in Abgrenzung zu Online schärfen<br />
wir automatisch ein gutes Print-Profil.<br />
Zu 6 a<br />
Nein. Sie kochen (hoffentlich) besser.<br />
Zu 6 b<br />
Nein. Sie musizieren (hoffentlich) besser.<br />
Zu 6 c<br />
Füllen ja. Reichen nein.<br />
Zu 7 a<br />
Wir werden uns im Lokalen mehr auf die Vorausschau konzentrieren müssen, weil<br />
Nachschau auch andere können.<br />
Zu 7 b<br />
Wer ist jetzt „wir“?<br />
Zu 7 c<br />
Ja. Mehr denn je.<br />
Zu 7 d<br />
Es gelten weiter die journalistischen Grundsätze. Nah dran sein, ohne dazuzugehören.<br />
Zu große Nähe verengt den Blick.<br />
Zu 8<br />
Welche Rückkehr? Aus den Lokalzeitungen ist das Lokale nicht verschwunden.<br />
Zu 9<br />
Online ist eine wunderbare Plattform für lokalen Content. Wie Zeitungen auch.<br />
53
PANEL 3:<br />
„ISLAMPHOBIE & MISSBRAUCHSHYSTERIE –<br />
WENN MEDIEN NICHT MEHR FUNKTIONIEREN“<br />
Leitfragen<br />
1 Thilo Sarrazin hat ein Buch geschrieben und ist seit dessen Veröffentlichung<br />
in nahezu allen TV-<strong>Talk</strong>shows aufgetreten, hat nahezu allen größeren Zeitungen<br />
Interviews gegeben. Was war das größere journalistische Versagen –<br />
Sarrazin ein großes Forum für seine Thesen gegeben, oder eine offene<br />
Diskussion über Integrationsdefizite in Deutschland vor Sarrazin nicht<br />
zugelassen zu haben?<br />
2 Was haben Fernsehen, Hörfunk und Printmedien zur Versachlichung der<br />
Debatte und zur Lösungsfindung beigetragen?<br />
3 Welche Leistung haben die Leitmedien in Deutschland in der Integrationsdebatte<br />
erbracht? Werden die journalistischen Meinungsbildner ihrer Verantwortung<br />
gerecht?<br />
4 Angesehen Medien, beispielsweise der Deutschlandfunk, der SPIEGEL und<br />
der STERN, haben im Zusammenhang mit der Integrationsdebatte Hörer- und<br />
Leserzuschriften veröffentlich, die islamophob und xenophob zu nennen<br />
ein gnädiger Euphemismus ist. Müssen Medien Volkes Stimme filtern?<br />
5 Prägen und stimulieren bestimmte Massenmedien ein negatives Bild von<br />
Ausländern und Migranten, um so unterschwellig vorhandene Ressentiments<br />
zu bedienen?<br />
6 Wie könnte eine angemessene Berichterstattung im Themenfeld<br />
Ausländer und Migranten ausschauen. Welches Anspruchsprofil an<br />
solide Medienarbeit ist aus Ihrer Sicht denkbar?<br />
7 Im Frühjahr waren die Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen und<br />
in der Odenwaldschule das Thema Nr. 1 in den Medien. Inzwischen ist die<br />
Berichterstattung darüber nahezu verstummt. Ist tatsächlich alles zum<br />
Thema Missbrauch gesagt?<br />
8 Skandale machen Quote und Auflage. War die Berichterstattung über die<br />
Missbrauchsvorwürfe nach Ihrer Wahrnehmung der Aufklärung oder der<br />
Auflage verpflichtet?<br />
9 Haben sich Journalistinnen und Journalisten im Zusammenhang mit den<br />
beiden großen Debatten dieses Jahres – Missbrauch und Integration –<br />
instrumentalisieren lassen? Welche besonders bemerkenswerten Beispiele<br />
fallen Ihnen ein?<br />
55
Bruder Paulus Terwitte<br />
Zu 1<br />
Mit der Aufregung bewusst das Geschäft angekurbelt zu haben. Ich sehe nicht,<br />
dass die Integrationsdebatte auch nur einen Schritt nach vorn gekommen ist. Hetzer<br />
können sicher sein: Sie kommen in die Medien. Und auch ZDF und FAZ machen mit<br />
nach dem Stil, der sonst auf dem Boulevard herrscht: Kann es stimmen ...<br />
Wir haben klare Zahlen: Weniger Asylbewerber, weniger Zuzüge nach D, wesentlich<br />
mehr Abwanderung von Ausländern, vor allem Hochqualifizierte.<br />
Zu 2<br />
Wenig. Oder spricht jetzt noch einer über Sarrazin oder recherchiert, wo es respektable<br />
Kulturfortschritte in Sachen Integration gibt? Im Kampf um die Quote wird die<br />
Darstellung der Disharmonie zur Leitidee. Versachlichung macht die Quote kaputt.<br />
Ich kann nur hoffen, dass die Kulturleistung eines freien Journalismus wieder neu<br />
wertgeschätzt wird. Und das meint: Gut bezahlter Journalismus, was gut recherchierten<br />
Journalismus zur Folge hat und dies wiederum hat gut informierte Konsumenten<br />
= Staatsbürger zur Folge.<br />
Zu 3<br />
Siehe Antwort 1 und 2.<br />
Zu 4<br />
Sie müssen sie wie Sarrazins Stimme, des Papstes Stimme und des Chefredakteurs<br />
Stimme hörbar machen, aufgreifen, einordnen, bewerten. Wer eine Wirklichkeit<br />
vorgibt nur abzubilden und dann die Hände in Unschuld wäscht, handelt verantwortungslos.<br />
Wir brauchen Positionen. Entschiedene Ethik, die bereit ist, auch mal<br />
den Posten zu räumen, weil Volkes Stimme nicht genügend goutiert wurde.<br />
56
Zu 5<br />
Solange der Anteil der Mitarbeiter beim ZDF, der ARD , in den Zeitungen und Radiostadion<br />
nicht proportional der Zusammensetzung der Bevölkerung entspricht,<br />
natürlich! Man könnte beim Betrachten der großen Unterhaltungszeitschriften und<br />
-sendungen schon mal auf die Idee kommen, ob es denn wirklich keine Journalisten<br />
und Moderator/-innen mit philippinischer, chinesischer, afrikanischer oder schwe -<br />
discher Familiengeschichte gibt. Ganz zu Schweigen <strong>vom</strong> Tigerentenclub oder<br />
anderen Sendungen, in denen zumindest an mancher Stelle der Fremde wegen der<br />
Folklore interessant ist – aber als Mitbürger?<br />
Zu 6<br />
Intergrative Aufsichtsräte und Redaktionen nach den Proportionen der Gesellschaft<br />
mit einem leichten „und noch etwas mehr“ wären die beste Voraussetzung für eine<br />
Berichterstattung, die der gesellschaftlichen Realität von 4,5 Mill. Menschen mit<br />
Migrationshintergrund (5 % der Bevölkerung) gerecht wird.<br />
Zu 7<br />
Längst nicht. Was es zu berichten gab aus fünfzig Jahren verschweigen, wurde<br />
berichtet. Leider immer mit dem Unterton, es habe gestern stattgefunden. Die Folge<br />
davon muss nun bearbeitet werden: Da sitzen Menschen bei Familienfeiern zusammen,<br />
die auch die große Medienaufdeckung in Sachen sexueller Gewalt gegen Kinder<br />
durch Priester zum Thema haben. Und verstummen nun nochmals: die Töchter und<br />
Söhne, die seit vierzig Jahren schweigen, bei jeder Familienfeier.<br />
Zu 8<br />
Die Medien haben nicht aufgeklärt. Die Opfer haben den Mut gefasst durch einen<br />
mutigen Priester, die Medien zu informieren. Dem haben sich viele Opfer angeschlossen.<br />
Es gehört zu den Ammenmärchen, dass die Medien aufgeklärt hätten.<br />
Worüber denn? Doch nur darüber, was Opfer berichtet haben. Ob alle damit so<br />
glücklich waren, was aus ihrer Geschichte gemacht wurde, wage ich zu bezweifeln.<br />
57
PANEL 4: „DAVID GEGEN GOLIATH –<br />
DIE DIGITALE STEINSCHLEUDER“<br />
Leitfragen<br />
1 Welche journalistischen Impulse gehen nach ihrer Analyse von blogs in<br />
Deutschland aus?<br />
2 Nennen Sie bitte einige typische Fallbeispiele, wo Gegen-Öffentlichkeit,<br />
Kritik, Kontrolle und eine eigenständige Agenda-Funktion funktioniert?<br />
3 Welche strategischen Vorteile haben blogs im Kontrast zum<br />
„etablierten Journalismus“?<br />
4 Wo sehen Sie die wesentlichen Defizite von blogs in Deutschland?<br />
5 Einer der führenden online-Journalisten einer führenden Tageszeitung<br />
sagte kürzlich:<br />
„Die Bedeutung und Reichweite des online-Journalismus in Deutschland wird<br />
überschätzt.“ Teilen Sie diese Einschätzung? (incl. inhaltlicher Begründung)<br />
6 Wird das Potential des online-Journalismus in Deutschland nach ihrer Einschätzung<br />
ausgeschöpft? (Quellenvielfalt, Eigenständigkeit, visuelle Aufarbeitung,<br />
thematische Multi-Media-Potentiale etc.)<br />
7 Welche wesentlichen Unterschiede sehen Sie zwischen dem herkömmlichen<br />
Print-Journalismus u n d hochwertigen online-Journalismus?<br />
8 Welche wesentlichen Zukunfts-Trends sehen Sie für die kommenden<br />
fünf Jahren im Feld des online-Journalismus?<br />
9 Welche Vorteile hätte ein Ende der Anonymisierungs-Kultur, die von<br />
vielen online-Portalen gepflegt wird? (vgl. manche Regionalzeitungen<br />
akzeptieren nur noch Leserstimmen mit Klarnamen...)<br />
10 Viele Verlage „kanibalisieren“ ihre Geschäftsmodelle selbst, in dem sie<br />
mit kostenlosen Angeboten den Käufermarkt ihrer print-Produkte einengen.<br />
Welche Auswege sehen Sie hier und welche Bezahlmodelle haben künftig<br />
aus ihrer Sicht die realistischsten Umsetzungs-Chancen?<br />
61
Thomas Mrazek, freier Journalist, München<br />
Zu 1<br />
Blogs haben durch ihre einfachen Kommentarfunktionen Journalisten dazu angeregt,<br />
sich intensiver den Meinungsäußerungen ihres Publikums zu widmen und<br />
daraus auch einen Dialog entstehen zu lassen.<br />
Blogger haben Journalisten angeregt, über ihre Sprache und ihre Ausdrucksformen<br />
nachzudenken, ob sich dies nun tatsächlich in der journalistischen Praxis niedergeschlagen<br />
hat, wage ich zu bezweifeln.<br />
Blogger sind in der Regel meinungsfreudig, sie müssen sich keinen redaktionellen,<br />
journalistischen Normen unterwerfen. Sie können sich ihre Themen selbst rauspicken,<br />
ihre eigenen Schwerpunkte setzen. Was für eine Freiheit! Einige wenige journalistische<br />
Medien bieten für ihre Redakteure oder für freie Autoren auch Blog-Plattformen<br />
an, auf welchen eben diese Freiheit, diese ansatzweise Anarchie ein wenig ausgelebt<br />
werden kann (vorbildlich ist hier etwa FAZ.NET, wo es rund 20 thematisch ganz<br />
unterschiedliche und manchmal auch exotische Blogs finden). So können auch<br />
Themen, die im üblichen Redaktionsbetrieb – aus welchen Gründen auch immer –<br />
keinen Platz haben, auch in einem journalistischen Kontext publiziert werden. Die<br />
eher konservative Marke der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ öffnet sich damit<br />
zumindest ansatzweise ganz neuen, vielleicht auch jüngeren, linksliberaleren Nutzern<br />
– Blog sei Dank! Man muss allerdings auch anmerken, dass einige Medien mit<br />
ihren Blog-Angeboten gescheitert sind – die Gründe sind vielschichtig: nicht jedem<br />
Journalisten ist es gegeben, die richtige Tonalität für das Schreiben oder Veröffentlichen<br />
von Videos in einem Blog zu finden, hautnah konnte man manchmal die krampfhaften<br />
Versuche von Redakteuren beobachten, die auf Teufel komm raus witzig wirken<br />
sollten; manche der Angebote waren einfach zu ambitioniert oder zu sehr in der<br />
Nische und fanden nicht die erhoffte Resonanz im Publikum.<br />
62
Charakteristisch für gute Blogs ist es, wenn die Autoren ihren Lesern viele Links<br />
anbieten. Links, die auf Informationsquellen und weiterführende Angebote verweisen,<br />
Links, die Transparenz herstellen, die journalistische Recherchearbeiten nachvollziehbar<br />
und mitunter glaubwürdiger machen. Vor allem durch dieses ausgiebige<br />
Vernetzen mit externen Internet-Angeboten, welches ja auch von Suchmaschinen<br />
durch bessere Auffindbarkeit der jeweiligen Seiten belohnt wird, sind sicherlich<br />
Impulse für den Journalismus entstanden.<br />
Besonders erwähnenswert sind freilich auch vielfältigen Rechercheerfolge, die<br />
Blogger erzielten, weil sie Themen aufgegriffen, die Journalisten entweder überhaupt<br />
nicht oder nur unzureichend bearbeitet haben. In Blogs kann man also als Journalist<br />
durchaus respektable Fachleute finden, die gewisse Themen schon seit Jahren<br />
fundiert beackern.<br />
Somit können Blogs als ergänzende Recherchequelle durchaus Ansatzpunkte für<br />
journalistische Recherchen bieten.<br />
Doch wehe wenn Inhalte oder Ideen aus Blogs geklaut werden, dann können sich<br />
Journalisten – völlig zurecht – negativer Impulse aus der Blogosphäre sicher sein;<br />
auch bei anderen Vergehen oder Fehlern kann sich via Blogs schnell ein so genannter<br />
Shitstorm über Medien entfachen. Nicht immer geht es bei dieser Medienkritik<br />
sachgerecht oder fair zu, aber unterm Strich betrachte ich solche Korrektive als<br />
eher förderlich für das Mediensystem.<br />
Bei allem Lob halte ich es immer wieder für wichtig, dass man die vorgenannten<br />
Punkte nicht überschätzen oder gar glorifizieren sollte, das gilt für Deutschland<br />
aber auch weltweit – mit einer Mythologisierung von Blogs ist niemand gedient.<br />
Zu 2<br />
Natürlich muss man hier den „Klassiker“, das Bildblog, nennen: Seit 2004 erzeugt<br />
dieses von Medienjournalisten betriebene Blog eine Form von intermedialer<br />
„Gegen-Öffentlichkeit“, indem es die Fehlleistungen und Machenschaften der „Bild“<br />
und – seit dem Frühjahr 2009 – anderer Medien werktäglich aufs Tapet bringt und<br />
damit auch eine Form von Agenda Setting betreibt.<br />
Einen typischen Fall bietet das pharmakritische Blog Stationäre Aufnahme<br />
(http://gesundheit.blogger.de). Das Blog wurde der Öffentlichkeit im Sommer<br />
2008 bekannt, als es dokumentierte, wie der Gesundheitsexperte Hademar Bankhofer<br />
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Schleichwerbung betrieb. Bemerkenswert<br />
ist hier unter anderem, dass der anonyme Experte und Blog-Betreiber dieses<br />
Angebot schon seit 2006 auf einem in der Fachwelt anerkannten Niveau betreibt.<br />
Bis zu dieser Enthüllung wurde das Blog nur selten von herkömmlichen Medien<br />
63
wahrgenommen. Die Erwähnung und Verlinkung in anderen Blogs spülte die Nachricht<br />
nach oben, andere Medien recherchierten. Der WDR beendete schließlich seine<br />
Zusammenarbeit mit Bankhofer.<br />
Ein weiterer interessanter Fall ereignete sich Anfang 2009. Das Blog Netzpolitik.org<br />
veröffentlichte einen vertraulichen Vermerk des Berliner Beauftragten für Datenschutz<br />
und Informationsfreiheit über ein Gespräch mit der Deutschen Bahn AG. In<br />
dem Dokument ging es um das heikle Thema Mitarbeiter-Bespitzelung beim<br />
Bahn-Konzern. Netzpolitik-Betreiber Markus Beckedahl wurde wegen dieser Veröffentlichung<br />
von der Deutschen Bahn abgemahnt. Nicht zuletzt aufgrund des<br />
großen Drucks aus anderen Blogs und sozialen Netzwerken zog die Bahn ihre<br />
Abmahnung zurück. Hier zeigte sich vor allem wie schnell und effizient sich eine<br />
„Gegen-Öffentlichkeit“ formieren kann. Die Welle schwappte dann auch schnell in<br />
die klassischen Massenmedien über, die über die Abmahnung berichteten.<br />
Zu 3<br />
Der größte Vorteil dürfte wohl die redaktionelle Unabhängigkeit von Blogs sein –<br />
Blogger müssen bei ihrer Publikationstätigkeit keinerlei Rücksichten etwa auf<br />
redaktionelle Leitlinien oder latent vorhandene Grenzen wie etwa die berühmte<br />
„Schere im Kopf“ nehmen. Das Publikum erwartet von Blogs nicht unbedingt eine<br />
kontinuierliche Berichterstattung wie bei klassischen Massenmedien, Themen<br />
können im Idealfall frei nach Lust und Laune und zeitlich vorhandener Kapazität<br />
oder Kompetenz ausgewählt werden. Andererseits wächst mit zunehmenden Erfolg<br />
für bestimmte Blogs auch der Druck, immer auf dem Laufenden zu sein und aktuelle<br />
Entwicklungen kontinuierlich auf dem Radar zu haben. Auch brauchen sich Blogger<br />
beim Publizieren nicht unbedingt an die einschlägigen journalistischen Regeln halten;<br />
dass diese Freiheit nicht immer zu einer ausgewogenen und fairen Berichterstattung<br />
führt, ist natürlich auch anzumerken. Andererseits weiß ich aus meiner intensiven<br />
Beobachtung, dass sich die Zahl der „Betriebsunfälle“ aufgrund dieser Form<br />
der Berichterstattung aus Blogs in einem überschaubaren Rahmen hält. Ausnahmen<br />
bestätigen auch hier die Regel.<br />
Zu 4<br />
Hier muss ich an eine Kritik des Bloggers Don Alphonso anknüpfen, der die deutschen<br />
Blogs für zu selbstreferentiell hält. Das große Politik-Blog fehlt einfach, wenn man<br />
mal von den Nachdenkseiten absieht, die aber nicht mal eine Kommentarfunktion<br />
unter ihren Artikeln anbieten und somit nicht unbedingt ein klassisches Blog<br />
darstellen. Die nachhaltige Vernetzung der Blogger untereinander lässt auch zu<br />
wünschen übrig. Ob Deutschland mit rund 200.000 Blogs im Vergleich zu anderen<br />
Ländern mehr oder weniger nur ein „Blog-Entwicklungsland“ ist, wie es der ehemalige<br />
Focus Online-Chefredakteur, Jochen Wegner einmal beschrieb, vermag ich<br />
64
nicht zu beurteilen. Persönlich hatte ich bis vor fünf Jahren erwartet, dass in<br />
Zukunft viel mehr (vielleicht eine Million) Deutsche bloggen würden, doch der Funke<br />
sprang nicht über. Selbstkritisch muss ich anmerken, dass meine eigenen Blog-<br />
Projekte – aus Zeitmangel – derzeit eher dem Dornröschenschlaf anheim fallen.<br />
Zu 5<br />
Nein, ich teile diese Einschätzung nicht, vielmehr ist das Gegenteil der Fall: der<br />
Online-Journalismus in Deutschland wird unterschätzt. Das drückt sich vor allem<br />
durch die mangelnde Wertschätzung des Genres – auch unter Journalisten selbst –<br />
aus: Online-Journalismus wird hierzulande häufig als zweitklassiger Journalismus<br />
angesehen. Zumeist sind die journalistischen Inhalte im Netz ja kostenlos erhältlich<br />
– „was nichts kostet ist auch nichts wert“, mag die geringe Wertschätzung und<br />
Bedeutung prägnant auf den Punkt bringen. Da ist es kein Wunder, dass Online-<br />
Journalisten, auch wenn sie mehr als Journalisten anderer Medien in Schichtdienste<br />
eingebunden sind, zumeist erheblich schlechter als die Kollegen anderer Mediengattungen<br />
bezahlt werden. Online ist in Medienhäusern häufig noch das fünfte Rad<br />
am Wagen. Als Außenstehender kann ich es leicht behaupten: es fehlt Verlegern,<br />
aber häufig auch Rundfunksendern der publizistische Mut und die notwendige Leidenschaft<br />
für das Netz um dort zu reüssieren. Freilich stellt sich ökonomischer Erfolg<br />
im Internet nicht von heute auf morgen ein, freilich gibt es noch nicht den Erfolgsweg<br />
und es sind immer noch einige Unabwägbarkeiten da, aber mutiges Vorpreschen,<br />
kreatives Experimentieren findet nur bei wenigen Medien statt. Dabei wachsen<br />
die Online-Reichweiten bei den meisten Medien stetig – trotz der großen Konkurrenz<br />
um Aufmerksamkeit etwa durch soziale Netzwerke.<br />
Zu 6<br />
Nein, wie in den vorgenannten Antwort erläutert fehlt es an publizistischem Mut,<br />
Experimentierwille und es mangelt auch an ökonomischer Risikobereitschaft. Dass,<br />
was wir gerne als Qualitätsjournalismus bezeichnen, ist unter diesen Bedingungen<br />
nur schwer möglich. Wenn keine eigenen Geschichten recherchiert werden können,<br />
muss man eben auf Material der Agenturen zurückgreifen, ein eigenständiges<br />
publizistisches Profil lässt sich damit nicht aufbauen. Nur auf eigene Geschichten<br />
des Muttermediums zurückzugreifen und diese per copy paste verbreiten, ist auch<br />
nicht der Königsweg und beinhaltet zudem die Gefahr der Kannibalisierung. Multi-<br />
Media-Inhalte lassen sich nicht am Fließband produzieren, hier bedarf es auch viel<br />
Fingerspitzengefühl und Wissens um entsprechende Routinen im redaktionellen<br />
Bereich für solche aufwändigeren aber anspruchsvollen Inhalte zu entwickeln.<br />
Andererseits muss sich dies auch ökonomisch rechnen, nur von schönen, in der<br />
Szene der Online-Journalisten anerkannten Multimedia-Angeboten, lässt es sich<br />
eben auch nicht leben. Richtige Vorzeigeangebote für guten Online-Journalismus<br />
fehlen in Deutschland, gute Ansätze – obgleich durchaus nicht unumstritten –<br />
65
ieten etwa Spiegel Online, Zeit Online und FAZ.NET, um nur einige zu nennen.<br />
Auch öffentlich-rechtliche Angebote wie Tagesschau.de und Heute.de spielen oben<br />
mit, allerdings sind diese Websites letztlich durch die Medienpolitik in jüngsten<br />
Vergangenheit durch das so genannte Depublizieren stark gebeutelt worden.<br />
Zu 7<br />
Bei hochwertigem Online-Journalismus kann im besten Fall unmittelbar nach Veröffentlichung<br />
schon die Luft brennen – sprich: es finden mitunter niveauvolle<br />
Debatten statt; eine gute Geschichte verbreitet sich etwa über soziale Netzwerke<br />
binnen weniger Minuten weiter, vielleicht auch an Zielgruppen, die mit diesem<br />
Medium nie in Berührung gekommen wären und bei den Klickzahlen sieht man in<br />
Echtzeit, wie groß das Interesse ist, Print-Redakteure staunen oft über diesen<br />
Effekt: ich werde gelesen, über mein Werk wird diskutiert. Selbstverständlich soll<br />
dies kein Plädoyer für den unsäglichen Quotenfetischismus im Online-Bereich sein.<br />
Leichter als beim Print-Journalismus kann es beim Online-Journalismus der Fall<br />
sein, dass eine Geschichte aufgrund von Nutzerhinweisen noch weitergedreht werden<br />
kann oder muss – ein Prozess wird in Gang gesetzt. Zu hohes Tempo, zu viel<br />
Informationen aus dem Netz, zu große Gefahr diesem „Rausch“ zu erliegen und am<br />
Ende eine fehlerhafte Geschichte zu schreiben – dann doch lieber wieder zurück<br />
zum vermeintlich gemütlichen Print? Diesen Herausforderungen, diesen Verlockungen<br />
muss man sich als (Online-)Journalist einfach stellen! Die Existenzberechtigung des<br />
herkömmlichen Print-Journalismus soll angesichts dieser wohlfeilen und fast<br />
schon erdrückend wirkenden Argumente nicht in Frage gestellt werden.<br />
Zu 8<br />
• Es wird eine Marktbereinigung stattfinden. Wenige Medien werden wirklich<br />
guten, originären Journalismus im Netz anbieten können und sich damit<br />
dauerhaft etablieren.<br />
• Einige Medien werden nolens volens ihre Angebote auf ein Mindestmaß<br />
runterfahren.<br />
• Crossmediale Arbeitsabläufe zwischen den verschiedenen Medien werden<br />
sich weiter verbessern, vielleicht sprechen wir in fünf Jahren gar nicht mehr<br />
explizit <strong>vom</strong> Online-Journalismus.<br />
• Das Pflänzchen Datenjournalismus wird im Online-Bereich richtig aufblühen.<br />
• Neue Routinen bei der Nutzerbeteiligung im so genannten Prozessjournalismus<br />
könnten sich bei einigen Medien etablieren.<br />
• Hoch- und nutzwertige Multimedia-Anwendungen für diverse Empfangsgeräte<br />
werden zum Alltag gehören.<br />
• Bei einigen Medien werden sich neue Micropayment-Systeme etablieren.<br />
66
Zu 9<br />
Mögliche Vorteile eines Endes der Anonymisierungs-Kultur wären vielleicht gehaltvollere,<br />
verlässlichere und für Journalisten einfacher zu betreuende Diskussionen.<br />
Die Gefahr der Beschädigung der eigenen Marke durch ausufernde, niveauarme<br />
Diskussionen wäre geringer. Umso mehr Medien mit diesem eher restriktiven Modell<br />
des Nutzer-Dialogs reüssieren, umso mehr Nachahmer wird dieses Modell finden.<br />
Schmerzlich ist allerdings der Verlust an Datenschutz, es gibt auch für seriöse Nutzer<br />
durchaus Gründe, warum sie auf Anonymität an solchen Orten bestehen.<br />
Viele Verlage „kannibalisieren“ ihre Geschäftsmodelle selbst, in dem sie mit kostenlosen<br />
Angeboten den Käufermarkt ihrer Print-Produkte einengen. Welche Auswege<br />
sehen Sie hier und welche Bezahlmodelle haben künftig aus ihrer Sicht die realistischsten<br />
Umsetzungs-Chancen?<br />
Mit der „Kannibalisierung“ sorgen die Verlage letztlich für Reichweite, die sie den<br />
Werbetreibenden – leider zumeist für viel zu geringe Margen – verkaufen können.<br />
Mit einfachst für den Nutzer zu handhabenden Micropayment-Systemen könnten<br />
mehr Gewinne erzielt werden. Eine für alle Marktteilnehmer praktikable Lösung –<br />
ob „großes“ oder „kleines“ Medium – ist jedoch immer noch nicht in Sicht. Es muss<br />
mehr und mutiger, vielleicht auch auf unpopuläre Weise, experimentiert werden.<br />
Vermutlich werden sich Mischformen aus Freemium (Angebote, bei denen Basisdienste<br />
gratis angeboten werden und für weitere Dienste ein Preis verlangt wird),<br />
Werbefinanzierung und Paid Content etablieren. Medien, die mehr Experimentierfreude<br />
zeigen, flexibel und – in Bezug auf die Nutzer – rücksichtsvoll mit den<br />
verschiedenen Bezahlmodellen agieren, könnten sich am Ende behaupten. Nicht<br />
auszuschließen ist, dass sich Medien durch falsche Strategien in dieser heiklen<br />
Frage gänzlich ins Aus manövrieren.<br />
67
Dr. Christian Stöcker, Redakteur, Spiegel Online, Hamburg<br />
Zu 1<br />
Das können nahezu beliebige sein, <strong>vom</strong> lokalpolitischen Skandal über Mediengeschichten<br />
bis hin zu kritischer Unternehmensberichterstattung. Faktisch allerdings<br />
gewinnen Blog-Geschichten immer dann besonders schnell an Schwung,<br />
wenn es klassische David-gegen-Goliath-Geschichten sind. Klassisches, typisches<br />
Beispiel ist das Vorgehen der Deutschen Bahn gegen Netzpolitik.org. Da ist einerseits<br />
Erregungspotential in der Sache gegeben (Mitarbeiter-Überwachung), andererseits<br />
ein als aggressiv wahrgenommenes Vorgehen eines großen Unternehmens gegen<br />
einen, der als unabhängiger Vertreter der gerechten Sache betrachtet wird.<br />
Zu 2<br />
Das Beispiel Netzpolitik.org versus Deutsche Bahn habe ich bereits genannt. Andere<br />
typische Fälle wahren die Abmahnungen von Jack Wolfskin gegen Handarbeits-<br />
Heimwerker im Zusammenhang mit der Verkaufsplattform Dawanda wegen verletzter<br />
Markenrechte am Tatzen-Logo, oder der Streit zwischen dem Sportartikelhersteller<br />
Jako und einem Sportblogger namens Trainer Baade, der angeblich unzulässige<br />
Schmähkritik geübt hatte, als er Jako als „Schlurchmarke“ bezeichnete. In allen diesen<br />
Fällen erzeugte die Blog-Aufmerksamkeit schließlich ein Echo in den Massenmedien,<br />
das für die betreffenden Firmen eher unangenehm ausfiel. Zu nennen wäre<br />
auch noch das Aufgreifen des Interviews des damaligen Bundespräsidenten Horst<br />
Köhler zum Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr – Deutschlandradio Kultur hatte<br />
die Brisanz des eigenen Materials offenbar nicht erkannt, einige Blogger schon. In<br />
diesem Fall allerdings griffen Mainstreammedien das Thema kurz darauf aufgrund<br />
von Leserbriefen etc. selbst auf, unabhängig von der Berichterstattung in Blogs. Ein<br />
weiteres Beispiel wäre der tätliche Angriff auf einen Demonstranten bei der „Freiheit<br />
statt Angst“-Demonstration in Berlin, der von einem Passanten auf Video festgehalten,<br />
online gestellt, von Blogs aufgegriffen wurde und so schnell die Mainstream-<br />
Medien erreichte (all das innerhalb weniger Stunden), was zu Ermittlungen gegen<br />
68
die betreffenden Beamten führte. Diese Art von Aufsicht über Ereignisse im öffentlichen<br />
Raum ist langfristig womöglich die wichtigste quasi-journalistische Aufgabe<br />
digitaler Gegenöffentlichkeiten. Handy-Kameras sind schließlich überall.<br />
Zu 3<br />
Ich würde eher von taktischen Vorteilen sprechen. Blogs sind nicht notwendigerweise<br />
journalistischen Standards verpflichtet: Gegenchecken, Fakten prüfen, Gegenstimmen<br />
einholen etc.. Sie können deshalb auf viele Ereignisse und Meldungen<br />
deutlich schneller reagieren. Beispiel: Die Enttarnung des ersten Mannes, der in<br />
„Tatort Internet“ als potentieller pädophiler Straftäter vorgeführt wurde, vermeldete<br />
Netzpolitik.org einen Tag früher als beispielsweise Spiegel Online – weil die mühevolle<br />
Aufgabe, alle Behauptungen zu verifizieren, für die Blogautoren entfiel.<br />
Zu 4<br />
Ich halte die Frage für falsch gestellt. Da Blogs keine konkret definierte Aufgabe<br />
haben, kann man ihnen auch nicht konkrete Defizite vorwerfen. Es gibt zehn-,<br />
womöglich hunderttausende Blogs in Deutschland, die meisten haben keinerlei<br />
journalistischen Anspruch. Ein oft erhobener und sicher nicht ganz falscher Vorwurf<br />
ist: Nach wie vor beschäftigen sich viele der meistgelesenen deutschen Blogs vor<br />
allem mit der Blogosphäre, mit Social Media, mit Medien, also mit, im weitesten<br />
Sinne, Selbstbespiegelung. Das ist in den USA längst anders – aber dort sieht auch<br />
die übrige Medienlandschaft anders aus als bei uns.<br />
Zu 5<br />
Ich teile diese Einschätzung keineswegs. Spiegel Online hat mittlerweile fast zehn<br />
Millionen Unique User im Monat. Das ist keine Schätzung sondern eine messbare Tatsache.<br />
Von der offenkundigen Agenda-Setting-Wirkung ganz zu schweigen. Geschätzt<br />
werden dagegen die Reichweiten von Printmedien, und zwar schon seit vielen Jahren.<br />
Zu 6<br />
Mit gleichem Recht könnte man fragen: Wird das Potenzial des Journalismus in<br />
Deutschland ausgeschöpft? Die Antwort wird immer lauten: natürlich nicht. Es geht<br />
immer besser, tiefer, genauer, in Form und Präsentation noch angemessener. Das<br />
ist nicht zuletzt eine Frage des Geldes und der Ressourcen – das ist online nicht<br />
anders als in jedem anderen Medium.<br />
Zu 7<br />
Hochwertiger Online-Journalismus ist nicht Zeitung im Internet, sondern vereint die<br />
Stärken aller Mediengattungen. Er kann Bilder zeigen, wenn es etwas zu zeigen<br />
gibt (muss das aber, im Gegensatz zum Fernsehen, nicht tun, wenn es nicht zu zeigen<br />
gibt), er kann Information je nach Bedarf als Grafik, Animation, Tabelle präsentieren,<br />
69
er kann Bewegtbild liefern, wenn das Sinn ergibt, aber auch lange Analysetexte, er<br />
kann Hintergrundinformationen in beliebiger Tiefe jederzeit mitliefern und dem<br />
Leser das eigene Archiv mit internen und die eigenen Quellen mit externen Links<br />
erschließen. Außerdem kann er auf schnelle Rückkanäle (Lesermails, Foren, Facebook,<br />
Twitter, etc.) zurückgreifen, was oft neue Erkenntnisse, Einsichten, Rechercheansätze<br />
zu Tage fördert. Es wird schon sehr bald schlicht nicht mehr sinnvoll sein,<br />
zwischen „Print“ und „Online“-Journalismus zu unterscheiden, sondern wenn<br />
überhaupt zwischen reinem Text- und anderen Formen des Journalismus.<br />
Zu 8<br />
Multimediale Verzahnung wird zweifellos zunehmen, vor allem aber wird die Allgegenwart<br />
des Internet über mobile Geräte den Journalismus und seine Rezeption verändern,<br />
ebenso wie die zunehmende Selbstverständlichkeit, mit der alle möglichen<br />
Arten von Inhalten von Nutzer zu Nutzer direkt weitergereicht werden, ohne den<br />
Umweg über Plattform-Startseiten. Das Lokale wird auch online stärker in den Vordergrund<br />
treten. Wie aber die Welt, das Netz oder gar der Journalismus in fünf Jahren<br />
tatsächlich aussehen werden, ist unmöglich zu prognostizieren. Zur Erinnerung:<br />
Twitter ist vier Jahre alt, das iPhone drei Jahre.<br />
Zu 9<br />
Das würde die Debatte sicher mancherorts zivilisieren. Eine generelle Abschaffung<br />
der Anonymität im Netz würde ich aber für einen großen, gefährlichen Fehler halten.<br />
Ein Beispiel: Wer sich über Krankheiten, Depression, abseitige Hobbys oder andere<br />
heikle Themen informieren oder austauschen möchte, darf nicht gezwungen werden,<br />
das unter seinem Klarnamen zu tun. Das würde zu der Art von Totalüberwachung<br />
führen, die derzeit oft als Schreckgespenst und zwangsläufige Folge der Vernetzung<br />
an die Wand gemalt wird.<br />
Zu 10<br />
Dafür, dass Verlage ihre eigenen Angebote „kannibalisieren“ gibt es meines Wissens<br />
wenige verlässliche Belege. Der Auflagenrückgang der deutschen Tagespresse war<br />
Mitte der Neunziger schon in vollem Gange – damals war das Internet hierzulande<br />
noch ein echtes Exotenthema. Die Auflagen etwa des „Spiegel“ und der „Zeit“<br />
dagegen trotzen bislang allen Medienkrisen weitgehend unerschrocken – obwohl<br />
beide Online-Angebote betreiben. Das Problem, das das Internet den Verlagen<br />
bereitet, ist ein völlig anderes: Weil es zu viele Werbeflächen gibt, wird für Werbung<br />
online zu wenig bezahlt. Ob und welche Bezahlmodelle sich durchsetzen werden,<br />
wage ich nicht zu prognostizieren, eins aber ist klar: Das Bezahlen digitaler Inhalte<br />
muss einfacher werden. Das ist nach wie vor die größte Hürde, gerade um Kleinund<br />
Kleinstbeträge für Inhalte zu bekommen.<br />
70
Peter Schink, Geschäftsführer mediati<br />
Zu 1<br />
Blogs haben den Journalismus bereichert. Zum einen haben viele Journalisten das<br />
Medium Blog für sich selbst entdeckt und schätzen die persönliche Form des<br />
Schreibens und den direkten Kontakt zu Lesern. Zum anderen haben Blogger die<br />
Journalisten-Rolle des „Gatekeeper“ aufgelöst. Konkurrenz belebt das Geschäft.<br />
Zu 2<br />
Davon gibt es inzwischen einige: Typisch war wohl die Mobilisierungen gegen das<br />
Leistungsschutzrecht und im Rahmen der so genannten „Zensursula“-Debatte (mit<br />
der erfolgreichsten Petition in der Geschichte des Bundestages). Auch im Bereich<br />
des Datenschutzes und bei einigen Firmenskandalen funktioniert die „politische<br />
Funktion“ von Blogs.<br />
Zu 3<br />
Blogs sind radikal subjektiv und kennen keinen Chefredakteur. Ich würde das nicht<br />
einen strategischen Vorteil nennen, aber einen strukturellen.<br />
Zu 4<br />
Ich sehe keine Defizite. Die oftmals angemahnte Selbstreferentialität, der Ego- und<br />
Hobby-Journalismus in Blogs existiert. Ich würde das aber nicht negativ einordnen<br />
wollen.<br />
Zu 5<br />
Das halte ich für einen Witz.<br />
Zu 6<br />
Nein. Solange Online-Redaktionen ständig wegen geringer Einnahmen unter Rechtfertigungsdruck<br />
stehen, werden eigene multimediale Formate selten finanzierbar<br />
71
sein. Die Eigenständigkeit von Online-Redaktionen darf man jedoch infrage stellen.<br />
Online sollte letztlich ein Ausgabekanal für eine Marke sein, Journalisten sollten<br />
crossmedial hintergründig und inhaltlich arbeiten.<br />
Zu 7<br />
Die Ansprache von Lesern bzw. Nutzern funktioniert im Medium Internet anders.<br />
Beispielsweise ist Print ein One-Way-Medium, Online ein Two-Way-Medium. Das<br />
Internet kennt zudem viel mehr redaktionelle Formate. Print ist gedruckt, das Internet<br />
ist verlinkt. All das hat Auswirkungen auf Journalismus.<br />
Zu 8<br />
Originäre Inhalte werden wichitger, Aggregation von Information wird wichtiger,<br />
Einordnung von Information wird wichtiger. Außerdem wird die Medienlandschaft<br />
stärker fragmentiert.<br />
Zu 9<br />
Die Qualität der Leserbeiträge steigt, wenn sie sich dafür anmelden und mit Klarnamen<br />
registrieren müssen. Der Nachteil liegt auf der Hand: Die Schwelle zur Beteiligung<br />
ist höher.<br />
Zu 10<br />
Die grundsätzliche These ist falsch. Ist der Online-Auftritt kostenlos, kaufen deshalb<br />
nicht weniger Leute die Zeitung – sondern mehr. Die Frage nach den Bezahlmodellen<br />
ist in der Theorie einfach beantwortet (und in der Praxis manches Mal<br />
schwer zu realisieren): Wenn ein Angebot einzigartig ist und von Nutzern „begehrt“<br />
wird, verkauft es sich, solange der Preis stimmt. Inzwischen lässt sich auch sagen,<br />
dass der Einzelverkauf online leichter fällt als Abo-Angebote, und dass Archive<br />
leichter zu monetarisieren sind als das tägliche Nachrichtengeschäft.<br />
72
Hardy Prothmann, heddesheimblog.de<br />
Zu 1<br />
Hoffentlich die besseren. Tatsächlich sind journalistische Blogs die Vorreiter. Sie<br />
verbinden „old school“-Journalismus mit neuen Entwicklungen im Journalismus.<br />
Beispielsweise dem Kontakt zu Leserinnen und Lesern über Communities und<br />
soziale Netzwerke. Sie sind schnell, unabhängig und überwiegend überparteilich<br />
und trauen sich fern von „etablierten Medien-Wirtschaft-Politiknetzwerken“ kritische<br />
Haltungen – was von Lokalzeitungen kaum mehr erwartet werden darf.<br />
Zu 2<br />
http:/heddesheimblog.de, http://hirschbergblog.de, http://ladenburgblog.de,<br />
http://regensburg-digital.de, http://l-iz.de, http://netzpolitik.org, http://carta.info,<br />
http://freitag.de<br />
Zu 3<br />
Sie sind schlank, schnell, vernetzt und überall erreichbar.<br />
Zu 4<br />
Sie sind unterfinanziert.<br />
Zu 5<br />
Da das Zitat weder die Bedeutung noch die Reichweite noch die Überschätzung<br />
durch wen näher definiert, ist der Aussagegehalt gleich null. Vermutlich hat das ein<br />
Mitarbeiter eines überregionalen Portals gesagt und zwar nicht spiegel.de, bild.de<br />
oder zeit.de, denn die haben Bedeutung.<br />
Zu 6<br />
Das Potenzial wird ausgenutzt – leider nicht überall im gleichen Maße. Hauptsächlich<br />
wegen Punkt 4. Darüber hinaus gibt es noch erheblich mehr Potenzial, Stichwort<br />
73
Geo-Daten. Insgesamt ist Online die einzige Mediengattung, die überhaupt Entwicklungspotenzial<br />
hat. Hörfunk, Fernsehen und Print stehen am Ende ihrer Entwicklung.<br />
Zu 7<br />
Wieso wird nach dem Unterschied zwischen „herkömmlichem Print-Journalismus“<br />
und „hochwertigem Online-Journalismus“ gefragt? Soll das bedeuten, dass „hochwertiger<br />
Online-Journalismus“ sich nicht mit „hochwertigem Print-Journalismus“<br />
vergleichen lässt? Oder dass es kaum noch „hochwertigen Print-Journalismus“ gibt?<br />
Der Unterschied zwischen Print- und Onlinejournalismus ist ansonsten im wesentlichen<br />
der, dass ein gedrucktes Medium ohne Anschluss ist. Das Medium Papier<br />
ermöglicht keine Vernetzung. Ich lese seit gut drei Jahren fast keine Zeitung mehr<br />
und bin trotzdem besser informiert als je zuvor. Radio (bis auf Deutschlandfunk/Radio)<br />
spielt dabei ebenfalls keine Rolle, das Fernsehen nur bedingt und im<br />
Spartenbereich von Arte, 3Sat oder im Nachtprogramm von ARD und ZDF.<br />
Zu 8<br />
Der Online-Journalismus wird weiter neue Formen der publizistischen Darstellung<br />
entwickeln und sich etablieren. Die Bedeutung im täglichen Nachrichtengeschäft<br />
und die Reichweite sowohl bei den jeweiligen Agenden als auch bei den Leserinnen<br />
wird enorm wachsen, vor allem in der lokalen und regionalen Berichterstattung.<br />
Online-Journalismus wird den Zeitungen weiter schmerzhaft zusetzen.<br />
Die Zukunftsmärkte der Berichterstattung liegen im Lokalen, gerade wegen der<br />
zunehmenden Globalisierung.<br />
Zu 9<br />
Die Debatte über eine „Anonymisierungs-Kultur“ spiegelt nur die Hilflosigkeit „etablierter<br />
Medien“ mit den neuen Herausforderungen des Internet und die Angst vor<br />
dem Kontakt zum Leser. Früher haben selbst Zeitungsredakteure oder andere Personen<br />
unter Pseudonym geschrieben. Walter Jens schrieb bei der ZEIT unter „Momos“,<br />
um ein Beispiel zu nennen. Das Verfassen von Leserbriefen durch Redakteure dürfte<br />
kein Einzelphänomen gewesen sein und ganz sicher sind auch heute in vielen<br />
Redaktionen Mitarbeiter auch unter Pseudonymen in den Kommentarfunktionen<br />
vertreten. Die Pflege und Moderation von Kommentaren ist eine organisatorische<br />
und journalistische Herausforderung. Wesentlich sind die Inhalte, nicht die Namen.<br />
Zu 10<br />
Sie haben Verständnis dafür, dass ich die geschäftlichen Probleme von Verlagen<br />
genau im Blick habe, aber ganz sicher nicht interessiert bin, Zeitungen einen Ausweg<br />
aus ihrem Dilemma zu zeigen. Ein Tipp aber doch: Zeitungsredaktionen sollten ihre<br />
journalistische Haltung überprüfen, dann wären sie schon ein ganzes Stück weiter.<br />
74
Stefan Plöchinger, Chefredakteur sueddeutsche.de<br />
Welche journalistischen Impulse gehen nach Ihrer Analyse von Blogs in<br />
Deutschland aus?<br />
Erstens sind viele inhaltlich eine Bereicherung. Oft drehen sich Blogs um Themen<br />
für die andernorts Ressourcen fehlen, manche bieten gute Expertise, andere<br />
stoßen Kritik oder Debatten an, sie sind mal mehr, mal weniger interessant – in der<br />
Summe ein wichtiger Beitrag zur Pluralität im Netz. Zweitens ist die Form spannend:<br />
subjektiv, im Idealfall fokussiert und eher knackig als länglich. Solche<br />
Formate können auch Newssites gut tun, „New York Times“ und „Guardian“<br />
machen es vor.<br />
Nennen Sie bitte einige typische Fallbeispiele, wo Gegen-Öffentlichkeit, Kritik,<br />
Kontrolle und eine eigenständige Agenda-Funktion funktioniert?<br />
Der Klassiker ist Bildblog, gerade weil sich die Kollegen dort auch um andere<br />
Medien als „Bild“ kümmern. Die Kritik in diesem Blog mag manchmal etwas<br />
kleinteilig oder überspitzt sein, trotzdem ist es ein Muss für Onlinejourna -<br />
listen – sei es nur zur Kontrolle der eigenen Site. Ansonsten lese ich zum<br />
Beispiel viele Techblogs aus den USA. Sie halten mich besser auf dem Stand als<br />
Newssites.<br />
Welche strategischen Vorteile haben Blogs im Kontrast zum<br />
„etablierten Journalismus“?<br />
Die spannendsten sind schneller, kürzer, subjektiver und damit in der Regel<br />
kurzweiliger als klassische Newsangebote. Zugleich können das die Nachteile sein:<br />
zu hektisch, zu wenig tief, zu persönlich, damit erschöpfend. Gute Blogger haben<br />
für sich eine Strategie gefunden, um die Vorteile der Form zu nutzen.<br />
75
Wo sehen Sie die wesentlichen Defizite von Blogs in Deutschland?<br />
Jedes ist anders. Ich kann keine gemeinsamen Defizite ausmachen, eine Generalisierung<br />
fände ich unredlich. Das einzige vielleicht: Zu wenige Blogs schaffen es<br />
bisher, durch eine gute Kombination von Kompetenz, Charakter und Stringenz wirklich<br />
populär zu werden. Ich wünsche mir manchmal mehr Blogs wie Sprengsatz;<br />
was Michael Spreng da macht, ist kontrovers, meist reflektiert und reizt damit die<br />
Leser – dabei kommt der Autor nicht mal aus einer netzaffinen Generation. Wie<br />
immer man zu seinen Thesen steht, von solchen Experimenten auch etablierter<br />
Kollegen könnte man mehr vertragen.<br />
Glauben sie an die Legende von „online first“?<br />
Apodiktische Regeln scheitern meistens an der Realität. Man muss letztlich je nach<br />
Geschichte entscheiden; jedes Thema ist ja anders. Generell: Eine Exklusiv -<br />
nachricht zum Beispiel muss nicht zuerst online erscheinen. Aber in der Regel<br />
sollte sie parallel zu Print erscheinen – weil die kombinierte Veröffentlichung<br />
die Schlagkraft erhöht.<br />
Bei der Bild-Zeitung gilt dieser Slogan jedenfalls in der Praxis nicht.<br />
Jeder legt sich seine eigene Strategie zurecht. Ich finde das klüger als generelle<br />
Regeln, die im Alltag nicht funktionieren.<br />
Einer der führenden Online-Journalisten einer führenden Tageszeitung<br />
sagte kürzlich: „Die Bedeutung und Reichweite des Online-Journalismus<br />
in Deutschland wird überschätzt.“ Teilen Sie diese Einschätzung?<br />
Erst mal: Ich hänge nicht der These an, dass sich Onlinejournalismus grundlegend<br />
von TV- oder Printjournalismus unterscheidet. Unser Handwerk bleibt letztlich das<br />
gleiche, die Menschen konsumieren uns heute nur anders als vor zehn Jahren.<br />
Viele lesen uns jetzt eben im Internet. Entsprechend ist die Bedeutung: Man sollte<br />
das Netz schätzen – nicht unter- oder überschätzen. Man sollte aus dieser gigantischen<br />
Chance etwas Relevantes machen, statt lange über Relevanzen zu debattieren.<br />
Ihre Einschätzung: unterschätzt oder überschätzt?<br />
Mancher Politiker und Journalist unterschätzt Online immer noch, obwohl hier tatsächlich<br />
Agendasetting passiert. Mancher Insider überschätzt Online – für Outsider<br />
dreht sich die Welt ja keineswegs nur ums Netz.<br />
Wird das Potenzial des Online-Journalismus in Deutschland nach Ihrer<br />
Einschätzung ausgeschöpft? (Quellenvielfalt, Eigenständigkeit, visuelle<br />
Aufarbeitung, thematische Multi-Media-Potenziale etc.)<br />
In Deutschland weniger als in den USA, aber auch in den USA können die meisten<br />
Seiten noch lernen. In den vergangenen Monaten und Jahren haben wir Beat Blogs<br />
76
und spannende Integrationsformen für Facebook und Twitter auf Newssites gesehen,<br />
wunderbare Infografiken und Reportagen, die die mediale Vielfalt des Netzes<br />
nutzen. Das alles macht großen Spaß, auch dem Leser. Das Problem ist, dass solche<br />
Formen erst mal Zeit kosten – und wir aus Angst davor zu wenig versuchen. Meine<br />
Erfahrung ist: Wenn wir es versuchen, wird es oft einfacher als erwartet. Manchmal<br />
spart man sogar Ressourcen.<br />
Was hindert sie am Versuch?<br />
In wohl allen deutschen Online-Redaktionen die Routine und die Nöte des Alltags.<br />
Man muss sich zwingen, für kreative Formen Raum freizuschaufeln – und, falls sie<br />
sich bewähren, in den Alltag zu überführen.<br />
Welche wesentlichen Unterschiede sehen Sie zwischen dem herkömmlichen<br />
Print-Journalismus u n d hochwertigen Online-Journalismus?<br />
Wie gesagt, grundsätzlich gibt es handwerklich keine Unterschiede. In der Feinarbeit<br />
natürlich schon – von SEO bis zur pointierten Verkaufe von Geschichten.<br />
Online bedeutet: potenziell sekundenaktuell, potenziell unendlich tief, potenziell<br />
multimedial. Es kommt darauf an, was man aus diesem Potenzial macht. Die Möglichkeiten<br />
sind groß, aber man muss nicht alle nutzen, sondern nur jene, die für die<br />
jeweilige Geschichte die richtigen sind. Dies im Alltag zu schaffen und das nötige<br />
Rüstzeug zur Hand zu haben, ist die spezifische Herausforderung des Mediums.<br />
Wie wichtig sind die SEOs und wann macht ein SEO einen guten Job?<br />
Google, Google News etc. sind für mich wie ein interaktiver Kiosk. Natürlich will<br />
man da gleich neben der Kasse liegen. Also optimiert man seine Seite. SEO steht<br />
aber nicht zwingend im Widerspruch zum guten alten Newsjournalismus, im<br />
Gegenteil. Wenn man zum Beispiel Newsgeschichten mit klaren nachrichtlichen<br />
Überschriften versieht, die Reizworte enthalten, dann ist das sowohl klassisches<br />
Blattmachen als auch SEO. Eine handwerkliche Aufgabe, die sich im Übrigen von<br />
jener in den Zeitungen nicht so sehr unterscheidet.<br />
Was verstehen sie unter „pointierter Verkaufe“?<br />
Die Aufmerksamkeitsschwelle des Lesers ist gering, sein Interesse flüchtig. Das<br />
verdrängt man als Journalist gern, aber es ist so. Also muss jede Überschrift und<br />
jeder Teaser das Publikum reizen, auf den Punkt getextet sein, die Geschichte blitzschnell<br />
verständlich machen. Jedes Wort muss sitzen, und die Geschichten müssen<br />
einen klug überlegten, möglichst überraschenden Spin haben – natürlich ohne an<br />
der Realität vorbei zu dichten, man darf den Leser nicht verladen. Auch das:<br />
gewohntes Handwerk, dicht dran an Print, aber bei Online fast immer unter<br />
größerem Zeitdruck.<br />
77
Wie sieht das Rezept für den idealen „Teaser-Text“ zu Beginn einer Story aus?<br />
Wenn der Spin der Geschichte überraschend ist, schreibt sich der Teaser wie von<br />
selbst. Wenn es eher klassische News sind, gibt es ein paar Tricks – den Artikel auf<br />
Reizworte und gute Zitate scannen, Kontrastkonstruktionen, Überhöhung und<br />
vieles mehr. Drei wichtige Regeln: Erstens den Teaser am Ende zwar öffnen auf das<br />
berühmte „mehr ...“ hin, aber nichts elementar Wichtiges offen lassen, das frustriert<br />
Leser. Zweitens nicht übergeigen, das frustriert auch. Drittens sich zwingen,<br />
sich von Rezepten zu lösen. Eine Seite mit immer gleichen Teaserkonstruktionen<br />
ist langweilig.<br />
Welche wesentlichen Zukunfts-Trends sehen Sie für die kommenden fünf Jahre<br />
im Feld des Online-Journalismus?<br />
Fünf Jahre sind im Netz kaum zu überblicken. Für die kommenden zwei Jahren wäre<br />
meine Prognose: Die journalistischen Formen werden vielfältiger, das Layout<br />
hoffentlich kreativer und übersichtlicher, und wir müssen uns mit alternativen<br />
Plattformen auseinandersetzen. Redaktionen müssen in Social Networks präsenter<br />
werden. Wir brauchen attraktive Sites für Smartphones, Tablets, vielleicht sogar<br />
Fernseher, denn die Leute lesen uns längst nicht mehr nur am Rechner. Das ist<br />
mehr als eine technische Frage, sondern auch eine blattmacherische: Was ändert<br />
es, wenn Menschen unsere Site unterwegs oder im Wohnzimmer abrufen?<br />
Ist diese Nutzung „alternativer Plattformen“ nur eine Investitionsfrage der<br />
Verleger – oder welche Ressourcen sind nötig, um dieses ehrgeizige Ziel zu<br />
erreichen?<br />
Es ist erst mal eine journalistisch-gestalterische Frage: Welche Informationen interessieren<br />
Menschen auf solchen Plattformen mehr, welche weniger? Wie präsentieren<br />
wir sie, womit experimentieren wir? Dafür sind wir Journalisten eigentlich<br />
Experten. Investitionen ergeben in der Regel nur Sinn, wenn wir diese Vorarbeit<br />
gemacht haben.<br />
Welche Vorteile hätte ein Ende der Anonymisierungs-Kultur, die von vielen<br />
Online-Portalen gepflegt wird? (vgl. manche Regionalzeitungen akzeptieren<br />
nur noch Leserstimmen mit Klarnamen ...)<br />
Vor allem Facebook und Twitter haben die Debattenkultur verändert. Mehr Menschen<br />
als früher sind heute bereit, identifizierbar im Netz zu kommentieren, und<br />
mittelfristig wird sich diese Position hoffentlich durchsetzen. Weniger Forentrolle,<br />
die provozieren – mehr reale Menschen, die debattieren, so dass die Qualität der<br />
Beiträge steigt.<br />
78
Wie können sie denn die lästigen „Forentrolle“ filtern?<br />
Beispiel: Wer mit seiner Facebook-Anmeldung einen Artikel kommentiert, tut dies<br />
in der Regel mit Klarnamen und Bild. In diesem Rahmen Thesen in den Raum zu<br />
schleudern, bloß um zu provozieren – das geschieht nach aller Erfahrung viel seltener,<br />
die Selbstdisziplin ist größer, man muss viel weniger eingreifen, die Stimmung<br />
ist besser.<br />
Vergiften diese „Forentrolle“ nicht die gewünschte, kreativ-intelligente<br />
Debattenkultur?<br />
Ja, deshalb hoffe ich, dass sich Formen durchsetzen, wie sie bei Facebook zu sehen<br />
sind.<br />
Viele Verlage „kannibalisieren“ ihre Geschäftsmodelle selbst, in dem sie<br />
mit kostenlosen Angeboten den Käufermarkt ihrer Print-Produkte einengen.<br />
Welche Auswege sehen Sie hier und welche Bezahlmodelle haben künftig aus<br />
ihrer Sicht die realistischsten Umsetzungs-Chancen?<br />
Man bezahlt nicht für Artikel, die man anderswo umsonst bekommt. Deshalb wird<br />
eine klassische Newssite immer effizienter über Anzeigen zu finanzieren sein als<br />
mit Paywalls – weil immer irgendwer kostenlos News bringen wird. Aber dass die<br />
Leser für Exklusives gern Geld ausgeben oder für ganzheitliche Leseerlebnisse auf<br />
einem Coffeetable-Gerät wie dem iPad, das zeigen „Wall Street Journal“ und<br />
„Spiegel“. Mit das Wichtigste ist vermutlich, dass das Bezahlsystem so simpel und<br />
etabliert ist wie bei iTunes oder PayPal.<br />
Wann wird hier etwas passieren?<br />
Alle wesentlichen Verlage prüfen, planen, experimentieren, es ist Bewegung drin.<br />
Aber natürlich hat noch keiner das ideale Geschäftsmodell der Zukunft gefunden.<br />
Das macht die Sache ja so spannend.<br />
Warum haben die Verlage dieses Thema „verschlafen“?<br />
Das wird gern gesagt, stimmt so aber nicht. Weltweit, auch in Deutschland, experimentieren<br />
Verlage seit Jahren mit Paid Content und stellen zum Beispiel E-Paper<br />
ihrer Zeitungen ins Netz – was in der Summe kein riesiger Erfolg war. Das liegt an<br />
vielem, vor allem an mangelnder Aufbereitung und daran, dass sich die meisten<br />
Menschen erst seit dem iPad vorstellen können, auf einem Monitor gern eine<br />
Zeitung oder Zeitschrift zu lesen. Das Haptische, das Blattmacherische und die<br />
menschlichen Gewohnheiten sind offensichtlich nicht zu unterschätzen. Eine<br />
wichtige Lernerfahrung der vergangenen Jahre.<br />
79
Welche publizistische Innovationen stehen im deutschen Online-Journalismus<br />
noch aus?<br />
Data Journalism zum Beispiel. Das ist für uns weitgehend Neuland. Den Bundesetat<br />
oder Parteispenden zu dekodieren, auch so Simples wie Wahlergebnisse oder<br />
die Arbeitslosenzahlen, und zwar attraktiv und mit Erkenntnisgewinn für den Leser,<br />
offen und für Nutzung durch andere Sites zugänglich – das wäre ein Transparenzgewinn<br />
für eine Newssite, den Journalismus, die Demokratie.<br />
Wie können solche qualitativen Optimierungs-Strategien umgesetzt werden?<br />
Onlineredaktionen müssen ständig checken, ob die Strukturen stimmen, in denen<br />
sie arbeiten, Routinen hinterfragen und offene Debatten führen. Die Herausforderungen<br />
im Netz sind so vielfältig, dass ich jeder Redaktion interne Think Tanks und<br />
harte externe Sitekritiken empfehlen würde. Und dann: Get things done.<br />
Was steht auf ihrem „Priorisierungs-Zettel“ bezogen auf den Online-Journalismus?<br />
Jeden Tag versuchen, besser zu werden. Das ist das Wichtigste – alles Weitere siehe<br />
oben.<br />
Fragen: Thomas Leif<br />
80
„Es ist unmöglich<br />
die Fackel der Wahrheit<br />
durch ein Gedränge<br />
zu tragen, ohne<br />
jemanden den Bart<br />
zu sengen.“<br />
G.C. Lichtenberg, 1780<br />
81
IMPRESSIONEN
TEIL II<br />
MEDIENPOLITISCHE ANALYSEN @<br />
JOURNALISTISCHE REFLEXIONEN
Wofür stehen wir?<br />
Von Tom Schimmeck<br />
„Wofür stehen wir?“ Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Und die Frage wird, ich<br />
verrate es Ihnen gleich, umso interessanter, je älter man wird. Weil man Zwischenbilanzen<br />
zieht. Weil man widerwillig registriert, welche Träume geplatzt sind, welche<br />
Illusionen zerstoben. Und sich fragt: Was bleibt?<br />
Im Grunde hat man als Journalist wohl die Wahl, zynisch zu werden und alles für<br />
Lug & Trug und eh vergebens zu halten – oder dranzubleiben, menschlich, engagiert,<br />
mit offenen Ohren, Augen, mit allen Sinnen, mit Neugier. Mit der Überzeugung,<br />
dass manches morgen besser sein könnte, wenn man die Menschen nur aufklären<br />
und sich richtig reinhängen würde.<br />
Natürlich gibt es auch Nebenalternativen: Sie können ins Kloster gehen und niederknien<br />
und beten. Oder sich in ihrem abgeschotteten Privatissimum einnisten und<br />
den ganzen Tag ihre Flatrate abtelefonieren und die tollsten Hits hören und auf der<br />
Spielkonsole Level 12 erreichen oder anderweitig die Zeit totschlagen. Nur zu. Das<br />
Zerstreuungsangebot ist größer denn je.<br />
Die Frage lautet also: „Stehen“ wir überhaupt noch für irgendetwas? Für eine Überzeugung?<br />
Für ein Anliegen? Für etwas, das über den Tag hinausreicht, das mehr ist<br />
als wir selbst? Haben wir noch das Stehvermögen dafür – das „Standing“? Und das<br />
Bewusstsein?<br />
Wollen wir für irgendetwas aufstehen und einstehen, das mehr ist als unser kleines<br />
selbstgebasteltes Dasein? Dafür auch geradestehen?<br />
Wenn Sie der Sprache des politischen Journalismus ein bisschen genauer zuhören,<br />
stellen Sie staunend fest, dass es in der Politik in letzter Zeit eher selten darum geht,<br />
wofür einer steht. Also: welches Anliegen ein politisches Subjekt befeuert. Für welches<br />
Ideal einer lebt. Der Journalist fragt heute viel lieber, wie ein Politiker „positioniert“ ist,<br />
ob er „gut aufgestellt“ ist. Gut aufgestellt und hübsch positioniert ist man, wenn die<br />
85
Pressestelle ganze Arbeit geleistet hat, wenn die Imageberater einen ins optimale<br />
Licht gerückt haben, wenn die mühsam gedrechselten und dann bis zum Erbrechen<br />
wiederholten Sätze zuvor demoskopisch wie psychologisch ausgetestet und für<br />
wirkungsvoll und im Einklang mit dem Zeitgeist befunden wurden. Es geht eher selten<br />
um Positionen, Haltungen, Überzeugungen. Es geht um die perfekte Show. Darum,<br />
ob die Bühnenbeleuchtung stimmt, der Schlips gerade sitzt; ob das Image richtig<br />
rüberkommt, die Medien das Richtige, sprich: das Erwünschte, schreiben.<br />
Die Sprache des Aufstellens und Positionierens entkernt das Politische, reduziert es<br />
auf die Strategie, auf Inszenierungsfragen. Das ist einfacher und schneller, erlaubt es<br />
dem Journalisten doch, seiner subjektiven Tagesform zu frönen und in den großen<br />
Deutungswellen des Top und Flop mitzuschwimmen. Es ist leider meist auch<br />
unendlich dämlich.<br />
„Wofür stehst Du?“ Also wir Journalisten stehen oft einfach nur dumm herum. Zum<br />
Beispiel vor irgendwelchen dicken Türen, hinter denen wichtigere Leute irgendwelche<br />
Entscheidungen fällen. Wir warten dann darauf, dass – hoffentlich bitte, bitte – mal<br />
einer dieser Wichtigen herauskommt und uns eine Wortspende gibt, irgendetwas<br />
sagt, das wir artig weitermelden und -senden können. Oder doch zumindest<br />
irgendwie bedeutend guckt, während er aufs Klo geht. Oder das einer unserer Kontakte<br />
uns eine SMS aus dem Saal beamt. Das wird übrigens, sagen mir Politkorrespondenten,<br />
immer wichtiger: Die schnelle SMS aus der Sitzung.<br />
Ein Politiker erzählte mir neulich: Das sei schon absurd, man sitze in der Bundestagsfraktion<br />
und könne auf seinem Smartphone mitverfolgen, wie andere Kollegen,<br />
die ebenfalls im Raum anwesend sind, über die Medien ihre kleinen Intrigen gegeneinander<br />
spielen.<br />
Wir Journalisten sind da nur Werkzeug. „Medium“ im eher physikalischen Sinne.<br />
Wir stehen für nichts. Wir stehen nur zur Verfügung.<br />
Politisch, behaupten die Studien, stehen wir Journalisten noch immer eher ein<br />
bisschen links. Bei der letzten großen Weischenberg-Studie über Journalismus in<br />
Deutschland 2005 verorteten sich die Befragten auf einer Skala von 1 bis 100, bei<br />
der 1 für „politisch links“ und 100 für „politisch rechts“ stand, im Schnitt bei 38.<br />
Ihre Kollegen schätzten die Befragten ein Stückchen weiter rechts ein, bei 41. Und<br />
ihre Arbeitgeber, die Medien, genau in der „Mitte“, nämlich bei 51. Daraus lässt<br />
sich bereits eine gewisse Anpassungsleistung erahnen. Denn tatsächlich sind die<br />
Medienbesitzer in aller Regel eher bei der CDU oder der FDP zuhause. Der Journalist,<br />
so scheint es, macht oft einen Kompromiss zwischen der eigenen Meinung und der<br />
seines Brötchengebers – bzw. der des <strong>vom</strong> Besitzer ausgewählten Chefredakteurs.<br />
Er steht dann zwischen sich selbst und den an ihn gerichteten Anforderungen.<br />
Manchmal ist das ein zugiger Ort.<br />
Wobei solche Verortungen natürlich höchst subjektiv sind. Was heißt schon „Mitte“?<br />
Das hängt immer <strong>vom</strong> Zeitgeschehen und dem daran geknüpften Geist ab. Der Wind<br />
86
wechselt seine Richtung. Was eben noch Mitte war, ist plötzlich extrem. Auch umgekehrt.<br />
Und wenn 50 Jahre Debatte gar nicht fruchten, bebt irgendwo die Erde so<br />
schwer, dass selbst betonharte Glaubensbekenntnisse zerbröseln. Wer hätte etwa<br />
gedacht, dass wir mit der schwarzgelben Truppe aus der Atomkraft aussteigen?<br />
„Mitte“ ist etwas sehr diffuses. Mitte ist einerseits irgendwie öde. Auch ein bisschen<br />
feige. Wer immer ab durch die Mitte strebt, drückt sich gerne mal vor einem eigenen<br />
Standpunkt. Verdrückt sich auf die sichere Seite. Mitte ist andererseits Stabilität.<br />
Sie steht für den Grundkonsens der Gesellschaft. Solange alle wesentlichen Kräfte<br />
in die solide, gemütliche, gutbürgerliche Mitte streben, fährt der Gesellschaftsdampfer<br />
ruhig geradeaus.<br />
„Die soziale und politische Mitte in Deutschland war der Stabilitätsanker der Bonner<br />
<strong>Republik</strong>; sie sorgte dafür, dass Bonn nicht Weimar wurde“, schrieb unlängst der<br />
Sozialwissenschaftler Herfried Münkler. In Deutschland wähnt sich der Großteil der<br />
Bevölkerung seit Jahrzehnten in der Mitte. „Doch diese Mitte“, fährt Münkler fort,<br />
„als Garant einer vielleicht in vieler Hinsicht langweiligen, aber doch zuverlässig funktionierenden<br />
Demokratie ist seit geraumer Zeit gefährdet, und zwar sowohl als<br />
politische als auch als soziale Mitte.“<br />
Unsere Gesellschaft breche nicht morgen auseinander, beruhigt Münkler. Auch ein<br />
Berlusconi steht uns wohl nicht unmittelbar bevor. Doch, so sagt er: „in der Gefühlund<br />
Vorstellungswelt der Menschen macht sich die Vorstellung breit, dass die<br />
Gesellschaft in eine obere und untere Hälfte zerfalle. Wo vor kurzem noch das Bild<br />
einer mächtigen, die Gesellschaft zusammenhaltenden Mitte dominierte, herrscht<br />
nun die Sorge vor, man müsse darauf achten, dass man zur oberen Hälfte der Gesellschaft<br />
gehöre und nicht in die untere Hälfte abrutsche. Es ist ein Merkmal mitte -<br />
dominierter Gesellschaften, dass in ihnen diese Sorge keine Rolle spielt. Wenn sie<br />
inzwischen in breiten Kreisen anzutreffen ist, so zeigt dies, dass der Erwartungshorizont<br />
der Menschen nicht mehr durch eine dominante gesellschaftliche Mitte<br />
bestimmt wird.“<br />
Die Zeiten werden auch hier rauer. Bald werden wir uns sehnen nach den biederen<br />
Zeiten der deutschen Mitte. Spätestens, wenn auch bei uns, wie überall rundum,<br />
der Rechtspopulismus dröhnt.<br />
Die Forschung zeigt, dass wir Journalisten heute eher aus den oberen Etagen der<br />
Gesellschaft stammen. Die lieben Eltern sind mindestens Angestellte, gern auch<br />
Beamte, viel obere Mittelschicht ist dabei. Das liegt auch an der Akademisierung<br />
unserer Berufsstandes – das Gros hat heute einen Hochschulabschluss. Und unser<br />
prädemokratisches Bildungssystem sorgt ja – wie inzwischen allgemein bekannt<br />
ist und in zahllosen internationalen Vergleichsstudien bestätigt wurde – sehr verlässlich<br />
dafür, dass die so genannten „besseren Kreise“ unter sich bleiben.<br />
Doch selbst die noble Herkunft nutzt nicht mehr allzu viel. Auch unter Journalisten<br />
wächst der Druck. Es fällt auch in unserer Zunft immer schwerer, einen anständigen<br />
87
88<br />
Job zu ergattern. Man wird durch endlose Praktika genudelt, bekommt dann vielleicht,<br />
eines ganz schönen Tages, mal einen Zeitvertrag. Die Konkurrenz ist groß. In<br />
Berlin-Mitte zum Beispiel sehen sie all diese freischaffenden Künstler in den Cafés<br />
hocken. Auf ihrem Laptop tippend. Sie strecken ihren Latte Macchiato über Stunden.<br />
Checken per kostenlosem W-Lan ständig ihre Inbox, ob bitte vielleicht ein Auftrag<br />
eingegangen ist.<br />
Die tollen Tage, da irgendein Chefredakteur oder gar Verleger sagte: „Du hast<br />
Talent, hier hast Du Geld. Probier Dich aus. Fahr los in die weite Welt und bring mir<br />
irgendwas, es wird schon gut sein“ – die sind irgendwie vorbei.<br />
Der aufrechte Gang ist nicht mehr die vorherrschende Fortbewegungsart im Journalismus.<br />
Die Honorare sind, selbst bei Qualitätszeitungen oft lausig. Es gibt jetzt<br />
auch bei uns eine enorme Spreizung zwischen Arm und Reich. Ganz oben ein paar<br />
Alphatierchen, die verdammt gut verdienen. Manche kassieren – sobald die eigene<br />
Visage zur Marke geworden ist – nebenbei noch für Werbeauftritte. Oder werden<br />
gleich Chief Communication Officer bei einem Großkonzern. Unten das wachsende<br />
journalistische Fußvolk. Viele, viele Leute, die sich irgendwie durchschlagen. Sie sind<br />
oft sehr engagiert, idealistisch, experimentierfreudig. Sie machen tolle Sachen.<br />
Und kommen trotzdem auf keinen grünen Zweig. Das kann auf Dauer frustrierend<br />
wirken, demütigend. Es ist nicht einfach, unter solchen Bedingungen eine politische<br />
Haltung zu entwickeln und zu behaupten.<br />
Denn Würde und Haltung sind nicht nur eine Frage hehrer Ethik. Sie haben auch<br />
einen handfesten ökonomischen Aspekt. Es geht immer auch um die Existenz. Um<br />
die Kohle. Denn erst kommt das Fressen. Und dann die Moral. Wenn überhaupt.<br />
Vor allem die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sind, man muss es mal so klar<br />
sagen, rotzfrech geworden. In den Sonntagsreden ist immer noch von der vierten<br />
Gewalt und der Wächterfunktion und der Demokratie die Rede. Im Alltag aber geht<br />
es jetzt hart zur Sache. Selbst die nach jahrelangen Verhandlungen vereinbarten<br />
Mindeststandards für die Bezahlung freier Autoren werden notorisch nicht eingehalten.<br />
Dabei sind sie ohnehin miserabel.<br />
Als Autor unterschreiben sie inzwischen meist daumendicke Zusatzvereinbarungen,<br />
mit denen sie alle Rechte an ihrem Werk für alle Zeiten an die Verlage abtreten.<br />
Damit die das, was Sie geschaffen haben, überall drucken und senden können, auf<br />
ewig, im ganzen Weltall, in allen Sprachen, vertont oder als Comic. Ohne jemals<br />
wieder einen Cent an Sie zu bezahlen. Hier ein Beispiel: Der Autorenvertrag der<br />
Gruner und Jahr Wirtschaftsmedien – das ist eine vor kurzem zusammengelegte<br />
publizistische Großküche, in der sämtliche Wirtschaftstitel des Hauses aufgekocht<br />
werden. Ich zitiere Paragraph 2.1.:<br />
Der Vertragspartner räumt den G+J Wirtschaftsmedien das räumlich, zeitlich und<br />
inhaltlich unbeschränkte Recht ein, die Beiträge im In- und Ausland auf sämtliche<br />
– auch im Zeitpunkt des Auftrags unbekannte – Nutzungsarten für sämtliche Zwecke<br />
zu nutzen. Die G+J Wirtschaftsmedien haben insbesondere das Recht, die Beiträge
eliebig oft für redaktionelle, werbliche und gewerbliche Zwecke in Printmedien<br />
(insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Sonderausgaben und Sonderdrucken der<br />
Beiträge, Zeitungen und Zeitschriften, Büchern und Kalendern), in (Lizenz- und<br />
Merchandising-)Produkten der G+J Wirtschaftsmedien, in Rundfunk, Film, Fernsehen,<br />
im Internet, in Mobilfunknetzen, anderen Datennetzen, auf Datenträgern und in<br />
jeglicher sonstiger digitaler Form (alle Speicher-, Träger- und Übertragungstechniken<br />
und -geräte, z. B. als e-Paper, e-Magazine oder mobile Applikation) zu nutzen, die<br />
Beiträge in Datenbanken zur Recherche und zum Download bereitzuhalten, zu digitalisieren,<br />
zu archivieren und in Pressespiegeln sowie in der Öffentlichkeitsarbeit<br />
und Eigenwerbung für die Medien und Produkte der G+J Wirtschaftsmedien zu nutzen.<br />
Die G+J Wirtschaftsmedien dürfen die Nutzungsrechte auf Dritte übertragen …<br />
Und so weiter. Und es geht noch lange weiter. Ich habe schon etliche solcher<br />
Verträge unterschrieben. Sie bekommen nämlich sonst keinen Auftrag. Ich ärgere<br />
mich darüber. Denn langfristig ist das wirtschaftlicher Selbstmord.<br />
Auch die Festangestellten stehen unter einem enormen Zeit- und Spardruck – weil<br />
in den Verlagen längst die Renditeerwartungen dominieren. Hinzu kommt ein<br />
wachsender Anpassungsdruck in der Peer Group: Egal, ob sie sich als Journalist<br />
in Berlin Mitte herumdrücken oder an der Frankfurter Börse. Seit Jahren<br />
wächst auch der von der PR-Industrie gesteuerte Lärm, der die Redaktionen unablässig<br />
mit Sprüchen, Studien und Statistiken, mit Events und wohlfeilen Promis<br />
beregnet.<br />
Genug davon. Ich will Sie nicht über Gebühr deprimieren. Auch gar nicht schwarzmalen.<br />
Es gibt nämlich jeden Tag richtig guten Journalismus. Ich kenne eine Menge<br />
großartiger Journalisten. Einige von ihnen sind sogar sympathisch. Außerdem<br />
wächst man ja grade unter widrigen Umständen an seinen Aufgaben.<br />
Und es gibt viel zu tun. Gerade in der globalisierten Wikileaks-Welt. Nie waren die<br />
Zusammenhänge komplexer. Nie gab es mehr Informationen, die gesichtet, geordnet,<br />
verstanden, beurteilt und einsortiert werden mussten. Wir brauchen mehr Journalismus<br />
denn je. Und wir brauchen neue, tolle, kluge Plattformen, auch im Internet.<br />
Da hinken wir noch schwer hinterher, im Vergleich etwa zu Frankreich und den USA.<br />
Der deutsche Online-Journalismus ist unterentwickelt. Man beschäftigt sich tendenziell<br />
eher mit Selbstmarketing und den eigenen Be- und Empfindlichkeiten als<br />
mit gutem Stoff. Aber das wird sich ändern.<br />
Egal ob fest oder frei, ob off- oder online, in jedem Fall braucht braucht man als<br />
politischer Journalist den eigenen Kopf. In dem sich neben einem Haufen Fakten<br />
und Theorie auch ein Werkzeugkasten befinden sollte, der einen zu einer eigenen<br />
Haltung befähigt. Lauter Sachen, die man nicht downloaden kann: Eigene Wertmaßstäbe<br />
und Kriterien, Überzeugungen, Erfahrungen. Auch Empathie. Wer unberührbar<br />
ist, ganz und gar cool, der sollte besser Metzger werden.<br />
89
Dazu gehört auch die ständige Selbstreflektion. Was ist wirklich wichtig? Und für<br />
wen? Was halte ich warum für gut und richtig? Wer wirkt wie auf mich?<br />
Jürgen Leinemann, langjähriger Spiegel-Autor, ein Freund und ein Vorbild, schrieb<br />
einmal:<br />
Wer sich den aufrechten Gang erhalten will, der braucht ein reflektiertes Verhältnis<br />
zu sich selbst und seinem Beruf, einen verantwortlichen, bewussten Umgang mit<br />
der eigenen Subjektivität.<br />
Neben Sachkunde und Menschenkenntnis brauche es, sagt Leinemann, eine Gabe,<br />
die der britische Philosoph Isaiah Berlin „Wirklichkeitssinn“ nennt: „Sie hat eher<br />
mit Verstehen zu tun als mit Wissen, und sie ist durch nichts zu ersetzen.“ Dieser<br />
Sinn wächst und gedeiht nur durch Teilnahme am Leben und der Welt. Er macht den<br />
„Riecher“ aus, den man hat oder auch nicht. Er befähigt einen, aus Fakten, Beobachtungen<br />
und, ja, Empfindungen, weit mehr zusammenzudenken als die bunte<br />
Oberfläche ohnehin preisgibt. Haltung ist ein unverzichtbarer Bestandteil. „In seiner<br />
Haltung“, sagt Leinemann, „hat die Freiheit des Journalisten ihren Rückhalt. Wie er<br />
auf Ereignisse und auf Menschen reagiert, wie er sich zur Macht und gegenüber<br />
Mächtigen verhält, das ist nicht nur individuell relevant, sondern das hat auch politische<br />
Folgen. Für mich sind zwei Sätze als Leitlinien bestimmend geworden. Der erste<br />
heißt: Wirklichkeit ist alles, wo man durchmuss. Der zweite ist eine Gedichtzeile<br />
von Peter Rühmkorf: ,Bleib erschütterbar und widersteh.‘“<br />
Was ebenfalls gegen allzu viel Schwarzmalerei spricht: Im Grunde geht es uns in<br />
Deutschland – vergleichsweise – verdammt gut. Wie sind frei von Despoten. Keiner<br />
landet im Knast, weil er den Mund aufmacht. Im Rechtsstaat Deutschland ist die<br />
freie Meinungsäußerung ziemlich ungefährlich. Anders als in Russland, China,<br />
Moldawien, Mexiko und Dutzenden anderer Staaten.<br />
Auch Hysterisierung, Gleichschaltung und Abstumpfung sind bei uns noch lange<br />
nicht so weit gediehen wie etwa in den USA, in Italien oder in Ungarn. Länder, in<br />
denen man sehr unterschiedliche, durchweg furchterregende Varianten des Niedergangs<br />
demokratischer Öffentlichkeit verfolgen kann.<br />
Sicher, auch hierzulande sind Journalisten vielerlei Pressionen von Politik, Wirtschaft<br />
etc. ausgesetzt. Die PR-Industrie marschiert. Die Agendasetter, Eventmanager und<br />
Spindoctores manipulieren auch hier recht emsig an der öffentlichen Meinung herum.<br />
Und viel zu viele Journalisten machen mit bei diesem Zirkus, pinseln den angehübschten<br />
Unfug einfach ab. Nicht, weil ihre Freiheit existenziell bedroht, die Propaganda<br />
so allmächtig wäre. Nein, oft eher, weil es einfacher ist und schneller geht.<br />
Weil es bequemer ist. Weil es gewünscht wird und/oder besser bezahlt. Sie können<br />
auch anders. Die Gefahr hier bei uns besteht eher in einer Art gespreizter Dekadenz.<br />
Wirklich angefochten, sagt Leinemann, werde die die Freiheit erst, „wenn Journalisten<br />
leichtfertig hinnehmen, was man mit ihnen macht oder mit vorauseilendem<br />
90
Gehorsam auf Druck der Mächtigen reagieren. Ist die viel beklagte ,Schere im Kopf‘<br />
nicht eher ein Sofa im Kopf, Ausdruck von Bequemlichkeit und nicht von berechtigter<br />
Furcht vor Risiken? ... Die journalistische Freiheit wird in der Bundesrepublik heute<br />
weniger durch obrigkeitsstaatliche Pressionen bedroht als durch die weiche<br />
Knechtschaft einer eitlen Selbstverliebtheit.“<br />
Und er zitiert György Konrád, über Jahrzehnte als ungarischer Dissident staatlich<br />
bevormundet: „Jetzt ist es nicht mehr die Geheimpolizei, die bei den Bürgern<br />
Gehirnwäsche betreibt, sondern die als Abfolgen von Moden dahinwogende Oberflächlichkeit.“<br />
Wofür stehen Sie? Ist es Ihnen womöglich peinlich, für irgendetwas zu stehen?<br />
Haben Sie vielleicht Sorge, als Weltverbesserer verspottet zu werden? Als „Gutmensch“?<br />
Ich möchte Ihnen hier einen kleinen Exkurs zumuten. In der Hoffnung,<br />
Ihnen etwas demonstrieren zu können über die Entstehung und Wirkung von<br />
„Falschwörtern“. Eine Wortschöpfung von Ivan Nagel übrigens. Der hat ein ganzes<br />
Falschwörter-Buch geschrieben.<br />
Der „Gutmensch“ also. Meine Erfahrung sagt mir: Wer über „Gutmenschen“ herzieht,<br />
ist meist ein mieser Typ. Gewiss, es gibt überdrehte Tierschützer, die jede Labormaus<br />
befreien wollen. Es gibt Super-Ökos, die nur und ausschließlich an das Schicksal<br />
bestimmter Insekten denken und Mülltrennung allzu verbissen sehen. Es gibt auch<br />
die Mega-Sozialarbeiter, die alle Verantwortung ihrer Schützlinge wegwischen mit<br />
Hinweisen auf deren schwere Kindheit. All dies sind Verengungen des Blickfeldes.<br />
„Gutmensch“ aber ist ein Hasswort – für einen wohlmeinenden, aber dämlichen<br />
Tropf, der den wahren Lauf der Welt noch immer nicht kapiert hat. Ein „Gutmensch“<br />
ist eine Art politischer Warmduscher, ein idealistischer Träumer, der die Realitäten,<br />
die Härte des Daseins verleugnet. Bis Mitte der 90er Jahre war das Wort so gut wie<br />
unbekannt. (...) Der Sprachdienst der Gesellschaft für deutsche Sprache versuchte<br />
sich 1997 an einer Definition dieses „Schmähwortes“: Es diene als „Schlagwort zur<br />
Stigmatisierung des Protests, zur Diffamierung des moralischen Arguments“.<br />
Gutmensch – das ist der Allround-Niedermacher des frühen 21. Jahrhunderts. Das<br />
Wort spiegelt die Verachtung des zynischen Pragmatikers für jedwede Vision. Es<br />
dient der Abgrenzung gegen jene, die den Gipfel cooler Abgeklärtheit noch nicht<br />
erklommen haben. Gegen lächerliche Idealisten, die sich für Analphabeten,<br />
Arbeitslose und Afrika engagieren. Die nachts aufstehen, um Kröten über die Straße<br />
tragen. Gene die, die immer noch diskutieren, protestieren, rebellieren wollen –<br />
wider jene Kräfte, die am Ende doch mehr Muskeln haben: gewichtige Politiker, die<br />
Industrie oder gar den eigenen Chefredakteur.<br />
Das Quellenstudium der deutschen Presse zeigt, dass es sich beim „Gutmenschen”<br />
um ein notorisch irrlaufendes, extrem lästiges, „esoterisch-gefühliges” Wesen<br />
handeln muss. Der Gattungsbegriff „Gutmenschentum” paart sich gern mit<br />
91
92<br />
Wörtern wie „missionarisch”, „moralistisch”, „multikulturell”. Ein „Gutmensch”<br />
ohne ein schönes fieses Adjektiv geht eigentlich gar nicht. „Gutmenschen” sind<br />
„grünhirnig”, „moralpachtend”, „ambitioniert”, „kirchentagshaft”, „oft verbissen<br />
wirkend”, „naiv”, „hölzern”, „schuldgeplagt” oder gar „schuldkomplexbeladen”,<br />
„selbstgefällig”, „links”, „pazifistisch”, „patentiert”, „verlogen”, „wirkungslos”,<br />
sehr oft „unverbesserlich”, „am Mammon desinteressiert” und doch, sapperlot:<br />
„steinreich”. Es sind „Multikulti-Fetischisten”, die „bei Bauchtanz und Chinapfanne<br />
ihre Erfüllung suchen” und sich „schützend vor Migrationsversager” stellen. Tagsüber<br />
gucken sie „gern traurig”, „lächeln melancholisch” und arbeiten unablässig<br />
am EU-Beitritt der Türkei.<br />
Selbst die Verknüpfung mit konkreten Personen schafft kaum Klarheit. Als Beispiele<br />
für „Gutmenschen” finden sich in seriösen deutschen Zeitungen unter vielen anderen:<br />
Claudia Roth, Muammar Gaddafi , Bono, Uwe Steimle, Johannes B. Kerner, Rainer<br />
Calmund, Matthias Sammer (der „Gutmensch der Bundesliga”), Jürgen Trittin,<br />
Bernard Kouchner, Günter Wallraff , Johannes Rau, Konstantin Wecker („Gutmenschenbarde”)<br />
und Victoria Principles, die Gefährtin von Bobby Ewing in Dallas (sie<br />
steht ihm „gutmenschlich zur Seite”, die dumme Nuss). Außerdem zahlreiche<br />
Politiker links der CSU, die Outdoormarke Timberland sowie sämtliche Gemeinschaftskundelehrer,<br />
„Pauschalumarmer” und „Allesversteher”.<br />
Dem modernen Neopragmatiker gilt die Rebellion 1968 als eine Art Urknall des<br />
„Gutmenschentums”. Bild-Chefredakteur Kai Diekmann hat die Entstehung dieser<br />
Spezies erforscht: 1968 bedeutet für ihn den „Epochenbruch der deutschen Gesellschaft<br />
in Richtung Egozentrik, Mittelmaß und Faulheit”, der den „Gutmenschen”<br />
hervorgebracht hat, „die säkulare Form des pietistisch abseitigen Frömmlers”, die<br />
heute „zur Plage geworden” sei. Der einst aufklärerische Rowohlt Verlag brachte<br />
2007 ein Buch mit dem lustigen Titel „Achtung, Gutmenschen!“ heraus, das er so<br />
anpries: „Sie quälen und sie nerven uns. Und es ist höchste Zeit, sie loszuwerden.”<br />
Ein besonders enger Freund des Begriffs war lange Josef Joffe, Herausgeber der an<br />
ungeraden Tagen liberalen Zeit. Er verteidigte zu Bush-Zeiten sogar das amerikanische<br />
Verteidigungsministerium gegen die „diplomatiebeflissenen State-Department-<br />
Gutmenschen”. (...)<br />
Längst ist der „Gutmensch” angekommen, wo er hingehört: an seiner Wortquelle.<br />
Am ultrarechten Rand wettert man inflationär gegen den „Terror der Gutmenschen”.<br />
Schon Ronald B. Schill, jener rechte „Richter Gnadenlos”, der dank des<br />
Elans der Hamburger Springer-Blätter vor Jahren zum lokalen Star aufstiegen durfte<br />
und im September 2001 als Koalitionspartner mit sagenhaften 19,4 Prozent die<br />
Machtübernahme der CDU gewährleistete, ekelte sich vor „Gutmenschentum”. Die<br />
„Freiheitliche Jugend” in Berlin sammelte Ende 2002 Vorschläge für die Aktion<br />
„politisch korrektester Gutmensch”. Jörg Haider verhöhnte seine Gegner immer<br />
wieder als „Gutmenschen”. Sein Wiedergänger, der lärmende FPÖ-Chef Heinz-<br />
Christian Strache, setzt die Tradition fort. Während er im Mai 2009 in Wien mit
einem Kruzifix gegen den Bau einer Moschee demonstrierte, nahm Strache (Slogan:<br />
„Abendland in Christenhand”) sich den „Geifer der Gutmenschen” vor. Die Jungen<br />
Nationaldemokraten melden im Internet, sie hätten „Gutmenschen in Stade die<br />
Stirn geboten”. Die NPD Mecklenburg-Vorpommern attackiert einen Kritiker als<br />
„besonders feisten Gutmenschen”.<br />
„Gutmensch” ist ein Nazi-Wort. Umstritten ist, ob es von Joseph Goebbels oder von<br />
Redakteuren des Stürmer 1941 in die Welt gesetzt wurde. Verwendet wurde es zur Verhöhnung<br />
des Kardinals Clemens August Graf von Galen, der gegen die Vernichtung<br />
sogenannten „lebensunwerten Lebens” – die systematische Ermordung körperlich<br />
und geistig Behinderter – protestierte. Auch Hitler hat immer wieder gutmeinende und<br />
gutmütige Menschen verspottet, die in ihrer Naivität nicht in der Lage seien, die<br />
von ihm definierten Feinde des Volkes – Juden und Bolschewisten – zu erkennen.<br />
Ein langer Exkurs. Doch dieses Wort ist ein gutes Beispiel für den Wandel von<br />
Lebenshaltungen. Und auch für den unreflektierten Umgang mit Worten.<br />
Meine These: Pragmatismus ist die Vorstufe des Zynismus. Was nicht heißt, dass man<br />
stets mit dem Kopf in den Wolken herumlaufen sollte. Wer aber nur und ausschließlich<br />
auf dem Boden vermeintlicher Tatsachen herumkriecht, wird nie eine gewisse<br />
geistige Flughöhe erreichen. Wie haben im Journalismus viel zu viel Mitläufertum und<br />
Pragmatismus. Wir fragen uns zu selten: Was machen wir zum Thema? Und: Machen<br />
wir selbst überhaupt etwas zum Thema? Wir sind selbstgenügsame Mittelschicht-<br />
Wesen, die viel zu viel mit anderen Journalisten verkehren. Und mit sogenannten „wichtigen<br />
Leuten“. Wir müssen wieder mehr das machen, an das wir selber glauben. (…)<br />
Ich habe in den letzten gut 30 Jahren als politischer Journalist diverse Phasen und<br />
Moden durchlebt: In den 70ern, als ich politisiert wurde, tobte noch der Kalte Krieg.<br />
Die Welt war zweigeteilt. Es gab den Kapitalismus und den – wie es immer so schön<br />
hieß – „real existierenden Sozialismus“. Der natürlich Mist war. Der Abtörner<br />
schlechthin. Ja, wir waren links. Aber dieser Osten schien fremd und falsch und<br />
sehr weit weg. Die DDR war für uns – mit Ausnahme der DDR-Bejubler von der DKP<br />
– das spießigste Land der Welt. Aber wenn man etwas zu meckern hatte, hieß es:<br />
„Geh doch nach drüben!“<br />
Willy Brandt stand für Aufbruch. Helmut Schmidt war dann schon eher das kühle<br />
Management. Mit dem klassisch gewordenen Satz: „Wer Visionen hat, soll zum<br />
Arzt gehen“. Danach kam die endlose Kohl-Ära, gefühlt 100 Jahre. Seit den 90ern<br />
herrscht Verwirrung: Die Machtblöcke weg, die Ost-West-Konfrontation vorbei.<br />
Vom „Ende der Geschichte“ war die Rede. So ein Quatsch.<br />
Es wurde die Ära der Zeitgeistler, der Hedonisten. Da wuchs eine neue Generation<br />
von Schreibern nach, der das triste Tagesgeschäft der deutschen Demokratie herzlich<br />
schnuppe war – zumeist Söhne, auch ein paar Töchter aus besserem Hause, gut<br />
gekleidet, gut ausgebildet, mit guten Tischmanieren. Sie hatten keinen Traum von<br />
93
einer besseren Gesellschaft, sie spürten wenig Feuer und Sehnsucht nach Sinn.<br />
Aber sie waren spaßhungrig und ehrgeizig, alert, flexibel und – pragmatisch. Statt<br />
großer Ideen inspirierten sie Labels, Logos und die Ästhetik der Waren.<br />
Und so begann in den 90ern eine Ära des Achselzuckens, des Durchwustelns, der<br />
vermeintlichen „Alternativlosigkeit“. Ideale galten als uncool.<br />
Ganz persönlich gesprochen: Ich bin kein großer Held. Ich bin schon gut damit<br />
beschäftigt, ich zu bleiben. Und ich bewundere Leute, die Karriere machen und<br />
denen trotzdem gelingt, authentisch zu bleiben. Ich wusste früh, und das war meine<br />
einzige Heldentat: Dass ich dies nicht schaffe würde. Ich habe mehrfach gekündigt<br />
bei großen Zeitungen, habe die Karriere verweigert. Und irgendwann kapiert: Ich<br />
bin am besten, wenn ich genau das mache, was ich will. Was mich interessiert. Was<br />
mich bewegt.<br />
Manchmal sind es die kleinen Widersprüche, manchmal die großen Lügen und<br />
Gemeinheiten dieser Welt. Manchmal auch schöne Dinge. Und „gute“ Menschen.<br />
Lassen Sie sich nicht beirren: Alles, was man wirklich zum Thema macht, ist eine<br />
tolle Story. Beharren Sie auf Ihrem Erleben und Ihrem Instinkt. Ich hab hier mal ein<br />
paar Synonyme aus dem Wörterbuch aufgeschrieben, damit Sie sie alle im Kopf<br />
haben: „festhalten, festbleiben, nicht lockerlassen, bestehen, verlangen, nicht<br />
ablassen, fordern, dringen auf, einhalten, nicht nachgeben, pochen auf, bestehen<br />
auf, fixieren, aufrechterhalten, nicht wanken, Ansprüche erheben, beharren auf,<br />
insistieren auf, erzwingen, Bedingungen stellen, beanspruchen“.<br />
Sicher. Sie können sich coachen lassen. Oder von der Routine platt walzen lassen.<br />
Am Ende aber geht es bei der Selbstbefragung vor dem Badezimmerspiegel immer<br />
darum, was einer mit Kopf, Herz und Hand tatsächlich so treibt. Wie das irgendwie<br />
in Einklang kommt. Als Journalist gibt es nichts besseres, als etwas zu erleben und<br />
zu begreifen. Und daraus etwas ganz Eigenes zu machen. Achten Sie darauf, dass<br />
nicht all Ihr Esprit im Mahlwerk des Alltags zu Staub wird. Es ist immer ein gutes<br />
Zeichen, wenn Sie sich noch aufregen können.<br />
Um die Welt eigenständig wahrnehmen zu können, braucht man offene Sinne. Man<br />
braucht dafür auch ein Fundament an Erfahrungen. Um vergleichen zu können. Um<br />
einen Instinkt zu entwickeln, was echt ist und was falsch, eine Ahnung, was hinter der<br />
Show stecken könnte an Strategien und Interessen. Und ein eigenes Raster an Überzeugungen.<br />
Überzeugungen? Das ist, was einem wichtig und lieb und teuer ist.<br />
Neulich stand ich als Dozent in einem Seminar an der Uni Leipzig. Politikjournalismus.<br />
Es war der Montag nach jenem FDP-Parteitag, auf dem Herr Rösler zu neuen Vorsitzenden<br />
aufstieg. Am Abend vorher hatte ich wahllos aktuelle Berichte über diesen<br />
Vorgang zusammengesucht und ausgedruckt, von Bild bis Spiegel, von taz bis Ostsee-<br />
Zeitung. Ich hatte die Artikel vorher nicht gelesen. Ahnte aber wohl, dass das<br />
Ergebnis traurig ausfallen würde. Die Texte verteilte ich an die Studenten. Dann<br />
94
stellte ich mich an die Tafel und schrieb die Adjektive auf, die die Studenten mir<br />
zuriefen. So trugen wir allmählich das Bild zusammen, das die Medien zeichnen.<br />
Und staunten bald. Die „Image“-Mache hatte perfekt funktioniert. Alle schrieben<br />
das Gleiche. Niemand zog eine politische Bilanz des Herrn Rösler. Stattdessen malten<br />
man ihn als mild, sympathisch, freundlich aus, erzählte von seiner Bauchrednerpuppe,<br />
von seinen Zwillingstöchtern. Eine heißt Schnuffel. Von seinen Vorlieben für<br />
Lakritz, Udo Jürgens und McDonalds. Wir mussten lachen.<br />
Nein, das schnelle Tagesbusiness kann nicht immer tiefgründig sein. Doch auch die<br />
journalistische Alltagsarbeit sollte von der Frage getragen sein: Was geschieht hier<br />
wirklich? Wem nützt es? Welche Folgen hat das für wen?<br />
Wir reden jetzt wieder viel von Haltung. Das Wort erlebt geradezu eine Renaissance.<br />
Es ist ein irgendwie merkwürdiges Wort – mit allerlei Bedeutungen. Was verstehen<br />
Sie unter Haltung? Wir reden hier über jene Bedeutung, die etwas mit der<br />
geistigen Einstellung und der eigenen Position im Geschehen zu tun hat. Haltung als<br />
Gegensatz zur Biegsamkeit, zur Willfährigkeit, zur Kriecherei und Schleimscheißerei.<br />
Die es auch im Journalismus gibt. Karl Kraus, der stets die Fackel der Haltung hochhielt,<br />
reimte über seine Zunft:<br />
Wie unberufen bunt sie es doch treiben<br />
mit der Berufsmacht und den Gottesgaben:<br />
sie schreiben, weil sie nichts zu sagen haben,<br />
und haben was zu sagen, weil sie schreiben.<br />
Journalisten haben sich schon immer im Spannungsfeld von Stirn zeigen und<br />
Anpassung bewegt. Schon zu Zeiten, als die einen die Übel des Feudalismus<br />
anprangerten und die anderen den Herrschenden nach dem Maul redeten. Ich<br />
zitierte aus dem Werk „Der Journalist“, publiziert anno 1902 von Dr. Richard Jacobi,<br />
damals Chefredakteur des „Hannoverschen Couriers“:<br />
Aber ohne solch ein ,inneres Verhältnis‘ wird der Zeitungsmann noch weniger<br />
befriedigt und befriedigend wirken als der Angehörige eines anderen Berufs. Fehlt<br />
ihm die Liebe zu seiner Thätigkeit, zu seiner Zeitung, die Hingabe an die Grundsätze,<br />
die sie vertritt, so wird er zum Rabulisten oder zum Tagelöhner. Beides ist gleich<br />
unerfreulich für den Leser wie für den Schreiber der Zeitung. Verficht der Journalist<br />
in seiner Thätigkeit nicht seine eigene Überzeugung, so ist sein Beruf allerdings ein<br />
traurig Handwerk. Und diese Überzeugungstreue muss nicht nur für den politischen<br />
Journalisten gefordert werden, sie hat auch auf den anderen Gebieten journalistischer<br />
Arbeit reiche Gelegenheit, sich zu bewähren. Der Schmock, der von sich sagen<br />
kann und muss: ,Ich habe geschrieben links und wieder rechts, ich kann schreiben<br />
nach jeder Richtung‘, ist der erbärmlichste Typus journalistischer Entartung.<br />
95
Haltung hat für mich nichts mit Ideologie zu tun – im Sinne einer engen Weltdeutung,<br />
die von ein paar Lehrsätzen (Leersätzen) eingeschnürt ist wie von einem Korsett.<br />
Haltung bedeutet gleichwohl, ein Konzept von der Welt zu haben, das die Weltdeutung<br />
ein wenig systematisieren hilft. Haltung bedeutet zudem, nicht Handlanger<br />
irgendwelcher Mächtigen und Gönner zu sein. Nicht käuflich zu sein. Der Aufklärung<br />
zu dienen. Konsequent zu sein im Urteil auch über sich selbst.<br />
Wir waren auf meiner kleinen Zeitreise durch die Haltungsmoden und -schäden des<br />
politischen Journalismus in den 90ern angekommen, einer Ära des Achselzuckens.<br />
Ihr folgte der neoliberale Furor des neuen Jahrtausends, der „Nuller“-Jahre. Eine<br />
neopragmatische Elite verklammerte sich in der Vorstellung: Wenn wir den Sozialstaat<br />
nur kräftig eindampfen, das Leben „entstaatlichen“ und den Marktkräften<br />
ihren wunderbaren Lauf lassen, wird das Land gewiss bald wieder kerngesund. So<br />
entstand das Mantra <strong>vom</strong> „schlanken Staat”. Das Ideal Gerechtigkeit kam in<br />
Deutschland auf strengste Diät. Genauso vermeintlich gestrige Ideale wie Gleichheit<br />
und Toleranz. Stattdessen wurden der Öffentlichkeit tagtäglich hohe Dosen<br />
der neuen Kampfbegriffe verabreicht: „Liberalisierung”, „Deregulierung”, „Flexibilisierung”,<br />
„Generationengerechtigkeit” ; „Privatinitiative”, „Eigenverantwortung”<br />
und „Selbstvorsorge”. Das deutsche Konsensmodell der Sozialpartnerschaft mit<br />
seinen Sicherungsmechanismen für ein würdiges Altern, gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit,<br />
Armut erlitt einen enormen Ansehensverlust. Diese Ideologie wurde als<br />
neue „ordnungspolitische Linie“ verbrämt.<br />
Die FDP, einst Heimat für Köpfe von beachtlichem Format, nun zur wirtschafts -<br />
liberalen Ein-Punkt-Partei geschrumpft, war Speerspitze dieser Bewegung. Als<br />
Vorhut solch schlanken Geistes deklamierte sie: Freiheit! Und meinte doch meist<br />
nur Steuerbefreiung. Die Freiheit der Habenden, der „Leistungsträger”, den Losern<br />
<strong>vom</strong> Penthouse herunter auf den Kopf zu spucken.<br />
Besonders bedrückend daran: Bald jeder wackere deutsche Meinungsmacher, der<br />
einen Stift halten konnte, lieferte passende Bekenntnisprosa ab, den Abstieg der<br />
Nation prophezeiend. Nahezu alle Organe waren mit von der Partie. Auch der von<br />
mir einst so bewunderte Spiegel. Der Sozialstaat, verkündete das Montagsmagazin<br />
schon 1998, sei „zum Monstrum geworden”. „Aufgebläht” sei unser „Rundum-<br />
Sorglos-Staat”, eine „Hängematte” für Millionen Nichtsnutze mit „Vollkaskomentalität”.<br />
Eine geradezu staatsfeindliche Wutwelle schwappte aus den Medien.<br />
Angefeuert <strong>vom</strong> Altbundespräsidenten Roman Herzog, der in Zeitungsanzeigen<br />
wider das „verfettete Gemeinwesen” wetterte. „Dass der Staat so fett und dick ist<br />
wie noch nie”, beklagte zum Beispiel auch die Bild-Zeitung. Noch 2008 schimpfte<br />
Springer-Chef Mathias Döpfner im Interview mit der Zeit – ein besonders schönes<br />
Asservat – auf das „alte deutsche Modell des sozialen Konsenses, das in Wahrheit<br />
asozial ist”. „Wir bemühen uns, die Armut gerecht zu verteilen, anstatt Wohlstand<br />
für möglichst viele zu ermöglichen”, sprach Döpfner in die schon anschwellende<br />
96
Finanzkrise hinein, bekannte sich als „glühender Anhänger des amerikanischen<br />
Kapitalismus” und pries als Vorbild Länder wie Irland.<br />
Wie kann man nur so monumental daneben liegen?<br />
Es war ein Jahrzehnt des aufgeregten Nichts. Des Nachplapperns. Der haltungslosen<br />
Leere. Nicht nur hier: 2005 kam Carl Bernstein zu Besuch in Deutschland, der<br />
berühmte Watergate-Enthüller der Washington Post. Er berichtete, wie sehr die<br />
Öffentlichkeit der USA in den Jahren des George Bush gelitten hat. Dass es nicht<br />
mehr um Wahrheitssuche ginge, sondern nur noch um Tratsch, Promis und Sensationen.<br />
Das sei, sprach Bernstein, der „Triumph der Idiotenkultur“.<br />
Der Markt-Furor scheint nun dahin. Der neoliberale Singsang war unter dem<br />
Ansturm der weltwirtschaftlichen Wirklichkeit auf Dauer kaum aufrechtzuerhalten.<br />
Obwohl manch Unverdrossener das Liedlein noch immer anstimmt. Als nicht weniger<br />
beunruhigend empfinde ich die neueste Polit-Mode: die des abgeklärten Überdrusses.<br />
Gepaart mit einer zunehmend verächtlichen Haltung gegenüber der<br />
Demokratie und ihren Akteuren schlechthin.<br />
Der letzte Wahlkampf warf erneut ein ungutes Licht auf den Zustand des politischen<br />
Journalismus. Nach dem Merkel-Rausch 2005 demonstrierten viele Alpha-Journalisten<br />
nun ostentativ Langeweile, sie gähnten um die Wette. Sie vermissten beim Duell<br />
Merkel-Steinmeier die üblichen Polit-Schlachten, die der Chronist nur ein wenig<br />
nachwürzen und servieren braucht. Stattdessen hätten die Journalisten mehr Kraft<br />
zur genauen Beobachtung, zur scharfen Analyse aufbringen können. Es mangelte<br />
ja nicht an spannenden, kontroversen, alle Menschen berührenden Themen. Doch<br />
die müsste man ja, herrje, durchdringen, aufbereiten, greifbar machen, zuspitzen.<br />
Wir sind nicht alle gleich. Und wir sind nicht alle schlecht. Es gibt viele Journalisten,<br />
die ihren Beruf lieben und tolle Arbeit machen. Aber es gibt auch Moden und Zwänge<br />
in unserem Metier, und die wirken immer wieder verblüffend stark. Hinzu kommen<br />
die Tücken der Eitelkeit.<br />
Was können Journalisten überhaupt erreichen? Wenn sie 100 Parteitage und 1.000<br />
Pressekonferenzen besucht haben, fragen Sie sich: Was hat Substanz? Was ist der<br />
Kern? Was bleibt? Und: Wo ist der Stoff, der das Hirn vibrieren lässt?<br />
Sie kennen das vielleicht: Sie lesen manchmal, selten etwas und denken: Donnerwetter,<br />
das ist total interessant. Oder: Verdammt, ich habe gerade wirklich etwas<br />
kapiert. Es kann ein Gedicht sein, ein grandioser Essay. Oder nur ein Satz irgendwo,<br />
der es für Sie wirklich auf den Punkt bringt.<br />
Meist geht einem solchem Geistesblitz eine schon lange anschwellende Ahnung<br />
voraus. Man hat ein Unbehagen gegenüber einem Sujet entwickelt. Und dann sagt<br />
da einer was und es zündet im Kopf. Mit ging es diese Woche so. Es war spät. Ich<br />
saß am Computer und hatte mir ein Glas Wein eingeschenkt, browste, während ich<br />
97
Email-Berge abarbeitete, durch diverse Links und stieß auf Immanuel Wallerstein,<br />
Senior Research Scholar an der Yale University, Mitbegründer der Weltsystem-<br />
Theorie. Das klang schon mal interessant. Es war ein Video: Ein alter Zausel an<br />
einem Hotelpool in Dakar. Mit dem Mikro schlenkernd. Ein Typ, der ein bisschen an<br />
Professor Hastings erinnerte. Er sprach über die letzten 500 Jahre Kapitalismus.<br />
Über die Schuldenkrise. Und jeder Satz war das Extrakt jahrelangen Forschens und<br />
Nachdenkens. Herrlich. Sein erster lautete:<br />
Alle Systeme haben begrenze Lebenszeiten, kein System ist ewig. Das gilt ebenso<br />
für das Universum, wie auch für das kleinste subatomare System. Der Grund dafür,<br />
dass alle Systeme begrenzte Lebenszeiten haben, besteht darin, dass sie alle innere<br />
Widersprüche haben und sich mit der Zeit aus dem Gleichgewichtszustand entfernen.<br />
Bevor Sie ganz aus dem Gleichgewicht geraten, ein letzter Gedanke. Wofür macht<br />
man politischen Journalismus? Um zu vermelden, dass der stellvertretende Frak -<br />
tionsvorsitzende Müller-Meier-Schulze einen Schnupfen hat? Nein. Die Haltungsfrage<br />
für jeden von uns, nicht nur für politische Journalisten, lautet: Was machen wir<br />
aus unserem Leben? Finden wir eine Arbeit, die uns glücklich macht?<br />
Man weiß es doch eigentlich oft sofort, intuitiv: Ob da jemand vor einem steht, der<br />
an etwas glaubt. Der etwas erreichen will in dieser Welt jenseits des eigenen Vorteils.<br />
Oder glaubt es doch zu wissen.<br />
Das Minimum, die Untergrenze als Journalist läuft hier: Nicht käuflich, oder doch<br />
zumindest nicht ganz billig zu sein. Nicht für jeden Deal zu haben.<br />
Das maximal Erreichbare, denke ich, ist: einen integren, gründlich reflektierten<br />
Charakter zu entwickeln. Dabei viel Wissen um die Ambivalenz der Dinge und der<br />
Menschen anzuhäufen. Und diese gewisse Gebrochenheit zu ertragen, die jede tiefer<br />
gehende Erkenntnis mit sich bringt. Mit Witz. Mit Herz.<br />
Es ist gut, Wünsche, Träume und Ideale zu haben. Ein Anliegen. Eine Sehnsucht.<br />
Und dabei nicht zu erstarren.<br />
Also merken Sie sich bitte den Rühmkorf-Satz: „Bleib erschütterbar und widersteh.“<br />
Aktualisierte Rede von Tom Schimmeck auf der Sommerakademie der FES-Medienakademie – Juni 2011.<br />
98
Wie viel Charisma braucht die Demokratie und<br />
wie viel Charisma verträgt die Demokratie?<br />
Zum Verhältnis von Politik und Persönlichkeit<br />
Von Ulrich Sarcinelli<br />
Politische Persönlichkeiten stehen im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Kein anderer<br />
Berufsstand handelt so sehr im Scheinwerferlicht massenmedialer Dauerbeobachtung.<br />
Es ist „ständiges Handeln unter Unsicherheit“ (Wewer 2003, 363). Personalisierung<br />
ist deshalb in der Politikvermittlung wie in der Politikwahrnehmung ein<br />
probates Mittel, um Unsicherheit zu absorbieren und Orientierung zu ermöglichen.<br />
Und Personalisierung wird umso wichtiger, „je mehr Menschen sich nur nebenbei<br />
für Politik interessieren“ (Kepplinger/Maurer 2005, 183ff.; Kepplinger 1998, 180).<br />
Die wahlsoziologische Forschung kann recht gut nachweisen, dass Persönlichkeitseigenschaften<br />
wichtige Einflussgrößen für politisches Verhaltens sind. Das betrifft<br />
z. B. die Parteiidentifikation, also die dauerhafte gefühlsmäßige Bindung an Parteien.<br />
Sie wirkt wie eine Art Wahrnehmungsfilter. Sie beeinflusst die Kandidatensympathie<br />
und die Haltung zu politischen Sachfragen (vgl. Schoen/Schumann 2005; Schumann<br />
2005, 449). Dabei ist in den Sozialwissenschaften durchaus umstritten, ob Personalisierung<br />
in der Politik tatsächlich zugenommen hat oder ob es sich um ein Phänomen<br />
der Berichterstattung in den Medien handelt (vgl. z. B. Brettschneider 2002).<br />
Als unstrittig gilt jedenfalls: Personen geben der Politik ein Gesicht und erleichtern<br />
die politische Orientierung – nicht nur zu Wahlkampfzeiten. Denn Politik wird – bei<br />
aller Komplexität – immer noch von Menschen gemacht. In der Demokratie darf<br />
Verantwortung nicht anonym bleiben. Sie muss Personen zugeschrieben werden<br />
können, Amtsträgern oder gewählten Mandatsträgern. Wenn wir von Politik sprechen,<br />
99
verbinden wir damit immer auch konkrete Gesichter, wird denken an Personen, die<br />
wir für kompetent oder inkompetent, sympathisch oder auch weniger sympathisch<br />
halten. Politik und Persönlichkeit sind also aufs engste verwoben und darum soll<br />
es uns heute gehen.<br />
Zunächst einige wenige politik- und demokratiewissenschaftliche Anmerkungen. Einer<br />
der ersten, der uns – nüchtern und pragmatisch wie er nun mal war – eine systematische<br />
Check-Liste für das Verhalten von politischen Führungspersönlichkeiten an die<br />
Hand gegeben hat, war Niccolo Machiavelli. Fünf Dinge müsse ein kluger Herrscher<br />
miteinander vereinen können: virtu, also Tüchtigkeit, Klugheit, Tatkraft und Mut. Dazu<br />
gehörte für ihn die angemessene Kommunikationsweise, notfalls auch über Lug und<br />
Betrug zum Ziel zu kommen. Von Machiavelli stammt ja auch der berühmte und<br />
eigentlich heute noch gültige Satz: „Die Menschen urteilen im Allgemeinen mehr nach<br />
dem, was sie mit den Augen sehen, als nach dem, was sie mit den Händen greifen;<br />
denn (...) Jeder sieht, was Du scheinst, und nur wenige fühlen, was Du bist.“ Zweitens<br />
brauche der Herrscher „occasione“. Heute würde man sagen, er muss das Fenster der<br />
Gelegenheit nutzen, darf den richtigen Zeitpunkt, den historischen Moment für<br />
beherztes Handeln nicht verpassen. Drittens gehört natürlich noch das Quäntchen<br />
Glück dazu. Das Glück des Tüchtigen. Machiavelli spricht von fortuna (vgl. Machiavelli<br />
1990 (1513)). Der Herrscher brauche viertens „ambitione“, also Ehrgeiz, starke Willenskraft<br />
und Durchhaltevermögen. Und schließlich komme es auf die „neccesita“<br />
an, auf das Gespür für das Notwendige, für das, was entschieden und durchgesetzt<br />
werden müsse. Bei diesem Beratungskatalog in der Tradition der mittelalterlichen<br />
Fürstenspiegel hatte Niccolo Machiavelli immer die Persönlichkeit des Fürsten im<br />
Blick. Sein Handeln sollte Ausgangs- und Bezugspunkt von Politik sein. – Soweit<br />
der rund 500 Jahre alte Rat eines Renaissance-Klassikers. Er entwarf auch heute<br />
noch bedenkenswerte Klugheitsregeln für politische Führung und entfaltete als<br />
erster systematisch und nüchtern das Instrumentarium des politischen Handwerks.<br />
Die Betonung des Zusammenhangs von politischem Handeln und Persönlichkeit<br />
finden wir nicht nur bei vielen Klassikern der politischen Ideengeschichte, sondern<br />
auch bei Denkern der Gegenwart. So schreibt die Politikphilosophin Hannah Arendt:<br />
„Politik handelt von dem Zusammen- und Miteinander-Sein der Verschiedenen“.<br />
Macht könne demnach auch niemals ein einzelner haben, „weil sie immer erst aus<br />
dem Zusammenhandeln der Vielen“ entstehe. (Arendt 1993: 9 und 16). Politik ist –<br />
auch und vor allem – Handeln demokratisch verantwortlicher Männer und Frauen<br />
mit dem Ziel, das als notwendig Erkannte möglich, zustimmungsfähig und für alle<br />
verbindlich zu machen.<br />
Indem wir uns für den personellen Faktor in der Politik interessieren, fragen wir<br />
nach dem Unterschied, den Personen in der Politik und für die Politik ausmachen.<br />
100
Wir fragen, was politische Akteure zu politischen Persönlichkeiten, was sie mög -<br />
licherweise zu Figuren der Geschichte macht. – Von Heinrich von Treitzschke<br />
stammt der berühmte Satz „Männer machen Geschichte“. Mal abgesehen davon,<br />
dass die Frauen bei diesem Historiker der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
offenbar noch keine Rolle spielten: Stimmt es überhaupt, stimmt es noch, dass<br />
Persönlichkeiten Geschichte machen? Sind die Verhältnisse innerstaatlich und<br />
international inzwischen nicht zu komplex, als dass man politische Wirkung allein<br />
auf das Handeln einzelner Personen reduzieren könnte? Erlaubt unser politisches<br />
System mit seinen Anpassungszwängen, seinen parteipolitischen Rekrutierungsbedingungen<br />
und Karrierewegen heutzutage vielleicht gar nicht mehr die Ausbildung<br />
starker politischer Charaktere?<br />
Gerne wird in diesem Zusammenhang das Fehlen von ‚echten’ Charakterköpfen<br />
beklagt. Als leuchtende Beispiele kommen dann in Deutschland die immer gleichen<br />
Namen ins Spiel, von Konrad Adenauer über Ludwig Erhard bis zu Kurt Schumacher,<br />
von Herbert Wehner über Willy Brandt bis zu Franz-Josef Strauß. Und bemerkenswerterweise<br />
wird schon zu Lebzeiten inzwischen auch Helmut Schmidt genannt.<br />
Bekanntheit, Sympathie und Kompetenz werden heute mit Hilfe der Demoskopie<br />
zwar fast im Wochenrhythmus gemessen. Große Verehrung und parteiübergreifende<br />
Wertschätzung stellen sich erfahrungsgemäß allerdings erst spät ein. Man braucht<br />
Abstand. Deshalb erfolgt die Zuschreibung von historischer Größe selten schon zu<br />
Lebzeiten. Das verbindet übrigens politische Größen mit Künstlern, die oft verarmt<br />
und lange verkannt posthum dann die Galerien mit kaum mehr bezahlbaren Objekten<br />
versorgen.<br />
Nehmen wir das Beispiel Willy Brandts. Was hatte etwa Willy Brandt, was politische<br />
Akteure heute nicht haben? Dass gerade Willy Brandt immer wieder ins Spiel<br />
gebracht wird, verdient aus mehreren Gründen Interesse. Er war ja keineswegs der<br />
geborene Polit-Star, der große Parteiführer und Charismatiker von Anfang an. Lange<br />
wurde er öffentlich stigmatisiert und von politischer Seite übel – auch wegen seiner<br />
Herkunft als unehelicher Sohn aus einfachen Verhältnissen und als Reemigrant –<br />
diffamiert. Seine Partei nominierte ihn bereits auf dem SPD-Parteitag 1960 zum<br />
Kanzlerkandidaten. Aber erst sein Amt als Regierender Bürgermeister von Berlin<br />
gab ihm, dem nicht durch die Ochsentour gewanderten Parteivorsitzenden,<br />
zunächst Rückhalt. Einmal in das bundespolitische Regierungsamt gekommen,<br />
zunächst als Außenminister und dann als Kanzler, verfolgte er aber konsequent die<br />
von Egon Bahr konzipierten kühnen Entwürfe einer neuen Ost- und Deutschlandpolitik;<br />
gegen viele Widerstände. Seine Politik hat das Land zunächst tief gespalten;<br />
ganz ähnlich dem Kraftakt, den vor ihm Adenauer mit seiner Politik der Westintegration<br />
und Wiederbewaffnung vollbracht hat. Hinzu kam noch zweierlei. Brandt,<br />
der gelernte Journalist, wusste „als Virtuose der politischen Kommunikation“ (Walter<br />
2009: 121) die Nachfrage der aufkommenden modernen Mediengesellschaft zu<br />
101
edienen. Und nicht zuletzt: Er verstand sich auf die Moderation und Integration<br />
der Flügel, Gruppen und Strömungen seiner Partei in den unruhigen Nachachtundsechziger<br />
Jahren.<br />
Was sagt uns dies für den Zusammenhang von Persönlichkeit und Politik? Das<br />
Beispiel macht deutlich: Die gesellschaftliche Achtung, die besondere politische<br />
Wertschätzung oder gar historische Größe von politischen Persönlichkeiten, das<br />
ist nicht etwas, was – gleichsam genetisch – einfach vorhanden ist. Nein, die Qualität<br />
einer politischen Führungsfigur muss verdient werden, zumeist in einem langen<br />
streitigen Prozess. Hier trifft Max Webers viel zitierte Definition von Politik zu, die<br />
er als langsames Bohren von dicken Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß<br />
zugleich charakterisiert hat.<br />
Nun steht man mit dem Blick zurück immer in der Gefahr nostalgisch zu werden<br />
und sich in kulturkritischer Manier nach den angeblich besseren Zeiten zu sehnen.<br />
Statt eines vergleichenden Rückblicks werde ich auf einige systematische Punkte<br />
aufmerksam machen, die wir bei der Beschäftigung mit dem Persönlichkeitsfaktor<br />
in der Politik berücksichtigen müssen. Da ist zunächst der Zusammenhang von Amt<br />
und Person oder neutraler gesprochen, die Verbindung von Akteur und Institution.<br />
Politische Akteure operieren ja nicht im keimfreien Labor, sondern in einem komplizierten<br />
Umfeld mit vielfältigen gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen und<br />
institutionellen Bindungen und Verflechtungen. Sie haben ein Amt oder ein Mandat<br />
und handeln in Ausübung ihres Amtes. Dabei prägt das Amt die Person. Die Person<br />
kann aber auch das Amt in ganz unterschiedlicher Weise ausfüllen.<br />
Wie in keiner anderen Funktion wird der personelle Faktor beim höchsten Staatsamt<br />
in unserer <strong>Republik</strong> erkennbar. Denn der Bundespräsident verfügt über keine<br />
harten Kompetenzen und nur über einige wenige politische Reservefunktionen. Er<br />
ist eine Art Wahlmonarch mit überwiegend repräsentativen Aufgaben. Die Väter<br />
und Mütter des Grundgesetzes haben ihn aufgrund der Erfahrungen mit den verhängnisvollen<br />
Kompetenzen des Weimarer Reichspräsidenten politisch auf Diät<br />
gesetzt. Umso mehr kommt es in diesem Amt auf Persönlichkeitseigenschaften an:<br />
auf seine Glaubwürdigkeit, auf seine persönliche Integrität und nicht zuletzt auf die<br />
Fähigkeit mit Worten zu überzeugen. Weil er nichts zu sagen habe, müsse er reden,<br />
so hat Roman Herzog einmal treffend den Zusammenhang von Bundespräsidentenamt<br />
und Person charakterisiert. Bei diesem Amt hängt alles an der Persönlichkeit<br />
des Amtsträgers. Man braucht nur an so unterschiedliche Politikertypen wie Theodor<br />
Heuss, Gustav Heinemann, Walter Scheel oder Richard von Weizsäcker zu erinnern,<br />
um deutlich zu machen, wie dieses Amt bei allen Charakterdifferenzen mit jeweils<br />
eigenem Stil erfolgreich ausgeübt werden kann. Immer hat die Person das Amt in<br />
spezifischer Weise geprägt.<br />
102
Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, dass das Amt die Person prägt. Das wird<br />
in einem Satz des ehemaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer deutlich.<br />
Im Rückblick auf seine politische Biographie und die persönlichen Herausforderungen<br />
im und mit dem Außenministerium sagte der Vollblutpolitiker mit reichlich außerparlamentarischer<br />
Erfahrung: „Die Verwandlung des Amtes durch den Menschen<br />
dauert etwas länger als die Verwandlung des Menschen durch das Amt.“ (Fischer,<br />
zit. nach Leinemann 2004: 361) Fischer hat wohl ziemlich lange gebraucht, dem hochprofessionellen<br />
Apparat des Auswärtigen Amtes seinen Stempel aufzudrücken.<br />
Angesichts der wachsenden Verflechtungen und Abhängigkeiten in der Politik –<br />
und zwar national wie international – stellt sich die Frage nach den persönlichen<br />
Handlungsspielräumen politischer Akteure In der Forschung besteht Konsens: Für<br />
politische Persönlichkeiten entfalten Institutionen eine „handlungsermöglichende<br />
und zugleich handlungsbeschränkende Wirkung“ (Kaiser 2001: 255). Institutionen<br />
determinieren nicht politisches Handeln. Vielmehr bieten sie einen „Handlungskorridor“<br />
(Mayntz/Scharpf 1995: 52), der ganz unterschiedlich ausgefüllt werden<br />
kann. Mit Institutionen sind mehr oder weniger bestimmte Handlungslogiken verbunden,<br />
also Verpflichtungen, ein bestimmtes Amtsverständnis oder spezifische<br />
Rollenerwartungen. So ist das herausgehobene und verfassungsrechtlich mit der<br />
Richtlinienkompetenz ausgestattete Amt der Bundeskanzlerin institutionell zwar<br />
vorgegeben und im Grundgesetz ganz schlank beschrieben. Ob das Amt dann aber<br />
eher in moderierendem Präsidialstil oder mit starken politischen Vorgaben, eher<br />
diskret oder besonders auf kalkulierte Medienpräsenz hin wahrgenommen wird,<br />
dies hängt dann vor allem von der Persönlichkeit der Amtsträgerin oder des Amtsträgers<br />
ab. Kein Zweifel, dass dabei auch biographische Prägungen eine Rolle spielen.<br />
So mancher Gestus und so mancher politische Kraftakt des vormaligen Bundeskanzlers<br />
Schröder ist – auch – damit zu erklären, dass er sich aus einfachsten<br />
Verhältnissen hat durchkämpfen müsse. Zwar Meister medialer Selbstdarstellung<br />
war ihm die mühsame innerparteiliche und parlamentarische Kommunikation und<br />
Überzeugungsarbeit doch eher fremd. Stattdessen pflegte er einen Regierungsstil,<br />
der mit zunehmender Amtsdauer durch Basta-Politik und politische Kraftmeierei<br />
letztlich den Autoritätsverlust beschleunigt hat.<br />
Ganz anders Angela Merkel. Ihr zurückgenommener und gestenarmer Präsidialstil<br />
hat etwas zu tun haben mit ihrer DDR-Sozialisation. Hier war Vorsicht eine Überlebensfrage.<br />
Prägend für ihr politisches Verhalten dürfte auch ihre Ausbildung als<br />
promovierte Physikerin sein. Tatsächlich verhält sie sich ja nicht selten so, als sei<br />
Politik eine sozialphysikalische Versuchsanordnung, als gehe es um die diskrete<br />
Kontrolle von Reiz-Reaktionsmechanismen und unspektakuläre Lösungsansätzen.<br />
Unauffälligkeit als politisches Erfolgsprinzip, das ist ein unverkennbares Persönlichkeitsmerkmal<br />
der Kanzlerin.<br />
103
Freilich macht es einen großen Unterschied, auf welcher politischen Bühne man<br />
sich bewegt, auf der medienöffentlichen Vorderbühne oder auf der weniger öffentlichen<br />
und diskreten politischen Hinterbühne, auf dem Feld der Darstellungspolitik<br />
oder auf dem Feld der Entscheidungspolitik. Beide Handlungsfelder wollen<br />
bespielt werden und zwar mit unterschiedlichen Rollen, Kompetenzen und Legitimationsmustern.<br />
In der Darstellungspolitik, da gelten die Regeln der Mediendemokratie.<br />
Hier ist die „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ (Frank 1998) Gesetz. Ohne die Fähigkeit<br />
zum regelmäßigen publizitätsträchtigen Auftritt, ohne die Rituale des „öffentlichen<br />
Rechthabens“ (Schelsky 1983: 69) sind Sichtbarkeit, Bekanntheit, Sympathie<br />
und in der Folge auch Zustimmungserwerb nicht zu haben. Dies alles ist zwar<br />
keine Garantie für nachhaltigen politischen Erfolg. Es sind aber Voraussetzungen für<br />
Medienpräsenz. Und Medienpräsenz ist in der Mediendemokratie eine entscheidende<br />
Machtprämie.<br />
Politische Führungskompetenz erschöpft sich jedoch nicht in Medienpräsenz. Sie<br />
muss sich nicht nur auf den Bühnen der „Mediendemokratie“, sondern auch in den<br />
Räumen der Verhandlungsdemokratie bewähren. Mit „Verhandlungsdemokratie“<br />
werden hochgradig arbeitsteilige Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse<br />
umschrieben. Hier sind Aushandlung und Kompromissbildung oft nur deshalb<br />
möglich, weil diese nicht im Scheinwerferlicht der Medien, sondern eher vertraulich,<br />
diskret, sachorientiert und nicht selten informell ablaufen. Lassen Sie mich ein Zwischenfazit<br />
ziehen. Auf der Suche nach den Wechselbeziehungen zwischen Persönlichkeit<br />
und Politik haben wir als erstes feststellen können, dass es sich hier nicht<br />
um ein neues Phänomen, um ein Phänomen unserer modernen Mediengesellschaft<br />
handelt. Vielmehr gab es diesen engen Zusammenhang seitdem sich Politik<br />
historisch als eine Sphäre herauskristallisiert hat, bei der sich Menschen um die<br />
verbindliche Regelung kollektiver Angelegenheiten bemühen. Das ist ein Thema<br />
der politischen Ideengeschichte und der Klassiker politische Theorie von der Antike<br />
bis in die Gegenwart hinein. Wir haben zweitens den wechselseitigen Einfluss<br />
zwischen Person und Amt, zwischen Akteur und Institution mit dem Ergebnis<br />
herausgearbeitet, dass Ämter, dass Institutionen das Handeln von Personen nicht<br />
determinieren; dass sie vielmehr einen Handlungskorridor vorgeben. Ämter prägen<br />
jedoch auch Stil und Verhalten von Amtsträgern. Schließlich haben wir drittens<br />
deutlich machen können, dass die personellen Anforderungen auf der Medienbühne,<br />
also im Rahmen der Darstellungspolitik, ganz andere sind als die Kompetenzen,<br />
mit denen man sich im Felde der Entscheidungspolitik bewähren muss. Hier Kommunikationskompetenz<br />
in Verbindung mit Medienpräsenz, dort Fach- und Sachkompetenz<br />
gepaart mit Überzeugungskraft und Durchsetzungsfähigkeit.<br />
Was bedeutet dies alles für die eingangs gestellte Frage nach der Bedeutung von<br />
Charisma in der Politik. Wie viel Charisma braucht und wie viel Charisma verträgt<br />
die Demokratie? Gemeinhin assoziiert man mit Charisma etwas, was sich schwer<br />
104
messen und am ehesten noch mit einem Begriff wie persönliche Ausstrahlung<br />
umschreiben lässt. Einem Politstar wie dem derzeitigen Verteidigungsminister zu<br />
Guttenberg wird man so etwas ohne weiteres zubilligen. Kurz im Amt – zunächst<br />
als Wirtschafts- und dann als Verteidigungsminister, ausgestattet mit jugendlichem<br />
Habitus, tadellosem Outfit und mit rhetorisch gekonnten Statements dauerpräsent<br />
in den Medien hat er es schnell an die Spitze der Bekanntheits- und Beliebtheitsskala<br />
geschafft. Gleiches kann man von vielen anderen Spitzenakteuren nicht<br />
sagen. Sie mögen gute Arbeit machen und sich auch allgemeiner Wertschätzung<br />
erfreuen, Charismatiker müssen sie deshalb noch lange nicht sein.<br />
Was also macht eine charismatische Politikerin, einen charismatischen Politiker<br />
aus? Ist Charisma generell gut, ist Charisma überhaupt wünschenswert in der Politik,<br />
wünschenswert für die Demokratie? – Zum ersten Mal systematisch entfaltet hat<br />
Max Weber den Charisma-Aspekt in seinen Untersuchungen zu den gesellschaftlichen<br />
Grundlagen von Herrschaft. Herrschaft war für Weber eine Sonderform sozialer<br />
Beziehungen. In seiner Herrschaftssoziologie unterschied er idealtypisch zwischen<br />
traditionaler, legaler und charismatischer Herrschaft. Der personelle Faktor spielt<br />
dabei jeweils eine unterschiedliche Rolle. Charismatischen Charakter gewinne<br />
Herrschaft, wenn sie auf der außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit oder Heldenkraft<br />
oder Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offenbarten oder geschaffenen<br />
Ordnungen ruhe. Im Blick hatte der Klassiker der modernen Soziologie vor<br />
rund 100 Jahren den direkt gewählten, von Parteien, Parlament und Bürokratie<br />
weitgehend unabhängigen Reichspräsidenten (vgl. Weber 1988: 498ff.).<br />
Nun befinden wir uns mit Weber im Nach-Wilhelminischen Deutschland. Hier entwickelte<br />
er seine Herrschaftssoziologie nicht aus den Grundpostulaten der Selbstbestimmung<br />
des Einzelnen und der Volkssouveränität. Vielmehr sah er die Hervorbringung<br />
großer politischer Führerpersönlichkeiten als die zentrale Aufgabe der<br />
jungen <strong>Republik</strong>. Das war für ihn die wichtigste Legitimationsquelle der neuen<br />
parlamentarischen Demokratie (vgl. Mommsen 1989: 526). Vom Plädoyer für die<br />
plebiszitäre Führerauswahl versprach er sich die Überwindung von Parteibürokratie<br />
und Berufspolitikertum (vgl. Schluchter 1985: 101f.). Statt „ohnmächtige(r)<br />
Preisgabe an Klüngel“ die „Unterordnung unter selbstgewählte Führer“ (Weber<br />
1988: 501). Soweit Max Weber.<br />
Der Appell an das Charisma des „selbstgewählte(n) Vertrauensmann(s) der Massen“<br />
(ebenda: 499) erschien dem Nestor der Soziologie als der einzige Weg, um in<br />
„modernen bürokratischen Gesellschaften eine dynamische politische Ordnung<br />
und damit zugleich politische Freiheit ... aufrechtzuerhalten“ (Mommsen 1989: 527).<br />
Erst in der Kombination von charismatischer Führung und bürokratischer Abstützung<br />
politischer Herrschaft versprach er sich eine für die Industriegesellschaft<br />
„weitsichtige, zu Innovationen befähigte Politik und damit indirekt eine Erhöhung<br />
105
der gesellschaftlichen Dynamik“ (ebenda: 529). Statt einer „führerlosen Demokratie“<br />
aus Berufspolitikern ohne Mandat plädierte er für eine „Führerdemokratie“ mit<br />
einem direkt legitimierten, charismatischen Politiker (vgl. Weber 1988: 320ff.).<br />
Nun müssen wir uns mit dem Führerbegriff nicht weiter aufhalten. Der ist politisch<br />
verbrannt. Die Geschichte des Nationalsozialismus konnte Weber noch nicht kennen.<br />
Das abschreckende Beispiel der NS- Herrschaft zeigt jedoch, dass Charisma für<br />
sich genommen noch keinen guten Politiker ausmacht; dass Charisma Fähigkeiten<br />
zur politischen Verführung ebenso beinhaltet wie zur politischen Führung. Bei<br />
„charismatisch“ geht es um ein Herrschaftsverständnis des Außeralltäglichen.<br />
Weber spricht von einer außeralltäglichen Gnadengabe. Deshalb lässt sich Charisma<br />
auch nicht auf Dauer stellen. Sie hat etwas Mobilisierendes, bricht Konventionen,<br />
löst Versäulungen auf. „Charismatiker sind Aktivierer“ (Walter 2009: 11), die sich<br />
abnutzen und verbrauchen. Zum soliden politischen Alltagsgeschäft taugen sie<br />
nicht, schon gar nicht in einer funktionierenden Demokratie.<br />
Was lernen wir aus diesem kurzen Exkurs zu Max Webers Herrschaftssoziologie:<br />
Charismatiker mobilisieren und emotionalisieren. Ihre Legitimationsbasis ist die<br />
Öffentlichkeit. Für komplexe Verhandlungsdemokratien mit zahlreichen Vetospielern<br />
taugen sie eher nicht. Der Charismatiker kann Dinge in Bewegung setzen, bisweilen<br />
auch mal den gordischen Knoten durchschlagen. Effiziente Problemlösung<br />
kann er oder kann sie jedoch nicht ersetzen. Das heißt dann auch: Wir brauchen<br />
Personalisierung zu unserer Orientierung. „Charismatiker in Permanenz“ können<br />
moderne Demokratien jedoch nicht verkraften, weil sie „keine ordentlichen Handwerker<br />
der Politik sind“ (Walter 2009: 12). Also – ein wenig Charisma ist sicherlich nicht<br />
demokratieschädlich: „Zu viel Charisma ist (aber) gar nicht gut“ (Perger 2009)!<br />
Mit 10 Thesen möchte ich unsere Überlegungen zum Verhältnis von Politik und<br />
Persönlichkeit abschließen:<br />
1 Personalisierung ist ein unverzichtbares Element der Legitimation von Herrschaft.<br />
Dabei verträgt die Demokratie auch ‚einen Schuss’ Charisma. Das hilft<br />
die Komplexität politischer Sachverhalte zu reduzieren und erlaubt die personale<br />
Zuordnung von Verantwortung.<br />
2 Sympathie, Vertrauen, Charisma – auch Images – sind in der Politik keine<br />
angeborenen Eigenschaften. Es sind soziale Zuschreibungen, die das Bild von<br />
Akteuren aufgrund ihres oft langjährigen Handelns bestimmen.<br />
3 In dem Faktor Persönlichkeit verbinden sich individuelle Charaktereigenschaften<br />
mit einem langjährigen politischen Ausleseprozess. Dazu gehören frühe biographische<br />
Erfahrungen und Anpassungsfähigkeit ebenso wie Profilierung<br />
und nicht zuletzt die Fähigkeit zur Machtbehauptung. Nicht selten sind es auch<br />
politische Narben und biographische Brüche – etwa durch zeitweise Nieder -<br />
106
lagen – welche Führungsfiguren zu echten politischen Persönlichkeit machen.<br />
4 Images können ‚gemacht’ werden. Dafür gibt es inzwischen eine ganze Beratungsindustrie.<br />
Aber der Persönlichkeitsfaktor in der Politik ist kein reines<br />
Kunstprodukt. Bei Politikerinnen und Politikern haben wir es zumeist mit lange<br />
eingeführten ‚Markenprodukten’ zu tun. Versuche, Persönlichkeitsprofile sozialtechnologisch<br />
zu modellieren, das funktioniert auf Dauer nicht. – Denn, und<br />
das ist ein fünfter Punkt:<br />
5 Politik ist kein Experimentalgeschehen im Labor. Politisch handeln bedeutet<br />
immer handeln in bestimmten institutionellen Kontexten. Institutionen determinieren<br />
das Handeln nicht. Aber – sie geben politischen Persönlichkeiten<br />
einen „Handlungskorridor“ (Mayntz/Scharpf) vor. Die persönliche Stärke bemisst<br />
sich danach, ob der Handlungskorridor des Amts oder Mandats gestaltend<br />
ausgeschöpft und neue Handlungsspielräume geschaffen werden.<br />
6 Personen prägen das Amt, das sie übernehmen. Umgekehrt prägt das Amt die<br />
Person. Amtsverantwortung und Demokratieprinzip, Gemeinwohlorientierter<br />
Interessenausgleich als Amts- und Mandatsträger auf der einen, Parteiorientierung,<br />
Interessenpluralismus und einseitige Interessenverfolgung – beides<br />
sind notwendige und legitime Bestandteile demokratischer Ordnung, die<br />
jeweils unterschiedliche Rollen abverlangen.<br />
7 Für die Wahrnehmung von Politik ist der Persönlichkeitsfaktor ein wichtiges<br />
Element, um die Informationskosten zu reduzieren. Köpfe sind eindrücklicher<br />
als komplizierte Sachverhalte. Vor allem im Kontext von Wahlen ist deshalb<br />
Personalisierung unverzichtbar für Politikdarstellung und Politikwahrnehmung.<br />
8 Dauerhafte Bindungen an politisch-weltanschauliche Großgruppen werden brüchiger<br />
und die Orientierung an kurzfristigen Faktoren gewinnen an Bedeutung. Der<br />
personelle Faktor ist deshalb eine zunehmend wichtige Orientierungsgrundlage.<br />
9 Die moderne Mediengesellschaft verändert auch das politische Personal. Die<br />
Unterscheidung zwischen politischer „Elite“ und politischer „Medienprominenz“<br />
wird undeutlicher. Dass Politik zu einem reinen Starsystem wird, scheint –<br />
zumindest in der parlamentarischen Demokratie – zweifelhaft. Nach wie vor<br />
wird der politische Führungsnachwuchs über die ‚Ochsentour’ innerparteilicher<br />
Auslese und Karrierestationen rekrutiert. – Nicht unbedingt der attraktivste<br />
Weg, um fähige Persönlichkeiten in politische Verantwortung zu bringen;<br />
andererseits aber auch eine Erschwernis für den Durchmarsch von windigen<br />
Figuren. – Ein zehnter und letzter Punkt:<br />
10 Auch Politikerinnen und Politiker sind Teil der sich wandelnden modernen<br />
Gesellschaft. Wo aber die Verankerung in einer verbindlichen Werteordnung<br />
und wo Lebenserfahrung und berufliche Absicherung, kurz: wo dem politischen<br />
Spitzenpersonal das innere Geländer fehlt, ist die Neigung groß, sich an<br />
den stimmungsdemokratischen Schwankungen des Medien- und Meinungsmarktes<br />
zu orientieren.<br />
107
Abschließend noch einmal die Frage „Wie viel Charisma braucht die Demokratie?“<br />
oder Welche Persönlichkeiten braucht die Demokratie? Zunächst braucht sie mündige<br />
Bürger, die sich in der Politik auch, aber nicht nur an Persönlichkeiten orientieren;<br />
Bürger, die charismatische Führungspersönlichkeiten von charismatischen Verführern<br />
zu unterscheiden wissen. Dann aber ist die Demokratie auf Eliten angewiesen, „die<br />
nicht auf den Augenblicksnutzen setzen, sondern Interdependenzbewusstsein und<br />
Folgenbewusstsein, kurz: Eine stärkere Langfristorientierung entwickeln“ (Grimm<br />
1999: 54). Über den Unterhaltungswert unseres politischen Spitzenpersonals mag<br />
man streiten. Und ein wenig Emotionalität und persönliche Zuspitzung dürfte einer<br />
lebendigen Streitkultur durchaus förderlich sein. Letztlich aber braucht die Demokratie<br />
nicht so sehr politische Unterhaltungskünstler. Gebraucht wird vielmehr<br />
gemeinwohldienliches Führungspersonal, das sich nicht nur auf die Legitimation<br />
des Augenblicks konzentriert, sondern mit Mut und Verantwortung der Zukunft<br />
eines freiheitlichen Gemeinwesens verpflichtet weiß.<br />
Prof. Dr. Ulrich Sarcinelli ist Vize-Präsident der Universität Koblenz-Landau.<br />
„Wichtig ist, dass nun<br />
nicht alles kriminalisiert<br />
wird, was jene Jour na -<br />
listen tun, die unter<br />
Recherche nicht nur<br />
den Besuch von Presse -<br />
konferenzen verstehen“<br />
„Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann warnt vor falschen Schlüssen aus<br />
der Abhöraffäre britischer Boulevardmedien. „Handelsblatt“, S. 25<br />
108
Die Symbiose der politischen und<br />
medialen Klasse in Deutschland<br />
Ein unkontrollierter Lobbyismus besiedelt das Parlament<br />
Von Thomas Leif<br />
Derzeit gibt es 2177 (Stand: 12.3.2010) in Berlin beim Bundestag eingetragene Lobbyorganisationen<br />
mit mehr als 5000 Ausweisen, die ihnen den freien Zugang im Bundestag<br />
ermöglichen. Damit übersteigt die Zahl der akkreditierten Lobbyisten bei weitem<br />
die Zahl der Medienvertreter. Diese Daten spiegeln das Dunkelfeld, über das nur<br />
selten nachgedacht oder berichtet wird. Über die Anatomie des Lobbyismus in<br />
Deutschland ist wenig bekannt; Wissenschaft und Medien kapitulieren weitgehend<br />
vor der Komplexität und der professionellen Spurenvernichtung des Schweigekartells.<br />
Zugestanden werden muss jedoch, dass Recherchen im Feld der Lobby schwieriger<br />
sind als in der Sphäre der Geheimdienste.<br />
Was viele Abgeordnete gelegentlich hinter vorgehaltener Hand zugeben, verschweigt<br />
die zunehmend mächtigere und selbstbewusster auftretende Lobby. „Unsere<br />
Arbeit ist prinzipiell nicht öffentlichkeitsfähig“, bekennt ein führender Lobbyist des<br />
Chemie-Riesen Altana. Ein anderer Lobbyismus-Profi, Peter Köppl sagt frank und<br />
frei: „Lobbying ist <strong>vom</strong> Grundgedanken her ‘non-public’.“ (Köppl, 2003 : 107)<br />
Weil Lobbyisten grundsätzlich nicht und nur in sehr seltenen Ausnahmen über ihre<br />
Arbeit sprechen und auch Politiker einen realistischen Einblick in den parlamentarischen<br />
Maschinenraum verweigern, entsteht in den Öffentlichkeit eine merkwürdige<br />
Melange aus gleichzeitig festzustellender Übertreibung und Untertreibung<br />
des Lobby-Einflusses.<br />
Die ehrliche Begründung für die Demokratie-Gefahr des Lobbyismus hat Umweltminister<br />
Norbert Röttgen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Bundesumwelt-<br />
109
ministeriums präsentiert. Man habe den Ausstiegsbeschluss aus der Atomenergie<br />
so rasch vollzogen, damit die AKW-Lobby keine Zeit zur Intervention hatte, verriet<br />
er in einer leider wenig beachteten Phönix-Übertragung.<br />
Eine interessante Fußnote zu dieser Geschichte: bei der Unterzeichnung der Laufzeitverlängerung<br />
von AKW`s war der zuständige Reaktor-Minister nicht anwesend.<br />
Die Verträge wurden von Bevollmächtigten der großen Stromanbieter gegengezeichnet.<br />
Die gebetsmühlenartigen Mahnungen von Bundestagspräsident Norbert Lammert<br />
vor dem parlamentszersetzenden Lobby-Einfluß gegenüber der Bundesregierung<br />
oder die Lobby-Warnungen des früheren Präsidenten des Bundesverfassungs -<br />
gerichts Papier, stützen die Annahme, dass die Problemwahrnehmung gegenüber<br />
der „Stillen Macht“ und „Fünften Gewalt“ zugenommen hat. Das heisst: die Macht<br />
der Lobby wird von führenden Politikern nicht (mehr) ausgeblendet.<br />
Verzicht auf Öffentlichkeit verstößt gegen Grundprinzipien des Parlamentarismus<br />
Die heikelste Regelverletzung der Lobby-Organisationen in der parlamentarischen<br />
Praxis besteht in ihrer lautlosen Penetration des Gesetzgebungsprozesses. Und<br />
dies obwohl Öffentlichkeit für die parlamentarische Demokratie schlichtweg konstituierend<br />
ist. Es gehört zur DNA des Lobbyismus quasi klandestin und in wichtigen<br />
Fragen de facto konspirativ – also im geheimdienstlichen Stil – zu arbeiten. Offiziell<br />
wird das mit der gebotenen Vertraulichkeit begründet, tatsächlich geht es um die<br />
Wahrung des Grundsatzes: Macht ist die Schaffung von Ungewissheitszonen.<br />
Zu dieser Schweige-Mechanik gehört die gelegentliche Vermittlung von bestellten<br />
Botschaften, Teilinformationen, frisierten Statistiken und interessengeleiteten Studien,<br />
einer gepflegten Dementi-Kultur, die Nutzung gekaufter Information sowie die Platzierung<br />
von Desinformation. (vgl. PRGS Studie zur Durchsetzung der Atomenergie)<br />
Damit verstoßen Lobbyvertreter gegen wesentliche Grundanforderungen des demokratischen<br />
Prozesses und die offene Interessenartikulation im parlamentarischen<br />
Aushandlungsprozeß.<br />
Indem sich der Lobbyismus als Teil des parlamentarischen Prozesses von der<br />
Öffentlichkeit und damit von der öffentlichen Kontrolle absetzt, verstossen Lobbyisten<br />
gegen ein grundlegendes demokratisches Prinzip und verwirken damit das<br />
Recht, sich auf pluralistische Beteiligungsrechte zu beziehen. Denn Pluralismus<br />
kann nur funktionieren, wenn deren Akteure öffentlich agieren und sich an die gültigen<br />
Regeln des pluralistischen Diskurses halten.<br />
110
Woraus speist sich die historisch gewachsene Macht der Lobby?<br />
Fünf typische Argumentations-Muster prägen die Auseinandersetzungen um Konfliktthemen<br />
und Interessenpolitik:<br />
• der Drohung mit Arbeitsplatzverlusten oder Verlagerung von Jobs ins Ausland.<br />
• Reduzierung der Forschung oder Verlagerung von Forschung und Entwicklung<br />
ins Ausland mit den entsprechenden Nachteilen im internationalen Wettbewerb.<br />
• der Drohung mit öffentlichen Kampagnen, besonders vor wichtigen (Wahl)<br />
Terminen mit kostspieligen Anzeigen, Konferenzen und Aktionen.<br />
• der Drohung, mit den schonungslosen Mitteln des negative campaignings,<br />
Marketings etc. auch persönlich gegen führende Akteure zu reagieren.<br />
• Die Drohung mit rechtlichen Auseinanderseztungen und Anrufung aller<br />
Gerichts-Instanzen.<br />
Für diese Drohungen bieten manche Medien als Transporteure eine willkommene<br />
Plattform. Dies funktioniert vor allem durch die Belieferung mit (frisierten) Studien,<br />
Statistiken, footage, Materialien, Hintergrundgesprächen, auch exclusiven Material<br />
aus Ministerien und Behörden.<br />
Die Lobby-Organisationen verfügen über genügend Ressourcen die in Folge eines<br />
rigiden Sparkurses ressourcenknappen Medien zu versorgen. Dazu gehört auch<br />
die Bereitstellung von Texten, die zur Veröffentlichung nur noch konfektioniert oder<br />
leicht redigiert werden müssen.<br />
„In der Öffentlichkeit wird die Wahrheit unterdrückt.“ Das ist nicht die Protest -<br />
parole von attac-Demonstrationen, sondern die politische Bilanz des Finanzexperten<br />
und CDU-Kandidaten für das Amt des Finanzministers im Bundestagswahlkampf<br />
2005, Paul Kirchoff. Wenn ein früherer, konservativer Verfassungsrichter in<br />
dieser Schärfe und Klarheit den Status der für eine vitale Demokratie zentralen<br />
Leitwerts beschreibt, sollten nicht nur Grundwerte-Kommissionen und Bildungsbürger<br />
genau hinhören.<br />
Denn das schonungslose Testat über den Patient „Demokratie“ und der Beitrag<br />
des seit Jahren florierenden Lobbyismus wird ebenfalls „unterdrückt“.<br />
Lobbyisten profitieren von Medien-Defiziten<br />
Frank A. Meyer hat vor fast einem Jahr den altmodischen, aber längst nicht überholten<br />
Leitbegriff der „Aufklärung“ ins Spiel gebracht. Künftig müsse das Handwerk „das<br />
Ringen um das Wort, um die Sprache, um die Geschichte, um die Reportage, um das<br />
Interview, um die Reportage, um den Kommentar, um den Essay“ wieder stärker<br />
gepflegt werden. „Kämpfer müssen wir sein, leidenschaftliche, für unseren Journalismus.“<br />
(SZ 3.5.2010) Ein ziemlich visionärer Appell in einer Zeit, in der immer<br />
mehr Medienmacher von gefilterter Luft aus Fremdquellen leben und sich der Beruf<br />
immer rasanter zu einer Tätigkeit entwickelt. Ein fragwürdiger Alarmismus, ein von<br />
111
Fachkompetenz abgelöster Herdentrieb und eine Agenturabhängigkeit stimulieren<br />
das ADSyndrom, von dem der Journalismus besiedelt ist. Das Spannungsverhältnis<br />
von Handwerk und Tätigkeit, von Aufklären und Abschreiben, von Eigenständigkeit<br />
und Fremdbestimmung, von Tiefenbohrungen und Textbearbeitung prägt zunehmend<br />
das journalistische Angebot.<br />
Welche Folgen die von vielen Bürgerinnen und Bürgern daraus folgende beklagte<br />
örtliche Betäubung für die demokratische Willensbildung langfristig hat, ist derzeit<br />
kaum kein Thema der öffentlichen Debatte.<br />
In Zeiten zunehmender, auch von manchen Journalisten geschürter „Politikverachtung“,<br />
haben viele Medien ihren inneren Kompaß verloren, ihre publizistische Kernaufgabe<br />
der Kritik und Kontrolle, der Erklärung und Interpretation von politischen<br />
Zusammenhängen aufgegeben. Nicht erst die demokratiegefährdende Finanzmarktkrise<br />
ist ein Beleg dafür, dass viele Medien ihren Kontrollauftrag gegenüber<br />
Wirtschaft und Politik nicht ausreichend erfüllt haben.<br />
Kein Zweifel: In Deutschland gibt es quantitativ ein Überangebot an journalistischer<br />
Produktion in der Breite, dass in zunehmenden Tempo und atemberaubender Kürze<br />
„mehr <strong>vom</strong> selben“ produziert und selbst in der harten Nachricht noch den<br />
unterhaltsamen k(l)ick sucht. In den Nischen und Randzonen nistet sich erstklassiger<br />
Journalismus ein, der aber nur noch von Minderheiten wahrgenommen wird.<br />
40 Prozent der Deutschen geben an, dass sie die Vielzahl der Medien-Angebote in<br />
Zeitungen, Fernsehen, Hörfunk und Online verwirren. Die Orientierung über das<br />
wirklich Wichtige – so jüngste Allensbach-Befunde wird immer mehr Mediennutzern<br />
erschwert. Auf diesem Medien-Humus kann sich die publizistische Lobby-<br />
Arbeit fruchtbar entfalten.<br />
Bestellte Wahrheiten – die Medien sind erste Adresse der Lobby,<br />
viele Journalisten Teil ihres Informations-Kreislaufs<br />
Wie funktioniert dieser Mechanismus?<br />
Es gibt Schlüsseldokumente, die belastbar und sehr instruktiv sind. Dokumente, die<br />
das wahre Gesicht einer Branche zeigen, die sich gerne diskret und seriös gibt, mit der<br />
Aura nüchterner Argumente und überprüfbarer Fakten schmückt. Es geht um die<br />
Atomenergie-Lobby, die mit der 109-seitigen Studie „Kommunikationskonzept Kernenergie<br />
– Strategie, Argumente und Maßnahmen“ der Öffentlichkeit eine einmalige<br />
Blaupause ihrer bislang verborgenen Praxis und ihrer wahren Identität geliefert hat.<br />
Wer den lange geheim gehaltenen DNA-Code der Energie-Lobby entziffern und die<br />
Manipulationstechniken dieser Branche verstehen will, ist nicht mehr auf Sekundärinformationen<br />
angewiesen. Diesen Kollateralnutzen hat die Berliner „Unternehmens-<br />
112
eratung für Politik- & Krisenmanagement“ (PRGS) mit ihrer „Studie“ der Öffentlichkeit<br />
beschert.<br />
„Gespräche wurden durchgeführt u. a. mit Journalisten der Frankfurter Allgemeinen<br />
Zeitung, des Handelsblattes, der Wirtschaftswoche und der Welt.“ Schreiben die<br />
Autoren der ungewöhnlich detaillierten Geheim-Studie. „Selbstverständlich wurden<br />
diese Gespräche ohne Nennung (des Auftraggebers) oder des Auftrags geführt.“<br />
Offenbar auch mit Hilfe dieser Quellen wurden 16 Redakteure der zentralen Leitmedien<br />
politisch genau taxiert und auf der `links-rechts-Achse´ eingeordnet. „Lediglich<br />
die Welt nimmt mit Daniel Wetzel als schwarz-grünem Redakteur eine vermittelnde<br />
Position zwischen den Lagern wahr,“ heisst es anerkennend. Warum der Aufwand?<br />
Diese einfache Frage wird von den Lobby-Experten später in entwaffnender Offenheit<br />
beschrieben: „Grundlage des Lobbyings ist fundiertes Material. Politiker<br />
bevorzugen wie Journalisten quellenbasiertes Informationsmaterial, das die Neutralität<br />
der Information suggeriert.“ Die Betonung liegt auf Suggestion, auf den Schein<br />
der Seriösität, die Anmutung von Wahrheit. In der Studie wird das gesamte Spektrum<br />
des modernen Lobbyings und der auf Manipulation gegründeten Kooperation mit<br />
den Medien ausbuchstabiert: gekaufte und frisierte Studien mit wissenschaftlichen<br />
Antlitz, manipulierte Umfragen, Argumentations-Leitfäden, die Gegenargumente<br />
ausblenden und Werbebotschaften priorisieren, Negative Campaigning-Strategien<br />
gegen Atomkraft-Kritiker und Jubelbeiträge für die Förderer der Atomenergie.<br />
Das Leistungsversprechen der Autoren für die Auftraggeber rechtzeitig vor der<br />
Bundestagswahl im <strong>November</strong> 2008 ist kristallklar: „Die Ergebnisse von IfD (Anm.<br />
Institut für Demoskopie Allensbach), Emnid u. a. legen daher immer den Schluss<br />
nahe, dass allein ein Regierungswechsel ausreichen würde, um die Stimmung in<br />
Deutschland pro Kernenergie zu drehen.“<br />
Es handelt sich folglich um ein einmaliges Dokument, das – wie Branchenkenner<br />
bestätigen – allerdings auch in ähnlicher Form als „Maske“ exemplarisch für andere<br />
Lobbyorganisationen gilt. Strategische Leitmotive von den auf Lobbyarbeit spezialisierten<br />
Agenturen wie PRGS sind bezogen auf die Medien folgende Muster:<br />
• Themen und Positionen – wie im skizzierten Fall die langfristige Laufzeit -<br />
garantie für Atomkraftwerke – werden in Form der sogenannten „orchestrierten<br />
Kommunikation“ in der Öffentlichkeit verankert.<br />
• Semantisch positiv aufgeladene Begriffe und Fahnenwörter wie etwa „Kernenergie<br />
als Brückentechnologie“, eingebettet in das Konzept der „Nachhaltigkeit“<br />
sollen über die Medien etabliert werden. Die CDU nutzt beispielsweise<br />
den von der AKW-Lobby erfunden Begriff der „Brückentechnologie.“<br />
• Ausgewählte Journalisten und Medien werden mit „bestellten Wahrheiten“<br />
versorgt; sie erhalten frisierte (wissenschaftliche) Studien, passende<br />
Meinungsumfragen, getürkte Statistiken, von PR-Agenturen geschriebene<br />
113
Texte, Interviews und Meinungsbeiträge etc. Das Spektrum dieser Dienstleistungen<br />
und Informations-Rohstoffe ist schier unbegrenzt. Dazu gehört<br />
auch die Vermittlung von sogenannten „Experten“, die als „Mietmäuler“<br />
einsetzbar sind.<br />
• Medien-Kritiker werden mit allen denkbaren Methoden des negative campaignings<br />
überzogen, diffamiert und disqualifiziert. Ihre Reputation soll<br />
beschädigt werden.<br />
• Blogs, web-Seiten und andere „social media“-Plattformen werden von den<br />
Lobbys – wie im Fall der Bahnprivatisierung dokumentiert – gezielt instrumentalisiert<br />
und manipuliert.<br />
• Diese Aktivitäten werden von den Lobbyorganisationen in einem „eisernen<br />
Dreieck“ gesteuert. Dazu gehören sogenannte „Public Affairs Agenturen“<br />
und PR-Agenturen, die ihre Arbeit nach journalistischen Kriterien ausrichten<br />
und selten Spuren hinterlassen. Der Wechsel sehr erfahrener journalis -<br />
tischer Profis in die PR unterstreicht diesen Prozeß der Professionalisierung<br />
der Branche.<br />
• Der Handel mit sogenannten „Exclusiv-Informationen“ floriert. Agenturfähige<br />
Informationen werden gegen Wohlverhalten getauscht. Gute Informanten<br />
leben – sozusagen als Gegenleistung – in einer medialen Schonzone. Es gilt<br />
der Grundsatz: „In die Hand, die mich füttert, beiße ich nicht.“<br />
Warum ist die Lobby so erfolgreich?<br />
Der Cocktail aus Naivität, Bequemlichkeit und Gewöhnung<br />
Wer glaubt, dass es sich bei den professionellen Lobbyisten heute – wie gebetsmühlenhaft<br />
behauptet, um harmlose Akteure handelt, an die man sich im parlamentarischen<br />
Prozeß gewöhnt hat, sollte die Positionen von Verfassungsrichtern,<br />
Bundespräsidenten, Parteivorsitzenden, Ministern und zahlreichen Abgeordneten<br />
genauer anschauen.<br />
Denn die unkontrollierte Macht der Lobbyisten auch auf die Medien wird immer<br />
mehr Politikern im Schatten der Finanz- und Wirtschaftskrise unheimlich. Diese<br />
schleichende Entwicklung wird schon seit längerem auch <strong>vom</strong> Bundesverfassungsgericht<br />
registriert.<br />
„Verfassungsrichter Papier warnt vor Lobbyismus“ titelte die Börsenzeitung Anfang<br />
März 2010. Diese brisante politische Bilanz des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts<br />
(BVG) mit der Kernthese „Lobbyismus ist eine latente Gefahr<br />
für den Rechtsstaat“ hätte Medienmacher eigentlich alarmieren müssen. Aber das<br />
Interview des konservativen, mit hoher Reputation ausgestatteten Verfassungsrichters,<br />
schaffte es nicht einmal in die Pressespiegel der Parteien. Die Politik könne<br />
sich natürlich den Lobbyisten zu „Informationszwecken“ bedienen, räumt<br />
Papier ein. „Übertreibungen sollte man allerdings Einhalt gebieten und insbesondere<br />
die inhaltliche Formulierung der Gesetze in der Hand der Politik und vor allem<br />
114
des Parlaments und der Regierung belassen. Bürger wählen ja ein Parlament,<br />
damit dieses Gemeinwohlinteressen und nicht Partikularinteressen vertritt.“<br />
Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel bilanzierte die Aktivitäten der Finanzmarkt-<br />
Lobby ebenso eindeutig : „Wir müssen das Kasino schließen und aufhören, Klientelpolitik<br />
zu machen und den Lobbyinteressen nachzugeben.“ Sein Vorgänger Kurt<br />
Beck bemerkte im Zusammenhang mit den zuvor von der Pharmalobby bekämpften<br />
Gesundheitsreformen: „Wir werden vor dem Lobbbyismus in Deutschland nicht<br />
einknicken.“ Ein erfahrener, in langen Jahren gestählter Minister ergänzte in einem<br />
Hintergrundgespräch: „Gegen die Pharma-Industrie kann in Deutschland niemand<br />
regieren.“ Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Thomas Oppermann,<br />
verglich im Juli 2009 in einer <strong>Talk</strong>show den Einfluss der Medizinlobby sogar mit<br />
dem der italienischen Mafia. Starke Worte – aber Empörung ohne Folgen. Empörung<br />
als Ventil für ein generelles Unbehagen an der Übermacht von Lobbyinteressen.<br />
Signale der Hilflosigkeit?<br />
Die Macht der Lobby ist für die meisten Medien ein „Randthema“<br />
Dieser Eindruck der Dominanz von lobbyistisch geprägten Partikularinteressen hat<br />
sich nicht nur unter Verfassungsrichtern verdichtet. Sieben grundlegende, sich wechselseitig<br />
verstärkende Tendenzen, haben in den vergangenen Jahren das unkontrollierte<br />
Macht- und Gefahrenpotential des Lobbyismus öffentlich sichtbarer gemacht<br />
und eine spürbare Nervosität unter führenden Politikern erzeugt. Dazu gehören:<br />
• Die Formulierung von mehr als 20 Gesetzen, von Verordnungen oder Textbausteinen<br />
für Gesetze durch externe Anwaltskanzleien. Sie stellen die Gesetzgebungskompetenz<br />
des Parlaments und die Rolle der Abgeordneten in Frage.<br />
• Die Platzierung von sogenannten „Leihbeamten“ der Lobbyorganisationen<br />
in den Ministerien wird nach detaillierter Analyse <strong>vom</strong> Bundesrechungshof<br />
als ein „Risikopotential“ für die Unabhängigkeit der staatlichen Verwaltung<br />
bezeichnet.<br />
• Der Wechsel von mehreren Spitzen-Lobbyisten aus der Atomindustrie, der<br />
Privaten Krankenversicherungen und der Finanzwirtschaft in die Leitungsebenen<br />
verschiedener Ministerien der christlich-liberalen Koalition nährt<br />
den Verdacht der offenen Klientelpolitik und der Verlagerung von Lobbymacht<br />
in die politische Administration.<br />
• Fragwürdige Praktiken der Politikfinanzierung über Sponsoring, Spenden,<br />
bezahlte Reden – verbunden mit tatsächlichen oder unterstellten direkten<br />
Gegenleistungen – führt zum weit verbreiteten Eindruck, dass Lobbyisten<br />
sich den Zugang zur Politik und Medien über eine „gezielte Landschaftspflege“<br />
kaufen können.<br />
• Der direkte Wechsel von Ministerpräsidenten, Ministern, Staatssekretären<br />
und Spitzenpolitikern als Lobbyisten und Berater in die Industrie hat in den<br />
vergangenen Jahren massiv zugenommen. Dies gilt umgekehrt auch für zahl-<br />
115
eiche führende Journalisten, die nun als Lobbyisten tätig sind. Dies fördert<br />
die Durchlässigkeit der eigentlich getrennten Systeme.<br />
• Die Platzierung von Lobbyisten in parlamentarischen Gremien sowie die<br />
Vergabe von Studien und Beratungsaufträge an lobbynahe oder lobby -<br />
abhängige Dienstleister.<br />
Die Bündelung dieser Tendenzen, die kumulativ wirken und Zweifel an der Autonomie<br />
politischer Entscheidungen nähren, veranlassen nicht nur Richter des Bundesverfassungsgerichts<br />
zu eindeutigen Mahnungen. Auch im Parlament sind diese Signale<br />
angekommen. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat 2011 wiederholt die<br />
Legitimation der Demokratie und die Ausklammerung des Parlaments bei wichtigen<br />
Entscheidungen beklagt. Ohne erkennbare Resonanz. In den Leitartikeln der Leitmedien<br />
hat der Einfluß der „Fünften Gewalt“ aber immer noch eine Randposition.<br />
Welche Gründe könnte es für diese kaum zufällige Agenda-Politik geben?<br />
„Geschlossener Informations-Kreislauf“ –<br />
Symbiose von politischer und medialer Klasse<br />
Lobbyisten, Berater, Abgeordnete, Ministerialbürokratie, Minister und zahlreiche<br />
Medienvertreter sehen sich in einem geschlossenen Informations- und Beratungskreislauf<br />
integriert. Neu ist, dass Journalisten und Politiker proaktiv und routiniert<br />
die engen Kooperationsbeziehungen zur Lobby intensiv pflegen und die angebotene<br />
juristische, „fachliche“ und politische „Expertise“ offensiv nutzen. In einmaliger<br />
Offenheit hat Peter Friedrich, heute Minister für Bundesangelegenheiten aus Baden-<br />
Württemberg, diesen Verschmelzungs-Prozeß analysiert: „Der Lobbyist wird zum<br />
scheinbaren Helfer des Abgeordneten oder Beamten, er unterstützt ihn mit Argumenten,<br />
Formulierungshilfen, Studien. Alles hilfreiche Dinge, um selbst im politischen<br />
Wettbewerb zu bestehen. Die eigenen Interessen und Ziele verschmelzen<br />
mit denen der Lobby.“<br />
Was Friedrich offenherzig für die politische Klasse einräumt, bestätigen auch führende<br />
Journalisten, allerdings nur „unter drei“. Auch für sie gilt der Grundsatz, den<br />
auch Spitzen-Lobbyisten für sich reklamieren: „Unsere Arbeit ist prinzipiell nicht<br />
öffentlichkeitsfähig“.<br />
Die Parallelwelt von Lobby und Politik<br />
Laut einer Studie der Organisation „Lobby Control“ arbeiten 15 von 63 Ministern<br />
und Staatssekretären aus der früheren rot-grünen Koalition heute in Positionen mit<br />
„starkem Lobbybezug“. Sie profitieren von ihrem Insiderwissen, ihre alten Verbindungen<br />
und ihren Zugang zu ihren früheren Mitarbeitern in der Ministerialbürokratie<br />
sowie ihren Medienkontakten.<br />
Öffentlich kaum beachtet wurde bislang, dass auch zahlreiche Diplomaten diesem<br />
Weg in die Lobby-Politik folgen. So wechselte der Deutsche Botschafter in London,<br />
116
Wolfgang Ischinger, als Lobbyist zum Versicherungskonzern Allianz. Jürgen Chrobog,<br />
zuletzt Staatssekretär im Auswärtigen Amt, ging zur Quandt-Stiftung. Der frühere<br />
deutsche Botschafter in Neu Delhi, Heimo Richter, sucht sein Glück bei der Bosch-<br />
Stiftung. Zuvor heuerte schon Ex-Außenminister Klaus Kinkel als Präsident der<br />
Telekom-Stiftung an. Viele weitere Lobbykarrieren ließen sich dokumentieren.<br />
Auch international renommierte Politiker – wie der frühere britische Premier Tony<br />
Blair – verkaufen heute ihr Politikwissen. In diesem Fall als Berater ausgerechnet<br />
für die Investmentbank JP Morgan. Diese Bank war führend bei der Stimulierung<br />
extrem risikoreicher Finanztransaktionen bei gleichzeitiger Reduzierung von politischen<br />
Kontrollen. Auch der frühere Kanzler Gerhard Schröder und sein Vize Joschka<br />
Fischer haben diesen Weg eingeschlagen. Die Liste der Seitenwechsler ist sehr lang.<br />
Die Drehtüren von der Politik zur Wirtschaft schaden dem Ansehen der Politik, weil<br />
so sichtbar wird, dass persönliche Interessen offenbar politische Motive überlagern.<br />
Auch diese Haltung fördert das Misstrauen in die Integrität und Unabhängigkeit<br />
der Politik. Ohne eine gesetzlich geregelte „Abkühlungsphase“ von mindestens<br />
drei Jahren nach dem Ausscheiden aus der Politik wird man solche bruchlosen<br />
Wechsel nicht reduzieren können.<br />
Eine Initiative des Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Fraktion, Christian<br />
Lange, mit dem Ziel einen „Verhaltenskodex für ehemalige Mitglieder der Bundesregierung“<br />
einzuführen, blieb bislang erfolglos. Zwar lud der Innenausschuss am<br />
<strong>15.</strong>6.2009 zu einer Sachverständigenanhörung. Ein entsprechender Antrag zur<br />
Formulierung eines Verhaltens-Kodex wurde am 2.7.2009 – mit den Stimmen der<br />
SPD-Fraktion abgelehnt. Einen Brief des SPD-Politikers an die Bundeskanzlerin<br />
beantwortete der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium Dr. Christoph<br />
Bergner im Januar 2010. Der „Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten“<br />
gibt in seiner Antwort zu erkennen, dass die Bundesregierung auch mit<br />
Blick auf die im Grundgesetz geschützte Freiheit der Berufsausübung (Art. 12 GG)<br />
einem „Verhaltenskodex“ keine Chance gibt. „Ein Verhaltenskodex wäre zudem<br />
rechtlich unverbindlich und könnte in praktisch wichtigen Fällen keine hinreichenden<br />
Sanktionsmöglichkeiten bieten.“ Diese Antwort der Bundesregierung illustriert<br />
einen Grundkonflikt. Regelungen, die den Lobbyeinfluß auch nur im Ansatz begrenzen<br />
oder einhegen könnten, werden strikt abgelehnt.<br />
Nur wenige Journalisten interessieren sich für die Macht der Lobby; kaum jemand<br />
fordert eine Abkühlungsphase für Journalisten, die in den Lobbyismus – und oft<br />
genug – wieder zurück in den Journalismus wechseln. Das System wechselseitiger<br />
Abhängigkeiten funktioniert.<br />
Wer freiwillig „embedded“ und Teil eines funktionierenden Informationskreislaufes<br />
ist, hat offenbar keinen Grund zur Klage.<br />
117
Der zunehmende Einfluß der Lobby wirft die Demokratiefrage auf<br />
Christian Wulff will seine Amtszeit dem Thema „Zukunft der Demokratie“ widmen.<br />
Er sorgt sich vor allem um das „mangelnde Interesse vieler Bürger, sich in den<br />
Kommunen zu engagieren.“ Auch das schlechte Image der Politiker motiviert ihn zu<br />
seiner ungewöhnlichen programmatischen Schwerpunktsetzung. „Heute begleitet<br />
die Politiker viel Häme, viel Spott und viel Misstrauen – mehr als früher.“ Ungewöhnlich<br />
klar analysierte er: „Der Graben zwischen Wählern und Gewählten wird<br />
größer.“ Vertrauensverlust und Wahlverweigerung gegenüber Politik und Parlament<br />
einerseits, Passivität, Beteiligungs-Abstinenz und Desinteresse der Bürger andererseits.<br />
Die Kerze der Demokratie brennt also von zwei Seiten und niemand bietet<br />
derzeit eine überzeugende Perspektive zur Stabilisierung und Revitalisierung<br />
demokratischer Strukturen. Zum Lagebild gehört auch, dass Wulffs Entscheidung<br />
die Bedrohung der Demokratie in Deutschland zu ‘seinem’ Thema zu machen,<br />
kaum öffentliche Resonanz fand.<br />
Zusammenfassung in 11 Thesen:<br />
1. These:<br />
Lobbyvertreter verstoßen mit ihrer klandestinen Politik und den Verzicht auf Öffentlichkeit<br />
gegen wesentliche Grundanforderungen des demokratischen Prozesses.<br />
2. These<br />
Die fehlende Transparenz – als identitätsstiftendes Merkmal – des Lobbyismus widerspricht<br />
demokratischen Grundprinzipien. Damit steht die Demokratiefähigkeit in<br />
Frage. Die reklamierten Beteiligungsrechte im Rahmen der pluralistischen Aushandlungs-Demokratie<br />
führt der Lobbyismus damit ad absurdum, da Öffentlichkeit<br />
im demokratischen Prozeß schlichtweg konstituierend ist und die Zugangsberechtigung<br />
zur demokratischen Mitwirkung definiert.<br />
Lobbyismus führt – auch auf Grund seiner anonymen, die Öffentlicheit ausblendende<br />
Praxis – zur Vertrauensvernichtung gegenüber den gewählten Akteuren und schadet<br />
somit dem Ansehen der repräsentativen Demokratie, die sich immer stärken in die<br />
Richtung einer Postdemokratie entwickelt.<br />
3. These<br />
Lobbyisten und Politiker sind de facto Komplizen. Zwar grenzen sich selbst Spitzenpolitiker<br />
scharf von der lobbyistischen Übermacht ab; de facto schauen sie aber zu<br />
Lobbyisten auf und leben in einer symbiotischen Beziehung.<br />
Peter Friedrich, SPD-Minister aus Baden-Württemberg, diesen Verschmelzungs-<br />
Prozeß analysiert: „Der Lobbyist wird zum scheinbaren Helfer des Abgeordneten<br />
oder Beamten, er unterstützt ihn mit Argumenten, Formulierungshilfen, Studien.<br />
Alles hilfreiche Dinge, um selbst im politischen Wettbewerb zu bestehen. Die eigenen<br />
Interessen und Ziele verschmelzen mit denen der Lobby.“<br />
118
4. These<br />
Die Exekutive sieht Lobbyisten als effektiven Kooperationspartner.<br />
Parlamentarier schauen zu Lobbyisten auf und werden in ihren Fraktionen aufgewertet,<br />
wenn sie gute Kontakte zu Lobbyisten pflegen.<br />
Aus dieser „nützlichen“ Kooperations-Kultur wächst ein Komplizentum. Politiker<br />
gewähren ihren Partnern deshalb freiwillig Sonderrechte. Daraus ergeben sich heikle<br />
Problemzonen der freiwilligen Interessenabhängigkeit.<br />
5. These<br />
Alle Initiativen zur Begrenzung oder Einhegung des Lobbyismus wurden bislang im<br />
Parlament torpediert. Zwischen voluminöser Rhetorik und konkreten Restriktionen<br />
klafft eine große Lücke. Lobbyregister sind keine Lösung, allenfalls eine Selbstverständlichkeit.<br />
6. These<br />
Die Macht der Lobby ist für die meisten Medien ein „Randthema. Der Cocktail aus<br />
Naivität, Bequemlichkeit und Gewöhnung an die produktiven „Lobby-Informanten“<br />
führt zu einem bedenkenlosen Umgang mit dem Lobbyismus.<br />
Es gibt einen funktionierenden „Geschlossenen Informations-Kreislauf“ – eine<br />
Symbiose von politischer und medialer Klasse. Davon profitiert der Lobbyismus.<br />
7. These<br />
Das größte Problem ist die Macht-Asymetrie im Lobbyismus. Gewaltige finanzielle<br />
und personelle Ressourcen, professionelle Organisationsmacht, Erfahrungswissen,<br />
Expertise, Know-how, Image und Reputation – die gebündelten Ressourcen und<br />
die institutionellen Vorteile – sichern eine beachtliche Machtposition. Die Zugangsmöglichkeiten<br />
zu Entscheidungsträgern, das Netzwerk von Unterstützern in den<br />
Institutionen, die Strategiefähigkeit und Kenntnis „wie Politik gemacht wird“ verschärfen<br />
die ohnehin vorhandenen Machtasymetrien. Lobbyisten haben einen Sinn<br />
für Dramaturgie, für timing und die Wirkung von Bildern etc. Damit sichern sie sich<br />
Platzvorteile auf der parlamentarischen Bühne.<br />
8. These<br />
Lobbyisten leben von der Legende der Normalität und dem Märchen vermeintlicher<br />
Neutralität sowie dem Signum eines Gegengewichts, das die Inkompetenzen einer<br />
(vermeintlich) überforderten Politik kompensiert.<br />
Lobbyismus profitiert von diesen Mythen gekoppelt mit erheblichen Wissenslücken.<br />
Die natürliche Distanz nimmt ab, die kritische Masse schmilzt.<br />
Es gibt eine weit verbreitete (unreflektierte) Haltung zum Einfluss der Lobby, getrieben<br />
auch von der Skepsis gegenüber der Leistungsfähigkeit der etablierten Politik-<br />
Akteure.<br />
119
9. These<br />
Die Sozialwissenschaften haben den Wirkungs-Wandel des Lobbyismus nicht<br />
begleitet und analysiert. Sie vermittelt immer noch Parlamentsfolklore. Die Langzeitwirkung<br />
wissenschaftlicher Diskurse und empirischer Forschungsergebnisse fällt<br />
also weitgehend aus. Nach der klassischen Verbändeforschung zu Beginn der 50iger<br />
Jahre ist kaum belastbare empirische Forschung ergänzt worden. (mit wenigen<br />
Ausnahmen)<br />
Die Sozialwissenschaften in ihrer heutigen Verfassung sind offenbar strukturell<br />
unfähig diese Recherchearbeit zu leisten und die Ergebnisse mit weiteren Analysen<br />
zu verknüpfen.<br />
10. These<br />
Die überschätzte Zivilgesellschaft beschäftigt sich nur am Rande mit den Bedrohungen<br />
des Lobbyismus. Einige kleine, wohlmeinende Organisationen sind gegenüber<br />
der Übermacht der Lobby schlicht überfordert.<br />
11. These<br />
E i n e wirksame Gegenindikation zur Zähmung der „Stillen Macht“ wäre ein selbstkritischer<br />
Diskurs innerhalb der Lobbyorganisationen. Sie müssten Regeln akzeptieren,<br />
Öffentlichkeit zulassen und sich auf einen Kodex verpflichten, der Grenzen<br />
aufzeigt und Problemzonen definiert. Doch diese „Handwerksordnung“ wird es<br />
(noch) nicht geben. Denn Macht ist die Schaffung von Ungewissheitszonen.<br />
FAZIT: Das heisst: Lobbyismus in der Realität – nicht im Lehrbuch der Lobbyisten –<br />
ist eine zunehmende Gefahr für das parlamentarische System und die Demokratie.<br />
Bedauerlich, dass in der öffentlichen Sphäre diese Tendenzen und Analysen nur<br />
von ehemaligen Verfassungsrichtern und überzeugten Parlamentariern geteilt werden.<br />
Prof. Dr. Thomas Leif, Publizist. Jüngste Veröffentlichung: „angepasst und ausgebrannt“,<br />
Politik in der Nachwuchsfalle, München 2010<br />
120
Die Steine des Sisyphos<br />
Von Günter Grass<br />
Meine Damen und Herren,<br />
oder soll ich Sie, da wir allesamt der schreibenden Zunft angehören und mit dem<br />
Tintenfaß getauft wurden, kollegial um Aufmerksamkeit bitten? Schließlich hat sich<br />
diese Versammlung auf den Schriftsteller und Philosophen Albert Camus berufen und<br />
mit dem Motto <strong>vom</strong> „glücklichen Menschen“ jenen Sisyphos als Schutzpatron er -<br />
wählt, der seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mein einziger Heiliger<br />
ist. Auf ihn, der die Götter lästert, konnte ich mich allzeit verlassen: Sankt Sisyphos.<br />
Camus hat ihn und seinen Mythos für uns aufs Neue gedeutet. Allein die Tatsache,<br />
daß sein so knapp gehaltener wie langfristig wirksamer Essay inmitten der Drangsal<br />
deutscher Besatzung geschrieben und im Jahre 1942 von der Librairie Gallimard in<br />
Paris verlegt wurde, also in Kriegszeiten, als Frankreich zwischen Widerstand und<br />
Kollaboration schwankte, unter die Leser kam, ist ein Beleg mehr dafür, was Camus<br />
bewogen haben mag, das Absurde des Weltgeschehens bildkräftig zum Begriff zu<br />
formen: der nie zur Ruhe kommende Stein.<br />
Aber ist es nicht so, daß uns gegenwärtig mehrere Steine in Bewegung halten? Mit<br />
Blick auf das letzte halbe Jahr fällt auf, wie viele Großereignisse nacheinander weltweit<br />
und provinziell die Schlagzeilen der Zeitungen fettleibig machten, sich zeitgleich<br />
wechselseitig übertrumpften, auch wie sie miteinander um den Rang stritten. Sie<br />
schienen – der Schnee von gestern – erledigt zu sein und hörten dennoch nicht auf,<br />
das politische und ökonomische Geschehen weiterhin zu bestimmen.<br />
So verdrängte die Lächerlichkeit der Guttenbergschen Plagiatsaffäre die erst jetzt<br />
ins Blickfeld geratenen Folgen der von jenem adligen Ministerdarsteller schnurstracks<br />
liquidierten allgemeinen Wehrpflicht. Nicht nur für diese Leistung hatte ihn<br />
121
Journalistenfleiß hochgelobt; davon wird später die Rede sein. Doch kaum hatte die<br />
Kanzlerin dem Lügenbaron Glauben zu schenken versprochen, lösten Erdbeben und<br />
Flutwelle im fernen Japan eine atomare Katastrophe aus, die uns sogleich die längst<br />
verdrängten Reaktorruinen von Tschernobyl ins Gedächtnis riefen und Landtagswahlen<br />
zu Großereignissen steigerte. Und während noch Fukushima, wie es im Journalistenjargon<br />
heißt, zum „Aufmacher“ taugte, forderten Volksaufstände in Nordafrika von<br />
Tunesien und Ägypten über Libyen und Syrien Platzrecht auf erster Seite, indessen<br />
die Auftritte eines Außenministers selbst den restlichen Anhängern seiner Partei zur<br />
Peinlichkeit mißrieten. Und nun ist es die seit Jahren schwelende Griechenlandkrise,<br />
die alles, was geschah, überdauert und, – was Fukushima betrifft – die Zukunft<br />
belasten wird, mit Zwangsverordnungen und Europabeschwörungen übertönt.<br />
Und was es sonst noch gab und weiterhin geben wird: sich willkürlich überbietende<br />
Benzinpreise, Flüchtlingselend, fürstliche Hochzeiten, Fischer, die zu Piraten wurden<br />
und die in den Hintergrund geratene, wenngleich seit Jahren wirksame Klimaveränderung<br />
mitsamt ihren Begleiterscheinungen, die das Fortleben des Menschen -<br />
geschlechts begründetem Zweifel aussetzt.<br />
Zusammengefaßt läßt sich sagen, der Journalismus, um den es ja heute gehen soll,<br />
und der sich, – wenn ich das Motto dieser Tagung richtig verstehe – in Frage stellen<br />
will, lebt von der Hand in den Mund, zehrt von Sensationen und findet nicht Zeit<br />
oder nimmt sich nicht ausreichend Zeit, die Hintergründe alldessen auszuleuchten,<br />
was uns in immer kürzeren Abständen in dauerhafte Krisen bringt.<br />
Aber ist der Journalismus oder – direkter gefragt – sind die Journalisten wirklich<br />
bereit, sich selbst kritisch zu befragen? Als Schriftsteller weiß ich ein Lied davon zu<br />
singen. Mein Tun und Lassen ist ihrer permanenten Begutachtung ausgesetzt und<br />
war oft genug hordenmäßiger Dreinrede, den Treibjagden des Kampagnenjournalismus<br />
preisgegeben. Ich bin derlei Rituale gewohnt und habe mehrere Schlachtfeste<br />
mit nur noch gelegentlich juckenden Narben überlebt. Vielleicht deshalb, weil<br />
wir Schriftsteller ohnehin kritisch miteinander umgehen, was Journalisten so gut<br />
wie nie tun. Allenfalls rümpft der Eine, der Andere empfindsam die Nase, wenn es<br />
aus den Spalten der BILD-Zeitung allzu penetrant stinkt.<br />
Immerhin gibt es Ausnahmen. Las ich doch vor einigen Monaten in der Wochenzeitung<br />
DIE ZEIT den Versuch einer kritischen Selbstbetrachtung, wobei mir auffiel, daß es<br />
insbesondere Wirtschaftsjournalisten waren, die sich vorwarfen, vor der großen<br />
Finanzkrise, obgleich sie voraussehbar war, nicht rechtzeitig gewarnt zu haben.<br />
Weil aber die hier versammelten Journalisten offenbar vorhaben, sich ganz im Sinn<br />
des berufenen „glücklichen Menschen“ Sisyphos auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren<br />
und etliche liegengebliebene Steine zu wälzen, sehe ich mich eingeladen,<br />
einige Brocken von verschieden gewichtigem Umfang, die am Fuße des Berges<br />
ruhen oder auf halber Strecke bereits Moos angesetzt haben, beim Namen zu nennen.<br />
122
Kürzlich war ich in Greifswald, der Geburtsstadt des Schriftstellers Wolfgang Koeppen.<br />
Im Verlauf mehrerer Veranstaltungen gab dessen Roman „Das Treibhaus“, der den<br />
deutschen Bundestag während der frühen 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zum<br />
Gegenstand hat, Anlaß und Zunder genug her, um die Interessenvertretungen in<br />
einer sich pluralistisch verstehenden Gesellschaft, sprich den Lobbyismus, kritisch<br />
ins Bewußtsein zu rücken. Es gibt ihn und seine Begehrlichkeiten, was allein die<br />
Bundesrepublik betrifft, von Anbeginn. Von der Flick-Affäre über die Machenschaften<br />
des Spendenkanzlers Kohl bis hin zu den erpresserischen Tätigkeiten der Atomlobby,<br />
der Lobbyistenverbände der Pharmaindustrie, der Ärzte- und Apothekerverbände<br />
und der Krankenkassen, die bis heutzutage eine sozial verträgliche Gesundheitsreform<br />
verhindern.<br />
Nicht zuletzt sind es die großmächtigen Banken, deren Lobbytätigkeit mittlerweile<br />
das gewählte Parlament mitsamt der Regierung in Geiselhaft genommen hat. Die<br />
Banken spielen Schicksal, unabwendbares. Sie führen ein Eigenleben. Ihre Vorstände<br />
und Großaktionäre formieren sich zu einer Parallelgesellschaft. Die Folgen<br />
ihrer auf Risiko setzenden Finanzwirtschaft haben schlußendlich die Bürger als<br />
Steuerzahler auszubaden. Wir bürgen für Banken, deren Milliardengräber allzeit<br />
hungrig nach mehr sind.<br />
Selbstverständlich sind auch die Tages- und Wochenzeitungen, also die Journalisten,<br />
dieser Allmacht ausgesetzt. Es bedarf keiner altmodischen Zensur mehr, die<br />
Vergabe oder Verweigerung von Anzeigen reicht aus, um die ohnehin in Existenznot<br />
geratenen Printmedien zu erpressen. Dennoch, was heißt, trotz unterschwelliger<br />
Schweigegebote, wird es notwendig sein, durch gründlichen, mithin an die Wurzel<br />
gehenden Journalismus die Öffentlichkeit über unlegitimierten Machtgebrauch der<br />
Lobby aufzuklären. Er gefährdet die Demokratie weit mehr als hysterisch heraufbeschworene<br />
Gefahren, die im Sarrazin-Stil Angst und Schrecken verbreiten. Er<br />
macht die Parlamentarier und die Regierung unglaubwürdig. Er trägt dazu bei, daß<br />
die Wahlenthaltung der Bürger zunimmt. Ihm müssen, da er nicht abzuschaffen ist,<br />
weil Interessenvertretungen durchaus Berechtigung haben, strenge Grenzen<br />
gesetzt werden und sei es in Form einer Bannmeile um den Bundestag, auf daß das<br />
Heer der Lobbyisten in überschaubarer Distanz gehalten wird. Auch geht es nicht<br />
an, daß Politiker, unter ihnen hochrangige, kaum haben sie ihr Amt wie lästigen<br />
Krempel hingeworfen, in Konzernleitungen und Interessenverbänden fettdotierte<br />
Positionen besetzen. Man muß schon, wie ich es gerne tue, den Wirtschaftsteil der<br />
Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen, um zu erfahren, daß ein Herr Markus Kerber,<br />
lange tätig im Bundesinnenministerium, dann im Finanzministerium, Anfang Juli<br />
dieses Jahres einer Berufung folgt, die ihn zum Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes<br />
der Deutschen Industrie macht. Dort kommen nun, wie die FAZ lobend<br />
preisgab, seine internen Kenntnisse zugunsten dieses mächtigen Verbandes zur<br />
123
Wirkung. Dieser und ähnliche Positionswechsel bebildern einen Mißstand erster<br />
Ordnung. Seit Jahren ist er üblich. Deshalb bedarf es – so meine ich – einer gesetzlich<br />
verordneten Karenzfrist von mindestens fünf Jahren; es sei denn, die Allgemeinheit<br />
und insbesondere die Journalisten finden sich damit ab, daß Politik per se käuflich<br />
ist und bleibt.<br />
Ein weiteres Beispiel für unzulänglich aufgeklärte Öffentlichkeit ließ ich bereits zu<br />
Beginn meiner Rede anklingen. Es geht um die <strong>vom</strong> Tausendsassa Guttenberg im<br />
Handstreich erledigte allgemeine Wehrpflicht. Zwar lese ich zunehmend Berichte<br />
darüber, wie schwer es fällt, ausreichend viele Berufssoldaten und Freiwillige auf<br />
Zeit anzuwerben, zwar macht man sich Sorgen, welchen Eid zukünftig Söldner in<br />
welcher Form zu leisten haben, zwar wird der derzeitige Verteidungsminister<br />
bedauert, weil er von seinem Vorgänger einen einzigen Pfusch übernehmen mußte,<br />
aber kaum jemand macht sich oder will sich bewußt machen, was es bedeutet,<br />
wenn wir uns <strong>vom</strong> „Bürger in Uniform“ verabschieden und zukünftig mit einer Bundeswehr<br />
zu tun haben, die, wie die Erfahrung lehrt, als Söldnerarmee alles Zeug dazu<br />
haben wird, einen Staat im Staate zu bilden. Dieser Rückfall in Wallensteinsche<br />
Anwerbepraxis bahnt sich in Zeiten zunehmender Auslandseinsätze an, nahezu<br />
widerspruchslos und während – aberwitzig genug – unsere Freiheit am Hindukusch<br />
verteidigt wird.<br />
Angesichts dieses offensichtlichen Abgrundes sei mir ein Blick in die Vergangenheit<br />
erlaubt. Weil ich nun mal Altersringe genug angesetzt habe, kann ich mich gut an<br />
das Entstehen der Bundeswehr erinnern, an Konrad Adenauers Winkelzüge, an das<br />
Amt Blank, an meine Ablehnung der Wiederbewaffnung und an mein späteres politisches<br />
Bemühen als Bürger, ein wenig dazu beizutragen, daß das Konzept „Bürger<br />
in Uniform“ umgesetzt werden konnte, auch daß im Verlauf der Jahre gegen zähe<br />
Widerstände den Wehrdienstverweigerern als Ersatzdienstleistenden gesetzlich<br />
geregelte Anerkennung zuteil wurde. Doch zukünftig werden deren Sozialleistungen<br />
im Bereich der Alten- und Krankenpflege wegfallen. Welch ein nicht auszugleichender<br />
Verlust! Denn Söldner verweigern nicht. Es sei denn, ihr Sold wird gekürzt.<br />
Diese Mißgeburt, die als Reform verkauft werden soll, wird das Eigenverständnis<br />
der Bundesrepublik und der Bürger dieses Staates auf eine Weise verändern, die<br />
der Demokratie abträglich ist. Ich empfinde es als skandalös, daß nicht nur die<br />
Regierungsparteien, sondern alle drei Oppositionsparteien, mithin auch die SPD,<br />
die von Fritz Erler über Helmut Schmidt und Georg Leber bis hin zu Peter Struck vorzügliche<br />
Politiker in Sachen Verteidigungspolitik gestellt hat, nicht die Kraft haben,<br />
eine Alternative zu der jetzt schon sichtbaren Fehlentwicklung zur Diskussion zu<br />
stellen. Und gleichfalls versagen all jene Journalisten, die hinnehmen, was uns<br />
blaublütig eingebrockt wurde.<br />
124
Nun drängt sich auf, weitere Beispiele zu nennen, die deutlich machen, was versäumt<br />
wird und was neben anderem Aufgabe der Journalisten bleibt: den Finger in die Wunde<br />
zu legen, solange sie noch offen ist. Ich spreche von den Folgen des überstürzten<br />
Vollzugs der deutschen Einheit nach ausschließlich westdeutschem Interesse und<br />
Maßstab. Mehr als zwanzig Jahre ist es her und hatte dem Eigenlob dienliche Feiern<br />
zur Folge. Wer aber hinsieht oder bereit ist, hinzusehen, kann erkennen, was damals<br />
schon voraussehbar war, nun jedoch in gesteigertem Maße Wirklichkeit ist: der<br />
Osten gehört dem Westen. Die soziale Abstufung der Bürger der ehemaligen DDR<br />
und ihrer Nachkommen zu Deutschen zweiter Klasse ist dergestalt Tatsache geworden,<br />
daß überwiegend junge Menschen ihre Gemeinden, Klein- und Großstädte<br />
verlassen und in den Westen ziehen. Einige Regionen beginnen sich zu entvölkern.<br />
Und oft genug sind es Rechtsradikale, die bleiben, sich als Horden einnisten und in<br />
den aufgegebenen Gebieten auf unüberhörbare Weise den Ton angeben. Nur wenig<br />
und wenn, dann nicht den Ursachen nachgehend, erfährt davon die Öffentlichkeit.<br />
Dazu eine Ergänzung literarischer Art:<br />
Als kürzlich wieder einmal der von mir Mitte der 70er Jahre gestiftete Alfred-Döblin-<br />
Preis vergeben werden sollte, lasen im Literarischen Colloquium Berlin einige in die<br />
engere Wahl gekommene Autoren aus ihren Manuskripten. Zu ihnen gehörte eine<br />
junge Autorin, Judith Schalansky, die aus ihrem im Herbst dieses Jahres erscheinenden<br />
Roman „Der Hals der Giraffe“ las. Die Handlung spielt in einer mehr und<br />
mehr <strong>vom</strong> Wegzug ihrer Bürger geplagten vorpommerschen Kleinstadt. Eine Biologielehrerin<br />
von strengem Zuschnitt unterrichtet ihre schwindende Schülerzahl nach<br />
Darwinschem Ausleseprinzip und in voller Kenntnis der Tatsache, daß es ihre Schule<br />
mangels Schülern in drei, vier Jahren nicht mehr geben wird. Zudem ergreift die<br />
Natur von aufgegebenen Brachflächen, zerfallenden Gebäuden, <strong>vom</strong> Umfeld Besitz.<br />
125
Auf Ödland sprießt und rankt es tausendfältig. Selten gewordene Pflanzen<br />
wuchern in Mehrzahl. Mit ihnen triumphieren längst vergessene Wörter. Lakonisch<br />
beschließt die Erzählerin diesen Sieg der Natur mit dem Hinweis auf einst versprochene<br />
„blühende Landschaften“.<br />
Nun kann man sagen, wie gut, daß es noch immer die Literatur gibt, füllen doch<br />
Schriftsteller ab und an Lücken aus, die all jene Journalisten lassen, deren Tintenfleiß<br />
nur dem rasch wechselnden Tagesgeschehen dienlich ist. Doch da gegenwärtig<br />
im Zusammenhang mit der anhaltenden Griechenlandkrise als Allheilmittel empfohlen<br />
wird, einer Treuhand griechischen Staatsbesitz anzuvertrauen und diesen<br />
nach den Regeln der Privatisierung zu versilbern, sollte auch Ihnen, die Sie als kritische<br />
Journalisten hier versammelt sind, ein Rückblick auf jene Treuhand erwägenswert<br />
sein, die vor zwanzig Jahren außerhalb parlamentarischer Kontrolle als<br />
halbkriminelles Unternehmen alles, was unter dem Besitztitel „volkseigen“ firmierte,<br />
zugunsten westlicher Schnäppchenjäger verscherbelt hat: mit Folgen bis heutzutage,<br />
die zu übersehen offenbar dem Konsens entspricht.<br />
Ich weiß, die Flut der alltäglichen Nachrichten, verstärkt durch den Ausfluß des<br />
Internets, überfordert jeden, der informiert sein möchte. Schon bieten sich dem<br />
übersättigten Konsumenten virtuelle Fluchträume an. Und doch bleibt niemandem<br />
erspart, um die Zukunft der uns Deutschen durch Siegerwillen geschenkten<br />
Demokratie und der noch durch die Verfassung geschützten Freiheitsrechte<br />
besorgt zu sein.<br />
Ich muß und will mich nicht auf Weimar als warnendes Beispiel berufen, die gegenwärtigen<br />
Ermüdungs- und Zerfallserscheinungen im Gefüge unseres Staates bieten<br />
Anlaß genug, ernsthaft daran zu zweifeln, ob unsere Verfassung noch garantiert<br />
was sie verspricht. Das Auseinanderdriften in eine Klassengesellschaft mit ver -<br />
armender Mehrheit und sich absondernder reicher Oberschicht, der Schuldenberg,<br />
dessen Gipfel mittlerweile von einer Wolke aus Nullen verhüllt ist, die Unfähigkeit<br />
und dargestellte Ohnmacht freigewählter Parlamentarier gegenüber der geballten<br />
Macht der Interessenverbände und nicht zuletzt der Würgegriff der Banken machen<br />
aus meiner Sicht die Notwendigkeit vordringlich, etwas bislang Unaussprechliches<br />
zu tun, nämlich die Systemfrage zu stellen.<br />
Keine Angst! Hier soll nicht die Revolution ausgerufen werden. Die fand, was<br />
Europa betrifft, zuletzt im zwanzigsten Jahrhundert statt und zwar im Plural mit<br />
bekannten Ergebnissen, zu denen als Folge Konterrevolutionen und Völkermord<br />
gehörten. Vielmehr geht es darum, aus der gesamten Gesellschaft heraus, wie es<br />
mittlerweile viele Bürger tun, fordernd Fragen zu stellen: Ist ein der Demokratie wie<br />
zwanghaft vorgeschriebenes kapitalistisches System, in dem sich die Finanzwirtschaft<br />
weitgehend von der realen Ökonomie gelöst hat, doch diese wiederholt<br />
126
durch hausgemachte Krisen gefährdet, noch zumutbar? Sollen uns weiterhin die<br />
Glaubensartikel Markt, Konsum und Profit als Religionsersatz tauglich sein?<br />
Mir jedenfalls ist sicher, daß das kapitalistische System, befördert durch den Neoliberalismus<br />
und alternativlos, wie es sich darstellt, zu einer Kapitalvernichtungsmaschinerie<br />
verkommen ist und fern der einst erfolgreichen Sozialen Marktwirtschaft<br />
nur noch sich selbst genügt: ein Moloch, asozial und von keinem Gesetz<br />
wirksam gezügelt.<br />
So stellt sich anschließend die Frage: Hat die von uns gewählte Staatsform, also<br />
die parlamentarische Demokratie, noch den Willen und auch die Kraft, diesen auf<br />
sie übergreifenden Zerfall abzuwenden? Oder wird weiterhin jeder Reformversuch,<br />
die Banken und deren Umgang mit Kapital unter Kontrolle zu bringen, – was heißen<br />
soll, sie gemeinnützig zu verpflichten – mit dem bislang gängigen Hinweis „so<br />
etwas ist, wenn überhaupt, nur global zu lösen“, in den Bereich der Unverbindlichkeit<br />
abgeschoben?<br />
Eines scheint mir gewiß zu sein: Sollten sich die westlichen Demokratien als unfähig<br />
erweisen, den real drohenden und den voraussehbaren Gefahren mit grundlegenden<br />
Reformen zu begegnen, werden sie all dem nicht standhalten können, was in den<br />
kommenden Jahren unabweisbar sein wird: Krisen, die weitere Krisen hecken, der<br />
ungebremste Anstieg der Weltbevölkerung, die durch Wassermangel, Hunger und<br />
Verelendung ausgelösten Flüchtlingsströme und die von Menschen gemachte<br />
Klimaveränderung. Ein Zerfall der demokratischen Ordnungen jedoch ließe – wofür<br />
es Beispiele genug gibt – ein Vakuum entstehen, von dem Kräfte Besitz ergreifen<br />
könnten, die zu beschreiben unsere Vorstellungskraft überfordert, so sehr wir<br />
gebrannte Kinder sind, gezeichnet von den immer noch spürbaren Folgen des<br />
Faschismus und Stalinismus.<br />
Habe ich übertrieben? Wenn ja, dann nicht stark genug. Mit Hilfe nur weniger Beispiele<br />
sollten Blindstellen erkennbar gemacht werden. An denen mangelt es nicht.<br />
Zusätzlich böte sich an, über die Macht der Konzerne im Bereich der Presse, über<br />
die unsäglichen Quasselrunden des öffentlichrechtlichen Fernsehens und über den<br />
gesellschaftsfähig gewordenen Opportunismus, wie er sich alltäglich druckfrisch<br />
verbreitet, zu klagen. Doch darüber wissen Sie, denen „Ausgewogenheit der<br />
Berichterstattung“ mehr oder weniger fordernd als Weichspüler empfohlen wird,<br />
Genaueres zu sagen.<br />
Eher scheint es angebracht, noch einmal den Schutzpatron dieser Tagung herbeizuzitieren.<br />
Als ich jung war und mich während der ersten Nachkriegsjahre in einer<br />
durch ideologischen Wahn zerstörten Umwelt zu orientieren versuchte, bot sich die<br />
127
französische Spielart des Existentialismus an. Es war nahezu modisch, sich existentialistisch<br />
zu geben und sich düster zu kleiden. Insbesondere war es der Streit<br />
zwischen Sartre und Camus, der über die Grenze schwappte und bis in die Ateliers<br />
der Düsseldorfer Kunstakademie, in der ich als Lehrling meinem ersten Beruf als<br />
Bildhauer nachging, für Diskussion sorgte, die entsprechend streitbar verlief. Dabei<br />
hinderte mangelte Kenntnis nicht daran, lautstark leidenschaftlich zu werden. Ich<br />
habe mich erst später für Camus entschieden. Seine Sicht des Menschen in der<br />
Revolte, das heißt sein Plädoyer für den permanenten Widerspruch hat mich<br />
geprägt. Als etwa Mitte der 50er Jahre in deutscher Übersetzung der Mythos <strong>vom</strong><br />
Sisyphos erschien, waren es seine Sätze, die mir den Weg wiesen. Etwa die Definition<br />
des Glücks: „Es macht aus dem Schicksal eine menschliche Angelegenheit, die<br />
unter Menschen geregelt werden muß.“ zudem die schöne Gewißheit: „Die niederschmetternden<br />
Wahrheiten verlieren an Gewicht, sobald sie erkannt werden.“<br />
Ich nehme an, daß diese Einsichten geeignet sind, auch Ihre journalistische Arbeit<br />
zu bestimmen. Wir haben nur diese Welt. Und da die Existenz des Menschen -<br />
geschlechts auf dem blauen Planeten jüngeren Datums ist und deren Dauer von<br />
unserem Tun und Lassen abhängt, sind wir für dessen Zustand verantwortlich. Wir<br />
haben ihn weitgehend verunstaltet, treiben Raubbau und hinterlassen unseren<br />
Nachkommen eine nicht abzuweisende Erblast. Also gilt es, diese und andere<br />
Wahrheiten zu erkennen und zu benennen. Es gilt, Steine zu wälzen. Zu dieser<br />
lebenslänglichen Fron ermuntert uns Albert Camus. Er sagt: „Der Kampf gegen Gipfel<br />
vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen<br />
Menschen vorstellen.“<br />
Rede zum Zustand des deutschen Journalismus am 2.7.2011 in Hamburg.<br />
128
Von der Medien- zur Stimmungsdemokratie<br />
Von Thymian Bussemer<br />
Wer (…) die gestörten Beziehungen zwischen Politik und Bürgern in den Blick nehmen<br />
will, darf über die Dritten im Bunde nicht schweigen: die Medien. Sie sind es, die in<br />
einer Massen-Demokratie den Diskurs zwischen Politikern und ihren Wählern organisieren<br />
und das gesellschaftliche Streitgespräch moderieren sollen. Und sie sind es,<br />
die das Maß der öffentlichen Erregung über die Politik bestimmen und den Takt der<br />
Empörungswellen vorgeben. Aus dem öffentlichen Diskurs sind sie nicht mehr wegzudenken,<br />
immer prominenter wird ihre Rolle im gesellschaftlichen Diskurs und immer<br />
mehr tragen sie Verantwortung für das Bild des Politischen, welches die Menschen in<br />
ihren Köpfen haben. „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir<br />
leben wissen“, so ein berühmtes Diktum des 1998 verstorbenen Soziologen Niklas<br />
Luhmanns, „wissen wir durch die Massenmedien“. 1 Je komplexer und vernetzter<br />
unsere Welt wird, desto mehr gewinnt dieses Wort an Wahrheit. Während die meisten<br />
Menschen sich über Alltagsvorgänge und das Geschehen in ihrem Nahbereich<br />
noch ganz gut unabhängig von den Medien ein Bild machen können, trifft<br />
Luhmanns Satz auf die Vermittlung politischen Wissens ganz besonders zu. Denn<br />
spätestens seit dem Beginn des Fernsehzeitalters in den 60er Jahren ist Politik<br />
medialisiert, findet die Kommunikation politischer Fakten und Deutungen fast ausschließlich<br />
über die Medien statt.<br />
Dieser zweistufige Fluss der politischen Kommunikation von den Politikern als den<br />
eigentlichen Urhebern politischer Inhalte zu den Medien und erst von da zu den<br />
Bürgerinnen und Bürgern kann nicht ohne Rückwirkungen auf das Bild bleiben, das<br />
sich die Menschen von der Politik machen – aber auch auf die Politik selbst, denn<br />
auch diese verändert sich im Medienzeitalter. Mittlerweile orientiert sich nicht nur<br />
1 Niklas Luhmann: Die Realität der Massenmedien, Wiesbaden 1996 (2. Aufl.), S. 9.<br />
129
die Politikdarstellung, also die Art und Weise, wie Politikerinnen und Politiker ihre<br />
politischen Vorhaben erklären und um dafür um Unterstützung werben, sondern<br />
auch die Politikherstellung, also die Formulierung politischer Programme und Projekte,<br />
an der Art und Weise, wie die Medien diese aufgreifen, präsentieren und<br />
kommentieren. Politik im 21. Jahrhundert wird deswegen nicht mehr allein in der<br />
politischen Arena gemacht, sondern zwischen Politik und Medien ausgehandelt,<br />
bevor sie dem Volk präsentiert wird. (…) Damit gewinnt die Art und Weise, wie die<br />
Medien Politik interpretieren und darstellen, aber auch die Frage, welche Strategien<br />
Politiker im Umgang mit den Medien einschlagen, für die Konstruktion der demokratischen<br />
Öffentlichkeit eine herausgehobene Bedeutung. Denn klar ist: nur<br />
„Randfiguren der holzverarbeitenden Industrie“, wie Willy Brandt den Berufsstand<br />
einmal nannte, den er lange selbst ausgeübt hatte, sind diejenigen keinesfalls, die<br />
tagtäglich Politiker begleiten, ihre öffentlichen Auftritte analysieren, so manche<br />
sensible Information über Handy oder SMS zugesteckt bekommen und über deren<br />
Veröffentlichung entscheiden. Journalisten – oder zumindest solche, die wie die<br />
Berliner Büroleiter und politischen Korrespondenten der großen Zeitungen und<br />
Sendeanstalten nah an den Schaltstellen der Politik einflussreiche Positionen<br />
bekleiden – sind heutzutage nicht nur wichtige Einflussgrößen bei der Modellierung<br />
des Bildes von Politik, sondern auch vielfach selbst politische Akteure, die Forderungen<br />
erheben, in <strong>Talk</strong>shows auftreten und für private oder politische Belange<br />
ihren Einfluss geltend machen. Ob prominente ehemalige Pop-Journalisten, die als<br />
Anwohner des Berliner Nobel-Stadtteils Eichkamp ein Tempolimit auf der AVUS fordern<br />
oder Kommentatoren von großen Illustrierten, die bestimmte Politiker einfach<br />
„weg“ haben wollen: Journalisten verfügen in der Mediengesellschaft über genügend<br />
Einfluss (und zu dem das notwendige kommunikative Fachwissen), um ihre Anliegen<br />
lautstark zur Geltung zu bringen. Da „verhört“ die Bild-Zeitung schon mal den<br />
Arbeitsminister oder ein einflussreiches Hamburger Wochenmagazin fordert brüsk<br />
von Kanzlerin und Vizekanzler, „abzutreten“. Ganz unverhohlen hat die sonst so<br />
seriöse Zeit in der ersten Jahreshälfte 2010 der Bundesregierung gedroht: „Wenn<br />
Schwarz-Gelb sich nach der Sommerpause nicht berappelt hat, dann muss und<br />
wird diese Gesellschaft einen Weg finden, sie loszuwerden.“ 2<br />
Dies zeigt, dass die Medien in unserer Gesellschaft mittlerweile eine Rolle spielen,<br />
die weit über die ihnen <strong>vom</strong> Grundgesetz zugewiesenen Aufgaben hinausgeht.<br />
Ihnen kommt dabei zugute, dass es nach wie vor keine Übereinkunft darüber gibt,<br />
welche Aufgaben der Journalismus in der Demokratie genau hat. Das Grundgesetz<br />
gibt immerhin Anhaltspunkte: Die klassischen Aufgaben der Medien in einer freiheitlichen<br />
Gesellschaft sind Information, Interessensartikulation sowie Kritik und Kon-<br />
2 Bernd Ulrich: Spielen und gurken; in Die Zeit Nr. 28 <strong>vom</strong> 8.7.2010.<br />
http://www.zeit.de/2010/28/01-Bundesregierung<br />
130
trolle. 3 (…) Doch kommen sie dieser Aufgabe wirklich nach? Oder präsentieren die<br />
Medien eine eigene, nach einer höchst selektiven Aufmerksamkeitslogik gestaltete<br />
Welt, in der Nichtigkeiten zum Skandal erhoben werden und echte Skandale unbemerkt<br />
passieren, weil die Damen und Herren Journalisten mit ganz anderen Dingen<br />
beschäftigt sind? Maßen sie sich nicht viele Journalisten das Recht an, so zu agieren,<br />
als ob sie nicht nur Beobachter, sondern auch Akteure aus eigenem Recht wären?<br />
„Einem ehemaligen Chefredakteur der Berliner Zeitung wird ein Bonmot zugeschrieben,<br />
das leider Wahlspruch eines ganzen Berufsstandes sein könnte“,<br />
schreibt die Journalistin Susanne Gaschke in der Zeit. „‚Die Presse ist ja die vierte<br />
Gewalt’, soll der Mann gesagt haben, ‚aber was sind noch mal die anderen drei?’“. 4<br />
Unterm Strich geht es hier um ein klassisches Henne-Ei-Problem, nämlich um die<br />
Frage, ob etwas real ist, weil darüber berichtet wird, oder ob es Berichterstattung<br />
gibt, weil in der Realität etwas Signifikantes passiert ist. Wer also gibt bei der Darstellung<br />
der Welt den Takt vor? „All the news that fit to print“ lautet der legendäre<br />
Wahlspruch der New York Times. Das ist ein hehrer Anspruch mit doppeltem<br />
Boden. Denn die Redaktion der New York Times bekennt sich damit nicht etwa<br />
dazu, alle relevanten Nachrichten zu drucken, sondern erhebt lediglich den<br />
Anspruch, alle Nachrichten zu bringen, die sich zum Druck eignen. Dies verweist<br />
auf die in der Kommunikationswissenschaft oft beschriebene Schleusenwärter-<br />
Rolle der Medien, ihren Einfluss darauf, welche Nachrichten Eingang in die Berichterstattung<br />
finden und welche unterdrückt werden. Und da passt eben die Nachricht<br />
„Mann beißt Hund“ nach wie vor wesentliche besser ins Konzept als das umgekehrt<br />
Geschehen. Schon durch ihre permanenten Selektionsentscheidungen, was<br />
relevant ist und was nicht, formen die Medien entscheidend unser Bild von der<br />
Realität. In Erich Kästners Roman Fabian. Die Geschichte eines Moralisten stellt<br />
jemand die Frage, warum in der Welt immer genau so viel passiert, wie in die Zeitung<br />
passt. Gleich darauf erfindet der Redakteur Münzer Straßenkämpfe in Kalkutta mit<br />
vierzehn Toten und zweiundzwanzig Verletzten. Auf diese dreiste Fälschung angesprochen,<br />
entgegnet Münzer: „Wozu das Mitleid mit den Leuten? Sie leben ja noch,<br />
alle sechsunddreißig, und sind kerngesund. Glauben Sie mir, mein Lieber, was wir<br />
hinzudichten, ist nicht so schlimm wie das, was wir weglassen.“<br />
In dieser Bereitschaft der Medien, all das gierig aufzusaugen, was in ihrer Aufmerksamkeitsschemata<br />
passt, liegen die Ursprünge der politischen Inszenierung. Oft geschieht<br />
heutzutage in der Realität nur etwas, damit schöne Bilder für die Medien entstehen. (…)<br />
3 Vgl.: Maybritt Illner u. Hajo Schumacher: Szenen einer Zugewinngemeinschaft; in: Dies. (Hg.):<br />
Schmierfinken. Politiker über Journalisten, München 2009, S. 9-20, hier S. 14ff.<br />
4 Susanne Gaschke: Das Volk sind wir; in: Die Zeit Nr. 40 <strong>vom</strong> 24.9.2009.<br />
http://www.zeit.de/2009/40/Medienschelte<br />
131
Mit Schirm, Charme und Melone Richtung Abgrund<br />
Die Politik hat mittlerweile ein hohes Maß an Routine darin, solche Bilder als<br />
Placebos echter Handlungen zu produzieren. Ob Gerhard Schröder in Gummistiefeln<br />
bei der Elbe-Flut, Angela Merkel mit tiefem Dekolleté in Bayreuth oder Karl-Theodor<br />
zu Guttenberg inmitten von Flecktarnuniformen in der Transall-Maschine: die Politiker<br />
haben sich auf die Allgegenwart der Kameras längst eingestellt und inszenieren<br />
sich entsprechend. Selbst wenn Guttenbergs Nachfolger Thomas de Maizière bei<br />
Truppenbesuchen demonstrativ eine bonbonfarbene Windjacke trägt, ist auch dies<br />
eine Botschaft. Sie lautet: „Seht her, ich bin ganz anders als mein inszenierungsfreudiger<br />
Amtsvorgänger.“ Zu glauben, dass de Maizière nicht ganz genau weiß, wie er<br />
sich als Verteidigungsminister inszenieren will, wäre naiv. Denn die Politik ist in den<br />
letzten Jahrzehnten telegen geworden und imitiert mehr und mehr die Aufmerksamkeitsregeln<br />
der Medien. Das hat auch Einfluss auf die Auswahl des politischen Personals.<br />
Die besten Aussichten auf ein politisches Spitzenamt hat heute, wer im Fernsehen<br />
gut rüberkommt, zugespitzt formulieren und auch den komplexesten Sachverhalt<br />
in 30 Sekunden umfassend erklären kann. Das ist nicht ganz neu. Schon 1976 hatte<br />
der CDU-Chefstratege und Wahlkampfexperte Peter Radunski gefordert: „Nicht<br />
interne Kompetenz, sondern außenwirksame Ausstrahlung muß die Entsendung von<br />
Unionspolitikern zu Fernsehrunden und Fernsehveranstaltungen aller Art bestimmen.“<br />
5 Wie sehr die Sprache der <strong>Talk</strong>shows und Vorabendsendungen mittlerweile auf<br />
die Politik abfärbt, führte unfreiwillig die niedersächsische SPD vor, die im April 2010<br />
auf der Suche nach einem Landesvorsitzenden und parallel zu einer neuen Staffel von<br />
„Deutschland sucht den Superstar“ ganz unverblümt ein „Kandidaten-Casting“ veranstaltete.<br />
Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Michael Glos stellte nach seinem<br />
Ausscheiden aus dem Bundeskabinett ernüchtert fest: „Es dreht sich heute viel zu<br />
viel um die Show. Als ich in der Politik anfing, gab es zwei Fernsehanstalten. Die Macht<br />
der bewegten Bilder war sehr viel geringer. Es wurde weniger diskutiert, ob jetzt<br />
einer einen gestreiften oder einfarbigen Anzug trug. Ob die Krawatte zum Anzug<br />
gepasst hat. Mein Ehrgeiz war es nie, Krawattenmann des Jahres zu werden.“ 6<br />
Doch auch eine Gegenbewegung ist zu beobachten: Die belagerte Politik zieht sich<br />
von den allgegenwärtigen Medien zurück, verlagert ihr Kerngeschäft in Arkanzirkel<br />
und Hinterzimmer, die vor Medienberichterstattung sicher sind. Wirklich wichtige<br />
Entscheidungen – etwa Gerhard Schröders Entschluss zu Neuwahlen im Mai 2005<br />
oder Angela Merkels Entscheidung, Christian Wulff als Bundespräsidenten zu<br />
nominieren – werden im kleinsten Kreis vorbereitet und dann zu einem genau definierten<br />
Zeitpunkt handstreichartig öffentlich gemacht. Die Politik will mit dieser<br />
Taktik um jeden Preis verhindern, dass Entscheidungen in den Medien wochenlang<br />
5 Zit. n.: Thomas Mergel: Propaganda nach Hitler. Eine Kulturgeschichte des Wahlkampfs in der Bundesrepublik,<br />
Göttingen 2010, S. 199f.<br />
6 Der Spiegel Nr. 8 <strong>vom</strong> 23.2.2011, S. 42.<br />
132
„zerredet“ werden. So führt die immer stärkere mediale Ausleuchtung der politischen<br />
Bühne zu dem paradoxen Effekt, dass das Politische sich zurückzieht, bevor der<br />
Scheinwerfer es erfassen kann. Ob die pikanten Abwägungen der rot-grünen Regierung<br />
im Irak-Krieg im Hinblick auf Überflugrechte und den BND in Bagdad, der konspirative<br />
und nach der Atomkatastrophe in Japan eilig zurückgedrehte Deal von Schwarz-<br />
Gelb mit den Atomkonzernen oder die deutsche Geheimdiplomatie im Hinblick auf<br />
Guantánamo: die Angst der Politik vor Skandalisierung und ritualisierter öffentlicher<br />
Erregung führt unterm Strich zu einem Transparenzverlust demokratischer Politik,<br />
weil delikate Fragen strikt aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden.<br />
Die Politik reagiert auf die neuen Kommunikationsverhältnisse mit einer gefährlichen<br />
Umarmungsstrategie. Eigentlich müsste es ihre Aufgabe sein, Bollwerke gegen die<br />
Überformung des Politischen zu errichten. Sie müsste dafür Sorge tragen, dass nicht<br />
diejenigen, die am lautesten schreien automatisch die sind, die mit Zuwendung<br />
bedacht werden, dass Wahrheitskriterien nicht von Aufmerksamkeitskriterien überlagert<br />
werden, dass politische Positionen nicht gänzlich hinter der Personalisierung<br />
verschwinden und dass der Meinungsstreit unter möglichst breiter Inklusion geführt<br />
wird. Doch statt für die Verteidigung eines politischen Diskursraums zu kämpfen, der<br />
diesen Namen auch verdient, passt die Politik sich gleich doppelt an – an die selektiven<br />
Perspektiven der Medien und die nur zyklische, aber hochgradig von Interessen<br />
geleitete Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger. Statt sich also der allgemeinen<br />
Erregungsflut entgegenzustemmen und für die Versachlichung der Diskussion zu<br />
werben, versucht die Politik immer häufiger, sich an die Spitze der Welle zu setzen.<br />
Dies zeigt, dass sie nach wie vor kein Mittel gefunden hat, um den Inszenierungserfordernissen<br />
der Medien und der Gelangweiltheit des Publikums an komplexen<br />
Abwägungen ein eigenes, authentisches Bild des Politischen entgegenzusetzen,<br />
das in deren Augen Bestand haben kann. Um überhaupt Zugang zur Öffentlichkeit<br />
zu finden, imitiert die Politik die Aufmerksamkeitsregeln der Medien – oft um den<br />
Preis der Selbstaufgabe. Denn sie verzichtet so nicht nur darauf, eigene Themen im<br />
gesellschaftlichen Diskurs zu setzen, sondern trägt zur weiteren Erosion der Demokratie<br />
bei, weil die Diskrepanz zwischen Reden und Handeln auf diese Weise immer<br />
größer wird, was die Glaubwürdigkeit der Politik stetig weiter untergräbt.<br />
Die Lösung von Sachproblemen gerät dabei zunehmend in den Hintergrund, denn<br />
medialisierte Politik ist immer verkürzte Politik mit einem besonderen Fokus auf<br />
das Symbolische an der Spitze, nicht mit Blick auf die Veränderung in der Fläche.<br />
Die Medien sind mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln der persönlichen<br />
Beobachtung, der unmittelbaren Präsenz am Ort des Geschehens und der Konzentration<br />
auf die politischen Eliten nicht in der Lage, die Bandbreite des Politischen,<br />
das sich an vielen Orten gleichzeitig abspielen kann und kein eindeutiges Raum-<br />
Zeit-Personen-Kontinuum hat, hinreichend zu erfassen. Die eigentliche Prozesslogik<br />
133
des Politischen kann also von den Medien nicht adäquat abgebildet werden, der<br />
politische Kern bleibt für sie unsichtbar. Zudem sind die Medien so darauf konditioniert,<br />
die Inszenierungsebene der Politik zu deuten und zu dekonstruieren, dass<br />
ihr die Herstellungsebene der Politik regelmäßig aus dem Blick gerät. Weil sie<br />
immer nur versuchen, den A-Promis von den Lippen abzulesen, weil ihre Arbeitsweise<br />
prinzipiell darin besteht, Sachkonflikte zu personalisieren, um diese für das<br />
breite Publikum verständlich zu machen, übersehen sie den Ort der eigentlichen<br />
Politikherstellung. Die Medien suchen nicht dort nach politischer Gestaltungsmacht,<br />
wo diese ganz regulär und verfassungskonform verortet ist: am unteren Ende in<br />
den Ortsvereinen der politischen Parteien und den regionalen Parlamenten und am<br />
oberen in den höheren Etagen der Ministerialbürokratie, zum Beispiel bei jenen<br />
drei Dutzend Spitzenbeamten, die im Gegensatz zu den Ministern und Parlamentarischen<br />
Staatssekretären ihre Häuser wirklich im Griff haben. Die Medien fokussieren<br />
aber immer alles auf die politische Spitze – selbst wenn diese von vielen<br />
Vorgängen gar keine Kenntnis hat. Nico Fried, erfahrener Parlamentsredakteur der<br />
Süddeutschen Zeitung, räumt dies in einem Interview mit Leif Kramp und Stephan<br />
Weichert offen ein: „Wenn wir ein Defizit haben in der politischen Berichterstattung<br />
insgesamt, dann besteht das in etwas ganz anderem: Nämlich dass den Leuten, und<br />
das ist auch ein bisschen unser Versäumnis, überhaupt nicht klar ist, wie viel an<br />
Politik jenseits dessen, was berichtet wird, noch alles stattfindet. Damit meine ich<br />
Abgeordnetenausschüsse, Gesetzgebungsarbeit und solche Dinge.“ 7 (…)<br />
Während es also der Politik nicht gelingt, ihre eigenen Anliegen adäquat in die<br />
Medien zu tragen, gilt umgekehrt, dass die Medien nicht in der Lage sind, ein konsistentes<br />
Bild des Politischen zu zeichnen. Diesen Effekt macht sich die Politik<br />
zunutze, um die Medien auf der Vorderbühne mit den von ihnen verlangten Inszenierungen<br />
zu bedienen, aber im Hinterzimmer ihren ureigenen Code, ihr eigenes<br />
Programm weiter zu verfolgen. Die Politik schaltet also den Autopiloten ein, ignoriert<br />
die Medien nach Möglichkeit ignoriert und sucht die Referenzpunkte für die Prüfung<br />
ihrer Realitätstüchtigkeit vor allem innerhalb der politischen Klasse selbst. Sie<br />
tritt damit den Weg ins Biotop an – oder den in den Bunker. Dort werden dann<br />
Konzepte wie Merkels berühmtes „Durchregieren“ oder Schröders „Politik der<br />
ruhigen Hand“ geboren, die vor allem eines beweisen sollen: dass die Politik auch<br />
in feindlicher Umwelt noch aktionsfähig ist.<br />
Deswegen lautet die eigentliche Frage für die Zukunftsfähigkeit unserer Demokratie,<br />
wie wir wieder zu einer Diskursordnung kommen, die einen entschiedenen Gegenpunkt<br />
zur Stimmungsdemokratie setzt, das allgemeine Anspruchs- und Servicedenken<br />
hinterfragt und ernsthafte Versuche zur Rehabilitierung des Politischen unternimmt.<br />
7 Zit. n.: Leif Kramp u. Stephan Weichert: Journalismus in der Berliner <strong>Republik</strong>. Wer prägt die politische<br />
Agenda in der Bundeshauptstadt? Studie für das Netzwerk Recherche, Juni 2008, S. 38.<br />
134
Entscheidend ist dafür, wie sich das Politische und das Mediale im 21. Jahrhundert<br />
zueinander verhalten werden. Ohne Frage bedrängen die Medien mit ihren bunten<br />
Bildern, ihren Verflachungen und Personalisierungen die Demokratie. Doch das<br />
Politische ist noch da. Es muss nur mühsam unter einer dicken Schicht unnützer<br />
Ablagerungen hervorgeholt werden. Dabei ist Pragmatismus angesagt. Bürger,<br />
Politiker und Journalisten müssen die übermächtig werdenden Erregungswellen<br />
hinter sich lassen und die vorherrschenden Schwarz-Weiß-Zeichnungen der Realität<br />
durch ein ambivalenteres Bild der Welt ersetzen, weil nun einmal die Welt weitaus<br />
ambivalenter und komplexer ist, als Agenturmeldungen oder Präsidiumsbeschlüsse<br />
dies nahe legen. Alle am öffentlichen Diskurs Beteiligten müssen sich von der<br />
apodiktischen Sicht eines letztlich von Eigeninteressen getriebenen „so ist es“<br />
lösen und versuchen, die Welt in ihrer ganzen Kompliziertheit in den Blick zu nehmen.<br />
Das alles hilft nicht nur gegen die Politikverdrossenheit, weil sich die Menschen<br />
plötzlich ernst genommen fühlen, sondern es macht auch die Frage nach<br />
dem „Wie soll es sein?“ viel einfacher. Vor allem aber: Sobald über ein Problem<br />
unter Einbeziehung aller breit und offen diskutiert wird, lösen sich die Verhärtungen,<br />
entsteht Verständnis für die Position und Situation des jeweils anderen. (…)<br />
Wichtig für die öffentliche Debatte der Zukunft erscheint, dass alle Beteiligten sich<br />
als Diskursteilnehmer verstehen, nicht als Einpeitscher, Durchzieher und Abschießer.<br />
Wer sich öffentlich zu Wort meldet, muss sich auch den Geltungsansprüchen seiner<br />
Aussagen unterwerfen, muss seinen Willen zur Richtigkeit und auch Wichtigkeit<br />
seiner Äußerungen im Zweifelsfalle auch durch seine Taten beweisen. Da Verständigung<br />
überhaupt nur möglich ist, wenn wir uns gegenseitig glauben, dass wir<br />
es ernst meinen und den jeweils anderen als Partner akzeptieren, spielt die Tonalität,<br />
mit der Politiker, Bürger und Medien aufeinander zugehen, eine herausgehobene<br />
Rolle. Alle drei Parteien müssen künftig acht geben auf die Verletzungen, die<br />
sie sich in der Auseinandersetzung zufügen. Barack Obama hat am 13. Januar 2011<br />
bei der Trauerfeier für die Opfer des Amoklaufs von Tuscon einen bemerkenswerten<br />
Satz gesagt: „In Zeiten eines sehr polarisierten Diskurses sollten wir wieder in<br />
einer Art und Weise miteinander reden, die heilt und nicht verletzt. Ich bin überzeugt,<br />
wir können es besser.“ 8<br />
Aktualisierter Auszug mit freundlicher Genehmigung des<br />
Klett-Cotta Verlags aus: „Die erregte <strong>Republik</strong>.<br />
Wutbürger und die Macht der Medien“, Stuttgart: Klett-Cotta 2011, 253 S.<br />
Dr. Thymian Bussemer arbeitet als Manager bei einem niedersächsischen Automobilhersteller.<br />
8 Zit. n. Frankfurter Allgemeine Zeitung <strong>vom</strong> 14.1.2011, S. 1.<br />
135
Rede zur Lage des Journalismus<br />
Von Frank A. Meyer<br />
Was ist das Mantra dieser Veranstaltung? Das Mantra, um das es bei dieser Rede<br />
geht, lautet: Recherche, Recherche, Recherche. Recherche ist auch mein Zauberwort,<br />
mehr noch: Es stand am Anfang meiner Initiation als Journalist.<br />
Damals in den frühen sechziger Jahren war das Handwerk des Recherchierens noch<br />
nicht identisch mit dem journalistischen Handwerk. Parteilich ausgerichtete Zeitungen<br />
beherrschten die Presselandschaft. Aber wir jungen Schweizer Journalisten<br />
lasen den Spiegel. Und wir entdeckten darin Wort Recherche. Und damit entdeckten<br />
wir, dass man wichtige Menschen des öffentlichen Lebens anrufen und befragen<br />
kann, ja befragen muss. Und dass man überhaupt gezielt nachforschen kann, nach<br />
den Hintergründen von Politik, Wirtschaft und Kultur.<br />
Wie das so war, möchte ich Ihnen in einer kurzen Anekdote schildern: Es muss<br />
1964 oder 1965 gewesen sein und ich 20 oder 21, da erdreistete ich mich, wegen<br />
einer Auskunft den Generalstabschef der Schweizer Armee anzurufen – und<br />
zwar abends um 21 Uhr. Mir war mulmig dabei. Ich wusste, so etwas gehört sich<br />
nicht, schon gar nicht nach 18 Uhr. Ich rief trotzdem an, weil ich doch auch ein bisschen<br />
Spiegel-Journalist sein wollte. Der Generalstabschef der Schweizer Armee –<br />
damals noch eine der größten Landarmeen Europas – verlor komplett die Fassung:<br />
So etwas sei ihm noch nicht untergekommen, blaffte er mich in Kasernenhof-Ton<br />
an; was ich mich erfreche; und überhaupt: wer ich denn sei; ich habe keinen<br />
Anstand; seine Familie wolle ihre Ruhe. Doch dann gab er mir die Auskünfte, die<br />
ich brauchte.<br />
Die Anekdote klingt in den Ohren jüngerer Kollegen wohl wie erfunden. Aber so war<br />
es wirklich vor fast einem halben Jahrhundert. Inzwischen ist Recherchieren selbstverständlich.<br />
136
Doch wenn ich das so sage, zögere ich. Ist Recherchieren wirklich selbstverständlich?<br />
Und was verstehen wir unter Recherchieren?<br />
Der Begriff ist der französischen Sprache entnommen. Ich habe zum französischdeutschen<br />
Dictionnaire gegriffen und recherchiert. Recherchieren bedeutet danach:<br />
wiedersuchen, aufsuchen, forschen nach etwas, streben nach etwas, trachten nach<br />
etwas, aber auch den Umgang suchen oder entgegenkommen. Recherchieren ist<br />
der Schlüsselbegriff des Journalismus.<br />
Doch sind wir tatsächlich beseelt in unserer Arbeit von einem so umfassenden<br />
Verständnis des Recherchierens? Was tun wir, wenn wir recherchieren? Wir recherchieren<br />
die neuesten Sätze von Angela Merkel, die neuesten Zahlen des griechischen<br />
Debakels, die neuesten Trends der Dax-Unternehmen. Wir recherchieren von Minute<br />
zu Minute. Wir hängen am Tropf der Information, die wir anreichern mit dem, was<br />
wir bei Wikipedia finden und über Google zugeliefert bekommen. Die Schnelligkeit<br />
der Recherche ist unser Berufsstolz.<br />
Wir fühlen den Puls der Zeit. Ja wir sind der Puls der Zeit.<br />
Jeden Abend, wenn ich koche, richte ich es so ein, dass ich dabei die Nachrichten<br />
von Deutschlandradio höre, neben mir liegt mein Blackberry, der mir mit Blinken<br />
signalisiert, dass es etwas Neues gibt, im Salon läuft n-tv, um 19 Uhr im ZDF heute.<br />
Trotz meiner Abhängigkeit <strong>vom</strong> Stoff, der unser Journalistenleben bestimmt, habe<br />
ich lichte Momente. Und da befallen mich dann doch Zweifel: Werden wir dem Wert<br />
„recherchieren“, im Sinne von wiedersuchen und nachforschen, wirklich gerecht?<br />
Oder verengen wir den Begriff allzu sehr und manchmal auf fatale Weise auf das<br />
Nächstliegende, auf die Verfolgung der minütlichen, stündlichen, täglichen Ereignisse?<br />
Die elektronischen, vor allen die digitalen Medien zwingen uns die Geschwindigkeit<br />
auf. Wer nicht mithält, den bestraft der Markt. Das permanente Jetzt, Jetzt, Jetzt<br />
unterwirft unseren Beruf einer geradezu darwinistischen Auslese: Der Schnellere<br />
ist der Stärkere, der Stärkere, weil Schnellere überlebt. Längst sind wir kampfgestählt<br />
in diesem Verdrängungsprozess.<br />
Doch was muten wir unseren Lesern zu?<br />
Ja, betrachten wir uns einmal von außen. Für die Bürgerinnen und Bürger, für die<br />
Gesellschaft, für die Politik, für die Wirtschaft bestimmen wir die Zeit. Denn wir<br />
bestimmen den Takt, in dem die Ereignisse ablaufen. Wir sind es, die den Ereignissen<br />
Zeit geben, eine Zeit einräumen; in der Aviatik nennt man das: einen Slot zuteilen.<br />
Eine Minute, eine Stunde, einen Tag, eine Woche. Das auf die Menschen Einstür-<br />
137
zende – das Bestürzende –, das sind wir. Denn wir bringen es hervor und es liegt in<br />
unserer Macht, das aktuelle Spiel abzupfeifen, um ein neues anzupfeifen.<br />
Das ist unser Problem. Und das Problem der Menschen mit uns: Wir sind großartige<br />
Leistungsträger der totalen medialen Vernetzung dieser Zeit und dieser Welt, wir<br />
sind omnipräsent rund um die Uhr und rund um den Globus. Wer aber omnipräsent<br />
ist, erweckt auch rasch den Eindruck der Omnipotenz – übermächtig zu sein, eine<br />
Macht zu sein, der Leser, Zuhörer und Zuschauer, Bürgerinnen und Bürger ausgeliefert<br />
sind.<br />
Wenn wir Journalisten früher von Macht sprachen, meinten wir immer die Macht<br />
der Anderen, die Macht der Wirtschaft oder die Macht der Politik oder die Macht<br />
der Kirche. Die Mächtigen waren immer die Anderen. Nie wir! Wir betrachteten uns<br />
ganz selbstverständlich und nicht ohne Stolz als Kontrolleure der Macht und als<br />
deren Widersacher, im Falle autoritärer Macht natürlich als Feinde von Despoten<br />
und Diktatoren. Denn wir waren – wir sind – die Guten.<br />
Doch unsere totale Präsenz im Leben der Menschen hat aus uns Mächtige ge macht,<br />
eine Macht, die manche als größte Macht von allen empfinden. Es ist die Macht<br />
über die Slots der Ereignisse, über das Stakkato der Zeit. Die beschleunigte Zeit ist<br />
unsere Schöpfung.<br />
Beschleunigte Zeit aber bedeutet, dass der ganz einfache Mensch, der morgens zur<br />
Arbeit geht, vorher noch sein Kind in die Schule bringt, am Abend müde nach Hause<br />
kommt, sich um private Dinge kümmert, sich Sorgen macht um seine Familie, um<br />
sein berufliches Fortkommen, um die Schulnoten seiner Kinder – dass dieser ganz<br />
normale Mensch durch uns völlig überfordert ist.<br />
So viele Katastrophen, wie wir herbeischreiben – von den Eisbären, denen demnächst<br />
das Eis fehlt, über die ölverklebten Wasservögel bis zur Seuche Ehec – können<br />
Normalbürger gar nicht konsumieren.<br />
Wenn ich sage konsumieren, dann sage ich bewusst nicht: begreifen. Doch darum<br />
ginge es gerade: Dass die Menschen begreifen. Nehmen Sie dieses Verb auseinander.<br />
Lassen Sie die erste Silbe weg und das Verb wird ganz sinnlich: greifen. Etwas mit<br />
Händen greifen können. Einen Vorgang mit den Händen greifen können, ihn förmlich<br />
haptisch spüren. Das wäre doch, was wir möglich machen müssten.<br />
Wir stellen – noch so eine Katastrophe – mit Sorge fest, dass immer mehr Menschen<br />
sich der Beteiligung an der Demokratie verweigern: die Nichtwähler. Wir suchen die<br />
Ursache bei den Politikern. Was machen die Politiker falsch? Wir bemängeln, messerscharf,<br />
das Fehlen von Charisma, von Entscheidungsfreude, von Überzeugungskraft.<br />
138
Das ist nicht falsch. Doch in Wahrheit gehören die Politiker zum Spiel, dessen Tempo<br />
und auch Regeln wir mit unserer zeitsetzenden Macht bestimmen. Der Klick ist<br />
unser Kick. Wir wählen auch die Protagonisten der Gesellschaft danach aus: Wer<br />
Klicks generiert, genießt unsere Aufmerksamkeit. Die Langsameren, die Bedächtigeren<br />
– die Nachdenklicheren! – aus Politik, Wirtschaft und Kultur, fallen aus unserem<br />
nervösen Aufmerksamkeitsraster.<br />
Nervös sind wir. Hypernervös.<br />
Hypernervös sind deshalb die Menschen, hypernervös ist die Gesellschaft.<br />
Sind hypernervöse Zeiten gute Zeiten?<br />
Ich glaube es ist Zeit, zu entschleunigen. Wer aber kann entschleunigen? Die Herren<br />
der Zeit. Also wir. Und wie können wir entschleunigen? Indem wir den Begriff der<br />
Recherche so umfassend wie möglich interpretieren. Dazu müssen wir die Zeit als<br />
Raum zurückerobern. Es gibt dafür ein wunderbares Wort: Denkpause. Leider wird<br />
dieser Begriff oft falsch interpretiert. Als Pause <strong>vom</strong> Denken. Gemeint ist aber die<br />
Pause fürs Denken. Dazu brauchen wir in unseren Redaktionen Pausenzeiten und<br />
Pausenräume: die Möglichkeit, nachzudenken und zu recherchieren im Sinne von<br />
Nachforschen – Nachforschen in unseren Gedanken: Denn was uns zur Aktualität<br />
gleich in den allerersten Sekunden einfällt, ist ja wohl nicht das Einzige, was es<br />
dazu zu sagen gibt.<br />
Wenn ich schon bei Beispielen bin, gebe ich Ihnen ein inzwischen schon klassisches:<br />
Das Versagen der Medien in der Finanzkrise.<br />
Noch heute wundern sich Kollegen aus Wirtschaftsredaktionen, weshalb ihnen<br />
denn nichts aufgefallen ist an der perversen Entwicklung der globalisierten Finanzwirtschaft<br />
in den neunziger Jahren. Sie grübeln: Warum haben wir die windigen<br />
Derivate nicht durchschaut, ebensowenig das faule US-Hypothekengeschäft, oder<br />
den skrupellosen Handel mit Unternehmen, die gekauft wurden, um sie zu filettieren<br />
und anschließend als Einzelteile lukrativ weiter zu verkaufen. Warum fanden wir<br />
das alles in Ordnung, ja sogar toll und effizient und sahen es als Ausdruck höchster<br />
Managementkunst? Warum, warum, warum?<br />
Was die Welt in die Finanzkrise führte, war mit Recherchearbeit, die sich lediglich<br />
aufs Wirtschaftliche beschränkt, gar nicht vorauszusehen. Es wäre nur zu erkennen<br />
gewesen, wenn die Journalisten ihren Blick geweitet hätten; wenn sie das Recherchieren<br />
als Nachforschen und Erforschen betrieben hätten; wenn sie verstanden<br />
hätten, dass das Treiben in London und New York und Zürich nicht nur von wirtschaftlicher,<br />
sondern ebenso von gesellschaftlicher, ja von kultureller Bedeutung<br />
war – und immer noch ist.<br />
139
Die Wirtschaftsjournalisten hätten gewissermaßen den kulturell-politischen Blick<br />
haben müssen, den Blick fürs Ganze. Dann hätten sie auch rechtzeitig – und nicht<br />
erst nach dem Crash! – erkannt, dass die fundamentalistische Ideologie <strong>vom</strong><br />
Markt, der alles regelt, der belohnt und bestraft, dem also göttliche Bedeutung<br />
zugeschrieben wird: dass dieser Ökonomismus nichts anderes war und nichts<br />
anderes ist als ein Marxismus mit umgekehrten Vorzeichen: Statt alles durch den<br />
Staat, alles gegen den Staat.<br />
Ich habe – erlauben Sie mir ein klitzekleines Selbstzitat – 1997 über eine meiner<br />
Kolumnen den Titel gesetzt: „Vom Marxismus zum Marktismus.“ Dafür wurde ich von<br />
einem Schweizer Wirtschaftsmagazin des musealen Ökonomie-Verständnisses<br />
bezichtigt – von hoch oben herab, wo ja damals die Wirtschaftsjournalisten zu thronen<br />
pflegten.<br />
Es war rechtzeitig möglich zu sehen, wohin uns die neuliberale Hybris führte – diese<br />
leere Lehre, die so wunderbar passt für die betriebswirtschaftlichen Simpel, die<br />
gestern, heute und wohl leider auch morgen zahlreiche Chefetagen bevölkern.<br />
Das Versagen der Medien in der Finanzkrise wäre durch Recherche zu vermeiden<br />
gewesen: durch das Streben danach, die Ereignisse, die Entwicklung, die Zeit kulturell<br />
zu verstehen.<br />
Nur wer vor 2008 von den kulturellen Werten ausging, die unsere Gesellschaft<br />
immer noch, und hoffentlich in alle Zukunft zusammenhalten, hatte und hat auch<br />
heute den Blick für die Zerstörung der Werte durch eine völlig amoralische Ideologie.<br />
Das klingt hart. Aber das soll es auch.<br />
Wir sind nicht fertig mit der Finanzkrise. Und die Finanzkrise ist nicht fertig mit uns.<br />
Die Täter höhnen heute über die Staaten und über die Steuerbürger, durch die sie<br />
gerettet wurden.<br />
Übrigens waren es ja nicht nur die Wirtschaftsjournalisten, die sich dem Größenwahn<br />
dieser „Masters of the Universe“ hingegeben haben. Auch die politischen Journalisten<br />
und die People-Journalisten feierten die neuen Machthaber. Alles, was damals<br />
groß schien, wurde großartig dargestellt.<br />
Es liegt eine Zeit der Gigantomanie hinter uns Medienmachern. Die Zeit der größten<br />
Gewinne, der größten Mergers, der größten ökonomischen Imperien, von den<br />
größten Wirtschaftsführern erobert und mit größter Kühnheit – heute wissen wir<br />
mit größter Vermessenheit – noch größer gemacht. Es war auch die Zeit des größten<br />
Luxus: der größten Gehälter, größten Villen, größten Geländewagen, größten Yachten,<br />
größten Partys.<br />
140
Wir schwelgten mit in diesem Größenwahn. Geschmeichelt, wenn wir dabei sein<br />
durften, wenn wir mit einem der Allergrößten, mit einem dieser Riesenmänner, zu<br />
Tische sitzen durften. Die Verleger lancierten Hochglanz-Hofzeitschriften für den<br />
neureichen Geldadel, denn nach Adel dürstet es die Deutschen ja allemal. Vanity<br />
Fair und Park Avenue hießen die Huldigungsblätter.<br />
Was all dies für die ganz normalen Menschen bedeutete, das hat uns doch wenig<br />
gekümmert. Wir machten sogar die Diffamierung dieser ganz einfachen, dieser<br />
ganz normalen Menschen mit. Indem wir zum Beispiel Arbeitslosigkeit plötzlich als<br />
individuelles Versagen denunzierten, nicht mehr als Versagen der Gesellschaft.<br />
Jeder Bürger hatte die Pflicht, eine Ich-AG zu sein, sogar der Staat sollte wie ein<br />
Wirtschaftsunternehmen geführt werden. Über Politiker, die es anders wollten,<br />
haben wir uns amüsiert, im harmlosesten Fall.<br />
Sind wir heute weiter mit unserer Recherche, mit unserer „Recherche du temps<br />
perdu“? Denn es war ja verlorene Zeit. Nicht einmal die Aktionäre gewannen dabei,<br />
sondern wurden ärmer. Und die Volkswirtschaft ebenfalls. Allein die Hütchenspieler<br />
der Finanzwirtschaft wurden durch ihre maßlosen Boni reich und reicher.<br />
Decken wir diese Zusammenhänge heute auf, wenn wir über Griechenland, über<br />
die unzuverlässigen und trägen und sonnenverwöhnten Hellenen reden?<br />
Ich glaube, einiges hat sich doch verbessert. Jedenfalls hier in Deutschland, wo ich<br />
nicht nur den Vorzug Berlins genieße, jeden Tag fünfzig interessante Events zu verpassen,<br />
sondern wo ich in Zehlendorf auch meine Steuern zahle.<br />
Ich weiß, ich weiß, sie alle zieht es in die Schweiz, das Sehnsuchtsland der Deutschen.<br />
Und auf der Autobahn gegen Basel herrscht Gedränge. Ich bin der Gegenverkehr.<br />
Bei meiner Übersiedlung hatte ich angenommen, die anderen seien die Geisterfahrer,<br />
doch nein, der Geisterfahrer war ich.<br />
Trotz fortschreitender Integration pflege ich immer noch einen Blick von außen auf<br />
die deutschen Verhältnisse, vor allem auf die deutschen Medien. Ich habe die großen<br />
gesellschaftlichen Debatten der vergangenen 12 Monate mit größter Aufmerksamkeit<br />
verfolgt, vorab und täglich frühmorgens in sechs Zeitungen: die Sarrazin-Debatte,<br />
die Guttenberg-Debatte und die AKW-Debatte.<br />
Ich möchte einige Tageszeitungen nennen, die mich dabei ganz besonders beeindruckten.<br />
Die „Süddeutsche Zeitung“ natürlich, mit ihren Denk- und Wortkünstlern<br />
Kister oder Prantl; die „Frankfurter Allgemeine“ mit ihrer kategorischen Forderung<br />
nach bürgerlicher Tugend im Fall Guttenberg; „Die Welt“ mit ihren journalistischen<br />
141
Einfällen, quer zum Strom, manchmal gegen den Strom. Aber auch die Berliner<br />
Blätter, zum Beispiel der „Tagesspiegel“ mit seinem böspräzisen Castorff. Doch<br />
was wäre die deutsche Zeitungswelt ohne „Die Zeit“? Einst hanseatisch säkular,<br />
heute eher religionssüchtig, doch immer noch ein intellektuelles Paket, wie man es<br />
in andern Demokratien vergebens sucht. Schließlich „Der Spiegel“. Vielleicht bin<br />
ich hier sein ältester Leser: Ich begann mit der Lektüre im Alter von 16 Jahren und<br />
habe seither kaum eine Nummer verpasst. „Der Spiegel“ gehört zu meinem ganz<br />
persönlichen Bildungsroman.<br />
Ich könnte, ich müsste noch so viele Titel, Formate und Kollegen nennen, auch aus<br />
den elektronischen Medien, zum Beispiel das Magazin „report“ der ARD, oder<br />
Klaus Richter mit dem Magazin „Frontal“ des ZDF.<br />
Deutschland kann stolz sein auf die Vielfalt seiner Medien. Aber ich füge ich<br />
sogleich hinzu: Sie alle tragen große Verantwortung für diese Medien-Landschaft,<br />
die wir in der Schweizer – knorrige Bergler, wie wir uns so gern sehen – als „Bannwald“<br />
bezeichnen: als „Bannwald der Demokratie“. Der Bannwald hält die Lawine ab.<br />
Der Begriff „Bannwald“ trifft die Sache. Die Demokratie bedarf des Schutzes. Nicht nur<br />
der Verteidigung, wenn sie akut bedroht wird, sondern der stetigen Hege und Pflege.<br />
Wir bestimmen nicht nur das Tempo der total vernetzten Nachrichtengesellschaft,<br />
wir bestimmen auch die Themen und die Debatte über diese Themen. Und schließlich<br />
bestimmen wir, wie tief eine Debatte greifen soll.<br />
Mit der Debatte meine ich nun wahrlich nicht den Laber-Zirkus der endlos und Tag<br />
und Nacht aneinander gereihten <strong>Talk</strong>runden – an denen auch ich gelegentlich mit<br />
Lust teilnehme (in der Schweiz moderiere ich sogar eine eigene). Ich meine die<br />
Debatte dort, wo sie in Reflexion umschlägt: in den gedruckten Medien.<br />
Wir alle wissen: Schreiben für die Zeitung oder für die Zeitschrift bedeutet: Anhalten.<br />
Der Schreibprozess, der dann auch schwarz auf weiß bestehen muss, ist verbunden<br />
mit Verlangsamung, mit Zögern, mit Nachdenken, mit Verwerfen, mit Korrigieren,<br />
mit Neuansetzen, sogar mit Ängsten vor dem leeren Bildschirm – früher war es das<br />
leere Blatt. Ein schreckliches Handwerk. Ein wunderbares Handwerk. Wenn das<br />
Werk vollbracht ist.<br />
Dies ist das Wesen der Zeitungs- und Zeitschriftenkultur: Der Schreiber erforscht<br />
– recherchiert – seinen Gegenstand. Er erforscht sogar sich selbst, nämlich seinen<br />
Standpunkt. Er erforscht sogar sein Vokabular. Seine Tonalität. Er ist ganz verbunden<br />
mit diesem kreativen Prozess. Schreiben bedeutet Denken. Allein schon daran zu<br />
142
denken, dass das Geschriebene gedruckt wird, fordert die Vertiefung des Denkens,<br />
seine Ausweitung.<br />
Online, das schnellste Medium ist auch das flüchtigste. Es verfügt zwar sehr wohl<br />
über Qualitäten: in der Nachricht. Es bildet den ständigen Nieselregen der News,<br />
der auf den Konsumenten niedergeht, ihn nervös und hypernervös macht, wie es<br />
eben ein Eisregen stets tut.<br />
Der gedruckte Journalismus – nicht der ausgedruckte – fügt die Informationspartikel,<br />
die kein Bürger mehr überblickt, so zusammen, dass daraus Ordnung wird. Ordnung<br />
des Denkens und des Wissens.<br />
Ich habe mich als Zeitungsleser sehr delektiert an der Guttenberg-Debatte. Weil es<br />
dort um mehr ging als um die gefälschte Doktorarbeit, was ja nur dank des Internets<br />
so präzis zu eruieren war. Es ging sogar um sehr viel mehr. Nämlich um unverzichtbare<br />
Grundsätze und Tugenden – um die Kultur unserer bürgerlichen Gesellschaft.<br />
Die deutschen Printmedien haben diese Herausforderung vorzüglich gemeistert:<br />
durch Berichterstattung, Analyse, Wertung, auch Empörung und Polemik, was ja<br />
nun alles zum Journalismus in einer freiheitlichen Gesellschaft dazugehört.<br />
Aber das ist inzwischen schon bundesrepublikanische Geschichte.<br />
Gegenwärtiger ist ein Phänomen, das wir „Wutbürger“ nennen und das weit über<br />
den Protest gegen Stuttgart 21 hinausgeht. Denn man kann die jungen Menschen,<br />
die in Griechenland, in Spanien, in Italien, auch in Frankreich auf die Straße gehen,<br />
um ihrer Empörung über die herrschenden Verhältnisse Ausdruck zu geben, auch<br />
zu dem zählen, was in Deutschland „Wutbürger“ heißt.<br />
„Wutbürger“ ist allerdings das falsche Wort. Denn es reduziert den Widerstand von<br />
Bürgerinnen und Bürger, zumal von jungen Menschen auf deren Emotionen. Ich<br />
glaube, dass die Menschen auf der Straße nicht nur wütend sind, sondern sich sehr<br />
wohl Vieles überlegen. Übrigens haben wir das soeben sehr exemplarisch in Italien<br />
erlebt, wo vor allem junge Leute dem Regime Berlusconi in drei Referendumsfragen<br />
eine vernichtende Abfuhr erteilten. Sie wurden von keinem Politiker angeführt. Sie<br />
haben das Richtige und Wichtige aus sich heraus getan.<br />
Dieser europäische Widerstand muss unser Thema sein. Nicht jetzt, jetzt, jetzt und<br />
abgehakt, weil ja die Sommerpause bevorsteht. Denn es geht bei der demokra -<br />
tischen Unruhe, die Millionen Europäer erfasst hat, nicht mehr um das, was auf<br />
Französisch so treffend als politique politicienne – als Politiker-Politik – umschrieben<br />
143
wird. Es geht um viel mehr. Es geht um die Kultur unserer europäischen Gesellschaft.<br />
Um die politische Kultur, um die wirtschaftliche Kultur, um die Werte, die Politik<br />
und Wirtschaft bestimmen, oder eben leider nicht mehr bestimmen – und deshalb<br />
erneut zu bestimmen wären.<br />
Da müssen wir hinsehen, am besten hingehen. Mit Wikipedia und Google allein<br />
lässt sich dieses Phänomen nicht recherchieren. Man muss es spüren. Man muss<br />
zusammensitzen mit dem Demonstranten. Man muss nächtelang mit ihnen reden.<br />
Man muss sie reden lassen. Man muss sie erforschen, ergründen – recherchieren!<br />
Ohne uns ist alles nichts in der Demokratie. Das ist ein sehr selbstbewusster Satz<br />
aus dem Munde eines Journalisten. Aber so ist es. Wir geben der demokratischen<br />
Debatte die Sprache.<br />
Wir geben den Bürgerinnen und Bürgern die Sprache. In unseren Debatten muss<br />
deshalb auch eine Sprache zu lesen und zu hören sein, die für den Citoyen nützlich ist,<br />
weil er sie verwenden kann: für seine Ideen, für seine Kritik, für seine Empörung.<br />
Gerade für den Protest spielen die Internet-Medien eine große, eine befreiende<br />
Rolle: Indem sie Menschen zum Protest vernetzen. Doch Ideen, Kritik und Protest<br />
brauchen mehr als Vernetzung. Sie brauchen Reflexion. Und damit sind wir wieder<br />
bei unserer schriftlichen und gedruckten Kultur.<br />
Ich weiß, wir reden unablässig über „Online“ und „Free Content“. Wir veranstalten<br />
„Workshops“ und „Panels“ über die Krise der gedruckten Medien. Die Medienwissenschaftler<br />
haben sich unserer Branche bemächtigt. Sie verkünden das nahe Ende<br />
des gedruckten Wortes. Wir gucken ihnen mit schreckgeweiteten Augen in die professoralen<br />
Nasenlöcher – und glauben auch noch, was sie sagen.<br />
Und so werden unsere Verlage durch die Rollkofferkommandos der „Controller“<br />
und „Consultans“ gestürmt, die uns mit „Powerpoint Presentations“ erläutern,<br />
was der „Content for People“ pro Seite kosten darf, vor allem, dass der gedruckte<br />
„Content for People“ zu teuer sei, weil der „Consumer“ ja online auf die Gratisportale<br />
ausweichen könne.<br />
Warum beteiligen wir uns eigentlich an dieser Debatte, die uns deprimiert und<br />
lähmt und unsere Verleger verrückt macht und unser Image bei der Leserschaft<br />
beschädigt, so dass diese sich fragt, warum sie denn noch Zeitungen und Zeitschriften<br />
lesen soll, wenn deren Macher selbst nicht mehr daran glauben.<br />
Ich fürchte, wir fallen auf uns selber hinein. Wir lieben das Apokalyptische. Die<br />
Hoffnung, dass die Sonne eines Morgens nicht mehr aufgeht und wir als erste darü-<br />
144
er berichten können. Deshalb haben wir uns in den eigenen Untergang verliebt. Er<br />
beschäftigt uns ganz und gar. Er befriedigt die journalistische Sensationslust.<br />
Lassen Sie uns auf unsere Stärken besinnen, lassen Sie uns zurückkehren zu uns<br />
selbst – zu uns Journalisten, zu uns Rechercheuren der Gesellschaft, des Lebens,<br />
der Zeit, der Menschen. Lassen Sie uns all dies wieder erkennen als unsere Lebenswelt.<br />
Lassen Sie uns all dies lieben.<br />
Ja, doch, lieben!<br />
Ich benütze dieses schönste aller Verben mit Bedacht. Und auch ganz persönlich:<br />
Ich liebe meine demokratische Umwelt, die ich schreibend und redend – beispielsweise<br />
hier vor Ihnen – zu erkennen und zu durchdringen versuche. Ich liebe die<br />
Politik, weil ich die demokratische Kultur liebe. Und manchmal überkommt mich<br />
tatsächlich ein zärtliches Gefühl für Menschen, die sich in einer Partei, in einem<br />
Parlament, in einer Regierung für die öffentlichen Dinge engagieren.<br />
Wir müssen Kritiker sein, wir müssen harte und ätzende Kritiker sein. Aber es muss<br />
auch irgendwie unsere Zuneigung mitschwingen für das, worum es wirklich geht: um<br />
freiheitliche, demokratische, rechtsstaatliche, nicht zuletzt um gerechte Verhältnisse.<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind Journalisten. Das ist unser Beruf. Doch wir<br />
sind gleichzeitig Bürger. Und auch Bürgersein ist ein Beruf in unserer so hochkomplexen<br />
Gesellschaft. Wir haben also zwei Berufe: Journalist und Bürger.<br />
Wenn wir beiden gerecht werden, dann sind wir das, was wir immer sein wollten:<br />
Journalisten der Bürger.<br />
Die Rede hat Frank A. Meyer am 2.7.2011 in Hamburg vorgetragen.<br />
Frank A. Meyer ist Chefpublizist des Ringier-Verlages.<br />
145
„ ... und unseren täglichen <strong>Talk</strong> gib’ uns heute!“ 1<br />
Von Bernd Gäbler<br />
1. Die <strong>Talk</strong>shows sind in das Zentrum der televisionären Politikdarstellung- und<br />
vermittlung gerückt. In dieser Funktion haben sie die früher dominanten<br />
politischen TV-Magazine abgelöst. <strong>Talk</strong>shows verdrängen andere – vor allem<br />
filmische – journalistische Formate und Formen.<br />
2. Das Fernsehprogramm ist ein ruhiger Fluss, ein Wechsel von Geborgenheit im<br />
Ritual und Überraschung, von Sentiment und Sensation. Mittendrin, immer<br />
stärker sogar an hervorgehobenen, zentralen und Programm prägenden Sendeplätzen<br />
gibt es die Polit-<strong>Talk</strong>shows. Sie suchen Anschluss an diesen Programmfluss<br />
und reklamieren für sich, in diesen Gesprächsendungen werde die aktuelle<br />
Politik ebenso verhandelt wie die Frage, wie wir leben wollen. Die <strong>Talk</strong>show<br />
soll ein Forum der gesellschaftlichen Selbstverständigung sein. Tatsächlich<br />
beobachten die selbst unbeobachtet bleibenden Zuschauer, wie ausgewählte<br />
Diskutanten miteinander reden, argumentieren und streiten. Sie lassen sich<br />
dadurch unterhalten, erregen – oder sie schalten ab. Das erste bis zehnte Gebot<br />
für die „Macher“ lautet auch hier: „Bleiben Sie dran!“<br />
3. Die Themenfindung der politischen <strong>Talk</strong>shows unterliegt Konjunkturen und<br />
Quotenkalkülen. In der Regel entdecken die <strong>Talk</strong>shows keine relevanten ge sell -<br />
schaftlichen Konflikte oder Umbrüche, sondern tragen aus, was ohnehin „in“<br />
ist oder medial gerade thematisiert wird. <strong>Talk</strong>shows sind nie vorausschauend,<br />
immer reaktiv. Die zurzeit bedeutendste globale politische Umwälzung – die<br />
1 Zusammenfassung der Studie „Themen, Gäste, Inszenierung, Dramaturgie und die Bedeutung der<br />
Polit-<strong>Talk</strong>shows“.<br />
Die Analyse basiert u. a. auf einer Untersuchung von <strong>Talk</strong>shows, die zwischen dem <strong>15.</strong> März und dem<br />
<strong>15.</strong> Juni 2011 gesendet wurden, Interviews mit Programm-Machern und <strong>Talk</strong>show-Moderatoren sowie<br />
einer Literaturauswertung.<br />
146
arabischen Freiheitsbewegungen – gehen an den <strong>Talk</strong>shows völlig vorbei. Das<br />
Blickfeld ist begrenzt: Außenpolitik, Computer oder gar soziale oder ökologische<br />
Visionen kommen nicht vor; „Zwei-Klassen-Medizin“, Pflegenotstand“<br />
oder „Hartz IV“ funktionieren immer. Konkrete Fragen werden ins Wolkige<br />
geweitet. Kontroversen werden in der Regel nicht rationalisiert, sondern psychologisiert.<br />
Komplexe Entscheidungen werden gerne auf Ja/Nein-Schemata<br />
„heruntergebrochen“.<br />
4. In erschütternder Penetranz diskutieren die immer wieder gleichen Gäste in<br />
sich wiederholenden Konstellationen. Nicht die Logik des Arguments zählt,<br />
sondern der sympathische Gesamteindruck. Die Gäste müssen fernsehgerecht<br />
agieren, also beharrlich bei ihrer Meinung bleiben, die sie sicher verlautbaren.<br />
Sie müssen schlagfertig sein und auf Pointe hin sprechen können. Im Zweifelsfall<br />
ist der Show-Wert wichtiger als die Kompetenz. Die <strong>Talk</strong>shows haben Nachfrage<br />
geschaffen für den Typus des „unterhaltsamen Politikers“. Sie prägen<br />
wesentlich das Image einzelner Politiker. Sie sind – freilich nicht risikofreie –<br />
Bühnen für deren Selbstinszenierung. In der Regel verdeutlicht die <strong>Talk</strong>show,<br />
ob ein Diskutant selbstbewusst und dominant auftritt oder unsicher ist und<br />
sich in die Enge treiben lässt. Die Kluft zwischen Politik-Darstellung und realer<br />
Verhandlungs- und Entscheidungspolitik wird größer.<br />
5. Wichtige gesellschaftliche Akteure wie Wirtschaftslenker, bedeutende Künstler<br />
oder junge Wissenschaftler, praktische Reformer und selbst Bürgermeister von<br />
Großstädten kommen nicht vor. Stattdessen sind einige alte Männer (Arnulf<br />
Baring, Hans-Olaf Henkel) als „<strong>Talk</strong>show-Mobiliar“ allgegenwärtig. Andere werden<br />
reflexhaft zu bestimmten Themen eingeladen (Lauterbach – Gesundheit;<br />
Fussek – Pflege; Siggelkow – Armut; Pfeiffer – Jugendgewalt). „Meinungs-Slots“<br />
müssen „gefüllt“ werden. Wie ein „one trick pony“ (Robert Pfaller) soll der Gast<br />
die festgelegte Rolle konsequent durchhalten und dabei „authentisch“ wirken.<br />
6. Die Lebendigkeit der <strong>Talk</strong>shows resultiert im Wesentlichen aus den redaktionellen<br />
Dramaturgien. Trotz unterschiedlicher Akzentsetzungen im Einzelnen<br />
– von der Arena bis zum Zirkus – verlaufen sie meist nach dem Schema von<br />
Konflikt und Konsens. Zuerst wird der Konflikt in einem Dualismus extremer<br />
Positionen verdeutlicht, dann folgt der Appell zur zu Versöhnung und Zusammenarbeit.<br />
Durch viele einzelne Elemente und Gimmicks – <strong>vom</strong> „Einspielfilm“<br />
bis zum „Anklatscher“ – wird einer meist schnell redundanten Debatte immer<br />
wieder neuer Schwung verliehen. Wechselseitige Überzeugung, Nachdenklichkeit,<br />
sich verändernde Auffassungen, die Freude am Austausch der Argumente<br />
– also alles das, was einen voraussetzungslosen freien Disput ausmachen<br />
würde – spielt in der Polit-<strong>Talk</strong>show kaum eine Rolle.<br />
147
7. In jüngster Zeit lähmt nicht mehr so sehr der Partei-Proporz die <strong>Talk</strong>shows,<br />
sondern die ständige Inszenierung einer Zwei-Welten-Lehre zwischen Politik<br />
und Lebenswirklichkeit. Häufig sind allenfalls noch zwei von fünf Positionen<br />
mit Politikern besetzt. Meist vertreten sie Regierung und Opposition. Zwischentöne<br />
interessieren weniger. Die liebste Konstellation der <strong>Talk</strong>shows im letzten<br />
Vierteljahr lautete Union vs. Grüne. Gemessen an ihrer parlamentarischen Stärke<br />
ist die FDP über- die SPD unterrepräsentiert. Sozialdemokraten interessieren vor<br />
allem noch als sozialpolitische Kontrahenten zu Neoliberalen. In Kontroverse zu<br />
den Politikern treten oft Journalisten als Anwälte der Bürger auf. „Experten“<br />
pro und contra ergänzen das Tableau. Brav spielen auch „Betroffene“ in den<br />
<strong>Talk</strong>shows die ihnen zugewiesenen Rollen. Ihre Auftritte sind eine Art „scripted<br />
reality“ für die gehobenen Stände.<br />
8. In den <strong>Talk</strong>show-Redaktionen arbeiten clevere Optimierer. Ihre Kriterien sind<br />
Quote und Unterhaltungswert, nicht Neugier auf gesellschaftliche und politische<br />
Entwicklungen oder gar der Drang nach Aufklärung. Immer häufiger klammern<br />
sich die <strong>Talk</strong>shows als „Trittbrettfahrer“ an populäre Filme im Vorprogramm.<br />
Das Problem der <strong>Talk</strong>shows ist nicht, dass sie besser werden müssten, sondern<br />
dass sie an ihrer eigenen Routine und Orthodoxie zu ersticken drohen.<br />
9. Jetzt schon haben die <strong>Talk</strong>shows den Zenit ihrer Bedeutung überschritten. Bald<br />
kommt die Inflation. Deren Wesen ist nicht, dass es zu viel von derselben Sorte<br />
gibt, sondern dass die einzelne Sendung entwertet wird.<br />
10. Es kommt nicht darauf an, die <strong>Talk</strong>show neu zu interpretieren oder die bestehenden<br />
Formate noch weiter gemäß der Sehgewohnheiten zu optimieren, sondern<br />
endlich einmal wieder zu experimentieren: mit konkreten Themen, Jugendforen,<br />
entscheidungsnahen Diskursen, unorthodoxen Konstellationen oder sogar<br />
open-end-Debatten. Mehr Neugier, mehr Filmkunst und neue Formen der Kombination<br />
von Reportage und Diskussion würden die Bedeutung des Fernsehens<br />
für die politische Willensbildung unterstreichen.<br />
Die Studie „ ... und unseren täglichen <strong>Talk</strong> gib’ uns heute!“<br />
wurde von der Otto Brenner Stiftung herausgegeben.<br />
Weitere Infos unter: www.ottobrenner-stiftung.de<br />
148
„Komplizierte Geschichten einfach erzählen.“<br />
Thomas Leif im Gespräch mit Seymour Hersh<br />
Kritische stories bringen meist Konflikte mit sich.<br />
Wie gehen Sie vor der Veröffentlichung mit den Betroffenen um?<br />
Weil ich älter und erfahrener bin, versuche ich heute nie, etwas zu verdrehen. Wenn<br />
die Veröffentlichung einer Geschichte schlecht für meinen Gesprächspartner sein<br />
wird, sage ich es ihm. Wenn sie bitter für ihn sein wird, sage ich es ihm. Ich bin mir<br />
aber nicht sicher, ob ich das gemacht habe, als ich jünger war.<br />
Auf lange Sicht ist es besser, ehrlich zu bleiben. Nehmen wir folgenden Fall an: Ich<br />
schreibe eine Geschichte und sie wird in zwei Tagen herauskommen. Die Person,<br />
mit der ich gesprochen habe, denkt vielleicht, ihr werde die Story gefallen – aber<br />
das wird sie nicht. Dann rufe ich denjenigen an und sage: „Sie werden meine<br />
Geschichte nicht mögen. Ich möchte nur, dass Sie das wissen, Sie werden sie nicht<br />
mögen.“ Manchmal schreien mich die Leute dann an. Aber auf lange Sicht ist es<br />
gut, so vorzugehen. Es ist besser, als es sich zu einfach zu machen und zu denken,<br />
die werden den Text nicht mögen und schreibe ihn trotzdem. Ich lasse die Leute<br />
gerne wissen, was sie erwartet.<br />
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Fehler, die Journalisten immer<br />
wieder machen?<br />
Ach, Vermutungen, immer Vermutungen. Sie glauben nicht, wie viele Vermutungen<br />
oder Unterstellungen einfach so angenommen werden. Journalisten nehmen an,<br />
etwas sei die Wahrheit oder dass ihnen jemand die Wahrheit erzähle. Diese Unterstellungen<br />
sind das größte Problem. Es steckt mehr dahinter, als nur kritisch und<br />
skeptisch zu sein. Sie können nämlich hinterfragen und skeptisch sein – und doch<br />
immer nur einer Vermutung folgen. Außerdem: Wenn du eine gute Geschichte hast,<br />
dann lässt du sie sich selbst erzählen. Du musst sie nicht noch zuspitzen. Du musst<br />
die Dramatik oder die Sensation nicht extra hervorheben, wenn sie schon drinsteht.<br />
149
Die größte Schwierigkeit bei einer komplizierten Geschichte ist, sie einfach zu<br />
erzählen. Ich meine nicht simpel oder nur mit kurzen Sätzen, sondern eindeutig<br />
und sauber. Das kann sehr schwer sein.<br />
Manchmal versuchen Journalisten eine harte Geschichte schön zu schreiben, mit<br />
einem schicken Einstieg. Beim New Yorker, wo ich heute arbeite, gibt es immer<br />
Reibereien, weil sie keine direkten Geschichten mögen. Sie wollen, dass Du mit<br />
einem historischen Ereignis beginnst. Also habe ich dort in meiner Zeit als festangestellter<br />
Mitarbeiter jede Geschichte mit der Invasion in der Normandie angefangen<br />
– ich habe mir einen Scherz erlaubt.<br />
Aber in einem Punkt haben sie Recht. Wenn du eine lange Geschichte schreibst,<br />
musst du etwas finden, das den Charakter der Geschichte widerspiegelt. Auch das<br />
ist kompliziert. Tatsachengeschichten zu schreiben, ist schwer. Die Menschen<br />
bewundern Schriftsteller für ihre erfundenen Romane, aber ich glaube, einige der<br />
bestgeschriebenen Texte sind Tatsachentexte. Ich lese englische Übersetzungen<br />
der Artikel des SPIEGELS, das sind gute lange Stücke – mit Anfang, Mitte und Ende.<br />
Eindeutig und sauber zu arbeiten ist schwer. Glauben Sie,<br />
dass diese Grundhaltung amerikanischer Journalisten heute prägt?<br />
Das ist schwer zu verallgemeinern. Meine alte Zeitung, die New York Times, macht<br />
gute Arbeit. Die Washington Post veröffentlichte kürzlich eine lange Geschichte<br />
über der Zahl der Organisationen und Unternehmen, die im Bereich der „Inneren<br />
Sicherheit“ und der Geheimdienste aktiv sind. Die war sauber, gut und mit vielen<br />
Grafiken ausgestattet. Heute ist alles Multimedia, selbst die großen Storys haben<br />
heute den Hinweis: „Gehen Sie auf www.nytimes.com und dort Sie finden jedes<br />
Interview.“ Alles ist Multimedia. Das hat einige Vorteile. Man kann die langen Interviews,<br />
die man geführt hat, online stellen. Mein Problem ist jedoch das hochwertige<br />
Schreiben. Davon gibt es nicht genug und nicht jeder kann es. Um ehrlich zu sein,<br />
habe ich auch das Gefühl, heute sind einige Journalisten nicht so qualifiziert, wie<br />
es ihre Vorgänger früher einmal waren. Aber ältere Menschen glauben ja immer,<br />
dass die Dinge nicht mehr das sind, was sie einmal waren.<br />
Manche Insider sagen der „Online-Journalismus wird überschätzt“:<br />
es gäbe zu weinig eigenständig recherchierte Geschichten in den Online-Medien.<br />
Wie schätzen Sie die Lagen in den USA ein?<br />
Ich spreche seit 15 Jahren mit Kollegen darüber, investigativen Journalismus online<br />
zu betreiben. Investigative Journalisten verbringen zwei Monate für eine Recherche,<br />
sie fliegen um die Welt und investieren vielleicht 100.000 Dollar in eine Geschichte.<br />
Sie brauchen Geld und niemand hat bis jetzt herausgefunden, wie Online-Journalismus<br />
investigative Recherche finanzieren soll. Das ist heute das große Problem<br />
des Online-Business. Ich bin sicher, sie werden es lösen, ich weiß aber nicht wie?<br />
Es ist ein Finanzierungsproblem.<br />
150
In Deutschland wird mit Abonnements noch mehr Geld über die Auflage verdient,<br />
in Amerika ist das nur ein kleiner Anteil. Also leiden die Unternehmen dort, sie stellen<br />
nicht mehr ein, lassen Leute ziehen. Sie veröffentlichen zwar noch immer inves -<br />
tigative Geschichten, aber immer weniger. Die Journalisten bekommen nicht mehr<br />
die Zeit, weil sie Geld kostet. Das Personal wird für andere Dinge gebraucht.<br />
Ohne die Wissensspeicher von Informanten gibt es keine „Investigation“.<br />
Wie gelingt es Ihnen wichtige Informanten zu öffnen?<br />
Eine Möglichkeit ist, ihnen etwas Neues zu erzählen. Das hilft, wenn man anruft. Man<br />
muss dieses erste Stückchen Information haben, auch wenn es schwer zu bekommen<br />
ist. Wenn du etwas hast, das niemand weiß oder wissen sollte, kommst du ins<br />
Gespräch.<br />
Ich habe heute in einem Buch eines ehemaligen Regierungsanwalts gelesen. Er<br />
beschreibt darin, wie er reagierte, wenn ein Journalist mit einem sensiblen Thema<br />
zu ihm kam. Er hat nicht die Wahrheit gesagt. Er schreibt: „Ich habe gelogen. Ich<br />
habe gesagt, ich weiß nicht, wovon sie reden. Dann bin ich zu meinem Boss gegangen<br />
und habe ihm gesagt, der weiß was, pass auf ihn auf.“ Aber wenn man ein Körnchen<br />
Wahrheit findet, etwas Wichtiges, dann kann das wie ein Dosenöffner wirken.<br />
Eine weitere Erfahrung aus meinem Karriereweg: Wenn man mit Leuten weit oben in<br />
der Regierung spricht – die meisten Reporter treffen sich mit den Beratern für nationale<br />
Sicherheit oder dem Außenminister und wollen etwas, ein Interview usw. –,<br />
sage ich oft: „Bevor wir reden, lassen Sie mich erzählen, was ich kürzlich gehört<br />
habe.“ Ich gebe ihnen etwas, das kann auch mal Klatsch sein, aber es unterscheidet<br />
mich von den anderen.<br />
In Amerika ist es doch so: Mancher kommt von einer Bank oder einem Konzern in<br />
den hohen Regierungsjob. Letztes Jahr hat er also 90 Millionen Dollar verdient,<br />
dieses Jahr sind es 200.000 Dollar. Warum macht er das? Ganz einfach, weil er<br />
wichtig sein und Geheimnisse kennen will. Nun arbeitet dieser Beamte also im<br />
Weißen Haus oder im Finanzministerium und weiß all diese wunderbaren Dinge.<br />
Dann kommt der ahnungslose Reporter und der weiß etwas, was der Beamte noch<br />
nicht weiß. Häufig reagiert er dann so: „Wenn Sie glauben, Ihre Info sei wichtig,<br />
hören Sie sich mal das hier an …“<br />
Sie setzen also auf einen Austausch von Informationen?<br />
Na ja, eher auf einen Handel. Manche Kollegen sagen: du erzählst nie einer Quelle<br />
etwas, was sie nicht unbedingt wissen muss. Ich sage: du bekommst nichts, ohne<br />
auch zu geben. Du erzählst denen, was Du machst und weißt. Aber heute ist das<br />
auch leicht für mich, weil ich mir in den vergangenen 35 Jahren Informanten aufgebaut<br />
habe, die ich viele Jahre kenne. Wenn ich zu denen mit etwas Wichtigem komme<br />
und sie nicht darüber reden können, dann sagen sie das, bevor ich richtig loslege.<br />
Aber manche sagen: „Du liegst nicht ganz richtig, ich würde mir mal diese Sache<br />
151
hier anschauen.“ Tatsächlich versuchst du ja auch nicht permanent, etwas Geheimes<br />
zu erfahren und zu drucken. Es ist vielmehr so, dass du nach etwas Geheimem und<br />
zugleich Schlechten suchst.<br />
Ich bin Amerikaner, wenn meine Regierung etwas Kluges macht – zum Beispiel<br />
herausfinden, was Al-Qaida tut – werde ich nicht dazwischenfunken. Ich bin nicht<br />
prinzipiell dagegen. Ich bin nur dagegen, dumme und kriminelle Dinge zu tun. Ich<br />
bin dagegen, Menschen in Gefängnisse wie Guantanamo zu stecken, weil Amerika<br />
immer als vernünftiges und ehrenwertes Land wahrgenommen wurde und wir nun<br />
unseren Ruf zerstört haben.<br />
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Informanten aus der zweiten Reihe,<br />
ich meine nicht die Minister?<br />
Die dritte Reihe ist manchmal wichtig. Die erste Reihe hilft oft nicht weiter.<br />
Warum?<br />
Weil sie die Dinge schönreden. Das einzige, woran sie interessiert sind, ist dir eine<br />
Geschichte zu verkaufen, die du so erzählen sollst, wie sie es sich wünschen. Etagen<br />
tiefer, in der zweiten oder dritten Reihe, finden sich manchmal Menschen, die tatsächlich<br />
an der Wahrheit interessiert sind. Aber die Leute an der Spitze der Regierung,<br />
come on ...<br />
Da wurde kürzlich ein Bericht veröffentlicht, dass die Obama-Regierung bei der<br />
Ölpest im Golf von Mexiko nicht gut reagiert hat, dass sie Informationen verdreht<br />
hat. Oh mein Gott, was waren sie aufgeregt, das alles zurückzuweisen. Natürlich<br />
sind sie aufgeregt. Regierungen sind so. Und Obama mag ein anständiger Mann<br />
sein, ich halte ihn für ehrenhaft, aber auch er ist ein Politiker.<br />
Arbeiten Sie auch mit den Geheimdiensten? Sind sie manchmal nützlich?<br />
Natürlich. Ich kontaktiere ihn aber nicht offiziell, indem ich etwa eine Notiz an den<br />
Chef der CIA oder dessen Pressereferenten schreibe und um ein Briefing oder Treffen<br />
bitte. Das mache ich nicht mehr, weil ich es nicht nützlich finde.<br />
Was machen Sie dann? In welchen Situationen nutzen Sie den Geheimdienst?<br />
Ich finde Leute, die genug wissen und treffe sie informell. Du findest Gesprächspartner,<br />
wenn du zu jemandem in der CIA gehst, der ein Experte aber kein Faulpelz<br />
ist. Du suchst einen ehrlichen und ehrbaren Analysten. Dann sagst du ihm offen:<br />
„Ich möchte wissen, wie der letzte Stand in einer Angelegenheit ist, aber kein Briefing<br />
besuchen, weil dort soviel verdreht wird.“<br />
Wie überprüfen Sie diese Informationen <strong>vom</strong> Geheimdienst?<br />
Da musst du dich anstrengen, das ist fürchterlich. Einige mögen mich, weil sie wissen,<br />
ich habe viele Informanten. Nicht unendlich viele, aber mehr als die meisten. Und<br />
152
wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe und genügend Infos habe, dann ist der eine<br />
Informant nicht verdächtig, weil ich die Informationen von einem zweiten erhalten<br />
haben könnte, selbst wenn die Behörden das prüften.<br />
Wenn ich eine sensible Geschichte schreibe, wie zum Beispiel über Nuklearwaffen<br />
in Pakistan und wie Amerika damit umgeht, macht das die Regierung verrückt. Also<br />
prüfen sie mögliche Informanten und finden heraus: Der hat es gewusst, aber er<br />
hat etwas anderes nicht gewusst, was der Hersh geschrieben hat. Also folgern sie,<br />
er kann nicht die Quelle sein. Wenn du drei oder vier verschiedenen Informanten<br />
hast, die dir Geheimnisse verraten und du alle diese Informationen im Text verwendest,<br />
ohne die Namen der Quellen zu nennen, verwirrst du die Verfolger. Sie können<br />
nicht herausfinden, wer es dir letztlich gesteckt hat.<br />
Aber sie suchen. So etwas ist nie öffentlich, aber den meisten Ärger hatte ich, als<br />
Bush Präsident und Cheney Vize-Präsident waren. Sie haben nachgeforscht, wer<br />
mit mir gesprochen hat und sie haben bestimmte Leute bestraft. Dabei haben sie<br />
aber immer die falsche Person erwischt, immer!<br />
Wenn Sie die vergangenen Berufsjahre Revue passieren lassen: welche<br />
Personen sind die besten Quellen sind? Sind es die Leute in der dritten Reihe?<br />
Es gibt immer einen General, der zwei Sterne hat und gerne drei oder vier hätte, aber<br />
er wird mit zwei Sternen pensioniert. Der ist gut. Wenn er pensioniert wird, gib ihm<br />
einen Monat Langeweile und dann sprich mit ihm. Er wird Informationen haben. In<br />
Konzernen gibt es immer jemanden, der einen wichtigen Job will und ihn an einen<br />
Konkurrenten verliert. Er wird dir erzählen, warum der andere ein Ekel ist und den<br />
Job trotzdem bekommen hat. Das ist keine schöne Aufgabe, aber da ist immer<br />
einer, der gerade das Unternehmen verlassen hat oder gefeuert wurde. Es gibt<br />
153
immer eine Ex-Frau, wenn du wirklich verzweifelt bist. Das mag ich zwar überhaupt<br />
nicht, aber ich kenne Kollegen die so an Informationen gekommen sind. So ist das<br />
in der Geschäftswelt.<br />
In der Geheimdienstwelt gibt es immer Leute, die in Ruhestand gehen. Wenn du<br />
etwa ein Viersterne-General im Kommando bist und du gehst in Ruhestand, sechs<br />
Monate später weißt du immer noch viel, weil deine Nachfolger weiter mit dir sprechen,<br />
um dich um Rat zu fragen. Damit kommt man weit. Ich hatte vor kurzem ein<br />
fantastisches Interview mit Musharraf in London. Er erzählte viel, weil unser Treffen<br />
außerhalb seines Büros stattfand und ihm ein paar Dinge auf der Seele lagen.<br />
Bob Woodward geht und trifft den Präsident und er ist sehr akkurat damit. Ich habe<br />
keine Beschwerden über ihn, er ist sehr präzise, ein sehr ehrenwerter Mann. Aber<br />
ich bevorzuge etwas tiefer anzusetzen.<br />
Welche Erfahrungen haben Sie mit anonymen Quellen?<br />
Die muss man haben. Wenn jemand in einem sensiblen Bereich arbeitet, droht ihm<br />
Gefängnis. In Amerika haben wir fantastische Freiheiten, keine Zensur. Es ist die<br />
Aufgabe der Regierung das Geheime zu bewahren. Wenn ich ein großes Geheimnis<br />
erfahre, ist das nicht mein Problem, es ist ihr Problem. Dabei kann ich immer entscheiden,<br />
es zu veröffentlichen oder nicht.<br />
Und beurteilen Sie die Qualität von anonymen Quellen?<br />
Du kannst nicht ohne sie. Aber beim New Yorker geben sie Unsummen – wirklich<br />
ungewöhnlich viel Geld – für Factchecker aus. Das sind 15 bis 20 Leute. Sie kosten<br />
viel Geld, aber sie machen das Magazin besser. Meinen anonymen Quellen<br />
habe ich über die Jahre erklärt, dass ich nichts verwenden kann, es sei denn, sie<br />
154
sprechen separat noch einmal mit einem unserer Factchecker. Also organisiere ich<br />
den Anruf des Factcheckers, welche Zeit, welche Nummer, manchmal nutzen wir<br />
eine öffentliche Telefonzelle, wenn die Sache sehr sensibel ist. Einige Leute sprechen<br />
nur zu Hause mit mir. In einigen Fällen fliegt ein Factchecker nach Washington. Ich<br />
bringe ihn zu den Leuten und gehe dann, so dass sie in Ruhe reden können.<br />
Mögen Sie die Factchecker, denen Sie den Kontakt zu den wichtigsten Informanten<br />
ermöglichen müssen?<br />
Ja, sie können mächtig nerven, aber sie sind eine große Hilfe. Ich habe etwas<br />
Erstaunliches beobachtet: Jemand im Inneren der Dienste, ein Techniker, wird dem<br />
Fact checker mehr erklären als mir, weil er glaubt, ich würde etwas von der Materie<br />
verstehen, was ich aber nicht unbedingt tue. Ein Encrypter zum Beispiel erklärt<br />
dem Fact checker ausführlicher als mir, wie das Codiersystem funktioniert. Die<br />
Factchecker sind gut, sie machen Notizen. Ich nehme oft Details von ihnen und nutze<br />
sie für die Story.<br />
Kann ein guter investigativer Journalist annähernd jedes Ziel erreichen,<br />
wenn man nur hart arbeitet? Ist die Intensität der Recherchearbeit das<br />
wichtigste Erfolgskriterium?<br />
Du musst dranbleiben, den letzten Anruf machen, immer dranbleiben. Das ist schwer.<br />
Manchmal fühle ich mich wie ein Fundraiser oder ein Geldeintreiber für eine<br />
gemeinnützige Organisation.<br />
Fundraiser – ist diese gelegentlich penetrant auftretene Profession vergleichbar<br />
mit Journalismus?<br />
Die Leute sind immer schnell dabei zu sagen, mit ihnen spreche ich nicht. Ich glaube<br />
nicht daran, Leute zu Hause aufzusuchen und an ihre Türen zu klopfen. Einige Kollegen<br />
sagen, sie machen das, aber ich finde das anstößig. Anders ist es in folgendem Fall:<br />
Ich habe kürzlich an einem Sonnabend jemanden „Drinnen“ angerufen. Er sagte:<br />
„Komm vorbei.“ Ich antwortete: „In einer Stunde bin ich da.“ Und er sagte: „Fein.“<br />
Meine Frau war etwas sauer, aber es war ein wichtiger Typ und er war einverstanden,<br />
mich zu sehen. Außerdem: Sie mögen es, wenn du sagst: „Ich bin gleich da.“ Sie<br />
sehen, du arbeitest hart.<br />
Es kann aber nicht oft genug betont werden: Es ist wichtiger, dass du mehrere<br />
verschiedene Quellen hast und sie verteidigst.<br />
Sie haben Quellen, Material, Dokumente – was braucht man zusätzlich noch<br />
für eine erstklassige Geschichte ? Welche Bedeutung haben Fantasie und<br />
Kombinationsfähigkeit?<br />
Manchmal hast du vier oder fünf Fakten und du schreibst eine Story und plötzlich<br />
verstehst du etwas. Es passiert nicht oft, dass du völlig überraschend feststellst,<br />
155
oh mein Gott, jetzt versteh ich die Hintergründe und dann legst du das Puzzle Stück<br />
für Stück zusammen.<br />
Man braucht eine Art emotionale Intelligenz?<br />
Ja und es ist faszinierend, wenn das passiert.<br />
Wie behandeln sie die Informanten? Georg Mascolo <strong>vom</strong> Spiegel soll im Team<br />
die Rolle des so genannten „idealen Schwiegersohn“, gespielt haben?<br />
Nicht nur das, er ist ein sehr sozialer Typ. Er gibt viele Feiern in seinem Haus und er<br />
lädt die Regierungsleute oder die BND-Leute von der Botschaft ein. Er ist sehr<br />
freundlich, warm und er geht aus sich heraus.<br />
Was sollten junge Journalistinnen und Journalisten lernen, die investigativ<br />
arbeiten wollen?<br />
Sie sollten wissen, dass sie am Anfang beginnen müssen, und nicht gleich als<br />
investigativer Journalist starten. Sie müssen lernen zu schreiben, vorsichtig und<br />
gründlich zu sein. Wenn du Talent hast, dann begegnet dir schnell dieser schöne<br />
Moment, eine Geschichte zusammenzusetzen, die kein anderer kennt. Das ist das<br />
Wichtige, etwas zusammenzusetzen, das niemand anderes kennt. So findet man<br />
Spaß und Ruhm. Aber du musst klein anfangen, du schreibst Portraits von Leuten,<br />
Features, du machst die klassische Zeitungsarbeit. Du lernst, zu schreiben, du<br />
lernst, deine Talente einzusetzen. Sei akkurat und dann wirst du sehen: Manche<br />
Kollegen verbringen ihr ganzes leben als Stenografen oder Sekretäre. Sie hören<br />
den Präsidenten, schreiben auf, was er sagt, und sind glücklich damit. Andere<br />
sagen, ich will mehr. Das hat auch was mit Intelligenz zu tun. Ich glaube, die klugen<br />
Journalisten wollen mehr als nur Statements aufschreiben.<br />
Ist die Public-Relation-Industrie eine Gefahr für den Journalimus?<br />
Ja, wissen Sie, wer davor früh gewarnt hat? Walter Lippmann, der berühmte ame -<br />
rikanische Journalist. Er hat 1924 in einem Buch geschrieben: Seid vorsichtig mit<br />
der Public Relation. Sie verdrehen alles, sie verführen einen leicht zu einer anderen<br />
Realität. Ja, sie sind eine echte Gefahr, vor allem, weil sie langsam so gut werden.<br />
Ein Verhalten, das die Public-Relations-Offiziellen ihren Kunden beibringen,<br />
lautet beispielsweise: Sagt nichts.<br />
Sind die PR-Spezialisten stärker und professioneller als Journalisten?<br />
Ja, manchmal sind sie viel besser, weil viele gute Journalisten in der Wirtschaftskrise<br />
das gemacht haben, was sie vorher nie gedacht hätten. Sie haben einen dieser gut<br />
bezahlten Jobs angenommen. Es gibt diese Gefahr. Es ist mittlerweile eine Kunst<br />
geworden, Nachrichten zu verdrehen und zu verpacken. Das ist erschreckend.<br />
156
Wie sollten die Medien reagieren?<br />
Das große Problem ist, das Zeitungen und Fernsehen das Gleiche falsch machen:<br />
Sie befördern die Leute, die sie kontrollieren sollten. Wir könnten 70 Prozent der<br />
Redakteure in Amerika – in Deutschland ist es wahrscheinlich besser – feuern. Die<br />
Leute, denen die Druckmaschinen gehören, befördern nicht die Leute, die sie<br />
befördern sollten. Oft gibt es in den oberen Etagen nette Mitarbeiter, aber das sind<br />
nicht die richtigen. Sie sind nicht aggressiv. In meiner Karriere ist mir oft passiert,<br />
dass Kollegen nach einer Weile müde von mir wurden, weil ich immer sagte, dies<br />
ist nicht gut und das hier auch nicht. Weil ich oft negativ bin und die dunkle Seite<br />
suche, werden sie davon müde. Nur sehr selten findet man einen starken investigativen<br />
Mann, der Chefredakteur oder leitender Redakteur (Editor) wird. Die London<br />
Times hatte einmal eine Abteilung, „The Inside Team“, das ist 20 bis 30 Jahre her.<br />
Ende 60er hatten sie dieses spezielle Teams aufgestellt. Sechs Reporter haben<br />
ausschließlich investigativ gearbeitet. Sie schrieben gute Texte zum Beispiel über<br />
den Krieg in Vietnam. Und sie hatten einen fantastischen leitenden Redakteur. Aber<br />
heute will niemand mehr so viel Einfluss und Macht aus der Hand geben.<br />
Was ist die politische Essenz Ihres journalistischen Lebens<br />
Vertraue niemals den Leuten im öffentlichen Leben, das ist nicht unser Job. Wir sind<br />
keine Cheerleader für unsere Regierungen. Nach 9/11 waren Reporter in den USA<br />
zu sehr mit Applaudieren beschäftigt, anstatt skeptisch gegenüber George Bush<br />
und seinen Behauptungen zu Bomben im Irak zu sein. Amerika zuerst, hieß es bei<br />
ihnen, wir wollen Rache – da haben wir unsere Seele verloren. Die Bush-Regierung<br />
hat im großen Stil moralisch versagt.<br />
Was treibt Sie an?<br />
Ich mag Geschichten. Ich hasse Lügen und ich liebe Geschichten. Ich liebe es,<br />
Geschichte zu erzählen, die noch keiner kennt.<br />
Herzlichen Dank für das Gespräch.<br />
Übersetzung: Lars-Marten Nagel<br />
Seymour Myron Hersh (*8. April 1937 in Chicago), Spitzname Sy, ist ein US-amerikanischer Investigativjournalist<br />
jüdischer Herkunft und bekannter Muckraker.<br />
Seymour Hersh wurde 1969 weltbekannt, als er während des Vietnamkriegs das Massaker von My Lai<br />
aufdeckte. 2004 sorgte er erneut für Aufsehen, als er maßgeblich den Folter-Skandal im irakischen<br />
Abu-Ghuraib-Gefängnis bekannt machte.<br />
157
Wichtig und falsch<br />
Von Bernhard Pörksen<br />
Eine Debatte, die einen Journalisten zu Unrecht diffamiert, ein Skandal, der keiner<br />
ist, der aber doch eine notwendige Diskussion erzwingt und eine berechtigte Sehnsucht<br />
artikuliert – eine Nachbetrachtung zum Eklat um den Henri Nannen Preis 2011.<br />
Es gibt Debatten, die sind nötig. Und es gibt Debatten, die nötig sind und gleichzeitig<br />
gut begründet. Bei der Diskussion um René Pfister stellen sich die Verhältnisse<br />
etwas komplizierter dar. Hier handelt es sich um eine Debatte, die dringend vonnöten<br />
ist, aber in diesem speziellen Fall äußerst schlecht begründet. Diese Debatte<br />
diffamiert einen Reporter, der dies nicht verdient hat; sie kreist um einen Skandal,<br />
der nicht stattgefunden hat. Und doch braucht der Journalismus (und eben hier<br />
beginnen die Fragen von allgemeiner Relevanz) das wache Bewusstsein für Grenzen<br />
und eigene Grenzüberschreitungen, für die stets bedrohte Unterscheidung von<br />
Fakt und Fiktion, Sein und Schein. Gerade jetzt, in einer Phase der mediengemachten<br />
Überinszenierung ist die Reflexion über die Gefahren des Bluffs so nötig wie selten<br />
zuvor. Und eben dies macht den Eklat und all die Essays und Polemiken, die Interviews<br />
und aufgeregten Kommentare so aufschlussreich, so wichtig – auch wenn<br />
man sagen muss: Eigentlich müsste der Name des Protagonisten gelöscht und die<br />
grundsätzlich bedeutsame Diskussion ihrem konkreten Anlass entzogen werden.<br />
Doch zunächst: Was ist überhaupt geschehen? Der Autor René Pfister hat ein Porträt<br />
des Politikers Horst Seehofer verfasst, die Geschichte eines Machtmenschen. Und<br />
die Jury des Henri Nannen-Preises hat sich dazu entschlossen, dieses Porträt als<br />
beste Reportage des Jahres 2010 auszuzeichnen, um ihm den Preis dann in einem<br />
spektakulären Akt der öffentlichen Bestrafung wieder abzuerkennen. Pfister wählt<br />
in diesem Text – dies gehört zur guten Tradition des ideengesteuerten Schreibens –<br />
gleich zu Beginn eine zentrale Metapher, um den Machtwillen des Instinktpolitikers<br />
Seehofer zu demonstrieren; sie zeigt die ihm eigene Mentalität der fröhlich-unbe-<br />
158
kümmerten Manipulation. Das ist der erste zentrale Punkt: Die Einstiegsszene hat<br />
ohnehin nur metaphorischen, nur allegorischen Status. Es ist ein Seelenbild, das<br />
aber – aller semantischen Doppelbödigkeit zum Trotz – seine Entsprechung in der<br />
Realität findet. Seehofer, so der Einstieg des Porträts, sitzt im Keller seines Ferienhauses<br />
und kann am Stellpult seiner Spielzeugeisenbahn schalten und walten wie<br />
er möchte. Diese Szene hat René Pfister nicht selbst mit erlebt, aber er hat sie<br />
gründlich, umsichtig und präzise recherchiert. Er hat sich Fotos zeigen lassen,<br />
Kollegen befragt, den offensichtlich endlos-langweiligen Geschichten Seehofers<br />
über seine Eisenbahn zugehört und den Dokumentaren beim Spiegel dies alles vor<br />
der Veröffentlichung berichtet. Noch einmal: Niemand bezweifelt die Fakten, auch<br />
Seehofer selbst hat sie bestätigt. Niemand bezweifelt die Wahrheit der Geschichte<br />
– im konkreten wie im übertragenen Sinne. Und René Pfister hat auch nicht<br />
behauptet, dabei gewesen zu sein und Seehofer am Stellpult beobachtet zu haben.<br />
Alle Vergleiche mit einem wild collagierenden Plagiator, der einmal Verteidigungsminister<br />
war, oder dem Borderliner Tom Kummer, der sich seine gefeierten Interviews<br />
am heimischen Schreibtisch in Los Angeles einfallen ließ, sind falsch, ehrverletzend,<br />
demonstrieren die eigene Unkenntnis der verhandelten Sachverhalte und eine<br />
letztlich selbst problematische Geschwindigkeit und Ungenauigkeit des Urteils, was<br />
Wahrheitsfragen betrifft. Als Pfister am Abend des 6. Mai auf die Bühne des<br />
Hamburger Schauspielhauses kam, um für eben diese Geschichte eine der höchsten<br />
Auszeichnungen des deutschen Journalismus in Empfang zu nehmen, hat ihn die<br />
Moderatorin Katrin Bauerfeind gefragt, wie er denn in den Keller gelangt sei. Und<br />
René Pfister hat ganz unbekümmert vor den Augen von ein paar hundert Gästen<br />
erklärt, er sei nie im Keller gewesen. Das ist der zweite zentrale Punkt: In dieser<br />
Antwort liegt sein eigentlicher Fehler. Es ist kein Fehler der Profession, sondern ein<br />
Fehler der Performanz. Auf der Vorderbühne der Preisverleihung wird – gerne auch<br />
in etwas übertriebener Form – die Kanzelrede erwartet, nicht aber eine arglose<br />
Beschreibung branchenüblicher, im Zweifel heikler, aber mitnichten skandalöser<br />
Vorgehensweisen, die der Erläuterung bedürfen. In diesem Moment sitzen hier<br />
Menschen beisammen, von denen nicht alle die journalistischen Regeln im Detail<br />
kennen oder gar beherrschen, die sich aber doch an diesem Abend vergewissern<br />
wollen, dass die ethisch-moralischen Standards und Richtlinien unbedingt gelten<br />
und dass sie notfalls selbst dafür Sorge tragen – und seien die Anforderungen und<br />
Ansprüche noch so wirklichkeitsfern. Um nicht missverstanden zu werden, sei noch<br />
hinzugefügt: Dies ist keine nachträgliche Aufforderung zur Lüge in Richtung des<br />
Beschuldigten, sondern lediglich eine Beschreibung von Situationsregeln, die<br />
gebrochen wurden – und die eine Skandalisierung erst möglich gemacht haben.<br />
Von René Pfister hat man an diesem Abend eine naive Wahrheits- und Authentizitätsbeteuerung<br />
erwartet. Er hätte nur suggerieren müssen, er sei ganz nah dran gewesen<br />
und habe alles mit eigenen Augen gesehen, denn das Augenzeugenprinzip er scheint<br />
als natürliche Objektivitätsgarantie und als Ausweis einer besonders raffinierten<br />
159
Recherche-Genialität, der es in diesem besonderen Moment unbedingt zu huldigen<br />
galt. Das nämlich ist es, was auf der Vorderbühne und in einem solchen Moment<br />
stets verlangt wird: das normativ konsensfähige Bekenntnis, die Glorifizierung von<br />
Standards, deren scheinbar unbedingte Gültigkeit schon am Morgen danach zerbröselt.<br />
Aber René Pfister hat diese Rede- und Gattungserwartung enttäuscht, und<br />
eben dies war sein Fehler der Performanz. Er hat nicht situationsgerecht gesprochen,<br />
sondern offen und ehrlich (darin besteht die besonders schmerzliche Paradoxie)<br />
davon berichtet, was im Journalismus alltäglich ist und auch für herausragende<br />
Schreiber mitnichten problematisch, weil es schlicht und einfach zu Gesetzen und<br />
Regeln der Form gehört. Reportagen verdichten Realität, und sie basieren nicht nur<br />
auf dem ohnehin fragwürdigen, weil keineswegs notwendig objektiveren Prinzip<br />
der Augenzeugenschaft. Sie schneiden Wirklichkeit schon durch den Akt der Auswahl<br />
zurecht. Sie arrangieren Erlebtes und Recherchiertes mit Blick auf den<br />
Erkenntniseffekt. Sie liefern auch szenische Rekonstruktionen – ohne dass der<br />
Reporter dabei gewesen sein muss. Sie werden eben gerade nicht nach dem Muster<br />
der in der Regel öden Chronologie präsentiert, sondern sie gliedern ihre Szenen<br />
und Stoffe dramaturgisch, wirkungsbezogen, mit Blick auf die fragile Aufmerksamkeit<br />
eines hastig blätternden Publikums. Sie verwenden Metaphern und Allegorien,<br />
die gerade den Zweck haben, den Leserinnen und Lesern eine fremde Welt nah<br />
erscheinen zu lassen, sie für einen Moment soziale, räumliche oder zeitliche<br />
Distanzen vergessen zu machen.<br />
Natürlich gibt es in diesen Prozessen der Realitätsverdichtung für den geschulten,<br />
den wirklich guten Schreiber, eine eigene Art der Versuchung. Irgendwann weiß<br />
man nämlich einfach, wie es geht. Irgendwann gewinnt die sprachlich-gestalterische,<br />
die dramaturgische Kompetenz an Eigendynamik. Sie rastert das Geschehen und<br />
bedingt schließlich eine womöglich ungleich unterhaltendere, brillant formulierte<br />
Stilisierung des Vorgefunden, die aber leider nicht mehr den Fakten entspricht.<br />
Aber auch das sogenannte Faktum, die Tatsache selbst ist Resultat eines komplexen<br />
Konstruktionsprozesses. Man weiß und erfährt nur, was man eben – aufgrund der<br />
eigenen Biographie und Biologie, der Sozialisation und der besonderen Situation,<br />
den Zufällen und den besonderen Glücksmonenten einer Recherche – in Erfahrung<br />
bringen kann. Man kann gar nicht nicht konstruieren. Auf diese schlichte Formel<br />
lässt sich die erkenntnistheoretische Grundmelodie von Immanuel Kant bis zu Wolf<br />
Singer bringen. Jeder Reporter muss überdies, hier beginnt die bewusstseinsfähige<br />
Aktivität, gestalten, kann gar nicht alles aufschreiben und verwenden, muss auswählen,<br />
eine gewaltige Restwelt ausblenden und gleichzeitig die Gesetze der<br />
Gattung und die Erfordernisse des Mediums beachten. Die Konsequenz: Auch der<br />
Akt der Gestaltung ist unvermeidbar; man kann nicht nicht gestalten, geht man<br />
doch bei der Recherche auf eine bestimmte Weise vor, wählt eine besondere Sprache,<br />
montiert Handlungsstränge, personalisiert eine Idee, komprimiert und fokussiert,<br />
160
liefert Kontext- und Hintergrundinformationen, dokumentiert Schlüsselszenen – aus<br />
eigenem oder fremden Erleben. Das ist ganz einfach journalistische Normalität,<br />
aber mitnichten ein Skandal. Diesen gestaltenden Zugriff kann man sich bewusst<br />
machen; man kann ihn trainieren, ihn als mehr oder weniger angemessen klassifizieren,<br />
aber er ist unvermeidlich Bedingung der Möglichkeit des mediengerechten<br />
Schreibens. Danach allerdings beginnen die Schwierigkeiten. Nun betritt man die<br />
Problemzone bewusster Realitätsverdrehung, weil man etwas schreibt, von dem<br />
man gleichzeitig weiß, dass es so nicht stimmt, nicht stimmen kann. Nun wird in<br />
anrüchiger Weise inszeniert, manipuliert, letztlich gelogen, getäuscht und getrickst.<br />
Genau diese Grenze von der unvermeidlichen Gestaltung bis hin zur vermeidbaren<br />
Täuschung hat jedoch René Pfister nicht überschritten. Was immer er aufschrieb,<br />
ließ sich und lässt sich belegen; nirgendwo steht oder stand geschrieben, dass die<br />
szenische Rekonstruktion – gleichsam auf einem Beipackzettel für womöglich<br />
verunsicherte Leser – deklariert werden muss. Der Skandal also, er fand nicht statt.<br />
Dass nun aber doch so entschieden, so wütend und mit einer solchen Intensität<br />
über sein Porträt debattiert wird, ist viel eher ein zeitdiagnostisch aufschlussreiches,<br />
ein letztlich positiv zu deutendes Symptom, Ausdruck eines fundamentalen Unbehagens<br />
in der Casting- und Inszenierungsgesellschaft, das die seriösen Protagonisten<br />
der Medienbranche völlig zu Recht erfasst hat, sie umtreibt, irritiert. Man sehnt sich<br />
nicht zufällig kollektiv nach Glaubwürdigkeit und Realitätsgewissheit, will in seinen<br />
Darstellungen, in seinen Reportagen und Berichten die eigentliche, die wahre Wirklichkeit<br />
entbergen. Diese Sehnsucht ist, aller Aufregung aus falschem Anlass zum<br />
Trotz, ganz einfach zu begrüßen, speist sie sich doch aus einem berechtigten Ekel<br />
vor einer längst totalitär gewordenen Kultur des Bluffs und der Show.<br />
Eine sehr informative Dokumentation zum Konflikt um den Henri Nannen Preis 2011<br />
finden Sie auf www.reporterforum.de<br />
Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Zuletzt veröffentlichte<br />
er – gemeinsam mit Wolfgang Krischke – das Buch Die Casting-Gesellschaft. Die Sucht nach<br />
Aufmerksamkeit und das Tribunal der Medien.<br />
161
Der Drang nach Aufmerksamkeit<br />
Interview mit Prof. Dr. Bernhard Pörksen<br />
Sie sagen, wir leben in einer Castinggesellschaft. Wie zeichnet sich diese aus?<br />
In der Castinggesellschaft ist die Sucht nach Aufmerksamkeit allgegenwärtig<br />
geworden. Und die mediengerechte Inszenierungspraxis hat längst die Sphäre<br />
der Prominenten verlassen. Man stellt sich permanent dar, geprägt und bestimmt<br />
von den neuen Medienwirklichkeiten. Fast jeder hat heute ein Fotohandy in der<br />
Tasche und kann sich oder seinen Nachbar ablichten und in einem Sozialen<br />
Netzwerk oder auf einem Blog präsentieren. Medien durchdringen unseren<br />
Alltag in einer derart massiven Weise, dass die Einsicht unabweisbar wird: Womöglich<br />
findet fast alles, was wir tun, potentiell vor einem uns unbekannten Publikum<br />
statt. Und eben diese Einsicht verändert unsere Art des Denkens, unsere Wahrnehmung,<br />
unsere Selbstpräsentation. Image und Ich verschmelzen in unauflösbarer<br />
Weise.<br />
Woher kommt denn dieser gesteigerte Drang nach Aufmerksamkeit?<br />
Zum einen ist es ein menschliches Grundbedürfnis, auf der Bewusstseinsbühne<br />
eines Publikums eine Rolle zu spielen. Wir wollen im Leben anderer wichtig sein.<br />
Zum anderen lässt sich Aufmerksamkeit kapitalisieren, man kann am Ende des<br />
Tages Beachtung in Bargeld verwandeln.<br />
Früher hatte das Fernsehen neben einer Informationsfunktion auch eine Unterhaltungsfunktion.<br />
Ist jetzt eine neue Funktion hinzu gekommen, die Spiegelung<br />
des eigenen Ichs, die Bereitstellung der offenen Bühne für alles und jeden?<br />
Das Fernsehen hat natürlich noch immer eine Informations- und Unterhaltungsfunktion,<br />
aber seine Macher propagieren die Selbstinszenierung in Form einiger<br />
weniger Schlüsselreize zunehmend aggressiver. Die Kernbotschaft lautet auch in<br />
Richtung der breiten Masse, der Unbegabten und der Nicht-Prominenten: Liefere<br />
162
eine Show! Die Belohnung besteht dann darin, das eigene Leben zu verlassen,<br />
noch einmal aufzubrechen. Aschenputtel im Medienzeitalter.<br />
Warum tun sich Teilnehmer von Casting – und anderen Reality-Shows teilweise<br />
diese Demütigung an, sich von einer Fernsehjury vor den Augen der Öffentlichkeit<br />
abkanzeln zu lassen oder sich unwürdigen Mutproben zu stellen?<br />
Es geht um Aufmerksamkeit und – im Unterschied zu Andy Warhol – um 15 Sekunden<br />
Ruhm, einen bescheidenen Augenblick der großen öffentlichen Präsenz. Fakt ist:<br />
Unsere Vorstellung von Prominenz hat sich verändert – der Star von heute taugt nicht<br />
mehr als ewig unerreichbarer Mythenproduzent, sondern agiert als möglicher Konkurrent<br />
in einem Spiel, in dem alle glauben, potenziell mitspielen zu können. Nicht-Prominente<br />
sehen sich heute zunehmend als Noch-nicht-Prominente. Und wenn Sie<br />
an solche zumutungsreichen Formate wie das Dschungel-Camp denken, dann findet<br />
man dort immer nur sogenannte C-Promis, also Leute, denen kaum mehr Beachtung<br />
geschenkt wird. Sie versuchen – oft mit allen Mitteln – wieder ins Rampenlicht<br />
zu gelangen, gehen ein besonderes Tauschverhältnis ein. Etwas zugespitzt: Ein<br />
Politiker, der medial stattfinden will, tauscht – natürlich oft aus strategischen Gründen<br />
– Information gegen Publizität. Diejenigen, die auf das Niveau des Dschungel-<br />
Camps abgerutscht sind oder als gänzlich Unbekannte von einem Leben als Star<br />
träumen, können dieses Tauschverhältnis selbstverständlich nicht anbieten. Sie<br />
tauschen daher Intimität, Vulgarität und Stupidität gegen Publizität, sie offenbaren<br />
Privates, Intimes, Primitives – einfach nur, um noch einmal vorzukommen.<br />
Welche Funktion erfüllen Teilnehmer von Casting-, Coaching- oder anderen<br />
Reality-Formaten für die Produzenten solcher Shows?<br />
Es geht nicht darum, dass sie sich als ein Individum präsentieren, ihren eigenen<br />
Charakter offenbaren; sie sind als Lieferanten von Stereotypien und Klischees<br />
gefragt. Schicksale, die womöglich existieren, werden offensiv zurecht geschnitzt.<br />
In den Reality-Formaten finden sich in der Regel keine normalen, alltäglichen Beziehungsprobleme,<br />
sondern man begegnet dem Gebrüll, dem Geschrei, dem Getrampel.<br />
Eine schlicht und einfach überforderte Mutter kommt nicht vor, sondern man<br />
braucht die Mutter, die ausrastet und ausflippt – das ist aggressives Realitätsdoping.<br />
Im Falle von Castingshows geht es darum, ein Melodram aus Hoffen und Bangen,<br />
Aufstieg, Absturz und Verzweiflung, Sentimentalität, Kampf und Intrige zu weben.<br />
Zu besetzen sind die immer gleichen Rollen: die Zicke, der Streber, die Naive, der<br />
Underdog, die Peinliche, das verkannte Genie. Wer stattfinden will, muss eine dieser<br />
Rollen verkörpern und außerdem das eigene Privatleben als Reservoir für rührende<br />
oder schockierende Geschichten zur Verfügung zu stellen.<br />
163
Es gibt inzwischen so viele Coaching-Formate, in denen Alltags-, Finanz-, Ehe-,<br />
Berufsprobleme behandelt werden und jeder kann sich dort bewerben, um therapiert<br />
zu werden. Ist das Fernsehen heute zu unserem „Freund und Helfer“ geworden?<br />
Letztlich wird hier ein leicht absurdes Rechtfertigungsmuster der Produzenten und<br />
Formatmacher offenbar, das besagt, man wolle eigentlich therapieren und helfen. Es<br />
sind Voyeure zweiter Ordnung, die hier am Werk sind: Sie liefern zum Sozialporno<br />
auch gleich die scheinbar aufklärerische Unterzeile und bemänteln die aggressive<br />
Dramatisierung privater Schicksale durch ein selbstbewusst geheucheltes Interesse<br />
an öffentlich praktizierter Lebenshilfe.<br />
Die ersten Formen des Reality-Fernsehen waren ja verglichen mit heute noch<br />
harmlos. Die erste Big Brother-Staffel wirkte fast wie ein Experiment, bei dem das<br />
Zusammenlebenden der Container-Insassen gezeigt wurde, auch mit der Gefahr,<br />
nichts als Langeweile darbieten zu können. Warum zieht das heute nicht mehr?<br />
Der Inszenierungsdruck nimmt offenkundig zu. Es gilt, möglichst gezielt Konflikte<br />
zu kreieren, die Beteiligten in leichte Kampfspiele zu verstricken, die Stimmung<br />
anzuheizen, um formatkompatible Schlüsselreize zu produzieren: den Zusammenbruch,<br />
die plötzliche Offenbarung eines Schicksalsschlages, den Streit, die Schlägerei.<br />
Zu diesem Zweck braucht man Strategien emotionaler Überhitzung, die<br />
Ungeübte irgendwann einbrechen lassen. Das einfache Leben hat da keine Chance.<br />
Normalität ist das Kontrastprogramm zur Realität im Reality-TV.<br />
Inzwischen hat sich ein neuer Trend erfolgreich etabliert: Scripted Reality Formate.<br />
Fiktive Storys, die von Laiendarstellern nachgespielt, jedoch im Stil der Dokumentation<br />
präsentiert werden, um den Anschein von Realität zu erwecken. Warum<br />
greift man weniger auf echte Fälle zurück?<br />
Die Macher von Castingshows berichten, dass sogenannte „Protas“ – Protagonisten<br />
echter Fälle – zunehmend schwer zu finden sind. Sie meinen überdies, Deutschland<br />
sei durchgecastet. Das mag sein. Scripted Reality ist allerdings noch aus<br />
einem anderen Grund erfolgreich. Die Darsteller solcher Doku-Shows agieren derart<br />
laienhaft, dass ihr Dilettantismus kurioser Weise den Eindruck der Echtheit erzeugt.<br />
Mit anderen Worten: Sie spielen so schlecht, dass es extrem schwer fällt, sie für<br />
„Schauspieler“ zu halten. Ihre tapsige Laienhaftigkeit dient gleichsam der Wahrheitsbeteuerung.<br />
Kann der Zuschauer heute noch unterscheiden, was echt und was ein Fake ist?<br />
Es ist, so meine ich, geradezu ein Merkmal der Castinggesellschaft, dass sie von<br />
einem permanenten Inszenierungsverdacht regiert wird. Man kann sich nie sicher<br />
sein, ob man es nicht gerade mit einer besonders raffinierten, einer besonders<br />
perfiden Form der Inszenierung und des Realitätsdopings zu tun hat. Gleichzeitig<br />
wächst die Sehnsucht nach Gewissheit und echter Information. Glaubwürdigkeit<br />
164
erscheint als Leitwert und Schlüsselkriterium, um Personen des öffentlichen<br />
Lebens zu bewerten. Und in diese doppelte Bewusstseinslage zwischen Inszenierungsverdacht<br />
und Gewissheitssehnsucht driftet man auch als Beobachter unvermeidlich<br />
hinein.<br />
Wie kommen wir aus dieser Inszenierungsfalle heraus?<br />
Richtige Rezepte kann ich nicht anbieten. Aber: Notwendig ist eine investigative<br />
Medienforschung und eine Form des unerschrockenen Prominenten-Journalismus,<br />
der sich darum bemüht, die Hinterbühne der Inszenierung durch Detailstudien auszuleuchten.<br />
In stillen Minuten kann man natürlich auch auf die offensive Mitarbeit<br />
der Privatsender hoffen: Die Totalinszenierung könnte sich zu einem solchen<br />
Exzess, zu einem solchen Gestammel und Getümmel steigern, dass niemand mehr<br />
zuschauen mag – und sich das Medium selbst demontiert.<br />
Fragen: Eleni Klotsikas<br />
Prof. Dr. Bernhard Pörksen, Universität Tübingen, Medienwissenschaftler und Autor des Buches:<br />
„Die Castinggesellschaft. Die Sucht nach Aufmerksamkeit und das Tribunal der Medien.“<br />
(Halem, September 2010)<br />
165
Die „Erfolge“ der PR und<br />
die „Krisen“ der vierten Gewalt<br />
Von Michael Behrent<br />
Wie hat sich die Medienlandschaft in den letzten Jahren entwickelt? Was sind die<br />
Mächte hinter den Kulissen? Funktioniert der kritische Journalismus noch? Wo führt<br />
uns die Entwicklung hin? Ist die Mediendemokratie künftig den Manipulateuren und<br />
ihren Methoden schutzlos ausgesetzt? Oder verändert sie sich insgesamt und<br />
damit auch das Berufsbild von Journalisten und PR-Leuten?<br />
Ich werde hier weder theoretisieren, noch werde ich Heldengeschichten aus meinem<br />
Beruf auftischen. Vielmehr möchte ich Sie einladen, mir bei der Betrachtung einiger<br />
Medienereignisse der jüngeren Zeit im Lichte der Leitfragen zu folgen. Einige dieser<br />
Ereignisse sind weltbekannt, andere wiederum kenne ich persönlich gut und weiß<br />
manches über Vorder- und Hintergründe. Ich beschränke mich jeweils auf die Aspekte,<br />
die für den Gedankengang zentral sind und verzichte auf die Darstellung aller Details.<br />
Zunächst zum Thema „die Macht der Medien“.<br />
Dieses Bild stammt aus der Zeit vor dem<br />
11. September 2001. Wir sehen die Twin-Towers<br />
des World Trade Centers in New York. Ich<br />
kann dieses Bild nicht sehen, ohne an den<br />
11. September 2001 zu denken. Und, ich weiß<br />
nicht wie es Ihnen geht, mir erscheint das<br />
Bild irreal. Das Bild in meinem Kopf zeigt zwei<br />
brennende Türme, die dann zusammenbrechen.<br />
Ich kann Ihnen heute noch sagen, was<br />
ich getan habe, als dies passierte. Ich saß im Konferenzraum meiner Agentur in<br />
Frankfurt, schaute CNN live und sah, wie der zweite Flieger in den zweiten Turm raste.<br />
166
Habe ich in diesem Moment die Macht der Medien gesehen oder die Macht von<br />
Osama bin Laden? Oder die Macht eines massiven kulturellen Konfliktes? Oder die<br />
Macht einer brennenden Ikone?<br />
Bezogen auf unser engeres Thema steht fest: Die meisten Bilder des Ereignisses<br />
wurden, technisch gesehen, nicht von Journalisten produziert, bzw. entstanden zu -<br />
fällig. Die Leistung von CNN war, innerhalb kaum einer Stunde ein Kamerateam auf<br />
einen benachbarten Turm zu schicken, eine journalistische Verarbeitung des Ereignisses<br />
war hingegen nicht möglich. Der CNN-Reporter schlug sich wacker, wusste<br />
aber nicht mehr als wir Zuschauer. Die Macht der Medien bestand darin, mich an<br />
einem überwältigenden Ereignis teilhaben zu lassen. Sie hatten aber nicht die Macht,<br />
mich teilhaben zu lassen und vor der Überwältigung zu schützen. Mein geschätzter<br />
Kollege Prof. Dr. Klaus Kocks fasste dies in einem anderen Zusammenhang treffend<br />
in die Formel: „Das unerhörte Ereignis als Freiheitsberaubung der Urteilskraft“.<br />
Ich sehe mich gerne als Herr über meinen Verstand, als kritisches Subjekt, das für<br />
sich selbst und sein Handeln Verantwortung übernehmen kann. Trotz moderner<br />
Hirnforschung und Überlegungen zur Schwarmintelligenz – mir will es nicht gelingen,<br />
einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn zu äußern, ohne die Instanz<br />
des kritischen Subjektes vorauszusetzen. Auch und gerade wenn ich in meinem<br />
Beruf als Kommunikationsberater darüber nachdenke, wie ich mein Publikum beeindrucken,<br />
verführen, überzeugen kann, um es einzunehmen, setze ich immer ein<br />
Publikum voraus, das aus vielen Einzelnen besteht, die sich ihren Verstand in kritischer<br />
Absicht zunutze machen wollen und können. Ich denke, der kritische Journalismus<br />
setzt ebenfalls die kritische Instanz verantwortlicher Subjekte voraus, die ein<br />
Publikum und eine Öffentlichkeit bilden.<br />
Der Anschlag auf das World Trade Center war ein Anschlag auf meinen Verstand,<br />
auf meine Fähigkeit zur kritischen Reflektion. Wenn Sie so wollen, war er eine geniale<br />
PR-Aktion der Al Quaida. Die journalistischen Medien konnten mich vor diesem<br />
Anschlag nicht schützen. Sie konnten mich nicht als kritisches Subjekt ansprechen.<br />
Im Gegenteil, sie zeigten den Schrecken nicht nur während er sich vollzog, sondern<br />
danach und in den folgenden Tagen und Jahren und erneut zum zehnten Jahrestag.<br />
Ich habe die Medien und die Journalisten verflucht, als sie mich immer wieder<br />
zwangen, dies zu sehen. Ich bin auch der Auffassung, dass Medien sich am Schrecken<br />
finanziell bereichert haben, indem sie die Schaulust des Publikums bedienten.<br />
Aber heute weiß ich auch, dass ihre Hauptaufgabe nicht war, die Bilder zu filtern,<br />
sondern danach eine Debatte über die Bilder zu organisieren, eine Verarbeitung zu<br />
leisten. Und das haben sie doch alles in allem hier in Deutschland, wo ich es einigermaßen<br />
überschaue, gut gemacht. Was ich also an diesem Bild sehe, ist die Ohnmacht<br />
167
der Medien, was ich nicht sehe, ist ihre Macht, nämlich daran zu arbeiten, die Urteilskraft<br />
zurückzugewinnen. Darin liegt die Aufgabe eines jeden guten Journalismus.<br />
Er muss mithelfen, die Überwältigung durch Ereignisse abzuarbeiten, indem er die<br />
unterschiedlichen Wahrnehmungen und Beziehungen der Menschen zu den Ereignissen<br />
sichtbar macht, indem er Konflikte und Widersprüche aufzeigt und kommunizierbar<br />
macht. Dafür braucht er Unabhängigkeit, darf selber nicht Partei sein.<br />
Fakten und Fiktionen<br />
Am Beispiel der Twin-Towers kann man aber sehen, wie sich moderne Medien<br />
manipulieren lassen: Durch Fakten, am besten durch Fakten, die man fotografieren<br />
kann. Wenn die Fakten auf der Hand liegen, kann ein Journalist nicht widerstehen.<br />
Ja er ist verpflichtet, zu berichten. Mit Fakten lassen sich daher nicht nur Hochhäuser,<br />
sondern auch Weltbankpräsidenten oder Vorstände zum Einsturz bringen. Aber wo<br />
kommen die Fakten alle her?<br />
Ich nehme an, dieses Bild kennen Sie.<br />
Jörg Häntzschel schreibt in der Süddeutsche<br />
Zeitung in ihrer Ausgabe <strong>vom</strong><br />
18. Mai dazu: „Dass der ‘perp walk‘ eine<br />
PR-Aktion ist, eine für die Presse inszenierte<br />
Justizperformance, bei der alle<br />
Aspekte – Schauplatz, Tageszeit, Handschellen<br />
ja oder nein – sorgfältig be dacht<br />
werden, daraus macht die US-Justiz kein<br />
Hehl. …(Der perp walk) dient dazu, die Öffentlichkeit über die Arbeitsweise der Justiz<br />
aufzuklären … Dieser Nutzen sei bedeutender als die Privatsphäre der betroffenen<br />
Personen.“ Die Medien und ihre Redaktionen müssen dieses oder ein vergleichbares<br />
Bild einfach zeigen, und zwar auf der Titelseite. Denn es ist auch politisch relevant.<br />
Bedauerlich ist, dass die Redaktionen sich dabei nicht der Wertung entziehen können,<br />
die durch die Inszenierung nahe gelegt wird. Die Journalisten müssen von dieser<br />
Wertung ausgehen, um in der Folge ihre eigene Wertung zu entwickeln, wie es der<br />
Kommentator der SZ getan hat. Die Staatsanwaltschaft hat nicht die Absicht, mit<br />
den Journalisten zu kommunizieren, sondern sie weiß, dass sie durch diese Bilder<br />
direkt mit uns, der Öffentlichkeit kommunizieren kann. Dazu braucht sie nur das<br />
Arrangement bereitstellen, die Arbeit machen dann die Medien. Die Journalisten<br />
und ihre Medien sind also zunächst vor allem Zwischenträger. Sie werden auch in<br />
diesem Fall „überwältigt“. Nur wenige Redaktionen verfügen über die Qualität der<br />
Süddeutschen Zeitung, dies auch angemessen öffentlich zu reflektieren. Die meisten<br />
anderen interessiert das Sexualleben von Dominique Strauss-Kahn.<br />
168
Im Herzen der Finsternis der PR<br />
Nicht immer sind aber die Erfolge der PR so offensichtlich durch Überwältigung<br />
erzielt. Ich lade Sie ein zu einem Besuch im Herzen der Finsternis der PR, und auch<br />
davon gibt es Bilder.<br />
Diese kleine Bilderserie stammt aus der<br />
Ausgabe 5/2010 des SPIEGEL. Sie zeigt<br />
einen Mann, der in einer Autobahntankstelle<br />
zunächst an die Kasse geht, sich<br />
nach einem Fax-Gerät erkundigt, um<br />
dann in den Hintergrund zu diesem Faxgerät<br />
zu gehen und von dort aus ein<br />
anonymes Fax zu verschicken. Dieses<br />
Fax sollte laut SPIEGEL das Gerücht<br />
über angeblich pädophile Neigungen<br />
eines hochrangigen Bankmanagers in<br />
die Welt setzen. Es wurde laut SPIEGEL von Norbert Essing versendet, und ich muss<br />
sagen, auch ich erkenne auf den Fotos Norbert Essing.<br />
Ich formuliere hier zurückhaltend, ich möchte mich um einer Pointe willen keinerlei<br />
Prozessrisiko aussetzen. Der durch den versuchten Rufmord Geschädigte hat nach<br />
dieser Berichterstattung gegen Herrn Essing prozessiert. Essing hat seinerseits<br />
Anzeige erhoben. Das Verfahren gegen Essing wurde inzwischen aus verfahrensökonomischen<br />
Gründen gegen ein hohes Bußgeld eingestellt.<br />
Ich bin Herrn Essing im Laufe meiner Tätigkeit als Kommunikationsberater mehrfach<br />
begegnet. Irgendwann nach seinem Ausscheiden als Kommunikationschef der<br />
Deutschen Börse wurde er zu einer grauen Eminenz der Publizistik der Finanz -<br />
industrie in Deutschland. Ich halte die Darstellungen im SPIEGEL und die Schlussfolgerungen<br />
für glaubwürdig. Demnach konnte Herr Essing viele Jahre Einfluss<br />
nehmen auf die Berichterstattung der deutschen Leitmedien, indem er ihnen<br />
sogenannte „Fakten“ lieferte. Der SPIEGEL-Bericht löste eine heftige Debatte<br />
innerhalb von Redaktionen aus. Manche Redaktionen verpflichteten sich öffentlich,<br />
künftig jede Zusammenarbeit mit Herrn Essing zu vermeiden. Manche taten dies<br />
nicht. Herr Essing ist, wie man hört, immer noch als PR-Berater tätig.<br />
Bezogen auf die Frage nach „Erfolgen“ der PR darf man mit Recht annehmen, dass<br />
es möglich ist, sogenannte deutsche Leitmedien mit Hilfe servierter Fakten zu einer<br />
bestimmten Berichterstattung zu bewegen, auch wenn dies nicht leicht zu bewerkstelligen<br />
ist. Und das geht deswegen, weil die Redaktionen auf Zuträgerdienste<br />
angewiesen sind. Die Medien halten sich Zwischenträger und alimentieren sie. Die<br />
Honorare werden von den Auftraggebern nicht für den Aufwand ihrer Berater<br />
169
gezahlt, sondern für die Fähigkeit, die Medienberichterstattung zu beeinflussen.<br />
Wenn Journalisten eine solche Praxis von PR-Leuten nicht dulden wollten, brauchten<br />
sie nur den Hörer nicht mehr abnehmen, bzw. das Fax in den Papierkorb werfen<br />
oder besser vernichten. Ich schließe hier ausdrücklich den kritischen Journalismus<br />
ein. Die Qualität unterscheidet sich in der Fähigkeit, die Informationen angemessen<br />
zu nutzen. Über die Angemessenheit wird dann wiederum oft öffentlich gestritten,<br />
ebenfalls unter Einsatz von PR und Gegen-PR.<br />
Netzwerk Recherche: Wer schützt uns vor der PR?<br />
Wenn man so will, kann man die bisherigen Beispiele als Belege für die Erfolge der<br />
PR sehen. Im Sinne der Antithese muss ich nun fragen, wie es um die vierte Gewalt<br />
steht. Was ist mit dem kritischen Journalismus? Nimmt die Qualität der öffentlichen<br />
Kommunikation ab? Und wenn ja, liegt das an der Schwäche des Journalismus?<br />
Als Zeugen für die These <strong>vom</strong> Niedergang des Journalismus möchte ich Ihnen das<br />
Netzwerk Recherche vorstellen. „netzwerk recherche e. V. tritt ein für den in Deutschland<br />
vernachlässigten investigativen Journalismus.“ Seit einigen Jahren warnt das<br />
Netzwerk massiv vor dem „wachsenden Einfluss der Public Relations“. Ich zitiere<br />
umfassend aus einer Pressemitteilung:<br />
„Guter Journalismus ist einer aufgeklärten Demokratie verpflichtet und bemüht<br />
sich um das ‘ganze Bild’ und die vollständige Klärung der Sachverhalte. PR ist den<br />
Interessen der Auftraggeber verpflichtet und muss positive Botschaften verbreiten.<br />
Durch die interessengeleitete Akzentuierung oder Auslassung von wichtigen Informationen<br />
vermittelt PR nur Teil-Wahrheiten und Ausschnitte der Realität.“<br />
Das Netzwerk verabschiedete nach heftigen Debatten mit Zustimmung der Mitglieder<br />
einen Forderungskatalog, um „die Unterwanderung des Journalismus durch versteckte<br />
PR zurückzudrängen“.<br />
netzwerk recherche fordert:<br />
• eine Kennzeichnungspflicht für Tätigkeiten von Journalisten für Unternehmen<br />
oder PR-Agenturen<br />
• eine schärfere Abgrenzung gegen PR und Schleichwerbung – im Pressekodex<br />
durch den deutschen Presserat<br />
• die Aufklärung über den Unterschied zwischen PR und Journalismus in Ausbildung<br />
und Praxis<br />
• der normierte Verzicht der Unternehmen auf nicht legitime, kommerzielle<br />
Beeinflussung sowie<br />
• angemessene Vergütung und Infrastrukturen, damit wirtschaftliche Zwänge<br />
nicht als Rechtfertigung für die Verknüpfung und Verschmelzung von journalistischer<br />
und PR-Tätigkeit herhalten können.<br />
170
Bei genauer Betrachtung ergibt sich die Plausibilität der Argumentation und der<br />
Schlussfolgerungen vor allem aus einem mit politisch-moralischer Wucht vorgetragenen<br />
Eigeninteresse. Ich glaube, PR und Journalismus brauchen einander. Ohne<br />
PR hätten die Journalisten keine Geschichten und ohne die kritischen Journalisten<br />
hätten viele PR-Leute keinen gut bezahlten Job. Mehr noch: Uns verbindet unser<br />
Handwerk. Darauf möchte ich noch zu sprechen kommen.<br />
Zunächst aber noch eine grundsätzliche Anmerkung. Ich habe nachgelesen, wo<br />
eigentlich der einleitende Anspruch herkommt, dass guter Journalismus der Demokratie<br />
verpflichtet ist und die PR dagegen nur Partikularinteressen, warum man<br />
also befürchten muss, dass die Demokratie ohne Journalismus gefährdet ist. Das<br />
Bundesverfassungsgericht kam in einem Urteil <strong>vom</strong> <strong>25.</strong> April 1972 zu dem Schluss,<br />
dass: „die freie geistige Auseinandersetzung ein Lebenselement der freiheitlichen<br />
demokratischen Ordnung in der Bundesrepublik und für diese Ordnung schlechthin<br />
konstituierend [ist]. Sie beruht entscheidend auf der Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit,<br />
die als gleichwertige Garanten selbständig nebeneinander stehen.“<br />
Dieses Urteil konkretisierte ein Urteil von 1958 in dem es hieß „Das Grundrecht auf<br />
freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit<br />
in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt […].<br />
Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend,<br />
denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf<br />
der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Es ist in gewissem Sinn die Grundlage<br />
jeder Freiheit überhaupt.“<br />
Die Basis der Demokratie ist der Kampf der Meinungen. Die Basis ist das Recht<br />
einer jeden Person und Vereinigung, für die eigenen Meinungen und Interessen<br />
einzutreten. Dabei hat sie sich natürlich an die Gesetze zu halten und muss sich<br />
legitimieren. Und zwar nicht gegenüber den Journalisten, sondern gegenüber der<br />
Öffentlichkeit insgesamt. In diesem Kampf wird das partikulare Interesse alles tun,<br />
um Zustimmung zu erlangen, also wird es auch versuchen, Journalisten zu beeinflussen.<br />
Wer das beeinträchtigen will, muss sich fragen lassen, ob er die freie Meinungsäußerung<br />
einschränken will. Die Aufgabe der Journalisten und der Medien<br />
ist, diesen Kampf der Meinungen und Interessen angemessen abzubilden, damit<br />
sich der Staatsbürger sein Urteil bilden kann, damit er qualifiziert an diesem Kampf<br />
teilnehmen kann. Dies ist der Sinn der Pressefreiheit.<br />
Journalismus hat kein Interesse an Transparenz<br />
Ich halte also die Äußerungen, dass PR und Journalismus sich wie Teufel und Weihwasser<br />
verhalten für falsch und in letzter Konsequenz für undemokratisch, weil sie<br />
nämlich „den“ Journalismus über die Einzelinteressen der Gesellschaft stellt. Ich<br />
171
teile aber die Sorge, die sich in den Forderungen des netzwerk recherche ausdrückt:<br />
Dass nämlich keine hinreichende Transparenz besteht über die Frage, wie eine<br />
Berichterstattung zustande kommt und dass Zweifel an der Qualität der Inhalte<br />
berechtigt sind. Es ist tatsächlich oft genug zweifelhaft, ob wirklich angemessen<br />
die wesentlichen unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema dargestellt werden.<br />
In dieser Frage der inhaltlichen Zusammensetzung und Qualität sind vor allem die<br />
journalistischen Medien höchst intransparent – aber eben nicht nur in Hinblick auf<br />
die Frage, wo eigentlich all die schönen Fakten herstammen, auf denen sie ihre<br />
Geschichten aufbauen, sondern auch in der Frage, warum sie eigentlich eine<br />
bestimmte Geschichte bringen, wie sie gewichten und werten. Die einfachste Möglichkeit,<br />
Transparenz über die Qualität herzustellen, wäre die Veröffentlichung der<br />
Diskussion in der Redaktionskonferenz, in der über das Blatt und das Programm<br />
entschieden wurde, in einem Editorial, z. B. im Internet. Eine Art Waschzettel, wie<br />
ihn der Verbraucherschutz für andere Konsumartikel vorschreibt.<br />
Warum passiert das nicht? Nun, ich denke, die Hohepriester der freien Presse<br />
befürchten, dass ihre Heilige Messe als Popanz entlarvt werden könnte. Jedes journalistische<br />
Medium verspricht dem Leser, Zuschauer, Nutzer: Ich habe hier exklusiv<br />
und frisch die neuesten und besten Informationen für Dich. Bei mir erhältst du Einblicke,<br />
die Dir sonst verborgen bleiben. Hier findest Du ein Abbild dessen, was für<br />
Dich wirklich wichtig ist.<br />
Dieser Suggestion fühlen sich die Journalisten verpflichtet, daran werden sie<br />
gemessen. Ein guter Journalist ist in der Praxis, wer den nächsten Scoop bringt und<br />
süffig präsentiert, weil er so die Aufmerksamkeit auf sein Medium zieht. Und um<br />
Aufmerksamkeit geht es, nicht um Realität, Komplexität und Widersprüchlichkeit.<br />
Aufmerksamkeit ist das Maß für Relevanz, und zwar sowohl für PR-Leute wie für<br />
Journalisten. Interessengegensätze entstehen dort, wo die Arbeitgeber von PR-Leuten<br />
und Journalisten aus legitimem Eigeninteresse die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche<br />
Aspekte eines Themas lenken wollen. Viel häufiger als es gut ist, sind<br />
sich aber PR-Leute und Journalisten völlig einig, weil sie es sich leicht machen.<br />
Gemeinsam geben sie dem Affen Zucker.<br />
Nur die Story zählt: Faktengestützte Kolportage statt Wahrheit<br />
Damit möchte ich darauf zu sprechen kommen, dass PR-Leute und Journalisten das<br />
gleiche Handwerk ausüben, und zwar auf sehr vergleichbare Weise. Wir sind nämlich<br />
Geschichtenerzähler, Fakten interessieren uns als Baustein einer Geschichte, die<br />
im Kopf unseres Publikums entstehen soll. Wir sind insofern auch immer affirmativ.<br />
Ein kritischer Kritiker ist als Journalist praktisch nicht denkbar. Ihm wird bestenfalls<br />
gelegentlich eine Seite als Gastautor eingeräumt. Als Geschichtenerzähler bedienen<br />
wir altbekannte Themen und Dramaturgien, die Plots der condition humaine in<br />
immer neuem Gewand. Unsere Frage ist immer zuerst: Welche Geschichte steckt in<br />
172
einem Faktum. Und dann fragen wir: Welche Fakten brauche ich zusätzlich, um meine<br />
Version der Geschichte zu erzählen. Und dann: Wie mache ich die Fakten gerichtsfest.<br />
Diese Haltung ist für Journalisten und PR-Leute ebenso gefährlich, wie im Ergebnis<br />
für das Publikum oder die Auftraggeber. Ich möchte Ihnen an einem Beispiel zeigen,<br />
wie diese Art von Bequemlichkeit funktioniert. Ich war am Rande daran beteiligt<br />
und möchte mit der Schilderung zugleich Abbitte tun. Wir betreten nun die Niederungen<br />
des Boulevards.<br />
Hier sehen Sie das Ergebnis der erfolg -<br />
reichen Bemühungen von Prinzessin Odette<br />
Krempien um positive PR. BILD-Frankfurt<br />
ver öffentlichte diesen Bericht am 24. <strong>November</strong><br />
2009 im Rahmen einer Serie von fünf<br />
Berichten als Ergebnis einer Reise in den<br />
Kongo, gemeinsam mit der Prinzessin und<br />
einem Team von RTL.<br />
Prinzessin Krempien war zwei Jahre zuvor, aus Namibia kommend, in den Frankfurter<br />
Norden gezogen, um den Sohn ihres ehemaligen Gatten in der Vatersprache zu er -<br />
ziehen. Sie gründete das DAJW, das Deutsch-Afrikanische Jugendwerk e. V., in dessen<br />
Rahmen afrikanischen und anderen Jugendlichen aus Migrantenfamilien Nachhilfeunterricht<br />
erteilt wird. Diese Arbeit wird bis heute mit ihrer Unterstützung fortgeführt.<br />
Parallel begann sie umgehend damit, sich eine gesellschaftliche Existenz aufzubauen.<br />
Höhepunkt war die Veranstaltung einer ambitionierten Spendengala in Frankfurt<br />
am 27.11.2009. Es ist leicht erkennbar, dass die Terminplanung für Pressereise und<br />
Berichterstattung auf diese Gala hinführen sollten. Soweit der Erfolg der PR.<br />
Am 8.12.2009 erschien in Frontal 21, einem der investigativen Flaggschiffe des<br />
öffentlich-rechtlichen Systems, ein sehr polemischer Beitrag, der unter dem Titel<br />
„Wo bleiben die Spenden für Afrika?“ der Prinzessin dubioses Geschäftsgebaren<br />
und die Täuschung der Öffentlichkeit unterstellte.<br />
In der Folge veränderte die BILD ihre Haltung<br />
zur Prinzessin. Eine Reihe von Journalisten<br />
nahm die Fährte des verwundeten Tiers auf,<br />
um es zu erlegen. Das Büro des DAJW wurde<br />
teilweise von Kamerateams belagert. Die<br />
Prinzessin zog mit ihren Kindern für einige<br />
Wochen ins Hotel, da sie auch zuhause von<br />
Medien belagert wurde.<br />
173
Zu diesem Zeitpunkt suchte der Manager einer Bank meinen Rat. BILD vermutete<br />
eine Verbindung zwischen ihm und der Prinzessin und wollte die Geschichte<br />
weiterdrehen, indem weitere Personen und Details einbezogen werden sollen. Ich<br />
riet ihm und der Bank, einen kurzen harschen Brief durch einen Anwalt zu schicken,<br />
der juristische Schritte androht, wenn irgendwelche Rechte verletzt würden. Weder<br />
die Bank noch der Manager sind in der Berichterstattung aufgetaucht. Noch so ein<br />
Erfolg der PR.<br />
Am 23.12.2009 gab die Staatsanwaltschaft Frankfurt bekannt, dass ein Ermittlungsverfahren<br />
wegen schweren Betrugs gegen die Prinzessin eingeleitet werde. Ein<br />
Erfolg des Journalismus?! Die Prinzessin ihrerseits versuchte eine Gegendarstellung<br />
beim ZDF zu erwirken, konnte aber einige Fristen nicht einhalten, weshalb es<br />
nicht zur Entscheidung kam. Eine Niederlage der PR.<br />
Am 1.4.2011 gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass das Ermittlungsverfahren<br />
gegen Prinzessin Odette Krempien eingestellt wurde. Von allen Vorwürfen bleiben<br />
am Ende des Tages einige Schlampereien. Ein Erfolg des Rechtstaates. Als einziges<br />
Medium berichtet die FAZ online die Sachlage im Detail und korrigiert damit faktisch<br />
die Medienberichterstattung.<br />
Hier die Fehler, die Prinzessin Krempien aus meiner Sicht machte: Sie sprach nicht<br />
gut genug Deutsch, um zu beurteilen, ob die Texte auf ihrer Website völlig korrekt<br />
waren; Sie suchte nach dem hiesigen Empfinden zu ehrgeizig einen Platz im Licht<br />
der Frankfurter Gesellschaft; Sie nahm zu naiv im Boulevard die Rolle der schönen<br />
Exotin an. All dies aber sollte nicht reichen, um bei Frontal21, einem Flaggschiff des<br />
investigativen Journalismus, einen Spendenbetrug zu unterstellen.<br />
Meine Frage ist in unserem Zusammenhang: Wenn es so wenig belastbare Fakten<br />
gab und so viele Beteiligte – woher wussten wir eigentlich alle, wie die Geschichte zu<br />
laufen hat? Ich für meinen Teil habe meinem Klienten, pragmatisch gesehen, einen<br />
richtigen Rat gegeben. Ich habe ihm gesagt: Zeige harte Kante gegenüber der Presse.<br />
Aber ich habe auch gesagt: Suche Abstand zur Prinzessin. Das war opportunistisch<br />
richtig, aber entsprach nicht der wahren Sachlage. Es war eine Konzession an die<br />
sich abzeichnende Kolportage. Die Fundamente der Kolportage wurden von der<br />
BILD gelegt mit ihren liebedienerischen Artikeln über die „Schöne Prinzessin“, die<br />
immer farbig im Bild war und deren Farbigkeit als exotischer Reiz sichtbar war.<br />
Diese kleine Geschichte beinhaltet alles am gemeinsamen Beruf von PR-Leuten<br />
und Journalisten, was verachtenswert ist, und nur Wenige können am Ende des<br />
Tages guten Gewissens in den Spiegel schauen. Zu diesen Wenigen gehört für mich<br />
in diesem Fall die FAZ. Alle anderen, natürlich die BILD, insbesondere aber auch<br />
174
Frontal 21, Die GRÜNEN in Hessen, die die Berichterstattung zum Anlass für eine<br />
Anfrage an die Landesregierung nahmen, die Berater der Prinzessin, die von Ihrem<br />
Glanz profitieren wollten, aber auch ich selber, der ich zur Distanzierung riet, obwohl<br />
die Fakten ungeklärt waren – wir alle haben nur unterschiedliche Rollen in einer abgeschmackten<br />
Kolportage um eine exotische Prinzessin gespielt und daran verdient.<br />
Diese Art von Sparsamkeit im intellektuellen Aufwand halte ich für symptomatisch.<br />
Indem wir uns an der Kolportage orientieren, tragen wir einer Ökonomie Rechnung,<br />
die uns nötigt, mit geringster Anstrengung die größte Aufmerksamkeit zu erzielen.<br />
Die Geschichte war von BILD angelegt, von Frontal 21 wurde sie einfach nur umgedreht.<br />
Kritischer Journalismus sieht für mich anders aus. Beteiligt waren immer<br />
Journalisten und PR-Leute.<br />
Das Publikum ermächtigt sich<br />
Ich komme zum Ende meiner Überlegungen, und zugleich möchte ich Sie einladen,<br />
ein neues Feld zu betreten. Die Krisen des Journalismus sind nicht auf die Erfolge<br />
der PR zurückzuführen. Und eine PR, die sich am Journalismus orientiert, teilt auch<br />
seine Krisen. Unsere Demokratie, unser öffentliches Leben hängt aber zum Glück<br />
nicht allein davon ab, ob Journalisten gut bezahlt werden oder unbeeinflusst bleiben<br />
durch PR-Leute. Wenn wir auf die Eingangsfrage nach der Macht der Medien zurückkommen,<br />
erleben wir gerade den Beginn eines neuen Zeitalters. Das Berufsbild von<br />
Journalisten und PR-Leuten verändert sich und löst sich aus den alten Strukturen.<br />
Wir müssen zum guten Schluss auf das Publikum zu sprechen kommen.<br />
Das Internet und seine neuen Medien wie Twitter, Facebook und Co. verändern<br />
alles. Das Publikum, das zuvor allein durch die Abstimmung am Kiosk und gelegentliche<br />
Leserbriefe intervenieren<br />
konnte, genießt neue Freiheiten und<br />
Kompetenzen. Informationen sind<br />
praktisch weltweit jederzeit verfügbar.<br />
Die Gatekeeper der Presse verlieren<br />
ein wichtiges Privileg: ihren Informationsvorsprung.<br />
Und die jüngsten Ereignisse zeigen:<br />
Öffentlichkeit ist nicht länger ein Privileg<br />
hochentwickelter Gesellschaften.<br />
Heute reichen Mobilfunknetze<br />
und der damit verbundene Zugang zum Internet, um Revolutionen zu ermöglichen<br />
und Aufstände zu organisieren. Wir alle haben verstanden, was auf dem Tahir-Platz<br />
passiert ist.<br />
175
Sicher: die am häufigsten besuchten Seiten im Netz sind Pornoseiten. Aber die<br />
Arroganz derer, die dies bevorzugt feststellen, gründet auf dem gefährdeten Privileg<br />
des besonderen Zugangs zur Öffentlichkeit. Mögen Millionen Menschen in Deutschland<br />
täglich Pornoseiten aufsuchen oder Banalitäten auf Facebook austauschen.<br />
Mit der gleichen Technologie entlarven einige von ihnen einen Verteidigungsminister<br />
als Hochstapler. Das Volk, der freche Lümmel, gerät außer Kontrolle.<br />
Jeder sollte nun wissen, dass öffentliche Kommunikation nicht dauerhaft ein<br />
abgekartetes Spiel zwischen PR und Presse sein kann. Ich würde niemandem<br />
mehr raten, das Risiko eines solchen Spiels einzugehen. Natürlich kann man<br />
sich auf den Standpunkt stellen, dass die Kritik irgendwelcher unerzogenen<br />
Blogger zu ignorieren sei. Aber warum eigentlich? Es sei denn aus dummer<br />
Arroganz oder reiner Verzweiflung.<br />
Möglicherweise haben die PR-Leute geringere Probleme, die neuen Medien zu<br />
nutzen als so mancher Journalist. Als der Regierungssprecher Steffen Seibert am<br />
28. Februar dieses Jahres einen Twitter – Account einrichtete, um sich direkt an<br />
eine interessierte Öffentlichkeit zu richten, musste sich der stellvertretende Regierungssprecher<br />
in der Bundespressekonferenz kritische Fragen anhören, die vermuten<br />
lassen, dass sich mancher Journalist fühlt, wie der Heizer auf der E-Lok. Wenn der<br />
Regierungssprecher uns auf Twitter umgeht, wer braucht uns dann noch? Wer sich<br />
für diese Fragerunde interessiert, der google „Seibert“ und „Twitter“ und schaue<br />
sich das erste Video an, das angezeigt wird. Dabei haben die Kollegen Journalisten<br />
durchaus mein Verständnis, denn ihr Beruf ist nicht durch ihr persönliches Versagen<br />
bedroht, sondern durch das der Verleger, die bislang kein Geschäftsmodell gefunden<br />
haben, wie sich künftig eine qualifizierte Redaktion refinanzieren kann. Die Hochburgen<br />
des Qualitätsjournalismus in Deutschland sind daher seit Jahren in der<br />
Krise, die Gehälter sinken, Stellen werden abgebaut. Als treuer Abonnent der<br />
Frankfurter Rundschau weiß ich, wie der Niedergang einer Qualitätszeitung aussieht.<br />
Und durch meine Zusammenarbeit mit den Institutionen des öffentlich-rechtlichen<br />
Systems weiß ich, dass die ungezählten freien Mitarbeiter, die die Beiträge<br />
herstellen, nicht wirklich zu den Profiteuren der GEZ gehören. Sie sind elend<br />
schlecht bezahlt und leben in ständiger Unsicherheit.<br />
Jeder Journalist und auch das netzwerk recherche muss sich daher fragen, ob ein<br />
werbefinanzierter bzw. ein öffentlich-rechtlich subventionierter Journalismus<br />
wirklich die einzigen Geschäftsmodelle für eine qualifizierte Publizistik sind. Die<br />
allerdings wird auch künftig gebraucht. Denn auch wenn uns via Internet viele<br />
Informationen sofort zur Verfügung stehen, suchen wir doch alle auch nach Einordnung<br />
und Orientierung.<br />
176
Dabei werden die klassischen Grenzen zwischen Journalisten und PR-Leuten<br />
zunehmend verwischen. Die ersteren werden sich für bestimmte Themen stark<br />
machen, wie es heute PR-Leute tun, die letzteren werden zunehmend zu Bericht -<br />
erstattern und Kommentatoren, wie es heute Journalisten sind. All dies wegen der<br />
neuen Kommunikationsplattformen im Internet, die übrigens auch von journalistischen<br />
Medien und PR-Medien publizistisch genutzt werden. Hier gewinnt am Ende<br />
der, der am besten überzeugt – unabhängig von der Frage, ob der publizistische<br />
Akteur ein Verlag ist oder ein anderes Unternehmen.<br />
Für Journalisten und PR-Leute heißt dies: Wer der Meinung ist, dass unser Handwerk<br />
ein Beruf ist, der gebraucht wird, der sollte bereit sein, sich auf gemeinsame<br />
Qualitätsstandards zu einigen. Wer glaubt, dass sich Qualität durchsetzt, der sollte<br />
darüber nachdenken, wie dies auch außerhalb der klassischen Verlagsmedien<br />
stattfinden kann. Die Debatte über die Mediendemokratie und einen Qualitäts -<br />
verlust der Medien durch eine fundamentale Antithese von PR und Journalismus zu<br />
strukturieren, halte ich dagegen für hoffnungslos. Die Frage ist auf lange Sicht<br />
allein, wer Qualität bezahlt.<br />
Aktualisierter Vortrag auf der Tagung der Erich Fromm Gesellschaft zum Thema<br />
„Macht und Medien“ am 28. Mai 2011, Mainz.<br />
Michael Behrent, Kommunikationsberater Frankfurt, www.script.com<br />
177
Steuert Öffentlichkeitsarbeit die Medien?<br />
Von Klaus Kocks<br />
Ein PR-Manager soll über PR reden. Beginnen wir also mit dem notorisch geringen<br />
Wahrheitswert von Selbstauskünften Gewerbetreibender über ihr jeweiliges<br />
Ge werbe. Man darf nie die Frösche fragen, wenn man einen Sumpf trockenlegen<br />
will. Deshalb sind Journalisten so schlechte Zeugen für den Zustand der Presse.<br />
Aber man fragt hier ja auch nicht die Frösche, sondern den Sumpf, was er von den<br />
Fröschen hält. Das ist eine ungewöhnliche, aber vielleicht doch aufschlussreiche<br />
Umkehr der Fragestellung. Wer steuert wen? Eine komplexe Frage. Ich habe mal<br />
von einem Ornithologen gelernt, dass im tropischen Regenwald die orangeroten<br />
Blüten der Strelitzien die Kolibris steuern, nicht umgekehrt. Die Pflanze steuert das<br />
Tier; wenn sie befruchtet werden will, ändert sie die Farbe, um das Tier zur Befruchtung<br />
anzufordern. Der Kolibri kommt dann, hält sich mit seinem hubschrauber -<br />
artigen Schwirrflügeln auf der Stelle und taucht den überlangen Schnabel ein,<br />
befruchtet und wird mit genau jener Menge Nektar belohnt, die er bereits für den<br />
Anflug verbraucht hat. Der Ornithologe glaubt, dass die Blumen sich den Schwirrflügler<br />
geschaffen haben und zwar mit einem besonderen langen Schnabel, damit<br />
er sie befruchten kann. Wer also steuert hier wen? Ein interdependentes System,<br />
in dem sich zwei Funktionen gegenseitig ermöglichen. Wer von beiden hat eine<br />
öffentliche Mission, die Blumen oder die Vögel? Die Vögel haben jedenfalls die<br />
größere Mühe.<br />
Gibt es eine Übermacht der PR? Und wenn ja, führt PR Böses im Schilde? Was kann<br />
die PR zur Beantwortung beitragen? Gäbe es diese Übermacht, würde PR sie leugnen.<br />
Führte PR Böses im Schilde, glauben Sie im Ernst, dass ausgerechnet PR dieses<br />
eingestehen würde? Also würde der Sumpf, in dem die Frösche gedeihen, immer<br />
so tun, als seien die Frösche die Krone der Schöpfung und die Strelitzien im Regenwald<br />
tun so, als gäben die Kolibris den Ton an.<br />
178
Public Relations, das meint Kommunikationsmanagement im Wege persuasiver<br />
Kommunikation auf der Basis eines ökonomisch bewehrten Interesses. Das ist keine<br />
Disziplin der Selbstkritik. Und es ist kein Gewerbe übermäßiger Transparenz. Hier<br />
stellt man sein Licht vorsätzlich unter den Scheffel. Da gilt das Roosevelt-Motto:<br />
„Speak softly, but carry a big stick!“ Eigentlich bin ich mit einer Selbstbestimmung<br />
der PR überfordert.<br />
Zweite Überforderung, nun zu der publizistischen Welt, die uns umgibt. Von welchen<br />
Medien reden wir? Ist dies die geordnete Welt, wie sie einst die Seite 1 der FAZ spiegelte?<br />
Mit Trennung von Meldung und Meinung, von Bericht oder Nachricht und<br />
Kommentar und mit der Trennung von Redaktion und Werbung? Hat nicht spätestens<br />
das Feature und dann das Internet all diese Sortierkästchen weggefegt? Journalismus<br />
ist, schmerzlich aber wahr, für alle jüngeren Generationen keine Profession mehr.<br />
Der Wert von Wikipedia liegt darin, so lernen wir, dass hier keine Experten schreiben;<br />
Expertise von Nicht-Experten, das ist neuerdings Leitkultur.<br />
Schließlich zum Unterschied von Journalismus und PR. Was auf unseren Baustellen<br />
der polnische Billiglöhner beim Fliesenlegen, ist der Journalist im PR-Geschäft. Aber<br />
das ist nicht nur individuelles Vergehen, sondern mittlerweile Geschäftspraxis.<br />
Kaum ein Verlag, kaum eine Redaktion, die heute nicht auch PR anbietet und hinter<br />
den Kulissen Corporate Publishing und Redaktion in vielfältiger Weise verschränkt.<br />
Hört man dazu die Gralshüter der Vierten Gewalt, fühlt man sich wie aus der Zeit<br />
gefallen. Sie reden, als stehe der Sündenfall noch bevor und man könne Adam<br />
noch raten, nicht in Evas Apfel zu beißen. Da draußen im Lande, wie man im Parlament<br />
sagt, ist aber nicht der Garten Eden, sondern Sodom und Gomorrha.<br />
Die Presse, so man ihr eine öffentliche Aufgabe zubilligt, was wohl eine allgemein<br />
politische Rolle, vulgo Vierte Gewalt, meint, wird zunehmend von PR abhängig,<br />
kann aber nicht ohne Weiteres von einer einzelnen PR gesteuert werden. Steuert<br />
PR die Presse: ja und nein! Wir haben es mit einem relativ autonomen, aber multikausal<br />
bestimmten System zu tun, dessen Überdetermination durch PR zunimmt.<br />
Der Einfluss der Public Relations überhaupt auf die freie Presse, wenn man darunter<br />
unabhängige Redaktionen versteht, steigt. Er hat sogar ein Ausmaß angenommen,<br />
das es angebracht erscheinen lässt, von der Gefahr eines Systembruchs zu reden.<br />
Dazu gibt es empirische Hinweise aufgrund unterschiedlicher Methode und folglich<br />
in unterschiedlicher Qualität. Man kann die Anzahl von Pressemitteilungen mit der<br />
Anzahl der erschienenen Artikel zu einem Anlass oder Thema vergleichen. Oder die<br />
Angehörigen der beiden Berufsstände „Pressesprecher“ versus „Journalisten“<br />
einem headcount unterziehen. Oder die Selbstbefindlichkeit von Journalisten<br />
mittels Fragebögen zum normativen Kanon stilisieren. Oder Verstöße gegen die<br />
179
Ehrenkodizes in Presse- oder Werbe- oder PR-Wächterräten zählen. Das ist aber<br />
alles, obwohl akademische Praxis, recht vordergründig.<br />
Das ökonomisch wirklich basale Moment ist die von Verlegern betriebene industrielle<br />
Rationalisierung von Redaktionen und die vorsätzliche Externalisierung von<br />
Redaktionskosten auf sogenannte Contentprovider, von denen man wissen kann,<br />
dass sie das Gratisangebot verdeckt durch eine dritte Quelle finanzieren, also<br />
einem dritten Interesse folgen. Redaktion kostet, PR gibt es gratis, das ist ein<br />
Verleger-Gospel. Die Pressefreiheit hat einen klaren Feind, die Verleger. Und der<br />
Presserat ist, wenn ich das überspitzt sagen darf, die PR-Agentur der Verleger zur<br />
Nebelung des systematischen Tatbestands durch akzidentielle Kritik.<br />
Geläufig ist die Diskreditierung von Reise-und Motorjournalismus als PR-gesteuert,<br />
aber dies ist zugleich eine wohlfeile Heuchelei und eine arrogante dazu, insbesondere<br />
der Herren in der Wirtschaft und im Feuilleton und allemal der Großkopferten<br />
in der Politik. Motorjournalisten haben in aller Regel das Auto, über das sie urteilen,<br />
auch tatsächlich selbst gefahren. Zugegeben, unter angenehmen Rahmenbedingungen,<br />
aber eben doch unter tatsächlichem Augenschein. Niemand kann behaupten,<br />
dass dies auch für die Wirtschafts-und Finanzpresse oder gar die Politik gelte. Hier<br />
reden allzu oft halb-qualifizierte Laien von Produkten, die sie nicht wirklich verstehen.<br />
Die Beispiele aus der letzten Finanzkrise sind Legion. Motorjournalisten haben<br />
wenigstens einen Führerschein. Aber die mangelnden Fahrkünste der Teilnehmer<br />
an den Börsenrallyes sind eher ein peripheres Problem. Es kommt schlimmer.<br />
Eines der Kernprobleme der Wirtschaftsberichterstattung liegt darin, dass alle<br />
Nachrichtenagenturen in den Händen derer sind, die die Geschäfte betreiben. Es<br />
herrscht Stamokap allenthalben. Bloomberg scheint mir für diesen Tatbestand<br />
paradigmatisch: erst Broker, dann Nachrichtenagentur, dann Bürgermeister. Geschäft,<br />
Medien und politische Macht in einer Hand. Man könnte das Bloomberg-Paradigma<br />
an Berlusconi extemporieren. Die Betroffenen bieten uns Bunga-Bunga, damit wir<br />
die wirklichen Fragen nicht stellen.<br />
Mein Einwand ist aber fundamentaler als die PR-Färbung dieses oder jenes Tenors.<br />
Das ist Kosmetik. Mein Einwand bezieht sich auf die systematische Integration der<br />
Funktionen „Geschäft“, „Politik“ und „Presse“ im Mediensystem. Ich wähle eine<br />
Metapher aus der Welt der Sportwetten, weil Börse im Kern nichts anderes als wetten<br />
ist. Wie geht das überhaupt, dass die Mitspieler eines Spiels zugleich auf den Ausgang<br />
des Spiels wetten dürfen? Wetten sie, wie sie spielen werden? Oder spielen<br />
sie, wie sie gewettet haben? Diese Frage ist von fundamentaler Bedeutung für die<br />
Kapitalmärkte, die über Wohl und Wehe ganzer Nationen entscheiden.<br />
180
Die Presse wird in einem integrierten System zu einer Funktion der Geschäfte und<br />
der Politik. Nicht immer einer einzelnen Parteipolitik. Nicht immer eines einzelnen<br />
Geschäfts. Aber immer öfter Funktion. Wenn also PR früher mal in einem Anbietermarkt<br />
agierte, so agiert PR heute zunehmend in einem Nachfragemarkt. Das ist die<br />
ökonomisch und publizistisch fundamentale Änderung. Hier hat der polemische<br />
Satz seinen Ort, dass man als PR-Manager gar nicht so viel lügen könne, wie die<br />
journalistische Nachfrage es verlange.<br />
Schon immer hat der arbeitsscheue, aber meinungsstarke Journalismus als sein<br />
Naturrecht begriffen, dass Stakeholder ihre Interessen in aufbereiteter Form zur<br />
Veröffentlichung anbieten müssen. Man reklamiert die Informationspflicht von<br />
Behörden, überträgt sie auf Unternehmen und weitet den Anspruch auf Informationen<br />
zur Sache auf ein Recht zu O-Tönen und TV-Interviews aus. Sonst heult die<br />
Journaille scheinheilig auf. Mit dem wachsenden Einfluss von Kapitalmärkten stützt<br />
sich dieses Begehren auch auf das Recht von Aktionären zu wissen, wie die Dinge so<br />
laufen. Im Politischen ist dies die Partizipationskultur, die sich der repräsentativen<br />
Demokratie auf die Schultern hockt. Folglich entsteht der Beruf des vorjournalis -<br />
tischen Informationsaufbereiters, vulgo Pressesprecher oder PR-Manager.<br />
Ökonomische Sonderform, über die man nachdenken muss: Da diese Dienst -<br />
leistung nicht <strong>vom</strong> Nachfrager bezahlt wird, sondern <strong>vom</strong> Anbieter, ist konkludent,<br />
dass ihr eigentlicher wirtschaftlicher Wert in einem mehr oder weniger verbor -<br />
genen Zusatznutzen für den Anbieter bestehen muss. Deshalb ist die polemische<br />
Metapher zutreffend, dass PR der Parasit einer freien Presse ist; Gesundheit des<br />
Wirtstiers willkommen. Die Rechnung bezahlt der Leser, die Gesellschaft, das<br />
Gemeinwesen.<br />
Relevant für den Zustand des Gesamtsystems ist nun die Frage, ob es sich bei dem<br />
PR-Einfluss um eine Nebenfunktion oder gelegentliche Störfälle eines ansonsten<br />
intakten Systems handelt (Unterdetermination) oder ob die Funktionalisierung von<br />
Journalismus schon so weit gediehen ist, dass die Strukturen an der Oberfläche<br />
nicht mehr den Tiefenstrukturen entsprechen (Überdetermination). Sieht aus wie<br />
Presse, ist aber PR. Die Verlässlichkeit der Information besteht dann nur noch in<br />
Folge der Vielzahl der PR-Einflüsse, die sich idealiter die Waage halten. Oder in<br />
einem Chaos, das sich einer diktatorischen Vereinheitlichung verschließt. Damit<br />
wechselt „check+balances“ in die PR, die zum eigentlichen Regulator geworden<br />
ist. Im publizistischen System wechselt die Reglerleistung von relativ autonomen<br />
Redaktionen auf eine Angebotsvielfalt von PR, in der viele eine große Chance haben,<br />
da die spezifischen Kosten dramatisch sinken; im Web sinken sie linear gegen Null.<br />
„Have your say“: das ist der neue Imperativ an jedermann.<br />
181
Ich argumentiere im Sinne einer Kybernetik der zweiten Ordnung, erspare Ihnen<br />
aber den Wissenschaftsjargon. Der Journalismus selbst diskutiert diesen Strukturwandel<br />
in der Metaphorik der Dekadenz, eines Sittenverfalls, gegen den man<br />
moralisch zu stehen habe, um den Titel eines larmoyanten Selbstvergewisserungsbuches<br />
aus journalistischer Feder zu zitieren. Da erscheint PR als Beelzebub, dem<br />
zu widerstehen ist. Ach je, da schaffen sich die Herren Redakteure kleine Teufelchen<br />
der Versuchung und brüsten sich mit Unabhängigkeit gegenüber diesen Phantasiegestalten.<br />
Not good enough.<br />
Verteidigen müsste die professionellen Privilegien der Journalisten, zumindest<br />
akzeptable Arbeitsbedingungen, eine gewerkschaftliche Organisation der Journalisten.<br />
Der DJV ragt an seine Aufgaben nicht mal ansatzweise heran. Er selbst ist<br />
PR-durchtränkt und PR-geleitet. Gewerkschaftlich wie publizistisch ist der DJV ein<br />
schlechter Witz prätentiöser Apparatschiks. Der DJV ist gewerkschaftlich das, was<br />
die Verleger sich wünschen, und publizistisch das, was die PR mag. Der Niedergang<br />
der Publizisten ist auch daran zu erkennen, dass er in diesem Land nicht ernsthaft<br />
diskutiert wird. Stimmen von Gewicht hört man allenfalls im „Netzwerk Recherche“,<br />
das sich in einer großen Geste gegen die journalistische Alltagswirklichkeit<br />
zusammengefunden hat.<br />
PR ist eine gegenläufige kommunikative Rolle zu der des Journalisten. Verleger<br />
müssen ihre Redaktionen so stellen, dass sie PR nutzen können, aber nicht PR<br />
unterliegen, weil ihnen hinreichende Arbeitsbedingungen entzogen werden. Aus<br />
der Perspektive eines Journalisten ist eine einzelne interessengebundene Einflussnahme<br />
gut zu wissen, aber als einzelne prinzipiell problematisch, und das heißt:<br />
immer zu problematisieren. Jede Quelle ist suspekt. Das wissen gute Historiker.<br />
Man macht sich im Interesse der Meinungsbildung des Bürgers mit keiner Sache<br />
gemein, auch nicht einer guten.<br />
PR ist ordnungspolitisch unproblematisch, solange Identität, Interesse, Ideologie und<br />
Intention prinzipiell erkennbar sind. Das ist meine Theorie der vier I. Da PR aber genau<br />
diese Transparenz systematisch, nicht nur akzidentiell, zu vermeiden versucht, ist PR<br />
auch akzidentiell problematisch. Jede Quelle ist suspekt. Das wissen, wie gesagt,<br />
gute Historiker. Man macht sich mit keiner PR gemein, auch nicht einer transparenten.<br />
Ob die Waffengleichheit von Pressesprechern und Journalisten noch besteht oder<br />
das System kippt, ist eine so wichtige Frage, dass man sie fallweise und konkret zu<br />
beantworten hat. Wir kennen Fälle, in denen Funktionalisierungen des Systems<br />
Tiefenstrukturen nachhaltig ändern, sodass die Anmutung eines Systems nicht mehr<br />
sein wirkliches Wirken erkennen lassen. Jeder Wahrheitsanspruch ist suspekt. Man<br />
macht sich mit keiner Wahrheit gemein. Aber das kennen Sie ja schon.<br />
182
Die Branchenpolitiker der PR und jene Professoren, die sie dabei willfährig alimentieren,<br />
teilen meine Sicht der Dinge entschieden nicht. Man ist mit Bezug auf<br />
berufsethische Kodizes bemüht, PR zu einem Instrument der Wahrheitspflege und<br />
einem originären Ausdruck demokratischer Kultur zu stilisieren. Ein Wächterrat will<br />
Regelverstöße sanktionieren. Das aber ist keine Selbstregulierung. Es ist der Versuch,<br />
Kritiker in den eigenen Reihen mundtot zu machen. Ich selbst bemerke das<br />
Wirken des Wächterrates vor allem darin, dass die hier vorgetragenen Überlegungen<br />
einer Zensur unterzogen werden sollen. Weil man, das ist die eigentliche Agenda,<br />
PR für PR machen möchte. Weil man Glaubwürdigkeit für sich reklamiert. Die Fünfte<br />
Gewalt plustert sich gegenüber der Vierten. Wenn das angemessen wäre, was dort<br />
normativ über PR gesagt wird, dann könnte man die Redaktion getrost gleich ganz<br />
nach Hause schicken. Dann fragen wir künftig Doktor Marlboro, ob Rauchen gesund<br />
ist. Und Angela Merkel, ob die Regierung was taugt. Vielleicht sollte man die<br />
Zeitungen dann auch Prawda, zu deutsch: Wahrheit, nennen.<br />
Ich fordere also von meinem Berufsstand die Einhaltung der vier I: prinzipielle<br />
Erkennbarkeit von Identität, Interesse, Ideologie und Intention. Und ich sage den<br />
Journalisten: Sie müssen immer und überall davon ausgehen, dass genau damit<br />
gespielt wird. Nicht als Unfall oder Zufall, sondern systematisch.<br />
Aber noch mal zum Kippen des Systems: In dieses Spiel dringen jetzt alle großen<br />
und kleinen Redaktionen ein, indem sie selbst PR als Dienstleistung anbieten. Und<br />
unverhohlen die redaktionelle Expertise als Consulting verkaufen und dabei verhohlen<br />
redaktionelle Abdeckung anbieten.<br />
Wenn aber nun Einzelfälle um herausgehobene PR-Manager, die es gibt oder nicht,<br />
Schlagzeilen machen, die die Grenzen zwischen Information und Desinformation,<br />
zwischen Beratungsgewerbe und organisierter Kriminalität verwischen, so ist das<br />
kein Problem meiner Position. Ich habe ja alle Beteiligten hinreichend gewarnt. Es<br />
ist ein Problem jener Chefredakteure, die vor diesen spin doctors auf und ab wieseln.<br />
Diese Schattengestalten werden, so hört man, in den Chefredaktionen hofiert, weil<br />
– Sie kennen mein Argument – PR kein Anbietermarkt mehr ist, sondern ein Nachfragemarkt.<br />
Das Spindoctoring ist, ökonomisch präziser formuliert, in die Rolle des<br />
umworbenen Lieferanten gebracht worden, dessen Rohstoffe man für das herzustellende<br />
Produkt dringend braucht, weil eben dieses Produkt Ware ist, in einem<br />
wettbewerbsintensiven Nachahmungsmarkt. Desinformation versucht man, wenn<br />
es eben geht, zu verhindern, aber lieber eine faule Story mitgeschleppt, als sie den<br />
anderen Blättern gelassen. Vor dieser Tür müssen die Journalisten kehren.<br />
Die Citoyen müssen sich in der Presse über die Bourgeois erheben dürfen, auch<br />
wenn wir hier über ein und dieselbe Gruppe reden. Und insofern ist Presse eben<br />
183
nicht Vierte Gewalt, eine Funktion des Gemeinwohls (volonté générale), sondern<br />
nur eine Funktion des gemeinsamen Interesses (volonté de tous), gegen das zu<br />
verstoßen das Wesen guter Geschäfte sein kann. Citoyen und Bourgeois sind Gegner,<br />
nicht Partner. PR und Presse als Intereffikation vereinheitlichen zu wollen, ist ein<br />
Manöver der Gegenaufklärung.<br />
Demokratie ist kein Ponyhof.<br />
Was propagiere ich? Bei Kant gibt es die Unterscheidung <strong>vom</strong> öffentlichen und privaten<br />
Gebrauch der Vernunft. Mit privat ist bei Kant der Privatwirtschaftliche gemeint.<br />
Der Journalist verkaufe seinen Artikel oder sein Blatt, der Pressesprecher sein<br />
Anliegen. Oberhalb dessen liegt aber der öffentliche Diskurs darüber, was wir als<br />
aufgeklärte Menschen für vernünftig halten. Was uns als Maxime einer allgemeinen<br />
Gesetzgebung recht und gut erscheint. Was das moralische Prinzip in uns von uns<br />
verlangt. Diesem öffentlichen Gebrauch der Vernunft müssen sich Journalisten wie<br />
PR-Manager stellen wollen. Dazu sollten meine Ausführungen einen Versuch unternehmen.<br />
Prof. Dr. Klaus Kocks, Kommunikationsberater Horbach (Westerwald), www.cato-sozietaet.de<br />
184
Zwischen Platon und Postmoderne –<br />
Glückwünsche zu 50 Jahren Panorama<br />
Von Olaf Scholz<br />
Ich gebe zu: Als ich die Einladung bekommen habe, hier bei Ihrer Feier zu sprechen,<br />
habe ich mich als erstes gefragt: Warum laden die Dich ein?<br />
Wollen die den Ersten Hamburger Bürgermeister, der ein paar salbungsvolle Worte<br />
zum Medienstandort Hamburg spricht?<br />
Wollen die den Politiker, der schon manchen Strauß mit ihnen ausgefochten hat?<br />
Oder hatten die einfach nur noch einen Platz im Programm und brauchten nach<br />
Edmund Stoiber einen Sozialdemokraten, um öffentlich-rechtlich ausgewogen zu sein?<br />
Ich weiß es nicht, weil ich nicht nachgeforscht habe. Ich habe zugesagt, weil ich<br />
einmal im Leben die Chance haben will, bei Panorama ungeschnitten zu reden.<br />
Um mit dem Wichtigsten und Angenehmsten zu beginnen:<br />
Fünf der sechs ARD-Politmagazine werden in diesem Jahrzehnt 50 Jahre alt. Panorama<br />
als ältestes macht den Anfang.<br />
Herzlichen Glückwunsch zu diesem runden Geburtstag und zu dem ordentlichen Stück<br />
Mediengeschichte, das Sie und Ihre Vorgänger in Deutschland geschrieben haben.<br />
Panorama und andere waren lange Jahre stilprägend für die Art und Weise, wie im<br />
deutschen Fernsehen mit politischen Vorgängen umgegangen wurde. Investigativ,<br />
unbequem, kritisch – zugleich einordnend, orientierend und aufklärerisch.<br />
185
Insbesondere in den 70er Jahren gehörten die Politmagazine zur staatsbürgerlichen<br />
Erziehung. Damals war unser Land immer noch im gesellschaftlichen Aufbruch. Kritik<br />
an den öffentlichen Verhältnissen gehörte zum guten Ton.<br />
Meine Generation hat unter anderem von Panorama und Monitor gelernt, sich über<br />
die Zustände in unserem Land zu empören.<br />
Wir sind auch durch die Berichterstattung mutiger Reporterinnen und Reporter<br />
politisiert worden.<br />
Seitdem ist viel passiert: Dass Kongresse zur Lebensqualität ganze Debatten prägen<br />
können, dass der Sozialstaat ausgeweitet wird und dass Parteien auf der Bundesebene<br />
noch an der absoluten Mehrheit kratzen – das alles ist vorbei.<br />
Das ist natürlich auch an den Politmagazinen nicht spurlos vorbeigegangen. Ihr<br />
gesellschaftlicher Humus wird trockener.<br />
„Die Kräfte schwinden“ überschrieb die Journalisten-Zeitschrift „Message“ kürzlich<br />
einen Aufmacher über die Politmagazine. Symptome einer Midlife-Crisis werden<br />
sichtbar.<br />
Und ich muss ganz persönlich gestehen. Auch ich habe nicht mehr das brennende<br />
Gefühl, kein Politmagazin verpassen zu dürfen.<br />
Natürlich sehe ich die Sendungen anders, seit ich auch darin vorkomme. Aber da<br />
ist mehr. Dem will ich – verbunden in kritischer Solidarität – heute etwas nach -<br />
forschen: Warum haben die Politmagazine soviel von ihrer ehemaligen Durchschlagskraft<br />
eingebüßt?<br />
Und – wichtiger noch: Wie sorgen wir dafür, dass sie wieder relevanter werden.<br />
Wir alle wissen, dass sich die mediale Landschaft geändert hat: Neue Medien und<br />
Medienangebote sind dazu gewachsen, erst das private Fernsehen, dann das Internet.<br />
Plötzlich gab es den Heißen Stuhl, Daily <strong>Talk</strong>s und Big Brother. Und im Netz werden<br />
Dissertationen geschreddert und diplomatische Geheimprotokolle zu Tausenden<br />
eingestellt.<br />
Das Angebot an Informationen – sinnvollen genauso wie nutzlosen – ist unüberschaubar<br />
geworden. Unverarbeitbar. Im Fernsehen ist der virtuose Slalom um die Informationsprogramme<br />
herum, deshalb für viele geübter Alltag an der Fernbedienung.<br />
Man könnte die häufigen Wechsel des Sendeplatzes der Politmagazine schon fast<br />
als subversive Gegenstrategie begreifen: Wenn man nicht mehr weiß, wann<br />
186
Panorama läuft, kann man es auch nicht mehr gezielt umgehen. Der Zufallskontakt<br />
zwischen Zuschauer und Sendung wird wahrscheinlicher.<br />
In den heutigen Mediengewittern hat sich aber auch die Haltung vieler gegenüber<br />
dem geändert, was sie dort zu sehen bekommen.<br />
Unser Weg führt schnurstracks von Platon zur Postmoderne – oftmals leider unter<br />
Umgehung des vernünftigen öffentlichen Gesprächs, das wir doch alle gemeinsam<br />
beschwören.<br />
Platon berichtet in seinem berühmten Höhlengleichnis davon, dass wir vor uns<br />
Abbilder einer Wirklichkeit sehen, die uns selbst nicht zugänglich ist. Wir sitzen<br />
gefesselt am Höhlenboden und sehen im Feuerschein vor uns an der Wand die<br />
Schatten der wahren Welt hinter uns. Weil wir uns aber nicht umdrehen können,<br />
halten wir die Schatten für die wahre Welt.<br />
Ein bisschen so funktioniert auch das Fernsehen – zumindest hat man das lange Zeit<br />
gedacht: Wir bekommen dort Realitäten gespiegelt, die uns selbst vielfach nicht<br />
zugänglich sind – und halten diese für real. Kein Wunder, dass es das Höhlengleichnis<br />
zwischenzeitlich auch zu einiger Prominenz in der Medienphilosophie gebracht hat.<br />
Das Fernsehbild als Widerschein der Wirklichkeit. So haben wir damals Panorama<br />
gesehen und die Faust in der Tasche geballt, angesichts der Ungerechtigkeiten, von<br />
denen wir damals erfahren haben.<br />
Aber das war eben auch die Zeit, in der Medientheoretiker auch dachten, dass wir<br />
uns zu Tode amüsieren könnten (Neil Postman) und deswegen das Fernsehen –<br />
dieses „Leben aus zweiter Hand“ – abschaffen müssten (Jerry Mander).<br />
Heute wissen wir selbstverständlich, dass das Fernsehen nicht bloß die Realität<br />
reflektiert, sondern etwas Eigenes erschafft. Wir regen uns auch nicht mehr auf,<br />
wenn wir dabei unterhalten werden. Und das Fernsehen abschaffen will schon<br />
gleich keiner mehr.<br />
Wir wissen: Wir sehen auf dem Fernsehschirm keine Schatten der Wirklichkeit,<br />
sondern flüchtige Höhlenmalereien der Redaktion, aus deren Skizzenhaftigkeit<br />
sich jeder Betrachter selbst sein Bild machen muss.<br />
Das gilt auch für Panorama und andere Nachrichtenmagazine. Und das ist auch<br />
völlig in Ordnung. Daran, dass der Blick von außen auf anderes fällt als der Blick<br />
von innen, muss sich jeder Politiker gewöhnen, der mit Medien zu tun hat.<br />
187
Schwierig wird es, wenn der alte Platon durch die Hintertür wieder ins Bild schlüpft<br />
und die Malerei der Redaktion wieder zum Abbild der Politik verklärt wird, nach<br />
dem Motto: Jetzt zeigen wir Euch mal wieder, wie die da wirklich sind, was die da<br />
wirklich machen und wie die Euch und uns nicht ausreichend ernst nehmen.<br />
Und schwierig wird es natürlich auch, wenn sich Redaktionen in die völlige postmoderne<br />
Beliebigkeit verabschieden nach dem Motto: Das ist halt meine Sicht,<br />
ihre ist eine andere. Ist doch schön, dass wir das beide sagen können. Das<br />
Anything goes führt meist zum Stillstand der Debatte.<br />
So einfach darf es sich heute niemand machen. In der Mediengesellschaft gibt es<br />
einerseits keine Kanzel mehr, von der aus ewige Wahrheiten und unumstößliche<br />
Ansichten verkündet werden.<br />
Alles steht täglich zur Disposition. Gerade deshalb sind wir aber andererseits<br />
darauf angewiesen, dass wir uns in der Gesellschaft auf ein gemeinsames Bild<br />
unserer Zeit einigen und zumindest in den grundlegenden Beschreibungen nicht<br />
völlig auseinander gehen. Wir brauchen einen Weg zwischen Platon und Postmoderne.<br />
Wir leben in einer Zeit, in der keiner den Zugriff auf die Wahrheit und die Wirklichkeit<br />
gepachtet hat. Kein Politiker und kein Panorama-Redakteur.<br />
Wir bieten unsere Interpretation der Geschehnisse an und legen sie zu dem großen<br />
Mosaik dazu, das wir gemeinhin unsere Öffentlichkeit nennen.<br />
Ich begreife die demokratische Öffentlichkeit als ein großes Gespräch zur Zeit, in dem<br />
unterschiedliche Interpretationen und Interessen, Meinungen und Mutmaßungen<br />
aufeinandertreffen.<br />
Der zwanglose Zwang des besseren Arguments entscheidet darüber, welcher These<br />
wir glauben schenken. Diese Idee hat Kraft, selbst wenn sie nicht befolgt wird.<br />
Wer aus diesem Diskurs aussteigen will, dem bleibt nur der Ausstieg aus dem Ge -<br />
spräch. Oder er reagiert wie der US-Politiker, der Mitte des letzten Jahrhunderts öffentlich<br />
bedauerte, dass man auf das Fernsehen nicht mit dem Gewehr schießen könne.<br />
Ich will kein Gewehr. Ich will ein Gespräch. Und gerade deswegen ärgere ich mich,<br />
wenn dieses Diskursive aus der Öffentlichkeit vertrieben wird.<br />
Daran haben Politiker wie Journalisten ihren Anteil. Wir entziehen damit aber<br />
gemeinsam den Legitimationsgrund, auf dem wir stehen.<br />
188
Jeder Politiker kennt das: Man gibt ein langes und umfangreiches Interview, antwortet<br />
sogar aufrichtig und ehrlich – und dann finden sich davon nur einzelne<br />
Passagen im Bericht und das in einem Kontext, der wenig mit den ursprünglichen<br />
Fragen zu tun hat.<br />
Ich kenne Kollegen, die fragen mittlerweile, wie viel Sekunden sie in dem Beitrag<br />
haben und dann liefern sie ein Statement, das keinen Wimpernschlag länger ist –<br />
und nichts weiter. Andere beantworten lediglich schriftliche Fragen schriftlich.<br />
Und auch wenn sie aus einer Sitzung kommen und zur nächsten müssen, dann<br />
können Sie kein differenziertes Gespräch mit einem Reporter führen. Die wenigsten<br />
Themen sind heute undifferenziert seriös zu besprechen. Deshalb lernen heute alle<br />
Spitzenpolitiker lächelnd an den Kamerateams vorbeizugehen, die Helmut Schmidt<br />
einmal der Wegelagerei bezichtigt hat.<br />
Schön ist das alles nicht. Auch nicht gesprächsorientiert. Manchmal begehen wir<br />
Politiker da putative Notwehr und bringen das öffentliche Gespräch um, bevor es<br />
uns durch Verzerrung schadet.<br />
Und manchmal tun wir das auch unnötig – keine Frage. Für mich zeigt das, wie viel<br />
Vertrauensarbeit wir wechselseitig leisten müssen.<br />
Journalisten und Politiker sind keine Partner, dürfen es auch nicht sein. Aber wir haben<br />
eine gemeinsame Verantwortung dafür, dass unsere Öffentlichkeit nicht weiter an<br />
demokratischem Gehalt verliert. Dazu brauchen wir Augenhöhe und Waffengleichheit.<br />
Es ist ganz einfach: Wir Politiker suchen nicht nach den Gewehren und sie Journalisten<br />
legen das im Mantel verborgene Schneidemesser beiseite, das unseren<br />
Gesprächsfaden zu zerschneiden droht.<br />
Stattdessen reden wir miteinander, hören uns zu und bleiben überzeugbar – auch<br />
wenn es der in der Konferenz bereits abgenickten These des Beitrags oder der<br />
Sprachregelung des Pressesprechers widerspricht.<br />
Ich habe der Panorama-Redaktion schon einmal den Vorschlag gemacht: Lassen<br />
Sie uns das Visier aufklappen: Fünf Minuten, ungeschnitten, live zu jedem Thema.<br />
Ich bin sofort dabei.<br />
Ich freue mich darauf, auf diesen Grill gelegt zu werden. Was ich nicht mag ist das<br />
Köcheln auf kleiner Flamme, bei dem aus einer differenzierten Betrachtung nach<br />
Wochen plötzlich etwas anderes wird.<br />
189
Wir brauchen kritischen Journalismus. Er bildet das Vertrauen in die Institutionen,<br />
die seiner Prüfung standhalten. Wir brauchen Journalisten, die Missstände aufspüren,<br />
Themen durchdeklinieren und die politisch Verantwortlichen zur Rede stellen.<br />
Erst sie machen eine Demokratie lebendig und funktionstüchtig. Aber das geht<br />
weder mit absolutem Wahrheitsanspruch noch mit spielerischer Leichtigkeit. Das<br />
ist harte Arbeit.<br />
Nehmen Sie den Namen Ihrer Sendung ernst: Panorama bedeutet Rundblick.<br />
Aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger müssen darauf vertrauen können, dass ihre<br />
Journalisten auch wirklich auf den Gipfel steigen und nicht vorher auf dem Grat<br />
zwischen Platon und Postmoderne ausrutschen.<br />
In der Midlife Crisis trauern ja viele dem jugendlichen Übermut nach. Ich empfehle<br />
ihnen: Vertrauen sie der Kraft ihrer Erfahrung. Werden sie gelassener – und lassen<br />
Sie sich gelegentlich auch einmal von uns überzeugen. Die Wahrheit liegt da draußen.<br />
Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Erfolg auf diesem schwierigen Weg. Wir brauchen<br />
Sie in Bestform!<br />
Olaf Scholz ist Erster Bürgermeister der Stadt Hamburg.<br />
190
Der Stachel im Journalisten-Sitzfleisch<br />
Von Tom Schimmeck<br />
Am Anfang war das Wort. Im Falle von netzwerk recherche in Form eines Buches:<br />
„Leidenschaft Recherche“. Anno 1999. Das schon im Klappentext den Missstand<br />
formulierte, der bis heute nicht behoben ist:<br />
„Im publizistischen Alltag ist die Recherche eine seltene Leidenschaft: Termin- und<br />
Arbeitsdruck, aber auch die unzureichende Kenntnis von professionellen Arbeitstechniken<br />
führt dazu, dass Journalisten sich meist auf die Ergänzungsrecherche auf<br />
der Grundlage einer Agentur- oder Zeitungsmeldung stürzen.“<br />
Das kam daher wie eine Selbstbesinnung auf den hehren Kern des geliebten Berufes.<br />
Und manchmal wurde es fast poetisch:<br />
„Erst Stille, dann ist Atem zu hören“, schrieb Hans Leyendecker im Vorwort: „Der<br />
Laptop zwitschert und piepst. Jemand rutscht auf dem Stuhl herum, klopft mit den<br />
Fingern auf der Schreibtischkante einen komplizierten Takt. Dann geht er auf und<br />
ab und schnieft ganz laut. Später hämmert er in die Tasten. Kurz gesagt: Da schreibt<br />
einer. Warum schreibt einer? Weil er nichts anderes gelernt hat oder weil er es weit<br />
bringen will?<br />
Wenn es weit gebracht hat, kreiselt er kunstvolle Kritiken im Feuilleton. Es gibt vorzügliche<br />
Reporter und in den Wirtschaftsteilen gut informierte Redakteure. Die<br />
Deutschen sind Meister im Meinungsjournalismus. Wer den Leitartikel tuten, den<br />
Fernsehkommentar sprechen darf, hat den Ausweis höchster Kompetenz erreicht.<br />
Aber die Zeitung und Sender beschäftigen nur wenige Rechercheure, die Enthüllungsstories<br />
liefern wollen. Die Sparte ist chronisch unterbesetzt.“<br />
Diesen Umstand galt es zu ändern. Nein, das Feuilleton sollte nicht geschleift, die<br />
eitlen Meinungsfürsten nicht entthront werden. Geplant war eher eine Art Wiederauferstehung.<br />
Man wollte die Erinnerung daran wachrufen, dass die selbst gewon-<br />
191
nene Information, das Hinausgehen und ganz eigenständig Hingucken, das Be -<br />
schaffen und Durchwühlen von Dokumenten, der Kontakt mit echten Menschen,<br />
mit dieser verdammt komplizierten Wirklichkeit außerhalb der vollklimatisierten<br />
Redaktionsstuben, das Eigentliche, das Wesentliche, das, wie es neudeutsch heißt:<br />
Kerngeschäft des Journalismus sind. Und alles weitere eher wunderhübsches Beiwerk.<br />
Das Buch, herausgegeben von Thomas Leif, bündelte Recherche-Erfahrungen von<br />
zwei Dutzend Journalisten. Da wurde robuste Hardware geliefert. Themen wie Aids,<br />
Diamanten, Neonazis und der Balkan. Ein Text, da habe ich wirklich gestaunt,<br />
befasste sich mir einer „heimlichen Seuche“ namens EHEC, mit Fällen von 1995. Da<br />
war das Netzwerk seiner Zeit voraus. Es hatte, könnte man sagen, schon immer<br />
eine Schwäche für Erreger.<br />
Man kannte sich.<br />
Manche schon ewig, andere nur flüchtig. Und stellte gemeinsam bald fest, dass<br />
jeder Einzelne oft ein bisschen einsam ist. Dass diese Rechercheure, die Spürnasen,<br />
die Trüffelschweine in ihren Zeitungen und Sendern eher Solisten sind. Einzelkämpfer.<br />
Kaum vernetzt. Was weniger an ihrem ausladenden Ego liegt als an der<br />
Rolle, die Rechercheure in den Hierarchien einnehmen. Wie überhaupt alle, die viel<br />
„rausgehen“ in die Realität. Sie sind unverzichtbar, klar. Geachtet sowieso, sicher.<br />
Aber sie sind eben oft nicht Teil der großen Routine, der ewigen Konferenzen und<br />
Kaffeerunden. Sind auch keine Hierarchen. Eher Außenseiter.<br />
„Dazu kam“, schrieb Thomas Leif neulich in einem Rückblick auf die Anfänge, „meine<br />
persönliche Erfahrung nach einem Jahrzehnt im Feld des Magazin-Journalismus und<br />
der Feature-Produktion in der ARD. Recherche-Journalismus war auch hier immer<br />
wieder bedroht: Fünftes Rad am Wagen, von Presseanwälten und betroffenen Lobbygruppen<br />
attackiert, unter Quotendruck und stets im Stahlbad politischer Interessen.“<br />
Und dann, Ende März 2001, traf sich eine etwa 40köpfige Schar – andere Quellen<br />
sprechen von „mehr als 35 Journalisten“ – in der Eifel, in einem Kaff namens<br />
Simmerath-Erkensruhr, besiedelt seit römischen Kaiserzeit. Man enterte ein verblassendes<br />
Wellness-Hotel, redete und schuf den „netzwerk recherche e. V.“. Über<br />
alle journalistischen Klassenschranken hinweg. Am 1. April. Kein Scherz.<br />
Hans Leyendecker war schon dabei, Kuno Haberbusch, Christoph Maria Fröhder<br />
und natürlich Thomas Leif. Das erste Motto lautete: „Recherche fordern und fördern.“<br />
„Fordern und fördern“ – das klingt, rückblickend, ein bisschen nach neuer Mitte<br />
und Hartz IV. Eine Satzung war schon entworfen. Und es wurde auch gleich ein Vorstand<br />
gewählt. Die Legende besagt, ein gewisser Georg Mascolo habe an jenem<br />
Wochenende einige Kandidaten-Namen auf einem Bierdeckel notiert.<br />
192
Aber – ich sage es für alle anwesenden Jury-Mitglieder des Henry-Nannen-Preises<br />
gleich dazu: Ich habe das nur gelesen. Auch überprüft. Ich war nicht dabei.<br />
Wozu das Ganze?<br />
Was war das, sagen wir mal: Ausgangsideal? Das große Ziel?<br />
Das Netzwerk, heißt es in den Grundsätzen „tritt ein für den in Deutschland<br />
vernachlässigten recherchierenden Journalismus. Es vertritt die Interessen jener<br />
Kollegen, die oft gegen Widerstände in Verlagen und Sendern intensive Recherche<br />
durchsetzen wollen.“<br />
Aber es sollte mehr sein als eine Wärmestube für einsame Rechercheure. Der Verein<br />
– mit vollen Namen heißt er übrigens „Netzwerk Recherche“ – Verein zur Förderung<br />
von journalistischer Qualität in der Medienberichterstattung“ – wollte von Anfang<br />
an ein Forum sein, ein Ort des Austausches und der Fortbildung. Auch ein Stachel<br />
im Journalisten-Sitzfleisch.<br />
Das Netzwerk begann, mit zahllosen Tagungen und Seminaren, mit Studien und<br />
Dokumentationen die Analyse, Kritik und Selbstkritik des Journalismus voranzutreiben.<br />
Es forciert dabei sozusagen die Recherche in eigener Sache, zum Thema<br />
Medien und Öffentlichkeit. Fordert stets mehr Leidenschaft, mehr Haltung, mehr<br />
Aufklärung ein. Und hat so eine permanente Qualitätsdebatte <strong>vom</strong> Zaun gebrochen.<br />
Dieses Netzwerk, das war bald klar, ist eine Truppe, die Ideale hochhält. Die sich<br />
selbst und anderen Feuer unterm Arsch macht. Die die selbstgenügsame Routine<br />
in den Verlagen und Sendern durchbrechen will. Die Moden und Macken der Branche<br />
aufs Korn nimmt. Und dabei manchmal ziemlich penetrant werden kann.<br />
Das hat nie allen gefallen.<br />
Gewissen Berufsverbänden etwa behagte die Konkurrenz nicht. Und unsere Attitüde<br />
– „Wir sind die Guten“ – geht sowieso manchem auf den Geist. Vor allem den Pragmatikern.<br />
Jenen, die sich selbst als „Realisten“ sehen. Die nicht fragen, wie man<br />
Dinge verändern, verbessern kann. Sondern nur, wie man irgendwie durchkommt.<br />
Einige Journalisten haben sich einen Sport daraus gemacht, uns als versnobten<br />
Elitetruppe abzupinseln. Wenn Sie ein bisschen googeln, werden Sie bald auf verlässliche<br />
Feinde des Netzwerks Recherche stoßen. Auf einen Medienjournalisten<br />
etwa, der uns gerne mal als „Clübchen“ bezeichnet, als „Netzwerk Pippi Langstrumpf“,<br />
als Häuflein von „im eigenen Saft drehenden Gestrigkeitsfanatikern“.<br />
Und dahinter einen – Zitat – „Journalistengeheimbund“ wittert, „der sich teilweise<br />
auf dem Niveau des Fähnlein Fieselschweifs bewegt“.<br />
193
Sie stoßen sicher auch zügig auf ein kunterbuntes, wöchentlich online verbreitetes<br />
Organ, das dem Netzwerk und namentlich der Vorsitzende Thomas Leif regelmäßig<br />
und verlässlich einen überbrät. Selbst ich hatte schon mehrfach das Vergnügen,<br />
dort Prügel zu beziehen. Vorläufiger Höhepunkt war ein Vergleich meiner Wenigkeit<br />
mit Margot Honecker. Das war fast schon wieder lustig.<br />
Mit der Zeit kapiert man, dass man so etwas sportlich nehmen muss.<br />
Was aber irritiert, seit Jahren schon:<br />
Dass es vor allem ein Thema gibt, bei dem die Emotionen immer wieder hochkochen:<br />
Die Unvereinbarkeit von Journalismus und Public Relations. Der „Medienkodex“,<br />
jene kurzen zehn Gebote, die das Netzwerk vor fünf Jahren verabschiedete, sind<br />
wohl das bis heute umkämpfteste Dokument. Vor der Paragraph fünf, vier Worte,<br />
klar und simpel: „Journalisten machen keine PR.“<br />
Der Satz war schon damals heiß umstritten. Und die Debatte flammt immer wieder<br />
auf. Sie nimmt sogar noch an Schärfe zu. Was vor allem ökonomische Gründe hat.<br />
Denn in den ersten zehn Lebensjahren des Netzwerks hat sich die Lage vieler Journalisten<br />
enorm verschärft. Allen voran derer, die für Tageszeitungen arbeiten. Es<br />
gab, gerade auch bei den Top-Blättern, große Entlassungswellen. Pauschalen und<br />
Honorare wurden wieder und wieder gekürzt. Immer weniger Journalisten sind festangestellte<br />
Kräfte. Immer mehr sogenannte „Freie“, die immer flotter immer mehr<br />
Text ausstoßen müssen, um halbwegs über die Runden zu kommen. Das frisst Zeit.<br />
Und geht natürlich zu Lasten der Recherche. Es kostet auch Stolz und Würde. Weshalb<br />
immer mehr Leute, die eigentlich Journalisten sein wollen, nebenher, oder<br />
auch vollberuflich, PR-Arbeit annehmen, für Pressestellen, Agenturen oder Firmenzeitungen<br />
arbeiten. Die oft deutlich besser zahlen.<br />
Das geht an die Substanz. Da tut sich eine Front unter Journalisten auf. Die, die es<br />
tun, die nebenbei PR machen, fühlen sich irgendwie ertappt, herabgewürdigt,<br />
gedemütigt. Die sagen sich: Ooh, wie gerne wäre ich ein prinzipienfester, rundum<br />
integrer, gründlich recherchierender Journalist. Und, wann immer ich es irgendwie<br />
schaffe, will ich einer sein. Oft aber ich kann nicht davon leben. Weil mir mein<br />
Lokalblatt nur 20 Cent pro Zeile bezahlt. Weil mir mein Lokalradio nur 90 Sekunden<br />
gibt. Weil ich als Onliner ohnehin Billiglöhner bin. Zum Teufel mit den hehren Geboten.<br />
Ich muss überleben, sagt sich der Journalist in der Zwickmühle. Ich muss pragmatisch<br />
sein. Die können mich mal.<br />
Da nerven dann irgendwann diese „Puristen“ <strong>vom</strong> Netzwerk, die immer die Fahne<br />
der Moral hochhalten. Da kommen Aggressionen hoch. Da ist schnell von den festangestellten<br />
Luxusjournalisten die Rede, von alten Posteninhabern, die keine<br />
194
Ahnung haben, was die Generation Praktikum und Zeitvertrag so durchmacht; was<br />
es heute heißt, zum journalistischen Prekariat zu gehören. Es ist eine oft sehr harte<br />
und persönlich geführte Debatte.<br />
Das erleben wir selbst bei den „Freischreibern“, die uns ja freundschaftlich verbunden<br />
sind. Im Onlineshop der Journalistenvereinigung „freischreiber“ gab es für kurze<br />
Zeit eine „Ethik-Ampel für freie Journalisten“. Das Ding – ich zitiere mal von der<br />
Website – „zeigt zuverlässig an, in welcher Funktion ein Journalist oder eine Journalistin<br />
gerade arbeitet.“ Steht die Ampel auf Rot „wird an ordinären Werbe-Texten<br />
herumgeschrieben, steht sie auf Gelb, handelt es sich um das feinere Corporate<br />
Publishing. Und bei Grün ist der freie Journalist ganz in seinem Element.“<br />
Der Freischreiber-Vorstand, so hörte ich, hat sich fast zerlegt ob dieser „Erfindung“.<br />
Wobei das wohl seit der PR-Tagung im Frühjahr erst einmal ausdiskutiert ist. Aber<br />
ich bin sicher: Das wird wieder aufbrechen. Die Debatte wird weitergehen.<br />
Was ist erreicht?<br />
Auf der Website des Netzwerks ist das „Rundgespräch“ zum Thema: „Investigativer<br />
Journalismus in Deutschland“ dokumentiert, das der Vereinsgründung vorausging.<br />
Gut 68 000 Zeichen, ein ziemlicher Riemen. Doch sehr interessant zu lesen. Weil er<br />
zeigt, wie mühsam man sich damals an die Themen herantastete. Wie beeindruckt<br />
viele waren von den US-amerikanischen Kollegen.<br />
Heute hat das Netzwerk Recherche genau 555 Mitglieder! Da ist ein Forum entstanden,<br />
wo man intensiv über die eigene Arbeit reden kann. ein Ort, wo Konkurrenten<br />
kooperieren. Wo es mal nicht in erster Linie um die tolle Schreibe geht, – jaa, die<br />
ist auch wichtig –, sondern um die Tücken und Tricks im recherchierenden Alltag.<br />
Ums Handwerk. Wo man sich Mut macht und lernt, wie man dranbleibt, wie man<br />
Quellen auftut. Was man etwa wie aus den Tiefen des Datenozeans fischen kann.<br />
Das Netzwerk setzt Standards. Es vergibt einen Positivpreis, den „Leuchtturm für<br />
besondere publizistische Leistungen“, mit dem hervorragende Journalistenleistungen<br />
gewürdigt werden sollen. Und einen Negativpreis, die „Verschlossene Auster“. Den<br />
haben schon Otto Schily und der Bahnchef Mehdorn, Wladimir Putin und die<br />
Katholische Kirche bekommen. Wenn die Gekrönten den Schneid haben zu kommen,<br />
entstehen sogar interessante Kontroversen. Wir haben das im letzten Jahr hier im<br />
Fall der katholischen Kirche erlebt.<br />
Dieser kleine Verein hat zugleich das Bewusstsein der Medienwelt nachhaltig verändert.<br />
Er bewahrt sie vor Realitätsverlust. Weil er immer wieder die Strukturen<br />
durchleuchtet. Weil er die so laut bejammerte Medienkrise kritisch begleitet, das<br />
195
Versagen der Verlage genauso thematisiert wie den Quotenwahn der Anstalten.<br />
Weil er die Mechanismen des Herdentriebs offenlegt. Und, stets aufs Neue, die Tricks<br />
der PR, der wachsenden Spin-Industrie.<br />
Weil er, wieder und wieder, die Frage aufwirft: Was behindert die Recherche? Was<br />
torpediert unsere gute Arbeit? Unseren Journalismus, der uns lieb und teuer ist,<br />
den wir alle machen wollen, mit Spaß und Leidenschaft. Weil er so viel mehr bedeutet<br />
als das Vollmachen von Seiten und Sendeflächen. Und garantiert nichts gemein hat<br />
mit dem von Medienmanagern und Controllern ersonnenen multifunktionalen,<br />
crossmedialen Billig-Journalismus, der nur noch Marketing „veredelt“.<br />
Was fehlt?<br />
Ist irgendwann alles gesagt? Endet dann die Debatte? Niemals. Weil es immer neue<br />
Herausforderungen gibt. Weil Journalismus jeden Tag wieder Tolles vollbringt und<br />
unglaubliches Unheil anrichtet.<br />
Und weil der Nachwuchs – und nicht nur der – immer wieder neu lernen muss, wie<br />
unverzichtbar es ist, dass Journalisten ran müssen an die Wirklichkeit – Hingehen<br />
müssen, gucken, nachfragen, nachlesen, RECHERCHIEREN. Journalismus, hat<br />
Hans Leyendecker mal gesagt, „ist nicht nur Broterwerb, sondern man hat auch<br />
eine Vorstellung von den Dingen, wie sie ungefähr laufen sollten.“<br />
Andererseits könnte man nach zehn Jahren resümieren: Es ist eigentlich alles gesagt.<br />
Und staunt als Medienkritiker immer wieder, wie viele offene Türen man einrennt.<br />
Man geht zu den Hauptstadtjournalisten nach Berlin. Und die selbst erzählen<br />
einem sehr präzise, wie absurd die journalistischen Mechanismen wirken, wie verrückt<br />
die Erregungsspiralen drehen. Und kommen doch nicht raus aus diesem Tanz.<br />
Man geht zu den Sportjournalisten und veralbert ihre immer gefühligere Masche.<br />
Weil die jetzt ständig live fragen müssen, wie toll sich wer fühlt und alle fünf Minuten<br />
jubeln müssen, wie super die Stimmung grad wieder ist. Und sie lachen und sagen:<br />
Ja, das ist albern.<br />
Man geht hin zu den Börsenjournalisten in Frankfurt und sagt ganz frech: Ihr macht<br />
hier doch nur Show, vor künstlicher Kulisse. Jodelt den Dax rauf und runter. Und die<br />
sagen: Ja genau. Und es ist scheußlich.<br />
Ich glaube, die meisten Journalisten wissen heute recht genau, was sie tun. In welchen<br />
Zwängen sie stecken. Individuell aber fehlt ihnen die Macht und die Kraft, etwas zu<br />
verändern.<br />
196
Was ich mir für die Zukunft wünsche: Dass dieses Netzwerk möglichst vielen die<br />
Kraft gibt, den besten Journalismus zu machen, zu dem sie fähig sind. Und dass<br />
dem netzwerk diese Mischung aus Handwerk plus Haltung weiter gelingt.<br />
Denn wir brauchen, gerade in der globalen, superkomplexen Wikileaks-Ära, mehr<br />
recherchierenden Journalismus denn je. Mehr Wissen. Mehr Können. Mehr Einordnung<br />
und Gewichtung. Und, ja, es gibt auch im heutigen „Mediengewitter“ unglaublich<br />
viel guten Journalismus. Leider braucht man eigentlich einen Assistentenstab,<br />
der einem die Spreu <strong>vom</strong> Weizen trennt.<br />
Noch etwas persönliches.<br />
So ein Netzwerk von Journalisten wird immer eine Gratwanderung sein.<br />
Journalisten sind ein fürchterliches Volk. Eigensinnig, spinnert, empfindlich. Gehetzt,<br />
misstrauisch, besserwisserisch, eifersüchtig, nachtragend. Sie haben obskure<br />
Obsessionen. Sie sind oft keine sehr sozialen Wesen.<br />
Und wir haben gerade eine kleine Krise im Netzwerk, wo auch ein paar dieser<br />
Eigenschaften hervorlugen.<br />
Mir fällt Lob immer schwer.<br />
Aber ich finde, es ist ein ganz großer Zwischendank fällig an Thomas Leif, Er ist der<br />
Motor dieses Ladens. Er hat auch mich in den letzten Jahren mit viel Elan auf diverse<br />
Bühnen gepeitscht. Und aus mir und vielen anderen manches herausgeholt, von<br />
dem wir gar nicht wussten, dass es da ist …<br />
Tom Schimmeck, Publizist, lebt in Hamburg<br />
197
198<br />
INTERESSANT VOR RELEVANT?<br />
ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT UND IDENTITÄTSVERLUSTE –<br />
WOHIN STEUERT DER JOURNALISMUS?<br />
„Richtig informieren heißt auch schon verändern.“<br />
Rudolf Augstein, Düsseldorfer Rhein-Ruhr-Club 1953<br />
Feuchtgebiete und Schoßgebete oder Rettungsschirme und Ratingagenturen – Die Veränderung<br />
der Nachrichtenfaktoren greifen die Fundamente des informierenden Journalismus an<br />
Bundestagspräsident Norbert Lammert hat das Bundesverdienstkreuz verdient. Seit Monaten<br />
wird er nicht müde, auf die gefährdete „Legitimation“ der Demokratie und des Parlaments<br />
hinzuweisen. Die <strong>vom</strong> Volk gewählten Abgeordneten sollen nur noch eilig abnicken, was in den<br />
Verwaltungszentralen der Europäischen Kommission und im Kanzleramt in enger Kooperation<br />
mit der Finanzmarkt-Lobby zubereitet wurde. Sein Befund gilt ausdrücklich nicht nur im Zusammenhang<br />
mit der bedrohlichen Banken- und Schuldenkrise. Bis heute ist es nicht gelungen,<br />
die wahren Ursachen der Finanzkrise sauber zu analysieren, Verantwortliche zu benennen und<br />
die richtigen Konsequenzen aus der verheerenden Dominanz der Finanzmärkte zu ziehen. Nur<br />
in einem Punkt ist man sich einig: die Politik kann ihren Bürgern nicht nachvollziehbar erklären,<br />
warum „die Märkte“, Banken und verschuldete Staaten mit hunderten von Milliarden Steuergeldern<br />
„gerettet“ werden sollen? Wäre dies nicht die große Stunde der Medien, die die<br />
Zusammenhänge erklären und erläutern, die Interessen der Akteure entziffern und gefährliche<br />
Instrumente der Finanzmärkte enthüllen könnten? Zugegeben: etwas Selbstkritik der Wirtschaftsjournalisten<br />
gibt es, nach 23.00 Uhr waren sehenswerte Dokumentationen im Programm.<br />
Aber – gemessen an der demokratie-zersetzenden Rolle der unregulierten Finanzmärkte, wird<br />
sich die ‘Vierte Gewalt’ – bezogen auf ihrem Anspruch als Kritik- und Kontroll-Instanz – nur als<br />
viertklassig bilanzieren lassen. Über die Versäumnisse, Irrtümer und Defizite diskutieren in Mainz<br />
führende Wirtschaftsjournalisten; sie stellen sich der Kritik von ausgewiesenen Wissenschaftlern.<br />
Wenn Orientierungslosigkeit und die Identitätsverluste von Journalisten gemustert werden,<br />
darf der „blinde Fleck des Auslandsjournalismus“ nicht ausgeklammert werden. Während des<br />
<strong>MainzerMedienDisput</strong>s wollen wir den Blick auch auf den notleidenden Krisen-Journalismus<br />
richten. Nicht wenige Berichte aus Afghanistan könnten auch direkt von den mobilent-TV-Teams<br />
der Einsatzkräfte produziert sein. Distanzlosigkeit, Begleiteinsätze der Truppen, Ausklammern<br />
der Fakten rund um einen aussichtslosen Einsatz prägen einen Journalismus, der sich „freiwillig<br />
in die Handlungslogik des Militärs einbinden lässt“ (embedded journalism). Von den Hotel-Terrassen<br />
der Nachbar-Staaten wird über die Revolte in Libyen berichtet, Gerüchte werden aufgeworfen<br />
und dementiert oder faktenfrei aufgebauscht. Die gemeinsame Klammer nicht nur in diesem<br />
Krisengebiet: nichts genaues weiß man nicht. Den überforderten Reportern vor Ort kann man<br />
hier kaum einen Vorwurf machen. Als Einzelkämpfer im Fallschirm-Einsatz hängen sie meist an<br />
der Nadel der nationalen Planungs-Redaktionen, die wiederum die Instant-Texte der Nachrich-
tenagenturen für die einzig wahre road-map halten. In Mainz treffen sich erstmals Macher und<br />
Planer zu einem ehrlichen Diskurs über die Grenzen der Kriegs- und Krisenberichterstattung.<br />
Alle fabulieren von der zunehmenden Bedeutung des online-Journalismus. Aber – sieht das<br />
Innenleben dieser Sparte wirklich aus. Gibt es hier – bezogen auf das Spannungsverhältnis<br />
von interessant und relevant – eine Akzentverschiebung Richtung Boulevard mit einer Rückkopplung<br />
auf die etablierten Medien? Leben auch hier immer mehr Medienmacher von gefilterter<br />
Luft aus Fremdquellen l und entwickelt sich der Beruf immer rasanter zu einer Tätigkeit? Das<br />
heikle Spannungsverhältnis von Handwerk und Tätigkeit, von Aufklären und Abschreiben, von<br />
Eigenständigkeit und Fremdbestimmung, von Tiefenbohrungen und Textbearbeitung diskutieren<br />
auf dem <strong>MainzerMedienDisput</strong> u. a. die Chefredakteure der führenden online-Portale.<br />
Zum 16. Mal wird Ende <strong>November</strong> in Mainz darüber debattiert, ob der Journalismus in seinem<br />
Charakter und seinen Verfassungsauftrag immer weiter ausgehöhlt wird. Eine Frage, die zunehmend<br />
mehr demokratie-interessierte Bürger interessiert, die aber in der etablierten Medienkritik<br />
weitgehend ausgeblendet wird. Theodor W. Adorno hat dieses Leitmotiv des MedienDisputs<br />
schon vor Jahrzehnten auf den Punkt gebracht: „Das Recht der Menschen auf Öffentlichkeit<br />
hat sich verkehrt in ihre Belieferung mit Öffentlichkeit; während sie deren Subjekte sein sollten,<br />
werden sie zu deren Objekten.“ Weil es 2011 genügend Gründe gibt diese Frage mit aktuellen<br />
Beispielen zu unterlegen und die Folgen kontrovers zu diskutieren, laden wir zum Mitmachen<br />
ein. Wenn Journalismus mehr sein soll, als die Kommentierung von Marketing, mehr als Stofflieferant<br />
von Brot und Spielen oder gekaufter Kommunikation. Der Erkenntniswert für das Publikum<br />
muss wieder wichtiger werden, als der Gesprächswert. „Sozialpornos“ in der Tarnung von<br />
scripted-reality Formaten der Privaten dürfen sich nicht als gedopter Realitäts-Ersatz etablieren.<br />
Eine intelligente Entschleunigung kann das Gegengift zur grassierenden Schwarmhysterie in<br />
den Medien sein. In diesem Sinne ist Verlangsamung mit einer Phase der Abklärung der Sachverhalte<br />
und der Nutzung von Erfahrungswissen oft mit einer Beschleunigung des Erkenntniswertes<br />
verbunden. Informationsverstehen, Kontext-Analyse sind eine abgeklärte Recherche<br />
sind die Orientierungspunkte für besseren Journalismus und gegen das ADSyndrom vieler Journalisten,<br />
die sich nur in der „Echtzeit“ ihrer Sekundär-Realität bewegen. 75% der Bevölkerung<br />
fühlen sich durch Medienberichte überfordert. 75% der Journalisten wissen das nicht. Ob sich<br />
all dies ändern lässt, wissen wir nicht. Das es sich lohnt darüber zu streiten und sich mit<br />
medieninteressierten Bürgern und Medienmachern zu verständigen, wissen wir. Denn Feuchtgebiete<br />
und Schoßgebete sollten künftig nicht die Relevanz von relevanten Themen überlagern.<br />
Die unabhängige Projektgruppe des <strong>MainzerMedienDisput</strong><br />
Claudia Deeg · Michael Grabenströer · Prof. Dr. Thomas Leif · Thomas Meyer<br />
Geschäftsführung:<br />
MGS Marketing GmbH<br />
Günter Schreiber<br />
Projektgruppe:<br />
Claudia Deeg<br />
Michael Grabenströer<br />
Prof. Dr. Thomas Leif<br />
Thomas Meyer<br />
Gesellschafter & Mitveranstalter:<br />
Monika Fuhr · Christoph Gehring<br />
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz<br />
Reinhard Weil · Carla Schulte-Reckert<br />
Friedrich-Ebert-Stiftung – FES<br />
Dr. Joachim Kind<br />
LMK – Landeszentrale für Medien<br />
und Kommunikation Rheinland-Pfalz<br />
Kontakt:<br />
Tel.: 0 26 34/96 88-12/13/14<br />
Fax: 0 26 34/96 88-19<br />
info@mediendisput.de<br />
Anschrift:<br />
Haus Forst<br />
Mittelstraße 5<br />
56579 Hardert<br />
199
Programm<br />
23. und 24. <strong>November</strong> 2011<br />
Mainz, SWR-Foyer und ZDF-Konferenzzentrum<br />
© Illustration: Gerhard Mester<br />
INTERESSANT VOR RELEVANT?<br />
ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT UND IDENTITÄTSVERLUSTE –<br />
WOHIN STEUERT DER JOURNALISMUS?
TALKSHOWS AUF DEM PRÜFSTAND<br />
DIE ZERQUATSCHTE REPUBLIK<br />
Der <strong>Talk</strong> ist allgegenwärtig. Täglich flimmern unzählige <strong>Talk</strong>-Shows über die Bildschirme<br />
der beiden öffentlich-rechtlichen Kanäle, der dritten Programmschiene und der Privaten<br />
Sender. Sind sie es, die uns Orientierung geben und Hintergrundwissen verschaffen?<br />
Oder haben sie sich zwischenzeitlich zu einer ergebnisarmen demokratischen Übung<br />
oder zu einem leeren postdemokratischen Ritual entwickelt? Kameratauglichkeit und<br />
Proporz kommen schon längst vor der Expertise. Wenn Kommunikation inszeniert wird,<br />
bleiben die Inhalte meist auf der Strecke.<br />
Auftaktveranstaltung im SWR-Landesfunkhaus · 23. <strong>November</strong> 2011<br />
JAUCHZET, FROHLOCKET, HOCHPREISET:<br />
18.45 Uhr Musikalischer Auftakt Waldemar Martynel<br />
19.00 Uhr Begrüßung:<br />
Dr. Simone Sanftenberg<br />
SWR-Landessenderdirektorin<br />
19.20 Uhr Podiumsdiskussion<br />
Die zerquatschte <strong>Republik</strong><br />
Prof. Dr. Jürgen Falter Uni Mainz<br />
Dr. Michel Friedmann Autor, N24<br />
Bernd Gäbler<br />
Autor der MMD-Studie zur Qualität von <strong>Talk</strong>shows<br />
Prof. Dr. Andreas Dörner Uni Marburg<br />
Dr. Alexander Kißler Focus<br />
Moderation:<br />
Amelie Fried<br />
Autorin<br />
20.50 Uhr Preisverleihung des „Leuchtturms“ für besondere publizistische<br />
Leistungen von netzwerk-recherche und <strong>MainzerMedienDisput</strong><br />
Preisträger und Laudator werden kurzfristig bekannt gegeben!<br />
21.30 Uhr Piano-Finale Waldemar Martynel<br />
Medienpartner:<br />
201
Tagesveranstaltung im ZDF-Konferenzzentrum<br />
INTERESSANT VOR RELEVANT?<br />
ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT UND IDENTITÄTSVERLUSTE –<br />
WOHIN STEUERT DER JOURNALISMUS?<br />
9.00 Uhr Musikalischer Auftakt Ensemble Klanggewitter<br />
9.15 Uhr MainzerMedienAgent Lars Reichow<br />
9.30 Uhr Begrüßung<br />
Peter Struck<br />
Vorsitzender der FES, Verteidigungsminister a.D.<br />
10.00 Uhr Keynote: Interessant vor relevant –<br />
Wohin steuert der Journalismus?<br />
Prof. Dr. Kurt Imhof Universität Zürich, Soziologisches Institut<br />
10.30 Uhr Panel 1: Staatsraison statt Frontberichterstattung –<br />
Auslands korrespondenten im Afghanistan-Krieg<br />
Prof. Dr. Günter Meyer Leiter ZEFAW, Mainz<br />
Ulrich Tilgner<br />
Auslandskorrespondent SF<br />
Dr. Carolin Emcke internat. Reporterin<br />
Christoph Reuter Freier Journalist<br />
Dietlinde Quack<br />
Moderation:<br />
Dr. Willi Steul<br />
Vorsitzende der Deutsch-Afghanischen-<br />
Inititative, Freiburg<br />
Intendant Deutschland-Radio / DLF<br />
11.30 Uhr Interview: Medienfragen sind Machtfragen<br />
Ministerpräsident Kurt Beck im Gespräch mit Claudia Deeg, SWR<br />
11.50 Uhr Panel 2: Wer bestellt – schafft an: Die Macher treffen auf die Entscheider<br />
Birgit Baumann Vorsitzende des Vereins der Auslandspresse (VAP)<br />
Ashwin Raman<br />
Freier Auslandsreporter (ARD u. a.)<br />
Dr. Michael Zeiß Chefredakteur BW, SWR-Fernsehen<br />
Theo Koll<br />
Leiter Außenpolitik ZDF<br />
Hans Hoyng<br />
Leiter Auslandsredaktion „Der Spiegel“<br />
Moderation:<br />
Prof. Dr. Hansjürgen<br />
Rosenbauer<br />
ehem. RBB-Intendant<br />
12.45 Uhr Mittagspause<br />
202<br />
aktuelle Änderungen vorbehalten!
13.30 Uhr MainzerMedienAgent Lars Reichow<br />
14.00 Uhr Panel 3: Leerverkauf im Wirtschaftsjournalismus<br />
Iris Bethge<br />
Geschäftsführerin Kommunikation des<br />
Bundesverbandes deutscher Banken<br />
Prof. Dr. Max Otte Universität Graz<br />
Prof. Dr. Rudolf Hickel Uni Bremen<br />
Prof. Dr. Volker Wolff Uni Mainz<br />
Hans-Jürgen Jakobs Süddeutsche Zeitung<br />
Mark Schieritz<br />
Die Zeit<br />
Moderation:<br />
Dr. Alexandra<br />
Föderl-Schmid<br />
Chefredakteurin Der Standard<br />
<strong>15.</strong>00 Uhr Kaffee & Kommunikation<br />
24. <strong>November</strong> 2011<br />
<strong>15.</strong>30 Uhr Panel 4: Sex, clicks, trash: „online first“?<br />
Wolfgang Büchner Chefredakteur dpa<br />
Stefan Plöchinger Chefredakteur SZ-Online<br />
Rüdiger Ditz<br />
Chefredakteur Spiegel-Online<br />
Rainer Meyer<br />
alias: „Don Alphonso“, Blogger<br />
Volker Birk<br />
Chaos Computerclub<br />
Jochen Wegner<br />
Mag10, Ex-Chefred. focus-online<br />
Kajo Wasserhövel Elephantlogic<br />
Moderation:<br />
Dr. Tanja Busse WDR<br />
16.30 Uhr Visuelle Tagesbilanz<br />
Prof. Dr. Martin Welker<br />
Tagesmoderation:<br />
Uni Leipzig<br />
Claudia Deeg<br />
Die Dokumentationen der vergangenen Jahre und weitere Studien finden Sie unter www.mediendisput.de<br />
(Download als pdf-Datei).<br />
Unsere Sponsoren und Wirtschaftspartner:<br />
203
IMPRESSUM<br />
Dokumentation zum <strong>MainzerMedienDisput</strong> –<br />
INTERESSANT VOR RELEVANT? ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT UND IDENTITÄTSVERLUSTE – WOHIN STEUERT DER JOURNALISMUS?<br />
Dokumentation 2010 und Vorschau 2011<br />
Konzeption und Redaktion: Prof. Dr. Thomas Leif<br />
Gestaltungskonzept & Artwork: Nina Faber de.sign, Wiesbaden<br />
Titel:<br />
Gerhard Mester, Wiesbaden<br />
Fotos: MGS Marketing GmbH, Jörg Niebergall; Bastian Dincher (S. 121, 125), Jann Wilken (S. 162)<br />
Druck:<br />
ColorDruckLeimen GmbH<br />
ISBN 978-3-86872-905-4<br />
204
„Nicht Ruhe und Unterwürfigkeit gegenüber<br />
der Obrigkeit ist die erste Bürger pflicht,<br />
sondern Kritik und ständige demokratische<br />
Wachsamkeit.“<br />
(Otto Brenner 1968)<br />
Ausschreibung<br />
Otto Brenner Preis<br />
Es werden Beiträge prämiert, die für einen kriti schen Jour na lis mus vorbild lich und bei spielhaft<br />
sind und die für demo kra tische und gesel l schaftspolitische Verantwortung im Sinne von<br />
Otto Brenner stehen. Vorausgesetzt werden gründliche Recherche und eingehende Analyse.<br />
Der Otto Brenner Preis ist mit einem Preisgeld von 45.000 Euro dotiert, das sich wie folgt aufteilt:<br />
1. Preis 2. Preis 3. Preis<br />
10.000 Euro 5.000 Euro 3.000 Euro<br />
Zusätzlich vergibt die Otto Brenner Stiftung:<br />
für die beste Analyse (Leitartikel, Kommentar, Essay) den Otto Brenner Preis „Spezial“<br />
10.000 Euro<br />
in Zusam men arbeit mit „netzwerk recherche e. V.“<br />
und für Nachwuchsjournalisten oder Medienprojekte<br />
drei Recherche-Stipendien von<br />
je 5.000 Euro<br />
den „Newcomer-/Medienprojektpreis“<br />
2.000 Euro<br />
Weitere Infos zum Preis (Bewerbungszeitraum, Jury, Preisträger, Bewerbungsformulare, Preisverleihung usw.):<br />
www.otto-brenner-preis.de<br />
Otto Brenner Stiftung<br />
Wilhelm-Leuschner-Str. 79<br />
60329 Frankfurt am Main<br />
E-mail: info@otto-brenner-preis.de<br />
Tel.: 069 / 6693 - 2576<br />
Fax: 069 / 6693 - 2786<br />
Die Jury<br />
Sonia Seymour Mikich,<br />
Monitor WDR<br />
Prof. Dr.<br />
Thomas Leif,<br />
Chefreporter<br />
SWR Fernsehen<br />
Mainz<br />
Prof. Dr.<br />
Volker Lilienthal,<br />
Universität Hamburg<br />
Harald Schumann,<br />
Der Tagesspiegel<br />
Prof. Dr.<br />
Heribert Prantl,<br />
Süddeutsche<br />
Zeitung<br />
Berthold Huber,<br />
Verwaltungsrat<br />
Otto Brenner<br />
Stiftung
„ Wir brauchen Journalisten, die Hintergründe<br />
transparent machen und zugleich für jeden<br />
verständlich formulieren können.<br />
Die Zielsetzung des Journalistenpreises,<br />
den die ING-DiBa einmal im Jahr vergibt,<br />
entspricht meiner Vorstellung von einem<br />
Wirtschaftsjournalismus, der dem Bürger<br />
Urteilskraft über ökonomische Themen<br />
verschafft.“<br />
Helmut Schmidt, Bundeskanzler a. D.<br />
der helmut schmidt-journalistenpreis 2012<br />
Der Helmut Schmidt-Journalistenpreis wurde erstmals 1996 ausgeschrieben und wird<br />
seitdem jedes Jahr für besondere Leistungen auf dem Gebiet der verbraucherorientierten<br />
Berichterstattung über Wirtschafts- und Finanzthemen verliehen. Der Preis ist insgesamt<br />
mit 30.000 Euro dotiert.<br />
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2012.<br />
Nähere Informationen zum Preis und zur Anmeldung finden Sie unter:<br />
www.helmutschmidtjournalistenpreis.de<br />
gestiftet von der




![Dokumentation des 7. MainzerMediendisputs (2002) [PDF]](https://img.yumpu.com/52469993/1/185x260/dokumentation-des-7-mainzermediendisputs-2002-pdf.jpg?quality=85)





![Dokumentation des 12. MainzerMediendisputs (2007) [PDF]](https://img.yumpu.com/52373740/1/184x260/dokumentation-des-12-mainzermediendisputs-2007-pdf.jpg?quality=85)

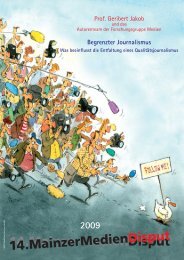

![(2008) [PDF] - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/52288699/1/184x260/2008-pdf-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)