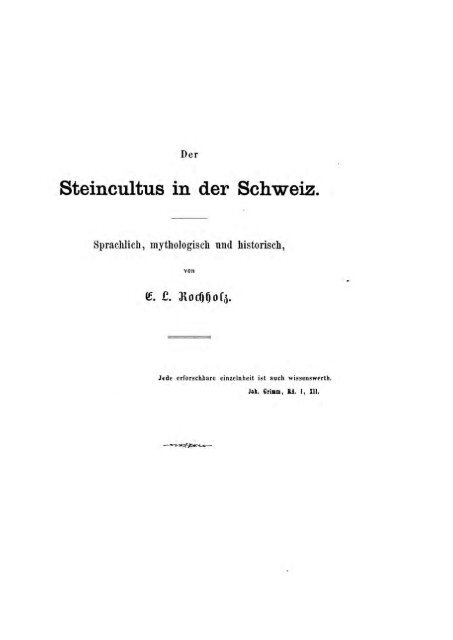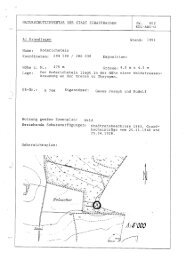PDF-Export ETH-Konsortium: Dokumente - www . erratiker . ch
PDF-Export ETH-Konsortium: Dokumente - www . erratiker . ch
PDF-Export ETH-Konsortium: Dokumente - www . erratiker . ch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der<br />
Steincultus in<br />
der S<strong>ch</strong>weiz.<br />
Spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>, mythologis<strong>ch</strong> und historis<strong>ch</strong>,<br />
g. £. Kocf)0ofu.<br />
Jede erfors<strong>ch</strong>bare einzelnheit ist au<strong>ch</strong> wissenswerth.<br />
Jab. Grimm, Ri. 1. III.
§ u D a r f.<br />
Erster<br />
Abs<strong>ch</strong>nitt.<br />
Spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e üeberreste aus der Steinzeit.<br />
Dio Steinzeit in Hont s<strong>ch</strong> en Appellativen redend :<br />
Der Stein, als das Gerippe des Erdleibes, ergiebt das Kno<strong>ch</strong>engerippe des mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en,<br />
daher der Stein Kultus allenthalben auf den Kno<strong>ch</strong>enUultus führte. Aufzahlung: der<br />
Kleinhindersteine: Örtli<strong>ch</strong>er Klüfte und Felsen, in denen die no<strong>ch</strong> ungeborenen und<br />
die wieder gestorbenen Säuglinge behütet werden.<br />
Der Sa<strong>ch</strong>s, ein Gottes-. Volks-, Waffen- und Ortsname.<br />
Der Plins und die Runsc sind zuglei<strong>ch</strong> Kamen örtli<strong>ch</strong>er Bergstürze und Bergriesen.<br />
Der Flinsstcin als BHtzhammcr Thorrs, dann als Petersstab verehrt, wird unter<br />
dem we<strong>ch</strong>selnden Namen Mangsslab, Baselstab. Keu<strong>ch</strong>en. Feuerstein u. s. \v. als<br />
Kir<strong>ch</strong>weihbrod na<strong>ch</strong>gebacken,<br />
Bo<strong>ch</strong>e nnd Roggen, bezei<strong>ch</strong>net beides petra und colus, den Stcinwirtel und Spinnwirtel<br />
der deuts<strong>ch</strong>en Riesinnen und der romanis<strong>ch</strong>en Bergfrauen. Bezügli<strong>ch</strong>e Orts¬<br />
namen, an die si<strong>ch</strong> der Berta- und Huldadienst Knüpft.<br />
R i c s e n a p p e 11 a t ì v a in Volks- und (ì e s c h 1 e c h t s n a ni e n fort¬<br />
dauernd :<br />
Die Wilden Manner als Repräsentanten städtis<strong>ch</strong>er Zünfte und ländli<strong>ch</strong>er Sennengenossens<strong>ch</strong>aften;<br />
ihre Wohnstatten, Felsengräber und Wahrzei<strong>ch</strong>en: ihre Namen<br />
auf einzelne Landesges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>ter vererbt:<br />
Ts<strong>ch</strong>udi und S<strong>ch</strong>ud, Eimer und Elbel,<br />
Ilun und Huhn. S<strong>ch</strong>wed und Fries,<br />
Geisser und Gaiser, Domilin, Essel und Durst.<br />
Der Meteorstein nnd Sirahlstein<br />
Zweiter Abs<strong>ch</strong>nitt.<br />
t<br />
(llaubensüberreste aus der Steinzeit.<br />
stürzt als leu<strong>ch</strong>tendes Kugelförmiges Gewitterphänomen, wird daher als Kugel und<br />
Kegel geda<strong>ch</strong>t, als ges<strong>ch</strong>leuderter Stein- und Eisenheil, als Donnerstein und Stein¬<br />
hammer. Der Kell und Strahlstein. beide dur<strong>ch</strong>lö<strong>ch</strong>ert, dienen zur Abwehr des Blitzes<br />
und werden medicinis<strong>ch</strong> und landwirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong> verwendet.<br />
Der Regenstein.<br />
Wie derselbe angebli<strong>ch</strong> vom Gewitterriesen ges<strong>ch</strong>leudert und von den Thränen der<br />
Riesin ausgehöhlt worden, so wird er gewälzt oder geworfen, um die Landesplagen<br />
der Dürre und l'ebcrsclnveinmiing abzuwenden. Daher sein Örtli<strong>ch</strong>er Name Fis<strong>ch</strong>bank,<br />
und seine Beziehung zu den Wassernixen.
Der gesalbte Stein.<br />
Die häufigen Namen Ankenbalme und Ankenfluh entspre<strong>ch</strong>en dem gefetteten Opfersteine<br />
der Germanen, den von Kronos vers<strong>ch</strong>lungenen Bätylien, dein vom Patriar<strong>ch</strong>en o-eöltcn<br />
Stein Bethel, und sind der Erd- und Erntegottheit geweiht. Erklärung ihrer<br />
Namen und landwirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en Beziehungen. Die Wetzsteine in der einzelnen<br />
Landesges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te.<br />
Der Heilslein.<br />
Cavern de la querison im Kant. Neuenburg. Pierre percée im Kant. Bern. BurKhardsgrab<br />
und Angelsa<strong>ch</strong>sengrab im Freiamte. Yerenalo<strong>ch</strong> zu Baden, St. Gallengrab<br />
zu Wangen etc. Aehnli<strong>ch</strong>e heilkräftige Steine in bena<strong>ch</strong>barten oberdeuts<strong>ch</strong>en Wall¬<br />
fahrtskir<strong>ch</strong>en.<br />
Kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Steinreliquien,<br />
angebli<strong>ch</strong> von Petronella, Mang. Martinus, vorn Heiland u. A. herstammend, und zu¬<br />
sammen einst in der Abtei Muri verwahrt.<br />
Die Steintis<strong>ch</strong>e.<br />
Die erratis<strong>ch</strong>en Blo<strong>ch</strong>e, von der Naturphilosophie der Edda und von der Geologie<br />
glei<strong>ch</strong>mässig der Periode der Eiszeit zuges<strong>ch</strong>rieben. Bes<strong>ch</strong>reibung einzelner Steinbocke<br />
aus dem Aargau, samml Betra<strong>ch</strong>tung ihrer Einzelsagen und Flurnamen. Der S<strong>ch</strong>alen¬<br />
stein zu Suhr. Der Bettlerstein und der Ilerdmandlistein bei AVohlen. Die Dillen¬<br />
steine im Erdleibe.<br />
Teufelssteine und Entslö<strong>ch</strong>er.<br />
Absinken der heidnis<strong>ch</strong>en und <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>en Tradition in die Allgemeinheit des Teufels¬<br />
glaubens; Ergebniss zahlrei<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> dem Teufel zubenannter Oertli<strong>ch</strong>keiten.<br />
Grenzsteine.<br />
Die<br />
Marronen und Mannli :<br />
wegweisende<br />
Steinhaufen auf den Alpenpässen. Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e<br />
Na<strong>ch</strong>weise über ihren Aufbau im Alterthum und in der Neuzeit.<br />
Der si<strong>ch</strong> umdrehende Markstein, der in Thorrs Haupte si<strong>ch</strong> rührende S<strong>ch</strong>leifstein;<br />
Erklärung beider Sagensätze.<br />
Orakelsteine: s<strong>ch</strong>reiende, singende, redende. Krönungs- und S<strong>ch</strong>andsteine. Die Sitte,<br />
den Neuling am Bannsteine zu lunzen, zu günggeln und einzustutzen.<br />
Die drei Länder trennenden Dreisteine (Triskelus) mit ihren vers<strong>ch</strong>iedenen Markzei<strong>ch</strong>en.<br />
Die Dreihäupter und Einhäupter historis<strong>ch</strong>en Namens an alten Bauten.<br />
Bildberge.<br />
Das Gebirg als Leib und Glied der Riesen. - Männli<strong>ch</strong>e Beinamen: Mann, Mannus<br />
und Menhir, auf <strong>ch</strong>thonis<strong>ch</strong>e Götter und Erdenmens<strong>ch</strong>en verweisend. Weibli<strong>ch</strong>e Berg¬<br />
namen : die Frauen und Jungfrauen benannten Berge, als ursprüngli<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>önheits¬<br />
gebilde aufgefasst. Einzelne Bildberge ges<strong>ch</strong>ildert. Umwandlung der heidnis<strong>ch</strong>en<br />
Namen der Berge und Bergpässe in <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>e.
Der Steincultus in der S<strong>ch</strong>weiz.<br />
Die Naturfors<strong>ch</strong>ung hat die S<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tungen im Bau der Gebirge<br />
zu Zeugen der Urges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te unsers Erdkörpers gema<strong>ch</strong>t, das Ergcbniss<br />
dieser Untersu<strong>ch</strong>ungen ist der feststehende Wissenszweig<br />
der Geologie. Die Alterthumsfors<strong>ch</strong>ung hat auf dem Gebiete der<br />
Mens<strong>ch</strong>heitsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te einen ähnli<strong>ch</strong>en Urzustand entdeckt, und<br />
au<strong>ch</strong> ihr dient nun zu ihren eins<strong>ch</strong>lägigen Fors<strong>ch</strong>ungen das glei<strong>ch</strong>e<br />
geologis<strong>ch</strong>e Material, der Stein; sie hat sogar na<strong>ch</strong> jenen antiquari¬<br />
s<strong>ch</strong>en Fundsteinen, denen die früheste Mens<strong>ch</strong>heit die Spuren ihres<br />
Daseins eingrub, jene von ihr nun erst no<strong>ch</strong> weiter zu erfors<strong>ch</strong>ende<br />
Urzeit die Steinzeit genannt. Man begreift unter derselben jene<br />
Periode, in wel<strong>ch</strong>er das no<strong>ch</strong> junge Mens<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t an ein und<br />
dasselbe Material gebunden war, wo man mit Steinen Holz sägte,<br />
Kleider wob, Wunden s<strong>ch</strong>lug und wieder <strong>ch</strong>irurgis<strong>ch</strong> operirte. Die<br />
Ansiedelungen und Werkzeuge dieses Urges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tes hat man seit<br />
etli<strong>ch</strong>en Jahren in dem Boden unserer Torfmoore und Landseen<br />
aufgegraben. Die Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te war bisher über dieses Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t<br />
stumm, nun,<br />
da die Steine reden, wird ihr allenthalben der ge¬<br />
lehrte Mund aufgethan, S<strong>ch</strong>illers in anderer Weise einst gemeinte<br />
Wort erfüllt si<strong>ch</strong>: Könnte die Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te davon s<strong>ch</strong>weigen, tau¬<br />
send Steine würden redend zeugen, die man aus dem S<strong>ch</strong>oss der<br />
Erde gräbt." Kaum aber hat man begonnen, diese örtli<strong>ch</strong>en Stein¬<br />
funde zu bea<strong>ch</strong>ten und zu verwerthen, so bemerkt man, dass sie<br />
als dieselben und allenthalben bei den Völkern der alten und neuen<br />
Welt si<strong>ch</strong> vorfinden, so weit nämli<strong>ch</strong> unsere Einsi<strong>ch</strong>t in dieselben<br />
Urzustände einzelner Völkerracen bis jetzt vorgedrungen ist, und<br />
in Folge dieser Erfahrung s<strong>ch</strong>eint nun die Frage um die Abkunft<br />
und Race jenes Volkes, dessen Steindenkmäler über den Boden<br />
unserer Lands<strong>ch</strong>aft ausgesät sind, eine müssige zu werden. Es<br />
ist, als ob die Specialhistorie kein Mittel besässe, mit an diesen<br />
Fors<strong>ch</strong>ungen Theil zu nehmen, ges<strong>ch</strong>weige dass sie einen gedenk¬<br />
baren Aufs<strong>ch</strong>luss über si<strong>ch</strong> selbst aus ihnen zu ziehen vermö<strong>ch</strong>te.<br />
Von dieser Kleinmüthigkeit haben si<strong>ch</strong> indess andere Nationen<br />
gegenüber derselben Frage ni<strong>ch</strong>t anwandeln lassen. Der Grie<strong>ch</strong>e
eignete si<strong>ch</strong> jenen Steincultus, den er auf seinem Grund und Bo¬<br />
den betraf, als einen unbezweifelbar hellenis<strong>ch</strong>en zu und verleibte<br />
ihn seiner Götter- und Mythenges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te ein; das kaiserli<strong>ch</strong>e Frank¬<br />
rei<strong>ch</strong> von heute lässt auf seiner eben entworfenen altgallis<strong>ch</strong>en<br />
Nationalkarte die Heidengräber und Baulasteine Burgunds und Loth¬<br />
ringens als unbezweifelte Druidensteine des gallis<strong>ch</strong>en Kellcnthums<br />
verzei<strong>ch</strong>nen. Ein Volk von nationalem Selbstgefühl pflegt also zu¬<br />
nä<strong>ch</strong>st aus si<strong>ch</strong> selbst, aus dem historis<strong>ch</strong>en Grundstoffe seiner<br />
Eigenart den aus »einem Boden gewonnenen antiquaris<strong>ch</strong>en Fund<br />
zu erklären, wenn es au<strong>ch</strong>, wie das hellenis<strong>ch</strong>e und das franzö¬<br />
sis<strong>ch</strong>e, si<strong>ch</strong> selbst als kein auto<strong>ch</strong>thones, sondern als ein liier ein¬<br />
gewandertes Volk anerkennt. Wir räumen uns daher dasselbe Re<strong>ch</strong>t<br />
ein, aber wir beweisen es zuglei<strong>ch</strong>, indem wir das hier aufzuzäh¬<br />
lende Material sowohl aus unserer Spra<strong>ch</strong>e, als au<strong>ch</strong> aus unserm<br />
Glauben und Brau<strong>ch</strong>, auf Grund deuts<strong>ch</strong>en Wissens als ein deut¬<br />
s<strong>ch</strong>es erklären.<br />
Ein Mens<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t, das dur<strong>ch</strong>aus an das glei<strong>ch</strong>e Material<br />
und Werkzeug dauernd verwiesen war, musste in seiner Vorstellungs-<br />
und Ausdrucksweise ein genau übereinstimmendes, ein ge¬<br />
s<strong>ch</strong>wisterhaft ähnli<strong>ch</strong>es sein. Sein Denken und Streben war ein<br />
irdis<strong>ch</strong>es, stoffli<strong>ch</strong>es, materielles, das Wesen der Materie galt ihm<br />
als Kraft, die personificirte Kraft mit materialistis<strong>ch</strong>em Aussehen<br />
und Thun, mit eigenwilligen und groben Trieben, ers<strong>ch</strong>ien ihm als<br />
das Götterges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t der Erdriesen. Bis dahin rei<strong>ch</strong>t die eine Seite<br />
der hier vorzulegenden Arbeit, und so weit nimmt sie ihre Mittel<br />
aus dem Fa<strong>ch</strong>e der verglei<strong>ch</strong>enden Mythologie. Die Spra<strong>ch</strong>e<br />
dieses Volkes, das nothwendige Abbild seines naturalistis<strong>ch</strong>en Den¬<br />
kens und seiner Steinwerkzeuge, musste eine Stoffspra<strong>ch</strong>e, das<br />
Gegentheil einer Begriffsspra<strong>ch</strong>e sein, und konnte na<strong>ch</strong> Inhalt und<br />
Form glei<strong>ch</strong>falls nur das Brudergefühl glei<strong>ch</strong>er Abstammung und<br />
Bestimmung, glei<strong>ch</strong>er Hoffnung oder Ohnma<strong>ch</strong>t ausdrücken. Mit<br />
den man<strong>ch</strong>erlei versteinerten Wort wurzeln, die von dieser Stoff¬<br />
spra<strong>ch</strong>e unzerbre<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> am Wege liegen geblieben sind, bes<strong>ch</strong>äftigt<br />
si<strong>ch</strong> das Fa<strong>ch</strong> der verglei<strong>ch</strong>enden Spra<strong>ch</strong>fors<strong>ch</strong>ung.<br />
Aus der Bes<strong>ch</strong>äftigung mit diesen beiden Fä<strong>ch</strong>ern und zuglei<strong>ch</strong><br />
aus der s<strong>ch</strong>on lange dauernden persönli<strong>ch</strong>en Ans<strong>ch</strong>auung eigenthümli<strong>ch</strong>er<br />
Steingeräthe und Denkmäler ist vorliegender Versu<strong>ch</strong><br />
entsprungen, wel<strong>ch</strong>er der Periode des Steincultus eine für unsere<br />
Lands<strong>ch</strong>aften zeitgemässe Gestallung zu geben tra<strong>ch</strong>tet.<br />
Wir beginnen mit der Erklärung einiger Urwörter, wel<strong>ch</strong>e das<br />
Gepräge der Steinzeit an si<strong>ch</strong> tragen und bis in die Spra<strong>ch</strong>e der
Gegenwart herein angedauert haben; diese werden zuglei<strong>ch</strong> un¬<br />
serm Leser als bequeme Hilfsmittel dienen, den na<strong>ch</strong>folgenden<br />
Mittheilungen mit eigener persönli<strong>ch</strong>er Ueberzeugtheit folgen zu<br />
können.<br />
Erster Abs<strong>ch</strong>nitt.<br />
Ï. Die Steinzeit in deuts<strong>ch</strong>en Appellativen redend.<br />
Das Wort Stein ist ein Spra<strong>ch</strong>petrefakt. Es findet si<strong>ch</strong> in allen<br />
jenen Spra<strong>ch</strong>en wieder, deren Ursprung man na<strong>ch</strong> Indien zurückverlegt,<br />
und die glei<strong>ch</strong>zeitig mit der deuts<strong>ch</strong>en in Europa einge¬<br />
wandert sind. Wir nennen den harten Obstkern Stein, der Grie<strong>ch</strong>e<br />
ebenso 'ooréor, der Slave glei<strong>ch</strong>falls mit derselben Wortwurzel kost'.<br />
Grimm, Wörtb. 1381. Sind dem Mens<strong>ch</strong>en dieser Spra<strong>ch</strong>periode dii;<br />
allwaltenden Götter die in den Himmel ragenden, ewig unveränder¬<br />
li<strong>ch</strong>en Gebirge, so bemisst er Empfindung, Aeusseres und Inneres,<br />
Lebensalter und Besitz na<strong>ch</strong> dem Material des Gesteins, denn der<br />
Begriff der Dauer und des Ewigwährenden lag ihm in der Stetig¬<br />
keit und Härte des Steins. Sinnverwandt mit Stein ist aus glei<strong>ch</strong>em<br />
(irunde Bein. Vier vers<strong>ch</strong>iedene Spra<strong>ch</strong>denkmale hat Grimm, Myth.<br />
531, angeführt über den Hergang bei Ers<strong>ch</strong>affung des Mens<strong>ch</strong>en.<br />
Dieselben rei<strong>ch</strong>en vom 10. bis zum 12. Jahrhundert, gehören einer<br />
englis<strong>ch</strong>-kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en Quelle an, einer friesis<strong>ch</strong>en Re<strong>ch</strong>tssatzung,<br />
steieris<strong>ch</strong>en Mön<strong>ch</strong>sgedi<strong>ch</strong>ten und italis<strong>ch</strong>en Lateinscribenten, liegen<br />
also der Zeit und dem Orte na<strong>ch</strong> einander fern genug. Während<br />
sie die einzelnen Organe und Theile des Mens<strong>ch</strong>enleibes überein¬<br />
stimmend aus a<strong>ch</strong>terlei Materialien der vorhandenen Welt hervor¬<br />
gehen lassen, verbleibt die friesis<strong>ch</strong>-steieris<strong>ch</strong>e Kosmogonie bei<br />
ihrer Behauptung, Gott habe Bein aus Stein ges<strong>ch</strong>affen von dem<br />
:<br />
steine gab er ime daz pein. Na<strong>ch</strong> der eddis<strong>ch</strong>en Kosmogonie wird<br />
der erste Mens<strong>ch</strong> Bure aus Salzsteinen herausgeleckt und der vor¬<br />
aus gewesene Urriese wieder in Stein verwandelt; in diesem Falle<br />
wird also Stein au<strong>ch</strong> aus Bein. Beinhart ist au<strong>ch</strong> steinhart. Man<br />
sagt, Stein und Bein frieren, Stein und Bein s<strong>ch</strong>wören, d. h. hart<br />
frieren, mit festen, hö<strong>ch</strong>sten Eiden s<strong>ch</strong>wören." Grimm, Wörtb. So<br />
klingt das Steinzeitalter sogar no<strong>ch</strong> in der Bildungsspra<strong>ch</strong>e des<br />
neunzehnten Jahrhunderts na<strong>ch</strong>, zum Beweise, dass die ältesten<br />
Vorstellungen in ihrer Naturgemässheit dur<strong>ch</strong> eine spätere, ver¬<br />
besserte Einsi<strong>ch</strong>t ni<strong>ch</strong>t eigentli<strong>ch</strong> überholt, sondern nur bestätigt<br />
und wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong> si<strong>ch</strong>ergestellt werden können. Der bekannte
8<br />
grie<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>e Mythus von dem aus Steinen entstandenen deukalionis<strong>ch</strong>en<br />
Mens<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t ist hervorgerufen dur<strong>ch</strong> die Thatsa<strong>ch</strong>e,<br />
dass die Kno<strong>ch</strong>ensubstanz (phosphorsaurer Kalk) und die Natur des<br />
Gesteins physiologis<strong>ch</strong> homogen sind. Das Gestein der Mutter Erde<br />
wird das Kno<strong>ch</strong>engerüste des Mens<strong>ch</strong>en, die Mens<strong>ch</strong>en sind ein<br />
erdgeborenes Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t, überall ist die Mythe ges<strong>ch</strong>äftig, diesen<br />
einen Satz zu variiren. Glei<strong>ch</strong>wie der die Medusa erblickende<br />
Atlas zum Berge erstarrt, seine Kno<strong>ch</strong>en zu Fels, sein Haupt zum<br />
wolkentragenden Gipfel, so wird au<strong>ch</strong> der eddis<strong>ch</strong>e Sturmriese<br />
Ymir, na<strong>ch</strong>dem er, Bein mit Bein, einen Sohn gezeugt hat, auf<br />
der Götter Geheiss zum Erdleibe. Stein und Bein ist der S<strong>ch</strong>ö¬<br />
pfungsmythe unentbehrli<strong>ch</strong>. Dem Pygmalion entsteht ein Weib aus<br />
dem Steine; Adams Leib ist aus der rothen Erde des Damascener<br />
Ackers gebildet; aber s<strong>ch</strong>on Adams Rippe wieder ist<br />
zeugungs¬<br />
fähig, aus ihr wird die Eva gebildet. An den Stein und an den<br />
Kno<strong>ch</strong>en knUpft si<strong>ch</strong> daher bald das Heil eines Landes, bald der<br />
Bestand einer Hauptstadt an, denn aus diesem örtli<strong>ch</strong>en Steinfelsen<br />
hier ist einst die S<strong>ch</strong>utzgöttin des Ortes, aus dieser S<strong>ch</strong>olle ist der<br />
Heros der Lands<strong>ch</strong>aft hervorgegangen, sterbend haben beide wie¬<br />
der ihre Gebeine, oder statt dieser einen heiligen Stein dem Orte<br />
zurückgelassen. Als Alkmene, die Geliebte des Zeus, zu Megara<br />
gestorben war, sandte Zeus den Hermes ab, um ihren Lei<strong>ch</strong>nam<br />
na<strong>ch</strong> der Insel der Seligen abzuholen. Dieser that's und legte an<br />
der Lei<strong>ch</strong>e Statt einen Stein in den Sarg. Da nun die Träger<br />
diesen ni<strong>ch</strong>t fortbringen konnten, öffneten sie den Sarg und fan¬<br />
den die Verwandlung. Hinter der Mythe von der Geliebten Un¬<br />
sterbli<strong>ch</strong>keit tritt hier der no<strong>ch</strong> ältere Glaubenssatz hervor, dass<br />
die megarensis<strong>ch</strong>e Göttin in Form eines Steines verehrt gewesen,<br />
dass dieser dorten für ihren leibli<strong>ch</strong>en Ueberrest gehalten worden<br />
ist. Des Orestes in Tegea begrabene Kno<strong>ch</strong>en wurden ausge¬<br />
graben und na<strong>ch</strong> Sparta gebra<strong>ch</strong>t, damit man im Kriege gegen<br />
Tegea siegrei<strong>ch</strong> sei (Herodot 1, 68). Theseus Gebeine wurden<br />
aus Skyros na<strong>ch</strong> Attika gebra<strong>ch</strong>t (Plutar<strong>ch</strong>, Thes. cap. 36). Sie<br />
sollten das Land s<strong>ch</strong>ützen, ihre Unverwesli<strong>ch</strong>keit verbürgte den<br />
Einwohnern die Hoffnung auf den ungestörten Fortbestand alles<br />
Wüns<strong>ch</strong>baren. Des Pelops angebli<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>ulter wurde an .meh¬<br />
rern Orten verehrt, au<strong>ch</strong> in Delphi rühmte man si<strong>ch</strong> ihres Be¬<br />
sitzes, ohne sie konnte- Troja ni<strong>ch</strong>t erobert werden. Aus ihr<br />
sollte andern Sagen zu Folge das Palladium gefertigt sein; dieses<br />
wurde später zu Rom im Vestatempel, die S<strong>ch</strong>ulter selbst zu Pisa<br />
in einer ehernen Lade bewahrt. Preller, Grie<strong>ch</strong>. Myth. II, 210
9<br />
und Mannhardt, Myth. 73. Die versteinerten Üeberreste urzeit¬<br />
li<strong>ch</strong>er Riesenthiere dienten dem ganzen Mittelalter ni<strong>ch</strong>t bloss zum<br />
Gegenstande des Erstaunens, sondern ebenso z.u Trägern glei<strong>ch</strong>er<br />
Traditionen. Sie hiengen als angebli<strong>ch</strong>e Rippen von Riesen und<br />
Dra<strong>ch</strong>en an Ketten unter der Einfahrt unserer Thore und Rathhäuser,<br />
sie waren feierli<strong>ch</strong> aufbewahrt in Kir<strong>ch</strong>en, Kapellen und<br />
Sakristeien; Na<strong>ch</strong>weise hierüber: Myth. 49T. 511. 522. No<strong>ch</strong> soll<br />
die Rippe der Heidenjungfrau in steieris<strong>ch</strong> Oberburg hängen; sie<br />
lässt alljährli<strong>ch</strong> einen einzigen Tropfen abfallen, und wenn sie<br />
ganz vertrüpfelt sein wird, so kommt der jüngste Tag. Grimm,<br />
DS. no. 140.<br />
Später, unter dem ersten Einflüsse mön<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong> gelehrter Tra¬<br />
dition, fieng man an, die bis dahin als Riesenreliquien verehrten<br />
Kno<strong>ch</strong>en für die Gebeine sol<strong>ch</strong>er Heiden auszugeben, deren Namen<br />
dur<strong>ch</strong> ihr Vermögen an Weisheit, Kunst oder Zauberkraft wenig¬<br />
stens in der Mythe no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t vers<strong>ch</strong>ollen war. War damals Virgilius<br />
als Di<strong>ch</strong>ter au<strong>ch</strong> gänzli<strong>ch</strong> ungelesen, so war er nun um so<br />
berühmter dur<strong>ch</strong> die magis<strong>ch</strong>e Kraft seines begeisternden Wortes,<br />
er galt daher in der Mön<strong>ch</strong>swelt als grösster Zauberer des Alterthums.<br />
Seine Gebeine wurden zu Neapel aufbewahrt, und man<br />
glaubte, das Glück der Stadt beruhe auf dem Besitze dieser Kno¬<br />
<strong>ch</strong>en. Im dortigen Castel d'uovo hiengen sie, in einem Sack ge¬<br />
sammelt, hinter einem Eisengitter; no<strong>ch</strong> der deuts<strong>ch</strong>e Rei<strong>ch</strong>skanzler<br />
Konrad hat sie dorten gesehen und die Ortssage beigefügt, dass<br />
dieselben, von hier entfernt, das Meer aufrühren und den Himmel<br />
verfinstern würden. Massmann, Kaiser<strong>ch</strong>ron. 3, 442. Stein und<br />
Bein sind also Gattungsbegriffe und Gattungsnamen gewesen, der<br />
Steincultus hat auf den Kno<strong>ch</strong>encultus geführt, das steinentsprun¬<br />
gene Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t denkt si<strong>ch</strong> folgere<strong>ch</strong>t sein S<strong>ch</strong>icksal dahin aus,<br />
ein steinvers<strong>ch</strong>lungenes werden zu müssen. Dies wird hier aus<br />
einander gesetzt und zuglei<strong>ch</strong> die Reihe jener örtli<strong>ch</strong>en Klüfte und<br />
Felsen unserer eigenen Lands<strong>ch</strong>aft mit herbeigezogen, in denen<br />
der Volksglaube die no<strong>ch</strong> ungeborenen und die wieder verstorbenen<br />
Säuglinge behütet und aufbewahrt sein lässt.<br />
Zwei ho<strong>ch</strong>ragende Felsblöcke, einer di<strong>ch</strong>t über den andern<br />
gelehnt, geben der Burg Li<strong>ch</strong>tenstein ihren Namen und dem glei<strong>ch</strong>¬<br />
namigen Freiherrenges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te sein Wappen. An den Bestand<br />
dieser Steine isl au<strong>ch</strong> der dieses Adelsges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tes geknüpft.<br />
S<strong>ch</strong>öppner, Baier. Sagb. 1, no. 194. Das hö<strong>ch</strong>ste Lebensalter heisst<br />
steinalt, der hö<strong>ch</strong>ste Besitz steinrei<strong>ch</strong>. Der Sterbende, der si<strong>ch</strong><br />
zu seihen Ahnen und Göttern versammelt wüns<strong>ch</strong>t, fährt in die
10^<br />
Felsen zurück; Karl in den Kyffhäuser, die drei Teilen in den<br />
Axenberg, König Etzel in die Lö<strong>ch</strong>er der SteinwändeM. Die<br />
Klage, Vers 2168. Ob dem Tode ihrer zwölf Kinder versteinert<br />
Niobe im Mutters<strong>ch</strong>merz ; die böse Stiefmutter des Kindermär<strong>ch</strong>ens<br />
springt vor Zorn in einen Kieselstein. Myth. 1, 321. Lässt Homer<br />
einen Helden seiner namhaften Abkunft si<strong>ch</strong> berühmen, so legt er<br />
ihm die Redensart in den Mund : i<strong>ch</strong> bin ni<strong>ch</strong>t aus dem Stein ent¬<br />
sprungen. No<strong>ch</strong> der heutige Wälderbauer, dem alle die Seinigen<br />
vorgestorben sind, pflegt seine gemüthli<strong>ch</strong>e Vereinsamung mit der<br />
Phrase auszudrücken I<strong>ch</strong> bin wie aus dem Stein gesprungen.<br />
:<br />
Auerba<strong>ch</strong>, Dorfges<strong>ch</strong>. Bd. Dur<strong>ch</strong> so ungeheure Zeiträume hin¬<br />
dur<strong>ch</strong> und in so vers<strong>ch</strong>iedenen Spra<strong>ch</strong>en hat das Ursprüngli<strong>ch</strong>e<br />
mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>er Empfindung ausgedauert und si<strong>ch</strong> in dem glei<strong>ch</strong>en<br />
Ausdrucke verewigt. Aus dem Urgestein, dessen Verwitterung<br />
einen der Vegetation günstigen Boden liefert, erbaut si<strong>ch</strong> das<br />
animalis<strong>ch</strong>e Kno<strong>ch</strong>engerüste und ist, diesem Ursprünge zu Folge,<br />
glei<strong>ch</strong>falls fähig, die fernem Generationen fortzuzeugen. Aus<br />
dem Harzfelsen ist der sä<strong>ch</strong>sis<strong>ch</strong>e Askanes gewa<strong>ch</strong>sen (Rollenliagen,<br />
im Ged. Fros<strong>ch</strong>mäusler), aus den Salzsteinen ist das nor¬<br />
dis<strong>ch</strong>e Volk hervorgeleckt worden dur<strong>ch</strong> die eddis<strong>ch</strong>e Riesenkuli<br />
Audhumbla. Eine hessis<strong>ch</strong>e Gräfin gebiert sogar einen grauen<br />
Wakenstein. Dieser wird in den Keller getragen und mit einem<br />
S<strong>ch</strong>wert zerhauen, worauf das helle rothe Blut fliesst. Als man<br />
sieben Tage später wieder na<strong>ch</strong> dem Steine sieht, liegt an seiner<br />
Stelle ein s<strong>ch</strong>önes Mägdlein mit la<strong>ch</strong>endem Munde. Wolf, Hausm.<br />
pg. 96. Das S<strong>ch</strong>wert als Feuerstahl haut den im Kiesel (Waken¬<br />
stein) s<strong>ch</strong>lummernden Funken heraus, das im Liebesfeuer gezeugte<br />
und empfangene Kind. Die S<strong>ch</strong>öpfung des Dritten da<strong>ch</strong>te si<strong>ch</strong> die<br />
Vorzeit veranlasst theils dur<strong>ch</strong> einen Meteorsteinregen, theils dur<strong>ch</strong><br />
den mit dem Hammer anges<strong>ch</strong>lagenen Feuerstein. Im ndd. Kinder¬<br />
spiel von der goldenen und faulen Brücke (des Regenbogens)<br />
folgt auf die Frage, womit diese gebro<strong>ch</strong>ene gläserne Brücke na<strong>ch</strong><br />
Holland, Brabant oder Engelland wieder gema<strong>ch</strong>t werden könne,<br />
die Antwort Fan stênen, fan bénen Au<strong>ch</strong> das Phänomen des<br />
:<br />
Regenbogens und aller übrige Gewitterapparat bestand dem Deut¬<br />
s<strong>ch</strong>en aus s<strong>ch</strong>öpferis<strong>ch</strong>em Stein und Bein. Jene auf die Prometheusmythe<br />
bezügli<strong>ch</strong>e Stelle bei Pausanias X, 4. 4<br />
zeigt, dass die rothe<br />
Erde, die bei Panopeus in Phokis als diejenige hergezeigt wurde,<br />
aus wel<strong>ch</strong>er Prometheus den ersten Mens<strong>ch</strong>en gebildet, ni<strong>ch</strong>t so¬<br />
wohl aus Erde bestand als vielmehr aus versteinerten Thonklümpdien.<br />
Das prometheis<strong>ch</strong>e Mens<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t entstand also aus
11<br />
einem mit dem Gewitter niedergegangenen Steinregen, und der<br />
Vers eines äs<strong>ch</strong>yleis<strong>ch</strong>en Fragmentes s<strong>ch</strong>ildert diesen Naturvorgang :<br />
Zeus lässt mit runder Steine Regenguss das Land umher aus ge¬<br />
sammeltem Ge wölke bedecken." Sind hierauf der von Prometheus<br />
und Pandora erzeugte Sohn Deukalion und sein Weib Pyrrha die<br />
einzigen, die si<strong>ch</strong> aus der Wellfluth gerettet haben, so verknüpft<br />
si<strong>ch</strong> bei ihnen die Sage vom Steinregen abermals mit der von der<br />
Mens<strong>ch</strong>ens<strong>ch</strong>öpfung, indem aus den Steinen, wel<strong>ch</strong>e beide Gatten<br />
hinter si<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>leudern, je Knaben und Mäd<strong>ch</strong>en entstehen, von<br />
denen die hellenis<strong>ch</strong>en Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>ter ihren Ursprung ableiteten. Die<br />
glei<strong>ch</strong>e Sinnbildli<strong>ch</strong>keit wird wohl au<strong>ch</strong> der Sage zu Grunde ge¬<br />
legen haben vom rothen Acker zu Damaskus, aus wel<strong>ch</strong>em Adam<br />
ers<strong>ch</strong>affen worden; dies s<strong>ch</strong>eint sogar eine nordamerikanis<strong>ch</strong>e<br />
Mythe zu bekräftigen. Es kennen und verehren die Sioux-In¬<br />
dianer einen Berg, aus dessen rothem Thon sie si<strong>ch</strong> ihre als Frie¬<br />
denssymbol geltenden Tabakspfeifen s<strong>ch</strong>neiden. Als der Naturfor¬<br />
s<strong>ch</strong>er Catlin, dessen Rcisebes<strong>ch</strong>reibung uns dies meldet, diesen<br />
heiligen Berg unbefugt bestieg und darüber von den Eingeborenen<br />
gefangen wurde, drohten sie, ihn mit dem Tode zu bestrafen. Die<br />
Tamanaquen am Orinoko glauben, na<strong>ch</strong> Humboldt, ein Mann und<br />
ein Weib habe zur Zeit der grossen Fluth si<strong>ch</strong> auf den Gipfel des<br />
Berges Tamanacu geflü<strong>ch</strong>tet und als sie hier die Frü<strong>ch</strong>te der Mau¬<br />
ritiuspalme hinter si<strong>ch</strong> geworfen, seien aus deren Kernen Männer<br />
und Weiber zur Wiederbevölkerung der Erde entsprungen. Na<strong>ch</strong><br />
S<strong>ch</strong>omburgk behaupten die Macusi-Indianer am obern Mahu in<br />
Guiana, der einzige Mens<strong>ch</strong>, der die grosse Fluth überlebte, habe<br />
Steine hinter si<strong>ch</strong> geworfen und so die Erde auf's Neue bevölkert.<br />
Der Mens<strong>ch</strong> fühlt si<strong>ch</strong> überall gezwungen,<br />
die Materie als das Ur¬<br />
sprüngli<strong>ch</strong>e und Ewige anzuerkennen, darum leitet er seine eigene<br />
Entstehung bald aus dem unorganis<strong>ch</strong>en Rei<strong>ch</strong>e ab, bald indirect<br />
von der vermittelnden Pflanzenwelt her. Die Sage von dem aus<br />
Baum und Pflanze ers<strong>ch</strong>affenen Mens<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te ist eine spä¬<br />
tere; erst das dritte Mens<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t lässt Hesiod aus den<br />
Es<strong>ch</strong>enbäumen entstehen. Der steinentsprungenen Sa<strong>ch</strong>sen erster<br />
König ist Askanes, aber s<strong>ch</strong>on in seinem Namen ist er ein Es<strong>ch</strong>enmann,<br />
und no<strong>ch</strong> im spätem Handwerksgrusse wa<strong>ch</strong>sen die s<strong>ch</strong>önen<br />
Mäd<strong>ch</strong>en in Sa<strong>ch</strong>sen auf den Bäumen. Ueber das mens<strong>ch</strong>enerzeu¬<br />
gende Steines<strong>ch</strong>leudern findet si<strong>ch</strong> folgende asiatis<strong>ch</strong>e Sage bei<br />
Masson, Reisen in Afghanistan (Weltpanoraina, Frankh 1843, Thl.<br />
46> Pg;- T9): Das Ziarat auf der Spitze des Ts<strong>ch</strong>ehel Tan<br />
geniesst unter den Brahui- Stämmen grosse Verehrung, die si<strong>ch</strong>
12<br />
auf Na<strong>ch</strong>stehendes gründet: Ein einfa<strong>ch</strong>es, s<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>tes Ehepaar,<br />
das s<strong>ch</strong>on viele Jahre lang dur<strong>ch</strong> die Ehe verbunden gewesen,<br />
hatte zu beklagen, dass ihre Verbindung mit keinem Sprössling<br />
gesegnet war. Die bekümmerte Frau begab si<strong>ch</strong> zu einem heiligen<br />
Manne in der Na<strong>ch</strong>bars<strong>ch</strong>aft und bat ihn, ihr seinen Segen zu<br />
geben, damit sie fru<strong>ch</strong>tbar würde. Der Weise tadelte sie, indem<br />
er erklärte: er habe ni<strong>ch</strong>t die Ma<strong>ch</strong>t, das zu gewähren, was der<br />
Himmel verweigert habe. Sein Sohn, der na<strong>ch</strong>her so berühmte<br />
Hazrat Ghous", rief aus, er sei überzeugt, den Wuns<strong>ch</strong> der<br />
Gattin erfüllen zu können; sofort warf er 40 Kieselsteine in ihren<br />
S<strong>ch</strong>oss, murmelte ein Gebet über sie und enlliess sie. Im Laufe<br />
der Zeit wurde sie von 40 Kindern entbunden. In der Verzweif¬<br />
lung über die überströmende Güte der hö<strong>ch</strong>sten Mä<strong>ch</strong>te setzte ihr<br />
Gatte alle Kinder, mit Ausnahme eines einzigen, auf den Höhen<br />
des Ts<strong>ch</strong>ehel Tan " aus. Später wurde er von Gewissensbissen<br />
gequält und eilte auf den Berg zurück, in der Absi<strong>ch</strong>t, ihre Ge¬<br />
beine zu sammeln und sie zu begraben. Zu seiner Verwunderung<br />
sah er sie alle lebendig und zwis<strong>ch</strong>en den Bäumen und Felsen<br />
herumhüpfen. Er kehrte zurück und erzählte seiner Frau die<br />
wundervolle Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te, und diese, die si<strong>ch</strong> sehr sehnte, dieselben<br />
wieder zurückzuerhalten, ma<strong>ch</strong>te den Vors<strong>ch</strong>lag, er solle am<br />
folgenden Morgen das Kind, wel<strong>ch</strong>es sie zurückbehalten halten,<br />
mit si<strong>ch</strong> nehmen und dadur<strong>ch</strong>, dass er es ihnen zeige, die Brüder<br />
zur Rückkehr bewegen. Er that es und setzte das Kind auf den<br />
Boden, um sie anzulocken. Sie kamen, aber sie nahmen es mit<br />
sicli hinauf in die unzugängli<strong>ch</strong>en Höhen des Berges. Die Brahuis<br />
glauben, dass die 40 Kinder no<strong>ch</strong> jetzt in ihrem Kindheits¬<br />
zustand um den geheimnissvollen Berg s<strong>ch</strong>weifen. Hazrat Ghous<br />
hat einen grossen Ruhm hinterlassen und wird hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> als<br />
der S<strong>ch</strong>utzheilige der Kinder verehrt. Viele Feiertage werden ihm<br />
zu Ehren gefeiert, sowohl in Beluds<strong>ch</strong>istan als in Sind. Im letz¬<br />
tern Lande wird der eilfte Tag eines jeden Monats als ein Jugend¬<br />
fest zum Andenken des Hazrat Ghous gefeiert. Viele Ziarats in<br />
vers<strong>ch</strong>iedenen Gegenden führen den Namen Ts<strong>ch</strong>ehel Tan. Kabal<br />
hat ein sol<strong>ch</strong>es in der Nähe von Arghandi." Unserm Landvolke<br />
gilt die Nagelfluh als eine Gebärmutter und als Eierstock der Steine<br />
(Stalder, Idiot. 2, 229), und es nennt sol<strong>ch</strong>erlei Deukalionsfelsen<br />
Titisteine und Kleinkindersteine. Von sol<strong>ch</strong>en handeln bereits die<br />
Aargauer Sagen 1, no. 11. Hier no<strong>ch</strong> Na<strong>ch</strong>trägli<strong>ch</strong>es aus dieser<br />
Gattung von Mythen.<br />
Seitdem unsere Historis<strong>ch</strong>e Gesells<strong>ch</strong>aft die Flurnamen im Aar-
13<br />
gau gemeindeweise hat aufzei<strong>ch</strong>nen und einsenden lassen, ist es<br />
mögli<strong>ch</strong> geworden, das Verzei<strong>ch</strong>niss jener Felsen no<strong>ch</strong> um ein<br />
Ziemli<strong>ch</strong>es zu vermehren, die man örtli<strong>ch</strong> als die Vorrathskammern<br />
der Mens<strong>ch</strong>engeburten angesehen hat.<br />
Im Bezirk Bremgarten kennt man von sol<strong>ch</strong>en Kleinkindersteinen<br />
folgende: Der Kindelistei zu Jonen, grosser Felsstein am<br />
Jonenba<strong>ch</strong>e. Der Hühnerstein in der Gemeinde Wohlen. Der Stein<br />
bei den drei Ei<strong>ch</strong>en, bei der Einsiedelei der Stadt Bremgarten ge¬<br />
legen. Der Chliekindelstein, ein Granitblock, der zwis<strong>ch</strong>en den<br />
Gemeinden Arni und Oberlunkhofen in einer Halde am Tobel des<br />
Dorl'ba<strong>ch</strong>es liegt. Der Kindlistei zu Aristau liegt zehn Minuten<br />
vom Dorfe und nur einige S<strong>ch</strong>ritte vom Fusswege ab im ebnen<br />
Walde. Zuglei<strong>ch</strong> läuft in seiner Nähe die Grenze des Gemeinde¬<br />
bannes von Aristau und Egg. Es ist ein Findlingsblock von Geissbergerslein,<br />
anderthalb Klafter ho<strong>ch</strong>, mit s<strong>ch</strong>arfen Kanten und<br />
einer Reihe künstli<strong>ch</strong> eingehaltener Grüb<strong>ch</strong>en. Die Dorfkinder da¬<br />
selbst bekommen bis in ihr zwölftes Jahr es ni<strong>ch</strong>t anders zu hören,<br />
als dass man sie zusammen hier herausgenommen habe. Zunä<strong>ch</strong>st<br />
dem Steinblocke steht ein Helglistöckli, zu Ehren der St. Barbara<br />
erri<strong>ch</strong>tet, das den Sommer über stets mit grünen Tannenwedeln<br />
andä<strong>ch</strong>tig besteckt ist; es dient zum S<strong>ch</strong>utz gegen den berü<strong>ch</strong>tigten<br />
Lands<strong>ch</strong>aftsgeist Stiefeli, der vom Kloster Muri bis hieher seine<br />
Reitbahn hat, und zuglei<strong>ch</strong> gegen jene Hexe von Aristau, die hier<br />
im Heinisumpfe versenkt liegt (Aarg. Sag. no. 395). Da die<br />
Dörfer Aristau, Birri und Althäusern bisher zusammen eine Kir<strong>ch</strong>¬<br />
höre bildeten, jetzt aber eine neue Kir<strong>ch</strong>e zu bauen vorhaben, so<br />
freut man si<strong>ch</strong> nun daselbst s<strong>ch</strong>on im Voraus, alsdann den Kindlistein<br />
sprengen und zum Neubau verwenden zu können.<br />
Bezirk Baden. Der Kindlistein zu Rohrdorf ist südli<strong>ch</strong> und<br />
thalwärts vom Dorfe gelegen. Der Kleinkinderstein der Stadt Mel¬<br />
lingen liegt im Grummet. Der Kindliacker, ein Weinberg im Ge¬<br />
lände des Dorfes Wettingen, weist mit seinem Namen auf den da¬<br />
selbst am Bussberg liegenden Kleinkinderstein. Aus dem Lehm<br />
eines Hügels des Dorfes Büblikon hat Gott der Herr S<strong>ch</strong>nellkügel<strong>ch</strong>en<br />
gedreht und die Buben von Büblikon draus gema<strong>ch</strong>t. Die<br />
Erzählung hievon steht in der Illustr. S<strong>ch</strong>weiz, Jahrg. 1863. Dorten<br />
im S<strong>ch</strong>warzgraben von Büblikon zeigte man zuglei<strong>ch</strong> einen Stein,<br />
weit im Ackerfelde drinnen liegend, bis zu wel<strong>ch</strong>em einst das<br />
Markts<strong>ch</strong>ifl, das sonst auf der Reuss von Luzern na<strong>ch</strong> Mellingen<br />
zu fahren pflegte, bei einem Ho<strong>ch</strong>wasser hingetrieben worden und<br />
ges<strong>ch</strong>eitert sein soll. Die ganze Manns<strong>ch</strong>aft sammt einer geladenen
lì<br />
neuen Kir<strong>ch</strong>englocke ging dorten im ebenen Felde unter. Der<br />
Glocke hat man no<strong>ch</strong> lange na<strong>ch</strong>gegraben, und für die Ertrunkenen<br />
soll zu Luzern eine kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Jahrzeil gestiftet worden sein.<br />
Bezirk Brugg. Die kleinen Kinder der Sladt Brugg holt man<br />
aus einer Sandsleinhöhle im Brugger Berge, die das Bruderhaus<br />
heisst. Die Gemeinde Remigen holt die ihrigen vom Dittelnstein,<br />
der auf dem Waldberge Lo<strong>ch</strong>graben liegt. Dorf Villigen hat glei<strong>ch</strong>¬<br />
falls einen Düttelistein. In Villna<strong>ch</strong>ern s<strong>ch</strong>ickt man die Hebamme<br />
zu einer Kluft des Berges Kaiofen; in dieser finden si<strong>ch</strong> zuglei<strong>ch</strong><br />
grosse Trümmer gehauener Mühlsleine vor, die man den Römern<br />
zus<strong>ch</strong>reibt.<br />
Bezirk Lenzburg. Das Dorf Seengen am Hallwyler See hat<br />
seinen Kleinkinderslein in einer Egerten, wel<strong>ch</strong>e die Erdbrust<br />
heisst. Die Riese, wel<strong>ch</strong>e am westli<strong>ch</strong>en Seeufer niedergehl und<br />
in den Genieindebezirk von Lülwyl gehört, heisst Häfni: in ihr liegt<br />
der für die Dörfer Alliswyl und Lütwyl als Kleinkinderstein gel¬<br />
tende Findlingsblock. Im Dorfe Ammerswyl findet man die kleinen<br />
Mäd<strong>ch</strong>en unter dem Felsblocke, der, unter seines Glei<strong>ch</strong>en der<br />
Grösste im Bann, gelegen ist in des Obristen Holz, einem Walde,<br />
der au<strong>ch</strong> die Fohren heisst. Die kleinen Buben muss man da¬<br />
gegen viel mühsamer aus mehreren Brunnenstuben der Gegend<br />
zusammenholen. In Othmarsingen holt man sie aus dem Gross¬<br />
stein, einem Granitblocke in der westli<strong>ch</strong>en Zeige des Dorfes<br />
gelegen.<br />
Bezirk Rheinfelden. In einer Felsens<strong>ch</strong>lu<strong>ch</strong>t der Waldung<br />
Ploweiel, die zum Dorfe Zuzgen gehört, soll der Chindligraben<br />
sein; hier ist angebli<strong>ch</strong> eine mit einem Decksteine vers<strong>ch</strong>lossene<br />
Höhle, aus der man die neuen Erdenbürger herausnimmt.<br />
Bezirk Kulm. Die Gemeinde Birrwyl hat einen Teti- oder<br />
Breitenstein ; man meldet uns von dorther ni<strong>ch</strong>ts anderes, als dass<br />
Teti ein kleines Kind genannt werde.<br />
Bezirk Zurza<strong>ch</strong>. In einer der drei Zeigen von Rümikon<br />
heisst eine Ackerbreite die Kindbetteräcker: hier soll eine arbei¬<br />
lende Frau im Felde von ihrer Niederkunft überras<strong>ch</strong>l worden<br />
sein. Daselbst sind aber no<strong>ch</strong> ausserdem örtli<strong>ch</strong>e Mailliwiesen und<br />
Bubenwiesen; jene moosig, diese Irocken.<br />
Auf dem Titer heisst die letzte Anhöhe, wel<strong>ch</strong>e von Vies<strong>ch</strong><br />
im Wallis auf den Vies<strong>ch</strong>erglets<strong>ch</strong>er führt (Es<strong>ch</strong>er, Die S<strong>ch</strong>weiz<br />
1851, 424). Aus dem Titisee im bad. S<strong>ch</strong>warzwald fis<strong>ch</strong>t die<br />
Ammenfrau die Neugeborenen heraus. Aus der Höhle des Rosen¬<br />
steins holt zu Heuba<strong>ch</strong> die Amme die kleinen Kinder; dort ist die
15<br />
Weisse Frau, die sie der Hebamme hinrei<strong>ch</strong>t. Meier, S<strong>ch</strong>wab.<br />
Sag. pg. 263. Bei der Rosstrappe im Harz befindet si<strong>ch</strong> unter der<br />
Teufelsbrückc eine warme Stube, worin die Kinder vor der Ge¬<br />
burt von der Kindermutler beaufsi<strong>ch</strong>tigt werden. Pröhle, Unlerbarz.<br />
Sag. pg. 4. Im Mühlgraben liegt jener grosse Stein, hinter<br />
dein na<strong>ch</strong> Kärntner Volksglauben die Hebamme die Kinder heraus¬<br />
holt. Wolf, Zts<strong>ch</strong>r. f.<br />
Myth. 3, 31. Eine Felsenhöhle beim Bergs<strong>ch</strong>losse<br />
Teck auf der Württemberg. Alb heisst Frena-Bubelinslo<strong>ch</strong>,<br />
und eine nä<strong>ch</strong>stgelegene Höhle mit rei<strong>ch</strong>en Brunnadern das Frau-<br />
Sibyllenlo<strong>ch</strong>. Daran knüpft si<strong>ch</strong> die Sage von einem auf S<strong>ch</strong>atztruhen<br />
liegenden Geisterhunde und zuglei<strong>ch</strong> von einem baieris<strong>ch</strong>en<br />
Ehepaar, das in dieser Höhle heimli<strong>ch</strong> zusammen lebte, zwei Kna¬<br />
ben zeugte und endli<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> diese umherlaufenden Kinder verralheh<br />
wurde. Antiquarius des Neckarstroms 1740. 46. Mit dem<br />
ersten Namen dieser Höhle ist die kinderbringende hl. Verena be¬<br />
zei<strong>ch</strong>net, deren Cultus in der S<strong>ch</strong>weiz mit zum ältesten gehört.<br />
Ein Lo<strong>ch</strong> in einem Felsen neben der Kapelle in der Verenen-Einsiedelei<br />
zu Solothurn ist gross genug, um eine Hand hineinzu¬<br />
stecken. Es ist der Grill' der Heiligen, die si<strong>ch</strong> am Fels theils<br />
gegen die Wogen der Sündflulh festhielt, theils gegen den sie ver¬<br />
folgenden Salan. Deshalb heissl es au<strong>ch</strong>, der Satan habe diesen<br />
Felsblock gegen die Heilige vergebli<strong>ch</strong> ges<strong>ch</strong>leudert, ni<strong>ch</strong>ts als die<br />
Spuren seiner Krallen vermo<strong>ch</strong>te er hineinzudrücken. No<strong>ch</strong> im¬<br />
mer pflegt man erkrankte Glieder zur Heilung an dieses Lo<strong>ch</strong> zu<br />
halten, und zuglei<strong>ch</strong> erkennt man darinn die von der Hacke der<br />
Ammenfrau gehauene Oeffnung, die allen Bedarf der Stadt Solo¬<br />
thurn an kleinen Kindern aus diesem erratis<strong>ch</strong>en Block herausholt.<br />
Wolf, Zts<strong>ch</strong>r. f.<br />
Myth. 4, 1. Er heisst deshalb Kindlistein. Wie<br />
nun die Frau Vreneli" es bewerkstelligt, dass ihr Kleinkindertrog<br />
im Steine nie leer wird, dies steht in den Aarg. Sag. 1, pg. 228.<br />
Ein isolirter Felsblock auf der Burgiluh zu Wölfliswyl im Frickthal<br />
heisst der Ankenkübel<br />
: in ihm steht glei<strong>ch</strong>falls ein Kleinkindertrog.<br />
Donnert es im Berge, so sagt man sol<strong>ch</strong>en Leuten zu Tröste, die<br />
eben ein Kind dur<strong>ch</strong> den Tod verloren haben : Es ist wieder ein<br />
Stein von der grossen Fluh heruntergepoltert, nun kann die Heb¬<br />
amme wieder ein anderes herausnehmen. Und wie zu Brugg, wird<br />
die dorten nä<strong>ch</strong>stgelegene Felskluft Waldbruderhöhle genannt. Man¬<br />
<strong>ch</strong>erlei örtli<strong>ch</strong>e Marienlegenden und Wallfahrtsmirakel knüpfen si<strong>ch</strong><br />
an derlei Höhlen und Grotten, deutli<strong>ch</strong> auf jenen Kindersegen zu¬<br />
rückweisend, den man ihnen ursprüngli<strong>ch</strong> beimass. Die drei Fräu¬<br />
lein von Landskron flohen vor Räubern bis auf eine Felsenkante
16<br />
hinaus und sprangen von ihr auf den Fels hinab. Dorten ver¬<br />
s<strong>ch</strong>wanden sie, denn der Fels hatte si<strong>ch</strong> geöffnet und eine Grotte<br />
gebildet, die si<strong>ch</strong> hinter ihnen s<strong>ch</strong>loss. Jetzt steht eine Wallfahrts¬<br />
kapeile droben mit einer natürli<strong>ch</strong>en Felsengrotte, die gegen Kin¬<br />
derkrankheiten stark besu<strong>ch</strong>t ist. Kinkel, Die Ahr. Bonn 1846,<br />
210. Die Wallfahrtskir<strong>ch</strong>e Maria-Stein, in einem Felsenthaie des<br />
Solothurner Jura, ist eine natürli<strong>ch</strong>e und dann künstli<strong>ch</strong> weiter<br />
ausgehöhlte unterirdis<strong>ch</strong>e Gebirgsgrotte. Dem wunderthätigen Bild<br />
der Gnadenmutter Maria daselbst werden mehrere Legenden<br />
s<strong>ch</strong>wankend na<strong>ch</strong>erzählt. Bald ist es das Knäblein gewesen, das<br />
dem Ritter von Rothberg na<strong>ch</strong> langer kinderloser Ehe geboren<br />
worden war; bald war's ein blosses Hirtenbüblein, das liier ein¬<br />
mal, neben seiner Mutter spielend, über die Fluh in den Felsen¬<br />
s<strong>ch</strong>lund hinunterstürzte. Als man den pfadlosen Abgrund errei<strong>ch</strong>t<br />
hatte, kam das Kind unverletzt den Su<strong>ch</strong>enden entgegen, ein Körb¬<br />
<strong>ch</strong>en fris<strong>ch</strong>gelesener Erdbeeren in der Hand, und erzählte, eine<br />
s<strong>ch</strong>öne Frau habe es aufgefangen und ihm gerade da, wo nun im<br />
Felsen die Kapellengrotte ist, das Körb<strong>ch</strong>en voll Beeren ges<strong>ch</strong>enkt.<br />
Maria mit den Rothbeeren ist in der Legende dieselbe Ammenfrau,<br />
wie in der Sage die kinderhütende Verena. Erstere überbringt<br />
denAeltern die Neugeborenen, oder nimmt die verstorbenen Säug¬<br />
linge zu si<strong>ch</strong> in's Paradies und führt sie da wieder in die Ruth¬<br />
beeren spazieren; so erzählt man heute no<strong>ch</strong> in der Oberpfalz:<br />
Panzer, Baier. Sag. 2, 13. 379. S<strong>ch</strong>önwerth, Oberpfälz. Sag. I,<br />
203. Ein Kir<strong>ch</strong>engemälde vom J. 1372, einst im Frankfurter Stadt¬<br />
spital und no<strong>ch</strong> 1706 daselbst vorhanden gewesen, stellt die Mutter<br />
Maria dar, ein Körb<strong>ch</strong>en Erdbeeren in der Hand, zu ihren Füssen<br />
das Christkind mit einem Vogel spielend. Frankf. Ar<strong>ch</strong>iv I, Heft<br />
3, 83. Das Kir<strong>ch</strong>lein Maria im Stöckl bei Bruneck in Tyrol ist an<br />
der Stelle einer frühern Höhle erbaut, bei wel<strong>ch</strong>er den Vorüber¬<br />
gehenden stets die Kinder abhanden gekommen waren. Eine<br />
Mutter, deren Kind au<strong>ch</strong> vers<strong>ch</strong>wand, drang Na<strong>ch</strong>ts mit einem<br />
(geweihten) Li<strong>ch</strong>t in die Höhle und trat hier unter lauter kleine<br />
Kinder, in deren Mitte eine s<strong>ch</strong>öne, herrli<strong>ch</strong>e Frau sass, das Ge¬<br />
raubte auf dem S<strong>ch</strong>oss haltend. Zingerle, in der Zts<strong>ch</strong>r. f. Myth.<br />
1, 463. Die Höhle im Altkönig, worin die sieben greisen Männer<br />
um den Steintis<strong>ch</strong> sitzen, s<strong>ch</strong>liesst si<strong>ch</strong>, bevor die Mutter nebst den<br />
hier erhaltenen Kostbarkeiten au<strong>ch</strong> ihr Kind mit herausgenommen<br />
hat, aber es findet si<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> sieben Jahren dorten wieder, blühend<br />
und fris<strong>ch</strong>. WTolf, Hess. Sag. no. 2. Aus dem Wesen der Gott¬<br />
heit, die man im Innern des Berges und Felsens gegenwärtig
17<br />
glaubte, di<strong>ch</strong>tete man si<strong>ch</strong> eine im Leib des Gebirges vers<strong>ch</strong>lossen<br />
liegende Kir<strong>ch</strong>e, eine versunkene Kapelle, angefüllt mit grossen<br />
Weihs<strong>ch</strong>ätzen. Einmal des Jahres, an dem allheidnis<strong>ch</strong>en Festtage,<br />
öffnet sie si<strong>ch</strong> dann für Glückskinder, so am böhmis<strong>ch</strong>en Rosen¬<br />
berg, eine Stunde entfernt von Hohen-Leipa. Ein Weib, das mit<br />
ihrem Kinde am Charfreilag ihn bestieg, fand ihn offen und trat<br />
in seine geheime Kapelle. Hier setzte sie ihr Kind nieder und<br />
sammelte daneben im AValde weiter ihr Leseholz. Als sie davon<br />
zurückkam, um das Kleine zu holen, fand sie den Berg ver¬<br />
s<strong>ch</strong>lossen. Sie musste allein heimkehren und betete das<br />
ganze<br />
Jahr, Gott möge ihr Kind bes<strong>ch</strong>ützen. Am nä<strong>ch</strong>stfolgenden Char¬<br />
freilag gieng sie wieder zu dem Berg, da eilte ihr das Kleine aus<br />
der offenen Kapelle entgegen, fröhli<strong>ch</strong> erzählend, eine s<strong>ch</strong>öne,<br />
freundli<strong>ch</strong>e Frau habe ihm jeden Tag Nahrung gebra<strong>ch</strong>t, die Zeit<br />
sei ihm dabei so s<strong>ch</strong>nell vergangen,<br />
als ob es bloss eine Wo<strong>ch</strong>e im<br />
Berg gewesen sei. Grohmann, Böhm. Sagb. 1, 298. Es wird si<strong>ch</strong><br />
na<strong>ch</strong>her bei der Bespre<strong>ch</strong>ung des Namens Roggenstein erklären,<br />
dass si<strong>ch</strong> diese legendaris<strong>ch</strong>en Züge auf die Götterfrauen Hulda,<br />
Berta, Isa und Frouwa stützen.<br />
Der Sa<strong>ch</strong>s, ein Gottes-, Volks-, Waffen-, Orts- und Ge¬<br />
s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tsname. In der altho<strong>ch</strong>deuts<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>e wird der Stein,<br />
der Mens<strong>ch</strong>, sein Gott, sein Volk und seine Waffe mit einem und<br />
demselben Worte benannt: Sa<strong>ch</strong>s. Der Feuerstein und das in den<br />
Holzgriff gefasste Steins<strong>ch</strong>wert heisst sahs; ni<strong>ch</strong>t etwa entlehnt<br />
oder abgeleitet von saxum und secare, sondern mit diesen Laleinwörtern<br />
selbst urverwandt. Das Volk, das mit sol<strong>ch</strong>en Kieselsteinwaffen<br />
fo<strong>ch</strong>t, hiess das Sa<strong>ch</strong>senvolk, und der ihm den S<strong>ch</strong>la<strong>ch</strong>tensieg<br />
verleihende Stammgott hiess altsä<strong>ch</strong>s. Saxiwl, S<strong>ch</strong>wertgenosse,<br />
in den angelsä<strong>ch</strong>s. Stammtafeln Saxnedt genannt, einer der Söhne<br />
Wuotans. Der Sa<strong>ch</strong>sen Stammgott ist also ein Steingott, seine und<br />
des Volkes Waffe ist der zur Säbels<strong>ch</strong>neide zugehauene Feuerstein,<br />
und sein Name kehrt wieder in der ersten Abs<strong>ch</strong>wörungsformel,<br />
mit wel<strong>ch</strong>er der norddeuts<strong>ch</strong>e Heide vor dem Christenpriester den<br />
Göttern entsagte. Hier werden als die drei obersten Gottheiten<br />
genannt: Thunaer, der Donnergott Woden, ahd. Wuotan, altnord.<br />
;<br />
Odhinn, und Saxnôt. (Aufzei<strong>ch</strong>nung im 9. Jahrh. Pertz 3, 19.)<br />
Die Erinnerung aber an die Ursprungssage des Volkes aus dem<br />
vergötterten Stein dauerte no<strong>ch</strong> lange fort. Im Annoliede des<br />
12. Jahrhunderts wird von den Steinbeilen der thüringis<strong>ch</strong>en<br />
Sa<strong>ch</strong>sen gesagt, dass letztere ihren Namen eben von diesen s<strong>ch</strong>ar¬<br />
fen Messern trügen :
18<br />
cin Duringin duo dir siddi was,<br />
daz si mihhili mezzir hiezin sahs;<br />
von den mezzerin also wahsin<br />
wurdin si geheizzin Saksin.<br />
Der Pfaffe Konrad in seinem Rolandsliede 797 wiederholt diese<br />
stehend gewesene Phrase : die steinherten Sahsen. Die Glosse zum<br />
Sa<strong>ch</strong>senspiegel beruft si<strong>ch</strong> ausdrückli<strong>ch</strong> auf diese Deutung des<br />
Sa<strong>ch</strong>sennamens :<br />
denn wir sind geglei<strong>ch</strong>et den Kieslingsteinen in<br />
unsern Streiten." Weitere Belege hierüber aus den Chronisten<br />
Widukind, Gotfried von Viterbo, Nennius, sowie aus den Re<strong>ch</strong>tsbü<strong>ch</strong>ern<br />
können na<strong>ch</strong>gelesen werden bei Grimm, RA. 772. 956.<br />
Ges<strong>ch</strong>. der deuts<strong>ch</strong>. Spra<strong>ch</strong>e 610. Bei Massmann, Kaiser<strong>ch</strong>ronik 3,<br />
485. 1010. Der Name Sa<strong>ch</strong>s vererbt si<strong>ch</strong> sodann in der deuts<strong>ch</strong>en<br />
Heldensage auf die Waffen der Heroen. Dietri<strong>ch</strong>s, des Riesenund<br />
Zwergenbesiegers, alles zerhauendes S<strong>ch</strong>wert heisst Eckesax,<br />
eigentli<strong>ch</strong> ein das s<strong>ch</strong>neidende Steins<strong>ch</strong>wert bezei<strong>ch</strong>nender Pleo¬<br />
nasmus. Jarnsaxa, d. i. die eisenfeste Klippe, der s<strong>ch</strong>arfe Eisen¬<br />
stein, wird in der Edda des Donnergottes Gemahlin genannt, die<br />
zuglei<strong>ch</strong> eine der neun Mütter des S<strong>ch</strong>wertgottes Heimdal ist. Der<br />
Name Sax für ein langes Beimesser ist bei den oldenburgis<strong>ch</strong>en<br />
Saterländern jetzt no<strong>ch</strong> gangbar (Klopp, Ges<strong>ch</strong>. Ostfrieslands 8),<br />
und der alte Re<strong>ch</strong>tsbrau<strong>ch</strong> der Nordsa<strong>ch</strong>sen, bewaffnet mit diesen<br />
hirs<strong>ch</strong>fängerartigen Messern beim Volksgeri<strong>ch</strong>t zu ers<strong>ch</strong>einen, ist<br />
na<strong>ch</strong> Grimms Beri<strong>ch</strong>t (RA. 772) no<strong>ch</strong> zu Anfang dieses Jahrhun¬<br />
derts den mit diesen Uebli<strong>ch</strong>keiten ni<strong>ch</strong>t vertrauten preussis<strong>ch</strong>en<br />
Beamten zu ihrem S<strong>ch</strong>recken si<strong>ch</strong>tbar geworden. Daher durfte<br />
s<strong>ch</strong>on der wackere Neocorus in seiner Ditmars<strong>ch</strong>en<strong>ch</strong>ronik (44)<br />
derjenigen deuts<strong>ch</strong>en Gelehrten spotten, die dieses Wort ebenso un¬<br />
nützer Weise aus dem Lateinis<strong>ch</strong>en ableiteten, wie man heute viel¬<br />
lei<strong>ch</strong>t es aus dem Keltis<strong>ch</strong>en abzuleiten beliebt. Von den Wels<strong>ch</strong>en,<br />
sagt Neocorus, haben wir unsere Volksnamen s<strong>ch</strong>on deshalb ni<strong>ch</strong>t<br />
entlehnt, weil wir von ihnen ebenso wenig wissen, als sie von<br />
uns. Sa<strong>ch</strong>ss, fährt er fort, heisst auf altdeuts<strong>ch</strong> ein Messer, und<br />
so lieti no<strong>ch</strong> bi den Obetiendern Sa<strong>ch</strong>sz ein Mest. S<strong>ch</strong>arsa<strong>ch</strong>sz ein<br />
Scliernteszer.<br />
Ein glei<strong>ch</strong>es S<strong>ch</strong>wanken hat au<strong>ch</strong> in der Behandlung jener<br />
Ortsnamen geherrs<strong>ch</strong>t, die zum glei<strong>ch</strong>en Wortstamme gehören. Die<br />
Orts<strong>ch</strong>aften Sax und Hohensax gründen si<strong>ch</strong> auf ein glei<strong>ch</strong>namiges<br />
Adelsges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t, das latinisirt urkundli<strong>ch</strong> si<strong>ch</strong> de<br />
rupe nannte.<br />
Glei<strong>ch</strong>wohl haben beide einen Sack in's Wappen genommen, wie
19<br />
das verwandte Edelges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t von Mosax einen Kornsack. Ild. von<br />
Arx, Ges<strong>ch</strong>. v. St. Gallen 1, 538. S<strong>ch</strong>on in einer Urkunde von 940<br />
wird das Graubündner S<strong>ch</strong>anis fäls<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> als ein Sexamnes gedeutet<br />
(Züri<strong>ch</strong>. Antiquar. Mittheil. Bd. 13, Heft 4, 138), obs<strong>ch</strong>on der Ort<br />
in rhätis<strong>ch</strong>er Spra<strong>ch</strong>e Sessam und in italienis<strong>ch</strong>er Sassame heisst,<br />
also beiderseits saxum bedeutend. Den Bündner Ort Seissa, ober¬<br />
halb Tusis im Domles<strong>ch</strong>ger Thale, erklärt man glei<strong>ch</strong>falls aus dem<br />
latein. saxum, obs<strong>ch</strong>on do<strong>ch</strong> die mundartli<strong>ch</strong>e Form des Wortes<br />
Sense (ahd. seginsd) selbst Seissa lautet. Kaum minder häufig als<br />
im romanis<strong>ch</strong>en Bünden finden si<strong>ch</strong> im reindeuts<strong>ch</strong>en Oberwallis,<br />
ferner in Unterwalden und im Berner Oberlande die wiederkehren¬<br />
den Localnamen : Saxon, Sa<strong>ch</strong>selen, Lützelsa<strong>ch</strong>sen, Sassel, Sass¬<br />
ba<strong>ch</strong> (er fällt in den obern See auf dem Grimselberge). Das ober¬<br />
pfälzis<strong>ch</strong>e Städt<strong>ch</strong>en Hilpoltstein heisst urkundli<strong>ch</strong> 1345 da ze dem<br />
stein. Das Siegel seiner Burgherren zeigt einen Adler auf einem<br />
Bühel si<strong>ch</strong> zum Fluge ans<strong>ch</strong>ickend mit ausgebreiteten Sa<strong>ch</strong>sen",<br />
und der Ums<strong>ch</strong>rift: sigili. Hiltipoldi de Lapide. Bavaria 2, 512.<br />
So setzt au<strong>ch</strong> die Peutingeris<strong>ch</strong>e Tafel an die Stelle der beiden<br />
vorhin genannten Bündner Orts<strong>ch</strong>aften Sessam und Seissa topo¬<br />
graphis<strong>ch</strong> einen Ort Lapidaria an, und so spre<strong>ch</strong>en eine Reihe<br />
von Orts<strong>ch</strong>aften s<strong>ch</strong>on in ihrer ältesten Namensform den Beweis<br />
aus, dass das Wort Sa<strong>ch</strong>s ni<strong>ch</strong>t ein aus dem Latein abgeleitetes,<br />
sondern der deuts<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>e zugehörendes ist. Der Deuts<strong>ch</strong>e,<br />
der bereits in seiner alten Götterlrias den steingewa<strong>ch</strong>senen Riesengolt<br />
Sa<strong>ch</strong>s mit aufzählte, konnte diesen Namen unmögli<strong>ch</strong> aus einer<br />
Spra<strong>ch</strong>e entlehnt haben, die ni<strong>ch</strong>t einmal ein eigenes Wort für den<br />
Begriff Bergriese besitzt, sondern das grie<strong>ch</strong>. Gigas, Titan, Cy¬<br />
clops dafür borgen muss. Findet si<strong>ch</strong> aber der Wortstamm sax<br />
wie in der deuts<strong>ch</strong>en, so au<strong>ch</strong> in der altitalis<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>enfamilie<br />
vor und ist er aus dieser übergegangen in das Dacoromanis<strong>ch</strong>e,<br />
Rhätoromanis<strong>ch</strong>e, Provenzalis<strong>ch</strong>e, so ist dies ein Beweis, dass er<br />
beiderseits dem indogermanis<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>stamme angehört, in ihm<br />
aber eben jener vorhistoris<strong>ch</strong>en Periode, deren Begriffe und An¬<br />
s<strong>ch</strong>auungen ni<strong>ch</strong>t dur<strong>ch</strong> jene Spra<strong>ch</strong>en, wohl aber dur<strong>ch</strong> die<br />
deuts<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong>weisbar sind. Allerdings erzählt Livius 1, 24, dass<br />
die dem Jupiter zu opfernden Eber zur Zeit der Könige no<strong>ch</strong> mit¬<br />
telst eines Steinmessers: saxo silice ges<strong>ch</strong>la<strong>ch</strong>tet worden seien;<br />
aber ohne diesen oder den glei<strong>ch</strong>zeitig erwähnten Brau<strong>ch</strong> der<br />
herba pura erklären zu können, übergeht er au<strong>ch</strong> die dabei ge¬<br />
spro<strong>ch</strong>enen S<strong>ch</strong>wurformeln, weil es vielerlei Worte seien :<br />
quae<br />
longo effata carmine non operae est referre.
20<br />
Flinsen und Bunsen nennt man im Gebirge einen Längen¬<br />
bru<strong>ch</strong> der Felswände, dur<strong>ch</strong> wel<strong>ch</strong>en Erde und Gestein losgerissen<br />
zu Thal stürzen. Sie sind von Wilden Männern und Weibern be¬<br />
wohnt, wel<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong> dem abruts<strong>ch</strong>enden Ges<strong>ch</strong>iebe und dem im<br />
Sturze Funken sprühenden Felsen vom Vorarlberger die Ruts<strong>ch</strong>ifenggen,<br />
vom Tiroler die Runzen genannt werden. Ueber Beide<br />
sind die Sagensammlungen Vonbun's und Zingerle's am ergiebigsten.<br />
Im Pitzthale, einem Nebenthaie des lnn, hält man die Runsen für<br />
Waldweiber von hoher Gestalt, grossen funkelnden Augen, strup¬<br />
pigem Langhaar, in unzugängli<strong>ch</strong>en Felsen wohnend. Pfeiffer, Ger¬<br />
mania 2, 213. Ihr Name ist ein mythis<strong>ch</strong>en Das Eckenlied nennt<br />
Rutze und Rütze ein ihre zwei Söhne im Walde aufziehendes Rie¬<br />
senweib, im Heldenbu<strong>ch</strong>e wird dieselbe Runtze genannt. Der Be¬<br />
ri<strong>ch</strong>t an den S<strong>ch</strong>weiz. Bundesrath : Ueber die Ho<strong>ch</strong>gcbirgswaldungen<br />
1862, 100 103 lässt erkennen, wel<strong>ch</strong>e Anwendung diesen Be¬<br />
nennungen heute bei den Aelplern gegeben wird; folgende An¬<br />
führungen sind daraus entnommen: An Runsen, Flinsen und<br />
Bä<strong>ch</strong>en darf nur mit Bewilligung der Tagwenräthe Holz gehauen<br />
werden. Glarner Forstordnung von 1806. Bei Flinsen, Runsen und<br />
Lauizügen soll der Boden mit Weidenstöcken besetzt werden<br />
(vom J. 1820). Flinsen, Runsen und Wildbä<strong>ch</strong>e sollen verbaut<br />
werden (vom J. 1851). Der Flinsstein ist der Feuerkiesel, die<br />
Monseer Glossen übersetzen flinssleina, pelra focaria, silex. Die<br />
keilförmigen Steine, die der Donnergott vom Himmel wirft, sind<br />
Flinse : ein vlins von donresträlen. Wolfram v. Es<strong>ch</strong>enb. 9, 32 in<br />
Grimms Myth. 163. Vom geheiligten Flinssteine hat das oberbaier.<br />
Dorf Flinsba<strong>ch</strong> Namen und Wallfahrt bekommen. Petrus (der an<br />
die Stelle des deuts<strong>ch</strong>en Donnergottes tretende Apostel) hat da¬<br />
selbst auf dem Petersberge in der Nähe der dorten stehenden Ka¬<br />
pelle seinen Stab fallen lassen (den Blitzhammer, den wir soglei<strong>ch</strong><br />
als den Mangsstab zu s<strong>ch</strong>ildern haben); unten am steilen Berge<br />
hat er gerastet. Nun sieht man im Felsen die Höhlung, die sein<br />
Stab eindrückte, unten aber ebenso seinen Sitz mit den einge¬<br />
drückten Vertiefungen von Händen und Füssen. Panzer, Baier.<br />
Sag. 1, no. 275. Die Bes<strong>ch</strong>affenheit dieses Flinses ist von der<br />
Thorsteinsaga ges<strong>ch</strong>ildert, die alte Züge aus dem Göttermythus des<br />
Thôrr an den Helden Thorstein geknüpft hat. Dieser erhält von<br />
einem Zwerge einen Stahl und einen dreifarbigen Feuerstein von<br />
dreieckiger Gestalt; der Stein trug die Wuns<strong>ch</strong>gabe in si<strong>ch</strong>, na<strong>ch</strong><br />
jedem Wurf in die Hand des Besitzers zurückzukehren, wie in dei-<br />
Edda s<strong>ch</strong>on von dem Blitzhammer des Donnergottes erzählt ist.
21<br />
S<strong>ch</strong>lug nun Thorstein mit dem Stahl an den Stein, wo derselbe<br />
weiss war, so entstand ein sol<strong>ch</strong>es Hagelwetter, dass Niemand da¬<br />
gegen ansehen konnte; s<strong>ch</strong>lug er an, wo er gelb war, so kam<br />
soglei<strong>ch</strong> Sonnens<strong>ch</strong>ein, dass aller gefallene S<strong>ch</strong>nee s<strong>ch</strong>molz; s<strong>ch</strong>lug<br />
er aber an die rothe Seite, so bra<strong>ch</strong> Blitz und Donner mit fliegen¬<br />
den Funken hervor. Russwurm in der Zeits<strong>ch</strong>r. f. Myth. 1, 414.<br />
Dies ist die Erzählung von der Wirkung, wel<strong>ch</strong>e das Alterthum in den<br />
dreieckigen Flins verlegte; der Römer nannte ihn das fulmen trisulcum<br />
und legte ihn als Donnerkeil, der oben und unten drei<br />
Spitzen und dazu die dreifa<strong>ch</strong>e Wirkung hatte von Donner, Blitz<br />
und Hagel, dem Jupiter in die ausgestreckte Hand : drei der<br />
Strahlen aus Hagel gezackt. Virgil. Aen. 8, 429.<br />
Betra<strong>ch</strong>ten wir nun die vers<strong>ch</strong>iedenen Formen, unter denen der<br />
Flinsstein heute no<strong>ch</strong> seine bald religiöse, bald landwirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>e<br />
Rolle spielt.<br />
Am Peterstage klopft man mit einem Hammer an Hauspfosten<br />
und S<strong>ch</strong>wellen, um das Ungeziefer daraus zu vertreiben. Wöste,<br />
Westfäl. Volksüberlief. 24. Am St. Mangstage (6. Sept.) s<strong>ch</strong>neidet<br />
man Haselruthcn und steckt sie<br />
gegen die Krautwürmer in die<br />
Ackerenden. S<strong>ch</strong>önwerth, Oberpfalz 3, 283. Petrus und St. Magnus<br />
mit S<strong>ch</strong>lüssel, Hammer und Stab erinnern an den goldenen S<strong>ch</strong>lüs¬<br />
selbund der Weissen Frau, d. i. an den im Gewitter niederfahren¬<br />
den Zickzack des Blitzes, der den Segen der Wolken ers<strong>ch</strong>liesst,<br />
oder au<strong>ch</strong> die Plage des Ungeziefers vertilgt, wie die feurige Blitz¬<br />
lanze legendaris<strong>ch</strong>er Heiligen und Helden die Würmer und Dra¬<br />
<strong>ch</strong>en des Gebirges dur<strong>ch</strong>bohrt und deren S<strong>ch</strong>atzhühlen öffnet. Un¬<br />
sere auf bestimmte Festtage gebackenen Wecken und Fladen sind<br />
theils ihrem Namen, theils ihrer Gestalt na<strong>ch</strong> alte sinnbildli<strong>ch</strong>e Wie¬<br />
derholungen dieser Donnerkeile und Donnerbeissel. Eine St. Galler<br />
Glosse aus dem 9. Jahrhundert s<strong>ch</strong>reibt: euneus, weggi; citindros<br />
kraphilin. Hattemer Denkm. 1, 266. Das Gebäcke, Namens Drei¬<br />
spitz, bes<strong>ch</strong>rieben im Oberrhein. Ko<strong>ch</strong>bu<strong>ch</strong> 272 (Mülhausen 1825)<br />
bildet ein Dreieck, wie die zwei Enden des Donnerhammers, ver¬<br />
bunden mit dem Hammerstiel, ein sol<strong>ch</strong>es bilden. Die Zeit, sie zu<br />
backen, ist lands<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong> eine vers<strong>ch</strong>iedene; zu Ilseburg am Harze<br />
und im Wendlande kommen diese dreieckigen Kröppeln je mit der<br />
Fasna<strong>ch</strong>t, also gerade mit dem alten Feste Donars, zum Vors<strong>ch</strong>ein<br />
(Wolf, Beitr. 1, 78); in Hessen je auf Weihna<strong>ch</strong>ten; immer er¬<br />
s<strong>ch</strong>einen sie als ein für die no<strong>ch</strong> erwartete oder s<strong>ch</strong>on ges<strong>ch</strong>lossene<br />
Ernte bestimmtes Opferbrod. Auf den altaargauis<strong>ch</strong>en Dorfkir<strong>ch</strong>¬<br />
weihen spielt man um dünne Lebzelten; die kleinern, viereckig,
22<br />
und roth gefärbt, heissen Feuersteine, die grössern Dreispitz,<br />
Dreizüpf, Baselstab; in katholis<strong>ch</strong>en Orts<strong>ch</strong>aften nennt man die¬<br />
selben Mangsstab, Heiligkreuz. Sie werdert in jenen Thals<strong>ch</strong>aften,<br />
wohin die Mode no<strong>ch</strong> wenig vorgedrungen ist, in der vollstän¬<br />
digen Gestalt eines na<strong>ch</strong> seinen drei Seiten kunstgere<strong>ch</strong>t be¬<br />
grenzten Keiles gebacken. Das westfälis<strong>ch</strong>e Festbrod Heitewiggen,<br />
von holländis<strong>ch</strong> wig, Keil, wird zu Ostri<strong>ch</strong> im Kreise Iserlohn in<br />
Form eines abgerundeten Doppelkeiles gebacken, auf der obern<br />
convexen Hälfte theils mit einem Andreaskreuze verziert, dur<strong>ch</strong><br />
dessen Mitte ein dritter Balken herabgeht, theils mit einem stum¬<br />
pfen lateinis<strong>ch</strong>en Kreuze. S<strong>ch</strong>riftl. Mittheil, von Wöste. Die Ermeländer<br />
S<strong>ch</strong>malzku<strong>ch</strong>en und die Danziger Süssbrode, die zum<br />
S<strong>ch</strong>weinefleis<strong>ch</strong> gegessen werden, nennt man dorten S<strong>ch</strong>malzkeil<strong>ch</strong>en,<br />
Pflaumenkeil<strong>ch</strong>en. S<strong>ch</strong>riftl. Mittheil, von Mannhardt. Au<strong>ch</strong><br />
Frankrei<strong>ch</strong> backt sol<strong>ch</strong>erlei eckige Keilbrode; sie heissen cugniue<br />
im Patois des Departements de la Meuse; franz. ist cogneux<br />
S<strong>ch</strong>legel, cognée Axt. Sind Pflaumen darauf gebacken, so heissen<br />
sie mit anzügli<strong>ch</strong>er Nebendeutung quina. (Mémoires de la société<br />
royale des antiquaires de France, tom. 10.) Der Quignot gilt da¬<br />
für in der Picardie; in der Kir<strong>ch</strong>e zu Bray hat ihn ein S<strong>ch</strong>üler<br />
dem Priester zu überrei<strong>ch</strong>en, während dieser die Weihna<strong>ch</strong>tsmette<br />
singt. Indess dann der Priester den Knaben in die Luft hebt und<br />
dreimal ausrufen lässt, Weihna<strong>ch</strong>ten wird der Ku<strong>ch</strong>en unter die<br />
Anwesenden vertheilt. (Mémoires de la société des antiquaires de<br />
Picardie. Amiens 1851. Tom. 1, pg. 580.) In den Basler Jahrzeit¬<br />
bü<strong>ch</strong>ern kommen für die festli<strong>ch</strong>e Begehung des Gregoriustages<br />
bestimmte Stiftungen eigener Feslbrode vor : pro cuneis sive cuneolis.<br />
Auf dem Basler S<strong>ch</strong>ulhause lag die Servitute, sie zu backen<br />
und den Armens<strong>ch</strong>ülern und Singknaben auszuspenden. Dieses<br />
S<strong>ch</strong>ulhaus- aber war s<strong>ch</strong>on seit dem Jahre 1280 in einem Gebäude,<br />
wel<strong>ch</strong>es damals Mont Job hiess (das ist der Name des Mons Jovis<br />
oder Bernhardin) und heut zu Tage die Diakonswohnung ist; das¬<br />
selbe musste je am Gedä<strong>ch</strong>tnisstage eines Stifters aus einem Viernzel<br />
Spelt, dem Viertel eines Malters, a<strong>ch</strong>tzig sol<strong>ch</strong>er cunei oder Spend¬<br />
keile backen. Fe<strong>ch</strong>ter, Basel im XIV. Jahrh. pg. 71. 97. Das<br />
Keilbrod ist also na<strong>ch</strong> des Donnergottes Keil benannt, der Weck<br />
eine Gabe des Erntegottes, wird ihm zum Ernteopfer in Form des<br />
Donnerkeils gebacken, wel<strong>ch</strong>er s<strong>ch</strong>wedis<strong>ch</strong> selbst Thôrviggar hiess.<br />
No<strong>ch</strong> legen die Insels<strong>ch</strong>weden einen Donnerkeil (bisavigg) in die<br />
Wanne des Saatkornes, dann s<strong>ch</strong>adet das Gewitter der Fru<strong>ch</strong>t<br />
ni<strong>ch</strong>t. Russwurm, Eibofolke 2, 249.
23<br />
Ein weiteres alterthümli<strong>ch</strong>es Wort für Fels ist in romanis<strong>ch</strong>er<br />
und deuts<strong>ch</strong>er Spra<strong>ch</strong>e ro<strong>ch</strong>e und Roggen.<br />
Für die romanis<strong>ch</strong>e Spra<strong>ch</strong>e bringt der Ausdruck keinerlei Be¬<br />
denken mit si<strong>ch</strong>, um so mehr aber für die deuts<strong>ch</strong>e; glei<strong>ch</strong>wohl<br />
ist er in beiden Spra<strong>ch</strong>en, wie mir s<strong>ch</strong>eint, einlassli<strong>ch</strong>er Unter¬<br />
su<strong>ch</strong>ung glei<strong>ch</strong>mässig bedürftig.<br />
Ein Jurafelsen von bedeutender Grösse, eine Stunde von Neuen¬<br />
burg ostwärts am Seeufer gelegen, heisst la ro<strong>ch</strong>e de l'éremilagc.<br />
In der Höhle des Felsens soll Pater Jakob, ein Mön<strong>ch</strong> aus der<br />
Abtei Landeron, einsiedleris<strong>ch</strong> gelebt und den Versu<strong>ch</strong>ungen des<br />
Teufels getrotzt haben, der ihn mit S<strong>ch</strong>wärmen von la<strong>ch</strong>enden,<br />
tanzenden, singenden Feen in seiner Anda<strong>ch</strong>t zu stören su<strong>ch</strong>te.<br />
S<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> liess er si<strong>ch</strong> in einen Wettkampf mit dem Bösen ein,<br />
den er siegrei<strong>ch</strong> bestanden haben soll; zum Zeugnisse dessen<br />
sollen ehemals Eindrücke von Rosshufen und zuglei<strong>ch</strong> vom S<strong>ch</strong>uh¬<br />
absatz des Pater Jakob am Fels zu sehen gewesen sein.<br />
Der romanis<strong>ch</strong>e Name für Waldfelsen von spindelartiger Gestalt :<br />
rocca, ro<strong>ch</strong>e, geht über in den wirkli<strong>ch</strong>en der Spindel; man nennt<br />
im Waadtlande und Ho<strong>ch</strong>burgund sol<strong>ch</strong>e s<strong>ch</strong>lankgestaltete Felsen :<br />
quenouille des Fées (fatae, soror es), quenouille à la bonne fée;<br />
à la bonne dame, altdeuts<strong>ch</strong> diu guote vrouwe. Zuglei<strong>ch</strong> aber<br />
findet si<strong>ch</strong> derselbe Wortstamm vielfa<strong>ch</strong> im Deuts<strong>ch</strong>en in demselben<br />
Sinne wieder. Ruckbein, Hausruck, Roggenstein, Hundsruck sind<br />
aller Orten deuts<strong>ch</strong>e Fels- und Bergnamen, die man vergebli<strong>ch</strong><br />
auf einen auf sol<strong>ch</strong>erlei wildliegenden Höhen ehemals getriebenen<br />
Roggenbau beziehen würde. Unser Roggenhäuser Thäl<strong>ch</strong>en dahier,<br />
ein zunä<strong>ch</strong>st der Stadt Aarau gelegenes anmuthiges Felsenthal, ist<br />
heute no<strong>ch</strong> auss<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> auf Mil<strong>ch</strong>wirths<strong>ch</strong>aft angewiesen. Das<br />
S<strong>ch</strong>warzwälder Rockertweibel ist das altherris<strong>ch</strong>e Landesgespenst<br />
im Rockertwalde (Baader, Bad. Sag. in Mone's Anzeiger) und das<br />
altbaieris<strong>ch</strong>e Rockadir'l ist die am Tegernsee hausende Geister¬<br />
jungfrau. Zwei den Waldstätter See überragende Felszacken, der<br />
Mythen- und S<strong>ch</strong>wyzerhôken, heisst man Rockenstock und Spin¬<br />
nerin. Meyer-Knonau, Kanton S<strong>ch</strong>wyz 37. Diese Namen sind alt.<br />
Der Wettinger Abt Silbereisen, der im J. 1576 seinen Auszug<br />
etli<strong>ch</strong>er Chroniken" verfasste, meist na<strong>ch</strong> Etterlins Luzerner Chronik<br />
arbeitend, nennt abwei<strong>ch</strong>end von diesem, die beiden Felsen des<br />
Rütli am See das Betli und den Roggenberg. Es fehlt also da¬<br />
bei obige Spinnerin; denn der Name Roggen ist hier ni<strong>ch</strong>t colus,<br />
sondern petra. Au<strong>ch</strong> Betli hat hier den altern Begriff von Bettung<br />
und Altar, goth. badi, ahd. petti<br />
:<br />
Altäre, die man im Winter mit
2^<br />
Korn und Stroh, im Sommer mit Gras und Blumen umstreute. Da¬<br />
her rühren denn au<strong>ch</strong> die urkundli<strong>ch</strong>en Brunhilden- und die sagen¬<br />
haften Hünenbetten, die unser Volk selbst no<strong>ch</strong> Heidenaltäre,<br />
Teufelskanzeln, Heidenhüwels, Heidenkerken" nennt. Kuhn, Westfäl.<br />
Sag. 1, pg. 39. Urkunde von 1043: lapis, qui vulgo dicitur<br />
leclulus Brunnihilde. Urk. von 1221 : Brunnekildenstein (beide bei<br />
Frankfurt). Urk. von 1334 : hin gein Sarbrucken biss an den stein,<br />
den man spri<strong>ch</strong>t Chriemhildespiel. Er heisst jetzt der Spielstein.<br />
In den Sagen auf Farö und Hven (Stockholm 1815) heisst es:<br />
Nördli<strong>ch</strong> bei Karlshögaslott befanden si<strong>ch</strong> in einem längli<strong>ch</strong>en Vier¬<br />
eck aufgestellte Steine, wel<strong>ch</strong>e der Frau Grimild Grab hiessen.<br />
W. Grimm, D. Helden-S. Kaiser Karls Bettstatt heisst ein grosser,<br />
sagenberühmter Stein auf dem Landgute Rei<strong>ch</strong>enstein bei Montjoie.<br />
S<strong>ch</strong>mitz, Eiflersag. 2, 96. Der Vertragsbrief im Re<strong>ch</strong>tsstreite zwi¬<br />
s<strong>ch</strong>en dem Abt Joh. Christof von Muri und den Landleuten Wolleb<br />
und Meier von Dintikon vom J. 1563 (Ar<strong>ch</strong>iv Muri) nennt unter<br />
den der Leutpriesterei zu Villmergen zinsfälligen Gütern : In Lan¬<br />
gelen vier Ju<strong>ch</strong>art Ackers unter dem Roggenstein, und gat der<br />
Weg derdur<strong>ch</strong> gan Thettigken. Die urkundli<strong>ch</strong>en baieris<strong>ch</strong>en Orts¬<br />
namen in Panzers Sagen 1, 375: Rockenstein, Ruckenstein, Rokkenbrunn<br />
ergeben keinen Sinn, wenn man sie ni<strong>ch</strong>t spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> zu¬<br />
sammenhält mit den S<strong>ch</strong>wungsteinen, die in England Rockingstone<br />
heissen, in Dänemark Rokkestene, in Frankrei<strong>ch</strong> ro<strong>ch</strong> branlaire,<br />
pierre qui croule, qui danse.<br />
Allein wie si<strong>ch</strong> das romanis<strong>ch</strong>e ro<strong>ch</strong>e in quenouille verkehrt, so<br />
das deuts<strong>ch</strong>e Roggen in Kunkelstein, Spindelstein, zusammenge¬<br />
zogen Spielstein, in Spinnwirtel, endli<strong>ch</strong> in Hollenstein, weil meist<br />
Localsagen hinzutreten von der spinnenden Frau Holla. Wie der<br />
Riese ein Rinderhirte ist, so ers<strong>ch</strong>eint die Riesin als Hausfrau mit<br />
Rocken und Spindel. Eifersü<strong>ch</strong>tig vers<strong>ch</strong>leudert sie ihren Wirtel<br />
gegen<br />
das badende Aarweib, das der Bergriese mit lüsternem<br />
Auge betra<strong>ch</strong>tet hat. Da liegt nun ihr Wirtel drunten in der Aare<br />
und starrt als Felsen aus den Flulhen bei der Stilli : Aarg. Sag.<br />
2, no. 435. Derselbe hat na<strong>ch</strong>mals sogar als Landesmarke ge¬<br />
golten. Der Marckenbrief entzwüs<strong>ch</strong>et der Grafs<strong>ch</strong>aft Baden und<br />
der Herrs<strong>ch</strong>aft S<strong>ch</strong>enkenberg ao. 1602" beginnt die Ansetzung der<br />
beiderseitigen Landmarken also : Nämli<strong>ch</strong> und des ersten, so solle<br />
die Landmar<strong>ch</strong> anfangen vom Laufen oder Wirten der Aaren, undzig<br />
an den Klopfbrunnen, aida ein Mar<strong>ch</strong>stein bei einer Ei<strong>ch</strong> ge¬<br />
setzt. Württembergs vielgedeuteter Name ist abzuleiten von einem<br />
sol<strong>ch</strong>en auf der Berghöhe ragenden, die Landesgrenze bestimmen-
25<br />
den Felswirtel. S<strong>ch</strong>were eiserne Wurfbüsten, mit denen man in<br />
die Wette warf, nennt man in Baiern Wirdinger (Panzer, Baier.<br />
Sag. 2, 390. 401) und die Wasserwirbel des lnn, in die man sie<br />
s<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> versenkte, heissen glei<strong>ch</strong>falls Wirten und Wirdin<br />
(S<strong>ch</strong>meller, Wb. 4, 165). Wir werden na<strong>ch</strong>her no<strong>ch</strong> erklären,<br />
dass dieses Vers<strong>ch</strong>leudern geheiligter Steine in Flüsse und Seen<br />
dazu diente, das Gelingen der Ernten zu fördern. Die drei Sterne,<br />
die den Gürtel des Orion bilden, heissen in Oberdeuts<strong>ch</strong>land die<br />
drei Mäder, in Böhmen Kosy, Sensen, m Polen Kosy, Mäher<br />
weil das Gestirn etwa zur Zeit der Heuernte aufgeht; allein eben<br />
dasselbe heisst s<strong>ch</strong>wedis<strong>ch</strong> Mariärock, Friggerock : Friggae colus.<br />
Bekanntli<strong>ch</strong> vers<strong>ch</strong>enkt die umziehende Frau Holla an fleissige Dir¬<br />
nen Spindeln und zündet faulen den Rocken an. So sind die Götter¬<br />
frauen Frigg und Huld Vorsteherinnen des Spinnens und Webens,<br />
und no<strong>ch</strong> im 16. Jahrhundert ist dies in unserer Redeweise ni<strong>ch</strong>t<br />
vergessen gewesen. Des Chronisten Heinri<strong>ch</strong> Bullinger Aeltermutter,<br />
eine geborene Küeferin aus Brugg, starb zu Bremgarten<br />
1522, zweiunda<strong>ch</strong>tzigjährig. Sie hatte von ihrer Mutter das Ge¬<br />
wandwirken erlernt, die heidnis<strong>ch</strong> arbeit genampt, die nit gar<br />
brüe<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> zun selben zeit war". So s<strong>ch</strong>reibt der Chronist H. Bul¬<br />
linger in seinem hds. Werke, Verzei<strong>ch</strong>nus der Bullingeren 1568".<br />
Das Original ist gegenwärtig Besitz von Jul. Waldesbül in Brem¬<br />
garten. Von seiner eigenen To<strong>ch</strong>ter Anna, geboren 1530 und<br />
vermählt an Zwingli's Sohn Ulri<strong>ch</strong>, sagt er glei<strong>ch</strong>falls: disse kont<br />
wol würken dass heidnis<strong>ch</strong> werk. Diese Anna ßullingerin hat von<br />
ihr Mueter Gertrud Küefferin gelehret würken heidnis<strong>ch</strong> Werk, hat<br />
hüps<strong>ch</strong>er arbeit gewürkt vnd es meiner Anna Zwinglj gelehret.<br />
Das syn wol die 4 oder 5 würkerin gesein, do je eine dess<br />
gs<strong>ch</strong>lä<strong>ch</strong>ts von der anderen würken gelernet." Wie das Wirken<br />
und Weben als heidnis<strong>ch</strong>es Werk angesehen ward, so war au<strong>ch</strong><br />
in dem Wesen von Hulda und Frigg unvergessen,<br />
dass beide Göt¬<br />
tinnen ursprüngli<strong>ch</strong> riesiger Abkunft gewesen waren ; und so fallen<br />
sie späterhin wieder in diese gröbere Gestalt zurück. Eine Frau<br />
Hulda mit der Potznasen kennt Luther, eine Frau Pre<strong>ch</strong>t (Ber<strong>ch</strong>ta)<br />
mit der langen Nas, mit der eisernen Nas, nennen Vintler und<br />
Martin von Amberg (Myth. 255. 256). Eisens<strong>ch</strong>ädel und Langnase<br />
ist nämli<strong>ch</strong> ein riesis<strong>ch</strong>es Epithet : Hornnefja (die Hornnase), Jarnhaus<br />
(Eisens<strong>ch</strong>ädel), Jarnnef (Eisennase), Jarnsax (Eisenmesser,<br />
des Donners Weib) sind altnord. Riesennamen, glei<strong>ch</strong>wie das s<strong>ch</strong>lesis<strong>ch</strong>e<br />
Bus<strong>ch</strong>weib von heute einen Eisenkopf hat und die Baiern<br />
von einer Eisenberta erzählen. Sie wurden trotz ihrer steinernen
26_<br />
oder eisernen Missgestalt als Göttinnen der häusli<strong>ch</strong>en Betriebsam¬<br />
keit verehrt. Die Glarner Frauen von Enneda giengen sonst am<br />
ersten Tage, da dorten die Abendsonne wieder in's Thal s<strong>ch</strong>eint,<br />
zusammen hinaus an den Gässlistein, einen Ungeheuern Felsblock<br />
am Fusse der Rothriese (Felsabsturz), und spannen auf diesem<br />
Felsen. Blumer-Heer, Kant. Glarus 610. Ein hoher Felsstock im<br />
Gebirge von obersteieris<strong>ch</strong> Wei<strong>ch</strong>selboden ist die sammt ihrem<br />
deutli<strong>ch</strong> zu sehenden Spinnrade versteinerte Spinnerin. Wolf,<br />
Zts<strong>ch</strong>r. f. Myth. 2, 23. An die Spindeln vers<strong>ch</strong>enkende Frau Hulda<br />
reiht si<strong>ch</strong> die spinnende Frau Berta an im Heidnis<strong>ch</strong>-Mythis<strong>ch</strong>en<br />
und im Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en. Karls d. Gr. Mutter ist Berhtrada; ihre<br />
To<strong>ch</strong>ter heisst im Gedi<strong>ch</strong>te König Rother Gertrud, die Heilige<br />
von Nivelles, in Brabant. Eine To<strong>ch</strong>ter desselben Namens hat<br />
Karl, zu Folge<br />
des Codex Vindob. 42 :<br />
sü gewan der selbe goles trat<br />
ein tohter, diu hiez Gêrtrûl,<br />
die<br />
heilige vrouwe,<br />
diu IU ze Haspelgouwe.<br />
Einhard in der Biographie Karls erzählt, indem er des Suetonius<br />
Biographie über Augustus na<strong>ch</strong>ahmt, Karls Tö<strong>ch</strong>ter hätten fleissig<br />
spinnen lernen müssen. So ward aus der spinnenden Ahnfrau<br />
Berta eine in's Riesenhafte zurück :<br />
vergröberte Berhte mit dem<br />
vuioze, Baerle mitten brêden voeten, Berthe au grand pied,<br />
reine Pedauque (d. i. regina pede aucae~), deren Bild in alle Kir¬<br />
<strong>ch</strong>en gestellt ward. Ebenso ges<strong>ch</strong>ah Berta's To<strong>ch</strong>ter, die als hl.<br />
Gertrud, die beweifte Spindel in der Hand haltend, auf den Altären<br />
abgebildet ist. Vgl. Massmann, Kaiser<strong>ch</strong>ronik 3, 479. Von dem<br />
eben erwähnten Haspelgau wissen au<strong>ch</strong> die Aargauer Sagen zu<br />
beri<strong>ch</strong>ten. Der Giebel, ein abgeholzter Bergabhang im Engstthale,<br />
zum Dorfe Ober-Entfelden gehörend, lässt no<strong>ch</strong> jetzt altes Mauer¬<br />
werk erkennen und heisst im alten Dorfrodel In der sleinj mur.<br />
Hier stand einst die herrli<strong>ch</strong>e Burg des Giebelkönigs, von hier aus<br />
pflegte er in goldener Kuts<strong>ch</strong>e in sein Rei<strong>ch</strong> hinabzufahren. Au<strong>ch</strong><br />
jetzt no<strong>ch</strong> thut er dies nä<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>er Weile, so oft die Witterung um¬<br />
s<strong>ch</strong>lagen will. Unter grossem Getöse rollt seine Kuts<strong>ch</strong>e bergab,<br />
ein Reiter auf einem Eber, ein anderer auf einem Esel folgen<br />
ihm, jeder hat eine Reihe Mil<strong>ch</strong>kellen an Riemen über die Brust<br />
ges<strong>ch</strong>nallt. Inzwis<strong>ch</strong>en sieht man dann auf der kahlen Spitze des<br />
Berges ein glänzendes Rad si<strong>ch</strong> umdrehen. Dies ist seiner Frauen<br />
goldener Garnwendel.
27<br />
II. Eiesenappellativa, in Volks- und Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tsnamen<br />
fortdauernd.<br />
Die Wilden Männer kommen in der heutigen S<strong>ch</strong>weiz no<strong>ch</strong> als<br />
Brunnenfiguren, Wirthss<strong>ch</strong>ilde, Fasna<strong>ch</strong>tsmasken vor, aber au<strong>ch</strong> als<br />
stehende Figuren bei S<strong>ch</strong>wingfesten und Aelplerkilbinen. Wir neh¬<br />
men hier das geringfügiger S<strong>ch</strong>einende des Stoffes voraus. Wenn<br />
sonst zu Basel mit dem 15. Januar die Fasna<strong>ch</strong>t begann, ers<strong>ch</strong>ienen<br />
Mittags S<strong>ch</strong>lag 12 Uhr drei abenteuerli<strong>ch</strong>e Masken auf den Strassen:<br />
Löwe, Greif und Wilder Mann. Jedem der drei Ungethüme wurde<br />
sein besonderes Leibtänz<strong>ch</strong>en mit Trommel und Pfeife aufgespielt<br />
und von ihm mit altlraditioneller Kunstfertigkeit ausgeführt. Sie<br />
waren die Repräsentanten der drei Stadtzünfte zum Rebhause, zum<br />
Greifen und zum Hären (Garn und Strick zur Vogelbeize), in deren<br />
Händen bis auf die Neuzeit das ganze Vogtwesen der Bürgers<strong>ch</strong>aft<br />
von Kleinbasel lag. Beim Festmahle der Drei wurde dann allen<br />
Bedürftigen Wein und Brod aus dem Gesells<strong>ch</strong>aftsvermögen ver¬<br />
abrei<strong>ch</strong>t zur Verbürgung der örtli<strong>ch</strong>en Tradition, als hätten einst,<br />
da no<strong>ch</strong> waldige Wildniss Stadt und Umgegend bedeckte, diese<br />
drei Unwesen hier gehaust. Die Sennbruders<strong>ch</strong>aft von Gersau<br />
am Vierwaldstätter See feiert ihren Jahrestag mit Ho<strong>ch</strong>amt und<br />
Zunfts<strong>ch</strong>maus alljährli<strong>ch</strong> als denjenigen, an wel<strong>ch</strong>em die zwei letzten<br />
Wilden Männer si<strong>ch</strong> auf der dortigen Alpweide hatten blicken lassen.<br />
Zwei in Laub gekleidete Vortänzer, man nennt sie die Ts<strong>ch</strong>ämeler<br />
(Banktänzer), lässt sie im Festzuge mit aufrücken und von zweien<br />
der tü<strong>ch</strong>tigsten Tänzer unterstützen. Wanderer in d. S<strong>ch</strong>weiz 1840,<br />
309. Die Unterwaldner Aelplerkilbi erinnert glei<strong>ch</strong>falls an diese<br />
Wilden Männer, als an die ursprüngli<strong>ch</strong>en Eigenthümer der Alp¬<br />
weiden. Sie beginnt am Wendelinstage, dem S<strong>ch</strong>utzpatron der<br />
Genossens<strong>ch</strong>aft, mit Ho<strong>ch</strong>amt und Predigt zum Ruhme des Hirten¬<br />
standes. Herna<strong>ch</strong> folgt das Fahnens<strong>ch</strong>wingen; alle Sennen stehen<br />
in einen Kreis, die Musik spielt und ein gewandter Jüngling s<strong>ch</strong>wingt<br />
über allen Häuptern fort und fort die Fahne der Bruders<strong>ch</strong>aft. Nun<br />
ers<strong>ch</strong>einen die beiden Festmasken, Wildmannli und Wildwibli. Beide<br />
sind in Tannrath gekleidet, Mooshüt<strong>ch</strong>en auf dem Kopfe, tragen<br />
Tanngrotzli in den Händen (Tannendolden), sie liebkosen und ver¬<br />
s<strong>ch</strong>leudern ihr Kindlein, das Lumpenditti, kehren der Procession<br />
voraus die Strasse zum Wirthshause und halten da bei Tis<strong>ch</strong>e einen<br />
gereimten Dialog ab, wel<strong>ch</strong>er si<strong>ch</strong> dem Kampfspru<strong>ch</strong>e verglei<strong>ch</strong>t,<br />
den die oberdeuts<strong>ch</strong>en Masken Sommer und Winter spre<strong>ch</strong>en. Businger,<br />
Kant. Unterwalden SO. Die Urner Jugend tanzte sonst zur
28<br />
Fasna<strong>ch</strong>tszeit um den Wildenmannsstein im Bannwalde ob S<strong>ch</strong>addorf<br />
und lief hierauf vermummt in Tannenreis und kettenklirrend<br />
in die nä<strong>ch</strong>sten Dörfer, wo man ihr Mil<strong>ch</strong>mahlzeiten vorzusetzen<br />
pflegte. Dies ges<strong>ch</strong>ah zur Erinnerung daran, dass hier der letzte<br />
Wilde Mann gesehen worden sei. Allen diesen Masken ist die vom<br />
Sturmwind entwurzelte Bergtanne und die klirrende Kette gemein¬<br />
sam, an wel<strong>ch</strong>er der heulende Windhund angebunden liegt. Das<br />
Glarner Landvolk erzählt no<strong>ch</strong> von angebli<strong>ch</strong>en Waldbrüdern, die<br />
als Wilde Männer und Heiden die Ueberbleibsel der Urbevölkerung<br />
sein und in der Wildniss des Gebirges ein unbekanntes Leben fort¬<br />
fristen sollen. Der romanis<strong>ch</strong>e Bündner nennt den Wilden Mann<br />
ilg humm sulvady, giebt ihm aber nur eine Grösse von drill halb<br />
Fuss, sein Weib<strong>ch</strong>en, die Fenka, ist no<strong>ch</strong> kleiner. In Deuts<strong>ch</strong>bünden<br />
heissen sie Waldfenken, und ihre verlassenen Hütten im obern Ge¬<br />
birge die Heidenhüsli. Neue S<strong>ch</strong>weiz.-Bl. 1850, Heft 1.<br />
Wer ni<strong>ch</strong>t bedenken mag, dass ä<strong>ch</strong>te Sage immer nur davon<br />
erzählt, was zuglei<strong>ch</strong> thatsä<strong>ch</strong>lioher positiver Glaube der Vorzeit<br />
gewesen ist, der wird diesen vereinzelten Angaben freili<strong>ch</strong> wenig<br />
Werth beilegen und historis<strong>ch</strong>e Beweiskraft no<strong>ch</strong> viel weniger. Er<br />
verlangt ni<strong>ch</strong>t Sagen, sondern Urkunden, S<strong>ch</strong>warz auf Weiss. Zu¬<br />
fälliger Weise kann ihm au<strong>ch</strong> dieser Wuns<strong>ch</strong> einmal erfüllt wer¬<br />
den; obs<strong>ch</strong>on uns selbst eben diese soglei<strong>ch</strong> mitzutheilenden Ur¬<br />
kunden dasjenige keineswegs erweisen, dessentwegen man sie<br />
citirt. Wir geben die na<strong>ch</strong>folgende Einzelnheit aus der Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te<br />
einer Wildenmännergemeinde getreu na<strong>ch</strong> dem Beri<strong>ch</strong>te des wa¬<br />
kern Historikers Ildeph. v. Arx, Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te von St. Gallen 2, 453 :<br />
T Das Calveiserthal (Calvesana) im Sarganser Lande nennt man die<br />
wildeste Gegend, die im St. Galler Lande zu finden ist. Drei Stun¬<br />
den weit dur<strong>ch</strong>zieht es ein Glets<strong>ch</strong>er, Bären erneuen von Zeit zu<br />
Zeit darin ihr altes Heimathsre<strong>ch</strong>t, nur der Sommerweide wegen<br />
wird es von den Hirten besu<strong>ch</strong>t. Um so mehr verwundert es,<br />
dur<strong>ch</strong> urkundli<strong>ch</strong>e Beweise zu erfahren, dass es vor Jahrhunderten<br />
bewohnt gewesen. Im Gegensatze gegen den an andern Orten<br />
gewöhnli<strong>ch</strong>en Gang der Landescultur, in denen Häuser entstanden,<br />
wo vorher keine waren, vers<strong>ch</strong>wanden hier die, wel<strong>ch</strong>e vor Altem<br />
dastanden, und die ganze Calveiser Gemeinde starb entweder aus,<br />
oder entwi<strong>ch</strong> vor dem immer mehr si<strong>ch</strong> ausdehnenden Glets<strong>ch</strong>er.<br />
Hier war eine Gemeinde mit Ammann und eigenem Geri<strong>ch</strong>te ge¬<br />
wesen, gefreit von allen jenen Abgaben, wel<strong>ch</strong>e die Alpen ringsum an<br />
das Stift Pfeffers entri<strong>ch</strong>ten mussten. Laut Urkunde von 1398 war<br />
dorten das Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t der Suiter wohnhaft; ihre Ammänner, Alt-
29<br />
ammänner und Beisitzer ers<strong>ch</strong>einen no<strong>ch</strong> 1473 vor dem Landvogte<br />
zu Sargans, um gegen Eingriffe in ihre Alpordnung das Re<strong>ch</strong>t an¬<br />
zurufen. Seit dreihundert Jahren steht nun das Thal mens<strong>ch</strong>enleer,<br />
nur die Alpen tragen no<strong>ch</strong> die Namen jener Gemeindeämter, wel<strong>ch</strong>e<br />
die ehemaligen Besitzer bekleidet hatten. Es steht no<strong>ch</strong> eine Ka¬<br />
pelle dorten, ihr zunä<strong>ch</strong>st der alte Calveiser Kir<strong>ch</strong>hof. Hier hat<br />
man ungeheuer grosse Mens<strong>ch</strong>enkno<strong>ch</strong>en vorgefunden und als eine<br />
Seltenheit weit vers<strong>ch</strong>ickt. Na<strong>ch</strong> dem Zeugnisse einer allgemeinen<br />
Volkssage befanden si<strong>ch</strong> unter den Calveisern einige Riesenge¬<br />
s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>ter. Jenes s<strong>ch</strong>on vorhin genannte Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t der Sutter,<br />
wel<strong>ch</strong>es dies Thal am letzten verliess, blieb in Glarus, wohin es<br />
gezogen war, lange no<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> seinen hohen Wu<strong>ch</strong>s ausgezei<strong>ch</strong>net."<br />
Wo jene Todtens<strong>ch</strong>mäuse zum Gedä<strong>ch</strong>tnisse der Ureinwohner<br />
ni<strong>ch</strong>t mehr stattfinden, da bestehen zum Theil no<strong>ch</strong> kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e den¬<br />
selben geltende Anda<strong>ch</strong>ten fort. Im Berninathale und in Samaden<br />
wurde für die Wilden Männer bis zur Reformationszeit eine be¬<br />
stimmte Messe gelesen, la messa di Rossedi genannt, für die nun<br />
unter den Glets<strong>ch</strong>ern Wohnenden. Sie waren hier die Ureinwohner,<br />
bis der Alles übereisende Rosediglets<strong>ch</strong>er sie vers<strong>ch</strong>üttete. So hat<br />
der Gemsjäger Colani unserm Linguisten und Mythographen L. Steub<br />
im J. 1852 an Ort und Stelle erzählt. Das letzte Ueberbleibsel<br />
dieser heidnis<strong>ch</strong>en Gemeindebräu<strong>ch</strong>e verrath si<strong>ch</strong> in der spätem<br />
nur vereinzelten Uebli<strong>ch</strong>keit, den Winden Mehl zu streuen, den<br />
Sturmwind mit Brod zu füttern, der Ber<strong>ch</strong>t und der Wilden Frau<br />
Speisen auf Kreuzwege und Feldsteine zu stellen. Myth. 403. 602.<br />
Die Luzerner Sennen pflegen bei ihren S<strong>ch</strong>wingfesten den stärk¬<br />
sten Ringer ihrer Partei in Ketten auf den Kampfplatz zu führen.<br />
Dabei geberdet er si<strong>ch</strong> wie rasend und wälzt si<strong>ch</strong> auf der Erde.<br />
Er tritt erst dann in die S<strong>ch</strong>ranken und ents<strong>ch</strong>eidet Sieg oder Nie¬<br />
derlage, wenn jeder seiner Kameraden von den Gegnern zweimal<br />
auf den Rücken geworfen ist. Dann ist seine Partei unheer",<br />
d. h. muss si<strong>ch</strong> aus Ers<strong>ch</strong>öpfung ergeben. Das Gegentheil von Unher<br />
ist der Riese Eishere aus dem Thurgau, von dem der Mön<strong>ch</strong><br />
von St. Gallen lib. 2, c. 12 sagt, er sei seinem Namen na<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>on<br />
ein bedeutender Theil eines fur<strong>ch</strong>tbaren Heeres gewesen. Egishére<br />
ist terribilis exercitus. monstri sind egisen: Hatterner, Denk¬<br />
male III, 603 a. Einen glei<strong>ch</strong>namigen Eisheri, miles Iringi, filii<br />
Dielbaldi, verzei<strong>ch</strong>nen die Mün<strong>ch</strong>en-Freisinger Hdss. Pertz, Ar¬<br />
<strong>ch</strong>iv 7, 812. Im Liede vom König Rother wird der Riese Asprian<br />
gekettet auf den Turnierhof herbeigeführt. Er fo<strong>ch</strong>t im Heere<br />
Karls gegen sol<strong>ch</strong>erlei Völker, deren Namen selbst wieder zu
30<br />
Riesennamen wurden : Böhmen, Wilzen, Avaren und Wenden. Die<br />
Haslithaler Sage erzählt vom Riesen Raubold, der si<strong>ch</strong> die Beine<br />
selbst zusammengekettet hatte. Aus Unterwalden herüberkommend,<br />
ers<strong>ch</strong>lug er im Hasli die Ahnfrau der Zwerge, die gute alte Ute,<br />
die des Thaies Wohlthäterin gewesen war. Alpenros. 1823, 219.<br />
Im Roman Simplicissimus (edd. A. Keller, pg. 945) erzählt der<br />
Autor, wie ihn eine Gauklerbande nackt entkleidet, Moos um die<br />
Lenden gehüllt und Ketten an die Hände gelegt habe, um ihn so<br />
als Wilden Mann um Geld herzuzeigen : Als i<strong>ch</strong> nun meiner Ketten,<br />
daran mi<strong>ch</strong> die Mausköpf (Spitzbuben) wie einen Wilden Mann<br />
herumges<strong>ch</strong>leppt, entledigt etc. Diese Sitte vom gekettet einher¬<br />
geführten Riesen begegnet der andern, Riesenkno<strong>ch</strong>en an Ketten<br />
aufzuhängen. No<strong>ch</strong> heute starren dem Wanderer ho<strong>ch</strong> über dem<br />
Portal der 1096 gegründeten Klosterkir<strong>ch</strong>e zu Alpirsba<strong>ch</strong> im<br />
S<strong>ch</strong>warzwalde ein hornförmiger Mammuthzahn und gewaltige Wir¬<br />
belkno<strong>ch</strong>en, in Kelten einges<strong>ch</strong>lungen, fremdartig entgegen. Im<br />
Chor einer Kapelle im Ammerthale war ein grosser Thiers<strong>ch</strong>ädel<br />
an die Mauer gekettet, der für den Kopf eines dort erlegten Lind¬<br />
wurmes ausgegeben wurde. Uhland in Pfeiffers Germania 1, 306.<br />
Wie in der Stadt Bern der grosse Christoffel und zu S<strong>ch</strong>affhausen<br />
der grosse Gott einst als Wahrzei<strong>ch</strong>en galt, so war das Wei<strong>ch</strong>bild<br />
oder Stadtsymbol zu Luzern der Wilde Mann. Er war, theilweise<br />
no<strong>ch</strong> jetzt si<strong>ch</strong>tbar, am Rathhause in sitzender Stellung abgemalt<br />
zum Angedenken an die Riesengebeine, die man 1577 bei dem<br />
Dorfe Reiden unter einem Ei<strong>ch</strong>baum ausgegraben hatte. Ehe Blu¬<br />
menba<strong>ch</strong> und Dolomieu na<strong>ch</strong>her den Ausspru<strong>ch</strong> thäten, dass diese<br />
Kno<strong>ch</strong>enmassen einem vorweltli<strong>ch</strong>en Riesenthiere angehörten, liess<br />
man zu jenem Gemälde einen Massstab und folgende Reime setzen :<br />
In der Statt Luzern Land da unden<br />
Bey dem Dorff Reyden hat man funden<br />
S<strong>ch</strong>röckli<strong>ch</strong> grosse Mens<strong>ch</strong>en Gbein<br />
Under einer Ey<strong>ch</strong> auf einem Reyn;<br />
Die Oberkeit derselben Statt<br />
Glehrten Leuhten die zugs<strong>ch</strong>ickt hat,<br />
Wel<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong> der Proportion<br />
Geometris<strong>ch</strong> das Mass han gnon,<br />
Hiermit ers<strong>ch</strong>eint unfehlbar gwüss,<br />
Wann aufre<strong>ch</strong>t gstanden diser Riss,<br />
Sey er gsyn mit der länge gli<strong>ch</strong><br />
Vierzehen mahlen disen Stri<strong>ch</strong>.
31<br />
Bes<strong>ch</strong>a<strong>ch</strong> im 1577 Jahr,<br />
Gott weiss, wie lang er vor da war.<br />
Was man gfunden, mag bhalten werden,<br />
Was übrig, verbleibt in der Erden.<br />
Im Na<strong>ch</strong>folgenden wird eine Reihe Wilder Männer aufgezählt,<br />
deren ehemaliger Wohnort, Felsstein oder Grab no<strong>ch</strong> bekannt ist<br />
und die uns dur<strong>ch</strong> die ihnen zuges<strong>ch</strong>riebene Gutmüthigkeit belehren,<br />
dass unsere heutigen Vorstellungen über die Gemüthsbes<strong>ch</strong>affenheit<br />
der Riesen unbere<strong>ch</strong>tigt und roh sind.<br />
Auf den Glass<strong>ch</strong>eiben eines Bauernhauses des alten Dorfes<br />
Matten im Bödelein bei Interlaken sah Wyss (Reise in's Berner<br />
Oberi. 1, 358) einen Bären gemalt, der ein paar Rüben im Gürtel<br />
trägt. Das Volk erzählte, dies sei einer der Riesen von lsellwald<br />
gewesen, die das Oberland na<strong>ch</strong> kaiserli<strong>ch</strong>em Aufgebote zum Rei<strong>ch</strong>sheere<br />
zu stellen hatte. Für ihre Keulenhiebe in der S<strong>ch</strong>la<strong>ch</strong>t ge¬<br />
nossen sie die Vergünstigung, so oft sie im Sommer dürstend"<br />
dur<strong>ch</strong>'s Thal giengen, auf den Pflanzplätzen bei Böningen, als auf<br />
Rei<strong>ch</strong>sboden, drei Rüben ausziehen zu dürfen, die eine in der<br />
Hand, die zwei andern im Gürtel davonzutragen.<br />
Der Botti im Grauholze bei Bern, wo man no<strong>ch</strong> sein von zwei<br />
Steinsäulen bedecktes altes Grab zeigt, ist in der no<strong>ch</strong> lebhaften<br />
Erinnerung des dortigen Landvolkes ein zwanzig Fuss langer Riese<br />
gewesen; die Bauern, die ihm am Felde begegneten, rei<strong>ch</strong>ten ihm<br />
statt der Hand die Pflugsterze, und immer verblieb ihr die Spur<br />
seines gewaltigen Händedrucks. Als er starb, trug seine Riesen¬<br />
s<strong>ch</strong>wester jenen grossen Grabstein in ihrem Fürtu<strong>ch</strong>e herbei. Jahn,<br />
der Kant. Bern antiquaris<strong>ch</strong>, 411. Botti's Name erinnert an den<br />
Riesensohn Lokis Farbauli.<br />
Im ehemaligen Länd<strong>ch</strong>en Gryon, nun glei<strong>ch</strong>namiges Pfarrdorf<br />
im Waadtländer Amte Aigle, lebte der Wilde Mann Bernard als<br />
Ziegenhirte. Seine Liebe, die er zur Blan<strong>ch</strong>e (Weisse Frau) em¬<br />
pfand und die unerwidert blieb, ist in einem eigenen Volksliede<br />
besungen, das dur<strong>ch</strong> Bridel (im S<strong>ch</strong>weiz. Museum 1784, 761) auf¬<br />
gezei<strong>ch</strong>net worden. Trauernd lag er bis zu seinem Tode auf einem<br />
Steine und hat diesem die Gestalt seines ganzen Körpers einge¬<br />
drückt. Als Blan<strong>ch</strong>e dann den Tod dieses ursprüngli<strong>ch</strong>en Ritters<br />
von Toggenburg erfährt, geht sie aus glei<strong>ch</strong>em Liebeskummer in<br />
ein Kloster. Treu wie Riesen, eine spät no<strong>ch</strong> im Norden übli<strong>ch</strong><br />
gewesene Redensart, hat also au<strong>ch</strong> bei uns einmal Geltung gehabt.<br />
Der Stein hiess la pierre du Sauvage und lag beim Dorfe Gryon bis<br />
1S50, wo er gesprengt worden. (Es<strong>ch</strong>er, Die S<strong>ch</strong>weiz v. 1851, 379.)
32<br />
Ein pierre dp Seroagios (italien. selvaggio=sauvage') findet si<strong>ch</strong><br />
beim Dorfe Luc, Val d'Anniviers, auf dem Wege na<strong>ch</strong> Bella-Tolaz,<br />
westli<strong>ch</strong> vom Borterhorn. Dieser mä<strong>ch</strong>tige Felsblock trägt auf seiner<br />
obern Flä<strong>ch</strong>e zahlrei<strong>ch</strong>e kleine Runds<strong>ch</strong>alen eingehauen. S<strong>ch</strong>weiz.<br />
Ges<strong>ch</strong>. Anzeiger 1858, 61.<br />
Die Ts<strong>ch</strong>udi (urk. 1256: Hans Sçhude. VonArx, St. Gall.<br />
Ges<strong>ch</strong>. 1, 546) sind na<strong>ch</strong>weissbar um Seckingen, in der ober¬<br />
rheinis<strong>ch</strong>en Waldstatt, dann im gegenüberliegenden Frickthal und<br />
im Glarnerlande altherkömmli<strong>ch</strong>. Sie berühmen si<strong>ch</strong> einer mythi¬<br />
s<strong>ch</strong>en Abkunft; nur hat ihr gelehrtester Sprosse, der Chronist<br />
Gilg Ts<strong>ch</strong>udi, diese Gcs<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tssagc ebenfalls ni<strong>ch</strong>t anders miltheilen<br />
mögen, als seiner Gewohnheit gemäss mit der fäls<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en<br />
Zuthat von angebli<strong>ch</strong>en Parteikämpfen zwis<strong>ch</strong>en dem Haus Oester¬<br />
rei<strong>ch</strong> und den Waldstätten. Der Ts<strong>ch</strong>udi, so beri<strong>ch</strong>tet er, des<br />
Glarner Landammann Rudolf Ts<strong>ch</strong>udi Sohn, war wegen seiner<br />
ausserordentli<strong>ch</strong>en Grösse der lange Riebing genannt und hieng den<br />
österrei<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>en Herzogen gegen die Waldstätte an. Deshalb er¬<br />
regte ihm sein S<strong>ch</strong>wager, der Urner Hans von Seedorf, wel<strong>ch</strong>er<br />
der Teufel genannt war, einen Erbstreit. Der Riebing fiel nun<br />
1316 in Unters<strong>ch</strong>ä<strong>ch</strong>en ein, der Urner Hans dagegen in Glarus.<br />
S<strong>ch</strong>on hatte Riebing auf diesem Streifzuge alle seine Waffen ver¬<br />
s<strong>ch</strong>ossen und zerhauen, als er einen jungen Tannenbaum aus dem<br />
Boden riss und damit no<strong>ch</strong> neun seiner Feinde hinstreckte. Zum<br />
Angedenken führen die Glarner Ts<strong>ch</strong>udi einen Tannenbaum mit<br />
rothem Stamm im Wappen mit drei fliegenden Wurzeln und neun<br />
dran hangenden rothen Zapfen.<br />
Der Name Ts<strong>ch</strong>ud bezei<strong>ch</strong>net in altrhätis<strong>ch</strong>er oder altrumanis<strong>ch</strong>er<br />
Spra<strong>ch</strong>e das S<strong>ch</strong>af; denn der Bergriese ist ein viehweidender<br />
Mil<strong>ch</strong>esser und sein Weib eine Wollenspinnerin. Wrie sodann Ts<strong>ch</strong>ud<br />
den Slaven einen Finnen (Barbaren) und Riesen bezei<strong>ch</strong>nete, so<br />
nennt die Snorra-Edda den Sohn des Riesen Thrym den Bergfinn.<br />
Wilder Mann muss also die deuts<strong>ch</strong>e Uebersetzung des rhäti¬<br />
s<strong>ch</strong>en Ts<strong>ch</strong>ud gewesen sein, und das Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t der Ts<strong>ch</strong>udi s<strong>ch</strong>eint<br />
si<strong>ch</strong> ursprüngli<strong>ch</strong> auf eine ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Vermis<strong>ch</strong>ung der Glarner<br />
oder Urner mit den Riesen bezogen zu haben. Der Name Ts<strong>ch</strong>ud<br />
in der Bedeutung von S<strong>ch</strong>afhirte klingt ebenso friedfertig, wie die<br />
weiter unten na<strong>ch</strong>folgenden Sagen von andern Wilden Männern.<br />
Der Wilde Mann ist daher in's Wappen und Wahrzei<strong>ch</strong>en der Bergsladt<br />
Wildeniann im Harze genommen worden, die Axt in der<br />
einen Hand, mit der Tanne in der andern, wie ihn einst Kaiser<br />
Heinri<strong>ch</strong> der Vogelsteller hier betroffen haben soll. Alljährli<strong>ch</strong> am
33<br />
Freis<strong>ch</strong>iessen um Johannis tritt er daselbst auf, ganz in Moos ge¬<br />
kleidet. Kuhn Nordd. Sagen no. 211. Der Wilde Mann ist ferner<br />
S<strong>ch</strong>ildhalter im Wappen Brauns<strong>ch</strong>weigs, Mecklenburgs und Preussens;<br />
er kommt als Hausname vor wiederholt um A<strong>ch</strong>en (Wolf, D. S. 188)<br />
um Brauns<strong>ch</strong>weig (Pröhle, Harzsag. 1, 257); im Wilden Mann zu<br />
Bremgarten ist 1469 Heinri<strong>ch</strong> Bullinger der Historiker und Refor¬<br />
mator geboren. Aarg. Beitr. 94. Glei<strong>ch</strong>wie Norwegis<strong>ch</strong>e Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>ter<br />
ihre Genealogie an den Riesen Forniot und dessen Söhne anknüpfen,<br />
so glauben au<strong>ch</strong> die Starken " unter den Zillerthalern einer Sippe<br />
zu entstammen, die aus dem Liebesverhältniss eines Bergriesen mit<br />
irgend einer hübs<strong>ch</strong>en Almerin entsprang. Bauern und Riesen leben<br />
häusli<strong>ch</strong> zusammen. Der Wilde Mann und der Geissler in Bünden<br />
werden Ziegenhirten in der Gemeinde Klosters, die Fengga wird<br />
Dienstmagd im Vorarlberger Bauernhofe. Aarg. Sag. 1, no. 228.<br />
Bauern und Riesen taus<strong>ch</strong>en s<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> ihre Namen aus; dies er¬<br />
weist si<strong>ch</strong> an folgenden s<strong>ch</strong>weizer. Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tsnamen: Rief, Egg<br />
und Eggen (Frickthal, Laufenburger Rheinstrecke), Hun (Kulmerthal),<br />
Hum (Dorf Entfelden), Häni (Züri<strong>ch</strong>see), Durst (Bezirk Ba¬<br />
den), Troll (Winterthur), Troller (Solothurner Gäu), Geysser (Ober¬<br />
aargau). Der Bergname Hundsbuck, Hundsrück, die First eines<br />
Längenberges bei Baden, glei<strong>ch</strong>t genau dem Gebirgsnamen Hunds¬<br />
ruck, beides stammt aus Hun. Die Reihe von Heidengräbern, die<br />
man eine halbe Stunde von der Stadt Solothurn am Aarufer unter¬<br />
su<strong>ch</strong>t hat, nennt si<strong>ch</strong> we<strong>ch</strong>selnd Hunnenberg, Hungerberg, Hohberg,<br />
Hünenberg. Zür<strong>ch</strong>. Antiquar. Mittheil. III. Der Feldname<br />
Hühnengrqber findet si<strong>ch</strong> bereits im Güntersthaler Zinsrodel v.<br />
J. 1344; H. S<strong>ch</strong>reiber vertraute diesem urkundli<strong>ch</strong>en Namen und<br />
entdeckte an Ort und Stelle gallis<strong>ch</strong>e Grabstätten. Mone, Bad.<br />
Urges<strong>ch</strong>. 1, 218. Der Hühnerstein, ein Felsstück von ziemli<strong>ch</strong>er<br />
Grösse inmitten Weges zwis<strong>ch</strong>en Bremgarten und Wohlen an der<br />
Strasse liegend, wird in seiner Benennung dur<strong>ch</strong> die wortdeutende<br />
Angabe erklärt, die Hühnerträger hätten hier zu ruhen und ihren<br />
Tragkorb abzustellen gepflegt. Gerade so erzählt Herrlein, Spesshartssag.<br />
179, von einem Felssteine zwis<strong>ch</strong>en Haslo<strong>ch</strong> und Faul¬<br />
ba<strong>ch</strong>: Hier habe Frau Hülle ausgeruht, wenn sie auf dem Garn¬<br />
verkauf war, und wo ihre Kotze (Tragkorb) mit den Füssen auf¬<br />
stand, sind die Lö<strong>ch</strong>er davon no<strong>ch</strong> jetzt im Stein zu sehen. Hier<br />
ruht eine Himmelsgöttin Huld, dorten ein Erdriese am Felsen aus<br />
und drücken ihm ihre Spur ein. Hühnerhubel ist der Name eines<br />
gallis<strong>ch</strong>en Hünengrabes bei Rixheim im Elsass, das von A. Stöber,<br />
Mühlhausen 1859, in einer besondern Monographie bes<strong>ch</strong>rieben ist.<br />
Argovia. III. 3
34<br />
Der Hünerweg zu Ingelheim, urkundl. 1385 wird von Mone, Ober¬<br />
rhein. Zts<strong>ch</strong>r. 5, 490 mit via Hunorum erklärt. Die niederdeuts<strong>ch</strong>en<br />
Hünkenberge, verderbt aus Hühnerberg, dieses aus Hünen, deuten<br />
gewöhnli<strong>ch</strong> auf einen Ort mit Grabstätten. Weinhold, Heidnis<strong>ch</strong>e<br />
Todtenbestattung 1, 23. 24. No<strong>ch</strong> vergröberter spri<strong>ch</strong>t Grohmanns<br />
Böhmis<strong>ch</strong>. Sagenb. 1, 74; es giebt dem Sturmgott Wuotan, des¬<br />
sen Gefolge aus den Seelen der im Sturm der S<strong>ch</strong>la<strong>ch</strong>t gefal¬<br />
lenen Helden bestand, ein Wuelisheer Verdammter bei, das in Ge¬<br />
stalt von glühenden Hühnern (feurigen Hünen) über die Waldgipfcl<br />
wegfährt. Eine Glucke mit einem Haufen glühender Hühner läuft<br />
des Na<strong>ch</strong>ts zwis<strong>ch</strong>en Andershausen und Kluvenfhal; man hält sie<br />
für verwüns<strong>ch</strong>te Mens<strong>ch</strong>en. Müller-S<strong>ch</strong>amba<strong>ch</strong>, Ndsä<strong>ch</strong>s. Sag. pg. 187.<br />
Hünenbetten sind in den Wesergegenden die Riesengräber ge¬<br />
nannt, Bett gilt dorten von Grab. Der Pfeils<strong>ch</strong>uss des Edeln von<br />
Hünenberg, dessen Burg bei Cham am Zugersee liegt, führt be¬<br />
kanntli<strong>ch</strong> zu dem Siege der S<strong>ch</strong>weizer am Morgarten. Dieser<br />
S<strong>ch</strong>uss war den Chronisten wegen seiner mär<strong>ch</strong>enhaften S<strong>ch</strong>uss¬<br />
weite stets auffallend gewesen; nun mag er, wie ja der Name des<br />
Burgherrn selbst, si<strong>ch</strong> aus dem Volksnamen Hun erklären, der<br />
wie späterhin der Name Unger, zu Riesenbenennungen gedient<br />
und mythis<strong>ch</strong>e Bedeutung angenommen hat. Lassen wir uns dur<strong>ch</strong><br />
den Ungar Arnold Jpolyj beri<strong>ch</strong>ten, wie in seinem hunis<strong>ch</strong>en Vater¬<br />
lande die Steindenkmäler aussehen, die man bei uns Hühnerslein<br />
und Hünenberg nennt, so findet si<strong>ch</strong>, dass sie den unsrigen an<br />
Gestalt, Aufstellung und Namen ähnli<strong>ch</strong>, oft sogar si<strong>ch</strong> glei<strong>ch</strong> sind<br />
und direct auf Attila's Hunnen führen. Er beri<strong>ch</strong>tet Ausführli<strong>ch</strong>es<br />
hierüber in der Zts<strong>ch</strong>r. f. Myth. 2, 259; hier bes<strong>ch</strong>ränkt uns unser<br />
Raum auf eine blosse Einzelnheit.<br />
Zwis<strong>ch</strong>en den Siebenbürgis<strong>ch</strong>en Orts<strong>ch</strong>aften Udvarhelyszek und<br />
Erdövidek im Lande der Szekler erstreckt si<strong>ch</strong> der Rikawald, dur<strong>ch</strong>¬<br />
flössen vom glei<strong>ch</strong>namigen Rikaba<strong>ch</strong>. An dessen Ufer und vom<br />
Wasser im Halbkreise umgürtet, stehen, etli<strong>ch</strong>e Klafter lang, mehrere<br />
Steine aufre<strong>ch</strong>t, eine Art Hütte bildend, die ursprüngli<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong><br />
einen grossen Fels überda<strong>ch</strong>t waren, den i. J. 1820 der Blitz ent¬<br />
zweigerissen und gestürzt hat. Von diesem Steinmale der Vor¬<br />
zeit erzählte s<strong>ch</strong>on die sogenannte heidnis<strong>ch</strong>e Szekler-Chronik, wie<br />
au<strong>ch</strong> heute no<strong>ch</strong> das dortige Volk, hier sei Rekas Grab, des Hun¬<br />
nenkönig Attila's Frau. Die Sage behauptet, der Fels sei von<br />
Mens<strong>ch</strong>enhand aufgestellt. Denn da die geliebte Reka gestorben<br />
und Alles uneinig war, wohin man die theuern Reste würdig genug<br />
begraben sollte, wälzte man endli<strong>ch</strong> den grossen Felsen vor ihrem
35<br />
Königss<strong>ch</strong>losse bergab, dass er an den Rand des Flusses rollte<br />
und über ihr Grab gestellt werden konnte. Von Hirtenknaben<br />
sollen hier thalcrgrosse Räd<strong>ch</strong>enmünzen gefunden, von einem Bild¬<br />
s<strong>ch</strong>nitzer Maté soll ein so grosser S<strong>ch</strong>atz aufgegraben worden sein,<br />
dass ihm über dem Wegs<strong>ch</strong>affen der Last sein S<strong>ch</strong>immel drauf<br />
gieng. Damit ist er der Stifter des nun berühmten und ausge¬<br />
breiteten Szeklerges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tes der Maté geworden.<br />
Das Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t der Geysser im Oberaargau findet si<strong>ch</strong> mit sei¬<br />
nem Namen wieder in dem der nordis<strong>ch</strong>en und oberdeuts<strong>ch</strong>en Bergund<br />
Sturmriesen Gusir und Geysa, der Bläser und Stürmer (Weinhold,<br />
Die Riesen 44), Geisser: der Wilde Mann beim Wintersturm<br />
:<br />
im Jura, und das Seegespenst am Glarner Oberblegi-See (Natur¬<br />
mythen 42. 148). Au<strong>ch</strong> dieses Appellativ, ableitend von giessen,<br />
ergiessen, führt auf den goth. Stammnamen Gauls, ags. Gedt,<br />
ahd. Kôz zurück, der ausgegossene Geist, der Gotters<strong>ch</strong>affne, und<br />
ist epis<strong>ch</strong> verwendet worden zu dem Heroenges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te der Geaten<br />
im ags. Gedi<strong>ch</strong>te Beovulf.<br />
Das im Glarnerlande zahlrei<strong>ch</strong>e Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t der Eimer stammt<br />
aus dem Elmthale, glei<strong>ch</strong>wie das vom heil. Sa<strong>ch</strong>senapostel Liudger<br />
gegründete Hclmstädt seinen Namen vom Elmgebirge auf der Lüneburgerhaide<br />
hat. (Rettberg, Kir<strong>ch</strong>.-Ges<strong>ch</strong>. 2, 482.) Von Elm und<br />
Hm, den mundartli<strong>ch</strong>en Namen des Ulmenbaumes, leiten diese Orts¬<br />
namen deshalb ni<strong>ch</strong>t ab, weil jenen beiden Landstrecken die Ulme<br />
fremd bleibt. Daniel Eimer nennt man aber im Glarnerlande sol¬<br />
<strong>ch</strong>erlei kahle Felszacken, deren Contur an eine Mens<strong>ch</strong>engestalt<br />
erinnert. Alben und Almis ist die Kalkerde genannt, die zwis<strong>ch</strong>en<br />
Mün<strong>ch</strong>en und Erding vier Quadratmeilen we;t die Torfmoore dur<strong>ch</strong>¬<br />
zieht. Elm bezei<strong>ch</strong>net s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong> die lohgelbe Farbe (Stal¬<br />
der 1, 94) und eine weissfarbige Taubenart (Tobler 166). Au<strong>ch</strong><br />
hier bleibt elb die Wortform. Elwez ist fulvus, Graff, Diulisca 2, 236 b.<br />
Der Elb aber ist der Wald- und Berggeist, das Erdmänn<strong>ch</strong>en.<br />
Elbelstein und Elbelskanzel sind Namen im Unstruth - und Werrathale,<br />
auf denen der dortige Wilde Jäger Elbel sein Wesen treibt.<br />
Be<strong>ch</strong>stein, D. Sagb. no. 450. Der Elbst ist ein Wassergeist im kleinen<br />
See am Seelisberg in der Nähe des Dorfes Treib am Vierwaldstätter<br />
; auf dem Seeboden sah man sonst ganz deutli<strong>ch</strong> eine Heerde<br />
S<strong>ch</strong>weine, die si<strong>ch</strong> auf den Rücken legten und dann das Aussehen<br />
fris<strong>ch</strong> abgezogener Kalbshäute annahmen. Cysat, Bes<strong>ch</strong>reib, des<br />
Vierwaldstätter Sees, pg. 429. Diese widerwärtig lautende Be¬<br />
hauptung erinnert glei<strong>ch</strong>wohl an die altrömis<strong>ch</strong>e Männerpuppe des<br />
Mamors, die bei der Frühlingsfeier der Mamertinen, di<strong>ch</strong>t einge-
36<br />
hüllt in Felle, dur<strong>ch</strong> die Stadt ges<strong>ch</strong>leppt, mit Stangen gehauen<br />
und über die Brücke in die Tiber gestürzt wurde. Der Name<br />
Elb bezei<strong>ch</strong>net im Entiebu<strong>ch</strong> den Betrunkenen, Albersterz und Elpentröts<strong>ch</strong><br />
bezei<strong>ch</strong>net den Dummkopf. Elggermann nennt man am<br />
S<strong>ch</strong>weizerrhein die Männ<strong>ch</strong>en aus Backwerk, zuglei<strong>ch</strong> einen unrührig<br />
dasitzenden, dummstarrenden Mens<strong>ch</strong>en, einen Teigklotz.<br />
Kir<strong>ch</strong>hofer, S<strong>ch</strong>weiz. Spri<strong>ch</strong>w. no. 56. In Glarus ist der Ellger<br />
(contrah. aus Elmiger) der Name eines Felsengesi<strong>ch</strong>tes am Wiggisgebirge,<br />
Elgis heisst jener sonnige Kalkfelsen nördli<strong>ch</strong> vom Orte<br />
Glarus zu wel<strong>ch</strong>em alljährli<strong>ch</strong>, sobald die Frühlingssonne dorten<br />
zuerst den S<strong>ch</strong>nee wegs<strong>ch</strong>milzt, die Kinder wallfahrten." Heer-<br />
Blumer, Kant. Glarus, 601. Hält man nun den Namen des Adels¬<br />
ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tes von Eibenstein (Myth. 1217) zusammen mit dem<br />
Glarnerges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te der Eimer, und dem Thurgauerges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te der<br />
Elgger (die man dorten angebli<strong>ch</strong> von S<strong>ch</strong>loss Elgg abstammen<br />
lässt), so ergiebt si<strong>ch</strong> abermals der Fall, wie einzelne Sipps<strong>ch</strong>aften<br />
ihren Stammbaum und Namen auf die Geister des Gebirgs zurück¬<br />
geführt haben. Die Genesis 6, 4 besagt dasselbe : Es waren au<strong>ch</strong><br />
zu den Zeiten Tyrannen (giganles, hat die Vulgata ri<strong>ch</strong>tiger) auf<br />
Erden; denn da die Kinder Gottes die Tö<strong>ch</strong>ter der Mens<strong>ch</strong>en be¬<br />
s<strong>ch</strong>liefen und ihnen Kinder zeugeten, wurden daraus Gewaltige in<br />
der Welt und berühmte Leute. I<strong>ch</strong> füge dem zum S<strong>ch</strong>lüsse no<strong>ch</strong><br />
zwei neuere Beispiele hinzu. Beim Dorfe Gren<strong>ch</strong>en und im be¬<br />
na<strong>ch</strong>barten solothumis<strong>ch</strong>en Jura wird der im Sturm einherziehend<br />
geda<strong>ch</strong>te Wilde Jäger der S<strong>ch</strong>wed genannt. Mit einem Zwil<strong>ch</strong>¬<br />
sack auf der A<strong>ch</strong>sel kommt er den Berg herauf und s<strong>ch</strong>üttelt ihn aus,<br />
dass lauter grüne hornblasende Jäger herausfallen. DieS<strong>ch</strong>weiz,<br />
Illustr. Ztg., 1862, no. 12. Vom grünen S<strong>ch</strong>wedenross ist eine<br />
ähnli<strong>ch</strong>e Sturmsage mitgetheilt: Aarg. Sag. 2, no. 512. Die<br />
Sturmgeister, die der Jura S<strong>ch</strong>weden nennt, heisst der Berner<br />
Aelpler Friesen. Im Grindelwaldthale gelten die Föhnstürme, die<br />
im Frühjahr den S<strong>ch</strong>nee von den Voralpen wegs<strong>ch</strong>melzen, glei<strong>ch</strong>¬<br />
falls als eine S<strong>ch</strong>aar Wilder Jäger, und heissen die Westfriesen.<br />
Das Volk im Oberhasli- und Simmenthai meint, es sei selber ursprüng¬<br />
li<strong>ch</strong> aus S<strong>ch</strong>weden und Friesland eingewandert. Dies ist jedo<strong>ch</strong> nur<br />
ein Spra<strong>ch</strong>missverständniss, entsprungen ni<strong>ch</strong>t im Volke, sondern<br />
bei s<strong>ch</strong>limm etymologisirenden Berner-Dorfpfarrern. Spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong><br />
friset" d. h. öffnet der West- und Föhnwind die Bewässerungs¬<br />
gräben der Felder, glei<strong>ch</strong>wie der Nordwind die Kornsaat frisst".<br />
Der Oberländer Frieser ist der Gräber von Profession. Stalder 1,399.<br />
Für unsern Zweck aber ergiebt si<strong>ch</strong>, dass man au<strong>ch</strong> hier einen
37<br />
altern Volksnamen mit dem eines Luftriesen in traditionell ge¬<br />
wordenen Zusammenhang gebra<strong>ch</strong>t hat.<br />
Domilin, Essel und Durst. Dur<strong>ch</strong> die kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>gelehrte Fär¬<br />
bung der Pilatuslegende sind die ursprüngli<strong>ch</strong>en Volkssagen vom<br />
Pilatusberge in sehr früher Zeit s<strong>ch</strong>on verwirrt und unkenntli<strong>ch</strong><br />
gema<strong>ch</strong>t worden. Die älteste Oberdeuts<strong>ch</strong>e Chronik, edd. Grieshaber<br />
1850, nennt pg. 16 den Pilatusberg no<strong>ch</strong> mit rhätis<strong>ch</strong>em Namen<br />
Frakmunt, beruft si<strong>ch</strong> aber s<strong>ch</strong>on als auf etwas Landläufiges darauf,<br />
dass droben des Pont. Pilatus Grab sei : und wil man, er (Pilatus)<br />
lige uf Fragmuonde bi Lulzerne. Glei<strong>ch</strong>wohl bleibt die ursprüng¬<br />
li<strong>ch</strong>e Heiligung des Pilatusberges etwas unbestreitbares und wird<br />
vom 13. Jahrhundert an bis in's se<strong>ch</strong>szehnte dur<strong>ch</strong> eine fortlaufende<br />
Reihe ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>er Angaben verbürgt; der Berg ers<strong>ch</strong>eint als in<br />
den Geisterbann gelegt, erst vom Volksglauben, später von der<br />
Obrigkeit, Niemand sollte ihn ohne eingeholte Erlaubniss besteigen,<br />
Zuwiderhandelnde wurden mit Gefängniss bestraft. Im Jahr 1518<br />
mussten der in Luzern si<strong>ch</strong> aufhaltende Herzog Ulri<strong>ch</strong> von Würt¬<br />
temberg und der St. Galler Bürgermeister Joa<strong>ch</strong>im Vadian, dann<br />
im J. 1555 der Naturfors<strong>ch</strong>er Konrad Gessner von Züri<strong>ch</strong>, 1580<br />
der Basler Arzt und Anatom Felix Platter die besondere Erlaub¬<br />
niss bei der Regierung einholen, um den Berg besu<strong>ch</strong>en zu dürfen.<br />
Leider haben uns au<strong>ch</strong> diese bevorzugten Reisenden alle in ihren<br />
Beri<strong>ch</strong>ten nur die Trümmer der Kir<strong>ch</strong>enlegende wiedererzählt,<br />
die sie hier ihrem eigenen Verstände widerspre<strong>ch</strong>end vorfanden,<br />
alles übrige aber, was sie sonst auf dem Berge gehört oder<br />
gesehen haben mo<strong>ch</strong>ten, bleibt uns von ihnen vers<strong>ch</strong>wiegen. Und<br />
do<strong>ch</strong> nur dieses Besondere allein würde uns heute den Grund des<br />
S<strong>ch</strong>reckens und der heiligen S<strong>ch</strong>eu einsehen lassen, womit dieses<br />
Gebirge so lange umgeben war; jetzt vermögen wir aus bloss ein¬<br />
zelnen letzten Bru<strong>ch</strong>stücken der Ueberlieferung auf das Ganze<br />
zurückzus<strong>ch</strong>liessen. Unserm bisherigen Verfahren gemäss ziehen<br />
wir einige besondere Gipfel und Felsen des Berges na<strong>ch</strong> ihren Namen<br />
und Eigenthümli<strong>ch</strong>keiten hier in Betra<strong>ch</strong>tung. Nahe bei der Bründelenalp<br />
liegt in der senkre<strong>ch</strong>ten Fluhwand, der steilsten Kluft, die<br />
über das Widderfeld zum Berggrat hinaufführt, die Höhle Tomilislo<strong>ch</strong>.<br />
Turne und Dummlin ist sie s<strong>ch</strong>on bei Chappeller, hist, mont<br />
Pilati 1767, 178 genannt. Da6 ahd. tuoma judicium, tômaheil majestas,<br />
führt auf die Eigennamen Tuomhilt, Tuomrî<strong>ch</strong>, Tuomgêr,<br />
Tuompirc, Tuompurc (mons mqjestalis). Wollte man diese Etymo¬<br />
logie zu kühn finden, so läge dem von Chappeller gemeldeten Na¬<br />
men Dummlin eine andere Ableitung für unsern Zweck ebenso
38<br />
nahe. Der Bergriese heisst in der deuts<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>e der Dumme,<br />
ni<strong>ch</strong>t weil er zunä<strong>ch</strong>st s<strong>ch</strong>wa<strong>ch</strong>köpfig ist, sondern weil er dämmerig,<br />
dumpf und gewitterfinster in die Lands<strong>ch</strong>aft hereinblickt; ähnli<strong>ch</strong><br />
spri<strong>ch</strong>t man vom dummen Teufel. Der Dimmerföhn s<strong>ch</strong>ieiert die<br />
Gegend ein dur<strong>ch</strong> Dunst und Höhenrau<strong>ch</strong>, düffiges, düppes Wetter<br />
ist dumpfes, s<strong>ch</strong>wüles. Grimm, Myth. 495 gewährt au<strong>ch</strong> einen ahd.<br />
Segensspru<strong>ch</strong> aus dem XI. Jahrh., der heidnis<strong>ch</strong> geda<strong>ch</strong>t und kir<strong>ch</strong>¬<br />
li<strong>ch</strong> gefasst an einen Bergriesen geri<strong>ch</strong>tet ist, damit man von<br />
Wunden genese. Der Riese heisst hier der Dumme (hebes) in<br />
dem Sinne des Wortes, dass er sammt seinem Sohne stumm und<br />
s<strong>ch</strong>laftrunken auf dem Saum des Berges liegt:<br />
Tumbo saz in berke<br />
mit tumbemo kinde in arme,<br />
lumb Mez der bere,<br />
tumb hiez daz kint,<br />
der heilege tumbo<br />
versegene Usa wunda!<br />
Der Weg von Dars<strong>ch</strong>eid na<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>önba<strong>ch</strong> (Kreis Daun) führt<br />
über den Sommersberg, dessen Kuppe die Tommen heisst. Unten<br />
ist der Steig dur<strong>ch</strong> den Geisterspuk einer den Leuten aufhuckelnden<br />
Frau berü<strong>ch</strong>tigt; oben rasselt, s<strong>ch</strong>reit und pfeift das Tommermänn<strong>ch</strong>en<br />
und rollt si<strong>ch</strong> den Fuhrwerken als Klotz in den Weg.<br />
Die drei Tommen bei Lonnig, an der Strasse na<strong>ch</strong> Koblenz, drei<br />
von allen Seiten si<strong>ch</strong>tbare Hügel, sind von drei Frauen s<strong>ch</strong>ürzen¬<br />
weise zusammengetragen worden. Ein weiterer Tomberg bei Rhein¬<br />
ba<strong>ch</strong> hat eine Höhle, in der ein bärtiger Greis am Tis<strong>ch</strong>e sitzt mit<br />
einer darauf liegenden goldnen (Wüns<strong>ch</strong>el-) Ruthe. S<strong>ch</strong>mitz, Eiflersag.<br />
2, pg.<br />
9. 24. 69. 57. Der s<strong>ch</strong>wedis<strong>ch</strong>e Tomtegubbe und<br />
Tomtekarl bezei<strong>ch</strong>net den Alten im Gehöfte, altn. tôft, s<strong>ch</strong>wed.<br />
tomi, area, domus vacua. Myth. 468. Mit diesemRiesennamen Tomilin<br />
hat nun später die kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Gelehrsamkeit zu Luzern cinen<br />
hl. Dominicus vers<strong>ch</strong>wistert und man nennt seitdem jenes Tomilinslo<strong>ch</strong><br />
die Dominikhöhle. In ihr ist der versteinerte Pilatus an<br />
einem steinernen Tis<strong>ch</strong>e zu sehen. Es steht nämli<strong>ch</strong> an ihrem<br />
Eingange ein a<strong>ch</strong>t Fuss hoher Fels, mit äusserst weissem Kalk<br />
überkrustet, in Form eines aufre<strong>ch</strong>tstehenden, gewandeten Man¬<br />
nes; an der Stelle seines Hauptes liegt ein glei<strong>ch</strong>weisser beweg¬<br />
li<strong>ch</strong>er Felsblock, hinter ihm ein sol<strong>ch</strong>er in Form eines Tis<strong>ch</strong>es, an<br />
den si<strong>ch</strong> die Figur anzulehnen s<strong>ch</strong>eint. Diese eben gema<strong>ch</strong>te Be¬<br />
s<strong>ch</strong>reibung rührt von einem Tiroler Maurergesellen her, der im<br />
Jahr 1814 vor Hunderten von Zus<strong>ch</strong>auern in diese senkre<strong>ch</strong>te Tiefe
39<br />
von 306 Fuss si<strong>ch</strong> hinabliess und so die Höhle bestieg. Abgebildet<br />
ist nunmehr dieser Bildstein na<strong>ch</strong> einer vom Zür<strong>ch</strong>er Idyllendi<strong>ch</strong>ter<br />
Mart. Usteri (+ 1827) gema<strong>ch</strong>ten Zei<strong>ch</strong>nung in den Zür<strong>ch</strong>. Antiqu.<br />
Mittheil, von 1859, Heft 23. Die Pilatus-Sennen nennen übrigens<br />
diese vermeintli<strong>ch</strong>e Bildsäule des hl. Dominik au<strong>ch</strong> unsern<br />
St. Cor¬<br />
nell" (Es<strong>ch</strong>er, Die S<strong>ch</strong>weiz von 1851, 74) und pflegen ihn als<br />
S<strong>ch</strong>utzpatron anzurufen. Was es aber mit dieser kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en An¬<br />
rufung des angebli<strong>ch</strong>en Heiligen ursprüngli<strong>ch</strong> auf si<strong>ch</strong> habe, dies<br />
erweist si<strong>ch</strong> aus einem nun folgenden und hier zum ersten Male<br />
hervorgehobenen Umstände.<br />
Es behaupten nämli<strong>ch</strong> die Anwohner des Pilatus im Unterwaldner<br />
Lande, diese Höhle lasse so weit im Innern vordringen, dass man<br />
darinnen die Glocken der auf der entgegengesetzten Seile des<br />
Berges auf Brünnlenalp weidenden Kühe hören könne (Chappeller,<br />
hist. Pilat. 178), und dorten in dieser Tiefe, heisst es, halten die<br />
drei Teilen ihren Zaubers<strong>ch</strong>laf. Eine Sage hierüber, freili<strong>ch</strong> jour¬<br />
nalistis<strong>ch</strong> aufgefärbt, enthält die Zeits<strong>ch</strong>rift Wanderer in der<br />
S<strong>ch</strong>weiz, Jahrg. 8, 1841; es lässt si<strong>ch</strong> daraus Folgendes ent¬<br />
nehmen : Der Riese Dominik pflegte von seiner Höhle aus über<br />
die Si<strong>ch</strong>erheit des Landes zu wa<strong>ch</strong>en und rief, so oft ein Feind<br />
den Grenzen si<strong>ch</strong> nahte, das Volk zum Kampfe auf. Nur einmal<br />
war er einges<strong>ch</strong>lafen. Als er wieder erwa<strong>ch</strong>te, erblickte er unten<br />
zu seinem S<strong>ch</strong>merz den Bürgerkrieg und erstarrte darüber zu<br />
Stein. Do<strong>ch</strong> todt ist er ni<strong>ch</strong>t, er wird wieder erwa<strong>ch</strong>en, wohl<br />
aber erst am Ende der Tage. Es ist Brau<strong>ch</strong>, das berühmte E<strong>ch</strong>o<br />
auf Bründelenalp zu wecken, indem man den Namen Dominik zur<br />
Höhle hinaufruft. Der Stein antwortet; langsam und gedehnt giebt<br />
ein mä<strong>ch</strong>tiges E<strong>ch</strong>o das ausgerufene Wort zurück. Wer aber, be¬<br />
haupten die Sennen, dem Dominik einen andern Namen zurufe,<br />
der müsse zuverlässig no<strong>ch</strong> selbiges Jahr sterben. Zür<strong>ch</strong>. Neujahrsbl.<br />
der Musikgesells<strong>ch</strong>. 1818, S. 2.<br />
Ueber das Ergebniss dieser selbstredenden Sage darf man hier<br />
si<strong>ch</strong> um so kürzer fassen. In den Berghöhlen wohnten die ersten<br />
Mens<strong>ch</strong>en, hier bestatteten sie ihre Todten au<strong>ch</strong> zur Grabesruhe.<br />
Die Stammväter des Volkes, die Fürsten und Helden der Vorzeit<br />
gehen daher in den Berg, liegen, sitzen, s<strong>ch</strong>lafen im Berge. Tod<br />
und Leben wohnt so vereint im Berge; in Joh. Ackermanns Ge¬<br />
sprä<strong>ch</strong> mit dem Tode wird au<strong>ch</strong> dieser angerufen Her Tot, Haupt¬<br />
:<br />
man vom Berge! Wackernagel, Altd. Lesb. 1139, Vers 18. Die<br />
Sagen von dem im Berge s<strong>ch</strong>lafenden Lieblingshelden des Volkes<br />
weisen auf die Zeiten des Grabalters und der Hügelbestattung zu-
AO<br />
rück, die dem Brennalter vorausgiengen. Erst als man begann,<br />
die Lei<strong>ch</strong>en dem Feuer zu übergeben, im Rau<strong>ch</strong> gen Himmel zu<br />
s<strong>ch</strong>icken, mag man si<strong>ch</strong> gewöhnt haben, die Götter und ihre Ge¬<br />
nossen als über den Wolken wohnend zu denken." Simrock,<br />
Myth. 367. Den ältesten Germanen wohnten daher die Götter no<strong>ch</strong><br />
in den Bergen, erst später auf deren Gipfel. Lässt daher ein ger¬<br />
manis<strong>ch</strong>er Volksstamm seinen Begründer im Berge begraben sein,<br />
so lag eine Vermis<strong>ch</strong>ung des Stammvaters, der selber wieder einen<br />
Gott zum Vater hat, mit dem Gotte ganz nahe, der glei<strong>ch</strong>falls im<br />
Berge thronte. Gott Mannus ist bei Tacitus der Sohn der Erde.<br />
Jeder einzelne Stamm hat so seinen eigenen Götterberg, sein<br />
eigenes S<strong>ch</strong>la<strong>ch</strong>tfeld, auf das der s<strong>ch</strong>lafende Gott heraustreten wird<br />
zum Siege und zum endli<strong>ch</strong>en Weltfrieden. Für den Oberpfälzer<br />
ist jener Göttersitz das Fi<strong>ch</strong>telgebirg, für den Altbaiern der Unters¬<br />
berg. S<strong>ch</strong>önwerth, Oberpf. Sag. 3, 351. Für den Mitteldeuts<strong>ch</strong>en<br />
ist es der Kyffhäuser, für den S<strong>ch</strong>weizer der Axenberg mit den<br />
drei s<strong>ch</strong>lafenden Teilen, und hier der Pilatus. So hat au<strong>ch</strong> der<br />
Riese Toll, der auf der Insel Oesel im Töllist begraben liegt, vor<br />
seinem Tode verordnet, dass man ihn zur Hilfe aufrufen solle,<br />
wenn ein Feind in's Land komme. Kruse, Urges<strong>ch</strong>. des ehstnis<strong>ch</strong>en<br />
Volksstammes 186.<br />
Wir übergehen alle in der Pilatussage selbst enthaltenen wei¬<br />
tern Einzelnheiten, so ernstli<strong>ch</strong> sie unsern Zweck au<strong>ch</strong> unter¬<br />
stützen. Der geheiligte See, der darinnen versenkt liegende und<br />
alljährli<strong>ch</strong> am Charfreitage wieder aufsteigende Seegeist, der Türst,<br />
der auf jenem Berge jagt, der feurige Dra<strong>ch</strong>e, der ihn glei<strong>ch</strong>falls<br />
mitbewohnt, der prophetis<strong>ch</strong>e Zeitbrunnen, die S<strong>ch</strong>aar von Zwergen<br />
und Erdmänn<strong>ch</strong>en, Alles dies kann anderwärts na<strong>ch</strong>gelesen werden.<br />
Unsere Aufgabe hat den Berg als einen von Riesen bewohnten und<br />
dem Steinzeitalter angehörenden na<strong>ch</strong>zuweisen. Hierin unterstützen<br />
uns besonders seine beiden Punkte : der Essel und der Gnappstein.<br />
Der Gnappstein lag ehedem auf der Oberalp des obern Pilatus;<br />
er war<br />
6 Fuss ho<strong>ch</strong> und lang und ruhte, von seinem Muttergestein<br />
abgelöst, auf seinem Mittelpunkte der Art im Glei<strong>ch</strong>gewi<strong>ch</strong>te, dass<br />
Jeder, si<strong>ch</strong> darüber hinlegend und si<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>aukelnd, ihn ohne Mühe<br />
bewegen konnte. Helvet. Almana<strong>ch</strong> vom J. 1804, 101. Er senkte<br />
si<strong>ch</strong>, wenn man ihn von der einen Seite bestieg, und neigte si<strong>ch</strong>,<br />
wenn man aufs andere Ende hinübers<strong>ch</strong>ritt, in seine vorige Lage<br />
zurück. Bei einem Bergsturz ist er in neuerer Zeit zu Grunde ge¬<br />
gangen (Meyer-Knonau, S<strong>ch</strong>weiz. Erdkunde 1, 284). Der Stein<br />
hatte seit alter Zeit s<strong>ch</strong>on die Aufmerksamkeit der Gelehrten er-
4-1<br />
regt gehabt. Der Naturfors<strong>ch</strong>er Gessner fand ao. 1555 an ihm eine<br />
Ins<strong>ch</strong>rift, die er für keltis<strong>ch</strong> hielt, und hieb daneben seinen Namen<br />
ein. Cappeller (hist. mont. Pilati 1767, 20) fand die alte Ins<strong>ch</strong>rift<br />
vers<strong>ch</strong>wunden bis auf ein Zei<strong>ch</strong>en, das einer s<strong>ch</strong>ief auf dem Kopfe<br />
liegenden Glocke gli<strong>ch</strong>. Daneben aber waren s<strong>ch</strong>on Jahreszahlen<br />
von 1518 (da der Württemberger Herzog Ulri<strong>ch</strong> den Berg bestieg)<br />
bis 1603 mit den Namen vers<strong>ch</strong>iedener Besu<strong>ch</strong>er eingehauen, wor¬<br />
unter eben jener Herzog Hudalricus. Besonders hervorhebenswerth<br />
ist, dass der Stein, als ihn der Geishirte vor Cappellers<br />
Augen in Bewegung setzte, zuglei<strong>ch</strong> weithin tönte: lapidem colli¬<br />
sione late exaudiendum sonum edentem concussil. Si<strong>ch</strong>er also ist,<br />
dass der Stein mit unter jene vielbespro<strong>ch</strong>enen Felsen gehört hat,<br />
die man keltis<strong>ch</strong> Dolmen, Mennhir, Mairen, Matronen, pierres<br />
mouvantes nennt, an die si<strong>ch</strong> die Feenverehrung und der Hexen¬<br />
glaube anknüpft, und wel<strong>ch</strong>e zu deuts<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t minder vielnamig<br />
Steinmannli, Lottelfelsen, Wagsteine, Gnappsteine heissen; gnappen<br />
ist wanken.<br />
Der andere no<strong>ch</strong> hervorzuhebende Punkt ist der Name der<br />
obersten Pilatusspitze. Sie heisst Essel, aber von Fremden und in<br />
Touristens<strong>ch</strong>riften Esel gespro<strong>ch</strong>en und ges<strong>ch</strong>rieben. Derselbe Name<br />
begegnet no<strong>ch</strong> anderwärts. Aargauis<strong>ch</strong>e Localnamen sind Etzelgraben,<br />
Ettenbühl (Hügel bei Kir<strong>ch</strong>leerau), Ettelwald (bei S<strong>ch</strong>nei¬<br />
singen). Heinri<strong>ch</strong> Ezil besitzt den Hof zu S<strong>ch</strong>erz 1273. Aarg.<br />
Beitr. 586. Des Riesen Name ist ahd. ezal, edax. Im zerstörten<br />
Weissenstein bei Werda, unweit Marburg, hauste ein Riese Na¬<br />
mens Essel, und die Wiese an der Stelle, wo der Riese beim<br />
Untergang der Burg die goldene Thür derselben in die Lahn ver¬<br />
senkte, heisst no<strong>ch</strong> jetzt der Esselswerd. Myth. 1218. Essen und<br />
Essel sind Dörfer im Osnabrückis<strong>ch</strong>en und Hoya. Pott, Personen¬<br />
namen 482. Wer Riesengrösse hat und Riesenkraft verbrau<strong>ch</strong>t,<br />
hat ebenso grossen Hunger und Durst. Die Essgier der Riesen<br />
liegt in ihrem Namen, das Mär<strong>ch</strong>en stellt sie daher stets mens<strong>ch</strong>en¬<br />
fresseris<strong>ch</strong> dar, und au<strong>ch</strong> dieses Prädicat hat si<strong>ch</strong> zum Namen jenes<br />
Zür<strong>ch</strong>er Bürgerges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tes der Manezze umgestaltet, die man seit<br />
dem 14. Jahrhundert urkundli<strong>ch</strong> kennt. Das alts, etan, ags. eoton,<br />
altn. iölun, ahd. ezal heisst edax. Burkard Waldis in seinem Eso¬<br />
pus I. 47, 6 nennt den Fresser einen etzler. Der Riesen wein¬<br />
gieriger Durst lebt ebenso in ho<strong>ch</strong>- und niederdeuts<strong>ch</strong>en Mund¬<br />
arten fort ; engl, thurst, ags. tkyrs, in Zingerle's Tirol. Sagen der<br />
Bergriese Thyrs<strong>ch</strong>, mhd. we<strong>ch</strong>selnd türse, dürs<strong>ch</strong> und lürste. Myth.<br />
486 489. Die Aarg. Sagen kennen beide Namen: die E tel-
42<br />
mutter no. 49, und zuglei<strong>ch</strong> den Durst und sein durstig Heer<br />
pg. 177. 390. In den Naturmythen (vgl. dorten das Register)<br />
ist von Letzterm no<strong>ch</strong> weiter beri<strong>ch</strong>tet. Die s<strong>ch</strong>einbar nieder¬<br />
deuts<strong>ch</strong>e Namensform Etelmutter, statt einer zu vermuthenden ober¬<br />
deuts<strong>ch</strong>en Ezzelmutter, ist kein Widerspru<strong>ch</strong> und findet si<strong>ch</strong> wie¬<br />
der in Ettig (hungrig), fressiger Ettiker (appetitus caninus). Stal¬<br />
der 1, 117.<br />
Damit wäre der ursprüngli<strong>ch</strong>e Name des Pilatusberges in sei¬<br />
ner deuts<strong>ch</strong>en Namensform wiedergefunden. Auf seinem Berggrat<br />
wohnt der Riese Ezzel, der sxoXvcpâyoç und edax. An seinem<br />
periodis<strong>ch</strong> laufenden Quell des Durstbrunnens trinkt der trunkene<br />
Sturmriese Türst, bibax, beide als die Verdoppelung eines und<br />
desselben leibli<strong>ch</strong>en Bedürfnisses, der Mens<strong>ch</strong>enbitte um das täg¬<br />
li<strong>ch</strong>e Bjot. Von ihnen hatte hier die Vorzeit die Erfüllung aller<br />
Wüns<strong>ch</strong>e erhofft, ihnen war das Steinorakel des tönenden und<br />
bebenden Gnappsteines aufgeri<strong>ch</strong>tet. Warum aber der Glaube und<br />
der Mens<strong>ch</strong>enverstand der Vorzeit si<strong>ch</strong> so lange zu diesen Vor¬<br />
stellungen gestimmt und befähigt fühlen konnte, dies wird si<strong>ch</strong><br />
ergeben aus dem nun folgenden Abs<strong>ch</strong>nitte vom Meteor- und<br />
Regenstein.<br />
Zweiter Abs<strong>ch</strong>nitt.<br />
II. Glanbenstberreste aus der Steinzeit.<br />
Der<br />
Meteorstein und Strahlstein.<br />
Dur<strong>ch</strong>si<strong>ch</strong>tig ers<strong>ch</strong>eint die Luft so rein<br />
Und trägt im Busen Stahl und Stein;<br />
Entzündet werden sie si<strong>ch</strong> begegnen,<br />
Da wird's Metall und Steine regnen. Göthe.<br />
Das ganze Alterthum besitzt den Steincultus und hat ihn glei<strong>ch</strong>er<br />
Massen auf die himmlis<strong>ch</strong>e Abkunft der Steine gegründet. Der vom<br />
Himmel stürzende Meteorstein, der im Gewitter s<strong>ch</strong>einbar nieder¬<br />
fahrende Donnerkeil, diese beiden weithin augenfälligen und über¬<br />
wältigenden Naturers<strong>ch</strong>einungen forderten des Mens<strong>ch</strong>en Na<strong>ch</strong>denken<br />
am ersten heraus, und er nennt sie beide na<strong>ch</strong> ihrer sinnli<strong>ch</strong>en Er¬<br />
s<strong>ch</strong>einungsweise übereinstimmend in allen Spra<strong>ch</strong>en Kugel und Keil.<br />
Der Name Kugel gilt dem Meteor. Jene kleinen Weltkörper, wel<strong>ch</strong>e<br />
in ungezählten Massen den Weltraum dur<strong>ch</strong>fliegen, werden, in un¬<br />
sere Atmosphäre gerathend, na<strong>ch</strong> allen Seiten dur<strong>ch</strong> Anziehung<br />
zerstört, entzünden si<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> Reibung, ers<strong>ch</strong>einen als Feuer¬<br />
kugeln, die man deshalb au<strong>ch</strong> am Tage sieht, zerplatzen und stürzen
43<br />
knallend herab, dem Aug' und Ohre des Mens<strong>ch</strong>en zum S<strong>ch</strong>recken<br />
und Staunen. Die Januarstürme dieses Jahres 1863, die in ihrer<br />
fur<strong>ch</strong>tbaren Wuth von den Alpen bis zur Ostsee beoba<strong>ch</strong>tet wer¬<br />
den konnten, waren besonders rei<strong>ch</strong> an sol<strong>ch</strong>erlei überras<strong>ch</strong>enden<br />
Meteoren. Während man damals z. B. in Mün<strong>ch</strong>en bei nä<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>em<br />
Donner und Blitz das Elmsfeuer an dem gothis<strong>ch</strong>en Bau der Auerkir<strong>ch</strong>e<br />
in spitzig leckenden Zungen auflodern sah, beri<strong>ch</strong>tete man<br />
glei<strong>ch</strong>zeitig von jenem 20. Januar Folgendes aus S<strong>ch</strong>werin : Ueber<br />
allen Städten Mecklenburgs entluden si<strong>ch</strong> die Blitze mit plötzli<strong>ch</strong>em<br />
Knallen, die ganze Atmosphäre s<strong>ch</strong>ien mit einem electris<strong>ch</strong>en Flui<br />
dum überfüllt, an den Spitzen der Windmühlenflügel erblickte man<br />
kugelförmige, leu<strong>ch</strong>tende Körper, die unter starkem Knallen plötz¬<br />
li<strong>ch</strong> zersprangen und das Gebäude in Brand steckten." Allg. Augsb.<br />
Ztg. 1863, no. 31. Aus 'sol<strong>ch</strong>erlei Ers<strong>ch</strong>einungen nun müssen wir<br />
uns erst die volle Nalurwahrheit wieder begreifli<strong>ch</strong> ma<strong>ch</strong>en, die in<br />
den alten Gewitter- und Riesensagen ausgespro<strong>ch</strong>en liegt. Das¬<br />
selbe eben bes<strong>ch</strong>riebene Phänomen wird als Solothurner Gebirgssage<br />
erzählt in den Naturmythen, pg. 58. : Drei Riesenbrüder<br />
kegeln. Die Riesen auf dem Weissenstein in Oberhessen besassen<br />
gemeinsam einen Backofen, der mitten im Felde lag, und zum<br />
Zei<strong>ch</strong>en, dass einer Holz zum Heizen herbeitragen solle, warfen<br />
sie si<strong>ch</strong> gegenseitig Steine zu. Als Zwei zu glei<strong>ch</strong>er Zeit warfen,<br />
fuhren die Steine in der Luft zusammen; nun liegen sie im Felde<br />
bei Mi<strong>ch</strong>elba<strong>ch</strong>, auf jedem eine grosse Hand eingedrückt. Die<br />
Hünen des Bruns- und Wiltberges zwis<strong>ch</strong>en Godelheim und Amelunxen<br />
warfen si<strong>ch</strong> grosse Kugeln als Spielbälle zu. Die Wilden<br />
Männer im Gasteiner Thale wohnten in einer unzugängli<strong>ch</strong>en Höhle<br />
der Klamm, vor wel<strong>ch</strong>er Apfelbäume standen; mit den Aepfeln<br />
warfen sie s<strong>ch</strong>erzhaft na<strong>ch</strong> den vorbeiziehenden Wanderern hinab.<br />
Myth. 510. 520. In der Oberpfalz (S<strong>ch</strong>önwerth, Sag. 2, 263) heisst<br />
es : Als das Himmelsgewölbe no<strong>ch</strong> ohne Sterne war, warfen die<br />
Riesen mit Kugeln hinein und dur<strong>ch</strong>lö<strong>ch</strong>erten es; nun sieht man<br />
dur<strong>ch</strong> diese Lö<strong>ch</strong>er das Li<strong>ch</strong>t des innern Himmels. Alle diese<br />
Sagenzüge spiegeln den Inhalt einer eddis<strong>ch</strong>en Mythe ab, in der<br />
die Fahrt erzählt ist, wel<strong>ch</strong>e der Gewittergott Thôrr na<strong>ch</strong> Jöttunheim<br />
zum Besu<strong>ch</strong>e des Riesen Geirr'öd ma<strong>ch</strong>t. Letzterer empfängt<br />
jenen auf dem Ho<strong>ch</strong>sitze in einer Halle, in der na<strong>ch</strong> gewöhnli<strong>ch</strong>er<br />
Sitte die Gastfeuer brannten. Daraus ward ein glühender Eisen¬<br />
keil genommen, mit dem der Wirth seinem Gaste ein Wettspiel<br />
anbot. Geirröd warf zuerst, und Thôrr mit seinen Eisenhand¬<br />
s<strong>ch</strong>uhen fieng den Keil auf. Er s<strong>ch</strong>leuderte ihn zurück, vergebli<strong>ch</strong>
w<br />
harg si<strong>ch</strong> der Riese hinter einer Eisensäule, der Wurf drang hin¬<br />
dur<strong>ch</strong>, dur<strong>ch</strong>bohrte seinen Leib und flog no<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> die Hauswand<br />
in die Erde hinaus. Hiebei fällt, sagt Weinhold (Die Riesen 49)<br />
auf die Steinkeile ein mythis<strong>ch</strong>er S<strong>ch</strong>immer, sie sind das Bild des<br />
Blitzes, und wenn der norwegis<strong>ch</strong>e Bauer zwei Gewitter am Ge¬<br />
birge gegen einander stossen sah, erinnerte er si<strong>ch</strong> des Kampfes<br />
zwis<strong>ch</strong>en Thôrr und Geirröd. Die zertrümmert niedergehende<br />
Meteorkugel wird geda<strong>ch</strong>t als Steinkeil, als glühender Eisenkeil,<br />
als Kugel und Kegelkugel. Das Geprassel eines in der Nähe ein¬<br />
s<strong>ch</strong>lagenden Wetters glei<strong>ch</strong>t dem Rasseln eines Haufens herab¬<br />
stürzender Steine. Es entsteht die Vorstellung von kolossalen<br />
Blöcken, mit denen im Himmel agirt werde, wie die rollenden<br />
Felsstücke" in den Kämpfen der Titanen au<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>on bei Hesiod<br />
eine Hauptrolle spielen. S<strong>ch</strong>wartz, Urspr. d. Mythol. 86. Der<br />
Dithmars<strong>ch</strong>e sagt vom rollenden, kra<strong>ch</strong>enden Donnerwetter, die<br />
Engel werfen mit Steinen, die Engel kegeln (Müllenhoff, S<strong>ch</strong>lesw.-<br />
Holst. Sag. pg. 358). Der S<strong>ch</strong>wabe meint, dieses Kegeln beim<br />
Donnern ges<strong>ch</strong>ehe mit Steinen, die, wenn sie an ein Lo<strong>ch</strong> kom¬<br />
men, herunterstürzen und auf Erden irgendwo eins<strong>ch</strong>lagen; man<br />
für<strong>ch</strong>tet deshalb ni<strong>ch</strong>t sowohl den Blitz, als vielmehr den Strei<strong>ch</strong>,<br />
wie man den Donner nennt. Meier, S<strong>ch</strong>wab. Sag. pg. 259. In<br />
Konrad von Megenbergs Bu<strong>ch</strong> der Natur (Augsburg bei S<strong>ch</strong>önsperger<br />
1499) wird gegen diese Meinung geeifert. Blatt E 4 f.:<br />
man vindet leütt, dye wänen das der doner ein stain sey, darumb<br />
das offl ein stain herab vellt mit dem doner in grossem welter. das<br />
isl ni<strong>ch</strong>t war. wan wäre der doner ein stain, so ma<strong>ch</strong>et er wun¬<br />
den den leütten vnd den Heren, die er s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t, als ander valient<br />
stain thuond. das ges<strong>ch</strong>ieht aber ni<strong>ch</strong>t. In den Niederlanden gilt<br />
der Flu<strong>ch</strong> : by gods heilige sleenen by de godsige steenen Wolf,<br />
Beitr. 1, 67. Aargauis<strong>ch</strong>e Volksrede sagt vom Rollen des Donners:<br />
Sie füeret Stei d'obe, sie ladet Stei ab, es <strong>ch</strong>roset (ein Wagenrad<br />
fährt knirs<strong>ch</strong>end und zermalmend engl, crushing über grob¬<br />
körniges Kies), der Tüfel muess Stei s<strong>ch</strong>leppe. Letztere Phrase<br />
erinnert direct an den im Hades zur Strafe steinwälzenden Sisy¬<br />
phus mit dem entrollenden tückis<strong>ch</strong>en Marmor". Allgemein ver¬<br />
breitet ist die Redensart: Die Engel kegeln, Petrus kegelt; au<strong>ch</strong><br />
sie stammt keineswegs aus einem gröbli<strong>ch</strong>en Uebermuth des Volks¬<br />
humors, vielmehr erinnert eine raketenartig aus einander stiebende<br />
Blitzgarbe wirkli<strong>ch</strong> an ein rings im Kreise zuglei<strong>ch</strong> umstürzendes<br />
Kegelspiel, in das die rollende Kugel hineins<strong>ch</strong>mettert.<br />
In andern Gegenden Deuts<strong>ch</strong>lands sieht man die in Heiden-
45<br />
gräbern gefundenen Steinhämmer und Kelte als ein Produkt des<br />
Blitzstrahles an, und statt zu s<strong>ch</strong>wören : dass di<strong>ch</strong> der Blitz spri<strong>ch</strong>t<br />
man, dass di<strong>ch</strong> der Hammer s<strong>ch</strong>lage! Der westfälis<strong>ch</strong>e Bauer er¬<br />
blickt in einem sol<strong>ch</strong>en auf der Hutung gefundenen Donnerkeil den<br />
Hammer Gottes, mit wel<strong>ch</strong>em der Herr seine Blitznägel in den<br />
Erdboden s<strong>ch</strong>lägt. Der Hammer ist aber das eddis<strong>ch</strong>e Attribut<br />
Thôrrs, ahd. hamer bedeutet harter Stein. Thôrrs Zei<strong>ch</strong>en ist das<br />
Hammerzei<strong>ch</strong>en. Mit dem Wurf dieses heiligen Geräthes wird das<br />
Re<strong>ch</strong>t auf Grund und Boden gesetzli<strong>ch</strong> bestimmt. Hammerwurf und<br />
Steinwurf berühren si<strong>ch</strong>, au<strong>ch</strong> Steine waren ein Zei<strong>ch</strong>en re<strong>ch</strong>t¬<br />
li<strong>ch</strong>er Uebergabe, ihr symbolis<strong>ch</strong>es Werfen bezeugt eine Urkunde<br />
von 1085 :<br />
guerpire cum lapide. Bis in neuerer Zeit pflegte in<br />
Sa<strong>ch</strong>sen der Ri<strong>ch</strong>ter die Gemeinde dur<strong>ch</strong> Herumsendung eines<br />
Hammers zu berufen, bei Vergantungen ges<strong>ch</strong>ieht no<strong>ch</strong> jetzt mit<br />
einem sol<strong>ch</strong>en der geri<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Zus<strong>ch</strong>lag. Grimm, RA. 64.162.181.<br />
Jeder Bauer, der sonst im Frickthaler Dorfe Wittnau in Gemeinde¬<br />
ges<strong>ch</strong>äften über Land ges<strong>ch</strong>ickt wurde, nahm als Ausweis und<br />
Laufpass den Waldhammer mit si<strong>ch</strong>, wel<strong>ch</strong>er beim Gemeindeam¬<br />
mann verwahrt lag. Naturmythen pg. 95. Weil ferner das Ge¬<br />
witter den Wa<strong>ch</strong>sthum der Flur befördert, so ist der Flur- und<br />
Grenzgott Thôrr zuglei<strong>ch</strong> der Erntegott, folgeri<strong>ch</strong>tig au<strong>ch</strong> der Ehe¬<br />
gott. Man legte seinen Donnerhammer der Braut zur Weihe in den<br />
S<strong>ch</strong>oss und segnete mit ihm die Lei<strong>ch</strong>en ein, jene zur Fru<strong>ch</strong>t¬<br />
barkeit, diese zur neuen Befru<strong>ch</strong>tung des Erdens<strong>ch</strong>osses. No<strong>ch</strong><br />
pflegt heute hinter dem ländli<strong>ch</strong>en Brautfuder der S<strong>ch</strong>reinermeister<br />
einherzugehen, in der Hand festli<strong>ch</strong> den Hammer tragend, und<br />
überall no<strong>ch</strong> hört der Aberglaube den Vorboten des Todes an<br />
Thüre und Hausladen anpo<strong>ch</strong>en, pöpperlen. Sub ascia dedicavil"<br />
ist eine häufige Ins<strong>ch</strong>rift römis<strong>ch</strong>-gallis<strong>ch</strong>er Grabsteine in den Strom¬<br />
gebieten der Rhone und Loire. Mone, Ges<strong>ch</strong>. des Heidenth. 2,<br />
373. Bei den Lappen s<strong>ch</strong>lug während der Einsegnung des Ho<strong>ch</strong>¬<br />
zeitspaares der Vater der Braut mit Stahl und Kieselstein Feuer,<br />
und ein sol<strong>ch</strong>es Feuerzeug wurde au<strong>ch</strong> ihren Todten mitgegeben.<br />
Der Feuerfunke im Kiesel sollte die S<strong>ch</strong>öpfung des Dritten, des<br />
im Liebesfeuer gezeugten und empfangenen Kindes ausdrücken,<br />
zuglei<strong>ch</strong> ebenso den Todten Li<strong>ch</strong>t geben auf dem Wege in's<br />
S<strong>ch</strong>attenrei<strong>ch</strong>. Mone, Ges<strong>ch</strong>. d. Heidenth. 1, 38. Ist so der Ham¬<br />
mer ein Symbol sittli<strong>ch</strong>er Weihe und ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>er Keus<strong>ch</strong>heit,<br />
so wird er Haus und Gut des Frommen vor Blitz- und Hagels<strong>ch</strong>lag<br />
bewahren, ebenso aber alle Blitze auf den Unkeus<strong>ch</strong>en herab¬<br />
locken. Zum Beweise mögen folgende Sätze dienen.
46<br />
Konrad von Megenberg, Bu<strong>ch</strong> der Natur (Augsb. S<strong>ch</strong>önsperger<br />
1499) bes<strong>ch</strong>reibt zuglei<strong>ch</strong> das Aussehen unserer Kelte, wenn er<br />
von ihrer Wirkung redet : Ceraunus heist donerstein vnd velli zuo<br />
stund mit den hymelplitzen. man spri<strong>ch</strong>t, an wel<strong>ch</strong>er stat der stein<br />
sey, do s<strong>ch</strong>ad kein doner no<strong>ch</strong> putzen nit. er ist dick vnd gar<br />
s<strong>ch</strong>arpf an einer seilten. Im Germanis<strong>ch</strong>en Anzeiger 1863 ist von<br />
Dr. Hartmann dieser Volksglaube erst neuli<strong>ch</strong> naturges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong><br />
näher begründet worden. Die Kelte bestehen häufig aus Polier¬<br />
stein, lapis lydius, dessen Eigentümli<strong>ch</strong>keit ist, in der Wärme<br />
und im Feuer zu s<strong>ch</strong>witzen. Umwickelt man einen Polierstein mit<br />
Faden und legt ihn in's Feuer, so bewirkt die aus dem Steine<br />
dringende Feu<strong>ch</strong>tigkeit, dass der Faden ni<strong>ch</strong>t brennt. Darinn sieht<br />
der gemeine Mann eine übernatürli<strong>ch</strong>e Wirkung und hält daher den<br />
Donnerkeil für ein S<strong>ch</strong>utzmittel gegen den Blitz. Denn wie der<br />
Stein den Faden gegen das Verbrennen s<strong>ch</strong>ützt, so wird au<strong>ch</strong> ein<br />
Haus, in dem si<strong>ch</strong> ein Donnerstein befindet, ni<strong>ch</strong>t vom Blitze be¬<br />
s<strong>ch</strong>ädigt. Ist daher ein Gewitter im Anzüge, so s<strong>ch</strong>witzt in Folge<br />
des Temperaturwe<strong>ch</strong>sels der Stein, alsdann pflegt der katholis<strong>ch</strong>e<br />
Landmann eine geweihte Kerze neben ihn auf den Tis<strong>ch</strong> zu stellen.<br />
Diesen no<strong>ch</strong> geltenden Brau<strong>ch</strong> meldet bereits Wierus, De praestigiis<br />
Daemonum, Basil. 1577, 587 : Alii strata mensa in medio<br />
cubiculi imponunt inier duas cereas ardentes hanc ceraunium lapi¬<br />
dent; is dum sudat, quod ipsis videlur miraculum. Das Lex. Myth.<br />
961 meldet aus Tellmar<strong>ch</strong>en, dass man daselbst auf einem Gehöfte<br />
Meeaas zwei sol<strong>ch</strong>e Donnerbeissel an jedem Donnerstagsabend ge¬<br />
was<strong>ch</strong>en, mit Butter und Fett am Feuer bestri<strong>ch</strong>en und feierli<strong>ch</strong><br />
auf den Ho<strong>ch</strong>sitz gestellt habe, in dem Glauben, damit dem Hause<br />
und der Flur Gedeihen zu vers<strong>ch</strong>affen. Da na<strong>ch</strong> dem Glauben un¬<br />
serer Sennen der Donner die Mil<strong>ch</strong> selbst im Euter der Kuh<br />
s<strong>ch</strong>eidet, so folgt, dass man das Euter besonders kranker Kühe<br />
mit dem Donnersteine bestrei<strong>ch</strong>t, im Jura mit einer aus gestossenen<br />
Belemniten (Chalützelstein) bereiteten Salbe eins<strong>ch</strong>miert.<br />
Man nennt ihn daher Kuhstein. Wagner, hist, natur. Helvet. Tiguri<br />
1680, 320.<br />
Einen Franzosen Marbodäus setzt man in's 11. Jahrhundert<br />
und s<strong>ch</strong>reibt ihm folgende Verse über den Donnerstein zu :<br />
Qui caste gerii hunc, a fulmine non ferietur,<br />
Nec domus, aut villae, quibus adfuerit lapis ille.<br />
Den Unkeus<strong>ch</strong>en also wird, diesen Lateinversen gemäss, der Blitz<br />
ers<strong>ch</strong>lagen, oder wie es Hiob 19, 21 heisst, die Hand Gottes rühren.<br />
Scriver, im Seelens<strong>ch</strong>atz 4, 925 erzählt von einem deuts<strong>ch</strong>en Edel-
47<br />
manne, der zur Erntezeit auf dem Felde draussen bei seinem Ge¬<br />
sinde war. Als ein Donnerwetter plötzli<strong>ch</strong> einfiel, barg er si<strong>ch</strong><br />
unter den bereits in einzelne Stiegen aufges<strong>ch</strong>oberten Garben, traf<br />
hier eine voraus darunter gekro<strong>ch</strong>ene Magd und trieb Unzu<strong>ch</strong>t mit<br />
ihr. Ein Blitzstrahl tödtete die Dirne und riss ihm Nase und Lippen<br />
weg. So hat diesen Gottgezei<strong>ch</strong>neten Scriver selbst no<strong>ch</strong> gesehen.<br />
Unmittelbar an diese Vorstellungen knüpfen si<strong>ch</strong> diejenigen an,<br />
die vom Strahlstein gelten. Ein im ganzen Alterthum ver¬<br />
breitet gewesener und jetzt wenigstens no<strong>ch</strong> spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong>klin¬<br />
gender Glaube ist, jeder Blitzstrahl gehe in Gestalt eines runden,<br />
hohlen Steines sieben Klafter tief in den Boden und komme, alle<br />
Jahre je um ein Klafter heraufrückend, wieder an die Oberflä<strong>ch</strong>e.<br />
Daher, heisst es, rühren alle guten Feuer- und S<strong>ch</strong>leifsteine. Es<br />
ist dies in Hesiods Théogonie 722 der eherne Hammer Akmon,<br />
der, von Zeus entsendet, zehn Tage vom Himmel zur Erde, und<br />
zehn andere, um von dieser zum Tartaros zu fliegen brau<strong>ch</strong>t. Es<br />
ist ebenso in der Edda Thôrrs Hammer, den der Riese Thrymr<br />
(tonitru) geraubt und a<strong>ch</strong>t Rasten tief unter der Erde vergraben<br />
hat. Oder es ist der mit dem S<strong>ch</strong>ulmeister wettwerfende Teufel<br />
in Haltri<strong>ch</strong>s Siebenbürg. Volksmär<strong>ch</strong>en pg. 164. Letzterer s<strong>ch</strong>leu¬<br />
derte einen S<strong>ch</strong>miedehammer in die Luft, der sieben Stunden<br />
brau<strong>ch</strong>t, bis er wieder zu Boden fällt. Der pfiffige S<strong>ch</strong>ulmeister,<br />
der den Hammer ni<strong>ch</strong>t bewegen kann, nimmt einen Finken und<br />
s<strong>ch</strong>leudert ihn in die Luft: Dieser Stein, sagt er listig, brau<strong>ch</strong>t<br />
sieben Tage, bis er zur Erde fällt; willst du so lange warten?<br />
Die Donnerkeile (nord. Thôrwiggar, s<strong>ch</strong>wed. Tordönsvigge) oder<br />
Kelte sind mit einem Oehr dur<strong>ch</strong>bohrt ; die Roll- und Klappersteine<br />
sind, wie ihr Name sagt, hohle Steinkugeln mit einem bewegli<strong>ch</strong>en<br />
Stein<strong>ch</strong>en in ihrem Innern; die S<strong>ch</strong>eibenstein<strong>ch</strong>en haben ein cirkelrundes<br />
Lo<strong>ch</strong> in ihrer Mitte, das dur<strong>ch</strong> Ausfall eines verwitterten<br />
Thons oder Drusenganges entsteht; Erforderniss aller dieser Steine<br />
ist, dass sie von Natur hohl seien. Da man die Ursa<strong>ch</strong>e ihrer ge¬<br />
regelten Dur<strong>ch</strong>bohrung in dem dur<strong>ch</strong> ihre Röhre fahrenden und in<br />
die Erde mündenden Blitze su<strong>ch</strong>t, so nennt man sie Strahl. Au<strong>ch</strong><br />
ihr englis<strong>ch</strong>er Name adderston deutet auf diese ste<strong>ch</strong>ende, sie dur<strong>ch</strong>¬<br />
s<strong>ch</strong>lagende Wolkens<strong>ch</strong>lange des Blitzes. Im Jura zeigt man örtli<strong>ch</strong>e<br />
Klippen am Berggrat her, in die der Blitz zu fahren pflegt, und<br />
nennt sie auss<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> Strahl; so z. B. im Thalkessel von aar¬<br />
gauis<strong>ch</strong> Asp, auf der Burgwand der Urgiss. In Kärnten glaubt man<br />
no<strong>ch</strong> heute, dass beim Gewitter kleine Bergkristalle, Dunderstoand'In,<br />
vom Himmel fallen. Zts<strong>ch</strong>r. f. Myth. 3. 29, 11. Am
48<br />
zahlrei<strong>ch</strong>sten vertreten sind sol<strong>ch</strong>erlei Stein<strong>ch</strong>en dur<strong>ch</strong> die Belemniten.<br />
Diese metamorphosirten Reste thieris<strong>ch</strong>er Gliedmassen, in<br />
Form von Thiersta<strong>ch</strong>eln und klauigen Fingern, bedecken im Jura<br />
weite Ackerstrecken. Die in ihnen einges<strong>ch</strong>lossen gewesenen or¬<br />
ganis<strong>ch</strong>en Bestandtheile sind verloren; ni<strong>ch</strong>ts als die leere, hohle<br />
Gelenkröhre des Reptils ist übrig. S<strong>ch</strong>reibt man sie dem Teufel<br />
zu, so sind sie Finger und Füsse, die der vom Himmel Stürzende<br />
si<strong>ch</strong> hra<strong>ch</strong>, und heissen alsdann Teufelsfinger, Teufelskegel (=thieris<strong>ch</strong>c<br />
Losung), Ste<strong>ch</strong>ehörndli (Hörndlibub=Teufel), S<strong>ch</strong>rättelifüsse.<br />
Die S<strong>ch</strong>rättelein sind die in den S<strong>ch</strong>raltenfluhen wohnenden Ge¬<br />
witterzwerge. Au<strong>ch</strong> Krottenstein heissen sie, weil die Gewitter¬<br />
kröte einen geheimnissvollen Stein im Haupte tragen soll; Alpfuss<br />
und Trudenfuss, weil sie an die Fussspur der Wetterhexe, an das<br />
Stampfen der Trude erinnern sollen. In's Bett gelegt bewahren<br />
sie den S<strong>ch</strong>lafenden gegen<br />
das Alpdrücken, an krankende Fru<strong>ch</strong>t¬<br />
bäume gehängt, ma<strong>ch</strong>en sie diese wieder fru<strong>ch</strong>tbar. In den Ställen<br />
dienen sie den Rossen gegen das Verfilzen der Mähnen, weil sie<br />
das S<strong>ch</strong>rättlein abhalten. In den Barren legt man statt sol<strong>ch</strong>er Belemniten,<br />
die allzu klein sein würden, zwei bis drei gewöhnli<strong>ch</strong>e<br />
Flusskiesel, dur<strong>ch</strong> die das Futter rein gehalten und die Stallkuh<br />
mil<strong>ch</strong>rei<strong>ch</strong> gema<strong>ch</strong>t werden soll. Man stampft jene ferner zu Mehl,<br />
trinkt davon gegen Krämpfe, legt sie als Pflaster verknetet auf<br />
Wunden. Der über Feld gehende katholis<strong>ch</strong>e Bauer trägt sie im<br />
Sacke mit si<strong>ch</strong>, an der Stelle des Geistli<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>ildes" oder statt<br />
irgend einer andern Sammlung von Zaubersegen. Sogar an den<br />
Paternosterkranz werden sie gehängt und mit in den Gottesdienst<br />
genommen. Ein besonderes Beispiel hievon aus der Gegenwart<br />
bietet Birlinger, S<strong>ch</strong>wab. Sag. no. 307.<br />
Der<br />
Regenstein.<br />
Klüftige Felsen und Feldsteine sammeln den Regen oder das<br />
Abwasser der Da<strong>ch</strong>traufen zu kleinen stehenden Pfützen in si<strong>ch</strong> an;<br />
na<strong>ch</strong> diesen Wasserhüllen nennt man sie in S<strong>ch</strong>waben Hollen- und<br />
Wollenlö<strong>ch</strong>er (Birlinger, Wörterbü<strong>ch</strong>l. d. S<strong>ch</strong>wab. Sag. 45. 60), in<br />
Norddeuts<strong>ch</strong>land Hüllen- und Wullenstein (Kuhn, Westfäl. Sag. pg.l.<br />
145). In Baiern ist aus dem Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te deren von Hullo<strong>ch</strong> jener<br />
berühmte Seyfried S<strong>ch</strong>weppermann, der Sieger von Ampfing, her¬<br />
vorgegangen (Bavaria 2, 504. 518). Allenthalben knüpft si<strong>ch</strong> die<br />
Sage daran : Frau Huld (Holla) habe auf diesem Frauen-Hollstein<br />
um den Verlust ihres ni<strong>ch</strong>t wiederkehrenden Gemahls unstillbare<br />
Thränen geweint (Wolf, Hess. Sag. no. 12), oder es habe Frau
49<br />
Holle den Fels gegen den Neubau einer Christenkir<strong>ch</strong>e zu s<strong>ch</strong>leu¬<br />
dern versu<strong>ch</strong>t, aber s<strong>ch</strong>adlos entglitt derselbe ihrer Hand und trägt<br />
von ihren Fingergriffen ein tiefes Lo<strong>ch</strong>, worinn zu jeder Zeit<br />
Wasser steht, mag es au<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> so lange ni<strong>ch</strong>t geregnet haben.<br />
Kuhn, Nordd. Sag. 110, Mark. Sag. 138. Die Erzählung geht da¬<br />
bei abwe<strong>ch</strong>selnd in's Seelenvolle und in's Triviale über, je na<strong>ch</strong>¬<br />
dem die alte Heidengöttin dabei bes<strong>ch</strong>ulten oder in ihrer <strong>ch</strong>rist¬<br />
li<strong>ch</strong>en Umkleidung beehrt sein soll. Gilt es der erstem, so hat<br />
sie hier in eifersü<strong>ch</strong>tiger Wuth ihr Wasser gelassen; hat die Er¬<br />
zählung bereits <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>e Gestalt und Wendung, so legt man am<br />
Ostertage Frühlingsblumen in den Hohlstein oder in das zunä<strong>ch</strong>st<br />
lliessende Wasser (Kuhn, ibid.), und so sieht man im Stein bei<br />
Rimba<strong>ch</strong> an der Fulda die Lagerstatt, auf wel<strong>ch</strong>er Marie ruhte, und<br />
das Was<strong>ch</strong>becken, worin sie ihr Kindlein wus<strong>ch</strong>. Wolf, Beitr. 2, 30.<br />
Die beiden Hergottstritte in S<strong>ch</strong>waben sind zertrümmert worden.<br />
Am Rosenstein nämli<strong>ch</strong> war der tiefe Tritt der Ferse zu sehen,<br />
die der Heiland hier aufgesetzt, und auf dem eine Viertelstunde<br />
entfernten S<strong>ch</strong>euelberge die Zehen, so dass das Mittelstück des<br />
Fusses über das ganze Thal gerei<strong>ch</strong>t haben muss. Das in beiden<br />
Fussstapfen angesammelte Wasser gebrau<strong>ch</strong>te man zu des Chro¬<br />
nisten Crusius Zeit gegen Augenleiden. Auf herzogli<strong>ch</strong>en Befehl<br />
wurde 1740 der abergläubis<strong>ch</strong>e Tritt" auf dem Rosenstein ge¬<br />
sprengt; später au<strong>ch</strong> jener auf dem S<strong>ch</strong>euelberge herausgehauen,<br />
aber auf dem Heuba<strong>ch</strong>er Rathhause no<strong>ch</strong> lange aufbewahrt. Meier,<br />
S<strong>ch</strong>wab. Sag. 161. 162.<br />
Zwei Glaubenssätze des Heidenthums drücken si<strong>ch</strong> dabei deut¬<br />
li<strong>ch</strong>er aus : Der Wurfstein besass regenerzeugende Kraft, und das<br />
in seinen Eindrücken angesammelte Regenwasser war zuglei<strong>ch</strong><br />
heilkräftig-. Deshalb spri<strong>ch</strong>t das Rolandslied (ed. W. Grimm) von<br />
jenem nazzen stein, wel<strong>ch</strong>er von den um Roland geweinten Thränen<br />
Karls d. Gr. bis heute benetzt bleibt; oder eben dahin sind die un¬<br />
stillbaren Thränen zu deuten, die der Wilde Mann auf dem Fels¬<br />
block beim Dorfe Gryon um seine geliebte Bianca vergoss (Natur¬<br />
mythen 105). Da der aus der Wolke ges<strong>ch</strong>leuderte Donnerkeil<br />
ni<strong>ch</strong>t ohne Gewitter zur Erde fallen konnte, so knüpft si<strong>ch</strong> an die<br />
einzelnen Felsblöcke entweder die Sage, der Teufel, der Gewitter¬<br />
gott des Mittelalters, oder die diabolisirte Frau Holle habe sie her¬<br />
abgeworfen; oder da der befru<strong>ch</strong>tende Gewitterregen in Hagel und<br />
Uebers<strong>ch</strong>wemmung ausarten kann, so entsteht au<strong>ch</strong> der Glaube,<br />
Gedeihen und Verwüstung der Flur sei dur<strong>ch</strong> das S<strong>ch</strong>leudern des<br />
Steines herbeizuzaubern. Man zog zu Rom den lapis manalis, der<br />
Argovia. III. 4
50<br />
vor dem capenis<strong>ch</strong>en Thore beim Tempel des Mars lag, bei an¬<br />
haltender Landesdürre in Procession na<strong>ch</strong> der Stadt. Ein bei Gre¬<br />
noble gelegener Dolmen, der Wunderstein, hatte no<strong>ch</strong> im 17. Jahr¬<br />
hundert eine Art <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>en Dienstes, um bei grosser Trockenheit<br />
Regen zu erhalten. Mone, Ges<strong>ch</strong>. d. Heidenth. 2, 361. Zu Köln<br />
hatte die hl. Gertrud den kalten Stein aus dem Rhein geholt, der<br />
hl. Bis<strong>ch</strong>of Severin, der daselbst no<strong>ch</strong> um Regen angefleht wird,<br />
hat ihn wieder in den Rhein geworfen. Jene Heilige bringt also<br />
trockenes Wetter mittelst des Steines, während dieser Bis<strong>ch</strong>of den<br />
Stein entfernt und damit zuglei<strong>ch</strong> die Landplage der Dürre. Statt<br />
des Steines wirft man später das Bildniss des mit ihm wirksam ge¬<br />
wesenen Heiligen bei s<strong>ch</strong>limmem Wetter in's Wasser. Beim Miss¬<br />
wa<strong>ch</strong>s des Weines warfen die Franken das Bild des St. Urban in<br />
den Ba<strong>ch</strong>, die Baiern bei langem Regen den hl. Leonhard, die<br />
Detzemer an der Mosel den hl. Bonifacius in die Hecken, wenn<br />
ihnen trotz der Gebete die Bohnen erfroren. Hocker, Deuts<strong>ch</strong>er<br />
Volksglaube 226. Die zaubernde Pfarrersfrau ma<strong>ch</strong>t mit einem<br />
winzigen Kieselstein<strong>ch</strong>en Regen und Hagel. Aarg. Sag. no. 402.<br />
Die Meinung, der Pilatussee beginne zu stürmen, wenn man einen<br />
Stein in ihn wirft, wiederholt si<strong>ch</strong> in dem Satze des Volksglaubens :<br />
Kinder, die im Frühlinge mit den Kieseln am Ba<strong>ch</strong>e spielen, deuten<br />
damit s<strong>ch</strong>were Sommergewitter voraus. S<strong>ch</strong>wäbis<strong>ch</strong>e Kinder ma<strong>ch</strong>en<br />
si<strong>ch</strong> aus Lehm ein tassenförmiges Gefäss, das sie unter dem Rufe<br />
Hagello<strong>ch</strong> beim Dommislo<strong>ch</strong>!" auf eine Steinflä<strong>ch</strong>e werfen, um<br />
damit einen mä<strong>ch</strong>tigen S<strong>ch</strong>all entstehen zu lassen. E. Meier,<br />
S<strong>ch</strong>wab. Kinderreime 96. Sie versu<strong>ch</strong>en also mittelst ihrer selbst¬<br />
gema<strong>ch</strong>ten Klappersteine den Hagel zu eliciren, den der Berggeist<br />
des Pilatus aus seinem s<strong>ch</strong>on vorhin erwähnten Tomilislo<strong>ch</strong> ent¬<br />
sendet. Sol<strong>ch</strong>e Steine nennt man im Alemann. Kinderliede pg. 177<br />
und 393 Wetterlei<strong>ch</strong>; der Spielreim ertheilt den Rath, dieselben ni<strong>ch</strong>t<br />
unvorsi<strong>ch</strong>tig weiterzuwerfen, sondern sie aus dem Felde mit heim¬<br />
zunehmen und sie auf das Thürgesimse in Verwahrung zu legen:<br />
Hott er lei, wer het de Stei?<br />
wenn d'ne findst, so trag ne hei!<br />
Welterlei<strong>ch</strong>, wer het de Stei?<br />
trag ne ûf die Sinze hei<br />
So lange man mit geweihten Glocken gegen Gewitter läutete, hatte<br />
au<strong>ch</strong> der sogenannte Zeitstein no<strong>ch</strong> eigene Geltung, der ehedem<br />
an's Glockenseil gebunden war, wie er jetzt als Gewi<strong>ch</strong>tstein an<br />
der Thurmuhr (mundartl. die Zeit) und im Bauernhause am Strick<br />
der S<strong>ch</strong>warzwälderuhr hängt. Au<strong>ch</strong> dieser Stein war ursprüngli<strong>ch</strong>
51<br />
«in geweihter, zuweilen sogar eine Riesenreliquie. Siegfried, der<br />
Dra<strong>ch</strong>entödter, hatte den Riesen Starkodd bei Jarnamodir in Hol¬<br />
stein bekämpft und ihm einen Zahn ausges<strong>ch</strong>lagen. Dieser wog<br />
sieben Pfund und wurde in Dänemark an einen Glockenstrang ge¬<br />
hängt. Nornagest erzählt, dass er den Zahn selbst gesehen und<br />
mit si<strong>ch</strong> genommen hahe. Russwurm, Nord. Sag. 166. 358.<br />
Wer den Erdmandlistein bei Wohlen behaut, dem reissen die<br />
drunter wohnenden Erdmänn<strong>ch</strong>en den Kopf ab ; wer einen Regen¬<br />
stein sprengt, der bringt Verderben über die ganze Gegend. Temme-<br />
Tettau, Preuss. Sag. no. 160, hat dafür eine der Gegenwart ange¬<br />
hörende Begebenheit vom Opferstein zu Rombinus. Derselbe lag<br />
an der Seite der Memel auf einem Berge, gegenüber der Stadt<br />
Ragnil, und war dem litthauis<strong>ch</strong>en Donnergott Perkunos geweiht.<br />
So lange der Stein stand, wi<strong>ch</strong> weder das Glück der Ehen no<strong>ch</strong><br />
der Segen der Felder aus dem Lande. Da kam ein fremder Wind¬<br />
müller und kaufte den Opferstein zu Mühlsteinen an. Na<strong>ch</strong>dem er<br />
endli<strong>ch</strong> fremde Arbeiter gefunden hatte, wel<strong>ch</strong>e die Arbeit wagten,<br />
wurden diese über dem Ges<strong>ch</strong>äfte alle unglückli<strong>ch</strong>; nun ist seit dem<br />
Jahre 1835 au<strong>ch</strong> der Opferberg mit eingestürzt und der Memelstrom<br />
frisst das Land.<br />
Diese Erzählung leitet über auf einen Stein unserer eigenen<br />
Lands<strong>ch</strong>aft, merkwürdig dur<strong>ch</strong> seine Gestalt, wie dur<strong>ch</strong> seine Sagen.<br />
Im Walde Lint, zwis<strong>ch</strong>en Lenzburg und Othmarsingen, liegt ein<br />
Felsblock, aus dem man vor etli<strong>ch</strong>en Jahren sämmtli<strong>ch</strong>en Bedarf<br />
an Steinen gebro<strong>ch</strong>en hat, der für den städtis<strong>ch</strong>en Kanalbau .zu<br />
Lenzburg nöthig geworden war; glei<strong>ch</strong>wohl ist der Fels no<strong>ch</strong> im¬<br />
mer bei 12 Fuss ho<strong>ch</strong>, 15 breit und 20 lang. Ehedem nannte man<br />
ihn die Fis<strong>ch</strong>bank und hielt ihn für den Mittelpunkt der sagenhaften<br />
Heidenstadt Lenz, wo die Marktweiber ihre Fis<strong>ch</strong>e feilgeboten hätten.<br />
Da der Wald ohne alles Gewässer ist, so nennt man den Fels seit<br />
neuerer Zeit Römerstein, veranlasst dur<strong>ch</strong> jene römis<strong>ch</strong>en Militär<br />
Stationen und Sommerquartiere des bena<strong>ch</strong>barten Waffenplatzes Vin¬<br />
donissa, die mit ihrem S<strong>ch</strong>utt hier ringsum den Boden füllen. Das<br />
bewaldete Landstück selbst, auf dem der Stein liegt, heisst S<strong>ch</strong>warz¬<br />
äcker, der moorige Waldboden ergiebt As<strong>ch</strong>ens<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten, Töpfers<strong>ch</strong>erben,<br />
Mauerwerk und römis<strong>ch</strong>e Imperatorenmünzen. Der Fels<br />
hat in seiner Grundlage mehrfa<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>lupflö<strong>ch</strong>er, die ni<strong>ch</strong>t dem<br />
Zufall anzugehören s<strong>ch</strong>einen, man kann sie zur Noth bekrie<strong>ch</strong>en.<br />
Eine Sage über ihn in den Naturmythen pg. 157 beri<strong>ch</strong>tet sehr an¬<br />
s<strong>ch</strong>auli<strong>ch</strong> von der Volksmeinung, wona<strong>ch</strong> sol<strong>ch</strong>erlei Blöcke einst<br />
dur<strong>ch</strong> Mens<strong>ch</strong>enhand zur Stelle gerollt und künstli<strong>ch</strong> in ihre jetzige
52<br />
Lage gebra<strong>ch</strong>t worden seien. Ein Fels des glei<strong>ch</strong>en Namens, pierre<br />
du poisson, lag vormals neben dem Rathhause zu Porrentruy, auf<br />
ihm wurde Re<strong>ch</strong>t gespro<strong>ch</strong>en und der Verurlheilte ausgestellt; seinen<br />
Namen, sagt A. Quiquerez im S<strong>ch</strong>weiz. Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tsanzeiger 1860,<br />
121, hatte der Stein davon bekommen, dass bei ihm an Markttagen<br />
die Fis<strong>ch</strong>lägel aufgestellt wurden. Man stosst also bei beiden Steinen<br />
auf dieselbe Namenserklärung, wohl nur deswegen, weil zwis<strong>ch</strong>en<br />
Wald-und Wassergottheiten, zwis<strong>ch</strong>en Wilden Weibern, Waldfeen<br />
und Nixen in den Sagen eine feste Verbindung besteht. Als Held<br />
Witti<strong>ch</strong> (Witugauuo, Widigoia, der Mann des Waldgaues) dur<strong>ch</strong><br />
Dietri<strong>ch</strong> von Bern verfolgt wird, breitet ihm am Meeresufer seine<br />
Ahnfrau Wakhild die Arme rettend entgegen und nimmt ihn auf.<br />
Weinhold, Riesen 66. Die Fis<strong>ch</strong>steine beziehen si<strong>ch</strong> demna<strong>ch</strong> auf<br />
Nixensagen. Es ist eine bekannte Vorstellung, wie die Nixen in<br />
vollständiger Hauswirths<strong>ch</strong>aft leben, aber ihr Bedürfniss an Fleis<strong>ch</strong><br />
bei den Mens<strong>ch</strong>en einkaufen müssen. Die Nixe von Trotha wurde<br />
dabei einmal von dem Fleis<strong>ch</strong>er, vor dessen Laden sie stand, an<br />
ihrem nassen Rocksaume erkannt, und während sie mit dem Finger<br />
auf das Stück Fleis<strong>ch</strong> hinwies, von dem sie zu kaufen wüns<strong>ch</strong>te,<br />
hieb er ihr mit dem Beil die Hand ab. Während na<strong>ch</strong>her der<br />
Metzger über Land gieng und einem losbre<strong>ch</strong>enden Regenwetter<br />
entkommen wollte, musste er zur Strafe in einen geringen Strassengraben<br />
stürzen und drinn ertrinken. Sommer, Thüring. Sag.<br />
no. 35. Rückert erzählt dasselbe in den Gesamm. Ged. 3, 188<br />
aus eigener Erinnerung vollständiger :<br />
Ein Nixlein hatt' au<strong>ch</strong> Fleis<strong>ch</strong> gewollt,<br />
Do<strong>ch</strong> fand's in seinem Fluss kein Gold.<br />
Da nahm's vom Karpfen S<strong>ch</strong>uppen blank,<br />
Trug sie in's Dorf zu Metzgers Bank,<br />
Er stri<strong>ch</strong> für baare Münz es ein<br />
Und fand die S<strong>ch</strong>uppen hinterdrein.<br />
Dieser Trug wiederholt si<strong>ch</strong> dreimal, zum vierten Male aber be¬<br />
tra<strong>ch</strong>tet der Metzger die Nixe genau, sieht, dass ihr Rocksaum<br />
wassernass ist, und während sie die S<strong>ch</strong>uppen auf die Bank wirft<br />
und na<strong>ch</strong> dem Fleis<strong>ch</strong>e langt, haut er ihr die Finger ab. Auf das<br />
Ges<strong>ch</strong>rei kommen alle Nixen, um das Blut der S<strong>ch</strong>wester wegzuwas<strong>ch</strong>en,<br />
was<strong>ch</strong>en um's Haus, bis dies einstürzt, was<strong>ch</strong>en um's<br />
ganze Dorf, bis es vom Wasser vers<strong>ch</strong>lungen ist. Heute no<strong>ch</strong><br />
steht in böhmis<strong>ch</strong> ßrandeis der Glaube an den Wassermann, der<br />
dort in der Elbe wohnt und mit Fis<strong>ch</strong>en handelt, so fest, dass man<br />
fremden Leuten, die Fis<strong>ch</strong>e dorthin zum Verkaufe bringen, immer
53<br />
erst auf die Rocktas<strong>ch</strong>en sieht, ob sie trocken sind. Grohmann,<br />
Böhm. Sagb. 1, 155.<br />
Der<br />
gesalbte Stein.<br />
Warum wohl pflegt man die Marktbutter in Form eines Wetz¬<br />
steines bei uns zum Verkaufe zu bringen Handgreifli<strong>ch</strong> freili<strong>ch</strong><br />
deshalb, weil der Stein Sense und Si<strong>ch</strong>el wetzen hilft zum Grasund<br />
Korns<strong>ch</strong>nilt; in Wahrheit aber, weil die Nomaden- und Hirten¬<br />
zeit den Stein salbte und mit Butter bes<strong>ch</strong>mierte zum Opfer für die<br />
Gottheiten, denen man den Mil<strong>ch</strong>- und Buttergewinn verdankte.<br />
Das classis<strong>ch</strong>e Alterthum s<strong>ch</strong>on zerbra<strong>ch</strong> si<strong>ch</strong> den Kopf über die<br />
Frage, in wiefern in Hellas der Steincultus als ältester anzusehen<br />
und wel<strong>ch</strong>e ursprüngli<strong>ch</strong>e Idee ihm zu unterlegen sei. Der Alt¬<br />
gott Kronos war als ein steinfressender Riese geda<strong>ch</strong>t; jener ver¬<br />
s<strong>ch</strong>lungene und wieder von ihm gegangene Stein war in der Nähe<br />
des delphis<strong>ch</strong>en Tempels aufgestellt, ein Zei<strong>ch</strong>en zu sein und ein<br />
Wunder fortan den sterbli<strong>ch</strong>en Mens<strong>ch</strong>en ". Von diesem Kronos-<br />
Mythus äussert Herodot 8. 8, 2: Er selbst habe im Beginne seiner<br />
S<strong>ch</strong>rift diesen Sagen der Hellenen die grösste Einfältigkeit vorge¬<br />
worfen; da er aber auf seiner Reise weiter gegen Arkadien ge¬<br />
kommen, habe cr hier den Gedanken fassen gelernt, es mö<strong>ch</strong>ten<br />
die so weisen Hellenen ihre Sagen ni<strong>ch</strong>t geradaus, sondern wohl<br />
mittelst räthselhafter Einkleidung zu erzählen gewohnt sein, und<br />
nun vermuthe er, dass eben das über Kronos Gesagte wirkli<strong>ch</strong><br />
Weisheit enthalte. Herodot vermuthete hier das Ri<strong>ch</strong>tige, aus¬<br />
spre<strong>ch</strong>en konnte er es ni<strong>ch</strong>t. Den mit Oel begossenen und mit<br />
geweihter Wolle umwundenen Opferstein, wie ein sol<strong>ch</strong>er nieder¬<br />
gelegt war am delphis<strong>ch</strong>en Altare, nannte man Baitylos, ein Name,<br />
wel<strong>ch</strong>er spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> und ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> Syrien und Phönicien ge¬<br />
hörte. Hier ers<strong>ch</strong>eint er als jener Stein Bethel, das Haus Gottes",<br />
den der Patriar<strong>ch</strong> Jakob erri<strong>ch</strong>tet und mit Oel salbt, ein Steinfetis<strong>ch</strong><br />
aus der vormosais<strong>ch</strong>en Religion : Jakob nahm den Stein, legt ihn<br />
hin als Mal und goss Oel darauf. 1. Mose 28, 18. Der Grie<strong>ch</strong>e<br />
leitete den Namen Bethel, Baitylos fäls<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> ab von ßaizrj, das<br />
Bauernkleid aus Ziegenfellen (oberdeuts<strong>ch</strong> der Pfait, Unterkleid),<br />
weil jener von Kronos vers<strong>ch</strong>lungene Stein listiger Weise mit<br />
Wolle und Ziegenfell so umwickelt gewesen sei, dass der Gott ihn<br />
habe wieder erbre<strong>ch</strong>en müssen. Allein die Gewitterwolke ist dem<br />
Grie<strong>ch</strong>en selbst eine feurige Ziege Chimaira, dem Psalmisten ist<br />
sie glei<strong>ch</strong>falls lautere Wolle; vom Meteor- und Regenstein Baitylos<br />
also sollte die Fru<strong>ch</strong>tbarkeit des Bodens und die Fette der Heer-
54<br />
den ausgehen, zum Opfer wurde er daher selbst mit Fett und Oel<br />
begossen. So war au<strong>ch</strong> der Stein der Kybele aus Kleinasien mit<br />
Zustimmung des pergamenis<strong>ch</strong>en Königs Attalus na<strong>ch</strong> Rom gebra<strong>ch</strong>t,<br />
hier unter dem Namen der grossen Göttermutter in seinen eigenen<br />
Tempel gestellt worden, und in dem Jahre, da dies ges<strong>ch</strong>ah, ver¬<br />
si<strong>ch</strong>ert Plinius N. G. 18, cap. 4, soll die Ernte ergiebiger gewesen<br />
sein, als in allen zehn vorhergegangenen zusammen. Dieser Stein<br />
zu Rom und jener zu Delphi weisen auf die Nomadenzeit zurück,<br />
da die Götter no<strong>ch</strong> steins<strong>ch</strong>leudernde, cyklopis<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>afhirten des<br />
Gebirges sind. Homers mens<strong>ch</strong>enfressender Polyphem, sowie die<br />
eddis<strong>ch</strong>en Bergriesen und die Wilden Männer der Alpensagen<br />
glei<strong>ch</strong>en si<strong>ch</strong> gegenseitig in ihrer ursprüngli<strong>ch</strong>en Grausamkeit und<br />
Gutmüthigkeit. Die Riesen im Gasteiner Thaïe stellen den Mens<strong>ch</strong>en<br />
Butter und Mil<strong>ch</strong> vor die Hausthüre; also eben das, was ihnen der<br />
Mens<strong>ch</strong> ursprüngli<strong>ch</strong> selbst opferte. Eine Gattung S<strong>ch</strong>iefersteine<br />
heisst in Norwegen Jyvrikling, der Fels (Kling) der Riesin Jyvri,<br />
weil sie ihn mit Butter bes<strong>ch</strong>miert und ihre Finger drein gedrückt<br />
hat. Der butterges<strong>ch</strong>mierte Stein wurde aber ni<strong>ch</strong>t von der Riesin,<br />
sondern für sie bestri<strong>ch</strong>en, und wie das Heidenthum hl. Bilder mit<br />
Oel und Fett salbte, so wurde na<strong>ch</strong>mals no<strong>ch</strong> das Herdbild am Tage<br />
Pauls Bekehrung, wenn es einen hellen, liebli<strong>ch</strong>en Tag bra<strong>ch</strong>te,<br />
mit Butter ges<strong>ch</strong>miert, sonst aber vom Backherd gestossen und in's<br />
Wasser geworfen. Myth. 513. 524. Fast jedes höher gelegene<br />
Berggut in unserm Jura benennt seine paar örtli<strong>ch</strong>en Felsblöcke<br />
mit dem wiederkehrenden Namen :<br />
Ankeballen, Ankefluh, Anken¬<br />
kübel, Ankenbälmli; gewöhnli<strong>ch</strong> mit dem Beisatze, wie einst hier<br />
Riese oder Hexe vergebli<strong>ch</strong> gebuttert und im Zorn alles Geräthe<br />
na<strong>ch</strong> drei Seiten vers<strong>ch</strong>leudert habe : In's Thal hinab den Rühr¬<br />
stock, auf die Bergmatte den Deckel, auf die Fluh hinauf den Rühr¬<br />
kübel. So erwähnt au<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>önwerth 2, 249. 250 einzelner Felsen<br />
im Fi<strong>ch</strong>telgebirge bei Neustadt, auf denen je ein kleinerer als Deck¬<br />
stein ruht, unter dem Namen Des Teufels Butterfass. Nä<strong>ch</strong>stver¬<br />
wandt mit sol<strong>ch</strong>en Benennungen der Felsblöcke ist der glei<strong>ch</strong>falls<br />
allenthalben wiederkehrende Volksglaube, alles bei ihnen an S<strong>ch</strong>er¬<br />
ben und Kno<strong>ch</strong>enresten Hervorgegrabene oder Aufgefundene müsse,<br />
wie sie selbst, heilbringend wirken. Die irdenen Grabtöpfe in nie¬<br />
derdeuts<strong>ch</strong>en Hügelgräbern s<strong>ch</strong>reibt man den Unterirdis<strong>ch</strong>en bei<br />
und nennt sie önnerersk potljüg, im Saterlande ölkerpött, Krug der<br />
Unterirdis<strong>ch</strong>en. Man gebrau<strong>ch</strong>t sie als Melkges<strong>ch</strong>irr, weil die Mil<strong>ch</strong><br />
drinnen fetter rahmt und mehr Butter ergiebt. Müllenhoff, S<strong>ch</strong>lesw.-<br />
Holst. Sag. no. 385. In Steiermark gilt das Berühren bes<strong>ch</strong>riener
55<br />
Hausthiere mit sol<strong>ch</strong>erlei in Heidenkogeln" gefundenen Gefässs<strong>ch</strong>erben<br />
für heilkräftig. Mittheil, des Steiermark, histor. Vereins<br />
1861, Heft 10, 267. Im Aargau bringen sie dem Finder unbe¬<br />
greifli<strong>ch</strong> ras<strong>ch</strong>en Wohlstand in die Bauernwirths<strong>ch</strong>aft Aarg. Sag. 2,<br />
:<br />
pg. 248.<br />
Verfolgt man die Vorstellungen vom gesalbten und gefetteten<br />
Opferstein, vom versteinerten Butterfass der Riesen, von den ver¬<br />
steinerten Broden des Teufels und ähnli<strong>ch</strong>en sagenhaften Mühl¬<br />
steinen oder Spinnwirteln, die der Satan oder seine Hexe auf dem<br />
Felsengrat des Gebirges weggeworfen, so führt ein in ihnen still¬<br />
liegender landwirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>er Gedanke über auf des Riesenmähers<br />
Wetzstein; der Donnergott wird zum Erntegott, sein Strahlstein<br />
zum si<strong>ch</strong>els<strong>ch</strong>ärfenden S<strong>ch</strong>leifstein. In Island nennt man jetzt no<strong>ch</strong><br />
eine bestimmte Art von S<strong>ch</strong>leifsteinen Thursaberg, Riesenberg.<br />
Maurer, Island. Sag. 36. Die Riesen werden also als Heumäher<br />
geda<strong>ch</strong>t. Von den uralten herrenlosen Wetzsteinen, die haufen¬<br />
weise unter dem Laub der Ho<strong>ch</strong>waldungen im Jura und im Frei¬<br />
amte gefunden und vom Landvolke begierig aufgekauft werden,<br />
beri<strong>ch</strong>ten die Aarg. Sag. 1, pg. 133. Der Mäher kauft und ge¬<br />
brau<strong>ch</strong>t sie als unbezahlbar gute Wetzsteine, Krämer und Aufkäufer<br />
feils<strong>ch</strong>en darum mit kaum geringerer Begierde, als wie jene neun<br />
Mäherkne<strong>ch</strong>te des Bergriesen Baugi thäten. Der wandernde Odhinn<br />
hatte sie bei der Mahd getroffen, zog seinen Wetzstein aus<br />
dem Gürtel und wetzte ihnen die Si<strong>ch</strong>eln. Als nun jeder den<br />
Wunderstein einzuhandeln verlangte, warf ihn der Gott in die Luft,<br />
und indem sie ihn um die Wette aufzufangen su<strong>ch</strong>ten, s<strong>ch</strong>nitten sie<br />
si<strong>ch</strong> mit den neuges<strong>ch</strong>ärften Si<strong>ch</strong>eln gegenseitig die Hälse ab. Au<strong>ch</strong><br />
in die Specialges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te sind diese Steine übergegangen. In Roeskilde,<br />
der dänis<strong>ch</strong>en Königsgruft, hieng vormals zunä<strong>ch</strong>st dem Grab¬<br />
mal der Königin Margaretha, wel<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>weden eroberte, ein drei<br />
Ellen langer Wetzstein. Zum Spott, hiess es, habe ihn der S<strong>ch</strong>we¬<br />
denkönig Albert ihr zuges<strong>ch</strong>ickt, statt des S<strong>ch</strong>wertes ihre Nähnadeln<br />
dran zu spitzen. Der Stein ward vom König Karl Gustav na<strong>ch</strong><br />
S<strong>ch</strong>weden fortgenommen und dorten in der Domkir<strong>ch</strong>e zu Upsala<br />
verwahrt. Zedier, Univ.-Lexic. 32, 1235. Glei<strong>ch</strong>es ma<strong>ch</strong>t si<strong>ch</strong> in<br />
der altern Berner Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te geltend. Der Bis<strong>ch</strong>of Johann von<br />
Vienne, den die Berner dur<strong>ch</strong> mehrere Kriegszüge in seinen<br />
Sprengel gezü<strong>ch</strong>tigt hatten, erlaubte si<strong>ch</strong> die Drohung, er wolle<br />
auf Bern ziehen und dorten den Stadtwald Bremgarten an der<br />
Aare niederhauen. Zum Hohne hiengen die Bürger S<strong>ch</strong>leifsteine<br />
an vers<strong>ch</strong>iedenen Orten im Walde auf, damit des Bis<strong>ch</strong>ofs Leute
56<br />
ihre Beile dran s<strong>ch</strong>leifen könnten. Bern. Neujahrsbl. 1825, 12. Der<br />
Weiberwetzstein hieng zu Kalten-Westheim an der Rhön als Wahr¬<br />
zei<strong>ch</strong>en des Ortes und Niemand durfte an ihm wetzen. That es<br />
Einer aus Unkunde oder Muthwillen, so kamen die Weiber herbei,<br />
tau<strong>ch</strong>ten ihn und liessen ihn nur gegen eine Geldbusse los. Die<br />
Weiber hatten dies Privilegium seit dem J. 1463, wo sie zur Ortsvertheidigung<br />
mithalfen. Wa<strong>ch</strong>smuth, Ges<strong>ch</strong>. deuts<strong>ch</strong>. Nationalität<br />
1, 166. Das Basler Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t Wettstein, das seit dem Osna¬<br />
brücker Frieden der Stadt man<strong>ch</strong>en Bürgermeister geliefert hat,<br />
benennt si<strong>ch</strong> glei<strong>ch</strong>falls na<strong>ch</strong> dem Wetzstein. Sol<strong>ch</strong>erlei Bezie¬<br />
hungen auf rein historis<strong>ch</strong>e Begebenheiten werden wieder aufge¬<br />
hoben dur<strong>ch</strong> die Sagen vom Hahn. Dieses dämonis<strong>ch</strong>e Feuer- und<br />
Gewitterthier trägt na<strong>ch</strong> dem friesis<strong>ch</strong>en Volksräthsel (Alemann.<br />
Kinderlied pg. 229) in beiden Krallen einen Hammer und einen<br />
S<strong>ch</strong>leifstein, die eddis<strong>ch</strong>en Attribute Thôrrs. Er hat ferner ebenda<br />
no. 379 381 in der linken Kralle einen S<strong>ch</strong>leifstein, einen weissen<br />
Stein im Kopfe, vers<strong>ch</strong>lingt Mühle und Mühlstein und wird zuletzt<br />
mittelst eines auf ihn gestürzten Mühlsteines amtli<strong>ch</strong> hingeri<strong>ch</strong>tet.<br />
Dies besagt<br />
: Mit dem Korns<strong>ch</strong>nitt, der unter Thôrrs S<strong>ch</strong>utze steht,<br />
sind au<strong>ch</strong> die sommerli<strong>ch</strong>en Ho<strong>ch</strong>gewitter vorbei, die der Hahn mit<br />
seinem zunderrothen Kamme bekräht, und das Ges<strong>ch</strong>äft des Wetter¬<br />
vogels ist zu Ende. Heuhahne und Krähhahne nennt man dem¬<br />
gemäss in der S<strong>ch</strong>weiz das Festmahl na<strong>ch</strong> beendigter Heu- und<br />
Kornernte, anderwärts ist damit au<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> das S<strong>ch</strong>nitterspiel des<br />
Hahnengreifens und Hahnens<strong>ch</strong>lagens verbunden. In Hannover<br />
giebt es zu ähnli<strong>ch</strong>em Zwecke dann die Gasterei des Bräuhahns,<br />
in Altbaiern die des Saathahns, und na<strong>ch</strong> der friesis<strong>ch</strong>en Bohnen¬<br />
ernte bekommen die S<strong>ch</strong>nitter das Mahl des Bohnenhahns. Wa<strong>ch</strong>s¬<br />
muth, Ges<strong>ch</strong>. deuts<strong>ch</strong>er Nationalität 2, 106. Bei Mecklenburger<br />
Erntebräu<strong>ch</strong>en ruft man singend dem Wold und Wouden. Wuotan-<br />
Odhinn war nämli<strong>ch</strong> selbst Erntegott, wie na<strong>ch</strong>mals sein Sohn Thunar;<br />
als Vater musste er also den Donnerkeil vorausges<strong>ch</strong>leudert<br />
haben ; er heisst daher in den Eddaliedern selbst Thundr und wirft<br />
den S<strong>ch</strong>legel, wie Thôrr den Hammer. Myth. 1206.<br />
Die Heilsteine.<br />
Felsen, deren bewegli<strong>ch</strong>en Deckstein man zu Heilzwecken er¬<br />
klettert und in deren Eindrücke man kranke Glieder legt, oder<br />
Klüfte, dur<strong>ch</strong> deren Enge man s<strong>ch</strong>lüpft und krie<strong>ch</strong>t, tragen den<br />
Namen Heilstein, Helfenstein. Jede Frau wird heil, sagt darüber<br />
die Edda, und wäre sie s<strong>ch</strong>on ein Jahr krank, die den Hyfjaberg
57<br />
erklimmt. Der Helfenstein im Fi<strong>ch</strong>telgebirge ist ein gewöhnli<strong>ch</strong>er<br />
Granitfels, auf dem ein kleinerer ruht (S<strong>ch</strong>önwerth, Oberpfälz. Sag.<br />
2, 244). Aus dem Namen Helf holz in Westfalen ist später ein<br />
St. Hülpe und St. Gehelfe gema<strong>ch</strong>t worden. Kuhn, Westfäl. Sag. 1,<br />
pg. 21. Auf dem Wege vereinzelter Namensumwandlungen sol<strong>ch</strong>er<br />
Art su<strong>ch</strong>te die Kir<strong>ch</strong>e den deuts<strong>ch</strong>en Paganismus allmähli<strong>ch</strong> zurück¬<br />
zudrängen und seine Superstitionen dur<strong>ch</strong> eine ihm unterlegte<br />
<strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>e Beziehung zu mildern. Wrollte ein sol<strong>ch</strong>er Versu<strong>ch</strong> im<br />
Einzelnen ni<strong>ch</strong>t fru<strong>ch</strong>len, so musste freili<strong>ch</strong> der örtli<strong>ch</strong>e Heiden¬<br />
brau<strong>ch</strong> gänzli<strong>ch</strong> verboten und als Teufelsdienst verdammt werden.<br />
Hierinn liegt mit ein Grund, dass der Name Heilstein seltener, der<br />
Name Teufelsstein um so häufiger geworden ist. Ein Vorsprung<br />
des Teufelsfclsens an der baieris<strong>ch</strong>en Donau heisst Teufelskanzel,<br />
und gerade bei dieser hat si<strong>ch</strong> der eingreifende Zug erhalten, dass<br />
man ihr heilkräftige Wirkung beimass. Wer mit Kreuzweh oder<br />
cinem Bru<strong>ch</strong> behaftet war, wurde gesund, wenn er dur<strong>ch</strong> das<br />
Lo<strong>ch</strong> dieses Felsens s<strong>ch</strong>lof oder si<strong>ch</strong> hindur<strong>ch</strong>ziehen liess. Dies<br />
nannte man bögein (dur<strong>ch</strong> den Steinbogen gehen), und jetzt no<strong>ch</strong><br />
pflegt man zu sol<strong>ch</strong>erlei Patienten s<strong>ch</strong>erzhaft zu sagen : Lass di<strong>ch</strong><br />
bögein Panzer, Baier. Sag. 2, 428.<br />
I<strong>ch</strong> beginne mit denjenigen wildliegenden Felsblöcken der<br />
S<strong>ch</strong>weiz, die man no<strong>ch</strong> als Heilsteine wirkli<strong>ch</strong> kennt, um mit<br />
denen zu s<strong>ch</strong>liessen, an die si<strong>ch</strong> ein kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>-religiöser Glaube<br />
bis auf die Neuzeit geknüpft hat.<br />
Die Höhle bei Corneaux im Neuenburger Jura, unfern der<br />
Berner Grenze gelegen, ist eine Felsengrotte, in deren Oeffnung<br />
eine Steinbank liegt, im Hintergrunde derselben aber ein isolirter<br />
Felsblock aufragt in Form eines den Arm ausstreckenden Mannes.<br />
Vielerlei um die Bildsäule herumliegende Rollsteine nennt man<br />
Krüge und Vasen, als ob man mit ihnen das Wasser der minera¬<br />
lis<strong>ch</strong>en Quelle zu s<strong>ch</strong>öpfen hätte, die nebenan aus der Wand rie¬<br />
selt. Die Bildsäule ist der versteinerte Zauberer, der von hier aus<br />
die Mön<strong>ch</strong>e der Ablei von Landeron verfolgte, sie in seine Höhle<br />
s<strong>ch</strong>leppte und zerstückelte, s<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> aber von dem Basler Bi¬<br />
s<strong>ch</strong>of mittelst des Leibrockes ers<strong>ch</strong>lagen und mit Allem in Stein<br />
verwandelt wurde. Um die Höhle hierauf von Mord und Blut zu<br />
reinigen, s<strong>ch</strong>lug der Bis<strong>ch</strong>of an die Felsenwand, und ein kleiner<br />
Heilquell sprudelt seitdem hervor. Davon heisst der Ort die Höhle<br />
der Genesung, caverne de la guerison, sonst au<strong>ch</strong> caverne du<br />
sorcier. Brustleidende giengen ehemals hieher, spuckten dreimal<br />
gegen die Bildsäule und nahmen im Quell ein Fussbad. Heute
58<br />
no<strong>ch</strong> holt si<strong>ch</strong> der an Rheumatismen Leidende einen jener krug¬<br />
ähnli<strong>ch</strong>en Steine, wärmt ihn und legt ihn zu si<strong>ch</strong> in's Bett. Man<br />
zerstösst ihn au<strong>ch</strong> und giebt ihn im Wasser jener Quelle kranken<br />
Stallthieren zu trinken.<br />
Der Pierre percée liegt auf einem Hügel zwis<strong>ch</strong>en Pruntrut und<br />
Courgenay im bernis<strong>ch</strong>en Jura. Der aufre<strong>ch</strong>tstehende Fels hat<br />
10 Fuss Höhe und 5 Breite und ist künstli<strong>ch</strong> in einen andern Stein<br />
eingelassen, der wagre<strong>ch</strong>t unter dem Boden liegt. S<strong>ch</strong>on im vori¬<br />
gen Jahrhundert ist diese künstli<strong>ch</strong>e Grundlage dur<strong>ch</strong> den Gelehrten<br />
Dunod ermittelt worden. In der Mitte hat der Fels eine Oeffnung<br />
von 15 Zoll Dur<strong>ch</strong>messer, die ihm den Namen des dur<strong>ch</strong>bohrten<br />
Steines gegeben hat. Dur<strong>ch</strong> dieselbe pflegen die Umwohnenden<br />
theils den Kopf zu stecken, um von Kopf- und Zahnweh befreit zu<br />
werden, theils neugeborene Kinder zu s<strong>ch</strong>ieben, in dem Glauben,<br />
dass denselben dann ihr Leben lang kein Leid widerfahre. Bis auf<br />
die jüngste Zeit hatte neben diesem Fels eine Linde gestanden,<br />
die hier den ausgedehntesten Geri<strong>ch</strong>tssitz des Eisgaues (pagus Elsgaugiensis)<br />
bezei<strong>ch</strong>nete und unter der s<strong>ch</strong>on seit dem 13. Jahr¬<br />
hundert geurkundet worden war. Die antiquaris<strong>ch</strong>en Untersu<strong>ch</strong>un¬<br />
gen der Jurassier bes<strong>ch</strong>äftigen si<strong>ch</strong> besonders gerne mit der Na<strong>ch</strong>¬<br />
weisung einzelner in Cäsars gallis<strong>ch</strong>em Kriege genannten Localitäten,<br />
und so hat Abbé Sérasset in seinem zweibändigen Werke<br />
über den französis<strong>ch</strong>en Jura den Stein als diejenige Stelle be¬<br />
s<strong>ch</strong>rieben, an wel<strong>ch</strong>er Cäsar und Ariovist ihre Verhandlung vor<br />
der S<strong>ch</strong>la<strong>ch</strong>t (lib. 1, cap. 43) abgehalten hätten. Die Sage fügt<br />
bei, beide Feldherren hätten damals dur<strong>ch</strong> das Lo<strong>ch</strong> des Felsens<br />
si<strong>ch</strong> die Hand geboten; diese Tradition hat in so ferne Sinn, als<br />
man unumstössli<strong>ch</strong>e Beweise besitzt, dass sol<strong>ch</strong>erlei Menhirs in der<br />
S<strong>ch</strong>weiz no<strong>ch</strong> zur Zeit der römis<strong>ch</strong>en Herrs<strong>ch</strong>aft erri<strong>ch</strong>tet worden<br />
sind. Vgl. Ferd. Kellers Pfahlbauten, dritter Beri<strong>ch</strong>t 1860, VUI.<br />
Hinter dem Chor der Wallfahrtskir<strong>ch</strong>e zu Beinwyl im Freiamte<br />
ist im Kir<strong>ch</strong>enboden eine Oeffnung, die in die Gruft des hier be¬<br />
statteten hl. Burkhard hinabmündet. Die Presthaften wallfahrten hie¬<br />
her und hängen ihre erkrankten Glieder zur Heilung in diese Oeff¬<br />
nung des Bodens. Unten in der Gruft entspringt der Burkhards¬<br />
brunnen, dessen Wasser gegen Fieber getrunken wird. Von dieser<br />
Wallfahrt handeln : 1. Der Selige Priester Bur<strong>ch</strong>ard, gewesster<br />
Pfarrherr zu Beinwyl. Gedruckt Zug bey Hiltensperger 1743;<br />
2. Inscriptio ad sepul<strong>ch</strong>rum D. Bur<strong>ch</strong>ardi in Beinwil. Tugii, typis<br />
S<strong>ch</strong>ell 1734. Diesen zwei Flieg. Blättern sind beigegeben ein La¬<br />
teingedi<strong>ch</strong>t und ein deuts<strong>ch</strong>es Fahrtlied, letzteres anfangend Im<br />
:
59<br />
Freyen Ambt<br />
|<br />
zu Langenmatt Bur<strong>ch</strong>ardus war geboren. Das Lied<br />
erwähnt, dass man dur<strong>ch</strong> den in der Gruft offen gelegenen Stein¬<br />
sarg hindur<strong>ch</strong>kro<strong>ch</strong> :<br />
Da s<strong>ch</strong>lieffen dur<strong>ch</strong> das hohle Grab<br />
die si<strong>ch</strong> kaum können regen.<br />
Dieselbe Angabe wiederholt si<strong>ch</strong> in den Lateinreimen :<br />
Juxta tumnlum steil tumba, Prope est videre locum<br />
concava e saxis strueta, in terrain rotunde fossum,<br />
per quam /egri quando replant quo, qui pedes claudos inferi,<br />
mir am opem inde portant. saepe gressum rectum re fer t.<br />
Extra lemplum fons videtur<br />
et in pretio habetur,<br />
qui Bur<strong>ch</strong>ardi dicitur,<br />
unde Salus bibilur.<br />
So ist au<strong>ch</strong> der Angelsa<strong>ch</strong>sen Grab zu Sarmenstorf, worin diese<br />
drei Lands<strong>ch</strong>aftsheiligen ursprüngli<strong>ch</strong> bestattet waren, ein Gewölbe<br />
7<br />
von Fuss Länge und 4 Breite, in das eine Steintreppe hinab¬<br />
führt. Gegen Kopfleiden lässt man den Deckstein wegheben, steigt<br />
hinab und betet drinnen. Der Steinsarg selbst, in dem die Hei¬<br />
ligen gelegen haben sollen, befindet si<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t mehr in jenem<br />
Gruftgewölbe, sondern wurde in die Wendelinskapelle versetzt.<br />
Das ehemalige öffentli<strong>ch</strong>e Bad der Stadt Baden war na<strong>ch</strong> der hl.<br />
Verena, deren Bildniss dorten aufgestellt stand, Verenabad ge¬<br />
nannt. In dem Steinboden des offenen Bassins stand ein Lo<strong>ch</strong><br />
offen, das Verenalo<strong>ch</strong>, dur<strong>ch</strong> wel<strong>ch</strong>es der Sprudel der heissen<br />
Quelle unmittelbar aufsteigt. Das Badhaus wurde später abgetragen<br />
und der Sprudel sammt dem hohlen Steine kapellenartig eingebaut.<br />
Damit ist folgende Sitte mit vers<strong>ch</strong>wunden, deren allgemeine Gil<br />
tigkeit no<strong>ch</strong> aus unserm Jahrhundert bezeugt ist. Diejenige Ehe¬<br />
frau nämli<strong>ch</strong>, die si<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> einem Erben sehnte, liess si<strong>ch</strong> hier<br />
des Na<strong>ch</strong>ts ungesehen Zutritt vers<strong>ch</strong>affen, senkte ein Bein in die<br />
Höhlung hinab und glaubte nun an die Erfüllung ihrer Wüns<strong>ch</strong>e.<br />
So ist au<strong>ch</strong> bei der Quelle Groosbeck zu Spaa ein Fusstritt ausge¬<br />
hauen, in den si<strong>ch</strong> zu glei<strong>ch</strong>em Zwecke unfru<strong>ch</strong>tbare Frauen hin¬<br />
einstellen unter Anrufung des hl. Remaclus. Wolf, Ndl. Sag. 227.<br />
Alle Freitage im Mai bringen die Mütter ihre Kinder an's St. Gallengrab<br />
in der Pfarrkir<strong>ch</strong>e des solothurn. Dorfes Wangen (bei<br />
Ölten) und stellen sie in das dortige offene Steingrab. Strohmeier,<br />
Kant. Solothurn 266. In der Pfarrkir<strong>ch</strong>e von s<strong>ch</strong>wyzeris<strong>ch</strong> Wollerau<br />
heisst ein Grabgewölbe Unser L. Frauen End; hier hinein<br />
treten die Mütter neunmal, ihr erkranktes Kind auf dem Arme.
60<br />
Bei Allawinden, Kant. Zug, steht neben einer Kapelle ein Nagel¬<br />
fluhstück von der Höhe eines gewöhnli<strong>ch</strong>en Gemarkungssleines. In<br />
seiner obern s<strong>ch</strong>iefen Flä<strong>ch</strong>e trägt er eine glatte, knieförmige Aus¬<br />
höhlung, die bloss dur<strong>ch</strong> das Anreiben erkrankter Gliedmassen so<br />
glatt und tief geworden sein soll. Bei Einsiedeln am Berge St. Jost<br />
liegt ein grosser Feldstein, dur<strong>ch</strong> dessen Mitte eine Rinne geht:<br />
Zieht hier der Wallfahrer seinen S<strong>ch</strong>uh dur<strong>ch</strong>, so ermüdet er ni<strong>ch</strong>t,<br />
wenn er alle Stationen des Jostberges zusammen besteigt. Lindinncr,<br />
Index memorabil. helvet. 1684. Glei<strong>ch</strong>es erzählt man beim<br />
Kloster Ihlefeld im Harz vom Nadelöhr :<br />
Alle Kne<strong>ch</strong>te, die hier vor¬<br />
bei zum ersten Male in die Harzwaldungen fahren, müssen dreimal<br />
diesen dur<strong>ch</strong>bro<strong>ch</strong>enen Felsen dur<strong>ch</strong>krie<strong>ch</strong>en und werden dabei von<br />
den Mitgesellen mit der Peits<strong>ch</strong>e gegeisselt. Harrys, Ndsä<strong>ch</strong>s. Sag.<br />
2, no. 37.<br />
Einige verwandte Fälle aus den bena<strong>ch</strong>barten oberdeuts<strong>ch</strong>en<br />
Lands<strong>ch</strong>aften mögen s<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> dazu dienen, die eben angeführten<br />
Beispiele no<strong>ch</strong> gewi<strong>ch</strong>tiger ers<strong>ch</strong>einen zu lassen.<br />
Bei s<strong>ch</strong>wäbis<strong>ch</strong> Immenried liegt im sog. Windhang ein Stein<br />
mit der eingedrückten Fussspur des hl. Ratper. Die Vorbeigehen¬<br />
den setzen ihren Fuss in diese Höhlung in dem Glauben, man<br />
könne dann ni<strong>ch</strong>t müde werden. Die glei<strong>ch</strong>e Meinung gilt von<br />
dem Steine im Kir<strong>ch</strong>lein zu Rethsee. Birlinger, S<strong>ch</strong>wab. Sag. 1,<br />
no. 635. Wer dur<strong>ch</strong> das Lo<strong>ch</strong> des Steinaltares der hl. Corona in<br />
Koppenwal s<strong>ch</strong>lüpft, bleibt in der Ernte frei von Kreuzweh; wer<br />
dur<strong>ch</strong> den Stein der Wolfgangskapelle in Österrei<strong>ch</strong>. Falkenstein<br />
s<strong>ch</strong>lüpft, hat eine glückli<strong>ch</strong>e Entbindung. Panzer, Baier. Sag. 2,<br />
84. 431. Das Steindenkmal des hl. Nonnosius in der Krypta des<br />
Freisinger Doms wird ebenfalls gegen Kreuzweh dur<strong>ch</strong>kro<strong>ch</strong>en;<br />
auf den daneben stehenden Petersstein legen die Landleute ihre<br />
mit Frais behafteten Kinder, ein Heilversu<strong>ch</strong>, der, wie sie glau¬<br />
ben, nur auf Leben und Tod geht. In der Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te Freisingens<br />
von Mei<strong>ch</strong>elbeck heisst es darüber: Von alten Zeiten her waren<br />
im Dome die Leute dur<strong>ch</strong> einen Bogen ges<strong>ch</strong>loffen, wenn sie<br />
Rückens<strong>ch</strong>merzen hatten." Die Obrigkeit hatte 1708 den Stein aus<br />
der Kir<strong>ch</strong>e bre<strong>ch</strong>en lassen (Bavaria 1860 I. Erste Hälfte, 465),<br />
allein na<strong>ch</strong> Panzers Baier. Sag. (2, 432) dauerte im J. 1855 der¬<br />
selbe Brau<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> fort, da es daselbst heisst: Es vergeht beinahe<br />
kein Tag, wo ni<strong>ch</strong>t Leute sowohl bei der Nonnosius-Tumba als<br />
au<strong>ch</strong> beim Petersstein Heilung su<strong>ch</strong>en. Wohl das spre<strong>ch</strong>endste<br />
Ueberbleibsel aus der Reihe dieser Heilfelsen ist die Wallfahrts¬<br />
kir<strong>ch</strong>e St. Wolfgang am lnn bei Salzburg. Na<strong>ch</strong>dem man vorher
;<br />
man<br />
61<br />
beim Passiren der mehrfa<strong>ch</strong>en Wallfahrtsstationen bereits dur<strong>ch</strong> ver¬<br />
s<strong>ch</strong>iedene Felsklüfte herkömmli<strong>ch</strong> ges<strong>ch</strong>lüpft ist, gelangt man zu<br />
der ganz in Fels gehauenen Kir<strong>ch</strong>e und kann abermals nur in<br />
gebückter<br />
Stellung dur<strong>ch</strong> einen Felsengang in's Innere hinein. Dieser<br />
Eingang, heisst es, hat die Eigens<strong>ch</strong>aft, dass von ihm jeder Dur<strong>ch</strong>¬<br />
krie<strong>ch</strong>ende, sei er gross oder klein, gedrückt wird. Na<strong>ch</strong> verri<strong>ch</strong>¬<br />
tetem Gebete, wobei man den Altar knieend dreimal umruts<strong>ch</strong>t,<br />
kauft man si<strong>ch</strong> eine Anzahl kleiner geweihter Metalläxte, die in<br />
der Kir<strong>ch</strong>e selbst feilgehalten werden; die einen davon wirft man<br />
opfernd soglei<strong>ch</strong> hinter ein Kapellengitter, und zwar so zahlrei<strong>ch</strong>,<br />
dass sie si<strong>ch</strong> hier zu blitzenden Haufen antliiirmen, die andern<br />
hängt man an den Rosenkranz, zum Andenken an den axts<strong>ch</strong>leu¬<br />
dernden Wolfgang. Denn drei Viertel Stunden von hier entfernt<br />
hatte der Heilige sein Beil in die Lüfte fortges<strong>ch</strong>leudert und dabei<br />
sol<strong>ch</strong>e Gewalt gebrau<strong>ch</strong>t, dass si<strong>ch</strong> am Standplatze seine Füsse in<br />
Stein gedrückt haben; hier, hinter dem Berge, wo er das Beil am<br />
Ufer des lnn wieder liegen fand, glaubte er au<strong>ch</strong> die Stelle ge¬<br />
funden, wo Gott eine Kir<strong>ch</strong>e haben wolle. Wer an Hau- oder<br />
Sti<strong>ch</strong>wunden leidet, verlobt si<strong>ch</strong> hieher, und wenn er den Ort wie¬<br />
der verlässt, ruft er in einiger Entfernung : Heiliger Wolfgang,<br />
darf i<strong>ch</strong> aufs Jahr wiederkommen? Dann giebt es zur Antwort:<br />
Ja! ja! ja! So glauben es hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> die Alten; die Neuen<br />
meinen, es sei das E<strong>ch</strong>o (Panzer, Baier. Sag. 2, 569). Hier klingt<br />
fast der ganze Thôrcultus no<strong>ch</strong> vereint na<strong>ch</strong>, den Sage und Le¬<br />
gende nur trümmerweise zu geben vermag,<br />
St. Wolfgang ers<strong>ch</strong>eint<br />
hier na<strong>ch</strong> allen Seiten als der Stellvertreter des Gottes, der mit¬<br />
telst des Hammerwurfes die Grenzen bestimmt; der den Winter¬<br />
himmel und die Eisdecke des Gebirgsflusses spaltet; dessen Hain<br />
ebenso viele Altäre und Heilsteine hat, als er selbst hier Handund<br />
Fussspuren zurückgelassen; dessen Waldfelsen mit Orakelstimme<br />
reden. Von man<strong>ch</strong>en andern mirakulösen Steinen ist ni<strong>ch</strong>ts<br />
mehr als die Erinnerung übrig, dass sie ihre wunderthätige Kraft<br />
dur<strong>ch</strong> den gröbli<strong>ch</strong>en Missbrau<strong>ch</strong> verloren haben, den die Hab¬<br />
su<strong>ch</strong>t mit ihnen trieb. Alle Kranken genasen, heisst es, die dur<strong>ch</strong><br />
das Lo<strong>ch</strong> in der Mauer der Stappenberger Kir<strong>ch</strong>e kro<strong>ch</strong>en; als<br />
aber ebenso krankes Vieh hindur<strong>ch</strong>krie<strong>ch</strong>en liess, hörte das<br />
Wunder auf und man mauerte das Lo<strong>ch</strong> zu. Kuhn, Nordd. Sag.<br />
no. 148. Hier stirbt der Brau<strong>ch</strong> am entweihenden Missbrau<strong>ch</strong>, wie<br />
das Heidenthum an seinem eigenen rohen Geize. In dem na<strong>ch</strong>¬<br />
folgenden Beispiele aber zeigt si<strong>ch</strong>, dass die geistige Verlassenheit<br />
au<strong>ch</strong> des heutigen Christenmens<strong>ch</strong>en zuweilen jene vergessenen
62<br />
Hilfsmittel des Heidenthums wieder entdeckt, um si<strong>ch</strong> mit ihnen<br />
magis<strong>ch</strong> zu s<strong>ch</strong>irmen oder den mangelnden Geistestrost vorzuzaubern.<br />
Es beri<strong>ch</strong>ten nämli<strong>ch</strong> die Verhandlungen der Ehstnis<strong>ch</strong>en<br />
Gesells<strong>ch</strong>aft (Dorpat 1840, Heft 1) folgende Thatsa<strong>ch</strong>e aus den<br />
Ostseeprovinzen Als dorten : zu Anfang der Dreissiger Jahre die<br />
lutheris<strong>ch</strong>en Prediger aus ihren Gemeinden anhaltend dur<strong>ch</strong> die<br />
russis<strong>ch</strong>en Popen verdrängt wurden, entstand bei dem verna<strong>ch</strong>¬<br />
lässigten Landvolke unter der Hand ein neues Heidenthum. Die<br />
Bauern mieden gemeindeweise jahrelang den ihnen fremden russi¬<br />
s<strong>ch</strong>en Gottesdienst; dafür aber s<strong>ch</strong>lüpften sie dann an Sonntagen<br />
auf der Hutung dur<strong>ch</strong> zerklüftete Weidenbäume.<br />
-Kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Steinalterthümer.<br />
Die Legenden und Sagen von versteinerten Broden hat Wolf,<br />
Beitr. 2, 37 vorübergehend in Berücksi<strong>ch</strong>tigung genommen; sie<br />
sind ni<strong>ch</strong>t blos zahllos, sondern vielfa<strong>ch</strong> von hohem Alter. Man<br />
hat sol<strong>ch</strong>e Wunderbrode aufbewahrt in der Peterskir<strong>ch</strong>e zu Rom,<br />
in der Marienkir<strong>ch</strong>e zu Danzig, in dem Ar<strong>ch</strong>iv der Kir<strong>ch</strong>e zu<br />
Dockum, im Kloster Oliva, im Kloster zu Muri und an vielen an¬<br />
dern Orten. Sie gelten als Zeugnisse der Strafe, die von den um¬<br />
wandernden und bei Mens<strong>ch</strong>en Einkehr nehmenden Göttern ver¬<br />
hängt wird gegen Hartherzige. Allerwärts sind ferner die Sagen<br />
vorhanden von Felsen, die ein Riese oder Teufel fehlgeworfen und<br />
mit den eingeprägten Fingern liegen gelassen hat. Es hat Grimm<br />
einige derselben in seiner Mythologie 512 ausgehoben, um an<br />
ihnen den Ton aller übrigen zu bestimmen; sodann hat Wolf in<br />
den Beiträgen 2, pg. 21 36 no<strong>ch</strong> andere derselben gesammelt<br />
und daran den Na<strong>ch</strong>weis gegeben, dass unter der Hülle des Riesen,<br />
Teufels, Helden oder Heiligen, wel<strong>ch</strong>er die Ma<strong>ch</strong>t hatte, den Felsen<br />
zu s<strong>ch</strong>leudern, Hand- und Fussspur ihm einzuprägen, ihn zu er¬<br />
wei<strong>ch</strong>en oder zu dur<strong>ch</strong>bohren zuglei<strong>ch</strong> der hö<strong>ch</strong>ste Ma<strong>ch</strong>tgott<br />
des Heidenthums, oft Odhinn selbst oder dessen Sohn verborgen<br />
sei. Wir wüns<strong>ch</strong>en nun weder diese Beweisführungen weiter auf¬<br />
zunehmen, no<strong>ch</strong> fernere Beispiele hierüber anzus<strong>ch</strong>liessen, wohl<br />
eingedenk jenes Erfahrungssatzes, der von sol<strong>ch</strong>erlei Stoffanhäufung<br />
sagt: Je grösser der Vorrath an Glei<strong>ch</strong>namigem, um so ge¬<br />
wisser die Ermüdung des Lesers und um so geringer seine Er¬<br />
kenntli<strong>ch</strong>keit. Nur etli<strong>ch</strong>e jener unserm Alpenlande ursprüngli<strong>ch</strong><br />
zugehörenden Heiligen sind zu betra<strong>ch</strong>ten mit ihrer Berge ver¬<br />
setzenden und Felswände spaltenden Geistesma<strong>ch</strong>t, dagegen sind<br />
die der Christenheit allgemein bekannten zu übergehen. Ni<strong>ch</strong>t be
63<br />
spro<strong>ch</strong>en werden daher der Dra<strong>ch</strong>enlödter Mi<strong>ch</strong>ael, der reisige<br />
Martinus, der Protomartyr Stephanus, die den S<strong>ch</strong>wert- oder<br />
Kreuzestod erleidenden Johann Bapt., Petrus und Paulus, sammt den<br />
thebäis<strong>ch</strong>en Legionären, von denen bereits Notker sang, sie seien<br />
die Krieger des Herrn, die mit dem Glaubenss<strong>ch</strong>werte der Wuth<br />
der römis<strong>ch</strong>en Heidenwelt siegrei<strong>ch</strong> trotzten. Näher liegen hier<br />
für persönli<strong>ch</strong>e Erfahrung und Ans<strong>ch</strong>auung die Heiligen Remigius<br />
(Romedi), Beatus, Magnus, Petronella. Um auf die letztgenannte<br />
Heilige zu gelangen, ist zu beginnen mit demjenigen Apostel und<br />
Heiligen, dessen Name Fels heisst, mit Petrus. Ihm ist aufge¬<br />
tragen, auf Erden Bauten zu gründen, uners<strong>ch</strong>ütterli<strong>ch</strong>er und fester<br />
als die Pforten der Hülle; im Himmel aber hat er na<strong>ch</strong> altver¬<br />
bürgtem Volksglauben die Meteor- und Regensteine zu rollen, dass<br />
die Wolken erbeben, si<strong>ch</strong> öffnen und den Regen fallen lassen. Wenn<br />
es donnert und blitzt, sagt man, Petrus wirft goldene Kegel. In<br />
der Ukermark sagt man ebenso bei allzu langem Regenwetter : Gott<br />
ist wieder einmal ni<strong>ch</strong>t zu Hause, sondern Petrus ist am Regieren.<br />
Kuhn, Nordd. Sag., Abgl. 415. Na<strong>ch</strong> Kuhns Mark. Sag. 455. 524<br />
ist Petrus der Soldaten Feind und verfolgt sie auf den Märs<strong>ch</strong>en<br />
dur<strong>ch</strong> Regenwetter. Vgl. Zts<strong>ch</strong>r. f. Myth. 1, 82. Ein baieris<strong>ch</strong>es<br />
Regiment war 1S15 beim Einmärs<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong> Frankrei<strong>ch</strong> mürris<strong>ch</strong><br />
geworden über das lange Regenwetter und hielt den hl. Petrus für<br />
den Urheber desselben. In Ermangelung seiner nahmen sie ein<br />
Nepomuksbild von der nä<strong>ch</strong>sten Brücke, banden es einem der Ka¬<br />
meraden auf den Rücken und liessen es Spiessruthen laufen. Pan¬<br />
zer, Baier. Sag. 2, no. 30. Hört es endli<strong>ch</strong> auf zu regnen, so<br />
sagt unser alemann. Kinderlied :<br />
Petrus wirft seinen S<strong>ch</strong>lüssel über den Rhein :<br />
Morgen soll's gut Wetter sein<br />
Petrus hat also dann das Zickzack seiner Blitzbündel vers<strong>ch</strong>leudert,<br />
wie die Riesin ihre Spindel, die Burgfrau ihren goldenen Zwirn¬<br />
knäuel, die Weisse Frau ihren S<strong>ch</strong>lüsselbund, Thôrr seinen Ham¬<br />
mer, Apoll seinen Pfeil. Als Felsengott den S<strong>ch</strong>lüssel, der den<br />
Wolkenhimmel öffnet, in der Hand führend, steht Petrus jetzo auf<br />
jenem Nagelfluhfelsen in der Wendelinskapelle zu Sarmenstorf, an<br />
dem dorten die drei Angelsa<strong>ch</strong>sen ers<strong>ch</strong>lagen wurden; glei<strong>ch</strong>wie<br />
er neben dem Nonnosiusgrab im Freisinger Münster auf seinem<br />
eigenen Heilstein steht (vgl. den Abs<strong>ch</strong>nitt :<br />
Heilsteine).<br />
Für des Petrus To<strong>ch</strong>ter galt die hl. Petronella no<strong>ch</strong> im J. 1497<br />
zu Rom, als dorten der Ritter Arnold Harff von Köln ihre Kapelle<br />
besu<strong>ch</strong>te. Harffs Pilgerfahrt, 1860 herausgegeben von E. v. Groote.
64<br />
Entweder war des Apostels eheloser Stand damals no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t zu<br />
Rom decretirt, oder der kölnis<strong>ch</strong>e Ritter hatte des Apostels S<strong>ch</strong>we¬<br />
ster für dessen Frau angesehen. In der S<strong>ch</strong>weiz ist Petronella's<br />
Verehrung nahezu glei<strong>ch</strong> alt mit dem Christenthum. U. Campell in<br />
seiner Rhätis<strong>ch</strong>en Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te erwähnt einer Steinins<strong>ch</strong>rift im Chor<br />
der Kir<strong>ch</strong>e von Katzis im Domles<strong>ch</strong>ger Thale; in ihr weihet Victor I.,<br />
aus der rhätis<strong>ch</strong>en Dynastenfamilie der Victoriden, diese neuge¬<br />
baute Kir<strong>ch</strong>e der hl. Petronella : S. Petronella, filia Petri. Gelpke,<br />
S<strong>ch</strong>weiz. Kir<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>. 2, 463. Dieser hier kir<strong>ch</strong>enstiftende rhä¬<br />
tis<strong>ch</strong>e Victor I. ist der Urgrossvater jenes Churer Bis<strong>ch</strong>ofs Tello,<br />
dessen Testament vom J. 766 auf uns gekommen ist. Jenes Frauenklösterlein<br />
auf der Insel Ufnau im Zür<strong>ch</strong>er See, das mit unter die<br />
Stiftungen des iris<strong>ch</strong>en Sendboten Fridolin gehört, ist der hl. Pe¬<br />
tronella geweiht. Züri<strong>ch</strong>. Antiqu. Mittheil. 1843, 13. So ist au<strong>ch</strong> ihr<br />
Cult im innersten Alpengebirge frühzeitig verbreitet. Eine Glocke<br />
im Thurme zu Grindelwald trägt die Ins<strong>ch</strong>rift O. S. Petronella pro<br />
nobis. 1044; sie soll zuerst in jener Kapelle gehangen haben, die<br />
der Sage na<strong>ch</strong> bis 1570 im Thale zwis<strong>ch</strong>en dem Vies<strong>ch</strong>erhorn und<br />
dem Eiger stand, dorten wo jetzt der untere Grindelwaldglets<strong>ch</strong>er<br />
ruht. Meyer-Knonau, S<strong>ch</strong>weiz. Erdkunde 1, 235. S<strong>ch</strong>eu<strong>ch</strong>zer, Itiner.<br />
Alpin. II, 287. Petronella's Grab zeigte man in der Dompeterkir<strong>ch</strong>e<br />
bei Molsheim im Elsass. Stöber, Sag. no. 163. Ihre im Kanton<br />
Tessin sehr zahlrei<strong>ch</strong>en Kapellen stehen meistens in den hintersten<br />
S<strong>ch</strong>neeklüften des Gebirges; Franscini's Tessinis<strong>ch</strong>e Ortsbes<strong>ch</strong>reib.<br />
zählt diese Kir<strong>ch</strong>lein der Reihe na<strong>ch</strong> auf. Aus diesen Anführungen<br />
lässt si<strong>ch</strong> folgern, dass der Petronellencultus in der S<strong>ch</strong>weiz über die<br />
Zeiten zurückrei<strong>ch</strong>t, in die man katholis<strong>ch</strong>er Seits die drei kir<strong>ch</strong>en¬<br />
ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Petronellen versetzt : eine sicilis<strong>ch</strong>e à Velia, eine de<br />
Chemille, f 1000, und eine von Florenz, + 1530. Hiefür steht uns<br />
no<strong>ch</strong> ein besonderer Beweis zu Gebot. Die Acta der Klosterstiftung<br />
von Muri sind daselbst im 13. Jahrhundert ges<strong>ch</strong>rieben worden. In<br />
dem Reliquienverzei<strong>ch</strong>nisse dieser Hands<strong>ch</strong>rift fällt es auf, dass unter<br />
den zu Muri in der Leutkir<strong>ch</strong>e und in der Klosterkir<strong>ch</strong>e hö<strong>ch</strong>st zahl¬<br />
rei<strong>ch</strong> aufbewahrten Heiligthümem fast ni<strong>ch</strong>ts als Steine aufgezählt<br />
werden, und zwar um so zahlrei<strong>ch</strong>er, je dunkler deren Abkunft und<br />
Zweck zu Muri selbst damals s<strong>ch</strong>on gewesen war. Neben man<strong>ch</strong>en<br />
Stücken sol<strong>ch</strong>er Art, die ihres hohen Alters wegen<br />
in jenem Ver¬<br />
zei<strong>ch</strong>nisse als s<strong>ch</strong>on wieder vergessen oder verloren angegeben sind,<br />
werden sodann au<strong>ch</strong> Reliquien von sol<strong>ch</strong>en Heiligen mit genannt,<br />
deren Wunderthaten besonders in's Steinrei<strong>ch</strong> fallen. Unter den<br />
mehrfa<strong>ch</strong>en Reliquien, wel<strong>ch</strong>e man damals zu Muri s<strong>ch</strong>on wieder
65<br />
verloren oder vergessen hatte, zählt diese Hands<strong>ch</strong>rift folgende<br />
her: In einem der Altäre der Leutkir<strong>ch</strong>e zu Muri, die bereits vor<br />
Erbauung des Klosters (1027) bestanden hat, lagen die Reliquien<br />
der hl. Petronella verwahrt, und man wüsste bereits damals ni<strong>ch</strong>t<br />
mehr si<strong>ch</strong>er, wie dieselben na<strong>ch</strong> Muri gekommen seien, man s<strong>ch</strong>rieb<br />
sie der Freigebigkeit einer unbekannten Matrone Cilia zu. Ferner<br />
bewahrte man daselbst au<strong>ch</strong> Stücke sowohl vom Felsen, auf dem<br />
die Heiligen Felix und Regula zu Glarus gewohnt, wie au<strong>ch</strong> von<br />
demjenigen, auf wel<strong>ch</strong>em sie zu Züri<strong>ch</strong> enthauptet worden. Ebenso<br />
lag daselbst ein Gestein von der Fussspur des hl. Magnus, wel<strong>ch</strong>e<br />
man im Gebirge um baieriseh Füssen örtli<strong>ch</strong> den Mangstritt nennt,<br />
weil hier St. Mang die ges<strong>ch</strong>lossenen Bergwände mit einem Fusstritte<br />
dur<strong>ch</strong>stiess. Ni<strong>ch</strong>t minder mangelte es hier an Reliquien vom<br />
hl. Martinus, zu dessen Ehren die Basilica Muri's im J. 1060 feier¬<br />
li<strong>ch</strong> eingeweiht worden war, weil dieser berühmte Bis<strong>ch</strong>of einst<br />
auf seiner Reise aus Italien hier dur<strong>ch</strong>gezogen sein und sogar im<br />
bena<strong>ch</strong>barten Windis<strong>ch</strong> gepredigt haben soll. Diesem s<strong>ch</strong>wertfüh¬<br />
renden und berittenen Heiligen werden in den Ho<strong>ch</strong>alpen die bei¬<br />
den Martinslö<strong>ch</strong>er zuges<strong>ch</strong>rieben. Der Flimserberg s<strong>ch</strong>eidet Bün¬<br />
den und Glarus. In seinem südli<strong>ch</strong>en Gipfel, dem S<strong>ch</strong>indelnberg,<br />
öffnet si<strong>ch</strong> ein runddur<strong>ch</strong>bro<strong>ch</strong>enes Lo<strong>ch</strong>, dur<strong>ch</strong> wel<strong>ch</strong>es im Früh¬<br />
ling und im Herbst die Sonne wie dur<strong>ch</strong> ein Rohr s<strong>ch</strong>eint. Die<br />
Glarner nennen es das Martinslo<strong>ch</strong>, und das Dorf Elm betra<strong>ch</strong>tet<br />
jährli<strong>ch</strong> vom 11. bis 13. März und am St. Mi<strong>ch</strong>aelstage dur<strong>ch</strong> das¬<br />
selbe die Sonne. Fäsi, S<strong>ch</strong>weiz. Erdbes<strong>ch</strong>reib. 4, 103. Dies ist<br />
das eine Martinslo<strong>ch</strong>; das andere hat der Eigerberg im Berner<br />
Oberlande. Die Sonne dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>eint es am 17. und 18. Januar, so¬<br />
dann am 25. und 26. November wie ein grosses Feuer. Martinus<br />
hat dasselbe mit Fuss und Stab dur<strong>ch</strong>gestossen ; wo er auf der<br />
gegenüberstehenden Seite des Mettenberges den Rücken zum Stoss<br />
anstemmte und in's Gebirge einpresste, da liegt der Martinsdruck<br />
mit den zwei bena<strong>ch</strong>barten Heidenlö<strong>ch</strong>ern. Jahn, Kanton Bern 328.<br />
Aehnli<strong>ch</strong>e Martinuseindrücke rei<strong>ch</strong>en bis in die Niederlande; vgl.<br />
Wolf, DMS. no. 300. In der wels<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>weiz werden sol<strong>ch</strong>e<br />
Stärkeproben dem hl. Remigius beigelegt, der Romerio und Romedo<br />
genannt wird ; far un salto di S. Romedo ist im italienis<strong>ch</strong> Bünden<br />
die Redensart, die einen Riesensprung bezei<strong>ch</strong>net. Von der Motta<br />
aus, unterhalb Selvapiana im Pusclav gelegen, wo no<strong>ch</strong> jetzt Re¬<br />
migius Fussspuren in einer Steinplatte gezeigt werden, sprang einst<br />
der von den Heiden verfolgte Heilige bis oben in die Felsen des<br />
Gebirges hinauf, die nun wie er San Romerio heissen. Hier oben<br />
Argovia. III. 5
66<br />
ist eine Höhle, man sieht in ihrem Fels, wo er zum Gebet hinkniete<br />
und wo er seinen Hirtenstab hinsteckte; alles Unreine wird<br />
aus ihr hinausgeblasen. Leonhardi, das Pos<strong>ch</strong>iavinothal, 1S59, pg. 100.<br />
Unter jenen Steinreliquien, wel<strong>ch</strong>e man in der Leutkir<strong>ch</strong>e und<br />
in der Klosterkir<strong>ch</strong>e zu Muri einst bewahrte, zählen die Gründungsacta<br />
no<strong>ch</strong> folgende aus des Heilands Erdcnleben herstammende<br />
Stücke auf: Vom Fels, wo Christus geboren worden; vom Stein,<br />
da er spra<strong>ch</strong>, wei<strong>ch</strong>e Satanas. Vom Stein, auf dem Johannes ent¬<br />
hauptet worden. Vom Stein, worauf des Heilands Füsse ruhten;<br />
von der Säule, da er die Ohrfeige bekam; von der Martersäule<br />
und dem Felsengrab Christi; vom Fels mit den Fussspuren der<br />
Himmelfahrt. Steine vom Berge Sinai, und Ueberbleibsel von den<br />
Steintafeln Moses. Stücke vom Steingrab Mariens. Steine, mit<br />
denen der hl. Stephanus getödtet worden. Steine vom Grabmal<br />
des Lazarus. Ein Stein aus dem Jordan, worauf Christus während<br />
seiner Taufe stand (diesen Stein hatte die Frau Judentha von Herz¬<br />
na<strong>ch</strong> im Frickthale dem Kloster ges<strong>ch</strong>enkt). Einen der Steine, die<br />
Satanas dem Heiland dargeboten, dass er sie in Brode verwandle.<br />
Endli<strong>ch</strong> ist no<strong>ch</strong> eines besondern Bildsteines geda<strong>ch</strong>t, auf dem<br />
Christi Gestalt und Antlitz eingedrückt gewesen sein muss,<br />
da die<br />
Chronik denselben unter der Phrase anführt : de pctra similitudinis<br />
ejus (sc. Christi). Die Na<strong>ch</strong>ri<strong>ch</strong>t von dieser Art Reliquie lässt weit<br />
zurückblicken in jene Riesensagen, die si<strong>ch</strong> meist an des Heilands<br />
Wunderthaten anges<strong>ch</strong>lossen hatten und ihrer Würdelosigkeit wegen<br />
frühzeitig wieder verdrängt worden sind. Es stehen daher zur<br />
Verglei<strong>ch</strong>ung obiger Angabe nur wenige kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Beispiele zu<br />
Gebote. In der Wallfahrtskir<strong>ch</strong>e zu Einsiedeln ist ein über das<br />
Gestein geheftetes Silberble<strong>ch</strong> mit fünf Lö<strong>ch</strong>ern zu sehen; Christus<br />
hat diese hier eigenhändig eingedrückt. Landsee, En<strong>ch</strong>iridion Helvet.<br />
103. Deutli<strong>ch</strong>er lautet eine Na<strong>ch</strong>ri<strong>ch</strong>t in Be<strong>ch</strong>steins D. Sagb. no. 695 :<br />
Der Herrgottstein, ein Fels zwis<strong>ch</strong>en Selb und Thierstein liegend,<br />
nahe der Eger, ist also gestaltet, dass si<strong>ch</strong> ein Mann in dessen<br />
Austiefungen glei<strong>ch</strong>wie in eine Form legen kann, alle Glieder¬<br />
formen sind in den s<strong>ch</strong>önsten Verhältnissen darin zu sehen. Chri¬<br />
stus hat auf diesem Stein ausgeruht und ihm die Gestalt seines hl.<br />
Leibes eingedrückt. Nur über Riesen oder Heilige von riesen¬<br />
haften Thäten, nie aber vom Heiland, gelten sonst sol<strong>ch</strong>erlei Le¬<br />
genden. Der böhmis<strong>ch</strong>e Ritter Leo von Rozmital beri<strong>ch</strong>tet aus<br />
seiner 1465 gema<strong>ch</strong>ten Pilgerreise (herausgegeben von S<strong>ch</strong>meller)<br />
pg. 178, in Spanien den Stein gesehen zu haben, worauf St. Jakob<br />
ruhte und s<strong>ch</strong>wamm : Do sieht man heutstags innen sein fusstritt.
67<br />
do im sein haubt und leib gelegen ist, hat er in den stein ein<br />
wun gedruckt als in ein wa<strong>ch</strong>s." (Wunne ist die in's Eis gehauene<br />
Oeffnung.) Am Wege von Klausen na<strong>ch</strong> Säben im Tirol liegt ein<br />
Fels, auf dem der hl. Kassian rastend die ganze Länge seines<br />
Leibes eingedrückt hat; deutli<strong>ch</strong> sieht man, wo der Ellenbogen<br />
si<strong>ch</strong> stützte. Zingerle, Tirol. S.-M. no. 752. So prägt Herakles<br />
(bei Herodot 4, 82), beim Flusse Thyre in Scylhien gelagert, am<br />
Fels seinen Körper ab; ebenso Starcather (bei Saxo Gramm. 111),<br />
ain Felsen si<strong>ch</strong> anlehnend. Die Veronikalegende lässt mittelst des<br />
S<strong>ch</strong>weisstu<strong>ch</strong>es Christi Antlitz si<strong>ch</strong> abdrücken; dem Glauben des<br />
Nordländers war es ni<strong>ch</strong>t um diese feinere Wendung zu thun, er<br />
begehrte das Geglaubte in<br />
ganzer Leibli<strong>ch</strong>keit vor si<strong>ch</strong> zu sehen<br />
und mindestens des Heilands Hand und Fuss körperli<strong>ch</strong> si<strong>ch</strong>tbar zu<br />
verehren. Beide sind ihm daher seit dein Anfang des Bu<strong>ch</strong>druckes<br />
bis heute jedes Jahr in neuer Abbildung in's Haus gegeben wor¬<br />
den. Seitdem nämli<strong>ch</strong> der Bu<strong>ch</strong>drucker Fros<strong>ch</strong>auer aus s<strong>ch</strong>wäbis<strong>ch</strong><br />
Rotweil na<strong>ch</strong> Züri<strong>ch</strong> einwanderte und mit seinen dorthin mitge¬<br />
bra<strong>ch</strong>ten Holzstöcken die ersten Kalender daselbst druckte, sind<br />
dieselben und ihre kleinen Holzs<strong>ch</strong>nitte von der na<strong>ch</strong>folgenden Zeit<br />
fort und fort copirt worden, bis diese Bauernkalender vor der Concurrenz<br />
unserer heutigen Volks- und Bilderkalender vers<strong>ch</strong>winden<br />
mussten. Bluns<strong>ch</strong>i's Zuger Kalender vom J. 1823 ist no<strong>ch</strong> sol<strong>ch</strong><br />
ursprüngli<strong>ch</strong>er Art, er bezei<strong>ch</strong>net die Namen der Wo<strong>ch</strong>entage dur<strong>ch</strong><br />
Keile, die der Feiertage dur<strong>ch</strong> Holzs<strong>ch</strong>nitte von Centimegrösse; ein<br />
glei<strong>ch</strong>er Tiroler Bauernkalender ers<strong>ch</strong>eint no<strong>ch</strong> jetzt bei Felician<br />
Rau<strong>ch</strong> in Insbruck, und Johann V. Zingerle beri<strong>ch</strong>tet über ihn in<br />
seinen Tirol. Sitten und Bräu<strong>ch</strong>en. In Beiden ist eine Art Rück¬<br />
erinnerung übrig geblieben an jene eben genannten steinernen<br />
Reliquien. Verzei<strong>ch</strong>nen sie z. ß. das Fest der Auffahrt, so stellt<br />
der Holzs<strong>ch</strong>nitt am obern Bildrande ein Paar Füsse des Empors<strong>ch</strong>webenden,<br />
am untern deren zurückgelassene Eindrücke dar.<br />
Dies ist der letzte Rest jener zu Muri mit aufbewahrt gewesenen<br />
Steinreliquie vom Fels mit den Fussspuren der Himmelfahrt". An¬<br />
derwärts aber hat sie si<strong>ch</strong> auf den vergessenen Heidensteinen er¬<br />
halten, wie die Fussspur beweist auf der obersten Spitze des Erdmännlisteines<br />
im Walde bei Wohlen.<br />
Die Steintis<strong>ch</strong>e.<br />
Selbst die Naturfors<strong>ch</strong>ung sieht si<strong>ch</strong> bei Bespre<strong>ch</strong>ung der Find¬<br />
lingsblöcke genöthigt, mit einer grossartigen Prämisse zu be¬<br />
ginnen, und da dieselbe unserm Zwecke in doppelter Hinsi<strong>ch</strong>t
68<br />
dient, in mythologis<strong>ch</strong>er und culturges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>er, so stellen wir<br />
sie voran.<br />
Die Findlingsblöcke sind, wie s<strong>ch</strong>on ihr Name andeutet, ni<strong>ch</strong>t<br />
da entstanden, wo sie jetzt liegen; sie gehören au<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t zu den<br />
das Skelet des Landstri<strong>ch</strong>s bildenden Gesteinen, sie sind vielmehr<br />
an ihre jetzigen Fundstellen dur<strong>ch</strong> Glets<strong>ch</strong>er ges<strong>ch</strong>oben worden,<br />
die eine Ausdehnung gehabt haben, wel<strong>ch</strong>e hinrei<strong>ch</strong>te, um die<br />
Blöcke des Montblanc und der südli<strong>ch</strong>en Walliser Alpen hinüber<br />
auf den Jura, an die Lagern und in das überrheinis<strong>ch</strong> gelegene<br />
Höhgau massenhaft zu tragen. Das Vorhandensein der Glets<strong>ch</strong>er¬<br />
s<strong>ch</strong>liffe in den Alpen wie im Jura, sodann die Aehnli<strong>ch</strong>keit des<br />
Gesteins der alten S<strong>ch</strong>uttgebilde mit den im Gebirge entstandenen<br />
Felsarten und mit der Bes<strong>ch</strong>affenheit der vor und neben den jetzi¬<br />
gen Glets<strong>ch</strong>ern liegenden Moränen, sol<strong>ch</strong>e und no<strong>ch</strong> andere Ver¬<br />
hältnisse spre<strong>ch</strong>en so unzweideutig für die einstige Wanderung der<br />
Findlingsblöcke aus den Alpen über die Eisfelder her in die Nie¬<br />
derungen, dass ni<strong>ch</strong>t wohl eine andere als diese von der Wissen¬<br />
s<strong>ch</strong>aft fast einstimmig getheilte Erklärungsweise zur Geltung kom¬<br />
men kann.<br />
Diese naturhistoris<strong>ch</strong>e Prämisse über die Eiszeit und die über<br />
die Glets<strong>ch</strong>ermeere aus den Alpen her zu uns ges<strong>ch</strong>obenen Find¬<br />
lingsblöcke erinnert lebhaft an unsere altdeuts<strong>ch</strong>e Mythe über<br />
die Entstehung der Welt. Die Edda erzählt, im Anfang der Dinge<br />
war ni<strong>ch</strong>ts als ein gähnender Abgrund des Chaos, den die Welt<br />
des Nebels und Frostes mit Eis auszufüllen begann. Als dann in<br />
dieses starrende Niflheim von Süden her aufthauende Li<strong>ch</strong>tfunken<br />
sprangen, bra<strong>ch</strong>ten sie in dem Glets<strong>ch</strong>ermeere einen Sturmriesen<br />
Ymir sammt seiner Kuh Audhumbla in's Leben. Drei lange Tage<br />
leckte diese nahrungsbedürftig an den mit Reif überfrorenen Salz¬<br />
steinen, am ersten Tage kamen Mens<strong>ch</strong>enhaare, am zweiten ein<br />
Kopf aus dem Gestein hervor, am dritten endli<strong>ch</strong> der ganze statt¬<br />
li<strong>ch</strong>e Mann Buri, der Erstgeborene. Mit ihm erlos<strong>ch</strong> zuglei<strong>ch</strong> die<br />
Zeit der Eis- und Frostriesen, sie wurden vertilgt und die Herr¬<br />
s<strong>ch</strong>aft der li<strong>ch</strong>ten Odhinis<strong>ch</strong>en Götterreihe begann. Der Naturfor¬<br />
s<strong>ch</strong>ung dient somit die Eiszeit zum Mittel einer aus den Alpen bis<br />
an die Meeresküsten si<strong>ch</strong> erstreckenden Steinwanderung, und der<br />
Mythe gehört dieselbe Voraussetzung an; aber an den über die<br />
Glets<strong>ch</strong>ermeere! gerollten Fels knüpft die Mythe soglei<strong>ch</strong> den Ur¬<br />
sprung des Mens<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tes selbst an, von einer aus den<br />
Glets<strong>ch</strong>ern entsprungenen Riesenwelt gcräth sie auf eine aus den<br />
Glets<strong>ch</strong>erblöcken entsprungene Mens<strong>ch</strong>enwelt, und diese Felsen
69<br />
selbst sind ihr also die Wiege der Mens<strong>ch</strong>heit. Wir su<strong>ch</strong>en hier<br />
einen ähnli<strong>ch</strong>en Ausweg; denn unsere Aufgabe ist, von der Naturund<br />
Mythenges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te hinüberzugelangen auf den realen Boden<br />
na<strong>ch</strong>weisbarer Mens<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te. Und dazu eben haben uns nun<br />
diese Findlingsblöcke zu dienen, vorausgesetzt, dass dieselben na<strong>ch</strong><br />
Lage, Stellung, Gestaltung und lands<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>er Umgebung einen<br />
mit ihnen verbunden gewesenen Cultus der Vorzeit unzweifelhaft<br />
ausdrücken.<br />
Wir beginnen mit den Da<strong>ch</strong>steinen und S<strong>ch</strong>alensteinen. Es sind<br />
dies isolirt stehende Felsblöcke, die dur<strong>ch</strong> gewaltsame Naturvor¬<br />
gänge von ihrem Muttergestein losgerissen, in entfernte Gegenden<br />
ges<strong>ch</strong>afft und hier s<strong>ch</strong>on von der Urbevölkerung in einen so an¬<br />
haltenden Gebrau<strong>ch</strong> genommen worden sind, dass ihnen redende<br />
Spuren davon bis heute verblieben. Der gemeine Mann in seinen<br />
Traditionen und der Alterthumsfors<strong>ch</strong>er sind beide von jeher dar¬<br />
über einig gewesen,<br />
dass sol<strong>ch</strong>erlei Steine gewissen Cultuszwecken<br />
der Vorzeit gedient haben, und nur darüber gehen die Meinungen<br />
no<strong>ch</strong> aus einander, wel<strong>ch</strong>em Volke sie beizus<strong>ch</strong>reiben, ob sie Grab¬<br />
stätten oder Altäre zu nennen seien, ob und mit wel<strong>ch</strong>en Mitteln<br />
man sie an ihre jetzige Standslelle gerückt, aufgeri<strong>ch</strong>tet und mit<br />
den vorhandenen Merkzei<strong>ch</strong>en behauen habe. So weit nun bis<br />
jetzt sol<strong>ch</strong>erlei Steine ausrei<strong>ch</strong>end untersu<strong>ch</strong>t sind und zuglei<strong>ch</strong> mit<br />
der Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te ihrer Oertli<strong>ch</strong>keit gründli<strong>ch</strong> zusammengehalten haben<br />
werden können, ergiebt si<strong>ch</strong> allenthalben übereinstimmend, dass sie<br />
auf einem von Mens<strong>ch</strong>enhand vorbereiteten Grund und Boden ruhen;<br />
dass unter oder neben ihnen As<strong>ch</strong>ens<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten, zum Theil au<strong>ch</strong> Kno<strong>ch</strong>enanhäufungen,<br />
Trümmer von Werkzeugen und Waffen liegen;<br />
dass die mehrfa<strong>ch</strong>en Rinnen, Gruben und gliederförmigen Vertie¬<br />
fungen in ihrer Wand kein Naturspiel, sondern ein absi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>es<br />
Werk der Mens<strong>ch</strong>enhand sind, endli<strong>ch</strong> dass ihnen entweder s<strong>ch</strong>on<br />
die frühere Landesges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te selbst einen heidnis<strong>ch</strong>-religiösen<br />
Zweck zus<strong>ch</strong>rieb, oder dass die jetzt umwohnende Bevölkerung sie<br />
no<strong>ch</strong> immer mit Sagen und Spukges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten, mit Zauberthieren,<br />
Gespenstern und magis<strong>ch</strong>en Feuern ausgestattet sein lässt. Ihr<br />
hohes ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>es Alter erhellt aus ihren Standplätzen. Wie<br />
weit entfernt von den Orts<strong>ch</strong>aften und Aeckern der Jetztzeit sie<br />
gewöhnli<strong>ch</strong> liegen, wie versteckt und verloren auf selten betre¬<br />
tenen Höhen, in Haide- und Waldstrecken, dies lässt si<strong>ch</strong> be¬<br />
messen aus zweien erst neuerli<strong>ch</strong> kund gewordenen Fällen. Die<br />
Gemeinde Bettwyl im Freiamte liegt auf der Höhe des Linden¬<br />
berges; ein Theil ihres Tannenwaldes zieht si<strong>ch</strong> vom Bergrücken
70<br />
gegen das sagenberühmte Heidenbad und Guggibad von S<strong>ch</strong>ongau<br />
hinab, wo der Blaubart hingeri<strong>ch</strong>tet und begraben worden ist (Aarg.<br />
Sag. 1, pg. 2228). Dieser Waldtheil mit seinen Nagelfluhblöcken<br />
trägt den redenden Namen Tis<strong>ch</strong>kämmerli. Mit Bestimmtheit spri<strong>ch</strong>t<br />
die Bevölkerung von hier vorhandenen Heidengräbern, aber die<br />
Steintis<strong>ch</strong>e im Ho<strong>ch</strong>walde sind zur Zeit von Sa<strong>ch</strong>kundigen no<strong>ch</strong><br />
ni<strong>ch</strong>t einmal aufgesu<strong>ch</strong>t. Einen andern glei<strong>ch</strong>en Fall meldet so<br />
eben Osenbrüggen in der Neuen Zür<strong>ch</strong>er Zeitg., 10. Juni 1863 :<br />
Die Bergweide Summerigs Rod, die am Köpfenberg gelegen ist,<br />
ho<strong>ch</strong> oben im hintern Wäggithal, Kant. S<strong>ch</strong>wyz, zeigt ein mit auf¬<br />
gesetzten Steinen umgebenes Gevierte, in das si<strong>ch</strong> kein Hirte hin¬<br />
einwagt, obs<strong>ch</strong>on der Raum das s<strong>ch</strong>önste Gras hat. Es ist ein Versammlungsplatz<br />
der Geister. Als hier einst zwei Geissbuben in<br />
Streit geriethen und der eine des andern Geisslein boshaft in das<br />
Gevierte warf, starb das Thier alsbald. Au<strong>ch</strong> hier spri<strong>ch</strong>t die Sage<br />
von einer heidnis<strong>ch</strong>en Opferstätte. Und do<strong>ch</strong> muss man annehmen,<br />
dass diese nun öden Plätze einmal bewohnt und angebaut waren,<br />
denn wo Stätten für die Todten si<strong>ch</strong> finden, ist vorauszusetzen,<br />
dass au<strong>ch</strong> die Lebenden bena<strong>ch</strong>barte Wohnungen gehabt haben.<br />
Aber Avie frühzeitig müssen diese Wohnungen wieder aufgegeben<br />
worden sein, wenn nun der Boden keine Spur des Anbaues mehr<br />
verrath und nur der über die Gräber gewälzte Granitblock no<strong>ch</strong><br />
Zeugniss giebt, dass hier einst Mens<strong>ch</strong>en bleibend ansässig waren.<br />
Dies sind Folgerungen, wel<strong>ch</strong>e jüngst Dr. Hartmann im German.<br />
Anzeiger (1863, no. 4) in Verbindung gebra<strong>ch</strong>t hat mit der s<strong>ch</strong>on<br />
so oft behandelten Frage, in wie fern diese Steine dem Keltenund<br />
ni<strong>ch</strong>t dem Germanenvolke beizus<strong>ch</strong>reiben seien. Er verweist<br />
dabei auf Tacitus, Germ. 27, der ausdrückli<strong>ch</strong> von den Germanen<br />
seiner Zeit sagt, sie hätten sol<strong>ch</strong>erlei Grabdenkmäler für überflüssig<br />
gehal'en, deren Höhe und Gewi<strong>ch</strong>t no<strong>ch</strong> die Begrabenen belaste.<br />
Tacitus, der sol<strong>ch</strong>erlei Denkmäler arduus, operosus, gravis nennt,<br />
thue dieses ohne Zweifel im Hinblick auf die keltis<strong>ch</strong>en Na<strong>ch</strong>barn<br />
und hebe damit hervor, dass die Germanen die Ehre so s<strong>ch</strong>werer<br />
Grabsteine vers<strong>ch</strong>mäht hätten. Do<strong>ch</strong> gerade der Germanenglaube,<br />
der von der Steinzeit so rei<strong>ch</strong>e und tiefgehende Mythen hinter¬<br />
lassen hat, widerspri<strong>ch</strong>t dieser neuen These, selbst wenn spätere<br />
historis<strong>ch</strong>e Zeugnisse ni<strong>ch</strong>t melden würden, wie oft und wie langehin<br />
die deuts<strong>ch</strong>e Kir<strong>ch</strong>e es verbieten musste, dass man bei sol<strong>ch</strong>er¬<br />
lei Heidensteinen opfere und bete. Tacitus hat also jenes Urtheil,<br />
wie so man<strong>ch</strong>es andere in seiner Germania, im Hinblick auf die<br />
denkmalssü<strong>ch</strong>tige Mode seiner Römer ges<strong>ch</strong>rieben; er würde sol-
71<br />
<strong>ch</strong>erlei deuts<strong>ch</strong>e Barbarenbauten, als das volle Gegentheil jenes sii<br />
tibi terra levis, ohnedies ni<strong>ch</strong>t operosus genannt haben, sondern<br />
hö<strong>ch</strong>stens onerosus. Wir wissen bis jetzt dur<strong>ch</strong> keine feststehende<br />
Thatsa<strong>ch</strong>e, ob jenes früheste Mens<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t, dessen Spuren<br />
an diesen Steinen zurückgeblieben sind, wirkli<strong>ch</strong> dem keltis<strong>ch</strong>en<br />
Volksstamme angehört hat; dies aber bleibt unbestritten, dass der<br />
germanis<strong>ch</strong>e Norden die Erri<strong>ch</strong>tung seiner Bautasteine als eine von<br />
der Odhinis<strong>ch</strong>en Religion vorges<strong>ch</strong>riebene Pfli<strong>ch</strong>t kannte, und dass<br />
unser Süden ebenso an sol<strong>ch</strong>erlei Steine nur deuts<strong>ch</strong>e Glaubensund<br />
Sagenzüge geknüpft hat. Unsere ganze vorliegende Arbeit<br />
ist ja vermögend, ihr hundertfältiges Material eben allein aus diesen<br />
Grundlagen deuts<strong>ch</strong>er Satzungen entnehmen zu können. Dana<strong>ch</strong><br />
verwerthen wir denn s<strong>ch</strong>on die S<strong>ch</strong>alensteine, mit denen wir jetzt<br />
beginnen.<br />
In Norwegen nennt man die Wilden Männer und Riesen Jatten<br />
und Trolden, und na<strong>ch</strong> ihnen die Felsblöcke, in denen s<strong>ch</strong>alen-,<br />
topfförmige, kreisrunde, oder rinnenartige Vertiefungen eingehauen<br />
sind, Jällegryler, Troldegryler, zuglei<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> St. Olafssteinc, weil<br />
dieser Heilige des Nordens zumeist die Riesen vertilgt hat. Myth.<br />
518. Erst im Juni dieses Jahres 1863 sind zu Longirod in der<br />
Waadt zwei grosse erratis<strong>ch</strong>e Blöcke entdeckt worden, in wel<strong>ch</strong>e<br />
gegen hundert sol<strong>ch</strong>er kreisrunden Bassins von anderthalb bis zehn<br />
Zoll Dur<strong>ch</strong>messer eingehauen sind. Dieselben kleinen Runds<strong>ch</strong>alen<br />
trägt der pierre de Servagios (des Sauvages), der beim Walliser<br />
Dorfe Luc im Anniviersthale liegt, auf dem Wege na<strong>ch</strong> Bella-Tolaz,<br />
westli<strong>ch</strong> vom Borterhom. S<strong>ch</strong>weiz. Ges<strong>ch</strong>. Anzeig. 1858, 61. In<br />
der Nähe des Heidensteins in den Stadtwaldungen von Biel liegt<br />
neben einer Reihe von Gräbern no<strong>ch</strong> ein anderer, der unter seiner<br />
Moosdecke viele künstli<strong>ch</strong>e, rundli<strong>ch</strong>e Vertiefungen zeigt, die grös¬<br />
sern, auf seiner obern Flä<strong>ch</strong>e, bis zu fünf Zoll Dur<strong>ch</strong>messer hal¬<br />
tend, die kleinem an den Seitenwänden eingemeisselt. ibid. 1857,<br />
47. Man hatte s<strong>ch</strong>on früher unter ihm zwei eherne Si<strong>ch</strong>eln ge¬<br />
funden :<br />
Vuillemin, Kant. Waadt 1, pg. 40. Dass ein sol<strong>ch</strong>er Erz¬<br />
fund ni<strong>ch</strong>t au<strong>ch</strong> über die angebli<strong>ch</strong>e Nationalität derer mit ents<strong>ch</strong>ei¬<br />
den kann, denen man die Erri<strong>ch</strong>tung des Steins ursprüngli<strong>ch</strong> zu¬<br />
zus<strong>ch</strong>reiben gedenkt, darüber wird das weiterhin Mitzutheilende<br />
si<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> eigens erklären. Hier nur ein Beispiel, wie sol<strong>ch</strong>erlei<br />
Werkzeuge, bei Feldsteinen aufgefunden, weitere Sagenbildungen<br />
veranlassen. In der Nähe der böhmis<strong>ch</strong>en Stadt Gabel nennt man<br />
drei beisammenstehende Felsblöcke den Dreijungfernstein. Drei<br />
Graserinnen sind in ihm verwüns<strong>ch</strong>t, die hier, während die Mess-
72<br />
glocke zur hl. Wandlung läutete, spottend ihre Si<strong>ch</strong>eln gen Himmel<br />
s<strong>ch</strong>leuderten. Grohmann, Böhm. Sagb. 1, 273. De Beaufort hat bei<br />
specieller Untersu<strong>ch</strong>ung der zahlrei<strong>ch</strong>en Dolmen des französis<strong>ch</strong>en<br />
Indre-Departements in mehrern dieser Dolmen Urnens<strong>ch</strong>erben und<br />
Gebeine, auf ihren Decksteinen aber jene s<strong>ch</strong>alenförmigen Vertie¬<br />
fungen, von fünf bis zu eilf und zweiundzwanzig hinauf, vorge¬<br />
funden und ist dadur<strong>ch</strong> zur Ueberzeugung gekommen, dass diese<br />
Steine ebensowohl als Grabmäler, wie als Altäre gedient haben.<br />
Mémoires des Antiquaires de l'Ouest, année 1851, 64. So sollen<br />
si<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> Mens<strong>ch</strong>enkno<strong>ch</strong>en in der Nähe jenes S<strong>ch</strong>alensteins und<br />
Steintis<strong>ch</strong>es zu zür<strong>ch</strong>eris<strong>ch</strong> Hermets<strong>ch</strong>wyl vorgefunden haben, von<br />
dem wir weiter unten no<strong>ch</strong> Beri<strong>ch</strong>t geben werden. Ein sol<strong>ch</strong>er<br />
S<strong>ch</strong>alenstein von ungewöhnli<strong>ch</strong> sorgfältiger Behauung, zum Theil<br />
s<strong>ch</strong>on bes<strong>ch</strong>rieben im Aarg. Tas<strong>ch</strong>enbu<strong>ch</strong> vom J. 1862, 38, ist<br />
leider s<strong>ch</strong>on vor etwa dreissig Jahren gesprengt und zum Bau des<br />
S<strong>ch</strong>ulhauses im Aargauer Dorfe Suhr verwendet worden. Was Zu¬<br />
verlässiges von Männern, die bei dieser Arbeit mithalfen, jetzt no<strong>ch</strong><br />
erfahren werden konnte, folgt hier na<strong>ch</strong>. In dem zum Dorfe Suhr<br />
gehörenden Walde Oberthal traf man auf der Berghöhe Rüfengrind<br />
unter den Wurzelstöcken der gefällten Tannen auf eine Rundpfla¬<br />
sterung von 12 Fuss Dur<strong>ch</strong>messer, geregelt besetzt mit Rollsteinen<br />
und Findlingskieseln, wie sol<strong>ch</strong>e in jenem Waldthale ni<strong>ch</strong>t vor¬<br />
kommen, also hier heraufgetragen worden sein mussten. Innerhalb<br />
dieses Kieselgürtels fand si<strong>ch</strong> ein zweiter, gegen 6 Fuss Dur<strong>ch</strong>¬<br />
messer haltend, kreisförmig über den untern hingepflastert, so dass<br />
also die eine Kiesellage auf die andere zu liegen kam. Als man<br />
die obere wegbra<strong>ch</strong>, fanden si<strong>ch</strong> zum Erstaunen der Arbeiter zwi¬<br />
s<strong>ch</strong>en den beiden S<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten des innern Kieselgürtels Kohlen. Zwei<br />
Felsplatten, beide aus glei<strong>ch</strong>em Gestein und dieselben Einhauungen<br />
s<strong>ch</strong>alenförmiger Figuren tragend, die grössere auf 30 Fuss Länge<br />
und Breite ges<strong>ch</strong>ätzt, wurden damals zuglei<strong>ch</strong> auf der am Hang<br />
jenes Hügels liegenden Thalmatte wenige Fuss unter der Erde mit<br />
aufgefunden. Ein Bergsturz, den au<strong>ch</strong> der Localname Rüfengrind<br />
andeutet, soll sie Beide von ihrem Standorte auf der Spitze des<br />
Waldhügels hinabgerollt haben. Man hielt sie damals für Stein¬<br />
kisten. Beide trugen an ihren Rändern Formen von tèllerartigen<br />
Gefässen eingehauen, deren Dur<strong>ch</strong>messer über 1 Fuss betrug. Nur<br />
der Rand dieser sogenannten S<strong>ch</strong>üsseln war reliefartig im Felsen<br />
frei, ihr Fuss sass in ihm selbst fest. Einige von ihnen waren be¬<br />
reits vom Felsen abgesprengt und zwar mittelst eines s<strong>ch</strong>arfen<br />
Keiles, dessen Eins<strong>ch</strong>nitt im Gestein si<strong>ch</strong>tbar zurückgeblieben war,
73<br />
sie lagen zum Theil no<strong>ch</strong> um die Fundstelle zerstreut herum. Im<br />
nä<strong>ch</strong>sten Umkreise jener Waldhöhe mit der doppelten Kieselpflasterung<br />
ist der Boden ziemli<strong>ch</strong> rei<strong>ch</strong> an Ges<strong>ch</strong>irrs<strong>ch</strong>erben und Ziegeltrümmern,<br />
ein bena<strong>ch</strong>barter Waldplatz heisst wegen seiner Menge<br />
von Todtengebeinen Kaibenstatt, hier sollen Heiden begraben liegen.<br />
Am merkwürdigsten verhält si<strong>ch</strong> dazu die dortige Localsage. Man<br />
nennt nämli<strong>ch</strong> die Dorfkir<strong>ch</strong>e von Suhr wegen ihres hohen Alters<br />
Heidenkir<strong>ch</strong>e und erzählt, sie sei an ihren jetzigen Standort am<br />
Pfaffenhügel eigenmä<strong>ch</strong>tig und wundersamer Weise von eben je¬<br />
nem Rüfengrind herabgewandelt.<br />
Was unser Bauer von seinem Mittagsbrode übrig lässt, das er<br />
fur si<strong>ch</strong> allein im Felde verzehrt, das pflegt er immer auf den<br />
nä<strong>ch</strong>sten Markstein zu legen und auf einen sol<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>alenstein,<br />
wenn die bebaute Flur bereits bis an diesen hinrei<strong>ch</strong>t. Warum also<br />
sollte ni<strong>ch</strong>t au<strong>ch</strong> der Heide hier einst sein Brod den Himmlis<strong>ch</strong>en<br />
oder den Unterirdis<strong>ch</strong>en opfernd dargebra<strong>ch</strong>t haben. Und wenn die<br />
Sage re<strong>ch</strong>t hat, die gewöhnli<strong>ch</strong> einen Heidenkir<strong>ch</strong>hof um diesen<br />
Stein gelegen sein lässt, so war derselbe ein Altar und Grab zu¬<br />
glei<strong>ch</strong>, wie ja no<strong>ch</strong> unlängst unsere städtis<strong>ch</strong>en Kir<strong>ch</strong>en zu Fami¬<br />
liengruften dienen mussten. Er war also den Vorfahren ein Lei¬<br />
<strong>ch</strong>enstein, den Na<strong>ch</strong>kommen ein Denkstein, und naturgemäss war<br />
es, hier Todtenopfer darzubringen, Volksversammlung, Fest und<br />
Geri<strong>ch</strong>t abzuhalten und dabei den Gott und Helden mitzufeiern, der<br />
die Spuren seiner Wunderthat hier im Felsen abgedrückt zurück¬<br />
gelassen hatte. Denn dies war dem Germanen ein Abzei<strong>ch</strong>en gött¬<br />
li<strong>ch</strong>er Ma<strong>ch</strong>t, dass Odhinn mit seinem S<strong>ch</strong>wert dur<strong>ch</strong> den Felsblock<br />
bohrte, dass Thôrr mit seinem Hammer die Felszacken des Ge¬<br />
birges ebnete, dass der Stein unter des Heiligen Fusslrilt si<strong>ch</strong> plötz¬<br />
li<strong>ch</strong> erwei<strong>ch</strong>te und die Fussspur ewig bewahrte, allen Erkrankten<br />
und Wegesmüden zur Heilung und Stärkung. Sogar die in Strö¬<br />
men liegenden Felsenbänke, vom Wasser überfluthet und daher<br />
meist unsi<strong>ch</strong>tbar bleibend, besitzen Eigennamen und Traditionen,<br />
wenn sie das Flussgerölle ausgewas<strong>ch</strong>en und mit diesen kesselförmigen<br />
Gruben gezei<strong>ch</strong>net hat. Der H ä fei ist ein liegt beim Dorfe<br />
Birrhard, Bez. Brugg, fast mitten im Reussstrome und ist bei me¬<br />
derai Wasserstande das S<strong>ch</strong>wimmziel der badenden Knaben. Seine<br />
Oberflä<strong>ch</strong>e ist wie übersät mit grossen und kleinen, s<strong>ch</strong>ön aus¬<br />
gerundeten Lö<strong>ch</strong>ern, die dem Volke als Häfelein ers<strong>ch</strong>einen. An¬<br />
dere Felsblöcke daselbst in der Reuss heissen Leisestein, Auenstein,<br />
S<strong>ch</strong>warzstein (er ist ganz von Moos überzogen), und an der Bann¬<br />
grenze gegen Büblikon hin der Teufelsstein.
74<br />
Uebergehend nun zu einem ähnli<strong>ch</strong>en Stein im Freiamte, wel¬<br />
<strong>ch</strong>er der Bettlerstein heisst, soll diesem Namen dur<strong>ch</strong> mehrere an¬<br />
dere seinesglei<strong>ch</strong>en erst eine ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Vorerklärung gegeben<br />
werden.<br />
Ein Theil der Bünzner Almende (Freiamt) ist die Bettelmalt ge¬<br />
heissen, sie wird in den Urkunden des Ar<strong>ch</strong>ivs Muri als ein Lehen<br />
erwähnt, mit dessen Nutzung die Verpflegung und Weiterführung<br />
derjenigen fremden Armen und Presthaften verbunden gewesen<br />
war, die den Zwing Bünzen passirten. Auf dieser Matte lag ein<br />
erratis<strong>ch</strong>er Block, wel<strong>ch</strong>er in diesen letzten Jahren gesprengt und<br />
zum Häuser- und Strassenbau verwendet worden ist. Bei dieser<br />
Gelegenheit entdeckten die Arbeiter vier Erzbeile, sog. Kelte, die<br />
mit ihrem Beilöhr na<strong>ch</strong> innen, mit der Barte na<strong>ch</strong> aussen gekehrt,<br />
geordnet in den Kiesboden gelegt, die Form eines vierspei<strong>ch</strong>igen<br />
Rades bildeten. Sie ma<strong>ch</strong>en jetzt einen bcsondem S<strong>ch</strong>muck in der<br />
Sammlung von Alterthümern aus, wel<strong>ch</strong>e unser no<strong>ch</strong> junge Verein<br />
si<strong>ch</strong> angelegt hat. Der Grenzpunkt der Waldungen von Baden und<br />
Birmenstorf liegt auf dem Bergrücken der Sommerhalde und heisst<br />
Bettelku<strong>ch</strong>i; er wird dur<strong>ch</strong> einen zwis<strong>ch</strong>en alten Tannen und Bu¬<br />
<strong>ch</strong>en stehenden Gemarkungsstein bezei<strong>ch</strong>net. Hier war einst der<br />
gewöhnli<strong>ch</strong>e Lagerplatz der Heiden und Zigeuner, wel<strong>ch</strong>e die<br />
Grafs<strong>ch</strong>aft Baden dur<strong>ch</strong>zogen. Beim Ku<strong>ch</strong>enbacken, heisst es,<br />
bogen sie die Zweige der Waldbüs<strong>ch</strong>e in die Pfanne herab und<br />
liessen sie mit Backteig behangen wieder empors<strong>ch</strong>nellen. Eine<br />
ähnli<strong>ch</strong>e Bettel<strong>ch</strong>u<strong>ch</strong>i", bei wel<strong>ch</strong>er einst die Zigeuner abzuko<strong>ch</strong>en<br />
pflegten, liegt beim Frickthaler Dorfe Zeiningen; auf den Bettler¬<br />
äckern beim Dorfe S<strong>ch</strong>latt haben die von einer Zauberfrau be¬<br />
herrs<strong>ch</strong>te S<strong>ch</strong>aar der Franzosenbettler" gelagert, Feuersbrünste<br />
hinwegbes<strong>ch</strong>woren und Gewitter herbeigezaubert, je na<strong>ch</strong>dem das<br />
Volk ihnen lohnte. Eine ähnli<strong>ch</strong>e sagenhafte Umgebung hat nun au<strong>ch</strong><br />
Der Bettlerstein bei Wohlen. Der Fussweg vom Dorfe<br />
Wohlen im Freiamte zum Frauenkloster Hermets<strong>ch</strong>wyl geht längere<br />
Zeit dur<strong>ch</strong> einen s<strong>ch</strong>attigen Wald. In dem Theile desselben, wel¬<br />
<strong>ch</strong>er Rothwasser heisst, kommt man zu einem erratis<strong>ch</strong>en Block,<br />
dem Bettlerstein, au<strong>ch</strong> Heis<strong>ch</strong>stein genannt; eine Viertelstunde<br />
weiter abermals zu einem ähnli<strong>ch</strong>en, dem Herdmänndlistein. Hier<br />
ist vorerst nur von jenem die Rede. Da<strong>ch</strong>förmig ragt er na<strong>ch</strong><br />
allen Seiten aus dem Boden, die beiden Firstenden nord- und<br />
südwärts kehrend. An der Nordseite wölbt si<strong>ch</strong> seine Sohle zu<br />
einer Höhle bogenförmig aus, in die man si<strong>ch</strong> bequem hinablassen<br />
kann. Trotz des Walds<strong>ch</strong>uttes, der seit undenkli<strong>ch</strong>er Zeit hinein-
75<br />
geweht wird, hat sie jetzt no<strong>ch</strong> einen Dur<strong>ch</strong>messer von 4 Fuss mit<br />
-5 Fuss Länge. Innen ist sie dur<strong>ch</strong>aus trocken und hübs<strong>ch</strong> übermoost.<br />
Hieher pflegten vormals die Klosterfrauen von Hermet¬<br />
s<strong>ch</strong>wyl ihre kleinen Sommerfahrten zu ma<strong>ch</strong>en, bis ihnen dur<strong>ch</strong><br />
eine S<strong>ch</strong>reckges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te ein Ziel gesetzt wurde. Letztere ist be¬<br />
reits in den Aarg. Sagen 1, no. 205, erzählt; aus ihr aber geht<br />
hervor, dass man damals no<strong>ch</strong> diesen Fels von Waldmännern und<br />
Erdmänn<strong>ch</strong>en bewohnt glaubte, wel<strong>ch</strong>e mit S<strong>ch</strong>inken, Ku<strong>ch</strong>en und<br />
Wein rei<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> versehen den zu Besu<strong>ch</strong> kommenden Wanderer<br />
treffli<strong>ch</strong> bewirthet hätten. Uebereinstimmend mit jenen anderwei¬<br />
tigen Angaben, man habe in sol<strong>ch</strong>e Zwergenstuben um einen<br />
süssen Ku<strong>ch</strong>en nur hinabzurufen gebrau<strong>ch</strong>t (Vetter Metz, gieb mir<br />
einen Pletz!"), heisst dieser Block der Bettler- oder Heis<strong>ch</strong>stein.<br />
Denn betteln und heis<strong>ch</strong>en ist in hiesiger Mundart synonym. Au<strong>ch</strong><br />
eine Na<strong>ch</strong>erinnerung davon ist no<strong>ch</strong> übrig und soll alsbald beson¬<br />
ders beda<strong>ch</strong>t werden, dass man heidnis<strong>ch</strong>e Reihentänze um den<br />
Stein aufführte. Die mehrfa<strong>ch</strong>en Lö<strong>ch</strong>er in seiner s<strong>ch</strong>rundigen<br />
Wand hält man für eine Reihe alter Bohr- und Sprenglö<strong>ch</strong>er ; sie<br />
gelten als ein Zeugniss, wie oft die Hebamme hier den goldenen<br />
S<strong>ch</strong>lüssel ansetzen, den goldenen Karst einhauen muss, wenn sie<br />
die Neugeborenen darunter hervornehmen soll. Denn der Fels ist<br />
zuglei<strong>ch</strong> ein sog. Kleinkinderstein für die umliegenden Orts<strong>ch</strong>aften<br />
gewesen. Als dann seit dem 15. Jahrhundert die Zigeunerbanden<br />
die S<strong>ch</strong>weiz dur<strong>ch</strong>zogen und besonders im Freiamte bei der laxen<br />
Polizeiordnung geistli<strong>ch</strong>er Herrs<strong>ch</strong>aften eine wahre Landplage wur¬<br />
den, flü<strong>ch</strong>teten si<strong>ch</strong> diese Landfahrer, so oft ein neues Edict zu<br />
ihrer Austreibung ers<strong>ch</strong>ien, hieher in die Wälder und gaben si<strong>ch</strong><br />
bei diesen Felsverstecken ihr Stelldi<strong>ch</strong>ein. So wiederholt oft ein<br />
blosser Fels im Waldesdicki<strong>ch</strong>t eine ganze Reihe weit aus einander<br />
liegender alter und neuer Lebensverhältnisse. Der Heide hatte bei<br />
diesem Stein zu den Unterirdis<strong>ch</strong>en um das tägli<strong>ch</strong>e Brod gebetet,<br />
das ihr stets glühendes Erdfeuer aus der Ackerkrume ihm empor¬<br />
reifen lassen sollte. Der Fahrende und Gehrende aus der Ritter¬<br />
zeit wurde na<strong>ch</strong>mals ersetzt dur<strong>ch</strong> die Stromer und Steifbettler aus<br />
der Räuber- und Zigeunerzeit, die, weil sie keiner der beiden Confessionen<br />
zugehörten, Heiden hiessen und im Besitze aller der¬<br />
jenigen Zauberkünste zu stehen s<strong>ch</strong>ienen, wegen derer ehedem<br />
die Heidenmänn<strong>ch</strong>en in diesen Felsklüften so ho<strong>ch</strong>gerühmt waren.<br />
Wenn diese Landfahrer hier um den Stein gelagert die gestohlenen<br />
S<strong>ch</strong>inken vers<strong>ch</strong>maust und das erbettelte Mehl verbacken hatten, so<br />
bogen sie, wie s<strong>ch</strong>on erwähnt, in ihrer faulen Uebersättigung die
76<br />
Zweige der Haselbüs<strong>ch</strong>e in den Teigrest der Backpfanne herunter<br />
und Hessen sie überbacken wieder in die Höhe empors<strong>ch</strong>nellen. Da<br />
glaubte dann der Bauer wohl an Zauber, wenn er Tags darauf an<br />
dem verlassenen Lagerplatze vorbeikam und die Krapfen an den<br />
Bäumen wa<strong>ch</strong>sen sah. Da sol<strong>ch</strong> ein Felsstein zuglei<strong>ch</strong> als Ko<strong>ch</strong>¬<br />
herd dienen konnte, so nennt ihn das Volk au<strong>ch</strong> Ofen, Ofenlo<strong>ch</strong>,<br />
Kü<strong>ch</strong>e; man meint sogar, es s<strong>ch</strong>lügen nä<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>er Weile no<strong>ch</strong> blaue<br />
Flammen unter ihm empor (wie dies vom Fis<strong>ch</strong>stein gilt im Lenzhard)<br />
oder man höre unter ihm die Backmulde auss<strong>ch</strong>arren, ein<br />
süsser Speisegeru<strong>ch</strong> dampfe aus ihm auf. (Vgl. Aarg. Sag. 1,<br />
pg. 336.) Bald au<strong>ch</strong> sind diese felsenbewohnenden Erdgeister<br />
ko<strong>ch</strong>ende Riesen, bald bratende Teufel. Der Himmelstein im Fi<strong>ch</strong>¬<br />
telgebirge ist ein walzenförmiger Granitblock mit einem mulden¬<br />
förmigen Eins<strong>ch</strong>nitt; darinn haben die Riesen ihre Suppe geko<strong>ch</strong>t,<br />
und am dortigen Teufelsstein sieht man in den Rau<strong>ch</strong>nä<strong>ch</strong>ten das<br />
Feuer brennen, bei dem der Teufel Kü<strong>ch</strong>lein backt. S<strong>ch</strong>önwerlh,<br />
Oberpfälz. Sag. 2, 245. 251. Alex. Kaufmann hat in seinen Quellen<br />
zu den Main- und Rheinsagen", pg. 187, aus einer Reihe zum<br />
Theil kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>-mittelalterli<strong>ch</strong>er Scribenten das Alter sol<strong>ch</strong>er Teu¬<br />
felstis<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong>gewiesen, an denen die Geister fortfahren, zu<br />
ze<strong>ch</strong>en und zu würfeln. Au<strong>ch</strong> hiedur<strong>ch</strong> erhält man also denselben<br />
Aufs<strong>ch</strong>luss, dass nämli<strong>ch</strong> sol<strong>ch</strong>e Heidensteine den Zweck hatten,<br />
Opfersteine zu sein. No<strong>ch</strong> jetzt, sagt Afzelius, S<strong>ch</strong>wed. Sag. 2,<br />
286, giebt es in S<strong>ch</strong>weden Elfenaltäre", gelegen in örtli<strong>ch</strong> be¬<br />
kannten Waldstrecken, die man Elfengärten und Frauen- (Feen-)<br />
steige nennt; und an ihnen wird no<strong>ch</strong> für Kranke geopfert. Die<br />
Ehsten bra<strong>ch</strong>ten auf einem unter dem Lindenaltar" stehenden<br />
Stein dem alten Lindenbaum Speiseopfer dar, man begoss den Baum<br />
mit fris<strong>ch</strong>em Thierblut, mit sogenannter fris<strong>ch</strong>er Suppe, man hieng<br />
in seinen Zweigen am Johannisabend Kränze auf, umruts<strong>ch</strong>te ihn<br />
auf blossen Knieen von Ost na<strong>ch</strong> West und wieder zurück, küsste<br />
dreimal den Stein und spra<strong>ch</strong> : Empfange die Speise als Opfer<br />
Kreuzwald, Der Ehsten abergläub. Gebräu<strong>ch</strong>e. Petersb. 1854. Bei<br />
der bretonis<strong>ch</strong>en Landesbevölkerung dauert die den Dolmen Qdol:<br />
Tis<strong>ch</strong>, men: Stein) gewidmete Verehrung ebenso fort; obs<strong>ch</strong>on<br />
no<strong>ch</strong> im J. 1658 neuerdings das Concil von Nantes verboten hatte,<br />
eine Gabe auf sie niederzulegen, und den Bis<strong>ch</strong>öfen anbefohlen<br />
war,<br />
sie von Grund aus zu zerstören. Jetzt wird das Fest der<br />
Sommersonnenwende bei ihnen abgehalten, wobei man Aehrenkränze,<br />
Fla<strong>ch</strong>sblüthen und farbige Bänder auf ihnen niederlegt.<br />
Hartmann-Pfau, Breton. Volkslieder, na<strong>ch</strong> Vilmarqué übersetzt, pg. 392.
77<br />
Unsere Landessagen deuten si<strong>ch</strong> den Zweck der bei uns vor¬<br />
kommenden Heidensteine glei<strong>ch</strong>falls ni<strong>ch</strong>t anders, und je mehr<br />
sol<strong>ch</strong>er Blöcke geordnet beisammen stehen, um so ausdrückli<strong>ch</strong>er<br />
wird von Spiel, Tanz und S<strong>ch</strong>mauss erzählt, die in der Vorzeit<br />
um diese Opferstätten stattgehabt hätten. Glei<strong>ch</strong>wie die Kloster¬<br />
frauen zu Hermets<strong>ch</strong>wyl einst um den Bettlerstein tanzten, ebenso<br />
sollen die Stiftsdamen von Olsberg ihre Tänze mit den jungen<br />
Rheinfeldner Rathsherren auf den Bergmatten des Jura abgehalten<br />
haben. Aarg. Sag. 1, pg. 281; man brau<strong>ch</strong>te sogar nur eine Na<strong>ch</strong>t<br />
auf jenem Waldfelsen am Rückfelde, wel<strong>ch</strong>er Tcufelskanzel heisst,<br />
zuzubringen, um von Stund an der beste Tänzer im Lande zu sein<br />
(ibid. 1, pg. 310). Der gottesdienstli<strong>ch</strong>e Tanz des Heidenthums<br />
gab allmähli<strong>ch</strong> jenen Felsen selbst, die man umtanzte, seinen Namen.<br />
Steintanz heisst jeder der dreierlei Steinkreise, die beim holsteini¬<br />
s<strong>ch</strong>en Dorf Dreetz je aus neun Krinkensteinen" bestehen. In sie<br />
wurden die übermüthigen Bauern verwandelt, die hier bei einer<br />
Ho<strong>ch</strong>zeit na<strong>ch</strong> neun Mettwürsten mit Brodlaiben kegelten. Dörr,<br />
Plattdüts<strong>ch</strong>e Volkskalenner 1859, 29. Steintanz heissen glei<strong>ch</strong>falls<br />
drei Steinkreise im Bu<strong>ch</strong>enwalde bei Boitin, und wie ihrer jeder<br />
glei<strong>ch</strong>falls aus neun behauenen Steinen besteht, so wiederholt si<strong>ch</strong><br />
bei ihnen au<strong>ch</strong> dieselbe Sage von wurst- und brodvergeudenden<br />
Ho<strong>ch</strong>zeitsbauern. Studemund, Mecklenburg. Sag. (S<strong>ch</strong>werin 1848)<br />
108. 170. Derselbe Name kommt in der iris<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>e den im<br />
Kreise stehenden Riesensteinen zu welsh <strong>ch</strong>oirgaur, latein. <strong>ch</strong>orea<br />
:<br />
giganlum. Myth. 518. In nordis<strong>ch</strong>en Gegenden finden sie si<strong>ch</strong><br />
zuweilen hundertfältig beisammen auf verhältnissmässig geringem<br />
Umkreise. Auf dem Girsfelde bei Ankum im Fürstenthum Osna¬<br />
brück zählt Dr. Hartmann (German. Anzeiger 1863, 126) an 200<br />
sol<strong>ch</strong>er Granitblöcke, auf künstli<strong>ch</strong>en Hügeln aufgestellt und mit<br />
Decksteinen belegt von zum Theil 12 Fuss Länge und bis 6 Fuss<br />
Breite; ja es mögen ihrer auf derselben Heide sonst wohl bis auf<br />
300 vorhanden gewesen sein.<br />
Das Gesagte mag als Vorbereitung dienen zur Betra<strong>ch</strong>tung des<br />
Herdmandlisteins, an dessen Bes<strong>ch</strong>reibung wir nun gehen. Er liegt<br />
in derselben Waldgegend, wie der Bettlerstein, von diesem etwa<br />
eine halbe Stunde entfernt, in dem Waldtheile Bannhau, und hat<br />
genau die Gestalt jener Steindenkmäler, die man Elfenaltäre, Dill¬<br />
steine, Heidenkir<strong>ch</strong>en, bei uns Toggelikir<strong>ch</strong>en, Zwergenstuben und<br />
Da<strong>ch</strong>steine nennt. Zwei erratis<strong>ch</strong>e Granitblöcke, na<strong>ch</strong> ihrer Lang¬<br />
seite aufgeri<strong>ch</strong>tet, gegen 15 S<strong>ch</strong>ritt von einander abstehend, ragen<br />
bis 16 Fuss aus dem Boden und halten auf ihrer Spitze einen
7S<br />
grössern dritten Granitfels als Deckstein über sie hergelegt, mit<br />
so geringer Berührungsflä<strong>ch</strong>e, dass er von unten auf betra<strong>ch</strong>tet<br />
zu s<strong>ch</strong>weben s<strong>ch</strong>eint. Na<strong>ch</strong> der Messung, die Herr Feer, Pfr. zu<br />
Fahrwangen,. vorgenommen (S<strong>ch</strong>weiz. Ges<strong>ch</strong>. Anzeig. 1S59, 4:3)<br />
hat er unterhalb eine Länge von 16 Fuss und eine Höhe von 91/,<br />
Fuss na<strong>ch</strong> seiner Spitze hin; letztere mag wohl bei 18 Fuss über<br />
dem Boden sein. An seiner obersten Spitze zeigt si<strong>ch</strong> etwa 18<br />
Zoll lang eine fussspurarlige Vertiefung. Zwis<strong>ch</strong>en den beiden<br />
Tragsteinen s<strong>ch</strong>eint der Raum si<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> unten no<strong>ch</strong> weiter fort¬<br />
zusetzen, ist aber mit hineingeworfenen Steinstücken angefüllt.<br />
Letzleres erinnert an einen in der Eil'el geltenden Bauernbrau<strong>ch</strong>;<br />
wer an einer Höhle vorbeikommt, die man für ein altes Zwergenlo<strong>ch</strong><br />
ansieht, wirft einen Stein hinein; dadur<strong>ch</strong> ist die Quer<strong>ch</strong>kaule<br />
bei Weingarten so enge geworden, dass man nur mit grosser<br />
Mühe no<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> den Eingang kommt. Wolf, DMS. no. 67.<br />
Um si<strong>ch</strong> erklärli<strong>ch</strong> zu ma<strong>ch</strong>en, wie man sol<strong>ch</strong>e Lasten zur Stelle<br />
bewegen und aufthüruien konnte, nimmt man an, erst seien die<br />
Slützsteine als die kleinere Last emporgerollt und zum Stehen ge¬<br />
bra<strong>ch</strong>t worden; sodann habe man sie mit Erde überführt, zugefüllt<br />
und so für das Aufs<strong>ch</strong>leifen der Deckplatten eine s<strong>ch</strong>iefe Ebene<br />
erri<strong>ch</strong>tet. Wenn dieses Verfahren beim Bau der sog. Steinkammern<br />
stattgefunden hat, so konnte dasselbe do<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t für die Gnappund<br />
S<strong>ch</strong>alensteine passen, deren Bestimmung ursprüngli<strong>ch</strong> war,<br />
offen unter freiem Himmel dazustehen, um bestiegen, bewegt, in<br />
ihren Steingruben mit Opfergaben belegt, in ihren Wundernaiben<br />
aber angebetet werden zu können. Diese Steine haben vielmehr erst<br />
an ihrer Grundlage gewöhnli<strong>ch</strong> eine Höhlung, die man die Doggelistube<br />
nennt und von Unterirdis<strong>ch</strong>en bewohnt sein lässt. So war<br />
der Doggelistein zu Gibelflüh in der Luzerner Gemeinde Ballwil<br />
ein isolirter Felsblock, der auf dem Bauernhofe Im Lo<strong>ch</strong> bei einer<br />
Kapelle lag und erst vor einigen Jahren gesprengt und verbaut<br />
worden ist. Dil Doggelistube an seiner Sphle war von kleinen<br />
Leuten bewohnt, die dem Gibelflüher jeden Samstag sein Haus¬<br />
wesen in Flur und S<strong>ch</strong>eune fein säuberli<strong>ch</strong> in Ordnung bra<strong>ch</strong>ten.<br />
Lütolf, Fünfortis<strong>ch</strong>e Sagen, Heft 1, pg. 50. Wo uns auf sol<strong>ch</strong>erlei<br />
Fragen die Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te keinen Aufs<strong>ch</strong>luss giebt, dienen oft die<br />
nä<strong>ch</strong>sten Local- und Flurnamen als gute Urkunden. Die Localnamen<br />
um den Herdmandlistein sind besonders spre<strong>ch</strong>ende. Wi<strong>ch</strong>¬<br />
tig vor allen s<strong>ch</strong>eint der Name des Waldes, in wel<strong>ch</strong>em der Stein<br />
liegt; er heisst Bannhau.<br />
No<strong>ch</strong> ist der Bannwald in man<strong>ch</strong>en Kantonen dur<strong>ch</strong> alte Bann-
79<br />
briefe für jeden Holzbezug unbedingt vers<strong>ch</strong>lossen und nur dem<br />
Weidebetrieb geöffnet; gewisse Wälder liegen im Bann, das heisst,<br />
ni<strong>ch</strong>t einmal der Aushieb des abgängig werdenden Holzes ist in<br />
ihnen erlaubt. Der im Jahre 1862 an den S<strong>ch</strong>weiz. Bundesrath<br />
erstattete Beri<strong>ch</strong>t über die Ho<strong>ch</strong>gebirgswaldungen" klagt über diesen<br />
zum Na<strong>ch</strong>theil einzelner Landstri<strong>ch</strong>e und Gemeinden allzu ausge¬<br />
dehnten und unökonomis<strong>ch</strong> festgehaltenen Forsts<strong>ch</strong>utz und sagt<br />
wörtli<strong>ch</strong>: No<strong>ch</strong> jetzt hält die Bevölkerung ängstli<strong>ch</strong> fest an den<br />
Bestimmungen dieser Bannbriefe, nur gezwungen und mit der<br />
grössten Besorgniss legt sie Hand an diese Heiligthümer (pg. 238).<br />
Der Erdmandlistein steht also in einem ursprüngli<strong>ch</strong> heiligen Wald-<br />
Iheile, wel<strong>ch</strong>er von der Dur<strong>ch</strong>forslung (Hau), die als besonderer<br />
Weg zu dem Steine hinführt, seinen Namen trägt. Der Hügel<br />
selbst heisst Herdmannlihübel, wobei man zuglei<strong>ch</strong> an Herd<br />
Erde, und an Hard Wald zu denken hat, da beides si<strong>ch</strong> auf die<br />
Wilden Männer und Zwerge bezieht. Hundert S<strong>ch</strong>ritte von ihm<br />
entfernt liegen die beiden Sidehübel, die, wie jener, von konis<strong>ch</strong>er<br />
Form sind und künstli<strong>ch</strong> aufgeworfenen Hügeln glei<strong>ch</strong>en. Man<br />
pflegt in jener Umgegend zu einem groben Mäd<strong>ch</strong>en spri<strong>ch</strong>wört¬<br />
li<strong>ch</strong> zu sagen, du bist so rauh wie der Sidehübel, denn die An¬<br />
höhe des einen starrt von Farrenkraut. Zwis<strong>ch</strong>en dem Herdmannlistein<br />
und dem kleinern Sidehübel läuft der Ba<strong>ch</strong> Rolhwasser vor¬<br />
bei, von dem wir s<strong>ch</strong>on beim Bettlerstein gehört haben. Zwei<br />
bena<strong>ch</strong>barte Sümpfe heissen Kohlmoos. Ein Waldweiher heisst<br />
Rosengarten, und die Anhöhe an ihm Jungfemhübel, er gilt als<br />
der Standort eines untergegangenen Frauenklosters, das dur<strong>ch</strong><br />
Feuer vertilgt worden sein soll. Man glaubt allgemein, dieser<br />
Waldtheil sei gebannt; wer ihn betritt, heisst es, findet den Weg<br />
ni<strong>ch</strong>t lei<strong>ch</strong>t wieder heraus. Au<strong>ch</strong> der Hermets<strong>ch</strong>wyler Erdmannlistein<br />
selbst ist gebannt; wer ihn mit Beil oder Hammer bes<strong>ch</strong>lägt,<br />
dem reissen die Erdmänn<strong>ch</strong>en den Kopf ab. Nordwärts vom Side¬<br />
hübel liegen drei no<strong>ch</strong> ununtersu<strong>ch</strong>te Grabhügel, die nä<strong>ch</strong>ste Flur¬<br />
strecke dabei heisst Mens<strong>ch</strong>enrüti. Man hat hier im J. 1832 einen<br />
Steinsarg mit Gebeinen und ein ehernes S<strong>ch</strong>wert ausgegraben.<br />
Der Finder nannte dasselbe semiloren" und behauptet, es na<strong>ch</strong><br />
Aarau abgegeben zu haben, wo es indessen in keiner Sammlung<br />
si<strong>ch</strong> vorfindet. Eine weitere Viertelstunde entfernt liegen die Grund¬<br />
stücke Kaibier und Allenbrunnen. Der erste Name drückt aus,<br />
dass man ringsum auf einem ausgedehnten Grabfelde steht, der<br />
zweite ist ein Spukplatz, auf dem man früherhin wandelnde Jung¬<br />
frauen gesehen und ein starkes Tosen in der Erde gehört hat.
80<br />
Ein paar Stunden von dem aargauis<strong>ch</strong>en Hermets<strong>ch</strong>wyl entfernt<br />
liegt das glei<strong>ch</strong>namige Zür<strong>ch</strong>erdorf Hermets<strong>ch</strong>wyl und auffallend ist<br />
es, dass si<strong>ch</strong>, wie bei'm erstem, so au<strong>ch</strong> bei diesem ein sol<strong>ch</strong>er<br />
Steintis<strong>ch</strong> vorfindet. Er war bis zum Jahre 1842 dur<strong>ch</strong> Gebüs<strong>ch</strong><br />
und Dornen überwa<strong>ch</strong>sen und ges<strong>ch</strong>ützt; damals aber wurde er<br />
gesprengt und sein Gestein zum Bau einer Sennhütte hergeri<strong>ch</strong>tet.<br />
Seine Deckplatte war s<strong>ch</strong>on vorher gestürzt und lag in no<strong>ch</strong> be¬<br />
deutenden Bru<strong>ch</strong>stücken zwis<strong>ch</strong>en den vier Tragsteinen im innern<br />
Raum, der etwa vier Fuss ho<strong>ch</strong> über den Boden mit Erde aufge¬<br />
füllt war. Die Tragsteine waren vier Granitblöcke von zehn Fuss<br />
Höhe, die so nahe an einander gerückt waren, dass sie unten<br />
keinen Zwis<strong>ch</strong>enraum übrig Hessen. Ihre Unterlage war ein sehr<br />
unzusammenhängendes Steingerüste in kranzförmiger Gruppirung,<br />
unter demselben ein Gemengsei von Erdarten, bis endli<strong>ch</strong> der<br />
reinste Sandboden folgte. Ungefähr einen Fuss unter der Ober¬<br />
flä<strong>ch</strong>e lag ein Kranz von centners<strong>ch</strong>vveren Steinen um die Hauptgruppe<br />
gereiht. Dass also die Aufstellung der Steine keine zu¬<br />
fällige, sondern von Mens<strong>ch</strong>enhand bewirkt worden war, lässt si<strong>ch</strong><br />
hierna<strong>ch</strong> gewiss mit vollster Si<strong>ch</strong>erheit behaupten. Abgebildet ist<br />
dieses Denkmal in seiner ursprüngli<strong>ch</strong>en Gestalt im Anzeiger für<br />
S<strong>ch</strong>weiz. Ges<strong>ch</strong>. und Alterthumskunde 1856, 40. Anderweitige<br />
Steintis<strong>ch</strong>e in der S<strong>ch</strong>weiz haben mit dem eben erwähnten das¬<br />
selbe S<strong>ch</strong>icksal theilen müssen. So das Mors<strong>ch</strong>a<strong>ch</strong>er Thor ob Brun¬<br />
nen im Kant. S<strong>ch</strong>wyz. Dorten, wenn man die Berghohe erstiegen<br />
hatte und die erste Wiese betrat, lag ein rother Stein, se<strong>ch</strong>s Fuss<br />
lang, zwei breit, anderthalb dick, wie eine S<strong>ch</strong>welle über zwei<br />
andern, unter denen wie unter einer Porte der Weg hindur<strong>ch</strong>führte.<br />
Drei ledige Weibspersonen (also Riesenjungfrauen) hatten den<br />
Dreistein von freier Hand hieher gelegt. Zur Zeit der Revolution<br />
haben übermüthige Leute das Thor zerstört, zers<strong>ch</strong>lagen und den<br />
Deckstein in den Wald hinabrollen lassen. In diesem aber liegen<br />
zur Stunde no<strong>ch</strong> zwei andere ähnli<strong>ch</strong>e Rundblöcke, auf ein Fels¬<br />
lager wie von Mens<strong>ch</strong>enhand hingewälzt und von kleinern Trag¬<br />
steinen unterstützt. Sie sollen bei 2000 Centner s<strong>ch</strong>wer sein. So<br />
meldet na<strong>ch</strong> Fassbind (aus dessen hds. Werk Das <strong>ch</strong>risti. S<strong>ch</strong>wyz")<br />
Lütolf in den Fünfort. Sagen (Luzern 1862) Heft 1, 21, ohne indess<br />
diese seltenen Denkmäler näher zu bes<strong>ch</strong>reiben.<br />
Wir s<strong>ch</strong>liessen die Bes<strong>ch</strong>reibung der Steintis<strong>ch</strong>e, die selber so<br />
oft als Grabsteine auf ausgedehnten Lei<strong>ch</strong>enfeldern stehen, mit der<br />
ihnen zunä<strong>ch</strong>st verwandten Sage von den Dillsteinen und Heiden¬<br />
steinen. Diese liegen, heisst es, unergründli<strong>ch</strong> tief im Grunde der
8t<br />
Hcidenhügel versenkt. Hierüber soglei<strong>ch</strong> ein paar Beispiele. Der<br />
Heidenhügel zu Sarmenstorf im Freiamte liegt ausserhalb der Ort¬<br />
s<strong>ch</strong>aft gegen den Na<strong>ch</strong>barort Bettwyl hin; bogenförmig umzieht<br />
ihn der Bettwylerba<strong>ch</strong> in einem tiefen Tobel. Tannen wa<strong>ch</strong>sen<br />
auf seinem Abhänge, seine oberste Spitze ist frei, ein S<strong>ch</strong>loss soll<br />
droben gestanden haben, im Boden finden si<strong>ch</strong> Ziegelstücke, au<strong>ch</strong><br />
römis<strong>ch</strong>e Münzen. Von seiner Höhe, heisst es, gehe ein S<strong>ch</strong>a<strong>ch</strong>t<br />
bis auf den Grund der Hölle hinab und der Heidenstein vers<strong>ch</strong>liesse<br />
ihn. Aehnli<strong>ch</strong>es erzählt man au<strong>ch</strong> vom Reitenberge beim Freiämlerdorf<br />
Villmergen. Dieser Berg hat zwei W'aldzelgen, eine die<br />
Jungfrau, die andere der Heidenhubel genannt. Auf letzterem soll<br />
das Heidens<strong>ch</strong>loss sammt der Heidenkir<strong>ch</strong>e gestanden haben und<br />
hier in Mitte des Platzes gehe ein S<strong>ch</strong>a<strong>ch</strong>t nieder, der erst am<br />
Fusse des Berges wieder ausmünde. Ehedem soll er offen ge¬<br />
standen haben, und warf man dann Steine hinab, so habe es ge¬<br />
tönt, als ob es auf Kohlen und Rossnägel auffalle". Der S<strong>ch</strong>a<strong>ch</strong>t<br />
sei daher dur<strong>ch</strong> eine Steinplatte ges<strong>ch</strong>lossen worden und diese sei<br />
längst unkenntli<strong>ch</strong> übergrast. Ein alter nun eingegangener Weg<br />
zum Heidenhubel hinauf führte über eine Landstrecke Namens<br />
Kir<strong>ch</strong>enacker, dieser soll eines der Güter sein, die zum Heidenleinpel<br />
gestiftet waren und späterhin Anlass gaben zur Erbauung<br />
der jetzigen Dorfkir<strong>ch</strong>e von Villmergen.<br />
Diese Angaben entbehren des mythis<strong>ch</strong>en Grundes ni<strong>ch</strong>t. Dur<strong>ch</strong><br />
einen glei<strong>ch</strong>en Stein, den lapis manalis, da<strong>ch</strong>ten si<strong>ch</strong> die Römer das<br />
Thor der Unterwelt ges<strong>ch</strong>lossen; er lag auf dem Comitienplatze<br />
zu Rom und wurde hier dreimal des Jahres von seiner Oeffnung<br />
abgehoben, um den Manen die Rückkehr aus der Unterwelt zu<br />
ermögli<strong>ch</strong>en. Härtung, Relig. der Römer 2, 91. Die Deuts<strong>ch</strong>en<br />
kannten und nannten dafür den Dillstein; mhd. und ndd. dii, alt¬<br />
nord. ihil ist das Da<strong>ch</strong>, der Dillstein also -der den Höllengrund<br />
überdeckende Da<strong>ch</strong>stein, wie der seine drei Tragsteine lastend zu¬<br />
deckende obere des Steintis<strong>ch</strong>es. Dass er bei uns als Lei<strong>ch</strong>en¬<br />
stein galt, erweist si<strong>ch</strong> aus den mhd. Versen (Myth. 766):<br />
der dillestein der ist entzwei,<br />
die toten sint üf gewecket.<br />
Ein sol<strong>ch</strong>er Stein giebt dem Dillberg zwis<strong>ch</strong>en Langenzerin und<br />
Deberndorf im Ansba<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>en den Namen; er ist so gross, dass er<br />
bei entblösstem Laubwalde viele Stunden weit si<strong>ch</strong>tbar gewesen<br />
sein soll. W. Reynitzs<strong>ch</strong> (Truhten und Truhtensteine 1802) giebt<br />
pg.<br />
51 eine Abbildung von ihm: oben s<strong>ch</strong>eibenförmig abgeplattet,<br />
im Halbkreise von sieben kleinern Steinen umgeben. In der Wal-<br />
Argovia. III. 6
82<br />
bersna<strong>ch</strong>t (1. Mai) sollen ihn die Hexen umtanzen. Ein Tei<strong>ch</strong>, der<br />
Dilsgraben bei westfälis<strong>ch</strong> Bockenem, liegt an der Stelle eines<br />
untergegangenen S<strong>ch</strong>losses; an Ostern und Pfingsten versammelt<br />
man si<strong>ch</strong> hier, s<strong>ch</strong>lägt Ball, ko<strong>ch</strong>t Kaffee, und bemisst na<strong>ch</strong> der<br />
Höhe des Wasserstandes im Dilsgraben den Ausfall der Kornernte.<br />
Kuhn, Westfäl. Sag. no. 368. Ein Tau<strong>ch</strong>er, den man in den Tei<strong>ch</strong><br />
hinabliess, sah in einem grossen Saale den Ritter Tils, altgrau, und<br />
sein weisser Bart war ihm um den Tis<strong>ch</strong> gewa<strong>ch</strong>sen. Harrys,<br />
Ndsä<strong>ch</strong>s. Sag. 1', pg. 8. Auf der Platte des Hohentillen an der<br />
oberpfälzis<strong>ch</strong>-böhmis<strong>ch</strong>en Grenze war die vielgethürmte Tillenstadt<br />
gelegen. Der Berggeist spra<strong>ch</strong> seinen Flu<strong>ch</strong> über das heillose<br />
Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t dieser Stadt, der Tillen wankte und s<strong>ch</strong>loss den Ort in<br />
seine Tiefen. Fents<strong>ch</strong>, in der Bavaria II, 224. In neuester Zeit<br />
wurde der S<strong>ch</strong>mied yon Neualbenreut mit Bes<strong>ch</strong>lagzeug und Huf¬<br />
nägeln hinein und zu einem grossen freundli<strong>ch</strong>en Herrn geführt,<br />
dem er die Rosse bes<strong>ch</strong>lagen musste, ohne die daneben s<strong>ch</strong>lafen¬<br />
den vielen Soldaten darüber aufzuwecken. Die Goldstücke, die der<br />
Mann mit zurückbra<strong>ch</strong>te, waren über tausend Jahre alt. S<strong>ch</strong>önwerth,<br />
Oberpf. Sag. 3, 359. Alle Züge erinnern hier an die in<br />
den Berg gegangenen und dorten bis zur Götterdämmerung ruhen¬<br />
den Könige und Helden, an Kaiser Rothbart im Kyffhäuser und die<br />
drei Teilen im Axenberge. Hier s<strong>ch</strong>lafen sie und der Bart wä<strong>ch</strong>st<br />
ihnen dreimal um den steinernen Tis<strong>ch</strong>. Im aargauis<strong>ch</strong>en Volksliede<br />
vom Tannhuser und Frau Vreneli heisst es:<br />
Tannhuser sitzet am steinige Tis<strong>ch</strong>,<br />
Der Bart wa<strong>ch</strong>st ihm drum umme,<br />
Und wenn er drümol ummen is<strong>ch</strong>,<br />
Wird der jüngst Tag bald <strong>ch</strong>umme.<br />
Er fragt Frau Vreneli all Fritig spot,<br />
Wenn der Bart es drittmol umme goht<br />
Und der jüngst Tag öppen wöll <strong>ch</strong>umme.<br />
Teufelssteine und Entslö<strong>ch</strong>er.<br />
Wir sind rei<strong>ch</strong>er an Teufelssagen als an Heiligenlegenden. Den<br />
Anlass zu dieser auffallenden Ers<strong>ch</strong>einung gaben ursprüngli<strong>ch</strong> die<br />
Heidenbekehrer. Sie durften ni<strong>ch</strong>t wagen, dem deuts<strong>ch</strong>en Heiden<br />
die Existenz seiner Götter abzuläugnen, und waren selbst von der<br />
vorgetragenen Lehre überzeugt, dieselben seien lügneris<strong>ch</strong>e Teu¬<br />
felswesen, wel<strong>ch</strong>e die Mens<strong>ch</strong>heit bisher irre geleitet hätten. Der<br />
Deuts<strong>ch</strong>e musste daher bei seiner Bekehrung zuerst diesen Göttern<br />
als Teufeln abs<strong>ch</strong>wören und diese Abrenuntiatio für seine Tauf-
83<br />
kinder und Pathenkinder jeweilen öffentli<strong>ch</strong> wiederholen. Karl der<br />
Grosse verlangt in seinem encyklis<strong>ch</strong>en Auss<strong>ch</strong>reiben an die Bi¬<br />
s<strong>ch</strong>öfe vom J. 811 (Pertz, Legg. 1, 171), sie selbst sollten wissen<br />
und in der Landesspra<strong>ch</strong>e zu sagen im Stande sein, was abrcnuntiatio<br />
Satanae et opera ejus diaboli et pompae sei. Ein Capilulare<br />
Hludowiges und Hlolhars von 829 erklärt die Bedeutung ausführ¬<br />
li<strong>ch</strong>. Die vorges<strong>ch</strong>riebene Formel beginnt: Forsä<strong>ch</strong>istu diabolae?<br />
und setzt die Antwort darauf: ec forsa<strong>ch</strong>o alluni dioboles uuercum<br />
ende uuordum, thunaer ende uuoden ende saxnote ende alluni<br />
them unholdum, the hira geiiotas sint. (Pertz, Mon. 3, 19.)<br />
Die s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en Bekehrer litten selbst zumeist an dieser histo¬<br />
ris<strong>ch</strong>en Tcufelss<strong>ch</strong>eu. Der heil. Gallus vernahm die Stimme der<br />
Dämonen auf den Höhen von Bregenz und aus der Tiefe des ßodcnsees;<br />
der heil. Meinrad sah sie in den seine Klause umhüllenden<br />
Bergiiebeln; als St. Bernhard die Jupiterssäule am Mons Penninus<br />
umgerissen hatte, da erst wandelte si<strong>ch</strong> das Gebrüll (der Orkane)<br />
und das Raus<strong>ch</strong>en und Brausen der (Wind-) Dämonen in milde<br />
Engelslieder. Die Folge hievon musste sein, dass heut zu Tage<br />
die ganze heidnis<strong>ch</strong>e Götterwelt, soviel davon no<strong>ch</strong> im Gedä<strong>ch</strong>tnisse<br />
des Volkes zurückgeblieben ist, zum Teufelswerk paraphrasirt ist.<br />
Dieser Umwandlung aus heidnis<strong>ch</strong>-göttli<strong>ch</strong>en in <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong> verteufelte<br />
Wesen erlagen die ältesten Gottheiten zuerst, nämli<strong>ch</strong> die Erdgott¬<br />
heiten, die Riesen, die ihrer Natur na<strong>ch</strong> in einer Spannung gegen<br />
die Hiinmelsgottheiten gestanden hatten. Daher nennt das Volk<br />
alle sonst den Riesen zuges<strong>ch</strong>riebenen vorges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Bauten,<br />
Teufelsmauern, Teufelsbrücken, - Rossstall und Tanzplatz, Kü<strong>ch</strong>en<br />
und Kanzeln; Aarg. Sag. no. 430; und wo ein <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>er Bau<br />
seit älterer Zeit unfertig stehen blieb, heisst es spri<strong>ch</strong>wörtli<strong>ch</strong>, der<br />
Teufel hat seinen Stein drinn, hat seinen Stein darein geworfen.<br />
Heidnis<strong>ch</strong>es und Christli<strong>ch</strong>es, sagt Russwurm, Nord. Sag. 279, ein¬<br />
mal vom lebendigen Glauben verlassen, sinkt bald in die Na<strong>ch</strong>t<br />
der Zauberer und Unholde hinab. So weit verpestete der um si<strong>ch</strong><br />
greifende Teufelsglaube die Phantasie des Volkes, dass si<strong>ch</strong> sogar<br />
unsere Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>ternamen ernstli<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> ihm benannten: Das Ge¬<br />
s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t der Teufel in baieris<strong>ch</strong> Franken, die Tüfelbeiss in der<br />
S<strong>ch</strong>weiz, die Dusendüvel in Hessen, die Bütendüvel in Brauns<strong>ch</strong>weig,<br />
die Jagcnteufel, die Sladenteufel u. s. w. Wie der Hebräer einen<br />
Berg Gottes" annahm, einen Götterberg im fernsten Norden lie¬<br />
gend (Jesaias II, 3. XI, 9. LVI, 7), auf dem si<strong>ch</strong> die Götter ver¬<br />
sammelten; wie ferner der Hindu den heiligen Berg Meru verehrt<br />
und einen von dessen Nordgipfeln Sabba nennt,<br />
d. i. Versammlung:
84<br />
so ist nun in unserm allgemeinen Wissen der Blocksberg der Versammlungsberg<br />
aller Hexen von ganz Mitteldeuts<strong>ch</strong>land, so fahren<br />
um Walpurgis alle Hexen S<strong>ch</strong>wabens auf den Heuberg bei Rothen¬<br />
burg, alle Hexen der S<strong>ch</strong>weiz auf den Pilatusberg oder auf die<br />
Bei<strong>ch</strong>enberge im badis<strong>ch</strong>en Wiesenthaie. Sind so die hö<strong>ch</strong>sten<br />
Häupter des Gebirges von Furien eingenommen, so wird ihr Ober¬<br />
gebieter au<strong>ch</strong> jeden nur einigermassen in's Auge tretenden Stein<br />
bewohnter Thäler zu einem Teufelssitz ma<strong>ch</strong>en. Würfelnd und<br />
ze<strong>ch</strong>end sitzt der Böse am Steinernen Tis<strong>ch</strong> in dem Aarauer<br />
Stadtwalde Gönhard; dieser Stein, sagt man, sei seit diesen letzten<br />
Tagen erst zers<strong>ch</strong>lagen worden. Auf der Burghalde, einem Berg¬<br />
walde beim Dorfe Dürrenäs<strong>ch</strong> im aarg. Kulmerthale, heissen zwei<br />
klafterhohe kammerartig gegen einander liegende Nagelfluhblöcke<br />
Des Teufels Rossstall. Die Bannwarte hören hier den Wilden<br />
Jäger johlen und sehen seine grünen Jägerskne<strong>ch</strong>te mit der Meute<br />
der Hunde über die Berghöhe hinziehen. Er s<strong>ch</strong>leudert im Reussthale<br />
die Teufelsburdi gegen die neuen Kapellen; er baut die eine<br />
Teufelsbrücke in der Reuss, Felsenbänke, wel<strong>ch</strong>e querhin den<br />
Strom dur<strong>ch</strong>ziehen, und eine zweite im Rhein zu S<strong>ch</strong>loss Weisswasserstelz<br />
bei Kaiserstuhl; er ko<strong>ch</strong>t und zapft Wein in der Teufels¬<br />
kü<strong>ch</strong>e und im Teufelskcller.bei Baden. Die Neuenhofer Dorfoffnung,<br />
im Wettinger Ar<strong>ch</strong>iv 150, 151, weist im Umkreis ihres<br />
Twings einen Bocksba<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> und eine Teufels S<strong>ch</strong>mitten.<br />
Bourrit, Pennin. und Rhätis<strong>ch</strong>e Alpen, Züri<strong>ch</strong> 1782, erzählt pg. 202<br />
die Sage vom bekannten Teufelsstein in der Reuss bei Gös<strong>ch</strong>enen; er<br />
untersu<strong>ch</strong>t mit dem Auge des Naturfors<strong>ch</strong>ers die Spuren, wel<strong>ch</strong>e die<br />
Satanskrallen in jenem Felsen zurückgelassen haben sollen. Man hat<br />
no<strong>ch</strong> neuerli<strong>ch</strong> ein Kreuz auf den Stein hinaufgesetzt. Ueber diesen<br />
Trieb des Volkes, Unerklärbares dem Teufel zuzus<strong>ch</strong>reiben, lässt<br />
Göthe seinen Mephistopheles (Faust II, 254) si<strong>ch</strong> also ausspre<strong>ch</strong>en :<br />
No<strong>ch</strong> starrt das Land von fremden Felsenmassen;<br />
Wer giebt Erklärung sol<strong>ch</strong>er S<strong>ch</strong>leuderma<strong>ch</strong>t?<br />
Der Philosoph, er weiss es ni<strong>ch</strong>t zu fassen,<br />
Da liegt der Fels, man muss ihn liegen lassen,<br />
Zu S<strong>ch</strong>anden haben wir uns s<strong>ch</strong>on geda<strong>ch</strong>t.<br />
Das treugemeine Volk allein begreift<br />
Und lässt si<strong>ch</strong> im Begriff ni<strong>ch</strong>t stören;<br />
Ihm ist die Weisheit längst gereift:<br />
Ein Wunder ist's, der Satan kommt zu Ehren,<br />
Mein Wand'rer hinkt an seiner Glaubenskrücke<br />
Zum Teufelsstein, zur Teufelsbrücke.
85<br />
No<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t untersu<strong>ch</strong>t sind die sog. Entslö<strong>ch</strong>er, die si<strong>ch</strong> im<br />
Frickthal mehrfa<strong>ch</strong> vorfinden sollen, so z. B. auf dem Sommerhaldenhübel<br />
in der Gemeinde Zeihen. Die Sage beri<strong>ch</strong>tet, die Fran¬<br />
zosen hätten dieselben gegraben, nämli<strong>ch</strong> jene voltaires<strong>ch</strong>en aus<br />
den Zeilen des Convents, die mit Gott gebro<strong>ch</strong>en hatten. Daraus<br />
ist zu s<strong>ch</strong>liessen, dass man diesen Entslö<strong>ch</strong>ern glei<strong>ch</strong>falls eine<br />
diabolis<strong>ch</strong>e Entstehung zus<strong>ch</strong>reibt. Ihr Name selbst verweist auf<br />
Riesen: ags. ent, pl. enlas, ahd. anlrisc, bezei<strong>ch</strong>net das Riesige,<br />
und no<strong>ch</strong> lebt in der baieris<strong>ch</strong>en Mundart cnteris<strong>ch</strong>, riesig, un¬<br />
geheuer und ni<strong>ch</strong>t geheuer bezei<strong>ch</strong>nend. Man vgl. S<strong>ch</strong>önwerth,<br />
Oberpf. Sag. 2, 270. Leopre<strong>ch</strong>ting, Aus dem Le<strong>ch</strong>rain, pg. 35<br />
stellt zusammen : enteris<strong>ch</strong>e Plätze, verwuns<strong>ch</strong>ene Hölzer und dem<br />
Teufel vers<strong>ch</strong>riebene S<strong>ch</strong>lu<strong>ch</strong>ten. Die baieris<strong>ch</strong>e Mundart spri<strong>ch</strong>t<br />
beiderlei Formen: enteris<strong>ch</strong> und enzis<strong>ch</strong>. In der S<strong>ch</strong>weizermundart<br />
s<strong>ch</strong>eint derselbe Fall zu gelten. Ein Enzigraben liegt beim Dorfe<br />
Moosleerau. Einen örtli<strong>ch</strong>en Entibühel leitet bei uns die Volks¬<br />
etymologie zwar unglückli<strong>ch</strong>, aber glei<strong>ch</strong>wohl sagengemäss von<br />
den im dortigen Gestein si<strong>ch</strong> abspürenden Entenfüss<strong>ch</strong>en her. Rie¬<br />
senbauten und aufgethürmte Steinblöcke nennt man im Norden<br />
enta geveorc, entis<strong>ch</strong>e Werke. Dass man sie nun auf die Türken,<br />
Zigeuner und Franzosen bezieht, d. h. na<strong>ch</strong> der Volksmeinung auf<br />
die fur<strong>ch</strong>tbarsten Feinde der Welt, verhält si<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t anders, als<br />
wie der nun herrs<strong>ch</strong>ende Brau<strong>ch</strong>, in unsern ländli<strong>ch</strong>en Frühlings¬<br />
und Pfingstspielen den Winterriesen als Türken auftreten zu lassen.<br />
Mannhardt, Mythen 354.<br />
Grenzsteine.<br />
Die Wandersitte, Steine auf den Gebirgspässen an vorbestimm¬<br />
ten Stellen zu Haufen aufzus<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten und immer einen neuen da¬<br />
bei niederzulegen, hat in Asien und Europa bis heute fortbestan¬<br />
den. Herodot 4, 92 s<strong>ch</strong>reibt sie dem Perserkönig Darius zu, der<br />
auf seinem Zuge gegen die Skythen an den Istros gelangend jedem<br />
Mann seines Heeres befahl, einen Stein an einen vorbestimmten<br />
Ort hinzulegen, und so daselbst grosse Steinhügel zurückliess.<br />
Prinz Waldemar von Preussen bes<strong>ch</strong>reibt in seiner Indis<strong>ch</strong>en Reise<br />
den Pilingah-Pass, über dessen Kamm die Grenze zwis<strong>ch</strong>en dem<br />
indo-britis<strong>ch</strong>en und dem <strong>ch</strong>inesis<strong>ch</strong>en Rei<strong>ch</strong>e fortläuft; er liegt<br />
12,700 Fuss über dem Meeresspiegel. Eine Menge von Stein¬<br />
pyramiden verkünden die Passhöhe, zu denen jeder Vorübergehende<br />
sein Stein<strong>ch</strong>en beilegt. Allg. Augsb. Ztg. 1857, no. 342. Strabo<br />
spri<strong>ch</strong>t bei Erwähnung des Herkulestempels auf dem Vorgebirge
86<br />
Cuneus sehr dunkel von gewissen Steinen, die dorten zu gottes¬<br />
dienstli<strong>ch</strong>en Zwecken zusammengehäuft und der Sage na<strong>ch</strong> von<br />
jedem hier Ankommenden umgedreht werden mussten : einer vater¬<br />
ländis<strong>ch</strong>en Sitte gemäss. Es s<strong>ch</strong>eint si<strong>ch</strong> diese Bemerkung auf die<br />
Gnappsteine zu beziehen, die man ersteigt und mit Körperbewegungen<br />
in S<strong>ch</strong>wung setzt. Allein W. v. Humboldt bemerkt in der Unter¬<br />
su<strong>ch</strong>ung über die vaskis<strong>ch</strong>e Spra<strong>ch</strong>e (Gesamm. Werke 2, 176), dass<br />
ebenso an der galicis<strong>ch</strong>-baskis<strong>ch</strong>en Grenze grosse Steinhaufen zu<br />
sehen sind, zu denen jeder in das übrige Spanien auswandernde<br />
Galicier entweder beim Fortgehen oder beim Wiederkommen einen<br />
neuen Stein wirft. So hatte au<strong>ch</strong> jeder Grie<strong>ch</strong>e, an den Wege¬<br />
statuen des Gottes Hermes vorüberwandernd, einen Stein zu den<br />
dort liegenden zu thun. Diese Anhäufungen nannte man na<strong>ch</strong> dem<br />
damit verehrten Gott Hermäen. Der einfa<strong>ch</strong>ste Hirtengott, ur¬<br />
sprüngli<strong>ch</strong> unter dieser rohen Gestalt des Wegsteines verehrt, ge¬<br />
staltete si<strong>ch</strong> daraus zu einem Weg und Steg, Heimath und Grenze,<br />
Handel und Wandel behütenden Gott des Eigenthums und Re<strong>ch</strong>tes.<br />
Dem Sennenges<strong>ch</strong>äfte vorstehend, das Felsgerölle aus den Triften<br />
wegräumend, Wald und Flur wegsam ma<strong>ch</strong>end, so s<strong>ch</strong>afft der<br />
Hermesdienst die wilde Weide zur wirthli<strong>ch</strong>en um und eröffnet das<br />
Land dem Verkehr. Na<strong>ch</strong> diesen mehrfa<strong>ch</strong>en Zwecken nun sind<br />
ähnli<strong>ch</strong>e Bräu<strong>ch</strong>e zu bemessen, wie sie si<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> in vers<strong>ch</strong>iedenen<br />
Landstri<strong>ch</strong>en vorfinden.<br />
Wenn die Kinder von Burgeis im Vints<strong>ch</strong>gau das erste Mal die<br />
Alpe ihres Dorfes besu<strong>ch</strong>en, so müssen die Neulinge einem vor¬<br />
ges<strong>ch</strong>riebenen Gebrau<strong>ch</strong> si<strong>ch</strong> unterziehen, dessen Verna<strong>ch</strong>lässigung<br />
den Segen von der Alp nehmen würde. Wo der Steig zur Zerzeralpe<br />
geht und nun eine Martinskapelle steht, da heisst ein Platz Zu<br />
den Wilden Fräulein. Hier befindet si<strong>ch</strong> ein Steinhaufen, unter<br />
dem die Wilden Fräulein ruhen sollen. Das Kind muss einen Stein<br />
davon aufnehmen, ihn anspucken, wieder zum Haufen legen und<br />
spre<strong>ch</strong>en: I<strong>ch</strong> opfere, i<strong>ch</strong> opfere den Wilden Fräulein! Au<strong>ch</strong> Er¬<br />
wa<strong>ch</strong>sene üben denselben Brau<strong>ch</strong>, sie würden sonst unbegleitet an<br />
dieser Stelle ni<strong>ch</strong>t wohl vorbeigehen können. Zingerle, Zts<strong>ch</strong>r. f.<br />
Myth. 2, 61. Tirolersitten, no. 956. Panzer, Baier. Sag. 2, no. 200.<br />
Wo Wilde Frauen sind, hat das Gebirge au<strong>ch</strong> Wilde Männer;<br />
die so gelegten Steine heissen daher au<strong>ch</strong> Mannli. Einer der Wil¬<br />
den Männer Tirols hatte seine Höhle ob Gnadenwald in einer Fels¬<br />
wand, in die ein ungeheures Thor führte. Als er gestorben war,<br />
s<strong>ch</strong>oben si<strong>ch</strong> die Felsen zusammen und s<strong>ch</strong>lössen das Lo<strong>ch</strong>; der<br />
s<strong>ch</strong>warze Streifen, der diese Fugen no<strong>ch</strong> anzeigt, heisst dorten
87<br />
das Mand'l. Alpenburg, Tirol. Myth. 1, pg. 15. Die Steinhaufen<br />
in den s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en und piemontesis<strong>ch</strong>en Alpenpässen, die auf<br />
einander verweisend dem Wanderer in den pfadlosen S<strong>ch</strong>nee¬<br />
wüsten als Führer dienen, nennt man deuts<strong>ch</strong> Mann, wels<strong>ch</strong> mar¬<br />
ron, aus latein. matronae und murenulae. Eine ahd. Glosse aus<br />
dem S. Jahrhundert führt dieselben s<strong>ch</strong>on an: murenulas: menni,<br />
sie führt auf murex, bei Virgil den ragenden Spitzfelsen bezei<strong>ch</strong>¬<br />
nend. No<strong>ch</strong> weiter dehnen die Deuts<strong>ch</strong>walliser den Begriff dieses<br />
Wortes aus; sie benennen den ganzen Gebirgsstock des mä<strong>ch</strong>tigen<br />
Matterhoms und der 11,000 Fuss hohen Tête blan<strong>ch</strong>e am Weissliorn<br />
ebenfalls zum Männlein, das wegweisend vielfa<strong>ch</strong> droben aufgethürmt<br />
steht: z'Mannje. Es<strong>ch</strong>er, Die S<strong>ch</strong>weiz 1851, 386. Da<br />
bereits das Heidcnthum in der Befolgung jenes Brau<strong>ch</strong>es ein gutes<br />
Werk sah, so durfte derselbe au<strong>ch</strong> zur Zeit der Bekehrung no<strong>ch</strong><br />
fortgeübt werden. Die Mön<strong>ch</strong>e von Bernard-Fagne sagten jedem<br />
Wallfahrer, dass je s<strong>ch</strong>werern Stein einer auf den nahen Kloster¬<br />
berg trüge, desto grösserer Sündenlast er los würde. Wolf, Ndl.<br />
Sag. no. 334. Daher wurde es eine Knabensitte, am hl. Abend<br />
vor Weihna<strong>ch</strong>ten eine hohe Steinpyramide aufzuthürmen, wie es<br />
auf dem Tungelsberge bei S<strong>ch</strong>weina ges<strong>ch</strong>ah und von Herzog im<br />
Thüringer Tas<strong>ch</strong>enb. 3S5 bes<strong>ch</strong>rieben ist. Menzel in Pfeiffers Ger¬<br />
mania 2, 234. Auf dem s<strong>ch</strong>lesis<strong>ch</strong>en Zobtenberge s<strong>ch</strong>eint man diese<br />
Steinhaufen angelegt zu haben, indem man zuglei<strong>ch</strong> die dorten<br />
liegenden rohen Steinbilder eines Bären, Wolfs und einer Sau als<br />
heidnis<strong>ch</strong>e steinigte.' Das angebli<strong>ch</strong>e Steinbild der Sau ist jetzt von<br />
einem Steinhaufen gänzli<strong>ch</strong> überdeckt, denn jeder Vorübergehende<br />
warf seinen Stein dazu und rief: Sau, hier hast du dein Ferkel!<br />
Weinhold, S<strong>ch</strong>les. Wörterb. 79.<br />
Mit diesen Steinhaufen, dur<strong>ch</strong> die man das Gebirg wegsam<br />
ma<strong>ch</strong>t und die Fluren klärt, hängt die Mythe zusammen von dem<br />
si<strong>ch</strong> rührenden Stein, auf wel<strong>ch</strong>e wir nun kommen.<br />
Wenn der äusserste Grenzstein im Gemeindebann einmal Mittag<br />
läuten hört, so springt er ringsum. Aarg. Spw. Der Solenstein bei<br />
Ins im Berner Seelande, au<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>alen stein genannt, dreht si<strong>ch</strong><br />
einmal um, wenn die Sonne im Mittagspunkte steht (Jahn, Kelt.<br />
Alterth. der S<strong>ch</strong>weiz). Wenn der Hahn kräht, rührt si<strong>ch</strong> der<br />
s<strong>ch</strong>were Stein zu Bis<strong>ch</strong>ofsheim. Simrock, Räthselb. 2, no. 196.<br />
Wenn hinten im Tiroler Ultenthale beim Hofe Hinterpilsen ein Hahn<br />
kräht, so bewegt si<strong>ch</strong> der Stein am Ausserhofe im Thaleingange<br />
oberhalb Lana. Dieser Stein aber ist ein kolossaler Felskegel, da<br />
gelegen, wo die S<strong>ch</strong>lu<strong>ch</strong>ten gegen den Zufall-Ferner hintergehen
88<br />
zu dem verglets<strong>ch</strong>erten Ende der Welt". Alpenburg, Tirol. Sag.<br />
1, pg. 180. S<strong>ch</strong>mitz in den Eiflersagen 2, 114 verlegt den Na<strong>ch</strong>¬<br />
druck eines ähnli<strong>ch</strong>en Glaubenssatzes auf das bedingende Wenn<br />
und behauptet: Wenn der Teufelsstein, wel<strong>ch</strong>er an der Kir<strong>ch</strong>e<br />
von Malmedy liegt, Mittag läuten hört, so dreht er si<strong>ch</strong> dreimal<br />
herum. Mit dieser Sylbenste<strong>ch</strong>erei ist aber do<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t aus der<br />
S<strong>ch</strong>linge zu kommen, denn s<strong>ch</strong>on lange, zuvor man jemals Mittag<br />
läutete, kannte man in Scandinavien s<strong>ch</strong>on denselben Satz; er steht<br />
im Skaldskaparmâl der Edda. Daselbst wird von dem Steine, der<br />
si<strong>ch</strong> in Thôrrs Götterhaupt rühre, so oft man Wetzsteine wirft,<br />
Na<strong>ch</strong>folgendes erzählt. Hrungni, der Grösste und Stärkste im<br />
Riesenlande, hatte ein Haupt von Stein, ein Herz aus einem drei¬<br />
eckigen, s<strong>ch</strong>arfen Kiesel, und brau<strong>ch</strong>te im Kampfe Steins<strong>ch</strong>ild und<br />
Steinbeil. So gerüstet kam er zu den Äsen und forderte den Thôrr<br />
zum Zweikampfe. Thôrr hatte ni<strong>ch</strong>ts als seinen nie fehlenden Ham¬<br />
mer Miöllnir, der Riese seinen Heinn, einen S<strong>ch</strong>leifsteinfels. Thôrrs<br />
Hammer traf im Fluge Hrungni's Heinn, dass dieser in tausend<br />
Stücke zersplitterte und dem Riesen das Haupt zers<strong>ch</strong>mettert wurde.<br />
Von den Trümmern, in die der Getroffene zerfiel, kommen alle<br />
Heinberge oder Wetzsteinfelsen her, die es in der Welt giebt.<br />
Aber einer dieser Splitter war dem Thôrr selbst in's Haupt ge¬<br />
fahren. Er begab si<strong>ch</strong> daher zur zauberkundigen Frau Groa (d. h.<br />
zur grünen Alp, von der S<strong>ch</strong>utthalde des Riesen hinweg), deren<br />
Gemahl Orendel erst jüngsthin dur<strong>ch</strong> Thôrr im Riesenlande befreit<br />
und in die Heimath zurückgebra<strong>ch</strong>t worden war. Als ihre Besegnungen<br />
und Bespre<strong>ch</strong>ungen so weit gewirkt hatten, dass der Stein¬<br />
splitter si<strong>ch</strong> zu lösen begann und bis zur Hälfte aus der Wunde<br />
heraustrat, wollte Thôrr dem Weibe no<strong>ch</strong> weiter Muth ma<strong>ch</strong>en<br />
und fieng an zu erzählen, wie er so eben ihren Gemahl im Trag¬<br />
korb über die Eisströme hergetragen habe und dass derselbe wohl¬<br />
behalten alsbald da sein werde. Darüber la<strong>ch</strong>te Groa vor Freuden<br />
auf und vergass die Besegnung fortzusingen. Da stand der Stein¬<br />
splitter wieder im Haupte fest und liess si<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> keine neuen<br />
Lieder mehr lockern. Deshalb hat Donar für alle Zeiten den Stein<br />
in seinem Haupte, und eben deshalb, fügt die Edda bei, ist es<br />
eines Jeden Pfli<strong>ch</strong>t, mit sol<strong>ch</strong>en Wetzsteinen ni<strong>ch</strong>t zu werfen, denn<br />
ebenso oft rührt si<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>merzend der Splitter in Thôrrs Haupte.<br />
Wel<strong>ch</strong>es ist nun der Sinn der Sage vom Steinsplitter in Thôrrs<br />
Haupte<br />
Kaum ein anderer, als dass der die unfru<strong>ch</strong>tbaren Felsenhäupter<br />
und störrigen Riesens<strong>ch</strong>ädel Zers<strong>ch</strong>metternde ursprüngli<strong>ch</strong> selbst
89<br />
riesig gewesen sei und ein glei<strong>ch</strong>es steinernes Haupt gehabt habe.<br />
Dies mö<strong>ch</strong>te si<strong>ch</strong> am ri<strong>ch</strong>tigsten ergeben aus der Thôrrsmythe, wie<br />
sie von den Scandinaviem auf das Volk der Lappen übergegangen<br />
ist. Zuglei<strong>ch</strong> mit dem roher verbliebenen Zustande ist bei diesen<br />
nebst einer Reihe gothis<strong>ch</strong>er Wurzelwörter, die sie unverändert<br />
von ihrem einstigen gothis<strong>ch</strong>en Grenzna<strong>ch</strong>bar in ihre Spra<strong>ch</strong>e her¬<br />
übernahmen (Dietri<strong>ch</strong>, in Haupts Zts<strong>ch</strong>r. liefert hierüber den Na<strong>ch</strong>¬<br />
weis), au<strong>ch</strong> der nordis<strong>ch</strong>e Mythus ursprüngli<strong>ch</strong>er verblieben. Dorten<br />
hatte das hölzerne Standbild des Donnergottes Tiermes einen<br />
Kiesel im Haupte stecken und einen Stahl dazu, so dass man an<br />
das Feuers<strong>ch</strong>lagen erinnert wurde. S<strong>ch</strong>wenk, Sinnbilder 230. Aber<br />
au<strong>ch</strong> das classis<strong>ch</strong>e Alterthum pflegte die rohen Steinfetis<strong>ch</strong>e aus<br />
früherer Zeit, glei<strong>ch</strong>sam zum Angedenken an den veralteten Glau¬<br />
ben, in die Tempelstatuen, statt des Kopfes des Gottes, einzusetzen.<br />
Friedrei<strong>ch</strong>, Symbolik, verweist dabei auf :<br />
Zoega Li bassirelievi<br />
anti<strong>ch</strong>i di Roma I, 49. 82. 90. Das altrömis<strong>ch</strong>e Bild des Jupiter<br />
war glei<strong>ch</strong>falls ein blosser Kieselstein, es war der lapis silex, oder<br />
lapis capitolinus, aufgestellt im Tempel des Jupiter Feretrius und<br />
daraus hervorgeholt, um Eids<strong>ch</strong>würe darauf abzulegen, Bündnisse<br />
zu s<strong>ch</strong>liessen (per jovem lapidem jurare. Cicero, adfam. VII, 12),<br />
das Opferthier damit abzuste<strong>ch</strong>en, oder den Eidbrü<strong>ch</strong>igen symbo¬<br />
lis<strong>ch</strong> damit todtzuwcrfen, Livius 1, 24, alles dieses aus dem Grunde,<br />
weil, wie Servius (zu Virgils Aen. 8, 641) ausdrückli<strong>ch</strong> angiebt,<br />
die Alten den Kiesel für ein Bild des Jupiter gehalten hätten. Na<strong>ch</strong><br />
altdeuts<strong>ch</strong>er Re<strong>ch</strong>tssitte wurden beim Blauen Stein Eide abgelegt :<br />
Vota ad lapides in ruinosis et silvestris locis. (Myth., Anh. XXXV.)<br />
Man bei<strong>ch</strong>tet na<strong>ch</strong> Mär<strong>ch</strong>en und Localsage dem Blauen Stein, der<br />
Rolandssäule, dem Ofen der Zunftstube. Denn wie die Rolands¬<br />
säule auf dem Markt und vor den Rathhäusem dem Stärkegott Donar,<br />
als dem S<strong>ch</strong>irmer des Re<strong>ch</strong>tes, geweiht war, so ihm als dem Eheund<br />
Herdgotte au<strong>ch</strong> der Ofen. Der Grüne Stein musste beim<br />
Gottesurtheil des Kesselfangs aus dem siedenden Kessel mit nacktem<br />
Arme herausgeholt werden; so thut Gudrun in der Edda (Simrocks<br />
Uebers. 240). Grimm, RA. 922. Die heidnis<strong>ch</strong>e Weisung, keine<br />
Feuersteine und S<strong>ch</strong>leifsteine zu werfen, damit si<strong>ch</strong> dadur<strong>ch</strong> der<br />
in Thôrrs Haupt steckende ni<strong>ch</strong>t s<strong>ch</strong>merzend mitrühre, lautet heut<br />
zu Tage verallgemeinert: Ist der Wurf aus der Hand, so ist er<br />
des Teufels. Zuglei<strong>ch</strong> aber empfindet sol<strong>ch</strong> ein heidnis<strong>ch</strong>er Teufels¬<br />
stein es ebenso s<strong>ch</strong>merzli<strong>ch</strong>, wenn das Geläute <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>er Glocken<br />
bis zu ihm ertönt. Bei uns zu Lande gilt nur no<strong>ch</strong> die Redensart:<br />
Der letzte Feldstein der Dorfgemarkung springe dreimal im Kreise
90<br />
herum, wenn man dereinst das Mittagsgeläute bis zu ihm hinaus<br />
vernehmen werde. Diesen Satz erklärt si<strong>ch</strong> Holtei in dem Roman<br />
Die Eselsfresser" 2, 254, dahin: Man habe sonst in S<strong>ch</strong>lesien zu<br />
sagen gepflegt, in jenen Dörfern, wo das Glockengeläute der<br />
grossen Städte hörbar sei, wären die Einwohner keine re<strong>ch</strong>ten<br />
Landleute mehr, sondern halb verdorbene Städter. Allein au<strong>ch</strong><br />
diese Erklärung wird dur<strong>ch</strong> die weitern Formeln, die unser Leit¬<br />
satz mit entwickelte, gänzli<strong>ch</strong> widerlegt. Zu Stendal, Perleberg<br />
und Belgcrn stehen alte Stcinfiguren an Thor und Marktplatz, die<br />
man Rolande nennt; davon heisst es: Wenn der steinerne Roland<br />
die Mittagsglocke läuten hört, so kehrt er si<strong>ch</strong> auf seiner Brunnensäule<br />
um. Femer zu Bamberg: Wenn die steinernen Domkröten<br />
am Portale der Domkir<strong>ch</strong>e am Charfreitage läuten hören (bekannt¬<br />
li<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>weigen zu dieser Frist dann die katholis<strong>ch</strong>en Kir<strong>ch</strong>englocken),<br />
so krie<strong>ch</strong>en sie um den Dom herum. Zöpfl, Re<strong>ch</strong>tsalterthümer 3,<br />
164. 247. 270. 288. Wenn die sog. Thuumsteine, deren einer in<br />
der Nähe von Trüstedt, ein glei<strong>ch</strong>er beim Dorfe Poppau in der<br />
preussis<strong>ch</strong>en Altmark liegt, den Hahn krähen hören, so drehen sie<br />
si<strong>ch</strong> um. Kuhn, Mark. Sag. S. 15. 26. Der Teufelsstein im Glanthale,<br />
Kant. Freiburg, beim Einflüsse der Gian in die Sane, ist<br />
ein 6 Fuss hoher pyramidaler Granitstein mit s<strong>ch</strong>ief dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittener<br />
Spitze. Seine regelmässigen Flä<strong>ch</strong>en deuten auf Behauung, zu¬<br />
glei<strong>ch</strong> ist der Eindruck einer mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en Fusssohle auf der Flä<strong>ch</strong>e<br />
zu sehen. Er ist ein Gespensterstein, ein Sammelplatz der Hexen.<br />
Letztere müssen ihn die drei Sonnwendnä<strong>ch</strong>te des Juli hindur<strong>ch</strong> in<br />
S<strong>ch</strong>aaren umtanzen, alsdann dreht si<strong>ch</strong> der Stein zuglei<strong>ch</strong> um si<strong>ch</strong><br />
selbst. (Mittheil, von Hartmann aus Freiburg.) Der bei Blois (Loire<br />
und Cher) auf einem Hügel stehende Dolmen heisst Mitterna<strong>ch</strong>ts¬<br />
stein, weil er si<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> dem Volksglauben alljährli<strong>ch</strong> in der Christ¬<br />
na<strong>ch</strong>t dur<strong>ch</strong> die Zauberkraft der Feen umdreht. Mone, Ges<strong>ch</strong>. d.<br />
Heidenth. 2, 361. Die Aargauer Sagen geben dasselbe über die<br />
Erdmänn<strong>ch</strong>en an; diese wandern aus dem Gebirge fort, wenn sie<br />
dort vom Glockens<strong>ch</strong>all, Hahnens<strong>ch</strong>rei, Mühlengeklapper und S<strong>ch</strong>miedegepo<strong>ch</strong>e<br />
errei<strong>ch</strong>t werden. Die Zwerge sind aber glei<strong>ch</strong>zeitig mit<br />
den Riesen entstanden, sie wu<strong>ch</strong>sen, sagt die Edda, im Fleis<strong>ch</strong>e<br />
des Urriesen Ymir von selbst, wie Maden. Der Riese also rührt<br />
si<strong>ch</strong> in dem Steine und su<strong>ch</strong>t vor dem verhassten Glockenklang zu<br />
entspringen. Zum Ueberflusse drückt es die S<strong>ch</strong>wed. Sage bei Af¬<br />
zelius 3, 192, ganz bestimmt aus : Felsstücke, bei Kir<strong>ch</strong>en liegend,<br />
nennt der S<strong>ch</strong>wede Riesensteine. Die Eindrücke, die man an ihnen<br />
findet, sind die Hand- und Fingerspuren des Riesen, der einst den
9t<br />
Fels gegen den Kir<strong>ch</strong>enbau s<strong>ch</strong>leuderte. Man behauptet, dass sol<strong>ch</strong><br />
ein Stein si<strong>ch</strong> jedesmal no<strong>ch</strong> umwende, so oft das Glockengeläute<br />
si<strong>ch</strong> vernehmen lässt." Der Ackerbau ist dem Riesen verhasst;<br />
theils also tanzt der Feldstein vor Freude, dass der Glockenklang<br />
das Riesenges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t zum Lande hinausges<strong>ch</strong>eu<strong>ch</strong>t hat; theils au<strong>ch</strong><br />
krümmt si<strong>ch</strong> der in den Feldstein verwandelte Riese vor S<strong>ch</strong>reck<br />
und S<strong>ch</strong>merz, wenn er unentrinnbar in den Boden gebannt vom<br />
Glockenzei<strong>ch</strong>en des Glaubens und der Cullur rings si<strong>ch</strong> umtönt hört.<br />
Hammerwurf, Stein- und Stabwurf sind Zei<strong>ch</strong>en re<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>er<br />
Uebergabe. Grimm, RA. 64. 162. 181. Der in unbetretenen Wild¬<br />
nissen zuerst si<strong>ch</strong> niederlassende Heilige vers<strong>ch</strong>leudert, des Weges<br />
unkundig und in der Wahl des Ortes zweifelhaft, seinen Stab. Wo<br />
dieser niederfällt, bestimmt ein im Wurfe getroffener Fels die Stelle<br />
der neu zu gründenden Einsiedelei. Der hl. Ursicinus, f 620, ist<br />
der Stifter des Juraklosters St. Ursitz oder Ursanne und wird in<br />
der Umgebung des Bielersees no<strong>ch</strong> als Patron verehrt. Er kam<br />
mit seinem Jünger Fromont in das Aisgau gewandert, Aisgaudia,<br />
na<strong>ch</strong> dem kleinen in den Doubs laufenden Fluss Alsa so genannt,<br />
und bestieg den Mont Repais, um von hier aus das Delsberger<br />
Thal zu übers<strong>ch</strong>auen und ihren Weilermars<strong>ch</strong> zu berathen. Der<br />
Mont Repais ist ein säulenartiger Fels, auf dem man das roh skizzirte<br />
Gesi<strong>ch</strong>t eines Mannes zu sehen glaubt, vermuthli<strong>ch</strong> ein alter<br />
Opferstein, na<strong>ch</strong>mals der Grenzstein der Probstei Ursanne. Un¬<br />
gewiss, wohin si<strong>ch</strong> wenden, sollen sie ihre Stöcke weithin ge¬<br />
s<strong>ch</strong>leudert haben. Der von Ursicinus fiel westwärts auf einen<br />
Felsen bei dem Doubs (Beridiai oder Beauregard), bohrte si<strong>ch</strong><br />
dorten in den Boden, Wurzeln treibend und als eine gewaltige<br />
Ei<strong>ch</strong>e si<strong>ch</strong> erhebend, die nun trotz aller von frommen Pilgern aus¬<br />
ges<strong>ch</strong>nittener Aeste und Aest<strong>ch</strong>en in steter Verjüngungskraft fort¬<br />
grünt. Der von Fromont ges<strong>ch</strong>leuderte Stab flog gegen Norden<br />
in einen tiefen Wald, wo dann der Jünger seine Einsiedelei er¬<br />
ri<strong>ch</strong>tete. Gelpke, S<strong>ch</strong>weiz. Kir<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>. 2, 167, na<strong>ch</strong> Quiquerez:<br />
Ueber die Sagen des Bisth. Basel.<br />
Steine reden, Steine s<strong>ch</strong>reien, denn Steine gelten als weis¬<br />
sagende Orakel.<br />
Was die ägyptis<strong>ch</strong>en Tempelpriester von der Memnonssäule den<br />
Pilgern erzählten, dass sie beim ersten Morgenstrahl der Sonne<br />
in einem lauten Tone erklinge, dies fand A. v. Humboldt auf sei¬<br />
nen Reisen an den Felsenufern des Orinoko auf naturhistoris<strong>ch</strong>em<br />
Wege zum Theil bestätigt. Die in dem porösen Gestein gefangene,<br />
kalte Na<strong>ch</strong>tluft entwi<strong>ch</strong> daraus beim ersten Anprall des Morgen-
92<br />
Sonnenstrahles mit einem die Luft dur<strong>ch</strong>klingenden Geräus<strong>ch</strong>e. Die<br />
erstarrten Theile gerathen dur<strong>ch</strong> die Temperaturvers<strong>ch</strong>iedenheit in<br />
Bewegung und dadur<strong>ch</strong> in ein momentanes Ertönen. Ein anderes<br />
Reden der Steine ist ihr E<strong>ch</strong>o, das in unserer Sage die Zwergen¬<br />
spra<strong>ch</strong>e heisst. Die S<strong>ch</strong>auer dieser Felsenspra<strong>ch</strong>e in den Wüsten<br />
des Ho<strong>ch</strong>gebirges lassen si<strong>ch</strong> aus folgender Thatsa<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong>fühlen.<br />
In den S<strong>ch</strong>nee- und Glets<strong>ch</strong>erwüsten zwis<strong>ch</strong>en Matterhorn und Monterosa<br />
führt ein wenig gekannter Glets<strong>ch</strong>erpass na<strong>ch</strong> Italien über den<br />
Arolaglets<strong>ch</strong>er hinüber. An den Eiswänden des dortigen Montgolon<br />
(Mont Colon s<strong>ch</strong>reibt Gotti. Studer) dient ein mehrere Sylben wie¬<br />
derholendes E<strong>ch</strong>o dem kühnen Wanderer als Wahrzei<strong>ch</strong>en, dass er<br />
in diesen tagereiseweiten Einöden hier in der gehörigen Ri<strong>ch</strong>tung<br />
na<strong>ch</strong> dem Val Palline hinüber vordringe. In sol<strong>ch</strong>en todesstarren¬<br />
den Eisthälem lässt si<strong>ch</strong> in Kürze mehr begreifen, als Eure S<strong>ch</strong>ul¬<br />
weisheit si<strong>ch</strong> träumen lässt, Horatio! und mehr glauben, als ein<br />
rationeller Christ zum Hausbedarf nöthig hat, unter anderm au<strong>ch</strong><br />
jene tiefe Wahrheit vom Amen der Steine, die in folgender Le¬<br />
gende von Kosegarten erzählt wird. Als der hl. Beda erblindet ist<br />
und glei<strong>ch</strong>wohl seine mühseligen Bekehrungsreisen no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t auf¬<br />
geben will, führt ihn der böse Bube, der ihm als Wegeleiter die¬<br />
nen muss, in die Wüste des Gebirges und meldet ihm, hier seien<br />
eben die Gläubigen zahlrei<strong>ch</strong> versammelt, um Gottes Wort zu ver¬<br />
nehmen. Soglei<strong>ch</strong> beginnt der eifrige Redner den Vortrag, und<br />
als der Strom seiner langen Begeisterung endigt, rufen die herzund<br />
gehörlosen Steine der Oede ein bewegtes S<strong>ch</strong>luss-Amen dazu.<br />
Mehrfa<strong>ch</strong> wird von der Gebirgssage dieses Wunder wiederholt. Bis<br />
in die S<strong>ch</strong>lu<strong>ch</strong>t des Teufelslo<strong>ch</strong>es bei Ber<strong>ch</strong>tesgarden wurde die hl.<br />
Agnes vom Teufel verfolgt; als der Böse ihr sogar hier na<strong>ch</strong>drang,<br />
s<strong>ch</strong>loss si<strong>ch</strong> hinter der Jungfrau der Fels s<strong>ch</strong>ützend ab. Wenn nun<br />
jährli<strong>ch</strong> einmal am Sonnenwendtage der Sonnenstrahl hinunter in<br />
diese S<strong>ch</strong>lu<strong>ch</strong>t trifft, jau<strong>ch</strong>zt und juheit drinnen die steinerne Agnes.<br />
Panzer, Baier. Sag. 1, no. 12. Bei elsässis<strong>ch</strong> Ober-A<strong>ch</strong>ern singen<br />
sieben Fräulein in einem ges<strong>ch</strong>lossenen Stein ein Marienlied, denn<br />
jene ganze Kir<strong>ch</strong>e, in die hinein sie den verfolgenden Hunnen<br />
entsprangen, verwandelte si<strong>ch</strong> hinter ihnen in einen ges<strong>ch</strong>lossenen<br />
Felsen. Nodnagel, Sagenb. no. 167. Eine Ballade von A. Kopis<strong>ch</strong><br />
über diesen Stein zu A<strong>ch</strong>em verfasst, s<strong>ch</strong>liesst also :<br />
Der Wand'rer, der vorüberzieht,<br />
Hört no<strong>ch</strong> im Stein der Frommen Lied.<br />
Mariastein ist ein Feldstein in dem Banne des Frickthaler Dorfes<br />
Wegenstetten, auf dem die Arbeiter zu ruhen pflegen. No<strong>ch</strong> vor
93<br />
Mannesgedenken hat man in ihm die Maria zu regelmässigen Zeiten<br />
gar s<strong>ch</strong>ön singen hören. Aarg. Sag. 1, no. 77.<br />
Längst s<strong>ch</strong>on hat der Volkshumor si<strong>ch</strong> dieses Glaubens zu sei¬<br />
nen derben Spässen bemä<strong>ch</strong>tigt und neue Ortsbräu<strong>ch</strong>e daraus ge¬<br />
s<strong>ch</strong>affen. Der Güngglerstein ist ein Mar<strong>ch</strong>stein zu Hornussen, der<br />
am Fricker Berge Staats- und Gemeindewaldung trennt. Die Kna¬<br />
ben sagen einem Neuling unter ihnen, er solle die Ohren an diesen<br />
Stein halten und hor<strong>ch</strong>en, wie es drinnen singe und läute. Er<br />
thut's und man stosst ihm den Kopf daran, dass ihm die Ohren<br />
sausen. Damit soll er dieses Günggeln und zuglei<strong>ch</strong> den Standort<br />
des Steines im Gedä<strong>ch</strong>tnisse behalten. Bei der Bannbe.s<strong>ch</strong>reitung,<br />
die man zu Rheinfelden alljährli<strong>ch</strong> abhält, pflegt man die jüngsten<br />
Knaben auf die äusserste Grenze zu s<strong>ch</strong>icken zur Besi<strong>ch</strong>tigung der<br />
dorten stehenden Marken. Hier pflegt man sie bei demjenigen<br />
Steine, an dem dreierlei Gemarkungsgebiete zusammentreffen,<br />
emporzuheben und stosst sie so unsanft auf den Stein nieder,<br />
dass sie dran gedenken". Im Ocsterrei<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>en heisst dies, einen<br />
lunzen. Vernaleken, Alpensag. 394. Im rheinpfälzis<strong>ch</strong>en Orte<br />
Weissenheim am Berg wird der in's Bürgerre<strong>ch</strong>t Neuaufgenommene<br />
zugestutzt", eingestossen. Es stellt si<strong>ch</strong> der Bürgermeister<br />
in Amtstra<strong>ch</strong>t sammt dem Gemeinderathe beim Rathhause auf<br />
vor<br />
dem Stein". Hier fassen je vier Männer den Neubürger an Hän¬<br />
den und Füssen, der Bürgermeister packt ihn dann am Nacken und<br />
stosst ihn auf den Stein. Der dumpfere oder hellere Ton beim<br />
Aufstossen wird prophetis<strong>ch</strong> gedeutet für die Gediegenheit des jungen<br />
Mitbürgers. Den Bes<strong>ch</strong>luss ma<strong>ch</strong>t cin S<strong>ch</strong>mauss, zu dem der Neueingestutzte<br />
Wein, Käse, Brod und einen Hut voll Nüsse steuern<br />
muss. Alle Wittwen des Dorfes dürfen si<strong>ch</strong> ihren Antheil von<br />
Wein und Käse holen. Riehl, die Pfälzer 325.<br />
Die Folge des S<strong>ch</strong>reiens und Singens der Steine ist ihr wei¬<br />
teres Vermögen der Weissagung und des Urtheilspre<strong>ch</strong>ens. Der<br />
Ire nannte den Steinhaufen car, den Priester, ableitend von car,<br />
cairneac. Myth. 1203. Der dreieckige, rothgraue Orakelstein der<br />
Iren hiess Laig-Fail und lag in einem Haine auf dem Hügel Temhuir;<br />
er bestimmte die Königswahl dadur<strong>ch</strong>, dass er einen Ton von<br />
si<strong>ch</strong> gab, wenn ein ihm willkommener Wahlfürst si<strong>ch</strong> auf ihn setzte.<br />
Er wurde später na<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>ottland gesendet, um dorten die Erobe¬<br />
rung des Landes zu befestigen, dann liess ihn Eduard L, na<strong>ch</strong> der<br />
Unterwerfung S<strong>ch</strong>ottlands 1295, na<strong>ch</strong> England führen und im Krö¬<br />
nungsstuhl der englis<strong>ch</strong>en Könige anbringen. Jetzt befindet er si<strong>ch</strong><br />
in der Westmünsterabtei. Friedrei<strong>ch</strong>, Symbol. 129. Die upsalis<strong>ch</strong>en
94<br />
Wahlkönigc wurden auf den Stein gehoben, der auf der Wiese<br />
Mora zu diesem Zwecke lag. Ein sol<strong>ch</strong>er Stein des Wahlplatzes<br />
und der Geri<strong>ch</strong>tsstätte hiess ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> Landthing, zu Worms der<br />
s<strong>ch</strong>warze Stein, zu Köln der blaue. Den zum Tode Verurtheilten<br />
wurde vom Henker der Rücken daran gebro<strong>ch</strong>en. Grimm,<br />
RA. 236. 803. Einen etwas humoristis<strong>ch</strong>en Anstri<strong>ch</strong> hatte jener<br />
S<strong>ch</strong>andstein, den straffällige Weiber öffentli<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>leppen mussten,<br />
obs<strong>ch</strong>on er s<strong>ch</strong>wer genug war, um mit seinem Gewi<strong>ch</strong>te au<strong>ch</strong><br />
Riesinnen zu ermüden. Der kleinste jener drei Laslersteine zu<br />
S<strong>ch</strong>affhausen, die bis zum J. 1836 vor dem dortigen Rathhause<br />
hiengen, mo<strong>ch</strong>te 60 Pfund wiegen, der grösste mehr als dreimal<br />
so viel. Im Thurn, Kant. S<strong>ch</strong>affhausen 102. Derjenige zu Winter¬<br />
thur wog zwar nur 25 Pfd., musste aber unter Trommels<strong>ch</strong>lag und<br />
Begleitung des Büttels dur<strong>ch</strong> sämmtli<strong>ch</strong>e vier Kreuzgassen der Stadt<br />
gezogen werden. Troll, Ges<strong>ch</strong>. v. Winterthur 4, 65. Die öster¬<br />
rei<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>en Pantaidinge (bearbeitet von Osenbrüggen 1863, 56)<br />
verfallen die S<strong>ch</strong>uldige, so oft sie auf diesem Gange rastet, in eine<br />
Busse von 72 Pfenn. Inzwis<strong>ch</strong>en legte der Ri<strong>ch</strong>ter drei Holzbe<strong>ch</strong>er<br />
in ein eimerhaltiges Fass Wein, und alle jungen Knaben des Fried¬<br />
kreises tranken es auf Kosten des Weibes leer. Dieser Strafstein<br />
trug na<strong>ch</strong> der vielnamigen Zungensünde vielfa<strong>ch</strong>e Namen. Er hiess<br />
Klapperstein. S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong> ist Klappertäts<strong>ch</strong> die Plaudertas<strong>ch</strong>e. So<br />
bezei<strong>ch</strong>nete er das lästernde Grossmaul der Riesinnen, die im Nor¬<br />
den unter dem bes<strong>ch</strong>impfenden Namen Munnridha (Mundklapper)<br />
und Munnharpa (Mundklemme) erwähnt werden. Er hiess ferner<br />
Po<strong>ch</strong>stein, von po<strong>ch</strong>en, trutzen; Pagstein, von bagen und balgen,<br />
zanken; Bogstein, von ndd. Bogge, giftige Kröte, so z.B. in den<br />
Statuten von S<strong>ch</strong>leiz von 1625, und demgemäss au<strong>ch</strong> Krötenstein,<br />
weil man die Kröte glei<strong>ch</strong>falls einen geheimnissvollen Stein im<br />
Haupte tragen lässt; s<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> Wagstein, von bewegen, wie<br />
au<strong>ch</strong> die auf ihrer Spitze bewegli<strong>ch</strong> ruhenden Orakelsteine genannt<br />
wurden.<br />
Ueber die Dreisteine als sagenumflo<strong>ch</strong>tene Grenzpunkte habe<br />
i<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong>folgende Einzelnheiten gesammelt.<br />
Der Dreifingerstein mit der Sage von einem in ihm vers<strong>ch</strong>lun¬<br />
genen landräuberis<strong>ch</strong>en Sennen steht an der Grenze zwis<strong>ch</strong>en den<br />
Ländern Züri<strong>ch</strong>, Zug und S<strong>ch</strong>wyz. Reithard, Sag. a. d. S<strong>ch</strong>weiz<br />
152. Der Dreiräts<strong>ch</strong>istein bildet die Grenzs<strong>ch</strong>eide zwis<strong>ch</strong>en den<br />
Orten Rütihof, Birmenstorf und Tätwyl im Bezirk Baden. Wenn<br />
die Thüringer, Fuldaer und Henneberger auf ihrem Grenzbegang<br />
glei<strong>ch</strong>zeitig am steinernen Tis<strong>ch</strong>e des Dreiherrensteines si<strong>ch</strong> be-
95<br />
gegneten, so assen sie au<strong>ch</strong> zusammen aus Einer S<strong>ch</strong>üssel. Ziegler,<br />
Der Rennstieg des Thüring. Waldes 1862. Die Burg Dreistein im<br />
Riesengebirge liegt an der S<strong>ch</strong>lesis<strong>ch</strong>en Grenze, drei senkre<strong>ch</strong>t<br />
stehende Felsecken im Innern der Ruine sollen den Eingang zu<br />
einer S<strong>ch</strong>alzgrotte ma<strong>ch</strong>en, die von einem rothkäppigen Zwerg<br />
gehütet wird. Grohmann, Böhm. Sagb. 1, 172. Auf dem Drei¬<br />
sesselstein im Böhmerwalde, drei Stunden von Salnau entfernt,<br />
sassen in der Heidenzeit drei Könige und bestimmten von ihm aus<br />
die Grenzen der drei Lande Böhmen, Baiern und Oesterrei<strong>ch</strong>.<br />
Alsdann geboten sie, dass der Wald ringsum Einöde bleibe auf<br />
ewige Zeiten. Der vereinödete Wald ist also ein heiliger Hain<br />
gewesen und die drei dorten auf dem Berge in den Fels gehaue¬<br />
nen Sessel waren der Sitz der drei Grenzgötter. Grohmann, ibid.<br />
1, 260. Hinter der Burgruine Thierstein im Beinwyler Thal, Kant.<br />
Solothurn, liegt zwis<strong>ch</strong>en zwei Juraklippen eingekeilt ein kugel¬<br />
runder Felsblock. Er ist der Sage na<strong>ch</strong> an Ketten angebunden,<br />
und wenn einst ein Feind in dies Ho<strong>ch</strong>thal hinaufzieht, wird der<br />
Stein sein Doppellager verlassen und gegen denselben zers<strong>ch</strong>met¬<br />
ternd die Burghalde hinabrollen. S<strong>ch</strong>weiz. Ritterburgen 3, 267.<br />
An die Dreisteine reihen si<strong>ch</strong> die Fünfsteine, wie der Daumen¬<br />
hands<strong>ch</strong>uh und der Hands<strong>ch</strong>uh mit fünf Fingern als Grenzzei<strong>ch</strong>en<br />
eingehauen waren. Der Daumen ist ein bekannter Berg im Algäu,<br />
der Fünffingerlistock ein Glets<strong>ch</strong>erberg südli<strong>ch</strong> von der Titiis<br />
gruppe gelegen. Daraus wird si<strong>ch</strong> die Mythe von Thôrrs nä<strong>ch</strong>t¬<br />
li<strong>ch</strong>em Abenteuer im Riesenlande erklären lassen. Als dieser näm¬<br />
li<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> Utgard (Aussengarten, Ausland) reist und hier zum ersten<br />
Male überna<strong>ch</strong>tet, wird er dur<strong>ch</strong> ein Erdbeben aufges<strong>ch</strong>reckt und<br />
entflieht aus seiner Waldhütte in einen daneben stehenden kleinern<br />
Anbau. Beim anbre<strong>ch</strong>enden Morgen sieht er aber, dass die ganze<br />
Hütte ni<strong>ch</strong>ts anderes ist, als ein Hands<strong>ch</strong>uh des nebenan s<strong>ch</strong>lafen¬<br />
den Riesen und der kleinere Anbau der Däumling dieses Hand¬<br />
s<strong>ch</strong>uhes. Der an der Grenze überna<strong>ch</strong>tende Gott erkennt erwa<strong>ch</strong>end<br />
also, dass er an dem mit riesigen Malzei<strong>ch</strong>en behauenen Grenzstein<br />
gelegen habe. Der Hands<strong>ch</strong>uh wurde beim Markenbegang vorge¬<br />
wiesen. In Sigehardi miracul. S. Maximini (Pertz, Mon. VI. 232)<br />
heisst es darüber: circumduclor ibat et ciroteca, quam rustici<br />
wantum vocant, manu superdueta demonstravil. Diese Sitte also<br />
wird namengebend für Grenzfelsen. Ein spitz zulaufender s<strong>ch</strong>war¬<br />
zer Trappfelsen auf den Färöem heisst, na<strong>ch</strong> den Fingern der<br />
Troldenfrau, Trollkonefingeren. Weinhold, Die Riesen 32. Der<br />
Riese zu Sonnerup (in Thiele's Dan. Sag. 1, 33) füllt si<strong>ch</strong> seinen
96<br />
Hands<strong>ch</strong>uh mit Dünensand, um ihn auf dem Hof des Bauern aus¬<br />
zus<strong>ch</strong>ütten, der ihn beleidigt hatte. Was dur<strong>ch</strong> die fünf Finger¬<br />
lö<strong>ch</strong>er herauslief, bildete die dortigen fünf Hügel. Myth. 504. Das<br />
Handzei<strong>ch</strong>en auf den Grenzsteinen geht über in die Marke des<br />
dreieckigen Hammers, des Hahnenfusses und dreier Füsse.<br />
Die lands<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en Namen Krinkenstein, Genagelter Stein, An¬<br />
nagelten bezei<strong>ch</strong>nen Feldsteine, auf denen als Malzei<strong>ch</strong>en ein Ring<br />
oder ein Rad mit Spei<strong>ch</strong>en eingehauen ist. Im steinern Rad hiess<br />
jene Stelle am Herlibcrger Rain, wo Verena's s<strong>ch</strong>wimmender Mühl¬<br />
stein endli<strong>ch</strong> im Züri<strong>ch</strong>see versank. Das dreispei<strong>ch</strong>ige Rad hatte<br />
s<strong>ch</strong>on dem classis<strong>ch</strong>en Alterthum als Grenzzei<strong>ch</strong>en gegolten, man<br />
stellte es in Form dreier Füsse dar, die im Laufe um cinen ge¬<br />
meinsamen Mittelpunkt begriffen s<strong>ch</strong>ienen, und nannte es demgemäss<br />
Triskelos. Die baieris<strong>ch</strong>e Stadt Füssen mit dem berühmten Felsenpasse<br />
des Mangstrittes führt drei na<strong>ch</strong> vers<strong>ch</strong>iedenen Himmels¬<br />
gegenden geri<strong>ch</strong>tete s<strong>ch</strong>warze Füsse im Wappen; denn bei ihr<br />
trafen die alten Grenzen zusammen von Baiern, S<strong>ch</strong>waben und<br />
Tirol. Aus dem Triskelos entwickelte si<strong>ch</strong> der heilige Dreifuss<br />
der grie<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>en und der germanis<strong>ch</strong>en Priesterinnen, sowie der<br />
Brau<strong>ch</strong> unserer Dorfoffnungen, mittelst des dreibeinigen, dreistempeligen<br />
Stuhles Güterbesitznahme re<strong>ch</strong>tsgiltig vollziehen zu lassen.<br />
Na<strong>ch</strong>weise in Grimms RA. 80, 5. Sol<strong>ch</strong>erlei Berg- und Ortsnamen<br />
wie Kaiserstuhl (Aargauer Städtlein, und Berg bei Heidelberg), Drei¬<br />
s<strong>ch</strong>übel und Trüs<strong>ch</strong>hübel (Alpe, die den Uebergang aus dem Thal<br />
der Emme in das Eritzthal, Kant. Bern, bildet. Stalder 1, 315.)<br />
bezei<strong>ch</strong>nen also ursprüngli<strong>ch</strong>e Grenzen. Dieser Dreizahl entspre¬<br />
<strong>ch</strong>end ers<strong>ch</strong>eint dann auf den Grenzsteinen als weiteres Zei<strong>ch</strong>en<br />
die Mondsi<strong>ch</strong>el. Man hat sie im Sandstein des S<strong>ch</strong>lossfelsens der<br />
alten Kaiserpfalz Bodmann am Bodensee eingehauen gefunden<br />
(Naturmythen 231). Statt der Mondsi<strong>ch</strong>el ist die Grassi<strong>ch</strong>el ein¬<br />
gehauen; eherne Si<strong>ch</strong>eln wurden unter Dolmen hervorgegraben.<br />
In die drei Jungfernsteine bei der böhmis<strong>ch</strong>en Stadt Gabel sind<br />
drei Graserinnen sammt ihren Si<strong>ch</strong>eln verwüns<strong>ch</strong>t; zu Kommotau<br />
ebenso sieben Jungfern. Grohmann, Böhm. Sagb. 1, 274. Ferner<br />
ers<strong>ch</strong>eint das dreieckig gespitzte Messer oder Se<strong>ch</strong> auf Feldsteinen,<br />
mit der obligaten Lokalsage, hier habe der Bauer seinen S<strong>ch</strong>loss¬<br />
junker, der ihm die O<strong>ch</strong>sen vom Pfluge nehmen wollte, unter die<br />
Ackerfur<strong>ch</strong>e hinabgepflügt. Dieses Messer- und Se<strong>ch</strong>zei<strong>ch</strong>en ist die<br />
altnordis<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>wertrune Tyr, zuglei<strong>ch</strong> der Name jenes S<strong>ch</strong>wert¬<br />
gottes Zio, na<strong>ch</strong> dem wir unsern oberdeuts<strong>ch</strong>en Ziustic, Ziuwestac,<br />
benennen. Die Gestalt jener Rune glei<strong>ch</strong>t einem Pfeile oder
97<br />
einer Lanzette und wiederholt si<strong>ch</strong> heule no<strong>ch</strong> als das allgemeine<br />
Zunftzei<strong>ch</strong>en der Messers<strong>ch</strong>miede auf den Messerklingen. Ebenso<br />
oft wiederholt si<strong>ch</strong> als Markenzei<strong>ch</strong>en das eingehauene Kleeblatt.<br />
Hierüber genügt ein Beispiel. Das Neuenburger Jurathal la Brévine<br />
mit einem glei<strong>ch</strong>namigen Dorfe ist an der französis<strong>ch</strong>en Grenze<br />
gelegen. Dorten im Walde ist ein 15 Fuss hoher Granitblock mit<br />
abgebro<strong>ch</strong>ener Spitze, hinter ihm ein anderer gegen 10 Fuss ho<strong>ch</strong>,<br />
von unregelmässiger Gestalt; die beiden heissen Pierres à trèfle<br />
(trifolium), weil an ihnen ein Kleeblatt ausgehauen und bis vor<br />
wenig Jahren no<strong>ch</strong> zu sehen gewesen war. Der Zweck dieses<br />
Zei<strong>ch</strong>ens ist dorten vergessen; jedes Haus, erzählt man, habe ehe¬<br />
mals ein Kleeblatt unter die Thürs<strong>ch</strong>welle gelegt, jeder über Feld<br />
Gehende eines auf den Hut gesteckt, dem Weidevieh habe man es<br />
um den Hals gebunden, Alles gegen den Wärwolf, der bei jenem<br />
Stein im Walde hauste. Dies Zei<strong>ch</strong>en vertritt seiner Gestalt na<strong>ch</strong><br />
Thôrrs Hammerzei<strong>ch</strong>en; in Form eines brcilgezogenen dreiblättri¬<br />
gen Kleeblattes bekreidet man unter einem vorges<strong>ch</strong>riebenen Segensspru<strong>ch</strong><br />
auf der Insel Wangeroge alles Melk- und Butterges<strong>ch</strong>irr<br />
gegen die Hexen. Friesis<strong>ch</strong>es Ar<strong>ch</strong>iv 1854 II, 13. 14. Die Drei¬<br />
ähren, glei<strong>ch</strong>falls ein häufiges Malzei<strong>ch</strong>en, haben zu Marienlegen¬<br />
den mehrfa<strong>ch</strong>en Anlass gegeben. Vgl. Panzer, Baier. Sag. 2, pg.<br />
379 und Stöber, Elsass. Sag. pg. 95. S<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> ist no<strong>ch</strong> vom Einhaupt<br />
und Dreihaupt zu reden. Da hierüber mein Aufsatz: Die drei<br />
Hunenköpfe, in der Argovia 1860 pg. 113 Erklärung und Ab¬<br />
bildungen bereits gegeben hat, so ist hier nur no<strong>ch</strong> das inzwis<strong>ch</strong>en<br />
über diesen Gegenstand Neuaufgesammelte na<strong>ch</strong>zutragen.<br />
Die Pfarrkir<strong>ch</strong>e zu Weggis am Fusse des Rigi ist so alt, dass<br />
sie in den (gefäls<strong>ch</strong>ten) Urkunden des Churwaldner Benedictinerstiftes<br />
Pfäfers als Bcsitzthum s<strong>ch</strong>on im J. 998, dann aber in einer<br />
Beslätigungsbulle von Pabst Pascal II. anno 1116 genannt wird:<br />
ecclesia St. Mariae cum villa Gaulegisia (alias Quatigiso). Ts<strong>ch</strong>udi<br />
s<strong>ch</strong>reibt no<strong>ch</strong> Wätgis. Auf dem Siegel der Kir<strong>ch</strong>genossen vom<br />
J. 1378 liest man Wetgis. Die Kir<strong>ch</strong>e gieng 1431 an die Kir<strong>ch</strong>¬<br />
genossen über, wurde 1473 umgebaut, der Thurm in seinem älte¬<br />
ren Theile verblieb und zeigt hier an den beiden Nordecken auf<br />
zwei besondem Quadern drei Mens<strong>ch</strong>enhäupter eingemeisselt. Eine<br />
Kaplaneihands<strong>ch</strong>rift bezei<strong>ch</strong>net diese Häupter als die Portraits des<br />
Baumeisters und seiner Frau, übergeht aber dabei das dritte Ge¬<br />
si<strong>ch</strong>t, weil es, auf seinem vorspringenden Mauerstein vom Wetter<br />
ausgewas<strong>ch</strong>en, heute ni<strong>ch</strong>t mehr kenntli<strong>ch</strong> ist. Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tsfreund<br />
XI, 134. Hier hätten wir also jene drei dem Feinde entgegen-<br />
Argovia. III. 7
98<br />
bückenden Hunnen- oder Riesenhäupter wieder, die man ehemals<br />
als S<strong>ch</strong>eu<strong>ch</strong>bilder auf Kir<strong>ch</strong>en, Brücken und Stadtthürme zu setzen<br />
pflegte. Ein glei<strong>ch</strong>es steinernes Vollhaupt ist in diesem Jahre erst<br />
îu Villmergen im Freiamte beim Abbru<strong>ch</strong>e der dortigen alten Dorfhir<strong>ch</strong>e<br />
zum Vors<strong>ch</strong>ein gekommen und unserer historis<strong>ch</strong>en Vereinssammlung<br />
einverleibt worden. Gervasius von Tilbury stimmt<br />
mit unserer bisherigen Erklärung dieser Alterthümer hübs<strong>ch</strong> über¬<br />
ein. Er erzählt aus eigenem Augens<strong>ch</strong>eine : Der Di<strong>ch</strong>ter Virgilius<br />
habe die Stadt Neapel dur<strong>ch</strong> Zauberthore gegen feindli<strong>ch</strong>e Angriffe<br />
ges<strong>ch</strong>ützt; er habe nämli<strong>ch</strong> zwei Köpfe von paris<strong>ch</strong>em Marmor,<br />
einen mit la<strong>ch</strong>endem Munde, den andern mit zürnendem Blick als<br />
Bilder des Glücks und des Unglücks für die Eins<strong>ch</strong>reitenden daran<br />
befestigt. Massmann, Kaiser<strong>ch</strong>ron. 3, 443. Erblasst die Erinnerung<br />
an Sage und Vorzeit, so überträgt man sol<strong>ch</strong> ein alterndes Denk¬<br />
mal auf diejenigen Vorgänge, die im Bauerngedenken haften blei¬<br />
ben; das ist der S<strong>ch</strong>weden-, der Türken- und der Franzosenkrieg.<br />
So liegt im S<strong>ch</strong>wedenhof bei Wildenstein in Wurtemberg unter<br />
dem Da<strong>ch</strong>e ein Kopf aufbewahrt, wie es (bei Birlinger, S<strong>ch</strong>wab.<br />
Sag. no. 257) heisst, zum ewigen Andenken an den letzten S<strong>ch</strong>we¬<br />
densoldaten, den man hier todts<strong>ch</strong>lug". Unter dem Da<strong>ch</strong>gesimse<br />
des gräfli<strong>ch</strong>en Saurauis<strong>ch</strong>en Hauses zu Graz ist ein hölzerner Tür¬<br />
kenkopf angebra<strong>ch</strong>t. Na<strong>ch</strong> fünfzehn vers<strong>ch</strong>iedenen Einfällen der<br />
Türken in die Steiermark hat hier in diesem Hause der letzte Türke<br />
gewohnt, bis ihm eine Kanonenkugel den Braten aus der S<strong>ch</strong>üssel<br />
s<strong>ch</strong>oss. Es ist das Haus zum Tatermann. Mittheil, des histor. Ver¬<br />
eins f. Steiermark 1862, Heft 11, 247. Der Name Tatermann (Feld¬<br />
s<strong>ch</strong>eu<strong>ch</strong>e, Kobold) hat si<strong>ch</strong> mit dem Volksnamen Tartar fäls<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong><br />
Terbunden, d. h. eine religiöse Mythe hat in ihrem Erblassen si<strong>ch</strong><br />
na<strong>ch</strong> dem Stützpunkt eines ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Namens umgesehen.<br />
Die Bildberge.<br />
Das Alterthum da<strong>ch</strong>te si<strong>ch</strong> die Erde sammt ihren Gebirgen als<br />
-den Leib eines aus den S<strong>ch</strong>öpfungsstürmen in Ruhe gebra<strong>ch</strong>ten<br />
Biesen. Ebe er znm ewigen S<strong>ch</strong>lafe erstarrt, oder in diesem<br />
S<strong>ch</strong>lafe selbst «o<strong>ch</strong> erzeugt er wundersam die ihn überlebenden<br />
Söhne und Tö<strong>ch</strong>ter. Dem s<strong>ch</strong>lummernden Ymir wä<strong>ch</strong>st unter dem<br />
Arme Mann und Weib, sein einer Fuss erzeugt mit dem andern<br />
¦einen Sohn. So erzählt die Edda, so au<strong>ch</strong> nooh nnser Ho<strong>ch</strong>gebirg<br />
mit seinen redenden Namen. Le Géant, der Gigante, heisst einer<br />
der Gipfel in der Montblanckette, und wo er si<strong>ch</strong> 2ur Ruhe hin¬<br />
gelegt hat, trägt die Gegend den Namen seines Grabes : La tombe
99<br />
du bon homme, de la bonne femme. Myth. 493. Dieser Gute Mann<br />
eben ist jener Alte vom Berge, der so vielen unserer hervorragen¬<br />
den Gebirgsstöcke den Namen gegeben hat. Na<strong>ch</strong> ihm trägt das<br />
Matterhorn seinen Walliser Localnamen Mann (Es<strong>ch</strong>er, Die S<strong>ch</strong>weiz<br />
1851, 386); na<strong>ch</strong> ihm ist der an der Toggenburger Grenze lie¬<br />
gende Altmann zubenannt, in wel<strong>ch</strong>em die Appenzeller Aelpler<br />
einen Greis mit grauen Haaren erblicken (Fäsi, Helvet. Erdbes<strong>ch</strong>reib.<br />
3, 62); ebenso na<strong>ch</strong> ihm im Ber<strong>ch</strong>tesgadner Lande der mit sieben<br />
Häuptern und mit ebenso viel Kindern zu Stein verflu<strong>ch</strong>te König<br />
Wazmann (S<strong>ch</strong>öppner, Baier. Sagb. 1, 64.) Dieser na<strong>ch</strong>drucksam<br />
wiederkehrende Bergname Mann führt auf die ältesten Spuren deut¬<br />
s<strong>ch</strong>er Spra<strong>ch</strong>e und Mythe zurück, auf jenen erdgeborenen Gott<br />
Tuisco und dessen Sohn Mannus, welMie der Germane als die<br />
Gründer des Mens<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tes anbetete und in Liedern feierte.<br />
(Celebrant carminibus antiquis Tuiscmiem deum terra edilum, et<br />
filium Mannum, originem genlis condiloresque. Tacitus Germ. 2.)<br />
Die Stammsage des Germanen fasst si<strong>ch</strong> als eine auto<strong>ch</strong>thonis<strong>ch</strong>e,<br />
seine Gottheit ist eine erdentsprungene, und von diesem mens<strong>ch</strong>ens<strong>ch</strong>affenden<br />
Mann giebt er si<strong>ch</strong> selbst den adjectivis<strong>ch</strong>en Beinamen<br />
Mens<strong>ch</strong>, ahd. mannisko, später mennisko, contrah. Mens<strong>ch</strong>e. Die<br />
Namens- und Mythenglei<strong>ch</strong>heit zwis<strong>ch</strong>en diesem deuts<strong>ch</strong>en Mannus,<br />
dem grie<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>en Minos und dem indis<strong>ch</strong>en Manu hat Kuhn, Zts<strong>ch</strong>r.<br />
f.<br />
Spra<strong>ch</strong>fors<strong>ch</strong>. 4, 91, dargethan. Sehr nahe liegend ist die Frage,<br />
ob ni<strong>ch</strong>t au<strong>ch</strong> der keltis<strong>ch</strong>e Name Menhir und Minhir mit zu dieser<br />
Wurzel der Urspra<strong>ch</strong>e gehöre; er bezei<strong>ch</strong>net bekanntli<strong>ch</strong> jene<br />
senkre<strong>ch</strong>ten Felsstücke, wel<strong>ch</strong>e auf einem ihrer Enden künstli<strong>ch</strong><br />
aufgeri<strong>ch</strong>tet stehen und bei uns Wagsteine heissen. Wenigstens<br />
gemahnt dies keltis<strong>ch</strong>e Menhir an jenen vom Di<strong>ch</strong>ter Frauenlob ge¬<br />
nannten Mennor, dem ersten unserer Ahnen, wel<strong>ch</strong>em Gott die<br />
deuts<strong>ch</strong>e Spra<strong>ch</strong>e eingegeben habe," mithin in glei<strong>ch</strong>er Folge au<strong>ch</strong><br />
an den aus dem <strong>ch</strong>thonis<strong>ch</strong>en Gottvater geborenen, das Mens<strong>ch</strong>en¬<br />
ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t aus der Erde aufbauenden und na<strong>ch</strong> si<strong>ch</strong> selbst benen¬<br />
nenden Mannus. Im nordis<strong>ch</strong>en Mythus vermählt si<strong>ch</strong> die grosse<br />
Erdmutter Jördh, eine To<strong>ch</strong>ter der Na<strong>ch</strong>t, mit Odhinn und wird<br />
yon ihm die Mutter Thôrrs. Sie heisst als Gebirgsgöttin Fiörgyn,<br />
darna<strong>ch</strong> ihr wetiergeboreuer Gebirgssohn Thôrr Fiörgynjar Burr,<br />
und den Namen der Beiden trägt die Virgunt, ein Waldgehirge<br />
zwis<strong>ch</strong>en Dinkelsbühl und Elwangea, Myth. 157. Neben dem Na¬<br />
men des Gottes kann also derjenige der Göttermutter und ihrer<br />
riesigen Tö<strong>ch</strong>ter dem Ho<strong>ch</strong>gebirge ni<strong>ch</strong>t mangeln. Unter den sieben<br />
Gipfeln der Blümlisalp ist die Weisse Frau dte mittlere und hö<strong>ch</strong>ste
100<br />
Spitze, 11,000 Fuss ho<strong>ch</strong>; die Wilde Frau 10,042. Die den Gemmipass<br />
beherrs<strong>ch</strong>ende Alt-Eis entspri<strong>ch</strong>t jener in der deuts<strong>ch</strong>en Hel¬<br />
densage genannten Rauhen Eis; im Jungbrunnen badend entwan¬<br />
delt si<strong>ch</strong> diese zur Frau Sigeminne, wird Wolfdietri<strong>ch</strong>s Frau, bis<br />
sie ihm s<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> vom Riesen Trasian entführt, d. h. in ihre un¬<br />
zugängli<strong>ch</strong>e Glets<strong>ch</strong>ereinsamkeit wieder zurückgenommen wird.<br />
S<strong>ch</strong>on daraus geht hervor, dass die Weiber und Tö<strong>ch</strong>ter der Berg¬<br />
riesen keineswegs immer von grausiger Ers<strong>ch</strong>einung sein mussten;<br />
und so ist uns denn das Abbild hö<strong>ch</strong>ster und überwältigender Kör¬<br />
perreize dargestellt in der Ers<strong>ch</strong>einung des unter dem Namen der<br />
Jungfrau bekannten Gebirges. Die Edda di<strong>ch</strong>tet bereits von dem<br />
Zauber, mit dem die Bergriesinnen jedes Herz ergreifen. Seitdem<br />
der S<strong>ch</strong>önheitsgott Freyr; erzählt sie, die Gerd erblickt hatte, des<br />
Bergriesen Gyme To<strong>ch</strong>ter, spra<strong>ch</strong> er kein Wort mehr und wei¬<br />
gerte si<strong>ch</strong> aller Nahrung. Dies war damals ges<strong>ch</strong>ehen, als Gerd,<br />
der Thüre ihres Hauses zus<strong>ch</strong>reitend, die Hände unter dem Ge¬<br />
wände hervorhob, um den Pfortenring zu ergreifen, und plötzli<strong>ch</strong><br />
von ihren blanken Armen Luft und Wasser, Himmel und Erde<br />
widerstrahlten. Das zunä<strong>ch</strong>st Unausspre<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e der feierli<strong>ch</strong>en Fir¬<br />
nenpra<strong>ch</strong>t der Gebirgswelt ist hier dur<strong>ch</strong> die di<strong>ch</strong>teris<strong>ch</strong>e Phantasie<br />
des eddis<strong>ch</strong>en Mythus zu einem innern Erlebnisse verans<strong>ch</strong>auli<strong>ch</strong>t,<br />
glückli<strong>ch</strong>er als das Vermögen aller na<strong>ch</strong>maligen Künstler und Di<strong>ch</strong>ter<br />
es vermo<strong>ch</strong>t hat. Wir rufen die Erinnerung aller unserer Leser<br />
auf, wel<strong>ch</strong>e gesehen haben, wie die Alpenpyramide der Jungfrau<br />
in die Länder niederstrahlt. Ihr Fuss badet im mil<strong>ch</strong>weissen Glet¬<br />
s<strong>ch</strong>ermeer, dur<strong>ch</strong>si<strong>ch</strong>tiges S<strong>ch</strong>leicrgewölke umgiebt sie bis zum<br />
Gürtel, lebendig wogend heben si<strong>ch</strong> die Gliedmasse daraus her¬<br />
vor, S<strong>ch</strong>ulter und Brust sind von zarter Rothe überflogen, das<br />
leu<strong>ch</strong>tende, stets wolkenlose Haupt ist ges<strong>ch</strong>mückt mit firnblanken<br />
Silbernadeln und kristallenen Diademen. Denn Aiguilles (Nadeln)<br />
und Cima (Kamm) nennt man jene dünnen ausgewas<strong>ch</strong>enen Felsen¬<br />
spitzen, die aus dem obersten Firnens<strong>ch</strong>nee no<strong>ch</strong> allein aufstarren ;<br />
glei<strong>ch</strong>wie man die im afrikanis<strong>ch</strong>en Wüstensande isolirt stehende<br />
Säule glei<strong>ch</strong>falls Nadel der Cleopatra genannt hat.<br />
Die weitere Ausführung dessen, was das Oberland über nam¬<br />
hafte Riesenfrauen erzählt, sei uns hier erlassen; theils weil diese<br />
Sagen allbekannt, theils weil sie s<strong>ch</strong>on bis auf den Eigennamen<br />
ausgestorben sind. So hausen dorten die drei S<strong>ch</strong>western: Das<br />
Gauliwîbli sammt ihrem Hünd<strong>ch</strong>en auf dem Gauliglets<strong>ch</strong>er, das<br />
Engstwîbli auf der Engstlenalp, das Gaismaidli von Hasliberg. Letz¬<br />
tere treibt no<strong>ch</strong> Kiltgängerei mit den Sennen im Hasli. Eben dorten
101<br />
lebt als Ahnfrau aller Zwerge die gute Frau Ute. Am Unteraar¬<br />
glets<strong>ch</strong>er haust das Walliserwîbli. Jährli<strong>ch</strong> am Jörgistage, dam<br />
Festlage der Sennen, treten diese in den Walliser, Berner und<br />
Glarner Alpen glei<strong>ch</strong>mässig gekannten Riesinnen aus dem Firn¬<br />
s<strong>ch</strong>nee hervor und rufen es in's Thal aus, dass sie mit Frau und<br />
Magd, mit Liebhaber und Geliebten, mit Hund und Heerde hier<br />
ihr glückli<strong>ch</strong>es Aelplerleben fortsetzen. Die Bes<strong>ch</strong>reibung dieses<br />
in der Glets<strong>ch</strong>erwelt andauernden Lebens der Seligen ist zu lesen :<br />
Naturmythen, pg. 221: Das verlorne Thal.<br />
So sind denn stets und aller Orten Berge von stark hervor¬<br />
tretender Gestalt na<strong>ch</strong> der Configuration ihrer S<strong>ch</strong>eitel und Kämme<br />
als Bildberge aufgefasst und zubenannt worden. Ein Küstentheil<br />
am grie<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>en Mittelmeere hiess im classis<strong>ch</strong>en Alterthum 0cov<br />
ncoaiosrov, der Phönizier nannte einen Berg in Peräa Pniel, Bei¬<br />
des heisst Gottes Angesi<strong>ch</strong>t (Friedrei<strong>ch</strong>, Symbol. 107). Das Berner<br />
Oberland hat seinen Mön<strong>ch</strong>, in steinerne Ruhe versunken; eine<br />
Felsenmaria mit dem Kind im Arme; einen am Bergsaum dahins<strong>ch</strong>rcitenden<br />
Riesen in so frappanter Bewegung, dass die Sage ihn<br />
in's Thal heruntersteigen lässt; einen Prometheus, ausgestreckt lie¬<br />
gend, an Armen und Beinen angeheftet (Kohl, Alpenreisen 3, 337);<br />
ein zum Sprung si<strong>ch</strong> aufstellendes Ross (Bourrit, Bes<strong>ch</strong>reib, der<br />
Pennin. und Rhät. Alpen 512); einen Felsenvorsprung am Roselauiglets<strong>ch</strong>er,<br />
seiner Gestalt wegen der Glcts<strong>ch</strong>erwä<strong>ch</strong>ter genannt<br />
(Es<strong>ch</strong>er, Die S<strong>ch</strong>weiz 1851, 178). In der Kleinen Windgellen,<br />
Kant. Uri, ist ein Berg unter dem Namen des Wilden Mannes be¬<br />
kannt; es ist ein Kolossalhaupt auf einem viereckigen Sockel, das auf<br />
der Kante einer Felsenmauer steht und die Höhe einer Tanne er¬<br />
rei<strong>ch</strong>t. Das Haupt stolz emporgeworfen, die Brust vortretend, von<br />
windgepeits<strong>ch</strong>tem Gewölke umflogen, in einer ringsum wilderregten<br />
Natur, sieht dieser Wilde mit fester Miene von seinem erhabenen<br />
Throne herausfordernd in die weite Welt hinaus. Von ihm er¬<br />
zählt der Aelpler dasselbe, was man vom versteinerten König Wazmann<br />
weiss : Er habe als Wilder Jäger an einem Feierlage ein<br />
Gratthier bis in diese Höhen hinauf verfolgt und sei im Augen¬<br />
blicke des S<strong>ch</strong>usses versteinert. Hoffmann, Berg- und Glets<strong>ch</strong>erfahrten,<br />
Züri<strong>ch</strong> 1859, 26. Ein Hinblick auf unsere Gegenwart liegt<br />
ohnedies ausserhalb des Gesi<strong>ch</strong>tskreises dieser Arbeit; sonst musste<br />
man au<strong>ch</strong> diejenigen Felsenprofile und Berghäupter mit aufzählen,<br />
an die wir unsere neuesten Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tserinnerungen anknüpfen.<br />
Sowohl aus dem Profil der Stockhornkette, als aus der Zackenreihe<br />
der Pilatuskämme setzt si<strong>ch</strong> die Phantasie der Reisenden die Phy-
102<br />
siognomie Ludwigs XVI. von Frankrei<strong>ch</strong> zusammen. Südli<strong>ch</strong> hinter<br />
Seelisberg und dem Rütli sieht man in der nis<strong>ch</strong>enartigen Vertie¬<br />
fung der Felswände ein Mannshaupt, wie von Mens<strong>ch</strong>enhand ein<br />
gehauen, man nennt dies Gebilde den Napoleonskopf. Zür<strong>ch</strong>. Neujahrsbl.<br />
d. Musikgesells<strong>ch</strong>. 1819, 6. Wel<strong>ch</strong> eine Reihe von Zeiten<br />
muss an diesen Bildbergen vorbeigegangen sein, bis sie ihre Rie¬<br />
sen- und Götternamen umgetaus<strong>ch</strong>t hatten gegen römis<strong>ch</strong>-<strong>ch</strong>rist¬<br />
li<strong>ch</strong>e, zuletzt sogar gegen Fürstennamen unserer letzten Tage ; wie<br />
oftmals müssen Germanen- und Römerzüge über die Alpen hin und<br />
zurück gefluthet sein, bis au<strong>ch</strong> die Alpenpässe ihre Eigennamen<br />
gegen die von <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>en Heiligen bleibend ausgetaus<strong>ch</strong>t halten.<br />
Der Grosse Bernhardsberg, der älteste der begangenen S<strong>ch</strong>weizerpässc<br />
aus dem Wallis na<strong>ch</strong> Aosta, führt in den romanis<strong>ch</strong>en und<br />
deuts<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>westerspra<strong>ch</strong>en des Mittelalters bereits seinen zweiten<br />
Namen Mons Jovis, Monte Joh, Job, französis<strong>ch</strong> Mont Joux. Sein<br />
älterer erster Name Mons Penninus weist auf Pen :<br />
Spitzsäule zu¬<br />
rück, Nadel und Spindel als Symbole des auf der Gebirgsspitze<br />
waltenden Sonnenstrahles geda<strong>ch</strong>t. Erst der hl. Bernhard, ein<br />
savoyis<strong>ch</strong>er Adeliger vom S<strong>ch</strong>losse Menthon bei Annecy, geboren<br />
923, legte als Ar<strong>ch</strong>idiaconus in Aosta den Grund zu den beiden<br />
Hospitien, auf dem Grossen und dem Kleinen Bernhard. Letzterer<br />
hiess Columna Jovis, au<strong>ch</strong> Oculus Jovis, so genannt wegen des<br />
leu<strong>ch</strong>tenden Steines, der in der dortigen Statue angebra<strong>ch</strong>t war.<br />
Die Legende ma<strong>ch</strong>t einen Karfunkel daraus, mit dessen Glanz der<br />
Teufel alle vorüberziehenden Wanderer verblendete. Im Abs<strong>ch</strong>nitt<br />
von den Grenzsteinen ist jedo<strong>ch</strong> bereits die alte Sitte gezeigt, wo¬<br />
na<strong>ch</strong> man den ältesten Statuen sol<strong>ch</strong>erlei Kiesel in's Haupt ein¬<br />
fügte, unter denen Jupiters Gottheit ursprüngli<strong>ch</strong> verehrt gewesen<br />
war. Der hl. Nikolaus ers<strong>ch</strong>eint dem St. Bernhard und fordert ihn<br />
auf, dieses Götzenbild mit Ketten zu umspannen und niederzureissen<br />
: Lass uns die Berghöhe ersteigen, die Teufel in die Berg¬<br />
s<strong>ch</strong>lünde verjagen, die von ihnen ums<strong>ch</strong>wärmte Jupitersstatue und<br />
Karfunkelsäule zers<strong>ch</strong>mettern und dorten ein Hospiz zum Segen<br />
der Mens<strong>ch</strong>en erri<strong>ch</strong>ten Bernhard that's, erbaute beide Chor¬<br />
herrenstifte und widmete sie dem hl. Nikolaus. Als Leo IX. 1049<br />
den Grossen Bernhard überstieg, fand er hier na<strong>ch</strong> ausdrückli<strong>ch</strong>er<br />
Angabe des Hermannus Contractus die begründete Gemeins<strong>ch</strong>aft<br />
der Chorherren vor. Gelpke, Kir<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>. d. S<strong>ch</strong>weiz 2, 137.<br />
Ts<strong>ch</strong>udi in seiner Gallia cornata 351 hat diese Namensumwand¬<br />
lung der Gebirgspässe ni<strong>ch</strong>t bloss der Aufmerksamkeit werth ge¬<br />
halten, sondern sie als den letzten Bru<strong>ch</strong> mit dem Heidenthum her-
103<br />
vorgehoben : Die Christen haben auf dem Berg Summarum Alpium<br />
den Sant Gothardum, den hl. Bis<strong>ch</strong>of aida, zu verehren vorgenom¬<br />
men, Sant Bernharten auf dem Pönino, Sant Barnabas auf dem<br />
Lucmanier, Sant Bernharden auf dem Adula, Sant Braulium auf<br />
dem Wormserjo<strong>ch</strong>. So hat man die Abgötter abgethan und an<br />
deren Statt die Alpfirslen denen <strong>ch</strong>ristli<strong>ch</strong>en Heiligen dediciret.<br />
Dieses Urtheil Ts<strong>ch</strong>udi's wiederholt si<strong>ch</strong> der heutige Bewohner des<br />
Gebirges aus ungelehrtem, praktis<strong>ch</strong>em Vorstellungsvermögen, wie<br />
er es im tägli<strong>ch</strong>en Kampfe mit seiner kargen Natur si<strong>ch</strong> erwirbt.<br />
Thal und Berg, sagt man im Fi<strong>ch</strong>telgebirge (S<strong>ch</strong>önwerth, Sag. 2,<br />
263), ma<strong>ch</strong>ten die Riesen, als sie auf der neuges<strong>ch</strong>affenen wei<strong>ch</strong>en<br />
Erde umhergicngen, denn Riesen sollen vor der Kreuzigung Christi<br />
in der ganzen Welt geherrs<strong>ch</strong>t haben."