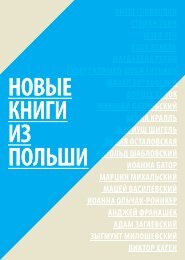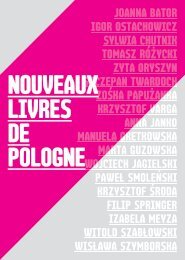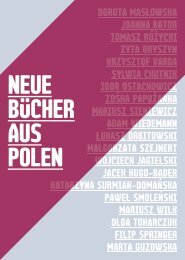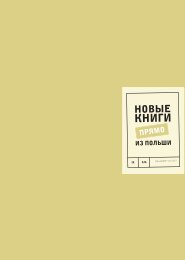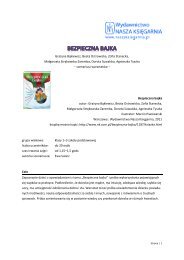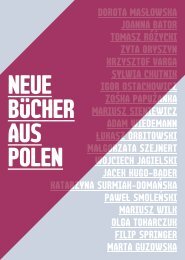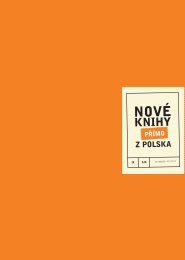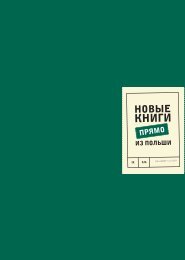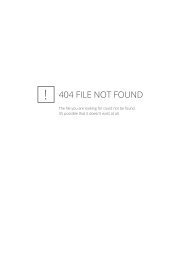Andrzej Stasiuk - Instytut KsiÄ Å¼ki
Andrzej Stasiuk - Instytut KsiÄ Å¼ki
Andrzej Stasiuk - Instytut KsiÄ Å¼ki
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Buchinstitut (<strong>Instytut</strong> Książki) ist eine staatliche Kultureinrichtung,<br />
die vom Kulturminister der Republik Polen ins Leben<br />
gerufen wurde. Seit Januar 2004 ist das Institut in Krakau angesiedelt,<br />
2006 entstand auch ein Büro in Warschau. Die Hauptdas<br />
Buch als Medium und die Leselust in Polen zu verbreiten so-<br />
ziele des Institutes liegen darin, die Lesebereitschaft zu fördern,<br />
wie weltweit für die polnische Literatur zu werben. Diese Ziele<br />
werden umgesetzt durch:<br />
» Vorstellung und Werbung für die besten polnischen Bücher<br />
und ihre Autoren<br />
» ÜBERSETZUNGSPROGRAMM © POLAND<br />
» Bildungsmaßnahmen, die die Vorteile aus einem vertrauten<br />
Umgang mit dem Buch als Medium verdeutlichen<br />
» Informationszentrum für Kinderbücher<br />
» Programm zur Leseförderung<br />
Tu Czytamy!<br />
/Hier wird gelesen!<br />
» jährlicher Literaturfestival-Zyklus<br />
4 Pory<br />
Książki / Die vier Jahreszeiten<br />
des Buches<br />
» Informationsportal zur<br />
polnischen Literatur<br />
www.bookinstitute.pl<br />
» Übersetzerkolleg<br />
» Seminare für Verleger<br />
» Präsentation der polnischen Literatur im Ausland<br />
» einen leichteren Zugang für ausländische Interessenten<br />
zu Informationen über das polnische Buch und den Buchmarkt.<br />
Das Buchinstitut stellt die Literaturprogramme bei polnischen<br />
Auftritten auf in- und ausländischen Buchmessen, bereitet Le-sungen<br />
polnischer Schriftsteller bei Literaturfestivals oder im<br />
Rahmen seiner PR-Maßnahmen für die internationale Verbreitung<br />
polnischer Kultur vor, gibt regelmäßig den Katalog „NEUE<br />
BÜCHER AUS POLEN“ heraus, in dem literarische Neuerscheinungen<br />
präsentiert werden, organisiert Studien- und Fortbildungsmaßnahmen<br />
sowie Treffen und Seminare für Übersetzer<br />
polnischer Literatur, zu denen es ständigen Kontakt pflegt, und<br />
verleiht auch den PREIS TRANSATLANTYK für den besten Vermittler<br />
polnischer Literatur im Ausland.<br />
DAS PROGRAMM TU CZYTAMY! besteht aus einer Reihe<br />
von Maßnahmen, die sich an Schulen, Bibliotheken und NGOs<br />
richten. Dazu gehören u.a.: Bildungsprogramme, Vermittlung der<br />
zeitgenössischen polnischen Literatur für Jugendliche, Vorbereitung<br />
und Publikation eines polnischen Literaturatlas, Organisation<br />
von Buchdiskussionsklubs. Ein Teil des Programms ist auch<br />
der jährliche Literaturfestival-Zyklus 4 Pory Książki.<br />
FESTIVAL 4 PORY KSIĄŻKI ist das größte Literaturfestival in<br />
Polen. Es findet parallel in mehreren Städten statt. Das Festival<br />
besteht aus vier Events: Pora poezji / Lyrikzeit (Februar), POPLIT<br />
(April), Pora prozy / Prosazeit (Oktober), Festiwal kryminału /<br />
Krimifestival (November). Gäste des Festivals waren bisher u.a.:<br />
Jonathan Caroll, Eduardo Mendoza, Boris Akunin, Alexandra Marinina,<br />
Michael Faber, Paulo Lins, Pedro Juan Gutierrez.<br />
www.bookinstitute.pl bietet Informationen zu aktuellen literarischen<br />
Erscheinungen und Events in Polen und im Ausland,<br />
präsentiert Neuerscheinungen und Verlagsprogramme, betreibt<br />
auch ein regelmäßiges Rezensions-Service. Man findet dort außerdem<br />
über 100 Biogramme zeitgenössischer polnischer Autoren,<br />
die Vorstellung von über 500 Publikationen, Fragmente,<br />
Essays, Anschriften der Verleger. Alles über polnische Bücher<br />
– auf Polnisch, Englisch und Deutsch.<br />
Direktorin des Buchinstituts: Dr. Magdalena Ślusarska
2<br />
Olga Tokarczuk<br />
Läufer<br />
6<br />
<strong>Andrzej</strong> <strong>Stasiuk</strong><br />
Dojczland<br />
10<br />
Włodzimierz Kowalewski<br />
Die Exzentriker<br />
14<br />
Henryk Waniek<br />
Der Fall Hermes<br />
18<br />
Eustachy Rylski<br />
Die Insel<br />
22<br />
<strong>Andrzej</strong> Bobkowski<br />
Dämmerung<br />
26<br />
Jerzy Pilch<br />
Der Zug ins ewige Leben<br />
30<br />
Janusz Rudnicki<br />
Kommt, wir gehen<br />
34<br />
Agata Tuszyńska<br />
Vorübungen zum Verlust<br />
38<br />
Joanna Rudniańska<br />
Brygidas Kätzchen<br />
42<br />
Mariusz Sieniewicz<br />
Die Rebellion<br />
46<br />
Hubert Klimko-Dobrzaniecki<br />
Wiegenlied für einen Galgenvogel<br />
50<br />
Michał Witkowski<br />
Barbara Radziwiłłówna aus Jaworzno-Szczakowa<br />
54<br />
Grzegorz Kopaczewski<br />
Huta<br />
58<br />
62<br />
66<br />
Marek Kochan<br />
Hanna Kowalewska<br />
Wacław Holewiński<br />
Spielplatz<br />
Die Maske des Harlekins<br />
Der Weg nach Putte<br />
Inhalt<br />
1<br />
70<br />
Lidia Amejko<br />
Viten der Heiligen der Siedlung<br />
74<br />
Adam Zagajewski<br />
Der Dichter spricht mit dem Philosophen<br />
78<br />
Marek Bieńczyk<br />
Durchsichtigkeit<br />
82<br />
Agnieszka Taborska<br />
Verschwörer der Phantasie. Der Surrealismus<br />
86<br />
Bianka Rolando<br />
Italienische Gesprächsbücher<br />
90<br />
Ignacy Karpowicz<br />
Die Neue Blume des Kaisers (und die Bienen)<br />
94<br />
Jerzy Jarzębski<br />
Alles über Lem<br />
98<br />
Julia Hartwig<br />
Dank für die Gastfreundschaft<br />
100<br />
Jacek Antczak<br />
Die Reporterin. Gespräche mit Hanna Krall<br />
102<br />
Ryszard Legutko<br />
Traktat über die Freiheit<br />
104<br />
Piotr Matywiecki<br />
Tuwims Gesicht<br />
106<br />
Krzysztof Kłosiński<br />
Die geisteswissenschaftlichen Neuerscheinungen des letzten Jahres<br />
110<br />
Adressen der Verlage und Agenten
Olga Tokarczuk Läufer<br />
2<br />
Photo: Danuta Węgiel<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Auf den ersten Blick wirkt Olga Tokarczuks neues Buch wie<br />
eine Sammlung längerer, kürzerer und ganz kurzer Erzählungen,<br />
doch in Wirklichkeit bildet es ein durchdachtes, sehr kunstvoll<br />
konstruiertes Ganzes. Thema dieser Geschichten ist eine Form<br />
des menschlichen Seins auf der Welt, die im unablässigen Reisen<br />
besteht. Der Reisende findet sich damit ab, daß die von ihm<br />
wahrgenommene Welt in eine Fülle nicht unbedingt logisch verbundener<br />
Fragmente zerfällt. Diese Fragmentarisierung spiegelt<br />
sich dementsprechend in der Konstruktion des Buchs, das aus<br />
einer Vielzahl scheinbar unzusammenhängender Fabeln besteht.<br />
Doch allen sind bestimmte Eigenschaften gemein. Zum einen<br />
kreisen sie alle um Situationen von Verlust, Defekt, körperlicher<br />
Behinderung, zum anderen geht es immer wieder um die Erforschung<br />
der Geheimnisse des menschlichen Körpers, die Technik<br />
der Kategorisierung und Aufbewahrung anatomischer Präparate<br />
oder ganzer Leichen.<br />
Das Buch geht auf die persönliche<br />
Geschichte der Autorin ein, auf ihr<br />
privates „ich bin“, wie zwei Fragmente,<br />
jeweils am Anfang und am Ende der Sammlung, lauten.<br />
Gleichzeitig jedoch ist es eine tiefgehende Auseinandersetzung<br />
mit der Menschheitsgeschichte und Mythologie – in erster Linie<br />
der griechischen – sowie eine eindringliche Betrachtung<br />
des Phänomens von Leben und Tod. Zwei Vorstellungen von<br />
Zeit treffen hier aufeinander: auf der einen Seite die zyklische<br />
Sicht der ewigen Wiederkehr, wie sie Mythen und Religionen<br />
eigen ist, auf der anderen die linear-progressive Sicht, wie<br />
sie dem menschlichen Leben in seinem Hinstreben zu Geheimnis<br />
und Tod eigen ist, eine Sicht, der es am Glauben an<br />
den Kreislauf der ewigen Wiederkehr und an der damit verbundenen<br />
Linderung existentieller Ängste mangelt. Es gibt in<br />
diesem Buch keine leichten Antworten auf schwierige Fragen,<br />
auf Schritt und Tritt stoßen wir auf Rätsel, die sich nicht lösen<br />
lassen. Anstelle solcher Antworten können wir überraschende<br />
Spiegelungen und Entsprechungen zwischen unterschiedlichen<br />
Erscheinungen beobachten. Das ist jene uns zugängliche Versi-<br />
on der Wiederholbarkeit der Welt, die eine schwache Hoffnung<br />
auf einen Sinn und eine Ordnung in der Welt aufkeimen läßt.<br />
Es ist ein kluges Werk einer reifen Schriftstellerin, vielleicht sogar<br />
das beste Buch, das Olga Tokarczuk bisher geschrieben hat.<br />
Jerzy Jarzębski<br />
Olga Tokarczuk (geb. 1962), Romanschriftstellerin<br />
und Essayistin, ihre Bücher wurden bereits<br />
in 18 Sprachen übersetzt.<br />
Olga Tokarczuk Läufer<br />
3<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Olga Tokarczuk Läufer<br />
4<br />
Meine<br />
Eltern waren nicht von einem<br />
ganz und gar seßhaften Stamm.<br />
Sie zogen viele Male um, von einem<br />
Ort zum anderen, bis sie sich schließlich für längere<br />
Zeit in einer Provinzschule niederließen, weitab von jeder<br />
richtigen Straße und Eisenbahnstation. Jedes Überschreiten<br />
der Gartengrenze, jeder Ausflug in die kleine Stadt war schon<br />
eine Reise. Einkäufe, Papiere, die im Gemeindeamt eingereicht<br />
werden mußten, immer derselbe Friseur am Markt vor<br />
dem Rathaus, der immer denselben erfolglos gewaschenen<br />
und gebleichten Kittel trug, auf dem die Färbemittel für die<br />
Haare seiner Kundinnen kalligraphische Flecken hinterlassen<br />
hatten, chinesische Schriftzeichen. Mama ließ sich die<br />
Haare färben, der Vater wartete an einem der beiden Tische<br />
draußen vor dem Café Nowa auf sie. Er las die Lokalzeitung,<br />
in der die Rubrik „Kriminalfälle“ mit Berichten über<br />
Marmeladen- und Gewürzgurkenraub aus irgendwelchen<br />
Kellern immer das interessanteste war.<br />
Und dann ihre touristischen Ferienausflüge, schüchtern,<br />
mit einem bis unters Dach vollgepackten Skoda. Lange vorbereitet,<br />
an Vorfrühlingsabenden geplant, wenn der Schnee<br />
gerade getaut, die Erde aber noch nicht wieder zu sich gekommen<br />
war, noch länger nicht ihren Körper den Pflügen<br />
und Hacken hingeben, sich befruchten lassen und ab dann<br />
die Zeit der Menschen vom Morgen bis zum Abend in Anspruch<br />
nehmen würde.<br />
Sie gehörten zu einer Generation, die mit Wohnwagen<br />
unterwegs war, einen Hausersatz hinter sich herzog. Einen<br />
kleinen Gasherd, Klappstühle, einen Klapptisch. Eine Plastikschnur<br />
zum Aufhängen der Wäsche, wo man Halt machte,<br />
hölzerne Wäscheklammern. Wasserfestes Wachstuch für<br />
den Tisch. Ein Picknick-Set für Touristen bestehend aus<br />
bunten Tellern, aus Besteck, Salzfäßchen und Gläser – alles<br />
aus Plastik.<br />
Irgendwo unterwegs, auf einem Flohmarkt, wie ihn er<br />
und meine Mutter besonders gerne besuchten (wenn sie sich<br />
nicht zufällig gerade gegenseitig vor Kirchen und Denkmälern<br />
fotografierten) hatte mein Vater einen Teekocher aus der<br />
Armee erstanden, ein Gerät aus Kupfer, ein Gefäß mit einem<br />
Rohr in der Mitte, in das man eine Handvoll kleingebroche-<br />
nes Reisig legen und es anzünden konnte. Obwohl es auf den<br />
Campingplätzen Stromanschlüsse gab, kochte er das Wasser<br />
immer in diesem qualmenden langsamen Teekessel. Er kniete<br />
über dem heißen Gefäß und lauschte stolz auf das Bullern<br />
des kochenden Wassers, das er dann auf die Teebeutel goß<br />
– ein echter Nomade.<br />
Sie hielten an den dafür bestimmten Orten, auf Campingplätzen,<br />
immer in Gesellschaft anderer Leute ihres Schlags,<br />
und hielten Schwätzchen mit den Nachbarn über die Socken<br />
hinweg, die an den Zeltschnüren trockneten. Mit Hilfe des<br />
Reiseführers wurden Reiserouten festgelegt, wobei die Sehenswürdigkeiten<br />
sorgfältig aufgelistet wurden. Bis Mittag<br />
Baden im Meer oder einem See, am Nachmittag ein Ausflug<br />
zu den Ruinen und Überresten von Städten, zum Abschluß<br />
das Abendessen, meistens aus Eingewecktem bestehend: Gulasch.<br />
Frikadellen, Klopse in Tomatensauce. Dazu brauchte<br />
man nur noch Reis oder Nudeln zu kochen. Ewiges Sparen,<br />
der Zloty steht schlecht, das ist der rote Heller der Welt.<br />
Orte suchen, wo es Stromanschluß gibt, dann wieder unwillig<br />
packen um weiterzureisen, jedoch immer im metaphysischen<br />
Bereich des eigenen Hauses. Sie waren keine echten<br />
Reisenden, denn sie reisten, um zurückzukehren. Und sie<br />
kehrten immer erleichtert heim, mit dem Gefühl eine Pflicht<br />
gut erfüllt zu haben. Sie kamen zurück, um einen großen<br />
Stapel Briefe und Rechnungen von der Kommode zu nehmen.<br />
Um große Wäsche zu machen. Die heimlich gähnenden<br />
Freunde mit ihren Fotos zu Tode zu langweilen. Das<br />
sind wir in Carcassone. Und hier ist meine Frau, vor dem<br />
Hintergrund der Akropolis.<br />
Dann führten sie das ganze Jahr ein seßhaftes Leben, ein<br />
Leben, in dem man morgens da weitermacht, wo man am<br />
Abend aufgehört hat, in dem die Kleidung ganz vom Geruch<br />
der eigenen Wohnung durchdrungen ist und die Füße rastlos<br />
ihren Pfad auf dem Teppich austreten.<br />
Das ist nichts für mich. Offenbar fehlt mir irgendein Gen,<br />
das beim Menschen Wurzelbildung bewirkt, sobald dieser<br />
einige Zeit an einem Ort ist. Ich habe es oft versucht, aber<br />
meine Wurzeln waren flach, jeder beliebige Windstoß konnte<br />
mich ausreißen. Ich konnte nicht sprießen, diese Pflanzenfähigkeit<br />
fehlt mir. Ich ziehe keine Säfte aus der Erde, ich<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
in ein Anti-Anteus. Meine Energie schöpft sich aus der Bewegung<br />
– aus dem Ruckeln von Autobussen, dem Dröhnen<br />
von Flugzeugen, dem Schaukeln von Fähren und Zügen.<br />
Ich bin handlich, klein und kompakt. Mein Magen ist anspruchslos,<br />
meine Lungen kräftig, mein Bauch fest, meine<br />
Armmuskeln stark. Ich nehme weder Medikamente noch<br />
Hormone und trage keine Brille. Alle drei Monate einmal<br />
rasiere ich mir die Haare mit dem Apparat, ich benutze so<br />
gut wie keine Schminke. Ich habe gesunde Zähne, vielleicht<br />
nicht ebenmäßig doch ganz, nur eine alte Plombe ist da, ich<br />
glaube im Sechser links unten. Leberwerte normal. Bauchspeicheldrüsenwerte<br />
normal. Die Nierenfunktion rechts und<br />
links hervorragend. Meine Bauchschlagader in der Norm.<br />
Meine Harnblase genau richtig. Hämoglobin:12.7; Leukozyten:<br />
4.5; Hematokrit: 41.6; Thrombozyten: 228; Cholesterol:<br />
204; Kreatinin: 1,0; Bilirubin: 4,2; und so weiter. Mein<br />
IQ – wenn man an so etwas glaubt – ist 121, das reicht. Ich<br />
habe eine außergewöhnlich gut entwickelte räumliche Vorstellungskraft,<br />
die fast eidetisch ist, dafür eine schlechte Lateralisierung.<br />
Persönlichkeitsprofil instabil, wahrscheinlich<br />
wenig vertrauenswürdig. Alter: psychologisch. Geschlecht:<br />
grammatisch. Bücher kaufe ich lieber im Taschenbuch, um<br />
sie ohne Bedauern auf Bahnsteigen liegenzulassen, für die<br />
Augen anderer. Ich sammle nichts.<br />
Ich habe mein Studium abgeschlossen, aber im Grunde<br />
habe ich keinen Beruf erlernt, was ich sehr bedauere: Mein<br />
Großvater war Weber, er bleichte die gewebte Leinwand, indem<br />
er sie auf einem Hang ausbreitete und dem hellen Sonnenlicht<br />
aussetzte. Es würde mir Spaß machen, Kette und<br />
Schuß mit einander zu verweben, aber es gibt keine transportablen<br />
Webrahmen, die Weberei ist eine Kunst für seßhafte<br />
Menschen. Unterwegs stricke ich. Leider ist es neuerdings<br />
bei manchen Fluggesellschaften verboten, Strick- oder Häkelnadeln<br />
mit an Bord zu nehmen. Ich habe wie gesagt kein<br />
Fach gelernt, dennoch habe ich, ungeachtet der Warnungen<br />
meiner Eltern, überleben können, indem ich auf Reisen alle<br />
möglichen Arbeiten ausgeübt habe und keineswegs unter die<br />
Räder gekommen bin.<br />
Aus dem Polnischen von Esther Kinsky<br />
Wydawnictwo Literackie<br />
Cracow 2007<br />
123 × 197 • 364 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-08-03986-1<br />
Translations rights: De Geus<br />
Olga Tokarczuk Läufer<br />
5<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
<strong>Andrzej</strong> <strong>Stasiuk</strong> Dojczland<br />
6<br />
Photo: Piotr Janowski AG<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die Handlung dieses – amüsanten und zugleich melancholischen<br />
– Büchleins ist einfach gestrickt: seit gut zehn Jahren absolviert<br />
<strong>Andrzej</strong> <strong>Stasiuk</strong> als Autor Lesereisen durch die deutschsprachigen<br />
Länder. Er liest, beantwortet Fragen, kehrt ins Hotel zurück,<br />
steigt morgens in den Zug, geht zur Lesung, liest, beantwortet<br />
Fragen, kehrt ins Hotel zurück...<br />
Mit Hilfe dieser Reflexionen ordnet <strong>Stasiuk</strong> die kulturelle Landkarte<br />
Europas, richtet Europa nach seinem eigenen Zentrum aus.<br />
Doch setzt er alles daran, dass trotz der vieljährigen Vergleiche<br />
zwischen Ost und West seine Heimat immer noch das vertraute<br />
Kuhdorf bleibt. Er idealisiert Polen nicht – na ja, vielleicht ein<br />
biss-chen. Sein Buch ist eine Art Überlebensratgeber für alle,<br />
die in ein ähnliches Abenteuer geraten sollten – das heißt, die<br />
radikale Konfrontation der heimischen Rückständigkeit mit der<br />
fremden Moderne. Es ist eher eine<br />
Erfahrung der Persönlichkeitspsychologie<br />
als der Geografie. Wie<br />
der Autor sagt: „Nach Deutschland<br />
fahren, das ist Psychoanalyse.“<br />
Um sich nicht „zum Deutschen“ machen zu lassen, also zu einem<br />
Anhänger der Höherwertigkeit westlicher über die östliche<br />
Kultur, muss man, erstens, Deutschland als ein Land behandeln,<br />
in das man zum Geldverdienen fährt. Dort gibt es Geld, Arbeit<br />
und gute Verhältnisse; hier, in Polen, das heißt in Rumänien<br />
– Menschen, mit denen man sich unterhalten, zusammen sein,<br />
gemeinsam etwas erleben kann. Zweitens muss man die Armut<br />
als die wahre Beziehung zwischen Mensch und Ding betrachten.<br />
Wenn uns das gelingt, werden wir sehen, dass in der Welt des<br />
Überflusses die Menschen zu Sklaven der Gegenstände werden<br />
– die ihren Status symbolisieren und die alte Ahnenherrlichkeit<br />
ersetzen. In der Welt der Armut ist es anders: hier landen die abgenutzten<br />
Autos des Westens, hier können die Menschen Dinge<br />
verwenden, die nicht mehr zu gebrauchen sind, und sie beurteilen<br />
sich nicht nach ihrem Besitz, denn sie wissen, dass alle Dinge<br />
nur geliehen und vergänglich sind. Außerdem muss man Sehnsucht<br />
haben, und wenn wir uns nach Polen, also nach Rumänien,<br />
sehnen, dann kann kein Bayern oder sonstiges Westfalen unsere<br />
Sehnsucht stillen, soviel ist klar. <strong>Stasiuk</strong> zwinkert uns aber bisweilen<br />
zu und sagt, dieser Text über die „Zigeuner des vereinten<br />
Europa“ sei nur ein Gag für das westliche Publikum.<br />
Przemysław Czapliński<br />
<strong>Andrzej</strong> <strong>Stasiuk</strong> (geb. 1960), Prosaist,<br />
Dichter, Essayist, Literaturkritiker. Seine Bücher<br />
wurden in fast alle europäischen Sprachen<br />
übersetzt.<br />
<strong>Andrzej</strong> <strong>Stasiuk</strong> Dojczland<br />
7<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
<strong>Andrzej</strong> <strong>Stasiuk</strong> Dojczland<br />
8<br />
Na<br />
ja. Da sind wir wieder bei der Politik gelandet,<br />
das wollte ich eigentlich vermeiden. In der letzten<br />
Zeit hat sich der politische Druck in Polen<br />
ein bisschen verstärkt. Die Leute, die da regieren, glauben<br />
nicht an ein Leben jenseits der Politik. Auf sie selbst mag das<br />
sogar zutreffen. Die tun ganz pfiffig und mutig, aber kaum<br />
sollten sie einmal nach Deutschland fahren, haben sie sich<br />
vor Angst in die Hosen gemacht. Ich glaube, der Präsident<br />
war’s. „Magen-Darm-Beschwerden“, so erklärte man das dem<br />
Volk in Fernsehen und Zeitungen. Zum Glück verschwinden<br />
die von der Politik meist bald irgendwo in der Versenkung,<br />
wir aber, das Volk, wir bleiben, denn das Volk kriegt nicht<br />
einfach so Dünnschiss. Jedenfalls wollte ich sagen, dass zu<br />
meinen Lesungen, auch wenn ich Pole bin, vermutlich andere<br />
Leute kommen als die aus den Meinungsumfragen. Nur<br />
ein paarmal war es so, dass jemand aufstand und dramatisch<br />
fragte: „Wann werden eure Homosexuellen endlich gleichberechtigt<br />
sein?“. Ich antwortete ebenso dramatisch: „Der Tag<br />
ist nah.“ Oder es wurde gefragt: „Wann hört ihr endlich auf,<br />
unsere Autos zu klauen?“ Ich erwiderte nach bestem Wissen<br />
und Gewissen: „Das wird wohl noch eine Weile dauern.“ Ja,<br />
sollen wir vielleicht die russischen klauen? Aber das waren<br />
Einzelfälle. Meist ging es meinem Publikum um die Literatur.<br />
Die Menschen kamen zum Zuhören und fragten danach<br />
nicht mehr nach Homosexualität, Feminismus und all<br />
dem. Sie fragten nicht einmal nach Jedwabne. Sie lauschten<br />
wirklich auf den Text. Sie hörten, wie die Gedanken eines<br />
Fremden in ihrer eigenen Sprache klangen, und ich überlegte,<br />
wie weit diese Gedanken auch ihre eigenen sein konnten.<br />
Ich fragte mich, ob mich das Deutsche ihnen näherbringt<br />
oder von ihnen entfernt, ob meine Worte und Gedanken auf<br />
Deutsch ebenso seltsam und unbekannt sind wie mein Land,<br />
oder gerade umgekehrt. Da saßen sie fast eine Stunde ruhig<br />
und reglos. Ihr Zuhören hatte etwas Unnachgiebiges, etwas<br />
Endgültiges. Damit war nicht zu spaßen. Hier hatte Luther<br />
die Bibel übersetzt. In Deutschland hat das Wort Gewicht.<br />
Vielleicht hat dieser Ernst sogar auf mich abgefärbt? Vielleicht<br />
nahm ich selbst das, was ich geschrieben hatte, ernster,<br />
zumal es in der deutschen Übersetzung ein Viertel länger<br />
war. In Freiburg durfte keine slawische Unbeschwertheit an<br />
den Tag gelegt, in Friedrichshafen musste die Selbstironie gezügelt<br />
werden. An manchen Orten wurde Eintritt verlangt.<br />
Sie alle, diese Menschen aus Städten, Kleinstädten, manchmal<br />
sogar vom Land, Frauen und Männer, Alte und Junge,<br />
kamen her, um etwas zu lernen, etwas zu erfahren, sich eine<br />
Meinung zu bilden. Nicht ausgeschlossen, dass sie nachsehen<br />
wollten, ob ich lüge. Oder prüfen, ob mein Menschsein<br />
ihrem Menschsein ähnlich ist. Oder sie wollten ihr Bedürfnis<br />
nach Umgang mit dem Andersartigen befriedigen. Wir<br />
musterten uns interessiert, doch auch verunsichert. Für viele<br />
von ihnen, vielleicht die meisten, war ich der erste Pole im<br />
Leben. Dazu war ich weder Landarbeiter noch Bauarbeiter<br />
noch der mythische Autodieb, der ihre BMWs und Mercedes<br />
in den Osten verschob. Auch sie waren die ersten Deutschen<br />
für mich. Schließlich sind meine Leser die einzigen<br />
Deutschen, die ich kenne. Außer meinen Lesern habe ich<br />
niemand kennengelernt. Abgesehen natürlich von den Zugreisenden,<br />
den Passagieren auf Bahnhöfen und Flughäfen.<br />
Davon habe ich mehr gesehen als Leser, und häufiger, aber<br />
wir wussten nicht viel voneinander. Ich hatte den Vorteil,<br />
dass ich wusste, wer sie sind. Wer ich bin, wussten sie dagegen<br />
nicht. Sie mochten ahnen, dass ich keiner von ihnen<br />
war, sie mochten sich vorstellen, ich sei ein großgewachsener<br />
Türke, aber sie konnten nicht herausfinden, wer ich wirklich<br />
war. Ich dagegen sah sie an und wusste: ihr seid Deutsche.<br />
Alle, fast alle in den Zügen und auf den Bahnhöfen. Ich hatte<br />
dieses elementare, grundsätzliche Wissen über sie, das sie<br />
von mir nicht haben konnten. Ich fühlte mich wie ein Spion.<br />
Ich beobachtete sie, dachte über sie nach und machte<br />
mir – wenn mir danach war – sogar Notizen. Ich drang in<br />
ihr Deutschsein ein. Ich fuhr mit dem silbernen ICE von<br />
Dortmund nach Berlin, schlückelte meinen Jim Beam, kritzelte<br />
etwas ins Notizbuch, sah die grünen Ebenen, die waldigen<br />
Höhen des Harz und konnte nach Belieben über das<br />
Deutsche sinnieren. […] Auf der Fahrt von Heilbronn nach<br />
Frankfurt kann ich im kosmischen ICE-Waggon darüber<br />
nachdenken und gleichzeitig zusehen, wie die Passagiere ihre<br />
Rollkoffer hinter sich herziehen und konzentriert die elektronischen<br />
Reservierungsanzeigen mustern. Sie bewegen sich<br />
vorsichtig, mit drollig gereckten Köpfen. Manchmal schließe<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
ich die Augen halb, dann verschwimmen ihre Silhouetten.<br />
Auf dem Platz neben mir lege ich, wenn er nicht reserviert<br />
ist, Sachen ab, denn ich will nicht, dass jemand sich dorthin<br />
setzt. Ihre Nähe ersehne ich keinesfalls. Ich will, dass ihre<br />
Gestalten sich mit meinen Gedanken vermischen, mit den<br />
Erinnerungen an die Autos des Onkels und die Erzählungen<br />
meiner Großmutter: Sie sollte schon sterben, stand schon<br />
an der Wand, da hat der Offizier es sich aus irgendeinem<br />
Grunde anders überlegt, die Pistole eingesteckt und ist weitergegangen.<br />
Ich will, dass sich die vom Tempo verschmierte<br />
Landschaft mit den pfeilgeraden Türmen am Horizont und<br />
die undeutlichen Bilder alter Städtchen mit roten Dächern<br />
darüber legen, will, dass sich das alles vermischt und am<br />
Ende ein verständliches Bild ergibt: Meine Großmutter an<br />
der Wand des eigenen Hauses, der silberne ICE, Axel mit<br />
der Thermoskanne am Dresdner Bahnhof, Klaus Kinski in<br />
Fitzcarraldo, Bruno S. in Stroszek, Brot für warme, frisch<br />
gemolkene Milch, fünfhunderttausend gebrauchte Golf auf<br />
polnischen Straßen, die Schlacht bei Grunwald, alte Leute<br />
in Polen, die mechanisch wiederholen: „Wissen Sie, unter<br />
den Deutschen war Ordnung“, die Graffiti auf den Mauern<br />
meiner Kreisstadt: „Wenn Hitler lebte, hätten wir Arbeit“,<br />
und dazu noch „Mein lieber Augustin“ und „Der Tod ist ein<br />
Meister aus Deutschland“...<br />
Aus dem Polnischen von Olaf Kühl<br />
Czarne<br />
Wołowiec 2007<br />
125 × 195 • 112 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-7536-005-9<br />
Translation rights: Czarne<br />
<strong>Andrzej</strong> <strong>Stasiuk</strong> Dojczland<br />
9<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Włodzimierz Kowalewski Die Exzentriker<br />
10<br />
Photo: Privatarchiv<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ciechocinek, ein verfallener polnischer Kurort im Jahre 1957.<br />
Die Zahnärztin Wanda erhält zwei Nachrichten: eine schlechte<br />
und eine gute. Sie erfährt, dass sie unheilbar krank ist, aber<br />
auch, dass ihr geliebter Bruder Fabian aus Großbritannien zurückkehrt,<br />
wohin er als Soldat der Anders-Armee kam. Fabian<br />
kehrt im Zuge des „Tauwetters“ nach Polen zurück, der politischen<br />
Entspannung, die in Polen nach Stalins Tod einsetzte. Die<br />
Heimreise ist für ihn keine leichte, frohgemute Entscheidung,<br />
denn die Begegnung mit der Schwester bedeutet die Konfrontation<br />
mit der noch nahen Kriegsvergangenheit und dem Verlust<br />
seiner Lieben. Nur das Geschwisterpaar hat überlebt. Wanda<br />
verharrt immer noch in Trauer, Fabian jedoch scheut vor ihr<br />
zurück. Der König des Lebens und Meister des Swings sucht<br />
in dem Trost, was er immer liebte.<br />
In der Musik. Die vor Jahren auch<br />
Wanda viel bedeutete, als sie in der<br />
Jazzband ihres Bruders brillierte. Es<br />
mag den Anschein haben, dass es in<br />
dem in Hoffnungslosigkeit versunkenen Städtchen keine Chance<br />
gibt, eine Band zu gründen. Dennoch geschieht das Wunder,<br />
und bei Fabian melden sich mehr und mehr Musiker. Zu<br />
ihnen gehört der Stadtmiliziant Stypa, der Sanatoriumsarzt Vogt<br />
und die schöne Englischlehrerin Modesta. Als auch Wanda ihre<br />
Skepsis überwindet, ist schon sicher, dass das Wunder wahr<br />
werden kann. Und währen, solang die Staatsmacht es zulässt.<br />
Die Erzählung über das Entstehen einer Jazzband bietet Kowalewski<br />
die Gelegenheit, nicht nur die polnische Wirklichkeit der<br />
späten fünfziger Jahre nachzubilden, sondern auch die Atmosphäre<br />
der Vorkriegszeit aufleben zu lassen. Zu deren Leitfigur<br />
der letzteren wird Reichmann, einstiger Kurgast in Ciechocinek<br />
und Autor bekannter Liedtexte. Er erscheint im Roman dank eines<br />
Tagebuchs, dass Fabian auffindet. Aber auch die lebenden<br />
Protagonisten zitieren den Geist ihrer Jugend. Diese „Exorzismen“<br />
lassen sie vergessen, was sie durchgemacht haben, und<br />
sie ihre Lebensfreude wiederfinden.<br />
Marta Mizuro<br />
Włodzimierz Kowalewski (geb. 1956),<br />
Schriftsteller, Essayist, mit etlichen Literaturpreisen<br />
ausgezeichnet. Die Exzentriker ist bereits sein fünfter<br />
Prosaband.<br />
Włodzimierz Kowalewski Die Exzentriker<br />
11<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Włodzimierz Kowalewski Die Exzentriker<br />
12<br />
Je<br />
tiefer es ins Landesinnere ging, desto mehr Schnee<br />
gab es. Sie jagten die schmale, fast völlig leere Straße<br />
zwischen den Spalieren nackter Bäume entlang,<br />
passierten nur dann und wann einen Fuhrwagen mit in Pelze<br />
geschlagenen Kutschern, kümmerliche Lastwagen und himmelblaue,<br />
durch den trüben Tag gräuliche PKS-Autobusse<br />
des Typs „Krasula“, die lange Rauchschleier von Abgasen<br />
hinter sich her zogen. Der Vauxhall preschte vor, ringsum<br />
entrollte sich eine ungesäuerte und groblinnene Landschaft.<br />
Die sumpfigen Tümpel waren noch nicht gefroren, ringsum<br />
Büschel von Gestrüpp, Felder unter einer dünnen Schneeschicht,<br />
einsame Katen. In den Dörfern Schweine auf Leiterwagen,<br />
Kinder, die unterwegs in große Brotlaibe bissen,<br />
in den Städtchen Schlamm und Kopfsteinpflaster, Schlangen<br />
vor den Läden mit Fleisch und Wurst. Das Radio spielte,<br />
zwischen den Nachrichten und „Wissenswertem für die<br />
Landwirtschaft“ Kujawiaks und Obereks, dann das Mandolinenensemble<br />
Ciukszas, Wicharys Tanzorchester, Gesang<br />
– Hanna Rek, Kurtycz, Koterbska.<br />
„Sie müssen gestern Geld wie Heu rausgeworfen haben.<br />
Vor allem, als sie später unbedingt diesen französischen<br />
Champagner trinken mussten. Sauer wie Gurkensaft.“ Modesta<br />
verzog das Gesicht.<br />
„Was heißt hier Champagner. Schaumwein, nichts anderes.<br />
Von der Marke habe ich noch nie gehört.“<br />
„Tausend haben sie verpulvert. Ganz sicher.“<br />
„Gleich kann es mehr werden, schauen Sie nur genau zu.“<br />
In der völlig menschenleeren Gegend standen zwei Milizianten<br />
mit einem Motorrad mit Beifahreranhänger, der in<br />
einer Schneewehe versank. Einer sah aus wie ein Luftlöscher<br />
eines Küsters – lang, mit Hakennase, der andere hatte den<br />
Hals bandagiert. Beide fuchtelten mit ihren Lutschern. Fabian<br />
fuhr an den Straßenrand. Der mit der Sperbernase ging<br />
um das Auto herum und klopfte auf Modestas Seite gegen<br />
die Scheibe.<br />
„Führerschein, Ausweis, Fahrzeugpapiere, Benzinkarte,<br />
Reiseerlaubnis“, rezitierte er, als sie das Fenster herunterdrehte,<br />
dann verbog er sich bis zur Hälfte und versuchte,<br />
den Schädel ins Innere zu pressen, und blieb dabei mit dem<br />
Helm am Dach hängen. Es verschlug ihm die Sprache, seine<br />
Züge längten sich vor Staunen.<br />
„Ahhh... wo ist denn hier das Lenkrad? Womit lenken Sie<br />
denn den Wagen, Genossin?“<br />
„Zyggy! Das ist doch ein englischer Wagen, alles für die<br />
linke Linke!“, röchelte der Bandagierte, bevor Modesta überhaupt<br />
irgendetwas antworten konnte.<br />
„Englisch? Englisch? In dem Fall wird ausgestiegen, sofort!“,<br />
kommandierte er und rückte seine Berichttasche<br />
zurecht. Er umkreiste das Auto nochmal in den winzigen<br />
Schritten einer Geisha, stand vor Fabian, deutete irgendwas,<br />
begann deutlich Silben zu artikulieren, ganz laut, fast schon<br />
brüllend:<br />
„Bit-te stei-gen Sie ...“<br />
Fabian stieg aus.<br />
„Sie sprechen Polnisch?“, freute sich der Miliziant.<br />
„Sehr gut.“ Es wäre nämlich dumm, gleich in einer Fremdsprache<br />
seiner Tätigkeit nachzugehen...<br />
Jetzt hatte er auch die Papiere vergessen, der Vauxhall nahm<br />
seine Aufmerksamkeit stärker in Anspruch, er sah sich im<br />
Fahrzeug um, machte sich an den Schaltknöpfen zu schaffen,<br />
prüfte, ob die Polster weich war, pfiff anerkennend.<br />
„Schau doch mal, Winiek“, sagte er erregt zu seinem bandagierten<br />
Kollegen, rupfte an der Lenkradschaltung „sogar<br />
den Schaltknüppel hat er links! Genosse Fahrer, wie fährt es<br />
sich damit auf polnischen Straßen? Unbequem, was?“<br />
„Aber das ist doch kinderleicht“, erwiderte Fabian. „Man<br />
muss sich nur daran gewöhnen, links ist rechts, und rechts<br />
ist links.“<br />
„Rechts ist links, links ist rechts. Kinderleicht“, sprach der<br />
Miliziant verständig nach.<br />
Sie kontrollierten gar nichts mehr, rissen Witzchen, fragten<br />
nach dem Motor, den PS, der Höchstgeschwindigkeit,<br />
dem Autofahren in England, den gefahrenen Strecken. Sie<br />
rieten noch, wegen des Wetters mit Licht zu reisen, gaben<br />
die Papiere zurück und salutierten höflich.<br />
Als die Rücklichter des Vauxhalls an der Linie zwischen<br />
Straße und Himmel verschwammen, hoben die beiden ihre<br />
Helme, wischten sich den Schweiß von den Stirnen, warfen<br />
die Lutscher, die Berichttaschen und die Gürtel mit den<br />
Halftern in den Motorradanhänger.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
„Schluss mit der Vorstellung. Jetzt schreibt ihr mir alles<br />
genau auf. Den Bericht morgen früh, vor der Lagebesprechung,<br />
8 Uhr fünfzehn“, befahl der Bandagierte trocken.<br />
Sie fuhren direkt zur Villa „Konstancja“, wo Modesta ein<br />
Zimmer mietete. Das war eine Pension mit einer sonderbaren<br />
Glaspyramide mitten auf dem Flachdach, gegenüber dem<br />
Kiefernpark, den jetzt Schneeflocken wie Watte bedeckten.<br />
Sie ließ ihn jedoch etwas weiter entfernt anhalten, erlaubte<br />
ihm nicht auszusteigen, rang selbst mit dem Koffer.<br />
„Ich gebe Ihnen die Hälfte für gestern zurück!“, rief sie<br />
zum Abschied.<br />
Aus dem Bayer-Schuppen, in dem einst die Britschka für<br />
Ausfahrten der Gäste in die Umgebung stand, rollte er ein<br />
Wägelchen auf quietschenden Rädchen heraus, fuhr zwei<br />
rostige Fahrräder ins Freie, warf die verschlissenen Gartenschläuche,<br />
eine Heugabel, Spaten und Harken zur Seite. Er<br />
fuhr hinein, und dann hob er mit dem Wagenheber das Vorderteil<br />
des Vauxhall an. Schnaufend und schnaubend robbte<br />
er unter dem Wagen hervor, zündete eine Taschenlampe<br />
an. Der Aufsatz auf der Ölwanne, die er beim Blechschmied<br />
Callender in Willersley in Auftrag gegeben hatte, war an Ort<br />
und Stelle, die darangelötete, von unten unsichtbare ehemalige<br />
Kakaodose auch, was er heute morgen noch hatte<br />
überprüfen können, blind tastend, vor dem Grand Hotel.<br />
Er drehte sechs Schrauben ab, danach den Blechdeckel, verschmierte<br />
sich die Hände mit Graphitöl, das er zur Tarnung<br />
drübergestrichen hatte. Dann stand er auf, mit einem Knäuel<br />
Lumpen polierte er das Blech, das einem Schildkrötenpanzer<br />
ähnelte, und endlich ließ sich die Dose öffnen. Er atmete<br />
auf. Es war nichts passiert. Der in mehrere Plastiktüten gewickelte<br />
und mit einem Band verklebte Inhalt hatte die Reise<br />
unbeschadet überstanden.<br />
Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier<br />
W.A.B.<br />
Warsaw 2007<br />
123 × 195 • 324 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 978-83-7414-036-2<br />
Translation rights: W.A.B.<br />
Włodzimierz Kowalewski Die Exzentriker<br />
13<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Henryk Waniek Der Fall Hermes<br />
14<br />
Photo: Elżbieta Lempp<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Der Vorsitzende des Großen Konsistoriums Hermann Daniel<br />
Hermes wird eines Tages unvermittelt seines Amtes enthoben.<br />
Ohne Begründung und ohne die Möglichkeit Einspruch zu erheben,<br />
auch wenn er dies für den Rest seines Lebens versuchen<br />
wird. Seine Vergehen kommen erst nach seinem Tode ans Licht,<br />
als die höchsten Richter sich seines Falles annehmen: die Engel.<br />
Mithilfe von Unterlagen, die bis zur Geburt des Angeklagten zurückreichen,<br />
aber auch dank modernster Überwachungs- und<br />
Archivierungsmethoden sind sie in der Lage, jede einzelne seiner<br />
Handlungen genau zu durchleuchten. Doch das Urteil der<br />
Engel ist von einer starken Antipathie gegen den Angeklagten<br />
geprägt, die Dokumente sind unvollständig und erlauben keine<br />
eindeutige Interpretation. Die Richter sehen sich gezwungen,<br />
neue Zeugen aufzuspüren, die Lücken zu schließen und sich für<br />
die einzig richtige Version der Wahrheit über Hermes zu entscheiden.<br />
Die Untersuchungen im Fall Hermes haben den Charakter eines<br />
Lustrationsverfahrens und der gesamte<br />
Roman kann als eine Reaktion<br />
auf das heutige Lustrationsmodell,<br />
eine zeitgenössische Variante der<br />
mittelalterlichen Hexenjagd, verstanden werden. Mit all ihren<br />
Verdrehungen der Wahrheit und ihrem Mangel an Objektivität,<br />
der jegliche Zweifel an der Schuld eines Angeklagten einfach<br />
wegwischt. Die scherzhafte Darstellung ändert nichts am Wesen<br />
ihres Sachverhalts: In der eindeutigen Beurteilung menschlicher<br />
Handlungen – so suggeriert Waniek – wird es immer auch<br />
Missbräuche geben.<br />
Die Geschichte spielt in der Zeit vor der französischen Revolution<br />
und dem Aufkommen der antimonarchistischen Bewegung,<br />
die zu tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungen führte.<br />
Hermes ist Freimaurer, Antimonarchist und ein Befürworter der<br />
sich anbahnenden Veränderungen, auch wenn er eher im Verborgenen<br />
wirkt. In seinen Ansichten und seinen Handlungen<br />
spiegelt sich die Einstellung zahlreicher „Verschwörer“ jener<br />
Zeit wieder. Darüber hinaus dienen sie dem Autor als Anlass zur<br />
Darstellung der verschiedenen Oppositionsgruppen und ihres<br />
Einflusses auf die Politik – in diesem Falle der preußischen.<br />
Henryk Wanieks Roman verbindet die Vorzüge des historischen<br />
Romans mit denen des politischen Traktats und der metaphysi-<br />
schen Abhandlung. Seine größte Stärke sind die Porträts seiner<br />
Protagonisten, sowohl der irdischen als auch der himmlischen,<br />
die in ihren Schwächen oft überaus „menschlich“ erscheinen.<br />
Auch die Balance zwischen Realismus und Fantastik gelingt ausgezeichnet.<br />
Marta Mizuro<br />
Henryk Waniek (geb. 1942), Maler, Prosaist,<br />
Essayist, Kunstkritiker, Übersetzer und Experte auf<br />
dem Gebiet der Esoterik.<br />
Henryk Waniek Der Fall Hermes<br />
15<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Henryk Waniek Der Fall Hermes<br />
16<br />
ENGEL:<br />
Ich möchte Ihnen allen eine<br />
langatmige Einleitung ersparen<br />
und sie gleich darauf<br />
hinweisen, dass ich mit Ihnen über die Bibliothek sprechen<br />
werde. Und da es sich hierbei um eine vertrauliche Angelegenheit<br />
handelt, bitte ich sie, nichts von dem, was hier gesagt<br />
werden wird, nach außen zu tragen. Ich danke Ihnen<br />
für ihr Kommen und zähle auf Ihre Unterstützung. Über<br />
Bibliotheken weiß ich so gut wie nichts. Selbstverständlich<br />
meine ich damit nicht die Regale, Kataloge und die ganze<br />
tote Ordnung der Bestände. Wie das aussieht, kann ich mir<br />
schon selbst vorstellen. Von Ihnen möchte ich etwas über<br />
die Geheimnisse hören, die sonst nicht in die Öffentlichkeit<br />
dringen, über die nur Eingeweihten vorbehaltene, tiefere<br />
Philosophie dieser bibliografischen Schatzkammern. Und da<br />
Herr Graf bereits die Augen geöffnet haben, frage ich Sie einfach<br />
zuerst. Über die Bedeutung der Bibliothek müssen Sie<br />
mir nichts erzählen. Es ist allgemein bekannt, dass sich dort<br />
die weltweit größte Sammlung von Hymnen befand. Warum<br />
eigentlich gerade Hymnen?<br />
GRAF:<br />
Entschuldigen Sie, dass ich so undeutlich spreche. Die Kälte<br />
macht meinem Unterkiefer irgendwie zu schaffen. Sehen<br />
Sie nur, wie er zittert. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen<br />
soll. Das alles ist schon so lange her und so verworren. Vor<br />
allem weil es mit so großen Kosten, Anstrengungen und Befürchtungen<br />
verbunden war. Eine Bibliothek bedeutet eine<br />
große Verantwortung. Des Nachts träumte ich von Feuersbrünsten;<br />
von Holzwürmern, monströsen Nagekäfern, die<br />
als Anobium punctatum bekannt sind und die sich durch<br />
die Seiten von Büchern fressen; von gemeinen Diebstählen<br />
der wertvollen Exemplare; von dreisten Fälschungen.<br />
Ich denke nur ungern daran zurück, aber für Sie, Herr Rat,<br />
mache ich selbstverständlich eine Ausnahme. Das Sammeln<br />
von Gesangbüchern – und anderen Büchern, über die ich<br />
später noch sprechen werde – ist eine Familientradition, die<br />
auf meinen Großvater zurückgeht. Heutzutage denkt jeder,<br />
Hymnen seien nichts weiter als Lieder für den gemeinen Pöbel.<br />
Vergessen sind die seligen Zeiten, als man in den Salons<br />
und den Gotteshäusern, auf den Exerzierplätzen und den<br />
Schlachtfeldern sang, im reinen Bestreben, die Herzen der<br />
Menschen und mit ihnen die ganze Welt zu läutern. Bereits<br />
zu Lebzeiten meines Vaters nahm das Unheil seinen Lauf.<br />
Der Kitsch griff um sich, eine Flut von Fälschungen raubte<br />
der Hymne ihre ursprüngliche Reinheit. Zuvor hätte niemand<br />
etwas Derartiges gewagt. Eine Hymne war etwas Heiliges!<br />
Ein römischer Soldat wäre lieber gestorben, als auch<br />
nur ein Wort seines Legionsliedes zu verändern. Der Gesang<br />
entschied über den Ausgang der Schlacht – über Sieg oder<br />
Niederlage. Zahlreiche entsprechende Hinweise finden sich<br />
bei Thukydides, noch mehr bei Sueton. Hätten die Klöster<br />
nicht damit begonnen, ihre Possen mit den Hymnen zu treiben,<br />
lägen nicht so viele von ihnen heute in Trümmern. Das<br />
Gleiche gilt für die so schmählich untergegangenen Staatswesen.<br />
Und je mehr Zeit verging, desto schlimmer wurde<br />
es. Die Hymne wurde in den Schmutz billiger Tanzbuden<br />
herabgezogen. Jeder erstbeste Zirkus brauchte seine Hymne.<br />
Und zur Zeit der Aufklärung erreichte der Skandal seinen<br />
Höhepunkt. Zu den traditionellen Melodien wurden jetzt<br />
moderne, rationalistische Texte verfasst. Irgendwo in Böhmen<br />
entstand eine geheime Hymenwerkstatt. Schleichhändler<br />
verkauften ihre Erzeugnisse zum halben Preis. Natürlich<br />
waren sie ohne jeden Wert. Die Leute sangen sich die Lunge<br />
aus dem Hals, doch es half nichts. Kein Heldenmut, keine<br />
göttliche Gnade und noch nicht einmal ein wenig Hoffnung.<br />
In dieser Welt sollte meine Bibliothek zu einer Arche Noah<br />
werden, einer Festung gegen den Ansturm der Barbarei.<br />
ENGEL:<br />
Und alle Falschheit sollte an Ihrer Bibliothek zerschellen!<br />
GRAF:<br />
Bereits in jungen Jahren betrachtete ich die Rettung der<br />
Hymne als meine Lebensaufgabe. Als ich mit zehn Jahren in<br />
die Schule kam, verfügte ich auf diesem Gebiet bereits über<br />
ein beträchtliches Wissen. Mit Entsetzen musste ich feststellen,<br />
dass alle meine Mitschüler und auch die meisten meiner<br />
Lehrer Gesangbücher von zweifelhaftem Wert verwendeten,<br />
sodass alles Lernen im Grunde für die Katz war. Als ich meinem<br />
Vater davon berichtete, nahm er mich aus der Schule<br />
und vertraute meine weitere Ausbildung dem Kaplan Mayer<br />
an. Dieser Mann besaß das außergewöhnliche Talent, in<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Sekundenschnelle zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden.<br />
Und eben diese Fähigkeit lehrte er mich, bis ich<br />
ein gewisses Alter erreichte. Dann öffnete er einen Schrank,<br />
den er bis dahin immer vor mir verschlossen gehalten hatte.<br />
Der Schlüssel allein reichte nicht, man musste auch die Zauberformel<br />
kennen: Makbenak. Er sprach sie, die Scharniere<br />
knarrten und was gab es dort nicht alles zu sehen! Und alles<br />
in tadellosem Zustand! Das Beste, was der menschliche Geist<br />
seit Entstehung der Welt hervorgebracht hatte. Die größten<br />
Schätze der Hymnologie. Mit der Zeit wies mich mein Lehrer<br />
in ihre Geheimnisse ein. Nach und nach erschlossen sich<br />
mir die Arkana des göttlichen Klangs.<br />
ENGEL:<br />
Ich habe gehört, dass sich dem Singenden manchmal die<br />
ganze unermessliche Macht der Hymne offenbart, die seinen<br />
Geist erleuchtet und ihn die Geheimnisse des Lebens schauen<br />
lässt. Ich habe auch gehört, dass der Hymne eine Kraft<br />
innewohnt, die, richtig angewandt, die Mauern belagerter<br />
Städte zum Einsturz bringt und die Herzen der Menschen<br />
entflammt. Sie haben vorhin von der Entstehung der Welt<br />
gesprochen, Herr Graf. Ich würde gerne wissen, was sie von<br />
der Legende halten, der Schöpfer habe weiter nichts getan,<br />
als nacheinander sieben Hymnen zu singen. Halten Sie es für<br />
möglich, dass, wie die Hymnologen behaupten, das Universum<br />
allein durch Gesang entstanden sein könnte?<br />
GRAF:<br />
Indem Sie diese alte Überlieferung als Legende bezeichnen,<br />
schmälern Sie eine wichtige Wahrheit und treffen doch<br />
gleichzeitig auch den Kern der Sache. Ganze vier dieser sieben<br />
Legenden befanden sich im Besitz unserer Bibliothek.<br />
Mein Vater hatte sie von einem levantinischen Händler erworben.<br />
Dieser wiederum hatte sie ebenjenem Kloster abgekauft,<br />
in dem Salomon selbst sie einst niedergelegt hatte.<br />
ENGEL:<br />
Genau das wollte ich von Ihnen hören. Nichts anderes habe<br />
ich erwartet.<br />
Aus dem Polnischen von Heinz Rosenau<br />
Wydawnictwo Literackie<br />
Cracow 2007<br />
123 × 197 • 334 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-08-04090-4<br />
Translation rights:<br />
Wydawnictwo Literackie<br />
Henryk Waniek Der Fall Hermes<br />
17<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Eustachy Rylski Die Insel<br />
18<br />
Photo: Świat Książki<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die Stärke und die Zierde von Rylskis Schaffen liegt bekanntlich<br />
in der Gestaltung der Haupthelden (wenngleich es auch<br />
den Nebenfiguren an nichts mangelt). In allen vier Erzählungen<br />
des Bandes Die Insel finden wir untadelige Beispiele dafür. Wir<br />
begegnen gewöhnlichen wie außergewöhnlichen Gestalten: einem<br />
unglücklichen Buchhalter, einem sterbenden Großschriftsteller<br />
in der Emigration, der entfernt an Gombrowicz erinnert,<br />
einem Provinz-Gänschen, sowie einem Opfer einer Urlaubsromanze,<br />
einem herausragendem, rebellischem Geistlichen und<br />
Playboy, dem – zumindest bis zu einem bestimmten Augenblick<br />
– eine Karriere in Vatikan winkt (in der titelgebenden Erzählung).<br />
Jeder dieser Helden ist ungeachtet seiner sozialen Herkunft<br />
oder seiner geistig-moralischen Qualitäten ein, um den Titel<br />
eines Romans von Rylski zu benutzen, „Mensch im Schatten“,<br />
eine gebrochene Gestalt, düster, aller Illusionen beraubt, ein<br />
definitiver Verlierer. Das soll aber<br />
nicht heißen, daß Rylski bei der Gestaltung<br />
der Personen schematisch<br />
verfährt; so ist es nicht.<br />
Man beachte den sorgfältig durchdachten<br />
Aufbau des Bandes. Alle<br />
vier Erzählungen spielen am Meer: die erste und dritte an der<br />
Ostsee, die zweite und vierte am Mittelmeer (im Süden Frankreichs<br />
und auf der titelgebenden Insel vor der Nordküste Afrikas).<br />
In der ersten und dritten Erzählung ringen die Helden mit<br />
Gebilden ihrer eigenen Einbildung, in der zweiten und vierten<br />
haben wir es mit dem klassischen Verhältnis zu tun, das heißt<br />
mit einem Duell der Antagonisten. Die Helden von zwei Erzählungen<br />
sterben unter hochbedeutsamen, metaphorisch ausgedrückten<br />
Umständen, in den beiden anderen kommt es zu einem<br />
geheimnisvollen Rollentausch.<br />
Rylski verführt einerseits durch deftige Handlungsmotive voller<br />
Überraschungen, mit fein dosierter Spannung und meisterhaft<br />
eingesetzten Täuschungsmanövern, und andererseits arrangiert<br />
er fesselnde Debatten, in denen es hart auf hart geht. Er möchte,<br />
daß wir sowohl seinen Einfallsreichtum beim Erfinden der<br />
Fabel als auch sein – wenn man so sagen darf – dramaturgisches<br />
Talent. Daß in den Erzählungen, die sich auf den Dialog<br />
stützen, die Handlung nicht zu kurz kommt, versteht sich von<br />
selbst. Das jüngste Buch von Eustachy Rylski ist in jeder Hinsicht<br />
gelungen.<br />
Dariusz Nowacki<br />
Eustachy Rylski (geb. 1944), Schriftsteller,<br />
Theater- und Drehbuchautor. Nach langem<br />
Schweigen veröffentlichte er 2004 wieder einen<br />
Roman.<br />
Eustachy Rylski Die Insel<br />
19<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Eustachy Rylski Die Insel<br />
20<br />
Vom<br />
Leben eingeschüchtert, beschloß die<br />
Friseurpraktikantin aus Wągrowiec, etwas<br />
träge vom Schlaf, von der Süße und<br />
der ersten Jugend, gemeinsam mit ihrer Freundin, übrigens<br />
auf deren Zureden, den Urlaub in einem der modischen<br />
Orte am Meer zu verbringen.<br />
Der Kurort entsprach ihren Vorstellungen von der großen<br />
Welt, und als ein Mann von Welt erwies sich auch Sylwek,<br />
ein gut aussehender Mann von dreißig, der den Duft von<br />
Erfolg, Geld, Selbstsicherheit und Eau de Cologne Paco Rabanne<br />
um sich verbreitete.<br />
Sylwek und sein Kumpel Kapiszon waren Könige des Lebens.<br />
Markenklamotten, gute Zigaretten, teure alkoholische<br />
Getränke, Armbänder an den Handgelenken und das jeweils<br />
passende Dope.<br />
Monika war beeindruckt von den Jungs und der Welt, die<br />
sie vor ihr ausbreiteten, so daß sie sich, irgendwo am Strand<br />
angesprochen, ohne spezielle Absicht, ja sogar ohne Überzeugung,<br />
sehr wahrscheinlich in einem Augenblick der Langeweile<br />
oder des gedankenlosen Übermuts voll Leidenschaft<br />
der Urlaubsromanze hingab.<br />
Sie war allzu begierig aufs Glück, als daß die ostentative<br />
Straflosigkeit, mit der die jungen Männer und ihre Kumpane<br />
das Leben genossen, sie auch nur im geringsten verlockt<br />
hätte. Kneipenschlägereien, bravouröse Pirouetten auf den<br />
Waverunnern, ein riskantes Hasardspiel vor der Eröffnung<br />
des Kasinos, das schon verfaulte, ehe es reif war, nächtliche<br />
Fahrten durch die engen Straßen der erschrockenen Stadt,<br />
schließlich die zotige Vorstadtsprache, die wie eine vergiftete<br />
Quelle durch die dünne Oberfläche vorgetäuschter Korrektheit<br />
drang – das alles hielt das Mädchen nicht davon ab, sich<br />
verzaubern zu lassen.<br />
Im Gegenteil: Je ungestümer dieses Leben verlief – und das<br />
war von Tag zu Tag mehr der Fall –, desto größer wurde Monikas<br />
Appetit darauf. Es ließ sich nicht verhehlen: Das Mädchen<br />
war zu jung, dumm und unempfindlich, um in ihrer<br />
Faszination durch einen Hauch Nachdenklichkeit stören zu<br />
lassen. Umso mehr als sie selbst an Glanz gewann und sich<br />
aus einer grauen Maus in eine verliebte Frau verwandelte, die<br />
sich ihrer Reize bewußt wurde.<br />
An Glanz gewann auch der Kurort, der in den Augen des<br />
Mädchens zu Hollywood, Monaco, San Remo wurde, Orten,<br />
die sie bisher nur aus den Klatschspalten von Illustrierten<br />
kannte.<br />
Als deren Heldin fühlte sie sich ein wenig.<br />
Doch der Urlaub ging zu Ende, ehe er richtig auf Touren<br />
gekommen war, wie es einem mit allen Annehmlichkeiten<br />
ergeht.<br />
Die Verliebten gingen auseinander. Monika fuhr nach<br />
Wągrowiec, Sylwek natürlich nach Warschau.<br />
Sie versprachen einander, sich regelmäßig zu schreiben<br />
und so oft wie möglich zu besuchen. Monika kehrte nicht<br />
mehr an ihre Arbeitsstätte zurück, denn man kehrt nicht aus<br />
dem Paradies in einen provinziellen Friseursalon und von<br />
einem Märchenprinzen zu langweiligen Kundinnen zurück,<br />
die nicht wußten, was Lust ist. Worüber hätte sie auch mit<br />
ihnen sprechen sollen? Und Gespräche waren doch das Wesen<br />
und der Kern ihrer Arbeit.<br />
Sie hatte vor, sich nach etwas Passenderem umzusehen.<br />
Derweil verflog ihr die Zeit mit Träumen und Briefen. Von<br />
Chips und Coca-Cola wurde sie mächtig dick, und vom<br />
Zanken mit den Eltern nahm sie Schaden.<br />
Bisher nach außen hin unsicher, vorsichtig und zurückgezogen,<br />
kompensierte sie dies durch ein größeres Maß<br />
häuslicher Unabhängigkeit, als es dem Status eines unselbständigen<br />
Kindes entsprach. Jetzt vertieften sich die Abhängigkeiten,<br />
schon aus Mangel an Arbeit, doch die Autonomie,<br />
die sich sich willkürlich zuerkannt hatte, entartete durch ihre<br />
Dreistigkeit.<br />
Damit verletzte sie die Eltern, ohne Rücksicht auf die Umstände.<br />
Die Eltern, bisher stets offen und von nicht nachlassender<br />
Geduld, verschlossen sich in einem Schweigen, das Monika<br />
bald aus Langeweile, bald aus einer sich selbst steigernden<br />
Wut brutal brach. Nicht ohne Erfolg, wenn Roheit auf die<br />
Wehrlosigkeit einfacher, fleißiger, verantwortungsbewußter<br />
Leute trifft, die, über die Zeiten verwundert und von ihnen<br />
unabhängig, zu Gefühlen bereit sind.<br />
Was nun die Korrespondenz betraf, so war sie ganz einseitig.<br />
Auf ihre immer ungeduldiger werdenden Briefe erhielt<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Monika keine Antwort.<br />
An manchen Tagen dachte sie an Selbstmord, an anderen<br />
heiterten die Urlaubserinnerungen ihre Seele auf, aber das<br />
eine wie das andere ergoß sich durch denselben Bach fieberhafter<br />
Euphorie, so als führten Gedanken an den Tod wie<br />
solche an das Leben zu demselben Ziel.<br />
Hin und wieder – meistens am Telefon – sprach sie über<br />
ihren Zustand mit ihrer Freundin Ewa, die in ihren Hoffnungen<br />
mehr Mäßigung bewies, nicht ihre Arbeit aufgab,<br />
ihre Urlaubsromanze mit Kapiszon gegen ein intimes Verhältnis<br />
mit einem wohlhabenden verheirateten Mann vertauschte<br />
und es sich gut gehen ließ.<br />
Zwei Monate gingen dahin. Die Tage wurden grau und<br />
kurz. Schlimmere Gedanken häuften sich, bessere wurden<br />
rar. Die Freundin redete Monika zu, etwas zu unternehmen.<br />
Sie sollte der Ungewißheit ein Ende machen. Sie schadet<br />
dem Leben. Entweder kann sie sich sagen, es ist aus und<br />
vorbei, oder sie soll, wenn sie das nicht kann, Konsequenzen<br />
daraus ziehen.<br />
Auf Monikas Frage hin, worin diese Konsequenzen bestehen<br />
sollten, wurde Ewa von sich aus aktiv. Mit einiger Mühe<br />
machte sie den Freund von Sylwek ausfindig, und nachdem<br />
sie Monika ein bißchen im ungewissen gelassen hatte, teilte<br />
sie ihr die Adresse ihres schon vergessenen sommerlichen<br />
Liebhabers mit.<br />
Es fiel Monika nicht leicht, aber nach Allerseelen machte<br />
sie sich zurecht, hob die Ersparnisse vom Konto der Eltern<br />
ab, stieg in den Zug und fuhr nach Warschau.<br />
Kapiszon traf sich mit ihr in einem Klub, der an ein Rattenloch<br />
erinnerte und im übrigen auch nicht viel größer war,<br />
erfüllt von den Spasmen psychedelischer Musik.<br />
Dort hing ein Haufen schrecklicher junger Leute herum,<br />
die in einer schrecklichen Sprache über schreckliche Dinge<br />
sprachen, aber am allerschrecklichsten fand Monika Kapiszon<br />
mit seiner unverhohlenen Hoffnung, sie zu ficken, irgendwo,<br />
an der Bar, in der Toilette, im Auto, auf der Straße.<br />
Er hielt sie hin, beschwindelte sie, machte sich über sie<br />
lustig, bestellte immer wieder ein neues Bier, antwortete<br />
nicht auf ihre Fragen oder teilte ihr ungebeten etwas mit,<br />
aber nach zwei Stunden dieser Quälerei, die Monika wie eine<br />
Ewigkeit vorkamen, ließ er nach, wurde weich, setzte aus,<br />
diktierte ihr eine Adresse und verschwand.<br />
Aus dem Polnischen von Friedrich Griese<br />
Świat Książki<br />
Warsaw 2007<br />
130 × 210 • 240 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 978-83-247-0558-0<br />
Translation rights:<br />
Bertelsmann Media<br />
Eustachy Rylski Die Insel<br />
21<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
<strong>Andrzej</strong> Bobkowski Dämmerung<br />
22<br />
Photo: Institut Littéraire<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
<strong>Andrzej</strong> Bobkowski nimmt als Schüler von Joseph Conrad<br />
in der polnischen Literatur eine Sonderstellung ein. Józef Czapski<br />
schrieb in der „Kultura“ nach dem verfrühten Tod des Autors<br />
von Wehmut? Wonach zum Teufel?: „Dieser Sohn Conrads könnte<br />
sich als unentbehrlicher Begleiter für so manchen Polen erweisen,<br />
der von Abenteuern träumt, von einem Leben ohne Zensur<br />
und ohne Verrenkungen auf Geheiß einer morschen Ideologie,<br />
von einem Leben nach eigener Wahl, selbstverantwortlich und<br />
erfüllt“.<br />
So kam es auch, und man kann höchstens bedauern, daß die<br />
Entdeckung Bobkowskis durch die jungen Polen so spät erfolgte<br />
(an der Wende der achtziger und neunziger Jahre des vorigen<br />
Jahrhunderts) und daß eigentlich nur eine Generation daran<br />
teilhatte. Die soeben erschienene Ausgabe gesammelter Prosa<br />
mit dem Titel Dämmerung könnte eine gute Einführung in das<br />
literarische Werk Bobkowskis darstellen, dessen wichtigste<br />
Errungenschaft natürlich Wehmut? Wonach, zum Teufel? bleibt.<br />
In Dämmerung finden wir jedoch<br />
Erzählungen, die direkt mit diesem<br />
Werk korrespondieren: ein kollektives<br />
Porträt der Bewohner eines<br />
Pariser Wohnhauses, das die französischen<br />
nationalen Veränderungen<br />
in den Kriegsjahren zeigt, und natürlich eine Radtour durch<br />
Südfrankreich gleich nach dem Krieg.<br />
Ein besonderer Leckerbissen für Literaturfreunde ist auch das<br />
Gespräch Boris Pasternaks mit einem KGB-Beamten, der ihn<br />
zwingt, den Nobelpreis abzulehnen. Über einen solchen Pakt<br />
mit dem Teufel erzählt Bobkowski auch an anderer Stelle, wenn<br />
er sich direkt an die Schriftsteller von jenseits des Eisernen Vorhanges<br />
wendet: „Ihr habt in Ruhe gelebt, ihr hattet ein Heim,<br />
einen gut gefüllten Kühlschrank, einen Garten; ihr hattet euer<br />
eigenes Klima und eure Landschaft, euren Boden, eure Bäume<br />
und euren Himmel und gleichzeitig euren eigenen Kontinent im<br />
Inneren, in den ihr emigrieren konntet, wenn euch danach war.“<br />
In diesem Band finden wir auch ein Fragment des Romans Die<br />
Dämmerung, der darin, mehr noch als sonst, seinen ganzen Individualismus,<br />
seine schöpferische Andersartigkeit und Ausnahmestellung<br />
unter Beweis stellte.<br />
Krzysztof Masłoń<br />
<strong>Andrzej</strong> Bobkowski (1917-1961), Autor<br />
von Wehmut? Wonach zum Teufel?, das als „Hymne<br />
an die Freiheit und das Individuum“ gilt.<br />
<strong>Andrzej</strong> Bobkowski Dämmerung<br />
23<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
<strong>Andrzej</strong> Bobkowski Dämmerung<br />
24<br />
Man<br />
gelangt von einem großen Hof über eine<br />
Seitentreppe hierher. Dort, geradeaus, sind<br />
diese breiten Steine mit dem himmelblauen<br />
Teppich, der wie eine Kaskade vom fünften Stock herabfällt.<br />
Unsere Treppe ist ein hölzerner sechsstöckiger Korkenzieher.<br />
Jene führt zu den großen, soliden Wohnungen richtiger Mieter.<br />
Unsere windet sich steil empor, bis unters Dach, wo sie<br />
zum Labyrinth der Korridore und Kammern „derjenigen von<br />
oben“ führt, wie die Concierge sich abfällig ausdrückt.<br />
Jacques, ein lebhafter Mitarbeiter der Metro, sagte ihr einmal,<br />
wenn er von oben hinunterspucke, überflute das ihre<br />
Schwelle. Das kann sie ihm nicht verzeihen. Und wenn sie<br />
am Morgen den mit Kacheln ausgelegten Hof abspritzt, fragt<br />
M. de Saint-Esprit, ein Staatsbeamter, stets mit freundlichem<br />
Lächeln: Ca pousse bien? Das polnische Zimmermädchen<br />
des Grafen de Farges ist zu vornehm, um sich mit der Hausmeisterin<br />
zu unterhalten; das schickt sich für Magda nicht,<br />
die sie Mademoissele Madeleine nennen. Nicht zu reden davon,<br />
daß Magda die Comtesse de Farge, wenn diese verreist,<br />
in allem vertritt und mit M. le Comte angeblich nicht nur<br />
am selben Tisch ißt... Das weiße Hündchen mit verschiedenfarbigen<br />
Flecken von M. Guillou, von Beruf Färber von<br />
Heidekraut, Immortellen und anderen ewigen Blumen für<br />
haltbare Kränze und Kaminsimse, macht vor das Tor immer<br />
das, was es auf der Straße machen sollte. Die Concierge verdächtigt<br />
die beiden einer Verschwörung, doch M. Guillou<br />
lächelt bloß und sagt gedehnt unter seinem bretonischen<br />
Schnurrbart: Quelle méchante bête. Wenn er das sagt, denkt<br />
er gewiß nicht an seinen „Friquet“. Mit Eliane, einem Modell<br />
vom Modehaus „Ardanse“, sind die Beziehungen seit Jahren<br />
abgebrochen; Eliane unternahm einen Staatsstreich: sie holt<br />
keine Briefe mehr ab. Um der Zensur ihrer Korrespondenz<br />
zu entgehen, der man entnehmen könnte, daß das Vorführen<br />
von Kleidern bei Modeschauen bei „Ardanse“ nicht die<br />
einzige Quelle ihrer Einkünfte darstellt, holt sie ihre Briefe<br />
poste-restante ab. Daher kann man oft hören, wie die wachsame<br />
Madame la concierge im Bistro an der Ecke quäkt: „Sie<br />
ist heute nachmittag nach Hause gekommen, ohne daß sie<br />
am Morgen weggegangen wäre“, oder: „Solche erheben sich<br />
vom Bett, wenn sie sich ausruhen wollen.“ Es ist ein ewiger<br />
Krieg. Doch die Angriffe begegnen bloß Elianes Lächeln,<br />
unserem Lächeln von oben.<br />
Dort oben gibt es kein Gas, keine Elektrizität. Es gibt<br />
den Wind, die Sonne, den Mond und die Sterne. Der Blick<br />
schweift über das endlose Meer der Dächer. Wenn schönes<br />
Wetter herrscht, sind sie blau und ruhig; wenn Wolken aufziehen<br />
und der Wind mit gewaltigen Schlägen auf sie einzuhämmern<br />
beginnt, werden sie grau und kalt. Der Regen<br />
runzelt ihre glatte Oberfläche, und der Sturm treibt von<br />
ihren Kämmen, wie von Wellenkämmen, Wasserwolken,<br />
um sie mit Krachen gegen die verglasten Luken über uns<br />
zu schleudern. Das Spinnennetz des fernen Eiffelturms reißt<br />
in Stücke, Sacre-Cœur, weiß wie ein Zuckerhut, verschwindet<br />
im Nebel. Der Wind rüttelt an den Türen, tappt durch<br />
die Korridore; die reglosen, schwarzen Abdeckbleche der<br />
Schornsteine recken ihm in ruckartigen Drehungen ihre eiserne<br />
Brüste entgegen. Wenn dann wieder die Sonne scheint,<br />
wenn die blauen Flecken des Himmels sich in den glänzenden<br />
Flächen spiegeln, entsteht eine tiefe, gute Stille.<br />
Auch das Frühjahr kommt hierher oben rascher. Ehe noch<br />
die Schaufenster von Vilmorin auf dem Quai de Mégisserie<br />
in farbigen Samensäckchen erblühen und das „Samaritaine“<br />
sich in ein riesiges Arsenal von Gießkannen, Rechen und Käfigen<br />
mit Geflügel verwandelt; ehe auf dem Pont au Change<br />
zweimal die Woche Baumschulen ausschlagen und auf den<br />
Gehsteigen eine grüne Bürste von Gemüse- und Blumensetzlingen<br />
aufgeht, spüren wir schon sein Nahen. Von Tag<br />
zu Tag krümmt sich der Bogen der Sonne stärker, eine verschlafene<br />
Fliege rutscht in ersten Ausflügen über die Scheibe.<br />
Das Tschilpen der Spatzen klingt anders, wenn sie in den<br />
Dachrinnen baden, im Wasser geschmolzenen Raureifs.<br />
Hier vergingen helle Tage und ruhige Nächte; hier vergingen<br />
Winter und kurze Frühlinge. Die Sommersonne walzte<br />
das Blech der Dächer heiß und kühlte es im Herbst wieder<br />
ab. Die Neonlichter vom Montmartre, von den Boulevards<br />
und vom Montparnasse färbten die Dächer lange Zeit rosa.<br />
Jahr für Jahr zerstoben einundzwanzig Salven künstlichen<br />
Feuers über ihnen, in Vierzehnter-Juli-Buketts, von jenem<br />
Krieg. Dann brach neuerlich Finsternis herein, erleuchtet<br />
von den Fackeln von Bränden, von fernen Explosionen, vom<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Sternenhagel von Leuchtspurgeschoßen. Das einst gutmütige<br />
Lächeln von oben wurde bösartig und konspirativ.<br />
An den langen Abenden las M. Guillou das Evangelium auf<br />
Lateinisch noch lauter, wobei er die unverständlichen Worte<br />
schlecht aussprach. Bei den Prozessionen seiner Kongregation<br />
bewunderten seine Glaubensgenossen sein Latein noch<br />
mehr als die schöne Fahne, auf die er immer so stolz war.<br />
Er lief nun in irgendwelche geheimnisvolle Versammlungen<br />
und beriet sich lange mit Jacques. M. de Saint-Esprit wurde<br />
wortkarg und ging oft mit einer Aktentasche, vollgestopft<br />
mit allerlei Papieren, zur Arbeit. Bei Jacques versammelten<br />
sich junge Leute in Windjacken, die mit schweren Stiefeln<br />
über die Treppe polterten. Eliane las die uferlosen Werke<br />
Vom Winde verweht und Der große Regen, und wenn die Sirenen<br />
zu heulen begannen, lief sie mit Magda nach unten.<br />
Im tiefen Hof der Metrostation „Pigalle“ ging es oft fröhlich<br />
zu. Manchmal sah man dort spät abends die schlanke<br />
Silhouette eines großgewachsenen Jünglings in brandneuer,<br />
schlecht sitzender Kleidung über die große Treppe huschen.<br />
Magda sagte, sie habe einmal gehört, wie sich jemand mit einem<br />
von ihnen englisch unterhielt. Wir lächelten und Jacques<br />
sagte: „Dort unten gibt es auch anständige Leute.“ Die<br />
Sprache war die gleiche, der gleiche der Sinn der verbotenen<br />
Worte.<br />
Und dann wurde das Lächeln wieder gutmütig wie zuvor,<br />
als nach einigen Tagen des Schießens eines Augustabends<br />
die Motoren von GMCs durch alle Straßen heulten. M. de<br />
Saint-Esprit sah verächtlich auf seine Plantage paketierten<br />
Tabaks auf dem Balkon und rauchte, über die Trikolore gebeugt,<br />
eine „Lucky“, Eliane und Magda kauten Kaugummi,<br />
so wie Hunderttausende langer, grüner Burschen mit schweren<br />
Helmen, und sagten „ok“. Jacques erzählte mit dem<br />
Pathos eines Cyrano von seinen Kämpfen im Viertel Batignolles,<br />
und M. Guillou färbte konzentriert viele Blumen<br />
für viele Kränze. Ein gutes Lächeln aber hatten alle, sogar<br />
die Concierge.<br />
Aus dem Polnischen von Martin Pollack<br />
Biblioteka Więzi<br />
Warsaw 2007<br />
125 × 199 • 111 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-603-5630-2<br />
Translation rights:<br />
Institut Littéraire Kultura<br />
<strong>Andrzej</strong> Bobkowski Dämmerung<br />
25<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Jerzy Pilch Der Zug ins ewige Leben<br />
26<br />
Photo: Olga Majrowska<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Seit dem Jahr 1994 publiziert Jerzy Pilch in etwa zweijährigen<br />
Abständen in Buchform seine ausgewählten Kolumnen und<br />
Feuilletons, die ursprünglich in Tageszeitungen und Magazinen<br />
erschienen waren. Der neueste Band Der Zug ins ewige Leben<br />
versammelt Texte, die in den Jahren 2002 bis 2006 erschienen<br />
sind. In der Verlagsinformation wurde angemerkt, dass der<br />
Autor absichtlich die Kolumnen über Fußball und Literatur ausgelassen<br />
hatte – zwei Phänomene, die für ihn von besonderer<br />
Wichtigkeit sind. Diese Texte sollen in einem extra Band publiziert<br />
werden.<br />
Im Zug ins ewige Leben kann man zwei dominierende Themen<br />
ausmachen. Das erste sind, sehr weit verstandene, gesellschaftliche<br />
Angelegenheiten; in diesen Texten geht es um die<br />
gegenwärtige polnische Politik und vor allem um die Parteienlandschaft<br />
– hier zeigt sich Pilch als<br />
ironischer Betrachter und bissiger<br />
Kommentator. Diese Art seiner feuilletonistischen<br />
Leidenschaft könnte<br />
man unelegant als ein schamloses<br />
Ausweiden der Fauxpas, Fehltritte und schlichter Dummheiten<br />
der politischen Klasse bezeichnen.<br />
Der zweite — und wohl wichtigere — dominierende Gegenstand<br />
sind im gewissen Sinne private Angelegenheiten, meist in<br />
einem erinnernd-nostalgischen Duktus wiedergegeben.<br />
Hier spricht Pilch am meisten über sein Befinden, über seine<br />
Lektüre, über kulturelle Ereignisse, die ihn beeindruckt hatten,<br />
über Begegnungen mit faszinierenden Menschen, die wichtig für<br />
ihn waren, über Dinge, die ihn als Privatmenschen bewegen.<br />
Jerzy Pilch gilt als ein unerreichter Meister der gegenwärtigen<br />
polnischen Feuilletonistik, ein scharfsinniger Autor, der mit<br />
feinem, raffinierten Witz von den Begebenheiten unserer Zeit<br />
berichtet. Die Texte, die im Band Der Zug ins ewige Leben versammelt<br />
sind, beweisen wieder einmal, dass dieser Autor den<br />
Meistertitel uneingeschränkt verdient.<br />
Dariusz Nowacki<br />
Jerzy Pilch (geb. 1952), Prosaiker und<br />
Publizist, Träger des Literaturpreises Nike (2001);<br />
veröffentlichte mehrere Bände mit erzählender<br />
und diskursiver Prosa.<br />
Jerzy Pilch Der Zug ins ewige Leben<br />
27<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Jerzy Pilch Der Zug ins ewige Leben<br />
28<br />
Ein<br />
weiteres Anzeichen des sich im polnischen Lande<br />
verbreitenden Gesundheits-Faschismus ist<br />
– das sich mit riesigen Schritten nähernde und<br />
mit Triumph in den Medien angekündigte – völlige Rauchverbot<br />
in den InterCity-Zügen. Aus den diesbezüglichen<br />
Fahrgast-Umfragen der polnischen Bahn PKP geht hervor,<br />
dass sich achtzig Prozent der Reisegäste für ein solches Verbot<br />
aussprechen.<br />
Für die Raucher ist es eine enorme Ehre, dass sie in dieser<br />
erbärmlichen Epoche des gesunden, und folglich ewigen<br />
Lebens, eine zwanzigprozentige Unterstützung erhalten haben.<br />
Nichtdestotrotz hat die gesunde Mehrheit einen niederschmetternden<br />
Vorsprung über der kranken Minderheit<br />
gewonnen. Die Nikotinsucht ist, wie allgemein bekannt,<br />
eine Krankheit, jedoch eine zweideutige, eine selbstverschuldete,<br />
eine exzentrische Krankheit; eine zwar im traditionellen<br />
Sinne des Wortes nicht ansteckende, und dennoch im<br />
wesentlichen Sinne viel schlimmere Krankheit! Der Qualm<br />
und der Gestank, die vom Raucher in die Umgebung entweichen,<br />
vergiften höchst effektiv alle in seiner Nähe. Mit<br />
einem Wort: es ist keine Krankheit, derer Opfer irgendeine<br />
Chance hätten, die Vorteile beziehungsweise den Status von<br />
Behinderten zu genießen. Im Gegenteil: der natürliche Raum<br />
des Rauchers wird überall immer mehr begrenzt, und in der<br />
Folge zerstört. Raucherzimmer nach alter Tradition wurden<br />
schon vor langer Zeit dem Erdboden gleich gemacht; und<br />
auch das, was es noch gibt, diese demütigenden „Raucherecken“,<br />
auch diese Orte, irgendwo in der Nähe der Aborte<br />
angesiedelt, verschwinden nach und nach.<br />
Wenn aus den InterCitys die Raucherabteile verschwunden<br />
sind, wird bei uns endlich die gelobte Gesundheits-<br />
Gleichschaltung Einzug halten. Ich werde mich in den Zug,<br />
von, sagen wir mal, Warschau nach Breslau setzen, und über<br />
fünf Stunden lang werde ich nicht qualmen, werde meinen<br />
mitfahrenden Nächsten nicht dem passiven Rauchen aussetzen<br />
– diesen gut gebauten netten Mann neben mir, der<br />
sich während der langen Reise mit gesundem Schmalzbrot<br />
und einem nach kräftigender ländlicher Wurst riechenden<br />
Brötchen stärken wird, der den Boden mit Schalen seiner<br />
hart gekochten Eier vollsauen wird, der mit der Glasur seiner<br />
Berliner Pfannkuchen die Sitzbezüge voll schmieren wird.<br />
Ich werde angesichts all dessen still und ruhig sitzen und mir<br />
sagen: Es ist ja nichts, passives Essen schadet doch niemandem,<br />
bisher haben ja die amerikanischen Wissenschaftler<br />
nichts darüber gesagt, und der psychische Druck, der zählt<br />
ja nicht, es ist alles gut, alles in Ordnung.<br />
Vielleicht werde ich aus Sehnsucht nach einer Kippe die<br />
Nase hochziehen, und mein nichtrauchender, vor Gesundheit<br />
strotzender, vor Empathie geradezu explodierender Mitreisender<br />
wird mir eine Knoblauchzehe anbieten, „Das ist<br />
doch das Beste gegen Schnupfen!“, wird er freundlich sagen,<br />
und wenn ich ablehne, wird er sich, „rein vorbeugend“, zwei<br />
davon genehmigen.<br />
Nachdem er dann seine Stärkung mit lebensspendender<br />
Fanta hinunter gespült, herzlich gerülpst, sich in den Zähnen<br />
gepolkt hat, wird er sich zur Ruhe betten wollen; er wird<br />
seine Schuhe ausziehen und seine Beine zur Entspannungszwecken<br />
auf den gegenüber liegenden Sitz legen – und dann<br />
könnte es geschehen (ich will niemandem etwas vormachen),<br />
dass ich einen Nervenzusammenbruch bekomme. Ich<br />
werde abwarten, bis er die Augen geschlossen hat, und mich<br />
dann verstohlen davon schleichen, in den Toilettenraum,<br />
und dort werde ich mein Zigarettenpäckchen hervorholen<br />
und mir eine anstecken – im vollkommenen Bewusstsein der<br />
Tatsache, dass ich ein Gesetz breche. Ich werde mit voller<br />
Verzweiflung qualmen, als wenn es um mein Leben ginge.<br />
Ich mache mir dabei keine Illusionen: kaum, dass der blaue<br />
Dunst aus meiner Zigarette seine feinen Nüstern reizen<br />
wird, wird mein vom Krebs bedrohter Abteilnachbar erwachen,<br />
den Zugführer rufen, und dann werden sie kommen.<br />
Sie werden kommen und an die Klotür trommeln und mich<br />
da heraus schleifen. Und meine Tabakorgie wird mich fünf<br />
Hundert Złoty kosten.<br />
Nein, es ist kein billiges groteskes Bild, das ich hier vor<br />
euch entstehen lasse – jeder von euch hat schon eine solche<br />
Reise hinter sich, alle seid ihr schon quer durch Polen gefahren<br />
mit einem Monster im Abteil. Wenn es kein monströser<br />
Fresssack war, dann ein niedliches Kindchen mit drei Stück<br />
Magnum-Eis und einer riesigen Tüte Chips in der Hand,<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
wenn es kein Psycho war, der Schweine totquatschen konnte,<br />
dann eine nach überaus sinnlichem „Masumi“-Wässerchen<br />
duftende Schönheit, die mit ihrem Stil und der Wahl der<br />
Kosmetik in den Siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts<br />
hängen geblieben war.<br />
Die Raucher-Abteile, vor allem die in der Ersten Klasse,<br />
waren keine verkommenen Ghettos. Nein, es waren Paradiese,<br />
Oasen der Ruhe und der Freiheit! Und wie oft hatten<br />
die Nichtraucher, um anderen Gefahren zu entkommen, an<br />
diesen angeblich verseuchten Orten um Asyl gebeten? Wie<br />
oft hatten wir, Raucher, die Panik (Todesangst gar!) in den<br />
Augen eines nach stundenlanger Qual vollkommen erschöpften<br />
Mitreisenden gesehen und hatten ihn zu uns geholt, uns<br />
seiner angenommen – und verzichteten, solange er brauchte,<br />
um zu sich zu kommen, auf das Rauchen? Und dann reisten<br />
wir in Harmonie und Frieden weiter.<br />
Vor über zehn Jahren hielt ich mich im Herzen eines amerikanischen<br />
Staates auf, der aus einem einzigen riesigen Maisfeld<br />
bestand. Mitten in dem Maisfeld gab es einen mehrere<br />
Hektar großen Park, in den ich mich öfters des Abends begab,<br />
um, auf einer Bank sitzend, in Ruhe eine zu rauchen;<br />
aus dem am Horizont sichtbaren Wald tauchten Jogger auf,<br />
blieben bei meinem Anblick wie angewurzelt stehen, dann<br />
änderten sie ihre Route, um kilometerweit an mir vorbei zu<br />
laufen, um mir bloß nicht zu nahe zu kommen; ich konnte<br />
sie gar nicht mehr sehen, da hörte ich noch ihre panischen<br />
Rufe: „Smoke! Smoke! Smoke!“ Ich will nicht verraten, welche<br />
englische Formulierung sich mir als Antwort aufdrängte.<br />
Doch ich wusste Eines: ich vermisste mein Vaterland. Heutzutage<br />
allerdings ist es hier auch nicht besser; und man kann<br />
sein Vaterland zu Raucherzwecken nicht verlassen, es wäre<br />
sinnlos, da der Gesundheits-Faschismus mittlerweile in der<br />
ganzen Welt verbreitet ist.<br />
Aus dem Polnischen von Paulina Schulz<br />
Świat Książki<br />
Warsaw 2007<br />
124 × 200 • 320 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-247-0720-1<br />
Translation rights:<br />
Bertelsmann Media<br />
Jerzy Pilch Der Zug ins ewige Leben<br />
29<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Janusz Rudnicki Kommt, wir gehen<br />
30<br />
Photo: Krystof Kriz<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Der Protagonist von Janusz Rudnickis neuer Prosa kehrt aus<br />
Deutschland in seine Vaterstadt Koźle zurück, weiß nicht wirklich,<br />
was er mit sich anfangen soll, schmiert sich aus Langeweile<br />
das Gesicht mit schwarzer Schuhcreme ein, die Briefträgerin<br />
veranlasst ihn, ins Treppenhaus hinauszugehen, die Wohnungstür<br />
schlägt hinter ihm zu, eine Gasexplosion zerstört seinen<br />
Wohnblock, im übrigen steht es in ganz Polen nicht zum besten,<br />
denn immer wieder explodiert an den verschiedensten Orten<br />
Gas; der Held zieht mit anderen, die ebenfalls ihr Dach über<br />
dem Kopf verloren haben, durch Polen und Deutschland, erlebt<br />
die wunderlichsten Abenteuer… Rudnicki erfand eine Geschichte,<br />
die aus einer langen Reihe grotesker und absurder<br />
Situationen besteht, die mal lustig, mal furchterregend sind. Im<br />
Grunde handelt das Buch jedoch von zutiefst ernsthaften Dingen.<br />
Ein weiteres Mal greift der Autor<br />
von „Meine Wehrmacht“ das Problem<br />
der – ich gebrauche hier eine<br />
Bezeichnung Zbigniew Kruszyńskis<br />
– „verschobenen Menschen“, die ihr Land auf der Suche nach<br />
ihrem Ort auf Erden verließen und immer noch – wie Rudnicki<br />
behauptet – „im Spagat leben“, die ihrer Wurzeln und Gewissheiten<br />
verlustig gegangen sich mit einer ins Wanken geratenen<br />
Identität herumschlagen. „Kommt, wir gehen“ ist auch eine Erzählung<br />
über polnisch-deutsche Traumata, die Geschichte, die<br />
der Gegenwart immer noch ihren Stempel aufdrückt, Henker,<br />
die zu Opfern werden, Opfer, die zu Henkern werden. Rudnicki<br />
verfasste eine traurig-lustige, mitreißende und zudem stilistisch<br />
virtuose Prosa. Was gäbe es hier zu leugnen, kaum jemand vermag<br />
den Satzbau so kunstvoll zu verdrehen wie der Autor von<br />
„Kommt, wir gehen“.<br />
Robert Ostaszewski<br />
Janusz Rudnicki (geb. 1956) Prosaschriftsteller<br />
und politischer Emigrant. Lebt in Hamburg.<br />
Janusz Rudnicki Kommt, wir gehen<br />
31<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Janusz Rudnicki Kommt, wir gehen<br />
32<br />
Einkaufen<br />
gehen – oder nicht?<br />
Und wenn mich jemand<br />
erkennt? Aber<br />
wer? Wer sollte mich schon erkennen? Ich bin gerademal zurück<br />
und hab die Fenster ausgepackt, damit mir das Gesindel<br />
aus dem Nachbarblock nicht durch die Koffer glotzt, in<br />
die Gardinen. Und außerdem bin ich allein – wie jetzt meine<br />
weißen Zähne im Spiegel, die plötzlich zum ersten Mal den<br />
Kontext des Gesichts verloren haben, meines Gesichts.<br />
Deshalb wundere ich mich beim Türklingeln, zum Teufel.<br />
Ich öffne die Tür. Die Briefträgerin. Gebückt sucht sie etwas<br />
in der Tasche, mit dem Mund hält sie eine Blume fest.<br />
Und sagt schnaufend durch die Blume:<br />
„der Scheißaufzug ist schon wieder kaputt, gude!“<br />
„Gude“<br />
antworte ich, und sie steht plötzlich wie gebannt still, ihre<br />
Augen auch. Und die Blume plumpst runter, weil sich ihre<br />
Ober- und Unterlippe immer weiter voneinander entfernen.<br />
Was denn? Ich betrachte ihre Zähne voller Plomben und<br />
Drähte, denke erst an Türen, dann an Stacheldrahtsperren,<br />
dann an Güterwaggons, in denen ich gleich auf die bewusste<br />
Rampe gebracht werde, mit anderen Worten, ich gebe mich<br />
meinen Assoziationen hin wie ein willenloser Lump, und so<br />
kriege ich die Zeit irgendwie rum. Ich langweile mich nicht,<br />
wenigstens das nicht. Bis sie schließlich sagt:<br />
„Sind das Sie?!“<br />
Sie fragt, weil wir uns gestern schon gesehen haben, im<br />
Treppenhaus, ich habe mich vorgestellt, weil ich zurückgekommen<br />
bin und alleine lebe, meine Dame, ein einsames<br />
weißes Segel auf dreißig Quadratmeter Fläche. Ich sage,<br />
„Das bin ich, erkennen Sie mich denn nicht? Das weiße Segel...“<br />
Darauf sie:<br />
„Das nenne ich weiß“,<br />
und ich erinnere mich gleich an das, was ich vergessen hatte.<br />
„Ach, Sie meinen mein Gesicht? Das kommt vom Gas im<br />
Bad, ich wollte mir eine Zigarette am Boiler anstecken, und<br />
meine Frau hat gleichzeitig in der Küche das warme Wasser<br />
aufgedreht.“<br />
Darauf sie:<br />
„Sie sind verheiratet?“,<br />
und wie erstaunt sie war!<br />
Darauf ich:<br />
„Nein“,<br />
und erstaune über meine Worte noch mehr. Was für eine<br />
meine Frau?<br />
„Nein, nein“,<br />
sage ich wieder und wieder.<br />
„das ist natürlich ein Witz, ich habe das Wasser in der Küche<br />
selbst aufgedreht und mir in der Zeit im Bad am Boiler<br />
eine Zigarette angesteckt...“<br />
Die Sätze in die eine Richtung, ich in die andere. Kehlkopfverschluss,<br />
ein Stau, ein Wall. Ihre Augen starren mich<br />
staunend an und meine sie, weil ich mich genauso über mich<br />
wundere wie sie. Und so stehen wir da. Die Türschwelle trennt<br />
uns. Und die Blume, die heruntergefallen ist.<br />
Bis sie plötzlich das Gewicht von einem Bein auf das andere<br />
verlagert. Sie muss schließlich ganz schön laufen, sie tun ihr<br />
weh. Die Bewegung der Beine versetzt auch den übrigen Teil<br />
des Körpers in Bewegung, sie kommt wieder zu sich und sagt,<br />
„es riecht hier auch irgendwie nach Gas. Ich habe ein Paket<br />
für Ihren Nachbarn, aber er ist nicht zu Hause, könnten Sie<br />
als Nachbar das Paket Ihres Nachbarn annehmen, für Ihren<br />
Nachbarn?“<br />
„Könnte ich. Könnte ich gern. Ich nehme es an.“<br />
Ich soll unterschreiben, dass ich es angenommen habe,<br />
aber:<br />
„Wo? Worauf?“<br />
Darauf sie:<br />
„Vielleicht an der Wand?“<br />
Ich versuche es einmal, zweimal an der Wand, der Kugelschreiber<br />
will nicht.<br />
„Die Minenflüssigkeit läuft so weg. Sie müssen es senkrecht<br />
machen, schreiben, wissen Sie? Nicht waagrecht.“<br />
Ich komme ins Grübeln. Eine märchenhafte Einteilung<br />
des Schreibens. Ich komme so tief ins Grübeln, dass mir die<br />
Briefträgerin vor den Augen herumfuchteln muss, um mich<br />
wieder an die Oberfläche zurückzubringen.<br />
„Hallo! Guten Tag! Hier bin ich.“<br />
„Senkrecht, sagen Sie?“<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
„Klar.“<br />
„Dann kommen Sie vielleicht kurz rein, denn hier gibt es<br />
nichts, wo ich den Kugelschreiber senkrecht halten kann.“<br />
„Nein, nein, ich finde hier gleich...“<br />
Sie sieht sich um, ich sehe mich um, bis sie schließlich sagt<br />
„Unterschreiben Sie schnell, ich bücke mich“,<br />
sagt sie und bückt sich schon, worauf ich sage<br />
„Lieber bücke ich mich, dann bereite ich Ihnen keine<br />
Mühe.“<br />
Ihre Augen werden schon wieder groß.<br />
„Soll ich das Paket annehmen oder Sie? Wollen Sie auf Ihrem<br />
eigenen Rücken unterschreiben?“,<br />
sagt sie langsam zu mir, unsicher und starrt mich so an, dass<br />
ich mich fühle, als stünde ein anderer vor ihr. Und nicht ich.<br />
„Na, dann bücken eben Sie sich“,<br />
sage ich, also bückt sie sich, irgendwie mit dem Rücken zu<br />
mir, und der Nachbar zu meiner Linken – als wir uns vorher<br />
begrüßt haben, hatte er mir erzählt, er erinnere sich noch an<br />
mich, wie ich in den Sandkasten pinkelte – dieser Nachbar<br />
verließ also dann auch seine Wohnung, ich machte dann eine<br />
so wollüstige Miene, als würde ich bis zum Hals in dieser<br />
Briefträgerin stecken, hic et nunc, daraufhin verwandelte sich<br />
der Nachbar in ein Fragezeichen, woraufhin die Briefträgerin<br />
mir den Kopf zudrehte, dann fauchte sie wild, als sie mich so<br />
wollüstig sah, war beleidigt, worauf sie sich aufrichtete, aber<br />
von der Stelle weg! Und dem Nachbarn fiel die Einkaufstasche<br />
aus der Hand, und aus der Tasche fielen Pfandflaschen,<br />
direkt auf den Boden, und zerbrachen. Und der Nachbar bekam<br />
keine Luft mehr, bis er endlich welche bekam, und fragt:<br />
„Wer sind Sie?“<br />
Dann erinnere ich mich wieder an das, was ich vergessen<br />
habe, dass ich mir das Gesicht mit Schuhcreme vollgeschmiert<br />
habe, den Hals auch, und die Ohren, und ich sage:<br />
„Ach, Sie meinen mein Gesicht?“<br />
Ich sage:<br />
„Das kommt vom Gas im Bad, ich wollte mir am Boiler<br />
eine Zigarette anstecken, und meine Frau hat in der Zeit das<br />
warme Wasser in der Küche aufgedreht.<br />
Darauf er:<br />
„Sie sind verheiratet?“,<br />
und wie erstaunt er war!<br />
„Nein, nein, das ist natürlich ein Witz, ich habe das Wasser<br />
in der Küche selbst aufgedreht...“<br />
Daraufhin die Briefträgerin, dass sie genug hat, sie jetzt<br />
geht und dem Nachbarn eine Benachrichtigung wegen des<br />
Pakets an der Tür hinterlässt, und sie ging, und der Nachbar?<br />
Nichts, er steht nur mit vor Staunen offenem Mund da, und<br />
Plomben hypnotisieren mich doch, also trägt es mich wieder<br />
weg zu den Waggons... Ach, was für eine Unordnung, hier!<br />
Das Glas liegt da, er steht da, ich stehe da, vielleicht gehe ich<br />
einen Besen holen?<br />
Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier<br />
W.A.B.<br />
Warsaw 2007<br />
123 × 195 • 192 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 978-83-7414-332-5<br />
Translation rights: W.A.B.<br />
Janusz Rudnicki Kommt, wir gehen<br />
33<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Agata Tuszyńska Vorübungen zum Verlust<br />
34<br />
Photo: Agnieszka Herman<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Diese Geschichte hat wirklich stattgefunden: das Buch von Agata<br />
Tuszyńska ist ein tief bewegendes Dokument von Krankheit<br />
und Tod ihres Mannes. Texte wie diese schreibt man widerstrebend:<br />
Soll man schon jetzt, frisch, vor der literarischen Öffentlichkeit<br />
etwas enthüllen, das ein hochgradig intimes Erlebnis ist,<br />
das für keinen Außenstehenden in seinem Schrecken zugänglich<br />
ist? Die Antwort auf diese Frage gibt die Autorin selbst wie ihre<br />
Vorgänger und sie klingt scheinbar banal: Schreib darüber, denn<br />
du bist Schrifstellerin! Daraus spricht die Überzeugung, dass<br />
der Schriftsteller jemand sei, dessen Pflicht es gerade dies ist:<br />
Das Enthüllen und in Worte Kleiden von Extrem- und Grenzerfahrungen.<br />
Die Beschreibung der tödlichen Krankheit von Henryk Dasko, ist<br />
also ein Buch das für diejenigen geschrieben worden ist, die an<br />
solchem Geschehen teilnehmen werden – sowohl in der Rolle<br />
der Kranken, so wie in der Rolle<br />
derjenigen, die den Sterbenden am<br />
nächsten sind. Es ist ein Reiseführer<br />
durch die Hölle, und zugleich eine<br />
Aufforderung, nicht die Waffen zu<br />
strecken und nicht aufzugeben, um jede weitere Lebenswoche<br />
oder jeden Lebensmonat zu kämpfen. Man kann fragen, ob das<br />
Sinn hat, wenn doch der Kampf aussichtslos ist und das Durchhalten<br />
in der Krankheit mit Leiden und Erniedrigung verbunden<br />
ist. Auf diese Frage gibt die Autorin keine eindeutige, weil persönliche<br />
Antwort. Es geht hier nicht um die einfache Verlängerung<br />
des Lebens um weitere Tage, sondern darum anzustreben,<br />
dass das Leben in einer möglichst vollen und sinnvollen Form<br />
abschliesst). Nach einem Abschluss verlangt auch die Geschichte<br />
der Liebe, die erst dann erfüllt ist, wenn sie die höchste Prüfung<br />
besteht, wenn sie extreme Aufopferung verlangt.<br />
Und noch eins. Henryk Dasko war polnischer Jude, der nach<br />
der antisemitischen Kampagne vom März 1968 aus Polen verbannt<br />
wurde. Diese Verbannung empfand er — neben der tödlichen<br />
Krankheit als die größte Tragödie seines Lebens. An allen<br />
Stationen seines Leidens können wir beobachten, wie unerhört<br />
nah ihm die polnische Literatur und Kultur war. Das Buch ist also<br />
ein nicht aufdringlicher, aber außerordentlich starker Akt der<br />
Anklage gegen diejenigen, die den letzten großen Exodus der<br />
Juden aus Polen verursacht haben.<br />
Jerzy Jarzębski<br />
Agata Tuszyńska (geb. 1957), Dichterin,<br />
Prosaikerin, Reporterin, Literatur- und Theaterhistorikerin.<br />
Ins Französische und Englische<br />
übersetzt.<br />
Agata Tuszyńska Vorübungen zum Verlust<br />
35<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Agata Tuszyńska Vorübungen zum Verlust<br />
36<br />
Die<br />
Welt der Krankheit, das Imperium der<br />
Krankheit. So sollte ich sie beschreiben. Ein<br />
Planet. Die Krankheit als unbekanntes Land.<br />
Ein Ort zwischendurch. Immer sind wir gesund geworden.<br />
Schwer krank, gestorben waren immer nur andere.<br />
Ich wiederhole. Wir waren gesund und wir konnten und<br />
wollten uns nie den Luxus erlauben, krank zu sein. Jetzt<br />
ist die Krankheit ein Urteil. Ein Aussetzen des vorherigen<br />
Lebens, vielleicht des Lebens überhaupt. Die Krankheit ist<br />
Verlust, Leid. Sie widerspricht UNS, der Willenskraft, der<br />
Kraft zu lieben.<br />
Gleichzeitig gehören wir der Welt der Gesunden und Kranken<br />
an, schrieb Susan Sontag. In unsere irdischen Reisepässe<br />
sind beide Visa eingestempelt. Den einen hat man das Privileg<br />
verliehen, den Planeten der Gesunden zu bewohnen. Für<br />
sie ist das natürlich. So war es mit uns. Von Zeit zu Zeit besuchten<br />
wir das Land der Krankheit, aber selten, notgedrungen<br />
und eilig – um so schnell wie möglich wieder heraus zu<br />
kommen. Jede Heimsuchung durch Krankheit, und sei sie<br />
auch kurz und mit Perspektive auf Heilung, erschien uns als<br />
Demütigung. Die Körper versagten ihren Dienst. Uns quälten<br />
Fieber, Husten, Ausschlag und gebrochene Gliedmaßen.<br />
Wir wollten fliehen. Fliehen zurück zu uns, ins Vaterland der<br />
Gesunden, wo alles möglich ist.<br />
Wir blieben nie für länger im Land der Krankheit, wir<br />
mussten es nicht. Wir wurden dorthin nicht deportiert, vertrieben.<br />
Solch eine Eventualität hatten wir nie in Betracht<br />
gezogen – die Zwangsemigration in die Welt der Kranken.<br />
Das Leben überwuchert vom Gewebe der Krankheit. Ihre<br />
Attacke zerstört alles. Explosion. Dynamit. Kein Platz für<br />
Umwege. Es zerstörte unser unerfülltes Schicksal von Innen.<br />
Und alles was wir hatten, haben, wurde endgültig. Mehr wird<br />
es nicht, und es wird nicht wie es war. Reisen, Kleidung,<br />
Versprechen wiederholen sich nicht in der Form, wie vor<br />
der Diagnose. Der Song von Cohen „I am your Man“, die<br />
Krawatte von Armani, die Porsche-Ledersitze, das Buch von<br />
Konwicki, Rollschuhe am See, gelbe Tulpen, berauschende<br />
Lilien zur Begrüßung, alles andere, anders. Nicht mehr dieser<br />
Geschmack. Der Beigeschmack von Asche.<br />
Das Krankenhaus ist nun zum Lebensmittelpunkt geworden,<br />
nicht wie bisher der Ort schneller, heimlicher Besuche<br />
anderer.<br />
Krankheiten gehen vorbei, so lehrte die Erfahrung. Hier<br />
ist es anders. Noch immer kann (und will) ich die Diagnose<br />
nicht akzeptieren, mich zu diesem Unterschied bekennen.<br />
Wir widersprechen der Krankheit. Wir glauben, sie wäre<br />
heilbar. Willenskraft soll uns Lebenskraft geben.<br />
Die durchschnittliche Größe unseres Gehirns sind 1400<br />
Kubikzentimeter (eineinhalb Liter Milch, genauso viel<br />
Whiskey oder Sauerkrautsuppe?). Das Gehirn eines Mannes<br />
wiegt von 1250 bis 1750 Gramm. Das macht aus dem<br />
raffiniertesten Organ eineinhalb Kilogramm Kartoffeln oder<br />
genau so viel Schweinenacken? Angeblich hatte der Autor<br />
von Rudnin, Iwan Turgenjew das schwerste Gehirn – über<br />
zwei Kilogramm.<br />
Die stark gefaltete Obefläche des Gehirns ermöglicht es,<br />
im Schädel die größte Anzahl von Nervenzellen zu „verpacken“.<br />
Ihre wichtigste Schicht ist die Rinde (Cortex) mit einer<br />
Dicke von nur 2-3 Millimetern, die Hauptzone für Informationsverarbeitung,<br />
besonders der Prozesse, die mit bewusster<br />
Repräsentation verbunden sind. Die Rinde hat eine große<br />
Oberfläche (wie ein riesiges Feld), und damit sie im Schädel<br />
Platz findet, muss sie gepresst werden, daher die Faltung und<br />
die Furchen. Das was in uns am wichtigsten ist, sieht aus<br />
wie ein zerknülltes Stück Papier. Es ist einmalig, sowie die<br />
Papillarlinien in der Hand.<br />
In die Operation gingen wir blind. Wir wollten nicht zu<br />
viel wissen.<br />
Der vordere Teil des Gehirns, also der Stirnlappen nimmt<br />
etwa 40% von der Gesamtheit ein, er ist für die Eigenschaften<br />
zuständig, die uns als Menschen charakterisieren. Hier<br />
also ist der Sitz der Ambitionen von H. und seiner inneren<br />
Kraft, sein Zauber und seine Überzeugungskraft.<br />
Hier wird das Wissen gespeichert – in Gestalt von Begriffen<br />
in Verbindung mit der Sprache. Das alles soll unangetastet<br />
bleiben. So wie alle Arten des Gedächtnisses – das episodische,<br />
semantische, prozedurale und deklarative Gedächtnis.<br />
Die Panik nahm mir die Erinnerung. Über Wochen funktionierte<br />
ich wie betäubt. Wie eine Marionette aus Papier,<br />
bewegt von der Notwendigkeit, dem Kranken zu dienen.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ich führte konkrete Tätigkeiten aus, Aufgaben, Bewegungen,<br />
Gespräche, ich handelte, holte, zog ihn um, kaufte<br />
ein, wusch, fütterte. Als die Zeit kam, sprach ich mit dem<br />
Rabbiner über die Bestattung, und vorher mit Onkel Janek<br />
und Martin über Geld und die Trauerfeier. Ob er verbrannt<br />
werden möchte? Juden werden nicht kremiert. Ob ich das<br />
wüsste? Nein, ich wusste es nicht. Ich wusste, dass er einige<br />
Fotografien im Sarg haben wollte. Ein Sarg, wenn ein Sarg,<br />
dann wird es keine Asche geben. Welche Fotos – und wer<br />
macht die Abzüge? Auf den Friedhof, auf dem Esters Eltern<br />
bestattet sind. Ich weiss nicht, wo sie bestattet sind. Fragen.<br />
Im Norden der Stadt. Mit anderen Juden.<br />
Aufschreiben. Aufschreiben, um es nicht zu verlieren. Das<br />
riet Miłosz. Warum nicht verlieren? Vielleicht sollte man vergessen,<br />
vielleicht wäre es besser so? Vielleicht rettet mich das<br />
Vergessen? H. will nicht zu diesem Zustand zurück, er will<br />
nicht wieder die Krankheit durchleben. Er tut alles, um die<br />
Hoffnung zu stärken. Er ist sich sicher. Dass das Schlimmste<br />
schon hinter uns liegt, das nichts endgültiges uns erwartet.<br />
Er spottet über die Diagnosen und Statistiken. Zwei Jahre?<br />
Warum nennen sie nur die schlechtesten Prognosen? Was<br />
für eine außerordentliche Kraft muss man haben, um an<br />
die Überwindung des unüberwindbaren zu glauben? Woher<br />
nimmt H. sie? Von mir jetzt sicher nicht mehr. Aus mir kann<br />
man nur Angst schöpfen.<br />
Aus dem Polnischen von Bernd Karwen<br />
Wydawnictwo Literackie<br />
Cracow 2007<br />
145 × 207 • 240 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-08-04099-7<br />
Translation rights:<br />
Wydawnictwo Literackie<br />
(except English rights)<br />
English rights: Agata Tuszyńska<br />
Contact:<br />
Wydawnictwo Literackie<br />
Agata Tuszyńska Vorübungen zum Verlust<br />
37<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Joanna Rudniańska Brygidas Kätzchen<br />
38<br />
Photo: Elżbieta Lempp<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Warschau im Sommer 1939. Die 6-jährige Helena, ihre Eltern,<br />
Brauereibesitzer, und ein recht leichtsinniges Kindermädchen<br />
führen ein glückliches Leben. Das einzige Problem des Mädchens<br />
ist das Fehlen von Geschwistern, sie freut sich also, als sie<br />
eines Tages ein herrenloses Kätzchen findet. Obwohl ihre neue<br />
Spielgefährtin klug ist und sprechen kann, kommt sie zu einem<br />
anderen Mädchen, Brygida, der Schwester eines Brauereimitarbeiters.<br />
Helenas Vater hat auch deutsche Geschäftspartner,<br />
gleichzeitig unterhält er gute nachbarschaftliche Beziehungen<br />
zu allen, auch zu Juden. So mancher von ihnen arbeitet in seiner<br />
kleinen Fabrik. Der Kriegsausbruch und die antisemitische<br />
Hetze sind nicht imstande, den alten Freundschaften Abbruch<br />
zu tun. Als Freunde der Familie ins Ghetto gesperrt werden, organisieren<br />
Helenas Eltern Hilfe. Die Aktion dauert den ganzen<br />
Krieg und gilt nicht nur Menschen,<br />
die sie kennen.<br />
Helenchen wächst heran und hört<br />
allmählich auf, sich über alles zu<br />
wundern. Mit dem Vater besucht sie<br />
das Ghetto, kommt mit dem Tod und<br />
Todesgefahren unmittelbar in Berührung,<br />
intuitiv spürt sie die Intensität einer Gefahr und lehnt<br />
Erscheinungen eines polnischen Antisemitismus angewidert ab.<br />
Sie berichtet über die Tragödie auf ihre eigene, kindliche Weise:<br />
naiv, aber getreu, ohne ein drastisches Detail auszulassen. In<br />
ihre Erzählung wird jedoch ein magisches Element eingeflochten,<br />
die Katze, die Brygida aus dem Ghetto führt. Die ganze Geschichte<br />
findet ihren Nachkriegsepilog, in dem die Schicksale<br />
der Figuren weitererzählt werden, unter anderem eine Begegnung<br />
Helenas und Brygidas in fortgeschrittenem Alter und der<br />
Tod der Hauptfigur.<br />
Joanna Rudniańska bedient sich einer recht selten verwandten<br />
Technik, indem sie Krieg und Holocaust aus der Perspektive eines<br />
Kindes erzählt, das die Massenvernichtung nicht unmittelbar<br />
betrifft, zu deren Augenzeugen es aber wird. Die kindliche Perspektive<br />
dient vor allem dazu, dieses Heldentum alltäglich zu<br />
machen, es als Reflex natürlicher Menschlichkeit und Treue gegen<br />
sich selbst zu zeigen. Dass sich die Botschaft des Romans an<br />
erwachsene Leser richtet, beweist auch das dramatische Ende<br />
der erzählten Geschichte.<br />
Brygidas Kätzchen ist ein Appell, weder die Tragödie zu vergessen<br />
noch diejenigen, die ihr nicht gleichgültig zusahen.<br />
Marta Mizuro<br />
Joanna Rudniańska (geb. 1948), von der<br />
Ausbildung her Mathematikerin. Sie begann mit<br />
Science-fiction-Erzählungen für Kinder und erhielt<br />
den Internationalen Janusz-Korczak-Preis.<br />
Joanna Rudniańska Brygidas Kätzchen<br />
39<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Joanna Rudniańska Brygidas Kätzchen<br />
40<br />
Helena<br />
wachte mitten in der Nacht<br />
auf. Sie bekam keine Luft,<br />
und ihr war schlecht. Sie hörte<br />
ein fürchterliches Tröten. Dann erinnerte sie sich, dass sie im<br />
Bunker war. Und das Tröten war das Schnarchen von Oma<br />
Istman, die sich nie hinlegte, sondern die Nächte in dem alten<br />
Sessel, der in einer Kellerecke stand, verbrachte. Es war absolut<br />
finster. Helena streckte die Hand aus. Neben ihr hätte auf<br />
dem Strohsack Stańcia liegen müssen. Aber Stańcia war weg.<br />
Helena krabbelte auf allen vieren über Stańcias Strohsack<br />
und gelangte, ohne aufzustehen, zur Tür. Im Dunkeln kam<br />
man wie ein Hund oder eine Katze besser voran, auf Händen<br />
und Füßen, fast wie auf vier Pfoten. Man kann nicht stolpern<br />
und hinfallen, und mit dem Kopf spürt man die Hindernisse<br />
besser. Helena stand erst bei der Tür auf. Langsam drückte sie<br />
die Klinke herunter und verließ den Bunker. Erst dann hörte<br />
sie die Flugzeuge. Das dumpfe Röhren kam näher, entfernte<br />
sich wieder. Hier war es auch dunkel. Helena ließ sich wieder<br />
auf ihre vier Pfoten fallen und kletterte nach oben, zu dem<br />
kleinen Flur, von dem aus man auf den Hof hinauskam. Sie<br />
schloss die Tür fest und trat ins Freie.<br />
Der Morgen musste bald grauen, denn der Himmel war<br />
viel heller als die Finsternis unten. Kein einziges Licht brannte.<br />
Der Mond, der sich hinter die Wolken schob, tauchte<br />
alles in einen fahlen Glanz. Helenas Haus und das Mietshaus<br />
nebenan waren schwarze Felsen. Helena ging zu ihrem<br />
Maulbeerbaum. Auf ihn konnte sie mit geschlossenen Augen<br />
klettern. Und das tat sie auch.. Sie öffnete die Augen erst, als<br />
sie weit oben war. Sie hörte Flugzeuge. Sie flogen von der<br />
Weichselseite heran, vier große, schwere Vögel. Sie warfen<br />
Bomben. Vor den vom Mond durchstrahlten Wolken konnte<br />
man deutlich kleine Päckchen aus den Flugzeugbäuchen<br />
fallen sehen. Helena bekam Angst, dass so ein Päckchen auf<br />
sie oder ihr Haus fallen könnte. Trotzdem sah sie hin. Und<br />
die Flugzeuge kamen immer näher. Irgendwo weit weg, vielleicht<br />
sogar in der Altstadt, war roter Feuerschein zu sehen.<br />
Das waren Brandbomben, hoffentlich fallen sie nur nicht auf<br />
mein Haus, dachte Helena.<br />
„Geht weg! Geht weg!“, schrie sie laut.<br />
Aber vier Flugzeuge kamen langsam genau hierher, zu Helenas<br />
Hof, immer größer und fürchterlicher. Helena sah von<br />
oben auf ihr Haus. Es schien ihr so klein neben dem hohen<br />
Mietshaus. Und plötzlich sah sie jemanden auf dem Dach.<br />
Und die Flugzeuge waren schon ganz nah. Dann lief die Gestalt<br />
auf dem Dach zwei Schritte. Es war Stańcia, Helena<br />
erkannte sie. Stańcia hatte einen Besen in der Hand. Auf das<br />
Dach fiel eine Bombe. Stańcia holte aus und fegte die Bombe<br />
mit einem Ruck vom Dach. Dann fiel eine zweite, und<br />
Stańcia fegte sie wieder runter, auf den Hof. Noch eine Bombe<br />
fiel auf das schräge Dach des Mietshauses und kullerte direkt<br />
auf das Dach von Helenas Haus. Die fegte Stańcia auch<br />
runter. Drei Bomben lagen rotglühend im Hof. Die Flugzeuge<br />
flogen weg. Auf dem Hof erschien Stańcia, schaufelte<br />
Sand aus der Truhe, die bei der Brauerei stand, und bedeckte<br />
die Bomben damit. Sie blickte in den Himmel und ging ins<br />
Haus. Helena kam vom Baum runter. Der Hof war leer. Es<br />
war schon fast völlig hell. Helena sah Vater und Herrn Kamil.<br />
Sie standen auf dem Fabrikdach. Herr Kamil rauchte<br />
eine Zigarette. Sie sprachen, stützten sich auf die Stöcke, die<br />
sie in den Händen hielten. Helena lief ins Haus. Ganz leise<br />
ging sie in den ersten Stock, in ihr Zimmer, in ihr Bett. Das<br />
war sehr angenehm – den Kopf an sein Kissen schmiegen<br />
und sich in die eigene Decke kuscheln. Mama hatte Recht,<br />
dass sie nachts nicht in den Bunker ging. Ich würde das auch<br />
gern tun, dachte Helena. Sie schlief sofort ein.<br />
Es war morgen. Helena betrat genau in dem Augenblick<br />
die Küche, als Stańcia die Milch warm machte. Stańcia<br />
schaute angespannt in den Topf, die Milch konnte jeden Augenblick<br />
überkochen.<br />
„Du warst heute nacht auf dem Dach. Ich habe dich gesehen.<br />
Beim nächsten Mal komme ich mit aufs Dach und<br />
werde Bomben wegfegen“, sagte Helena.<br />
Stańcia drehte sich zu Helena um. Und genau da kochte<br />
die Milch über. Zischend lief sie über die heißen Herdringe,<br />
und die Küche durchdrang ein unangenehmer Gestank.<br />
„Jessesmaria!“, schrie Stańcia und schob den Topf zur Seite.<br />
„Das hast du geträumt. Ich auf dem Dach? Was du dir so<br />
ausdenkst.“<br />
Wie war das also, dachte Helena. Habe ich das geträumt<br />
oder nicht? Wie war es wirklich? [...]<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ein paar Tage später kam Róża, Mamas beste Freundin.<br />
Helena mochte sie sehr. Sie sprach sie mit dem Vornamen<br />
an, weil Róża das so wollte. Róża und Mama waren die<br />
schönsten auf der ganzen Welt. Róża hatte schwarzes Haar,<br />
und Mama goldenes, und zusammen sahen sie aus wie zwei<br />
Märchenprinzessinnen. An diesem Tag schien Róża anders<br />
zu sein als sonst. Sie gab Helena nicht einmal einen Begrüßungskuss.<br />
Sie setzte sich in die Küche und holte Zigaretten<br />
aus der Handtasche.<br />
„Frau Róża! Sie haben doch nie geraucht! Ich habe Dzidzia<br />
immer gesagt, dass sie sich an Ihnen ein Beispiel nehmen<br />
soll!“, rief Stańcia aus.<br />
„Was ist passiert? Warum rauchst du?“, fragte Mama und<br />
nahm sich auch eine Zigarette aus Różas Schachtel.<br />
„Und du, warum rauchst du?“, fragte Róża trübsinnig und<br />
zündete die Zigarette an.<br />
„Seit wann rauchst du?“, fragte Mama weiter.<br />
„Seit letzten Sonnabend. Seit unser Haus niederbrannte.“<br />
„Mein Gott! Wie konnte ich das nicht wissen! Dein Haus?<br />
In der Wilcza?“<br />
„Ich habe immer geschlafen, wenn Luftangriff war“, sagte<br />
Róża. „Ich steckte den Kopf unter die Decke und dachte, es<br />
wäre am besten, wenn ich einschlafe und nach dem Luftangriff<br />
aufwache. Dann würde nichts passieren. Um nichts in<br />
der der Welt wollte ich in den Bunker runter, obwohl Vater<br />
mich deswegen furchtbar anbrüllte.“<br />
„Oh, Gott! Ihr wohnt doch im letzten Stock, direkt unterm<br />
Dach!“<br />
„Wir wohnen nicht mehr. Ich hatte sehr fest geschlafen,<br />
aber sie hatten mich geweckt. Sie zerrten an mir und schrieen,<br />
dass es brannte. Ich warf einen Mantel übers Nachthemd<br />
und lief runter. Stand auf der Straße und sah zu, wie die<br />
Gardine in meinem Zimmer Feuer fing. Weißt du, die rosa<br />
Gardine. Ich weinte. Ein Mann stand neben mir. Beruhigen<br />
Sie sich, sagte er. Ich habe noch eine Zigarette, zünden Sie<br />
sie sich an. Und ich zündete sie an. Die erste in meinem<br />
Leben, obwohl Mama nicht weit weg stand. Schließlich bin<br />
ich erwachsen, dachte ich.“<br />
„Schön erwachsen“, brummte Stańcia.<br />
Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier<br />
Wydawnictwo Pierwsze<br />
Lasek 2007<br />
130 × 180 • 160 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 83-923288-8-9<br />
Translation rights:<br />
Syndykat Autorów<br />
Joanna Rudniańska Brygidas Kätzchen<br />
41<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Mariusz Sieniewicz Die Rebellion<br />
42<br />
Photo: Grzegorz Czykwin<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Mariusz Sieniewicz hat sich bereits zu erkennen gegeben als ein<br />
Schriftsteller mit einer originellen und ungezügelten Phantasie,<br />
möglicherweise ist er neben Jacek Dukaj der einzige Prosaist<br />
der jüngeren Generation, der imstande ist, in seinen Texten<br />
vollkommen neue Welten zu erschaffen. Im neuesten Roman,<br />
Die Rebellion, hat sich Sieniewicz jedoch selbst übertroffen.<br />
Das Buch ist eine Dystopie, in der in überzeichneter Form die<br />
Ängste und Probleme der Moderne gezeigt werden. Sieniewicz<br />
beschreibt „die Zivilisation des Großen Knirpses“, in der<br />
der Terror der Jugend, Schönheit und Gesundheit herrscht und<br />
das Alter verfolgt und ausgeschlossen wird. Die Handlung des<br />
Romans spielt vor allem auf der imaginären „Insel der Alten“,<br />
wo die Alten unter der Aufsicht von metrosexuellen „Mädgen-<br />
Jungels“ (die Insel funktioniert ein bisschen wie ein Arbeitslager)<br />
die Leichen junger, schöner Menschen einbalsamieren, die<br />
im Mausoleum zur Ehre der Jugend<br />
ausgestellt werden sollen. Aber die<br />
Herrschaft der sich als Gebieter<br />
aufspielenden Jugend ist nicht gottgegeben,<br />
die verzweifelten Alten bereiten<br />
eine „geriatrische Revolution“ vor, an deren Spitze Błażej<br />
Kolumbus steht, der etwas von den Erlösern des Alters, etwas<br />
von Neo aus dem Film Matrix (Sieniewicz mischt im Roman<br />
Bezüge zu „Texten“ verschiedenster kultureller Register) hat…<br />
Sieniewicz hat sich bereits mehrfach mit dem Problem des Ausschlusses<br />
und der Marginalisierung von Menschen und ganzen<br />
Gesellschaftsgruppen beschäftigt, auch häufiger schon hat er mit<br />
seinen Texten bewiesen, dass man über diese Dinge in einer<br />
Sprache schreiben kann, die mit dem Stil von Propaganda wenig<br />
gemein hat. Sieniewicz schreibt nicht nur über die Rebellion der<br />
Alten, die Rebellion findet auch in der Sprache seines Romans<br />
statt, in dem verschiedene Sprachvarianten aufeinanderprallen,<br />
Klischees der Gegenwartssprache wechseln sich mit einer poetischen,<br />
symbolgeladenen Metaphorik ab. Fast jeder Satz von<br />
Die Rebellion wird für den Leser zu einem sprachlichen Abenteuer.<br />
Würde Witkiewicz heute leben, er würde sicherlich wie<br />
Sieniewicz schreiben!<br />
Robert Ostaszewski<br />
Mariusz Sieniewicz (geb. 1972),<br />
Prosaschriftsteller, Feuilletonist, wurde ins<br />
Deutsche, Litauische, Russische, Kroatische<br />
und Slowenische übersetzt.<br />
Mariusz Sieniewicz Die Rebellion<br />
43<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Mariusz Sieniewicz Die Rebellion<br />
44<br />
Das<br />
gigantische Bauwerk erinnerte an ein Gotteshaus<br />
der Neorenaissance, das man in einen<br />
kosmischen Meteoriten gehauen hatte.<br />
Das dem galaktischen Erz innewohnende Sakrale war hier<br />
sicherlich am besten aufgehoben. Risse gleich länglichen<br />
Glasfenstern zersprengten die Steinmauer, während die mit<br />
Ornamenten verzierte Kuppel – die an manchen Stellen von<br />
Moos überwachsen und von jedem Winkel der Insel zu sehen<br />
war – wie der Panzer einer futuristischen Schildkröte<br />
aussah. Vom oberen Teil der Fassade schielte das gigantische<br />
Auge eines Mandalas. Darunter eine anonyme Inschrift:<br />
jugend währt ewig, ist ein ewiger jungbrunnen –<br />
niemand vergisst sie, und jeder bleibt ihr treu.<br />
Zum gusseisernen Eingangstor führte ein über drei Steinstufen<br />
gelegtes Brett, vor dem die Spur der Lastwagen abbrach.<br />
Kaktus sah nach links und rechts und flüsterte,<br />
nachdem er die hoch angebrachte Klinke über seinem Kopf<br />
gedrückt hatte:<br />
„Hilf mir, Błażej, verdammt noch mal! Du solltest größer<br />
sein als ich, da du auf einer höheren Stufe stehst.“<br />
„Mann, du hast aber einen Leiterkomplex“, gab Kolumbus<br />
zurück.<br />
Sie schoben das Tor auf. Es knarrte fürchterlich. Brrr… der<br />
reinste Horror! Eisige Kälte umfing sie – frostiger als in einem<br />
Kühlhaus. Es fehlte nur noch, dass vom fäuligen Friedhof<br />
her ein Wolf heulte und der Schatten einer Hand mit<br />
einem Messer über die Mauern huschte. Kolumbus bereute<br />
seine Neugier. Er hörte Orgelmusik. Jemand war am Spielen,<br />
jedoch die Reinheit und der Fluss der Musik ließen sehr zu<br />
wünschen übrig. Die Töne brachen ab, klangen falsch, waren<br />
flach und unregelmäßig. Passender wäre die Feststellung<br />
gewesen, dass jemand erst dabei war, sich die Geheimnisse<br />
der Noten, Oktaven und Violinschlüssel anzueignen, ohne<br />
jedoch den richtigen Schlüssel zu dieser unzugänglichsten<br />
aller Künste zu finden.<br />
„Ganz ruhig. Der Große Knirps müht sich am Keyboard<br />
mit Bach ab. Matthäuspassion“, antwortete Kaktus sofort,<br />
als sie das Innere des Gotteshauses betraten, das in fluoreszierendes<br />
Licht getaucht war. „Hab keine Angst. Außer seinem<br />
Spiel hört und sieht er nichts. Manchmal glaube ich, dass er<br />
taub und blind ist. Der faschistische Narziss!“<br />
Aber Kolumbus’ Miene war bereits der Beweis für die unter<br />
Philosophen beliebte These, dass allein die Fähigkeit, sich zu<br />
wundern, den denkenden vom gedankenlosen Geist unterscheidet.<br />
Er stand mit offenem Mund da, wie ein Geschöpf,<br />
das sich seiner Erbärmlichkeit bewusst ist, vor dem „etwas“<br />
auftaucht, was menschliches Maß und Verstehen übersteigt...<br />
Sich die verschiedensten Wachsfigurenkabinette der<br />
Welt zugleich vorzustellen, hieße, sich nichts vorzustellen.<br />
Gedanklich alle nur möglichen Magazine und Garderoben<br />
auf der Erdkugel mit ihren unzähligen Puppen, Marionetten<br />
und Mannequins zu erfassen, hieße, nur den Schatten des eigenen<br />
Gedankens zu erfassen. Mit enormer Willensanstrengung<br />
sämtliche Geheimlabors, in denen mithilfe chemischer<br />
Formeln der fortgeschrittenen Wissenschaft die Zucht des<br />
modernen Homunkulus betrieben wird, an einem Ort zu<br />
versammeln, hieße, den Willen eines Hohltiers zu haben.<br />
Denn auf Sockeln und Podesten, Untersätzen und Postamenten<br />
standen hier mumifizierte Körper, die man auf Stangen<br />
aufgespießt hatte. Nicht enden wollende Legionen von<br />
Körpern! Von nackten und jungen Körpern. Körpern, die<br />
man zu Paaren verbunden hatte oder die in ihrer Einsamkeit<br />
über die Monaden grübelten.<br />
„Wir haben das Beste aus der Geschichte des vergangenen<br />
Hundertgartens und aus der heutigen Zeit gesammelt“, teilte<br />
Kaktus mit, wobei eine kleine dichte Dampfwolke aus seinem<br />
Mund entwich. „Natürlich ist es das Beste gemäß dem<br />
Großen Knirps und den Jungels. Wenn ich etwas zu sagen<br />
hätte, würde ich ganz andere verewigen“, schränkte er ein.<br />
„Wenn du willst, schau dich um. Obwohl das Museum noch<br />
nicht fertig ist und erst für die zukünftigen Generationen<br />
vorbereitet wird.“<br />
Kolumbus war etwas eingeschüchtert, wie sollte man hier<br />
auch nicht eingeschüchtert sein, wenn die angeblich berühmtesten<br />
Exponate der Vergangenheit, die schließlich, wäre<br />
nicht Kolumbus’ Gedächtnisschwund gewesen, ein Dokument<br />
seiner Vergangenheit sein könnten, von ihren Sockeln<br />
auf einen heruntersahen. Mut machte ihm Juanita Loslobos.<br />
Sie stand, als hätte jemand die Tänzerin während eines Walzers<br />
verzaubert. Worobiow hat das gut wiedergegeben, ur-<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
teilte er und ging weiter. Diese ersten menschlichen Götter,<br />
von der Tür aus gezählt, schienen ihm recht gewöhnlich und<br />
durchschnittlich zu sein, selbst auf den Kärtchen stand nicht<br />
viel. Irgendein „Max Coldwey. DJ. US“ mit einem Plattenspieler<br />
in der Hand, ein „Otto Schmidt. Designer. D“ mit<br />
erhobenem Haupt oder ein „James Peadlow. Snowboarder.<br />
GB“, der ein gekrümmtes Stück Brett unter dem Arm hatte.<br />
Je weiter er aber in die mumifizierte Welt der Körper, Köpfe<br />
und Hände eintauchte, die in den raffiniertesten Posen<br />
erstarrt war, desto größer wurde seine Neugier und Begeisterung,<br />
und das Pantheon der Unsterblichen schien kein Ende<br />
zu haben. Zunächst blickte er verstohlen auf das Kärtchen,<br />
um zu wissen, mit wem er die Ehre hatte, dann bewunderte<br />
er die fachmännische Arbeit der Juvenilarbeiter. Bei allen<br />
Mumien fielen die meisterhaft vollendete Haut, das atemberaubende<br />
Spiel der Muskeln sowie das ideale Verhältnis<br />
von Gliedern und Oberkörper ins Auge. Körper ohne Makel<br />
und Falten lockten mit ihrer polierten Glätte. Die Perfektion<br />
rühmte sich ihrer selbst – von Fuß bis Kopf, von einem Gott<br />
zum nächsten. Die Betagtesten waren nicht älter als dreißig<br />
Gärten. Der vergangene, obwohl noch nicht abgeschlossene<br />
Hundertgarten musste eine fürchterlich jugendliche Zeit gewesen<br />
sein.<br />
Oh, wer war denn der Junge mit dem apollinischen,<br />
schokoladenbraunen Körper und den schalkhaften Fransen<br />
anstelle von Haaren? Das Täfelchen lieferte sogleich die<br />
Antwort: „Bob Marley. Musiker“. In der Hand hielt er eine<br />
Gitarre, die Kolumbus an die Worte eines alten Liedes erinnerten:<br />
ein Junge mit ‘ner Gitarr, wäre für mich ein Paar, ein<br />
Pararar-rara-ra... Nach ihm eine Mumie mit großen Rehaugen<br />
– „Kurt Cobain. Musiker.“ Und die Blondine, die Gold<br />
und Rouge aufgelegt hatte, das war sicherlich Miss Mausoleum<br />
– „Barbara Handler. Barbie.“ Daneben, die schlanken<br />
Hände ihr entgegengestreckt: „Ken Handler. Ken“. Ein<br />
merkwürdiger Beruf, „Barbie“ oder „Ken“ zu sein.<br />
Aus dem Polnischen von Andreas Volk<br />
W.A.B.<br />
Warsaw 2007<br />
123 × 195 • 376 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 978-83-7414-332-5<br />
Translation rights: W.A.B.<br />
Mariusz Sieniewicz Die Rebellion<br />
45<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Hubert Klimko-Dobrzaniecki Wiegenlied für einen Galgenvogel<br />
46<br />
Photo: Gunnar<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Wiegenlied für einen Galgenvogel ist eine kurze Erzählung über<br />
Freundschaft und Wahnsinn. Die Fabel dieses kleinen, stimmungsvollen<br />
Werks ist deutlich autobiografisch gefärbt. Klimko-<br />
Dobrzaniecki lebte bis zum Juni 2007 zehn Jahre lang in Reykjavík,<br />
wo er zunächst ein Studium der isländischen Philologie<br />
begann und später in verschiedenen Berufen arbeitete, am längsten<br />
als Pfleger in einem Heim für Alte und geistig Behinderte.<br />
Einen Teil dieser Erfahrungen verarbeitete er in einer der Erzählungen,<br />
aus denen sein im vorigen Jahr erschienenes Diptychon<br />
Rosas Haus. Krýsuvík besteht.<br />
Die Ereignisse, von denen im Wiegenlied für einen Galgenvogel<br />
die Rede ist, sind eine eigentümliche Ergänzung der früheren Erzählung<br />
und erweitern das Feld der Personen und Dinge. Hier<br />
erscheinen Gestalten, die wir aus Krýsuvík kennen (der autobiografische<br />
Erzähler und Held, seine Frau Agnieszka, der exzentrische<br />
Kroate Boro), sowie die wichtigste Figur, der Musiker Szymon.<br />
Das Wiegenlied ist eine Hommage an einen Freund, der in<br />
jungem Alter Hand an sich gelegt hat.<br />
Die Erzählung ist ein Versuch, seine<br />
außergewöhnliche Persönlichkeit,<br />
von der Kunst und Wahnsinn gleichermaßen<br />
Besitz ergriffen hatten, zu fassen und zu erklären.<br />
Die Fragen nach den Gründen für den Selbstmord des Freundes<br />
werden hier nur mit größter Zurückhaltung gestellt. Der Erzähler<br />
vermeidet es, den scheinbar offensichtlichen Zusammenhang<br />
zwischen der Krankheit und der Verzweiflungstat herauszustellen.<br />
In der Welt dieser im Grunde realistischen und in der<br />
Wirklichkeit stark verwurzelten Erzählung ist die Grenze zwischen<br />
der sogenannten Normalität und dem Wahnsinn weniger<br />
verwischt als vielmehr höchst problematisch. Szymon war – wie<br />
alle Personen im Wiegenlied für einen Galgenvogel – ein außergewöhnlicher<br />
und doch zugleich ganz gewöhnlicher Mensch,<br />
jemand, von dem man sagt: „ein guter Kumpel“. Warum er sich<br />
das Leben nahm, muss ein Geheimnis bleiben.<br />
Hubert Klimko-Dobrzaniecki (geb. 1967),<br />
Schriftsteller, Autor von vier Prosabänden.<br />
Hubert Klimko-Dobrzaniecki Wiegenlied für einen Galgenvogel<br />
47<br />
Dariusz Nowacki<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Hubert Klimko-Dobrzaniecki Wiegenlied für einen Galgenvogel<br />
48<br />
Der<br />
Ozean wuchs, schwoll an und füllte den<br />
Meniskus zwischen dem Ende der Halbinsel<br />
und den Ufern der zeitweiligen Insel.<br />
Erst jetzt sehe ich mit aller Klarheit, dass das alles nur<br />
Schein ist, denn jedes Mal fehlt ein Element. Allmählich<br />
wird das Puzzle unvollständig. Unwiederholbarkeit. Sätze,<br />
Wörter, Bilder, Noten, auf Notenlinien geschrieben, die<br />
Art, eine Zigarette zu rauchen, ein Maßkrug mit Lücken<br />
in seinem Rand. Die Unwiederholbarkeit lebt, verwandelt<br />
sich in Erinnerungen, wird von Generation zu Generation<br />
weitergegeben, verzerrt, aufgeblasen oder verkleinert. Mündliche<br />
Überlieferungen, mein persönliches Dilemma mit der<br />
Bibel… Ich beschloss, nicht zweihundert Jahre zu warten.<br />
Vielleicht hat die Sache mit Gott wirklich erst einmal ruhen<br />
müssen. Ich habe das unwiderstehliche Bedürfnis, die<br />
Geschichte einer Freundschaft aufzuschreiben, eines kleinen<br />
Abschnitts des Lebens. Szymon ist weggegangen. Er ist jetzt<br />
nicht in der Stadt. Man kann ihm nicht auf der Straße begegnen.<br />
Das fehlt mir am meisten…<br />
Ein Streifen in den Wolken, zurückgelassen, bis er sich auflöst<br />
oder ein anderes Flugzeug ihn kreuzt. Ein paar Worte,<br />
dahingeworfen im Bus auf der Fahrt ins Zentrum, eine Zugreise.<br />
Kennengelernt haben wir uns weder im Bus noch im<br />
Flugzeug noch im Zug. Ohne Nebengeräusche, das Brummen<br />
des Motors, das Rattern der Räder, ohne Schaukeln<br />
und Turbulenzen. Der uns miteinander bekanntmachte,<br />
hieß Boro und war ein „freigelassener“ Irrer, der weiterhin<br />
in der Abteilung wohnte. Von Zeit zu Zeit drehte er durch.<br />
Vor allem im Sommer, wenn alles grün war. Er hatte einen<br />
ganzen Satz von Tabletten gegen das Grün. Die Ärzte waren<br />
zu dem Schluss gekommen, er sei bereits in Ordnung und<br />
man müsse ihn nicht wegschließen. Er müsse nur Medikamente<br />
nehmen. Einmal schien es mir, als würden in meinem<br />
Auto gleich Blätter aus ihm sprießen, als würde er sich gleich<br />
in Grünzeug verwandeln. Ich sah, wie er schwitzt und dann<br />
nach den Tabletten greift und zu schreien beginnt: Jetzt,<br />
jetzt, jetzt. Er schrie, er verwandele sich in ein Moosfeld und<br />
dann in eine große Rasenfläche. Ich weiß auch nicht, vielleicht<br />
war es die Gesellschaft geistesgestörter Menschen, die<br />
es mir erlaubt hat, normal zu bleiben… Vielleicht hat die<br />
Tatsache, dass ich eine Rasenfläche, ein Moosfeld, eine große<br />
Gurke oder Wassermelone durch die Gegend fuhr, mich davor<br />
bewahrt, Napoleon zu werden oder die Heilige Teresa.<br />
Boro durfte weiterhin im Irrenhaus wohnen, auch wenn<br />
die Ärzte darauf drängten, er solle ausziehen. Essen bekam<br />
er nicht mehr. So fuhr ich immer wieder zu ihm und nahm<br />
ihn mit zu Ikea, wo es in der Stadt die billigsten Hot Dogs<br />
gab. Gemeinsam stopften wir uns mit ihnen voll und tranken<br />
Fanta dazu. Eines Tages sagte er, in der Abteilung sitze<br />
ein Pole, ein Geiger. Er fügte ein paar Fucks hinzu, denn er<br />
fluchte für sein Leben gern auf Englisch, er sagte, erst wenn<br />
er ein paar Kraftausdrücke ausgestoßen habe, spüre er, dass<br />
er lebe, und er tat es am laufenden Band.<br />
Im hiesigen Psychiaterslang galt Szymon als ein Kaninchen<br />
aus dem Hut. Kaninchen sind Patienten, die für einige Zeit<br />
auftauchen und dann verschwinden, wieder auftauchen und<br />
so weiter. Halbwegs geheilt und ab ins Leben. Dann ein Tief<br />
und wieder in die Abteilung. Abteilung und Leben, Leben<br />
und Abteilung. Ein Kaninchen … Ich sagte Boro, er solle<br />
mal mit dem Pfleger reden und dieser mit Szymon und<br />
dem Arzt, vielleicht könnten wir zusammen zu Ikea fahren,<br />
Würstchen essen. Und eines Tages verdeckte diese riesige<br />
Gestalt, diese menschliche Eiche ohne Zähne, Boro, mit seinem<br />
Schatten eine schmächtige Gestalt mit Drahtbrille. Ihr<br />
silbernes Brillengestell warf den Lichtstrahl des Autoscheinwerfers<br />
zurück, und Boro wurde in einer Sekunde zu jener<br />
slawischen Eiche, die vom Blitz getroffen wird und um die<br />
sich die Ansässigen versammeln, um sich magischen Tänzen<br />
hinzugeben. Die Gestalt mit der silbernen Brille schritt um<br />
ihn herum, den Kopf künstlich in die Höhe gereckt, und<br />
schaute ihm in die Augen, diesem Stück Kroatien, diesem<br />
Stück mythischen Waldes, diesem Baum, dieser Eiche, diesem<br />
Verrückten. Plötzlich schaltete der Oberarzt der Psychiatrie<br />
das Auto aus, und die Scheinwerfer verloschen. Szymon<br />
blieb in Boros Schatten stehen und blickte zum roten Volvo<br />
hin. Der Arzt stieg aus dem Auto und fragte. Zu Ikea, ja?<br />
Nur zu Ikea, Würstchen essen, ja. Darauf wackelten sie einmütig<br />
mit den Köpfen und kamen zu mir.<br />
Der Mann, der äußerlich an Korczak, Maximilian Kolbe<br />
und Gandhi erinnerte und hinter einer Brille verborgen war,<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
die bei gutem Wetter ein Kornfeld oder eine große Scheune<br />
hätte in Brand setzen können, stellte sich vor. Ich bin<br />
Szymon Kuran. Freut mich sehr, antwortete ich. Nein, ich<br />
habe die Freude, entgegnete er, und dir scheint es nur so. Ja,<br />
vielleicht hatte er recht, vielleicht freute es ihn tatsächlich<br />
und mir schien es nur so, aufgrund der angelernten Erwiderung.<br />
Das nennt man wohl gute Erziehung. Ein Gemisch<br />
von Verboten und klimatischen Bedingungen. Szymon aß<br />
gerade einen Hot Dog, ich wollte ihn wohl etwas fragen, da<br />
schaltete sich Boro ein. Also was ist mit diesen Steinen, lispelte<br />
er. Ganz normal, erwiderte ich. Du musst wie die Hühner<br />
oder Strauße, die haben auch keine Zähne, und damit<br />
die Verdauungsprozesse richtig ablaufen, schlucken sie kleine<br />
Steinchen, die das Essen wie Zähne zerkleinern. Szymon<br />
hörte mein kurzes Referat zur Gastrologie und war erstaunt<br />
darüber, wie ich den Gedankengang verkürzt und das Thema<br />
so unsinnig und von der Mitte her angefasst hatte, er legte<br />
das Wurstpapier auf den Tisch und begann leise zu lachen,<br />
während Boro und mir ja bewusst war, dass das die Fortsetzung<br />
unseres unvollendet gebliebenen Gesprächs aus dem<br />
vorigen Monat war, über den Kauf eines künstlichen Kiefers<br />
oder eines Sacks mit Steinchen. Als Boro seine Reaktion sah,<br />
beendete er den Satz so wie immer. Auf Englisch und kurz.<br />
Fuck you, sagte er und aß den Hot Dog auf, wobei er sich<br />
das große Ende ostentativ in den Mund stopfte.<br />
Aus dem Polnischen von Gerhard Gnauck<br />
Czarne<br />
Wołowiec 2007<br />
145 × 170 • 96 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 978-83-7536-003-5<br />
Translation rights: Czarne<br />
Rights sold to:<br />
France/Editions Belfond<br />
Hubert Klimko-Dobrzaniecki Wiegenlied für einen Galgenvogel<br />
49<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Michał Witkowski Barbara Radziwiłłówna aus Jaworzno-Szczakowa<br />
50<br />
Photo: Kasia Kobel<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Der neue Roman von Michał Witkowski ist eine weitere „Beichte<br />
eines Kindes des (vergangenen) Jahrhunderts“ in unserer Literatur.<br />
Aber dieses Kind ist wie man vom Autor von Lubiewo<br />
erwarten durfte nicht etwa irgendeines, es ist ein besonderes.<br />
Erzähler des Romans ist Hubert, ein Mann im besten mittleren<br />
Alter, der seine chaotischen Erinnerungen – voll von Rückblenden<br />
und plötzlichen Zeitsprüngen – erzählt. Und zu erinnern hat<br />
er genug! Hubert ist ein kleiner Fisch in der kriminellen Halbwelt<br />
der Bergarbeiterstadt Jaworzno-Szczakowa. Er handelt mit allem<br />
Möglichen, betreibt ein halblegales Kino, in dem er Filme<br />
von Videokassetten abspielt, ist Besitzer eines Leihhauses, geht<br />
der Schuldeneintreiberei und Hehlerei nach.<br />
Aus dem, was ich bisher geschrieben habe, könnte hervorgehen,<br />
daß Witkowski eine Geschichte erzählt, wie es sie in unserer Literatur<br />
bereits viele gegeben hat, von der verrückten Wendezeit,<br />
von dem Ende der VR Polen und den Anfängen der 3. Republik<br />
Polen. Dennoch ist im Grunde die<br />
Figur des Hubert die wichtigste im<br />
Roman. Woher also stammt diese<br />
Barbara Radziwiłłówna im Buchtitel?<br />
Hubert identifiziert sich mit jener<br />
kontroversen früheren Königin<br />
Polens, genau so wird er in seiner kleinen Welt genannt. Der<br />
Erzähler von Witkowskis Roman ist ein Träumer und Phantast,<br />
ein Mensch, der von Widersprüchen hin- und hergerissen wird;<br />
einerseits denkt er nüchtern, ist fest in der Gegenwart verankert,<br />
schaut aber gleichzeitig sehnsüchtig in die Vergangenheit und<br />
versucht, eine Familiengenealogie aufzubauen bzw. zu erfinden,<br />
er spielt sich als rücksichtsloser Mafioso auf, ist dabei jedoch<br />
„weich“, sentimental und zartfühlend, er glaubt ebenso fest an<br />
Gott wie an Weissagungen und Horoskope. Hubert empfindet<br />
sich als anders, was zur Folge hat, dass er unglücklich ist, „gefangen<br />
in seinem Leben wie in einem Gefängnis“. Den Roman<br />
des Autors von Lubiewo muss man vor allem als Geschichte eines<br />
Sonderlings lesen, der verzweifelte Versuche unternimmt,<br />
seine Träume zu verwirklichen, er sucht Liebe (er ist unglücklich<br />
in seinen Angestellten Sascha, einen ukrainischen Muskelprotz,<br />
verliebt), Glück und Akzeptanz.<br />
Robert Ostaszewski<br />
Michał Witkowski (geb. 1975), Prosaschriftsteller,<br />
Feuilletonist, Autor des viel<br />
beachteten, in zahlreiche Sprachen übersetzten<br />
Romans Lubiewo.<br />
Michał Witkowski Barbara Radziwiłłówna aus Jaworzno-Szczakowa<br />
51<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Michał Witkowski Barbara Radziwiłłówna aus Jaworzno-Szczakowa<br />
52<br />
Genau.<br />
Ich seufze. Der Brünette. Brünet-te.<br />
Den örtlichen Laubenpieper<br />
nicht mitgezählt, der<br />
sich im Komitee was zusammengeklaut und an die zwanzig<br />
Gewächshäuser errichtet hatte, war ich der Reichste in ganz<br />
Jaworzno. Er aber hatte einen Gemüseladen. Und Gemüseladen<br />
bedeutete damals nicht: ein Laden mit Gemüse, sondern<br />
mit allem! Mit Kaugummi, mit saurer Mehlsuppe in der Flasche<br />
(bäh!), sogar solche Einmal-Schuhe, aus Papier, konnte<br />
man dort kaufen. So sah also auch sein Gemüse aus. Jeden<br />
Sonntag fuhr er mit seinem Peugeot bei der Kirche vor, im<br />
schwarzen Pelzmantel, mit Pelzmütze aus der UdSSR, total<br />
eingemummt, zum Schreien! Gelobt sei der Herr! Hatte sich<br />
goldene Zähne besorgt, Jogginganzug, oh ja, dem geht es<br />
gut! Ich konnte mich nicht konzentrieren, spielte unter der<br />
Bank nervös mit den Autoschlüsseln. Schlimmer noch: ich<br />
sandte frevlerische Gebete an die Ewige Jungfrau Maria, sie<br />
möge ihm Krebs schicken! Ich bin ein tief gläubiger Mensch,<br />
ich liebe Gott – und besonders die Muttergottes. Also: Krebs<br />
für ihn und meiner Tante Aniela, von der ich mir eine Erbschaft<br />
erhoffe, den Tod. Aber der hatte keine Angst vor Gott!<br />
Hatte seine Finger in diese ganze Mafia getunkt, in die Diskothek<br />
„Kanty“, in die „Retro“-Bar, das Café „Jaworznianka“,<br />
dann, einige Jahre später, tunkte er seine schmutzigen<br />
Finger in diese Night-Clubs, den Stangentanz an der Autobahn.<br />
Praktisch die ganze Kabel-Straße war von ihm aufgekauft<br />
worden, aber sagt selbst, ist das Jagiellonen-Geschlecht<br />
nicht besser als diese kabelnden Laubenpieper?<br />
Ich konnte mir nicht einmal einen Gemüseladen leisten,<br />
aber wozu hab ich denn meinen Kopf? Ich fuhr nach Niewiadów,<br />
Hitze, ich gehe, überreiche Kaffee, um zum Direktor<br />
vorgelassen zu werden. Nur dass der eine Zuteilung von<br />
Lochziegeln wollte, nun fahre ich wieder zum Direktor der<br />
Baumaterialien-Fabrik, parke meinen Kleinen, gehe, überreiche<br />
Kaffee, um zu ihm vorgelassen zu werden. Hitze. Und<br />
der sagt: nix, Scheiße, hab ich nicht. Aber ich hatte Beziehungen<br />
im Bereich Bobo-Kinderoveralls und sage zu ihm, es<br />
ist soundso, ich hab’ Kinderoveralls. Ach herrje! Da wird die<br />
Frau sich aber freuen! Für diese Overalls wiederum musste<br />
ich eine Badewanne schwarz, außerhalb der Zuteilung,<br />
beschaffen. Und so hab ich schließlich meinen Wohnanhänger<br />
N 126 gekauft, den kann der Kleine ziehen. Statt fand<br />
dies bereits Mitte der achtziger Jahre. Als Zdzisława Guca<br />
im „Panorama“ angekündigt hatte, uns stehe lang anhaltend<br />
schlechtes Wetter bevor, und die Gruppe „Lombard“<br />
hatte hinzugefügt, „eisiges Wetter“. Als sie im „Panorama“<br />
die Ankunft des Winters angekündigt hatte, die Ankunft<br />
der Nacht, der schwarzen Nacht der achtziger Jahre. Damals<br />
fingen die Menschen an, sich mit Siphons, Wohnanhängern<br />
und DDR-Plastikwannen zum Baden von Säuglingen einzudecken.<br />
All dies häuften sie an und begannen, sich eine<br />
Arche zu bauen. Um abzuwarten.<br />
Meine Bekannten hatten mich gefragt, was denn, Hubert,<br />
bei diesem lang anhaltend schlechten Wetter hast du vor, mit<br />
dem Wohnanhänger in die Ferien nach Jugoslawien zu fahren?<br />
So schwere Zeiten, und du machst Ferien-Zeit? Ha, ha,<br />
ha! Was für Ferien, wer hat denn was von Ferien gesagt? Ein<br />
Lokal! Lo-kal, sagt euch das was? Ein gastronomisches Lokal<br />
dritter Klasse, eine so genannte kleine Gastronomie, überbackene<br />
Baguettes, Fritten, Hot Dogs bei der Radziwiłłówna<br />
gibt es, wie man weiß, die besten. (Mit gerösteten Zwiebeln<br />
drüber gestreut?) Der oberste Grundsatz im Überbackenes-<br />
Geschäft? Den Leuten altes, verbrauchtes Öl andrehen, im<br />
Toaster aufgefrischte längliche Brötchen, geriebenen Käse,<br />
über den sich nichts Gutes sagen lässt, hier und da platt gedrückte,<br />
mit (mit Wasser verdünntem) Ketchup überzogene<br />
Champignons – all das gegen echtes Geld eintauschen. (Drei<br />
achtzig sind angemessen.) Was die Champignons angeht, so<br />
würde ich auch dafür nicht meinen Kopf hinhalten, aber der<br />
Mensch ist kein Schwein – der isst alles. Und dass das Geld<br />
bis vor kurzem so echt auch wieder nicht war, und was noch<br />
schlimmer ist, jeden Augenblick anfangen konnte, einem<br />
vor den Augen wegzuschmelzen – das war ja noch nicht die<br />
Endstation des Geschäftes. Denn das Geld wiederum musste<br />
man so schnell wie möglich in Goldbarren umtauschen<br />
und in einer sorgsam bewachten Kassette aus echtem Stahl<br />
verschließen. (Welche Sauce darf’s denn sein? Knoblauch-,<br />
pikant, mild, Ketchup, Senf?)<br />
Und sich die Hände reiben!<br />
Erst Stahl und Gold erlaubten zumindest einen Moment<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
lang, einen Wert zu sichern. Einen, der unruhig von Wasser<br />
und Champignons über Geld zu sichereren Erzen läuft.<br />
Denn der Wert, das ist Strom, das ist Wasser: ohne Futter,<br />
ohne Kabel irrt er träge umher, von irgendeiner ureigenen<br />
inneren Unruhe getragen. Und weshalb sollte er nicht in den<br />
sicheren Hafen unserer Kassette einlaufen? (Haben Sie vielleicht<br />
zwanzig Groschen?)Alles in allem ist doch jedes Geschäft<br />
von ähnlicher Natur – Scheiße verkaufen, irgendwas,<br />
wenig dafür bekommen, aber in solchen Mengen, dass man<br />
dieses Wenig, dieses „fast Nichts“ in zumindest ein bisschen<br />
Wert umtauschen kann, einen Barren Gold oder einen Barren<br />
gleichmäßig in einer Schatulle gestapelter Dollar. Die<br />
man sich des Nachts hervorholen kann, betrachten, eventuell<br />
liebkosen, küssen, dran schnuppern et cetera. (Darf’s<br />
noch etwas sein für die gnädige Frau?)<br />
Aus dem Polnischen von Marie Hauptmeier<br />
W.A.B.<br />
Warsaw 2007<br />
123 × 195 • 256 pages<br />
paperback<br />
ISBN 978-83-7414-328-8<br />
Translation rights: W.A.B.<br />
Michał Witkowski Barbara Radziwiłłówna aus Jaworzno-Szczakowa<br />
53<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Grzegorz Kopaczewski Huta<br />
54<br />
Photo: Johanna Möller<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Wir schreiben das Jahr 2008. Die Sonderzone Huta ist zu einem<br />
Modellbezirk des postmodernen Polens, vielleicht sogar Europas,<br />
geworden. Das ehemalige Industriegebiet wurde (nach<br />
dem Vorbild eines real existierenden Kattowitzer Bezirks) in ein<br />
elegantes Kondominium umgewandelt, in einen wunderschönen<br />
Bezirk, der von erfolgreichen Geschäftsleuten und Kulturschaffenden,<br />
Wissenschaftlern und Künstlern bewohnt wird.<br />
Der Bezirk Huta ist im Roman eine Verbindung aus Silicon Valley<br />
und Greenwich Village. Hier haben die internationalen Hightech-<br />
Konzerne ihre Hauptquartiere, es wimmelt von Künstlerclubs<br />
und Galerien. Mehr noch – in Huta scheinen sämtliche Utopien<br />
der Bürgergesellschaft Wirklichkeit geworden zu sein, alle<br />
Bewohner sind glückliche, kreative und von jeglichem Konsumzwang<br />
befreite Menschen. Das Fantastische (Futurologische)<br />
vermischt sich mit Elementen der Dystopie. Huta ist nämlich<br />
auch ein Ghetto, eine künstliche Ministadt, die von einer hohen<br />
Mauer umgeben ist und von hunderten von Kameras überwacht<br />
wird. Außerhalb der Umzäunung liegt jenes Oberschlesien, beziehungsweise<br />
Polen, das es nicht<br />
geschafft hat.<br />
In dieser Szenerie begegnet der<br />
Leser dem Protagonisten Tomasz,<br />
einem jungen Doktoranten der Soziologie, der einer Universitätsverschwörung<br />
auf die Spur kommt, später Mitarbeiter eines<br />
geheimnisvollen Instituts wird und an Duellen der Geheimdienste<br />
teilnimmt.<br />
Das Gesellschaftsexperiment Huta ist wissenschaftlich fundiert.<br />
Alles nahm seinen Anfang mit den Schriften des Philosophen<br />
und Soziologen Kaspar Kuhn, einem Zeitgenossen Hegels, der<br />
nicht nur eine alternative Theorie zur marxistischen Lehre über<br />
die dialektische Entwicklung von Gesellschaften, sondern auch<br />
die Grundlagen der prognostischen Statistik, die unerlässlichen<br />
Algorithmen usw. schuf. Was, nebenbei gesagt, Fiktion in der<br />
Fiktion ist: Denn einerseits hat Kopaczewski Kuhn samt seinem<br />
stürmischen Lebenslauf und seinem umstürzlerischen wissenschaftlichen<br />
Werk erfunden, andererseits ist der deutsche Philosoph<br />
– wie sich zum Schluss des Romans herausstellt – auch<br />
eine Erfindung der Romanfiguren, und zwar einer Gruppe von<br />
genialen, rebellischen und exzentrischen Gelehrten der Universität<br />
Schlesien. Kopaczewski, und mit ihm der Leser, amüsiert<br />
sich köstlich über den wissenschaftlichen Diskurs. Und eben das<br />
ist die Stärke des Romans, und das Einmalige an ihm.<br />
Dariusz Nowacki<br />
Grzegorz Kopaczewski (geb. 1977),<br />
Prosaschriftsteller. Autor von zwei Romanen.<br />
Grzegorz Kopaczewski Huta<br />
55<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Grzegorz Kopaczewski Huta<br />
56<br />
Mein<br />
Umzug von Chorzów nach Huta dauerte<br />
zwei Stunden. Kleider und Bücher<br />
transportierte ich mit dem Taxi. Meine<br />
ganzen Besitztümer passten in einen Opel Astra Kombi hinein.<br />
Eigentlich besitze ich auch heute nicht mehr. Seit dieser<br />
Zeit habe ich mir nichts Neues angeschafft. Besitz ist out in<br />
Huta. Schlecht. Besitz ist überflüssig in Huta. Wozu brauchst<br />
du eine Waschmaschine, wo es doch Cleanicum gibt, wozu<br />
einen Fernseher, wenn es Teledromat gibt, was machst du<br />
mit einem DVD-Player, wenn du ein Abo fürs Casablanca<br />
hast, was mit einer Kaffeemaschine, wenn du über dem<br />
Kaffeeholiker wohnst? Wozu brauchst du ein Auto, wo du<br />
in Huta wohnst?<br />
Gegen Abend als ich in der neuen Wohnung meine Sachen<br />
schon ausgebreitet hatte, klopfte der Nachbar. Das Gesicht<br />
kannte ich. Von der Versammlung. Schriftsteller – Sozialaktivist;<br />
er war es gewesen, der mit immer neuen Anträgen<br />
Joachim den letzten Nerv geraubt hatte.<br />
„Hallo“, begann er schüchtern, während er sich misstrauisch<br />
umschaute. „Ich bin der Nachbar. Von gegenüber. Ich<br />
wollte mal Hallo sagen.“<br />
Er hatte zwei Bier bei sich, das eine war schon angefangen.<br />
Ich ließ ihn hinein.<br />
„Gefällt es dir in Huta?“, bereits nach den ersten Worten<br />
konnte man sich denken, dass er nicht gekommen war, um<br />
sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Wir setzten uns<br />
aufs Sofa. Er gab mir das andere Bier. Es war warm.<br />
„Ganz okay. Und dir?“<br />
„Immer weniger. Dafür machen sie immer mehr Druck.<br />
Sie sagen, für meine Wohnung gäbe es sechs Interessenten.<br />
Mit Preisen für Filme, Bücher und anderem Gedöns.<br />
Aber das ist erstunken und erlogen, wie man weiß ist für<br />
dieses Jahr das Wohnungskontingent für Künstler bereits erschöpft.“<br />
Ich machte ein verdutztes Gesicht. „Ja. Sie haben<br />
Kontingente für alle erwünschten Gesellschaftsgruppen. Ich<br />
weiß das, weil ich eine Bekannte im Bezirksrat habe. Selbst<br />
die Stipendien sind schon verteilt worden, wozu also diese<br />
Drohungen? Angeblich ist alles völlig transparent, wird alles<br />
öffentlich diskutiert, aber wenn es drauf ankommt, erpressen<br />
sie dich. Alles ist angeblich ganz offen und tolerant,<br />
aber wozu haben sie eine Mauer gebaut? Angeblich ist sie ein<br />
Denkmal und musste restauriert werden, dabei weiß jeder,<br />
dass es von Załęże bis hierher einen Zaun gegeben hat, aber<br />
keine Mauer. Und was ist mit der Fußgängerbrücke zum Silesia<br />
Center? Sie hatten Angst, dass die Leute zum Shoppen<br />
ins Einkaufszentrum gehen, weil es billiger ist, also haben sie<br />
keine Genehmigung erteilt. Angeblich haben die Bewohner<br />
per Volksentscheid den Bau abgelehnt, aber was ist das für<br />
eine Abstimmung vom Homecomputer aus. Wenn jemand<br />
keinen hat, stimmt er nicht ab. Und ihnen ist es egal, ob du<br />
einen hast. Ich aber hatte zu der Zeit gerade Probleme und<br />
musste meinen weggeben. Und dann sagen sie, ich würde<br />
nicht zur Verbesserung des Images von Huta beitragen. Sie<br />
würden keine Waise aushalten, die außerstande sei, etwas<br />
Neues zu schreiben.“<br />
„Hast du Arbeit in Huta bekommen?!“ Ich nickte. „Wo?“<br />
„Im Institut für Geschichte.“<br />
„Der Chef des Instituts ist auch im Rat. Du hast es gut<br />
getroffen.“ Er begann unruhig hin und her zu rutschen,<br />
schließlich stand er auf. „Okay, es ist Zeit für mich. War nett,<br />
den Nachbarn kennen zu lernen. Auf Wiedersehen.“<br />
Er verließ die Wohnung. Er hatte sich nicht vorgestellt.<br />
Noch hatte ich ihm meinen Namen genannt. Als ich schon<br />
im Bett lag, klopfte er erneut. Wieder mit Bier. Wieder war<br />
es warm.<br />
„Weißt du, wie sie es machen, dass Huta so eine gute Presse<br />
hat?“, sagte er, als er sich auf das Sofa fläzte.<br />
„Nein. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.“<br />
„Sie stellen dem Fernsehen Räumlichkeiten zur Verfügung.<br />
Das heißt den beliebteren Journalisten sogar Wohnungen.<br />
Alle wollen in Huta wohnen. Und diese Lumpen vom<br />
Fernsehen und der Presse sind sogar bereit, dafür zu zahlen.<br />
Und zwar doppelt so viel wie die normalen Bewohner. Wie<br />
du und ich. Jeder möchte ein Künstler sein oder zumindest<br />
wie ein Künstler leben. Ich weiß nicht, wie Künstler leben,<br />
aber die, die ein paar tausend für die Wohnung zahlen, wissen<br />
es sicherlich. Nur die von den Boulevardzeitungen und<br />
national-katholischen Blättern bekommen keine Wohnungen.<br />
Aber trotzdem schreiben sie Eingaben. Huta kommt<br />
ihre Kritik gelegen. Das unterstreicht die Richtung, in die<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
sich der Bezirk entwickelt. Und weißt du, wieso wir jetzt den<br />
skandinavischen Monat haben?“<br />
„Haben wir den skandinavischen Monat?“<br />
„Hörst du nicht den Kauderwelsch auf der Straße?“<br />
„Stimmt, als würde man mehr germanische Sprachen<br />
hören.“<br />
„Vor zwei Monaten hat man von Balice und Pyrzowice<br />
eine neue Verbindung nach Skandinavien eröffnet. Dass<br />
Musik und Filme von jenseits der Ostsee angesagt sind,<br />
kommt nicht von ungefähr. Die Strindberg-Retrospektive<br />
auch nicht. Natürlich alles gut dosiert, in kleinen Portionen,<br />
damit es nicht entwertet wird. Um die Snobs anzulocken.<br />
Sogar mir hat man vorgeschlagen, ein Stück zu schreiben.<br />
Die Handlung sollte zwischen Freunden beim gemeinsamen<br />
Zusammenschrauben von Ikea-Möbeln stattfinden.“<br />
„Eine gute Idee.“ Ich musste sogar lächeln. „Und? Hast du<br />
es geschrieben?“<br />
„Naaaa…“, begann er sich mit dem ganzen Körper zu winden,<br />
„zuerst wollte ich nicht. Dann dachte ich, das wäre ein<br />
guter Hintergrund. Aber sie begannen Druck zu machen.<br />
Wer bin ich denn! Der Texter von diesem Arsch vom Gangende?<br />
Wie heißt er noch gleich?“<br />
„Wer?“<br />
„Na der, letzte Tür auf unserer Etage. Er singt im Fernsehen,<br />
jetzt hat er einen ganz bekannten Hit. „Ich fliege hoch<br />
ins Blaue hinein“, irgendwie so. Und er spielt in einer Soap<br />
mit. Meine Freundin Justyna sagt, dass sie ihm eine Wohnung<br />
vermietet haben, weil der Junge unbedingt ein Künstler<br />
sein wollte, so ein richtiger, hat er gesagt, und sie zocken<br />
ihn hier ganz schön ab, aber ihm gefällt es. Und da er fast<br />
jeden Tag in „Fakt“ ist, macht er Huta kostenlos Reklame.<br />
Das ist ein einfacher Junge.“<br />
Er blieb sitzen bis die Dose leer war. Er hatte sich nichthutagerecht<br />
beschwert, in nichthutagerechten Erinnerungen<br />
geschwelgt und zog einen nichthutagerechten Pessimismus<br />
hinter sich her.<br />
Aus dem Polnischen von Andreas Volk<br />
Czarne<br />
Wołowiec 2007<br />
125 × 195 • 185 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-7536-014-1<br />
Translation rights: Czarne<br />
Grzegorz Kopaczewski Huta<br />
57<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Marek Kochan Spielplatz<br />
58<br />
Photo: Privatarchiv<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Spielplatz ist ein zeitgenössischer Gesellschaftsroman mit satirischem<br />
Einschlag. Thema sind die Krise der Männlichkeit und die<br />
Umkehrung der Rollen in der modernen Familie.<br />
Der Roman hat drei Hauptfiguren. Zwei von ihnen sind Männer,<br />
die im Schatten ihrer Ehefrauen – Macherinnen, die an ihrer beruflichen<br />
Karriere basteln – stehen. Der dritte Mann ist ein Single<br />
und Playboy, ein Held der Medien und notorischer Aufreißer.<br />
Auf verschiedene Weise durchleben alle drei eine Krise ihrer<br />
männlichen Identität. Letzterer inszeniert, um als Supermann<br />
zu gelten, lustige und zugleich klägliche Verführungsschauspiele.<br />
Seine Männlichkeit ist immer konstruiert, immer zur Schau<br />
gestellt. Die zwei „Männer ihrer Frauen“ wiederum erleben die<br />
weibliche Dominanz auf unterschiedliche Art. Der eine ist einfach<br />
ein geistig beschränkter Versager<br />
und freiwilliger Arbeitsloser. Die<br />
Betreuung des kleinen Kindes, das<br />
Putzen und Kochen sind verantwortungsvolle<br />
Aufgaben, die ihn fast schon überfordern. Allerdings<br />
sollte er auf keinen Fall nach „Höherem“ streben, denn es scheint<br />
seine Bestimmung zu sein, das männliche Hausmütterchen zu<br />
spielen. Der andere ist ein träger Wissenschaftler, der, obwohl<br />
hoch qualifiziert, sich nicht rechtzeitig um seine eigene Karriere<br />
gekümmert hat. Er hat sich für ein bequemes Leben an der Seite<br />
seiner sehr gut verdienenden Frau entschieden. Nach Jahren des<br />
inneren Zwiespalts begreift er jedoch seinen Fehler. Er besinnt<br />
sich und findet seinen Platz in der Welt – er wird Schriftsteller.<br />
Kochan moralisiert nicht, ergreift für keinen seiner Helden Partei,<br />
spielt geschickt die kulturellen Stereotype durch und ist ein<br />
guter Beobachter des gesellschaftlichen Wandels, der in den<br />
letzten Jahren stattgefunden hat.<br />
Dariusz Nowacki<br />
Marek Kochan (geb. 1969), Prosaschriftsteller,<br />
Autor von Fernsehdrehbüchern und Bühnentexten.<br />
Marek Kochan Spielplatz<br />
59<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Marek Kochan Spielplatz<br />
60<br />
NEUN<br />
uhr. um diese uhrzeit sollte der<br />
meister kommen. Schon fast eine<br />
Viertelstunde macht sich Kätzchen<br />
in der Wohnung zu schaffen, klopft ab, misst nach. Davon<br />
absehen, es gut sein lassen, die Fenster schon fertig haben.<br />
Was solls, dass sie schief sind. Wer wird das schon bemerken,<br />
wer wird klopfen, um zu sehen, ob darunter Gips oder<br />
Hohlräume sind. Na, wer schon? Vater. Ja, Opa Witek wird<br />
klopfen, und es sofort bemerken. Aber was geht ihn unsere<br />
Wohnung an, soll er sich um seine kümmern. Wir werden<br />
hier wohnen. Helenka hat das Geld verdient, ich renoviere.<br />
Finger weg! Er, Kätzchen, lebt schließlich nicht, um die Erwartungen<br />
seines Vaters zu erfüllen, sondern nur für sich. Er<br />
hat sein eigenes Leben. Wegen irgendwelcher Fenster. Soll<br />
er sich zanken, wegen einer x-beliebigen Lappalie, Energie<br />
verschwenden. Er wird sagen, dass seine Frau es sich abends<br />
angeschaut habe und gemeint habe, auf keinen Fall aber ihretwegen.<br />
Das ist eine Notlösung, ein Hintertürchen, um<br />
das Gesicht zu wahren. So denkt Kätzchen von Punkt neun<br />
Uhr bis neun Uhr fünf, neun Uhr zehn. Selbst um neun Uhr<br />
fünfzehn ist das noch sein Standpunkt. Er ruft Helenka an.<br />
Er sei nicht gekommen, der Meister. Hat er dich vielleicht<br />
angerufen? Er hat meine Nummer ja gar nicht. Nein, gib sie<br />
ihm nicht. Sprich überhaupt nicht mit ihm. Heb nicht einmal<br />
ab, wenn er anruft. Ich erledige das, mit dem werde ich<br />
schon fertig. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Zumal<br />
der Meister nicht kommt. Dafür überkommt Kätzchen Wut,<br />
mit steigender Tendenz zwischen neun Uhr sechzehn und<br />
zwanzig vor zehn, mit dem Höhepunkt um halb. Was denkt<br />
er sich, der Vollidiot. Dieses Ledermännchen. Bildet er sich<br />
etwa ein, Helenka und er würden so lange auf ihn warten?<br />
Und Helenka allein schon gar nicht. Wo sie mit Geschäften<br />
beschäftigt ist, soll sie ihre wertvolle Zeit mit dem Meister<br />
verschwenden? Und das als zahlender Kunde. Immer größerer<br />
Hass steigt in ihm hoch, dann, kurz vor zehn, wird dieser<br />
allmählich schwächer, klarer und erstarrt. Zum Schluss<br />
verhärtet er sich. Warte nur Freundchen, dir werde ich es<br />
zeigen, du wirst dein blaues Wunder erleben. Er sieht sich<br />
den Auftrag durch, prüft, was er für Paragrafen hat. Ruhig,<br />
fast schon fröhlich ist Kätzchen, als es an der Tür klingelt, es<br />
ist fünf vor zehn. Habe ich es doch noch pünktlich geschafft,<br />
sagt der Meister selbstzufrieden. Und wo ist ihre Frau, ist sie<br />
nicht da? Na gut, dann erledige ich das mit Ihnen. Also, hier<br />
habe ich alles vorbereitet, hier die Rechnung, er händigt sie<br />
aus. Wir erledigen das, wird alles erledigt, antwortet Kätzchen,<br />
er lächelt. Nur halt heute noch nicht. Wieso das? Na<br />
ja, es müssen noch ein paar Kleinigkeiten verbessert werden.<br />
Verbessert werden? Wissen Sie, Herr, Kätzchen schaut auf die<br />
Rechnung, auf ihr ein Stempel mit einem Nachnamen, Herr,<br />
ja, Adrian, stimmts, von mir aus wäre das sogar okay gewesen.<br />
Ich habe es mir tagsüber angesehen, und alles in allem<br />
wäre das noch gegangen, ginge es nach mir. Aber meine Frau!<br />
Meine Frau, Herr Adrian, hat einen Wutanfall bekommen.<br />
Sie kommt um zwei vor neun, schaut es sich an und sagt zu<br />
mir, ein Skandal ist das, eine Pfuscherei, so nicht. Sie werden<br />
alle Fenster neu einsetzen, hat sie gesagt, oder wir wechseln<br />
gleich ganz die Firma, verfällt halt die Anzahlung, da kann<br />
man nichts machen. Jemand anderes wird das ordentlich machen.<br />
Ich konnte sie gerade noch so beruhigen, Herr Adrian,<br />
gib ihnen eine Chance, habe ich gesagt, im Grunde sind das<br />
gute Handwerker, sie haben sich bemüht, das muss in der<br />
Eile passiert sein, sie kommen nochmal und verbessern das<br />
in aller Ruhe. Sie haben Glück gehabt, dass Sie nicht früher<br />
gekommen sind. Sie hätte es Ihnen gegeben. Bis fünf nach<br />
hat sie gewartet und ist dann gegangen, Sie wären ganz schön<br />
unter die Räder gekommen, wenn Sie ihr zufällig über den<br />
Weg gelaufen wären. Sie kennen sie nicht, sie sieht nur so<br />
aus, aber in Wirklichkeit, Herr Adrian, ist sie ein Taifun. Sie<br />
hat ihre eigene Firma, in der Immobilienbranche, die Angestellten<br />
kommandiert sie herum, dass sie einem manchmal<br />
Leid tun können. Und dazu kennt sie sich noch aus. Rechtsanwältin.<br />
Von Verträgen versteht sie was. Sie hat mir gleich<br />
gesagt, dass Sie nur der Subunternehmer sind, dass Sie einen<br />
Vertrag mit der Firma haben, die die Fenster herstellt. Ist<br />
doch so, oder, Herr Adrian? Eben. Sie sagte, wenn irgendetwas<br />
nicht in Ordnung sein sollte, werde sie dort zur Geschäftsführung<br />
gehen und Sie so in die Pfanne hauen, dass<br />
Sie sich vor Schadenersatzforderungen nicht mehr retten<br />
können. Die Frau ist rachsüchtig, das können Sie mir glauben.<br />
Einmal hat ein Bauunternehmer einem ihrer Kunden<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
einen Bauplan für den Ausbau eines Dachbodens angefertigt,<br />
und als etwas nicht stimmte, ist sie vor Gericht gegangen, sie<br />
hat Gutachten vorgelegt, dass das Dachgeschoss eingestürzt<br />
wäre, sie haben seinen Gewerbeschein eingezogen, ihn aus<br />
der Gewerkschaft ausgeschlossen. Sie hat den Mann zerstört.<br />
Und Kontakte, die hat sie. Vorläufig nehme ich Sie in Schutz,<br />
sollte sie es aber auf Sie abgesehen haben, dann werden Sie in<br />
keiner seriösen Firma in Warschau mehr Arbeit bekommen.<br />
Mit den Adressen aus dem Computer würde sie Sie überall<br />
anschwärzen. Sie würden eine Zeitlang kämpfen, aber das<br />
muss ja nicht sein, wozu die Schwierigkeiten. Sie kommen<br />
doch aus Płońsk, dort ist Arbeit Mangelware, während es<br />
hier einen gesunden, großen Markt gibt. Wozu ein Risiko<br />
eingehen? Besser seine Sachen machen, Geld verdienen,<br />
reich werden. Und wenn sie erst zufrieden ist, wird sie Sie<br />
weiterempfehlen. Sowohl für Fenster als auch für größere Arbeiten.<br />
Wozu, glauben Sie, machen wir das wohl. Wir haben<br />
ein paar von diesen Mietwohnungen. Und sind gerade dabei<br />
weitere Wohnungen zu kaufen. Für uns sind das Peanuts!<br />
Er schnippt mit den Fingern. Ich beschäftige mich ausschließlich<br />
damit, kümmere mich um die Renovierungen,<br />
nehme das Geld in Empfang. Meine Aufgabe ist es, die Arbeiten<br />
zu beaufsichtigen. Schließlich geht es doch um Kleinigkeiten.<br />
Ja, aber was hilft es, dass es für mich okay ist,<br />
wenn sie nicht zufrieden ist. Ich kenne sie, Herr Adrian, wir<br />
leben jetzt fünf Jahre zusammen, und in der Zeit habe ich<br />
gelernt, dass man besser nachgibt, es so macht, wie sie es will,<br />
und dann ist es gut.<br />
Aus dem Polnischen von Andreas Volk<br />
W.A.B.<br />
Warsaw 2007<br />
123 × 195 • 428 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 978-83-7414-295-3<br />
Translation rights: W.A.B.<br />
Marek Kochan Spielplatz<br />
61<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Hanna Kowalewska Die Maske des Harlekins<br />
62<br />
Photo: Agnieszka Herman<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die Maske des Harlekins ist nach Polnische Sonate und Der Berg<br />
der schlafenden Schlangen der dritte Teil eines Romanzyklus<br />
von Hanna Kowalewska. Den Zyklus verbinden die Hauptfigur<br />
Matylda, ein Häuschen in Zawrocie als Ort der Handlung,<br />
das Tagebuch als Erzählform und die verstorbene Großmutter<br />
als Adressatin der Bekenntnisse. In den einzelnen Teilen wird<br />
das wechselvolle Schicksal der Hauptfigur erzählt (vor allem in<br />
Herzensdingen), doch zugleich steht immer auch – und das unterscheidet<br />
die einzelnen Romanakte voneinander – ein neues<br />
Geheimnis aus der Vergangenheit im Zentrum der Handlung.<br />
Der Besitz in Zawrocie ist eine Art Katalysator für Matyldas detektivische<br />
Neigungen, hier liegen die Spuren verborgen, die zu<br />
den Geheimnissen ihrer Familie führen, und hier „materialisieren<br />
sich“ auch die Geister der Vergangenheit.<br />
Ein solches Gespenst ist Olga, eine ehemalige Kommilitonin<br />
und Rivalin der Hauptfigur. Olga und Filip „der Verrückte“, Matyldas<br />
späterer Ehemann, waren ein<br />
Paar gewesen. Zwar hatte Olga den<br />
Kampf um ihn verloren, gleichzeitig<br />
war sie die einzige Zeugin von Filips<br />
tragischem Tod. Nach zehn Jahren,<br />
die seit jenem Ereignis verstrichen sind, kehrt sie nach Polen zurück<br />
und provoziert die Heldin zu einer neuen Ermittlung. Um die<br />
Wahrheit zu erfahren, wird sich Matylda der traumatischsten Erfahrung<br />
ihres Lebens stellen müssen. Und sich bei dieser Gelegenheit<br />
auf einen sadomasochistischen Entscheidungskampf mit<br />
einer Frau einlassen, die sie zutiefst hasst. Die Zeit wird jedoch<br />
zeigen, welche der beiden Protagonistinnen stärker leidet..<br />
Hanna Kowalewska bestätigt in diesem Roman ihr Talent für den<br />
Aufbau einer spannenden Romanhandlung und die Konstruktion<br />
einer Intrige. Sie ist auch eine ausgezeichnete Kennerin menschlicher<br />
Charaktere. Die Maske des Harlekins changiert also zwischen<br />
einem Thriller und einem psychologischen Roman.<br />
Hanna Kowalewska (geb. 1960), sie<br />
schreibt Gedichte, lyrische Prosa, Romane,<br />
Erzählungen, Hörspiele und Dramen.<br />
Hanna Kowalewska Die Maske des Harlekins<br />
63<br />
Marta Mizuro<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Hanna Kowalewska Die Maske des Harlekins<br />
64<br />
„Europa!“,<br />
fauchte sie und<br />
begutachtete den<br />
nächsten Kratzer<br />
im Leder ihrer italienischen Pumps. „Elendes Geschluder!<br />
Noch schlimmer als zu Zeiten der Kommune. Damals wusste<br />
der Mensch wenigstens, was ihm widerfahren konnte. Er<br />
war geistig darauf vorbereitet. Und jetzt hofft man auf werweißwas!“<br />
Vor zehn Jahren hatte Olga noch keine Highheels getragen,<br />
keine hautfarbenen Nylonstrümpfe und luftigen Gewänder.<br />
Sie hatte kein gefärbtes Haar auf dem Kopf, keine<br />
mit grellem Nagellack bepinselten langen Fingernägel und<br />
nicht Tonnen von Wimpertusche aufgelegt. Und sie bewegte<br />
sich nicht wie ein Dämchen, sondern stand mit beiden<br />
Beinen fest auf der Erde, trug solides Schuhwerk mit dicker,<br />
flacher Sohle. Warum hatte sie darauf beharrt, auf bürotauglichen<br />
Absätzen, in denen man stundenlang in der Nähe des<br />
Arbeitszimmers des Chefs am Schreibtisch sitzen konnte,<br />
die alte, neue Welt kennenzulernen, und das zu Fuß? Wozu<br />
brauchte sie Unbequemlichkeit und Schmerz? Warum hatte<br />
sie beschlossen, sich so furchtbar zu quälen? Wollte sie mir<br />
und sich beweisen, dass man diese Stadt in die Mülltonne<br />
klopfen konnte? Musste sie sie unbedingt so kleinmachen?<br />
Aber warum? Um ihr eigenes gegenwärtiges Leben zu erhöhen?<br />
Das Berliner? Das elegante? Das Highheelleben?<br />
Das alles hatte keinen Sinn, jedenfalls konnte ich keinen<br />
finden. Sie stöckelte, ich ging in meinem alten Schritt, in<br />
bequemen, nicht schlecht geschnittenen Schuhen. Also passten<br />
wir wie schon vor Jahren nicht zueinander, wenn auch<br />
damals aus völlig anderen Gründen.<br />
Nicht nur die Stadt, sondern die ganze Welt war in Olgas<br />
Gegenwart irgendwie anders. Es regnete, obwohl es nicht<br />
hatte regnen sollen. Zumindest war Olga davon überzeugt,<br />
dass es an genau diesem Tag nicht hätte regnen dürfen. Es<br />
hätte Hitze geben sollen, doch es gab keine. Olga stapfte in<br />
leichten Sachen in die Tiefe kalter Straßen, mit Gänsehaut,<br />
durchgefroren, kalt erwischt von der plötzlichen Kälte, die ihr<br />
durch Mark und Bein ging. Es sah aus, als verstünde sie diese<br />
Stadt und dieses Klima nicht mehr, nichts, was ihr früher so<br />
vertraut war wie mir. Sie beharrte zudem auf ihrer Ansicht,<br />
als müsste sich die Stadt und alles andere ihren Vorstellungen<br />
und Erinnerungen anpassen, nicht sie den Umständen.<br />
In der Nähe der Centrum-Kaufhäuser, in einer Seitenstraße<br />
– wo Olga einen winzigen Teeladen suchte, den es hier<br />
einmal gegeben haben sollte und der sich jetzt einfach nicht<br />
finden wollte – trafen wir Jakub. Er trug unter dem Arm einen<br />
bunten Karton, dessen Aufkleber der ganzen Welt kund<br />
taten, dass er nicht nur ein fürsorglicher, sondern auch ein<br />
großzügiger Papi war. Ein Fernglas! Ein Geschenk für seinen<br />
Sohn! Nun ja, was sonst hätte ihn in der Innenstadt, die er<br />
nicht mochte, aus dem Auto bewegen können.<br />
„Jakub? Soll heißen wer?“, fragte Olga provokativ, als wir<br />
uns gemeinsam unter die Schirme eines kleinen Cafés setzten.<br />
„Ein Bekannter? Ein guter Bekannter? Ein Freund? Der<br />
Liebhaber? Der Freund?“<br />
Jakub war einen Augenblick lang verlegen. Er wusste selbst<br />
nicht, wer er für mich war.<br />
„Ein Bekannter“, sagte ich für ihn, und er protestierte<br />
nicht.<br />
„Die Bezeichnung behagt ihm offensichtlich nicht besonders“,<br />
bemerkte Olga ironisch. Sie nahm sich gleich eine Zigarette,<br />
wartete, bis Jakub ihr Feuer gegeben hatte, und setzte<br />
dann zu ihrem Monolog an. „Entweder wäre er gerne mehr,<br />
oder du hast nicht die Wahrheit gesagt.“ Sie hatte die unerträgliche<br />
Manier, so zu sprechen, dass immer jemand vom<br />
eigentlichen Gespräch ausgeschlossen wurde. Diesmal war es<br />
Jakub. „Lass mich raten, Liebhaber. Ich weiß nur nicht, ob<br />
ehemaliger, gegenwärtiger oder auch nur potentieller.“<br />
„Achte nicht auf sie“, brummte ich Jakub zu. „Sie ist so.<br />
Ihr scheint, dass das Menschenprovozieren der einfachste<br />
Weg ist, um sie zu enträtseln. Deshalb schießt sie so blindlings<br />
drauf los.“<br />
„Manchmal trifft sie dabei ins Schwarze“, erwiderte Jakub,<br />
obwohl er wusste, dass mir das nicht gefallen würde.<br />
„Na bitte!“, lachte Olga triumphierend auf. „Schießen wir<br />
weiter?“<br />
„Hör auf!“, protestierte ich.<br />
„Wie du wünschst.“ Einen Augenblick lang widmete sie<br />
sich dem Zigarettenqualm. Aber sie hörte nicht auf, uns zu<br />
beobachten.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Um dem ein Ende zu setzen, griff ich nach der Speisekarte.<br />
„Sie haben hier eine ziemlich gute Auswahl, vor allem<br />
an Tee. Jasmintee, tropischen, Preiselbeer, mit Ingwer, mit<br />
Walderdbeeren.“<br />
„Das ist also heute dein Geschmack“, sagte Olga und<br />
schenkte meiner Aufzählung keinerlei Beachtung. Es war ihr<br />
gleichgültig, dass ihre Worte, vor allem aber ihr Ton Jakub<br />
verletzen konnte. „Schau...“, wandte sie sich an ihn, „Matylda<br />
und ich haben uns fast zehn Jahre nicht gesehen. Eine<br />
lange Zeit, nicht wahr?“ Sie klopfte die Asche ab. Jakub nickte.<br />
„Ich entdecke sie ganz neu. Alles an ihr ist anders. Du<br />
erinnerst auch in nichts an den Kerl, den sie damals liebte.<br />
Ihr Mann... Das klingt seltsam, wenn man über jemanden<br />
wie Matylda spricht.“<br />
Sie sah ihn mit einem ironischen Lächeln an, sie wollte<br />
sehen, welchen Eindruck das auf ihn machte. Jakub trug<br />
jedoch bereits die Maske der Gleichgültigkeit. Er stieß Zigarettenrauch<br />
aus und beobachtete das graue Wölklein gelassen,<br />
als beträfe die ganze Ansprache gar nicht ihn.<br />
„Zehn Jahre?“, fragte er einen Augenblick später und gestattete<br />
auch sich einen Anflug von Ironie. „Ausland, Gefängnis<br />
oder Nervenheilanstalt?“<br />
Olga lachte auf.<br />
„Erraten. Jetzt muss man nur noch ‚oder’ herauslassen“,<br />
sagte sie, „es hat sich doch gelohnt, sich von hier für eine<br />
Weile loszureißen, um jetzt euch beide und all das ringsherum<br />
zu sehen. Ein gar nicht übles Irrenhaus. Vielleicht auch<br />
ein Wanderzirkus. Ja, das ist wohl der bessere Ausdruck. Und<br />
die da“, sie deutete auf mich, „immer auf dem Hochseil, mit<br />
dem Schirmchen. Früher hat sie sich darauf herumgetrieben,<br />
weil sie glaubte, die Erdanziehungskraft gäbe es für sie nicht,<br />
jetzt weiß, dass das nicht stimmt, aber sie möchte sich an<br />
diesen Zustand erinnern, als sie sich täuschte. Vielleicht ist<br />
der Grund auch ein anderer? Vielleicht sucht sie da oben<br />
Seilakrobaten? Wer kennt sich schon bei ihr aus? Und du,<br />
was denkst du dazu?“<br />
„Ich denke, dass es dir auf solchen Absätzen schwer fiele,<br />
auf dem Seil zu gehen.“<br />
Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier<br />
Zysk i s-ka<br />
Poznań 2007<br />
125 × 195 • 318 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-7506-062-1<br />
Translation rights:<br />
Hanna Kowalewska<br />
Contact: Zysk i s-ka<br />
Hanna Kowalewska Die Maske des Harlekins<br />
65<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Wacław Holewiński Der Weg nach Putte<br />
66<br />
Photo: Włodzimierz Wasyluk<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ein Buch wie Der Weg nach Putte hat es in der polnischen Literatur<br />
der letzten Jahre nicht oft gegeben. Holewiński entwirft eine<br />
faszinierende Geschichte über die Biographie eines der führenden<br />
flämischen Maler des Barock, Jacob Jordaens (1593-1678).<br />
Die Handlung des Romans setzt im Jahr 1640 ein. Zu diesem<br />
Zeitpunkt ist Jordaens bereits ein gereifter, anerkannter und<br />
vermögender Maler: Er hat eine liebende Frau, wohlgeratene<br />
Kinder und ein prächtiges Haus. Doch wie so viele Künstler ist<br />
auch Jordaens von einer schöpferischeren Unruhe erfüllt. Sein<br />
Verhältnis zu Rubens, mit dem er sich immer wieder vergleicht,<br />
trägt deutlich zwanghafte Züge. Er ist nicht sicher, ob er wirklich<br />
ein künstlerisches Genie oder nur ein überaus begabter Handwerker<br />
ist. Doch Holewińskis Roman erzählt nicht nur von den<br />
Höhen und Tiefen einer Künstlerbiografie,<br />
vom Leben eines unermüdlichen<br />
Arbeiters, der alles andere<br />
der Malerei unterordnete. Im Hintergrund<br />
entwirft er auch ein detailliertes Bild des Alltagslebens<br />
im Antwerpen des siebzehnten Jahrhunderts, einer ehemals<br />
blühenden Handelsmetropole, die zunehmend im Verfall begriffen<br />
ist und von politischen und religiösen Konflikten geschüttelt<br />
wird. Der Weg nach Putte ist aber auch – und vielleicht vor allem<br />
– ein Roman über das Leiden an der Vergänglichkeit und über<br />
die Auseinandersetzung mit dem Tod. Nicht zufällig erwähnt der<br />
Autor im Titel des Romans den Ort, an dem Jordaens und seine<br />
Angehörigen beigesetzt wurden. Für den Maler selbst war der<br />
titelgebende „Weg nach Putte“ ein überaus schmerzvoller: Da er<br />
selbst ein sehr hohes Alter erreichte, musste er sich mit Tod fast<br />
aller seiner Angehörigen abfinden. Doch Jordaens überließ sich<br />
nie seiner Verzweiflung, immer fand er Trost in der Malerei.<br />
Wacław Holewiński (geb. 1956), Romanschriftsteller,<br />
Dramatiker, Herausgeber und<br />
Redakteur.<br />
Wacław Holewiński Der Weg nach Putte<br />
67<br />
Robert Ostaszewski<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Wacław Holewiński Der Weg nach Putte<br />
68<br />
– Rubens<br />
– warf jemand von<br />
der Seite ein.<br />
Ein anderer erblickte<br />
eine vorzügliche Ähnlichkeit zwischen der Gestalt auf dem<br />
Bild und dem seligen Frederik Hendrik, der allen noch lebhaft<br />
vor Augen stand.<br />
Nur Beck, ein reicher Kaufmann aus Den Haag, erlaubte<br />
sich eine spitze Bemerkung:<br />
– Wenn das Rubens sein soll, wie glücklich können wir<br />
uns da schätzen, dass wir unseren Rembrandt haben.<br />
Jordaens lauschte diesen Urteilen anfangs noch mit einer<br />
gewissen Befangenheit, doch mit jedem weiteren Lob hellte<br />
sich seine Miene auf und wuchs sein Selbstbewusstsein. Ihm<br />
selbst schien es, als ermangele es dem Bild an jenem pulsierenden<br />
Rhythmus, jener Intensität, die er in anderen Szenen,<br />
auf anderen Bildern mitunter eingefangen hatte. Da dies jedoch<br />
keinem der Anwesenden weiter auffiel...<br />
– Meister – die Fürstin hakte sich bei ihm ein und schritt<br />
neben ihm vom einen Ende des riesigen Gemäldes zum anderen<br />
– wenn die beiden anderen Bilder genauso schön werden...<br />
Ich werde stolz sein, solche Werke zu besitzen.<br />
Sie ließ Wein kommen. Einen Augenblick später brachte<br />
sie einen Toast aus, jedoch nicht auf ihn, sondern auf die<br />
Zukunft.<br />
– Auf dass dieses Haus in Zukunft möglichst oft Künstler<br />
von eurem Rang zu Gast haben möge.<br />
Der Klang zerbrechenden Glases, der auf die Unaufmerksamkeit<br />
einer der Damen zurückzuführen war, löste allgemeine<br />
Heiterkeit aus.<br />
– Ein gutes Zeichen – rief einer der anderen Maler und<br />
wandte sich gleich darauf an Jordaens, um ihm die verdiente<br />
Ehre zu erweisen.<br />
Die Fürstin überließ ihn seiner Obhut und unterhielt sich<br />
eine Weile mit dem jungen Jacob. Sie bat ihn, ihr zu zeigen,<br />
worin sein Anteil an dem Werk bestanden hatte. Anschließend<br />
lauschte sie einer lebhaften Unterhaltung zweier Maler,<br />
die mit ihren sachkundigen Bemerkungen über die Originalität<br />
des Kolorits und die unterschiedliche Farbdichte in<br />
den hellen und dunklen Bildpartien eine vielköpfige Zuhörerschaft<br />
um sich geschart hatten.<br />
Der Maler, der neben dem Auslöser dieses Aufruhrs stand,<br />
Egbertus Kuipt, wollte Jacob unbedingt in sein Atelier einladen.<br />
Er selbst malte keine großen Gemälde, wie Jordaens,<br />
sondern, in der Art seines entfernten Vetters Gerard<br />
ter Borch, kleinere Bilder, auf denen er reiche Bürger mit<br />
ihrer Dienerschaft darstellte. Mit großer Sorgfalt arbeitete<br />
er an jeder einzelnen Feder, jeder Portiere und jeder Spitzenmanschette,<br />
und eben daher rührte seine Bewunderung<br />
für Jacob, der auf einem so großen Gemälde nicht nur die<br />
Details erfasste, sondern auch scheinbar mühelos gewisse Figuren<br />
mit dem Hintergrund verschmelzen ließ, ein Gefühl<br />
für den Raum vermittelte, seine Verbundenheit mit der Tradition<br />
ausdrückte, etwas in sie einfließen ließ, das als „glatte<br />
Malerei“ bezeichnet wurde, und obendrein durch gezielten<br />
Einsatz des Lichts keinen Zweifel daran ließ, welche der Figuren<br />
die wichtigste war.<br />
Jacob, den es aus heiterem Himmel am ganzen Körper zu<br />
jucken begann, nahm Kuipts Einladung an und drückte ihm<br />
die Hand. Mit einem Mal spürte er, wie alles von ihm abfiel:<br />
die Aufregung, die Sorge, eine gewisse Angst. Er hatte<br />
gewusst, dass dieser Moment kommen würde, in dem andere<br />
ein Urteil über seine Kunst fällen würden, doch er hatte<br />
nicht geahnt, wie abhängig er noch immer von diesem Urteil<br />
war. Nur gut, dass die Fürstin zu dieser unangekündigten<br />
Vorführung Menschen wie ihn eingeladen hatte, Künstler,<br />
die Talent und unermüdlichen Fleiß besaßen und die die<br />
Welt mit anderen Augen sahen. Und wie ein Kind freute er<br />
sich über ihre Anerkennung.<br />
Jacob nahm an diesem Tag noch viele Gratulationen<br />
entgegen. Er zweifelte nicht an ihrer Aufrichtigkeit, einen<br />
Moment lang glaubte er sogar, dass niemand anders als er<br />
selbst... Hochmut – erkannte er freilich noch im selben Augenblick<br />
– Rüstzeug des Teufels... Schnell kam er wieder zur<br />
Besinnung. Nachdem alle gegangen waren, setzte er sich auf<br />
eines der Podeste und betrachtete lange sein Werk. Und als<br />
er lange genug gesessen hatte, griff er nach seinem Pinsel und<br />
warf ihn auf den Boden.<br />
Der junge Jacob war den Tränen nahe, als er sah, wie sein<br />
Vater zerstörte, was andere für ein Meisterwerk gehalten<br />
hatten.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
– Warum? – stieß er hervor.<br />
– Warum? – wiederholte Jordaens die Worte seines Sohnes.<br />
– Du hast einmal gesagt, dies würde mein bedeutendstes<br />
Werk werden, weißt du noch? – erinnerte er ihn an<br />
ein früheres Gespräch. – Ich möchte nicht, dass irgendjemand<br />
denkt, zu mehr sei ich nicht imstande. Aber mach dir<br />
keine Sorgen – versuchte er ihn zu trösten. – Du kannst mit<br />
dem zweiten Bild beginnen. Mit diesem werde ich schon allein<br />
fertig.<br />
Und bis zum Abend sprach er kein Wort mehr. Jetzt malte<br />
er, wie sein Herz es ihm eingab, und nicht nach einem<br />
bestimmten Plan. Die Kartons konnte er beiseite legen, sie<br />
zerreißen und verbrennen lassen, er brauchte sie nicht mehr.<br />
Der allgemeine Ausdruck des Bildes blieb in etwa der gleiche,<br />
doch jetzt erfasste er in den Umrissen der Figuren etwas,<br />
das zuvor niemand dort erahnt hätte. Frederik und Maurits<br />
erschienen nun als Inbegriff von Entschlossenheit, Stärke<br />
und Mannhaftigkeit. Die Frauengestalt – jener über ihnen<br />
schwebende Engel – war nicht mehr nur eine Dekoration,<br />
ein abschließendes Ornament, plötzlich wurde sie zu einem<br />
Objekt der Begierde, zum Gegenstand lüsterner Blicke und<br />
Seufzer. Sie war Mutter und Geliebte, Heilige und Hure. Sie<br />
schaute in ihre Gesichter, martialischen Mienen, die doch<br />
nicht für sie, sondern für den Feind bestimmt waren. Jacob<br />
wusste, dass er sich etwas näherte. Noch konnte er es nicht<br />
berühren, doch er näherte sich jenem Bereich, jenem Ort, an<br />
dem die Fantasie eins wurde mit dem, was unter seiner Hand<br />
auf der Leinwand entstand.<br />
Er ging zu seinem Sohn, nahm ihn bei der Hand und führte<br />
ihn zu dem Gemälde. Er stellte sich hinter ihn und wartete<br />
auf seine Reaktion. Der junge Jacob besah sich lange die Veränderungen.<br />
Als er sein Schweigen schließlich brach, klang<br />
das, was er sagte, wie ein Seufzer der Erleichterung.<br />
– Ich wollte es dir gegenüber zuvor nicht erwähnen – sagte<br />
sein Sohn ohne sich umzudrehen, ohne ihm in die Augen<br />
zu schauen. – Ich habe gesehen, wie du dich gequält hast.<br />
Ich hoffte, glaubte fest daran, dass du eine Methode finden<br />
würdest... Vielleicht habe ich heute als Einziger hier gewusst,<br />
dass kein Lob in der Lage sein würde, dich zu täuschen. Mir<br />
scheint, die nächsten beiden Bilder werden dir keine Schwierigkeiten<br />
mehr bereiten. Ich möchte nur wissen, was die anderen<br />
zu den Änderungen sagen werden.<br />
Aus dem Polnischen von Heinz Rosenau<br />
Wydawnictwo Dolnośląskie<br />
Wrocław 2007<br />
160 × 230 • 270 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 83-7384-603-6<br />
Translation rights:<br />
Wacław Holewiński<br />
Contact:<br />
Wydawnictwo Dolnośląskie<br />
Wacław Holewiński Der Weg nach Putte<br />
69<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Lidia Amejko Viten der Heiligen der Siedlung<br />
70<br />
Photo: Danae Ribbitsch<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Lidia Amejko trägt in ihrem Buch Antworten auf die Frage zusammen:<br />
Wie erklärt man sich die programmatische Tatenlosigkeit<br />
der Bewohner einer großstädtischen Plattenbausiedlung? Vor<br />
allem derer, die keinen Schritt aus der Schlafzimmer-Vorstadt<br />
tun – der Säufer, die sich um den einzigen Laden in der Siedlung<br />
herumdrücken, der Hausfrauen, die wie angenagelt an den<br />
Fenstern und den Fernsehern hängen, und der Rentner, die aus<br />
dem von Arbeit erfüllten Lebensrhythmus herausgefallen sind.<br />
Ihre täglichen Rituale sind leicht zu beobachten, aber was geht<br />
in ihrer Seele vor? Worüber debattieren sie, wie nehmen sie ihre<br />
Existenz und ihren Platz im göttlichen Heilsplan wahr – sofern sie<br />
sich einen solchen überhaupt zuschreiben? Indem die Autorin<br />
diese Menschen zur Aktivität, nämlich zur Selbstreflexion zwingt,<br />
gewinnt sie dem scheinbaren Marasmus einen philosophischen<br />
Sinn ab.<br />
Nicht auf ein Lob des kleinen Realismus, nicht auf ein Lob der<br />
Armen im Geiste will Amejko hinaus. Die surrealen Betätigungen<br />
und die metaphysische Reflexion, die<br />
die einzelnen „Heiligen“ beschäftigt,<br />
sind pure Erfindung. Sie hat etwas<br />
Komisches. Komisch ist, wie das,<br />
was nicht nur scheinbar nutzlos und gedankenlos ist, zum Erhabenen<br />
wird. Amejko schöpft aus der Bibel, aus der Geschichte<br />
der Philosophie, der Kunst und der Literatur, und zugleich<br />
übersetzt sie diese zur Hochkultur gehörenden Elemente in eine<br />
Art biblia pauperum. Sie paßt sie so an, daß sie zum selbstverständlichen<br />
Bestandteil einer plebejischen Erzählung werden. An<br />
dieser sind die Viten der Heiligen der Siedlung sprachstilistisch<br />
ausgerichtet.<br />
Sowohl die Stilisierung als auch der Rückgriff auf hochkulturelle<br />
Bezüge sind hier mit meisterhafter Konsequenz ausgeführt.<br />
Fremde, übergestülpte Ornamente springen natürlich ins Auge,<br />
sind aber gleichzeitig so vollkommen in die Erzählung eingeschmolzen,<br />
als gehörten sie zu ihr. Durch die Integration des<br />
Widerspruchs erreicht Lidia Amejko ein Ergebnis, das von Anhängern<br />
des Realismus oder Reportage-Autoren mit anderen<br />
Mitteln erreicht wird – das, was einem weniger sensiblen Beobachter<br />
trivial und nicht beachtenswert erscheinen könnte,<br />
wird von ihr geadelt.<br />
Marta Mizuro<br />
Lidia Amejko (geb. 1955), Schriftstellerin<br />
und Dramatikerin. Ihre Stücke wurden in mehrere<br />
Sprachen übersetzt.<br />
Lidia Amejko Viten der Heiligen der Siedlung<br />
71<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Lidia Amejko Viten der Heiligen der Siedlung<br />
72<br />
Dazu<br />
sage ich euch: Kyrill starb täglich aus<br />
Angst vor dem Tod!<br />
„Was soll denn das?!“ ruft ihr. „Jeder<br />
hat doch Angst vor dem Tod (solange er nicht getrunken<br />
hat), aber aus Angst wird man kein Heiliger! (Allein aus<br />
großem Mut, wovon dann den Kindern in Religion erzählt<br />
wird). Wieso sollen wir einen feigen Waschlappen zu den<br />
Heiligen zählen?“<br />
„Haltet einen Moment die Klappe, verdammich, und<br />
hört zu!“<br />
Es fiel Kyrill nicht leicht, aus Angst vor dem Sterben zu<br />
sterben, und so kam er eines Tages auf die Idee, sich vielleicht<br />
ein bißchen mit dem Tod vertraut zu machen und zu<br />
sterben, aber nur ein ganz klein bißchen, eine Prise auf der<br />
Fingerspitze, versuchsweise. Um zu sehen, ob es wirklich so<br />
schrecklich ist.<br />
Er legte sich aufs Sofa und drückte auf die Fernbedienung,<br />
um sich nicht während seines Sterbens zu verzetteln, denn es<br />
ist bekanntlich blöde, mit einem Auge zu sterben und mit<br />
dem anderen in die Röhre zu glotzen. (Das ist, Mann, die<br />
bewegendste Frage in der Siedlung: wie man sein endgültiges<br />
ENDE mit der Serie abstimmt, die sich bis in alle EWIG-<br />
KEIT hinzieht.)<br />
Kyrill drückte also, der Bildschirm wurde blaugrau, wie<br />
eine Leiche, in der Mitte glühte noch für einen Moment das<br />
helle Pünktchen wie eine Seele, und dann ging mit einem<br />
leisen Klick der Fernseher aus.<br />
Kyrill machte also die Augen zu und starb.<br />
So schlimm war es gar nicht!<br />
Am nächsten Tag wachte er zufrieden auf und schaute<br />
voller Freude in die Welt – wie bekanntlich ein jeder nach<br />
dem Tod! Er briet er sich ein Rührei mit Speck und sang<br />
dabei fröhlich vor sich hin, aber gegen Abend beschlich ihn<br />
die Furcht, daß er bei seinem Sterben etwas vergessen haben<br />
könnte, daß es irgendwie zu reibungslos gelaufen war, daß er<br />
es auf alle Fälle noch einmal nachprüfen sollte!<br />
So starb er am zweiten Tag.<br />
Am dritten Tag aß er sich satt, aber am Abend wurde er<br />
wieder unruhig und kreiste wie ein Hündchen, das Gassi gehen<br />
muß. Er wußte inzwischen, daß er nicht auf den Film<br />
nach der Tagesschau warten würde, sondern der Ewigkeit, die<br />
ihn in Schrecken versetzt, erneut ins Auge schauen wollte.<br />
Und so ging es von nun an Tag für Tag.<br />
Kyrill starb, dann stand er wieder auf von den Toten und<br />
machte sich das Frühstück.<br />
Anfangs war er sogar glücklich, aber bald kam es ihm blöde<br />
vor, daß er eigensüchtig vor sich hin starb, nur für sich<br />
allein, ohne an die anderen zu denken. Denn wenn ihm dieses<br />
Sterben schon so gut von der Hand ging, warum sollte er<br />
dann nicht für einen anderen sterben, der nicht eine solche<br />
Übung darin hatte wie er?<br />
Er hängte im Laden eine Bekanntmachung aus: „Sterbe<br />
kostenlos. Bestellungen unter Telefon 3452861, Kyrill<br />
Damasceński.“<br />
Als erste rief Frau Hapiór an, ob er nicht für sie sterben<br />
wollte, sie hätte vor den Feiertagen so viel zu tun und wüßte<br />
gar nicht, wo sie anfangen soll, und mit dem Tod, da könnte<br />
sie sich nicht mehr entsprechend vorbereiten. Sie würde zu<br />
einem späteren Termin sterben, wenn sie mehr freie Zeit hätte.<br />
Und für Kyrill würde sie einen Käsekuchen backen.<br />
Dann rief Herr Kruczek an, der während der Besatzung<br />
hundertmal um ein Haar getötet worden wäre und den Tod<br />
ganz und gar nicht fürchtete; jetzt aber brauchte er nur an<br />
ihn zu denken, und schon würde er blaß, weichlich und zittrig<br />
und müßte pausenlos weinen. Gar nicht mannhaft. Janina<br />
O., Dienerin des Saums, hätte ihm zwar den Übergang<br />
zum Nichts hübsch umsäumt, und Herr Kruczek würde<br />
auch Nacht für Nacht in dieses Loch gaffen, aber irgendwie<br />
hätte er Angst, ins Jenseits hinüberzukriechen. Ob Kyrill also<br />
nicht, als Nachbar, für ihn sterben wollte – als Dank dafür<br />
würde Herr Kruczek ihm den Abfluß reparieren.<br />
Verschiedene Leute wandten sich an ihn.<br />
Einer, der zu ihm kam, war gerade auf Entzug, wollte<br />
ein neues Leben beginnen und hatte keine Lust, dabei zu<br />
sterben; ein anderer wollte bei der Hochzeit seiner Tochter<br />
dabeisein, und wieder andere hatten sich einen billigen Auslandsurlaub<br />
gekauft, als sich plötzlich herausstellte, daß für<br />
sie selbst die last minute gekommen war!<br />
Kyrill war glücklich, weil er jetzt für andere starb!<br />
Und es ging ihm gut, denn jeder bedankte sich bei ihm mit<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
einem Geschenk. (Was sagt ihr nun? Kommt ihr euch nicht<br />
dumm vor, daß ihr übel über ihn hergezogen seid? Zeigt mir<br />
einen Heiligen, der für so viele sein Leben geopfert hätte wie<br />
Kyrill!)<br />
Nur im Himmel stieß die Sache auf Mißfallen.<br />
Bei einer Kontrolle stellte sich ein Fehlbetrag heraus: In der<br />
Siedlung sterben Leute, gut, aber Oben kommt keiner an!<br />
In der Rubrik „Tod“ ist bei Frau Hapiór ein Vogel vermerkt,<br />
während sie selbst durch die Siedlung geistert, als<br />
wenn nichts wäre, und für die Leute auch noch Käsekuchen<br />
backt!<br />
„Was ist denn das?“ entrüstete sich der Herr. „Das ist<br />
mir von Anbeginn der Welt noch nicht vorgekommen. Ich<br />
weiß, ich weiß, die Menschen sind durchtrieben und haben<br />
den Tod seit jeher betrügen wollen! Was sie sich nicht alles<br />
ausgedacht haben: Betten haben sie umgedreht, mit dem<br />
Vorderteil zum Fenster, und Namen haben sie vertauscht.<br />
Einer, Nondum, hätte es fast geschafft: er war dermaßen<br />
leer, daß zum Sterben gar nichts da war, und daher mußte<br />
Psychopompa zu ihm geschickt werden, um ihn zunächst<br />
mit sinnlichem Leben auszustopfen und ihn anschließend<br />
auf die andere Seite zu schubsen. Und dann war da noch<br />
dieser Schlauberger Farrago! Er hat mich dermaßen angekohlt,<br />
daß ich ihn wieder vom Himmel zur Erde zurückgeschickt<br />
habe.“<br />
Der Engel Buchhalter flog in die Siedlung hinunter, um<br />
der Sache auf den Grund zu gehen. Bei Jericho machte er<br />
Station, trank ein Bier, schwätzte mit den Leuten und fühlte<br />
sich gleich wie zu Hause.<br />
Zu Kyrill begab er sich mit provokativer Absicht: ob Kyrill<br />
nicht für ihn sterben wolle. Kyrill war einverstanden, nahm<br />
die Knete, für den Engel wollte er sterben. Aber dann ging<br />
es nicht weiter.<br />
Kyrill traten nur die Augen aus den Höhlen, er röchelte,<br />
rasselte, der Tod war ihm mittendrin ins Stocken geraten,<br />
steckte ihm wie eine Gräte im Hals – es ging weder vor noch<br />
zurück. Derweil legte der Engel ihm Fesseln an und brachte<br />
ihn vor das Gericht Gottes.<br />
So endeten die guten Zeiten in der Siedlung, als die Leute<br />
überhaupt nicht starben.<br />
Der Herr in seiner Barmherzigkeit sah sogar von einer Bestrafung<br />
Kyrills ab und befahl ihm lediglich, die Seelen zurückzugeben,<br />
damit die Bücher im Himmel stimmten.<br />
Aus dem Polnischen von Friedrich Griese<br />
W.A.B.<br />
Warsaw 2007<br />
123 × 195 • 232 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 978-83-7414-340-0<br />
Translation rights: W.A.B.<br />
Lidia Amejko Viten der Heiligen der Siedlung<br />
73<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Adam Zagajewski Der Dichter spricht mit dem Philosophen<br />
74<br />
Photo: Danuta Węgiel<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ein neuer Essayband Adam Zagajewskis über die Natur des<br />
Schreibens, das Verhältnis der Literatur zu Philosophie und<br />
Geschichte, über sich und andere, über Miłosz und Herbert,<br />
Gombrowicz und Cioran, Márai und Kertész. Der Titel des<br />
Bandes – Der Dichter spricht mit dem Philosophen – entstammt<br />
einem Text über den Briefwechsel zwischen Zbigniew Herbert<br />
und Henryk Elzenberg. „Ein ausgezeichneter Titel für das<br />
ganze Buch“, schreibt eine begeisterte Rezensentin, „denn die<br />
Aura des Gesprächs erfüllt alle hier versammelten Texte. Sie<br />
sind Rechenschaftsberichte über Lektüren und Reflexionen,<br />
Niederschrift der Verblüffung, des Staunens. Gesprächsanlass<br />
sind Betrachtungen über das Schreiben, vor allem aber über die<br />
Poesie“. Zagajewski interessiert die Poesie, die „den Katastrophen<br />
zum Trotz registrierte und damit den Fortbestand unseres<br />
geistigen Lebens aufrechterhielt, mitgestaltete, mitschuf – jener<br />
unausgesetzten, von vergangenen Generationen ererbten Kontemplation,<br />
die in der Erfahrung des<br />
Schönen und Bösen kulminiert, der<br />
Zeit und des Guten, der Transzendenz<br />
oder – für andere – des Nichts,<br />
der Meditation, etwas in Art einer<br />
permanenten Nachtwache in der Notaufnahme, ohne die das<br />
Menschentum in der uns bislang bekannten Form ernsten Schaden<br />
nähme“.<br />
„Ich weiß nicht, wie der Platz überschrieben werden wird, den<br />
Adam Zagajewski letztlich in der polnischen Kultur einnehmen<br />
wird“, schreibt Irena Grudzińska-Gross. „Er passt unter keine<br />
Formel, obwohl er als Dichter und Schriftsteller in der unmittelbaren<br />
Mitte der polnischen und europäischen Literaturtradition<br />
steht. Vielsprachig, hochgebildet schreibt er in seinen Gedichten<br />
über Musik und Philosophie, über andere Dichter, Architektur<br />
und Kunst. Dennoch ist das keine klassische Dichtung, die vom<br />
heutigen Tag losgerissen wäre; ganz im Gegenteil, sie berührt<br />
das Alltägliche, die Menschen greifen in Augenblicken der Angst<br />
nach ihr. Sie bringt Linderung, von dieser Poesie sprach Susan<br />
Sontag, obwohl sie keine Trostdichtung ist. Der Dichter Zagajewski<br />
trägt keinen Zorn, keine Besessenheit in sich, er ist jedoch<br />
entschieden und unbeugsam. Ihn zu lesen ist kein Kampf,<br />
sondern eine Art Gespräch, das abhängig macht.“<br />
Adam Zagajewski (geb. 1945), Dichter,<br />
Erzähler, Essayist, Preisträger renommierter<br />
Literaturpreise, in zahlreiche Sprachen übersetzt.<br />
Adam Zagajewski Der Dichter spricht mit dem Philosophen<br />
75<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Adam Zagajewski Der Dichter spricht mit dem Philosophen<br />
76<br />
Auf<br />
dem Computer schreiben. Ändert das etwas?<br />
Mit einem Gänsekiel schreiben, einem<br />
kostbaren Füllfederhalter, einem Bleistift...<br />
Die ersten Schreibmaschinen: riesige, schwarze Dinosaurier,<br />
mit goldenen Schriftzügen verziert, heute Schmuck von Restaurants<br />
und Bankräumlichkeiten. Meine Entdeckung der<br />
Schreibmaschine: Mein Vater, Ingenieur und Professor am<br />
Politechnikum, benutzte diese Maschine häufig. Bisweilen<br />
bat er, wenn er ein wissenschaftliches Buch (zu technischen<br />
Fragestellungen) oder ein Lehrbuch für den Druck vorbereitete,<br />
Mama um Hilfe, die den für sie völlig unverständlichen<br />
Text mühselig abtippte. Ich sah ihr dann gerne zu — mit<br />
Brille, voller Konzentration, war sie jemand völlig anderes<br />
als normalerweise. Aber die mathematischen Formeln, die<br />
kompliziert waren wie ein Genomnotat, fügte Vater selbst<br />
mit dem Bleistift ein.<br />
Die Entdeckung der Schreibmaschine meines Vaters war<br />
für mich etwas Epochales. Vater erlaubte, dass ich von Zeit<br />
zu Zeit auf seiner Maschine das Schreiben übte. Anfänglich<br />
gelang mir das nur sehr holprig, ich benutzte nur einen Finger,<br />
dann zwei. Oft verhakten sich die Typenhebel ineinander,<br />
blockierten sich, ich musste sie dann aus diesen kleinen<br />
Katastrophen befreien. Trotzdem erschien mir die Schreibmaschine<br />
als eine außergewöhnliche technische Errungenschaft:<br />
der Schlitten, die Zahnräder, vor allem aber die Walze,<br />
die eine schwarze, glatte Substanz überzog, deren Wesen weiche<br />
Passivität war, das Entgegennehmen der Typenschläge,<br />
die Walze, die sich gehorsam drehte und das eingespannte<br />
Blatt Papier zum selben Gehorsam zwang — all das weckte<br />
meine höchste Bewunderung. Das hatte die Menschheit<br />
im Zuge der mechanischen Erfindungen erreicht, die sich<br />
allmählich im Laufe der Jahrhunderte angesammelt hatten.<br />
Und endlich entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts diese<br />
fantastische Maschine. Das trockene Knallen der Typen gegen<br />
die Walze gehört zu den edlen und rhythmisierten Lauten.<br />
Bis heute bin ich eigentlich davon überzeugt, obwohl<br />
dem Anschein nach nichts diese Überzeugung stützt, dass<br />
die Schreibmaschine eine komplexere Apparatur ist als der<br />
Computer. Ihr tadelloses Benehmen... Der Klingelton, wenn<br />
man zum Blattrand gelangt — als führe man Schlitten, im<br />
Winter. Der chromblitzende Schreibmaschinenschllitten...<br />
Der leichte Duft von Maschinenöl... Nur eines störte mich:<br />
die Notwendigkeit unablässigen Reinigens der Typen, auf<br />
denen sich der Staub sammelte, der sich auf das schwarze<br />
Farbband gelegt hatte.<br />
Als ich die Kunst des Maschineschreibens mehr oder weniger<br />
beherrschte, machte ich die nächste Entdeckung: Vor<br />
mir lag nicht mehr die blutarme Schlangenlinie meiner ungeschickten<br />
Handschrift, sondern nur gleichmäßige, runde<br />
oder spitze Buchstaben in einer idealen Reihe, die einander<br />
nicht auf die Fußzehen traten, immer denselben Abstand<br />
zueinander einhielten wie die Ehrenkompanie eines kleinen<br />
Landes. Diese Lettern, die ich alle liebte, waren ein Meisterwerk<br />
der Grafik; das war schon fast ein Buch, ein Druck. Auf<br />
diese Weise schlug die Schreibmaschine die Brücke zwischen<br />
Seele und äußerer Welt, zwischen Privatestem und Öffentlichem,<br />
und das blitzartig, sofort, ohne die Vermittlung von<br />
Lektoren, Verlagen, Literaturagenten.<br />
Baut der Computer auch eine ähnliche Brücke? Ja, natürlich.<br />
Am Anfang aber irritierte mich die Lautlosigkeit des<br />
Computers. Die Nachtarbeiter segneten sie, einer meiner<br />
Freunde musste schon vor vielen Jahren auf die Arbeit mit<br />
dem Computer ausweichen, weil seine Nachbarn in einem<br />
Pariser Wohnhaus gegen den nächtlichen Lärm protestierten.<br />
Sie konnten nicht schlafen.<br />
Das Hämmern der Schreibmaschine tat der gesamten Umgebung<br />
kund, dass hier Wichtiges geschah: dass hier Energie<br />
unseres geistigen Lebens freigesetzt wurde und sich auf<br />
weißem Papier materialisierte. Die Kanonade der Typen, die<br />
aufs Papier hämmerten, waren Triumphsalven; die Geburt<br />
eines neuen Satzes (denn oft schrieb ich direkt in die Maschine,<br />
sogar Gedichte – nur ihre ersten Fassungen notierte<br />
ich mit einem Füller, einem Bleistift oder einem Kugelschreiber)<br />
begleiteten Schüsse, fast schon Feuerwerke. Jetzt gehe<br />
ich, wenn ich den Computer gebrauche, fast immer gleich<br />
vor: Die ersten Fassungen eines Gedichts entstehen im Notizbuch<br />
oder auf einem Blatt Papier, erst dann überführe ich<br />
sie auf den Bildschirm. Und der Computer schweigt mit der<br />
ihm eigenen Diskretion, oder er schweigt fast. Wir hören<br />
das sanfte Klackern der Tastatur, aber gewöhnlich nur dann,<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
wenn es um einen anderen geht. In der Bibliothek oder einem<br />
ruhigen Café (wenn es ruhige Cafés noch gibt) wird uns<br />
das Morsealphabet einer fremden, nicht unserer eigenen Tastatur<br />
stören. Die eigene stört uns nie. Da wir früher nichts<br />
gegen die Marschmusik einer Remington oder Olivetti einzuwenden<br />
hatten...<br />
Ändert das etwas? Ändert sich etwas an der Natur des<br />
Schreibens dadurch, dass wir anstelle des Gänsekiels den<br />
Computer verwenden? Für jemanden, dessen Jugendliebe<br />
der Schreibmaschine galt, ändert das mit Sicherheit bedeutend<br />
weniger als für alle diejenigen, die nur mit der Feder<br />
begannen, mit dem handschriftlichen Schreiben. Im allgemeinen<br />
ist man der Ansicht, dass die Erfindung des Computers<br />
für die Literatur eine nicht allzu glückliche Vergrößerung<br />
der Produktion bedeute, eine Vielwörterei, eine übermäßige<br />
Leichtigkeit des Schaffens. Die stummen Tage oder Wochen,<br />
in denen es mir nicht gelingt zu schreiben, sind heute genauso<br />
stumm, wenn mein Laptop auf mich wartet, wie sie früher<br />
stumm waren, als eine Schreibmaschine auf dem Schreibtisch<br />
stand und neben ihr Feder, Kugelschreiber, Bleistift<br />
und Notizbuch lagen. Die guten oder vollkommenen Tage<br />
sind nicht noch großartiger geworden. Die mittleren Tage<br />
sind genauso durchschnittlich wie in früheren Jahren. Es hat<br />
sich nicht viel verändert.<br />
Der menschliche Geist, unsichtbar, fragil und zugleich<br />
unbesiegbar, muss mit verschiedenen Materialien und Techniken<br />
arbeiten und kommt mit ihrer unablässigen Weiterentwicklung<br />
hervorragend zurecht. Da er auch mit unserem<br />
so fehleranfälligen Körper zurechtkommt, mit den Fingern,<br />
Alter und Krankheit, Rheuma und Neurose, da er abends<br />
einschläft und morgens erwacht und im Traum werweißwohin<br />
reist — was sollte er den Computer fürchten?<br />
Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier<br />
Zeszyty Literackie<br />
Warsaw 2007<br />
210 × 135 • 145 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-60046-85-2<br />
Translation rights:<br />
Adam Zagajewski<br />
Contact: Zeszyty Literackie<br />
Adam Zagajewski Der Dichter spricht mit dem Philosophen<br />
77<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Marek Bieńczyk Durchsichtigkeit<br />
78<br />
Photo: Elżbieta Lempp<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Was verbindet die Poesie und Architektur mit den Herrschaftskonzepten<br />
der letzten beiden Jahrhunderte? Marek Bieńczyks<br />
Antwortet lautet: die Idee der Durchsichtigkeit. Die zweihundertjährige<br />
Geschichte der Moderne, die Bieńczyk rekapituliert<br />
und von der er Abschied nimmt, bezog ihre Dynamik aus dem<br />
Projekt, die Welt sichtbar zu machen. Es begann mit Jean-Jacques<br />
Rousseau, der in seinen Schriften die Idee der Durchsichtigkeit<br />
als Ideal zwischenmenschlicher Beziehungen vertieft<br />
und erweitert. Jeremy Bentham ging in die entgegengesetzte<br />
Richtung – sein Ausgangspunkt war das Konstruieren von zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen. Das 19. Jahrhundert und die<br />
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts entschieden sich für Bentham.<br />
Die gesellschaftlichen Institutionen strebten danach, das Leben<br />
transparent zu machen. Nach den totalitären Systemen kam es<br />
zu einer Abkehr von der Durchsichtigkeit als Vorstellung, die die<br />
Beziehungen zwischen Herrschaft und Gesellschaft prägt. Aber<br />
die Ideologie der Transparenz überlebte...<br />
Woher kommt nach dem<br />
Ende der Moderne die Durchsichtigkeit<br />
– die doch ein Kind der Moderne<br />
ist? Die Antwort auf diese Frage ist eines der interessantesten<br />
Themen des Buches. Bieńczyk vertritt die Ansicht, dass<br />
die Durchsichtigkeit – die zur einzigen allgemein anerkannten<br />
Ideologie aufgestiegen ist – ein unrechtmäßiges Erbe der Moderne<br />
ist. Die Modernisierung versuchte nämlich, Bedingungen<br />
zur vollständigen gesellschaftlichen Kontrolle zu erarbeiten,<br />
und zwar mittels einer perfekten Organisation. Dagegen ist die<br />
heutige Durchsichtigkeit ein merkwürdiges Schutzschild gegen<br />
die Unvollkommenheit unserer Institutionen. Aber Marek<br />
Bieńczyk beschränkt sich nicht darauf, vom Wandel des politischen<br />
Denkens zu berichten. In seinem Buch skizziert er auch<br />
die Geschichte der Durchsichtigkeit in der europäischen Poesie<br />
und Architektur und erzählt von der Bedeutung dieser Idee in<br />
Konzepten des öffentlichen Raums. Und noch eines: Bieńczyks<br />
Buch ist ein existentieller Essay; das heißt in seinem Schreiben<br />
sind die eigenen Erlebnisse ein Element der Erzählung und Argumente<br />
der Ausführungen.<br />
Przemysław Czapliński<br />
Marek Bieńczyk (geb. 1956), Prosaschriftsteller,<br />
Essayist, Literaturhistoriker, Übersetzer aus dem<br />
Französischen.<br />
Marek Bieńczyk Durchsichtigkeit<br />
79<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Marek Bieńczyk Durchsichtigkeit<br />
80<br />
Über<br />
die Durchsichtigkeit und Durchschaubarkeit<br />
wollte ich schon seit vielen<br />
Jahren wenigstens ein paar Seiten<br />
schreiben. Die Durchsichtigkeit, sagte ich mir, ruft mich,<br />
bohrt in mir wie eine Sonde, ist mein Thema. In fremden<br />
Städten wählte ich zum Mittagessen Restaurants mit Panoramafenstern,<br />
abends blieb ich vor beleuchteten Schaufenstern<br />
stehen, die Freunde begannen sich über mich lustig<br />
zu machen und mir Glaskugeln zu schenken, es entstand<br />
eine ordentliche Sammlung. Ich hatte einen Glastick, ich<br />
betrat Zoohandlungen, um in die Aquarien zu starren, ich<br />
kehrte zu den Museen zurück, in denen Exponate (in Bozen<br />
dieser seltsame Ötzi, ein eingefrorener Schneemensch,<br />
Urahn, der mit einem Köcher voller Pfeile im Gletscher aufgefunden<br />
wurde) hinter Panzerglas ausgestellt wurden; ich<br />
zog es vor, Lenin und Mao Tse-tung in ihren gläsernen Särgen<br />
zu vergessen. Arbeitete ich an irgendeinem Text, dünnte<br />
ich unwillkürlich dessen konkreten Gehalt aus, die Wörter<br />
mieden die Bedeutungen, den Metaphern gingen die Ideen<br />
verloren, alles bewegte sich unvermeidlich auf die Abstraktion<br />
zu, hinter den Sätzen schimmerte das Weiß hervor. Es<br />
klingt lächerlich, aber ich mochte klare Suppen, Essen mit<br />
Gelatine, Fisch oder Fleisch in Sülze, in Aspik, und ähnliche<br />
Speisen. In der Wohnung hängte ich Reproduktionen der<br />
Gemälde Edward Hoppers auf, sie glänzten hinter Glas wie<br />
zu kitschige Heiligenbildchen.<br />
Ich mochte Hopper, so wie andere Erinnerungen mögen.<br />
Ich hatte das einst erlebt, so war es schon einmal gewesen;<br />
in Fantasien und Gedichten wurde ich der Held verschiedener<br />
Bilder, der Typ in der Glasveranda, der in den endlosen<br />
Horizont starrt, jener Cafébesucher, der aus dem Fenster auf<br />
die leere Straße schaut. Manchmal zog ich Olga in diese Fantasien<br />
mit hinein; wenn ich ihr davon erzählte, wurde sie<br />
ärgerlich, also verstummte ich schnell. Natürlich (stellte ich<br />
mir vor) waren wir vor allem Nighthawks, Nachthabichte,<br />
Vögel der Dunkelheit, Nachtschwärmer und Nachtfalter,<br />
wenn wir in verglasten Bars saßen, die sich um Mitternacht<br />
wie die Nester nach dem Frühling leerten; wir nippten an<br />
unseren Drinks mit amerikanischen Namen, Bronx, Manhattan,<br />
und beim letzten Whisky waren wir schon alleine,<br />
versunken in die feierliche Stille nach dem Leben, das ausgeflogen<br />
war. Sie füllte uns aus wie Helium; wir schwebten<br />
leicht über der Erde, über uns selbst, geflügelte Wächter des<br />
Planeten, dessen Emissäre in der kosmischen Nacht. Wir<br />
fühlten uns frei und obdachlos; unsere Gemeinschaft, Olgas<br />
und meine, konnte irgendwo über der Stadt fortbestehen<br />
und musste nicht in ihren Mauern sterben, sondern war verurteilt<br />
zum ziellosen Umherirren durch die Himmelsalleen,<br />
über die Felder an der Weichsel, durch die Stadtteilparks,<br />
wo auch immer. Nighthawks, das berühmteste Bild von Edward<br />
Hopper, tauchte immer häufiger auf Buchumschlägen,<br />
Ansichtskarten, ja sogar auf Werbetüten auf, von denen James<br />
Dean und Marlon Brando, manchmal Marilyn Monroe<br />
– deren Köpfe die anonymen Gesichtszüge der Barbesucher<br />
ersetzten – stumpf in ihre eigene Einsamkeit starrten. Das<br />
verunsicherte und irritierte mich etwas, meine Vorstellung,<br />
die Lieblingsfotografie von uns selbst, derart banal vervielfältigt<br />
und auf glänzende Laminatteilchen verteilt, mein<br />
Wunschtraum gemeinsam mit dem Plattencover von der Abbey<br />
Road oder dem Bild vom Bau des Chrysler Towers in ein<br />
Gelini Puzzle verwandelt, das in jedem Warenhaus erhältlich<br />
ist, in Erzählungen überschrieben, die aus dem Bild Hoppers<br />
wachsen wie Pilze aus dem Erdboden. Davon gab es viel,<br />
etwas zu viel, zu oft erschien „mein“ Bild auf Umschlägen<br />
von Büchern und Deckblättern von Kalendern, kostenlos<br />
Zeitschriften beigefügt, die man ohnedies nicht mehr kaufen<br />
wollte, jedoch fand ich mich auch mit dieser allgemeinen<br />
Begeisterung ab; da es sie nun einmal gab, da sich in ihr eine<br />
unausgesprochene Sehnsucht der Menschen regte, da sie von<br />
einer ihnen gemeinsamen Matrize von Wünschen zeugte, gewann<br />
sie an Gewicht. Wenn auch banalisiert und stereotyp,<br />
erzählte sie von einem Wunsch, der wie der Hunger jeden<br />
befallen kann. Ich existierte also (stellte ich mir vor), um die<br />
Verantwortung für ihn zu übernehmen, ihn zu durchleuchten<br />
im Namen aller bei einem Schnapsgläschen, bei Gläsern<br />
mit klirrenden Eiswürfeln an Juliabenden, bei einem Glas<br />
Grog (was zum Teufel ist Grog?), wenn der Frost auf den<br />
Fenstern den Dampf überwältigte, ihn aus den Mündern<br />
der Passanten ausstieß wie den Weißen Rauch für eine neue<br />
Winterreligion.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ich kannte die Deklamationen der anderen. So viele bebende<br />
Stimmen, die versuchten, Hoppers Bild auf den schmalen<br />
Schultern der Gedichte zu tragen, sein zerbrechliches Kügelchen<br />
über sie zu rollen. Sie zerschmolzen in den Halbschatten<br />
dieser Nacht, verklangen schnell, wobei sie einzelne<br />
Wörter wie Blickspuren zurückließen. „Der billige Duft der<br />
Gardenien“, den Sue Standing am Hals der Frau im roten<br />
Kleid herausgerochen hatte; „Patrone des Lebens“ sah Samuel<br />
Yellen in den drei Besuchern; die Nachricht über einen<br />
weiteren Sieg der Alliierten, die Ira Sadoff im Radio, das auf<br />
dem Bild nicht zu sehen ist, hörte; Fetzen von Gesprächen<br />
an der Bar über den Krieg, Hemingway und Fitzgerald, die<br />
Susan Ludwigson aufgeschnappt hatte, als sie ihr Gedicht<br />
schrieb mit der für die amerikanische Poesie charakteristischen<br />
Aufzählung alltäglicher Details, der kalt werdende<br />
Kaffee, die vier Salzstreuer auf der Theke, das sicherlich in<br />
der Nähe geparkte Auto, ach, und schließlich, dort, an dieser<br />
Bar, das sind ihre Eltern, jetzt streiten sie sich über den American<br />
Dream... Alle diese Gedichte, und mehr, ganze Romane<br />
(französische, englische) entsprangen den Nighthawks,<br />
wurden auf deren Flügeln in die Höhe getragen, waren auf<br />
rührende Weise nebensächlich wie die Erde vom Mond aus<br />
gesehen; jemand sah aus ihrem Inneren auf das Café Phillies,<br />
auf dessen durchsichtigen Körper und versuchte, sich<br />
den Anblick einzuprägen; nach irgendetwas sagte er etwas,<br />
flüsterte etwas, erzählte sein eigenes kleines Leben, seinen<br />
Nachtfaltertanz vor dem gelben Licht des Inneren. Er schaute;<br />
das Licht hinter der Glasscheibe, die sanfte Medusa, fesselte<br />
den Blick, brachte einen um die Augen, so wie man um<br />
den Verstand gebracht werden kann; die Scheibe trennte die<br />
Wörter vom Ich, sie fielen auf dieser Seite ab und verschwanden<br />
in der Dunkelheit.<br />
Aus dem Polnischen von Andreas Volk<br />
Znak<br />
Cracow 2007<br />
124 × 195 • 260 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-240-0838-4<br />
Translation rights: Znak<br />
Marek Bieńczyk Durchsichtigkeit<br />
81<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Agnieszka Taborska Verschwörer der Phantasie. Der Surrealismus<br />
82<br />
Photo: Marcin Giżycki<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die Essays des Bands Verschwörer der Phantasie bieten<br />
keine aktuelle Synthese des Surrealismus, auch wenn sie sich<br />
diesem Anliegen verdanken. In der Anreicherung um neue Fakten<br />
– sowohl solche zu weniger bekannten oder nach Jahren<br />
wieder neu entdeckten Vertretern der Kunstrichtung wie auch<br />
solche, die den fortwährenden Einfluss des Surrealismus auf<br />
zeitgenössische Künstler, Werbemacher und Designer unter Beweis<br />
stellen.<br />
Über die Geschichte der Kunstrichtung erzählt die Verfasserin<br />
fast en passant anlässlich ausgewählter „Themenkreise“, die zum<br />
Standardrepertoire der Surrealisten gehörten, und bei der Zeichnung<br />
von „Porträts“ ausgewählter Künstler. Die Autorin wählt sie<br />
nicht wie ein objektiver Wissenschaftler aus, der sein Thema<br />
erschöpfend abhandeln möchte, sondern wie eine Kunstbegeisterte,<br />
die die Akzente auf das legt, was sie selbst am Surrealismus<br />
fasziniert. Sie erzählt von ihren persönlichen Kontakten zu<br />
drei Künstlern: Leonora Carrington,<br />
Gisèle Prassinos und Roland Topor.<br />
Schon allein diese Kapitel des Buches<br />
sind von einzigartigem Wert. Die Autorin<br />
begegnete dem Werk der drei auch auf einer anderen Ebene<br />
– als Übersetzerin –, und diese Art intimen Kontakts mit dem<br />
Text spiegelte sich auch in den Verschwörern der Phantasie in<br />
origineller Art und Weise.<br />
Im Teil „Themenkreise“ ist von Fragen wie der Haltung der Surrealisten<br />
zum Selbstmord, zur Liebe und zum Wahnsinn die<br />
Rede, aber auch zum Mythos, zur Stadt und zu alltäglichen Gebrauchsgegenständen.<br />
In jedem Kapitel wechselt die Verfasserin<br />
ungezwungen zwischen den verschiedenen Ausdrucksformen<br />
der Kunst hin und her und führt damit vor, dass innerhalb der surrealen<br />
Bewegung nicht davon die Rede sein konnte, sich auf nur<br />
eine einzige Kunstform zu spezialisieren. Der Surrealismus war<br />
nämlich die erste Kunstrichtung, die komplexen und interdisziplinären<br />
Charakter besaß. Auch in dieser Hinsicht erfordert die<br />
Wahrnehmung aller Realisationsformen und die Erfassung aller<br />
Auswirkungen seiner „Elementarkraft“ vom Kenner der Materie<br />
ein sicheres Bewegen in der Geschichte der Malerei wie auch der<br />
Geschichte von Literatur und Film. Aber auch der Geschichte der<br />
Psychiatrie und der Postkarte. Und genau um eine solch umfassend<br />
gebildete Kennerin handelt es sich bei Agnieszka Taborska.<br />
Marta Mizuro<br />
Agnieszka Taborska (geb. 1961), Schriftstellerin,<br />
Kunsthistorikerin und Übersetzerin.<br />
Agnieszka Taborska Verschwörer der Phantasie. Der Surrealismus<br />
83<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Agnieszka Taborska Verschwörer der Phantasie. Der Surrealismus<br />
84<br />
In<br />
den besten Jahren des Stummfilms drehte Mack<br />
Sennett Hunderte von Komödien in Kurzfilm- und<br />
Spielfilmlänge, deren ewig scheiternde Antihelden<br />
über Abgründen baumelten, bei Verfolgungsjagden im<br />
Auto rasten, wie durch ein Wunder Explosionen unversehrt<br />
entgingen, einander Sahnetorten ins Gesicht warfen. Diese<br />
surrealistische, anarchische, gefährliche Welt, die Zirkus,<br />
Vaudeville, Burleske, Pantomime und Comic entstammt,<br />
regieren das Tempo, unablässige Überraschungen und ungefährliche<br />
Katastrophen. Bei Sennett begannen Charlie<br />
Chaplin, Harold Lloyd, Harry Langdon und Bing Crosby;<br />
die Slapstick-Komödie wurde zum Modegenre des amerikanischen<br />
Kinos der Zwanziger. Von dieser Epoche blieben<br />
Tausende Meter Zelluloid und ein Requisit: die Torte.<br />
Der Belgier Noël Godin alias Georges Le Gloupier, ein<br />
1945 geborener Regisseur, Schriftsteller und Schauspieler<br />
(unter anderem bekannt aus La Vie Sexuelle des Belges<br />
1950-78), ist Liebhaber des Kinos, der surrealistischen Poetik<br />
und der Situationskomik. Berühmtheiten diesseits und<br />
jenseits des Atlantiks zittern vor ihm.<br />
Bereits während seines Studiums übergoss Godin einen<br />
Hochschullehrer, der mit dem portugiesischen Diktator Salazar<br />
kollaborierte, mit einem Glas Kleber. In der von ihm<br />
gegründeten Zeitschrift „Friends of Film“ – in bester Tradition<br />
eine surrealistische Mystifikation – bebilderte er die Artikel<br />
mit Fotos der eigenen Familie. Er meldete beispielsweise,<br />
dass Louis Armstrong – ein einstiger Kannibale – den Film<br />
The Vegetables of Good Will finanziert, in dem Claudia Cardinale<br />
eine riesige Endivie spielt. Oder dass Richard Brooks,<br />
der Regisseur der Katze auf dem heißen Blechdach, eingestanden<br />
habe, seine Filme seien der letzte Dreck. Die Informationen<br />
über eine erfundene blinde Regisseurin aus Thailand,<br />
Vivian Pei, und ihren Film The Lotus Flower Will Never Again<br />
Grow on the Edge of Your Island veranlassten einen gewissen<br />
Spezialisten für asiatischen Film sogar, nach Thailand reisen,<br />
um Vivian Pei persönlich kennenzulernen.<br />
1968 traf Noël Godin einen Professor mit extrem reaktionären<br />
Ansichten mit einer Torte. Seit dieser Zeit tortet<br />
er besonders aufgeblasene Persönlichkeiten aus Kultur und<br />
Politik ein. Sein erstes Opfer wurde Marguerite Duras dafür,<br />
dass sie „Intelligenz und Klugheit dafür benutzt, ihre eigene<br />
Eitelkeit zu füttern“.<br />
Godin agiert nicht allein. Bei den schwierigen Aufgaben<br />
begleiten ihn knapp 30 Personen, die in langen Mänteln an<br />
den Ort des Geschehens kommen, unter denen Torten versteckt<br />
sind. Auch Godin tritt bisweilen selbst in Verkleidung<br />
auf. Die nach traditionellem Rezept angefertigten Backwerke<br />
kauft er in bescheidenen Konditoreien und straft die Offerten<br />
großer, reklamegieriger Firmen mit Nichtachtung.<br />
Die Opfer wählen die Mitglieder der Torten-Internationalen<br />
aus. Jeder Angriff wird sorgfältig vorbereitet, manchmal<br />
mithilfe von „Verrätern“, die die nötigen Angaben machen,<br />
wann und wo zugeschlagen werden kann. Dank eines solchen<br />
Verrats kam es im Februar 1998 in Brüssel zum berühmtesten<br />
Tortenattentat auf den Microsoft-Chef und<br />
reichsten Menschen der Erde Bill Gates. Dreißig lächelnde<br />
Robin Hoods, die zu Dreipersoneneinheiten gruppiert waren,<br />
riefen: „Gloupe! Gloupe!“ und bewarfen ihn, als er aus<br />
seiner Limousine stieg. Trotz fünf Leibwächtern und einer<br />
Eskorte von vier Motorradfahrern erreichten vier Torten ihr<br />
Ziel. Gates erhielt die Strafe für „die Nutzung von Intelligenz<br />
und Phantasie zur Aufrechterhaltung des tristen Status<br />
quo einer unvollkommenen Welt“.<br />
Nicolas Sarkozy wurde während eines Besuchs in Brüssel<br />
viermal getroffen. Mit Sicherheit sind neue Angriffen in<br />
Arbeit. Der bekannte Journalist Alain Beverini bekam seine<br />
Torte vor den Augen von Millionen von Fernsehzuschauern,<br />
als er in Begleitung von dreißig Leibwächtern vor einem Hotel<br />
in Cannes Holly Hunter interviewte (die die Hauptrolle<br />
in Das Piano gespielt hatte).<br />
Am meisten hat es Godin der französische Philosoph und<br />
Fernsehstar, der narzisstische Bernard-Henry Lévy angetan,<br />
der zu seinem Unglück einmal behauptet hat, er wäre der<br />
begabteste Schriftsteller seiner Generation. Dafür wurde er<br />
sieben Mal eingetortet, unter anderem auf der Bühne des Festivals<br />
in Cannes. Seit dieser Zeit bringt immer dann, wenn<br />
sich im Fernsehkabarett die Puppe Lévys zeigt, eine Sahnekaskade<br />
sie zum Schweigen.<br />
Die Torten erzeugen Aggression. Nach dem Angriff in<br />
Cannes trat Lévy nach Godin. Zwei weibliche Mitglieder der<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Torten-Internationalen rettete in letzter Sekunde die Polizei,<br />
als Leibwächter versuchten, ihre Gesichter in Kloschüsseln<br />
zu drücken. Nur Godard bewahrte angesichts des Angriffs<br />
Haltung. Als ihn 1985 in Cannes die Torte traf, leckte er<br />
die Sahne von der Zigarre und lobte die Huldigung an das<br />
Stummfilmkino.<br />
Ganze 95% der Attentate gelingen. Noël Godin hat mehrere<br />
Dutzend Opfer zu verbuchen. Er träumt von Sahnebombardements<br />
aus dem Flugzeug auf das Radrennen Tour<br />
de France und die Fußballweltmeisterschaft.<br />
Seine Art, den Dünkel zu bekämpfen, griffen die Patissiers<br />
Sans Frontières (Zuckerbäcker ohne Grenzen) auf. Zu<br />
ihren zahlreichen Opfern gehört unter anderem Oscar de la<br />
Rent, der in Portland vom Aktivisten des Kampfes gegen die<br />
Pelzindustrie mit einer Tofutorte vermöbelt wurde. Im September<br />
2001 wurde Karl XVI. Gustav, König von Schweden,<br />
Opfer einer Erdbeertorte. Mehrere Monate zuvor erreichten<br />
Apfeltorten den Vizepräsidenten von Białystok Bogusław<br />
Dębski, den Umweltschutzminister Antoni Tokarczuk und<br />
den ehemaligen Vizepremier Leszek Balcerowicz. Im Juni<br />
2004 traf eine Heidelbeertorte in Warschau Lech Kaczyński,<br />
und ein Jahr später – den Vizepräsidenten der Hauptstadt<br />
<strong>Andrzej</strong> Urbański.<br />
Nach dem von einem Mitarbeiter Godins auf den französischen<br />
Kulturminister Philippe Douste-Blazy verübten Tortenattentat<br />
brachte die Regierung den Fall vor Gericht. Der<br />
Attentäter wurde jedoch nach der Erklärung des Anwalts<br />
freigesprochen, Tortenwerfen sei in Belgien Tradition.<br />
Bei einem Tortenattentat helfen Lachen, eine dumme<br />
Miene und ein idiotisches Lied. Besser der bewaffneten Leibgarde<br />
zeigen, dass es nur um eine Torte geht. Die Torte nicht<br />
werfen, sondern aus der Nähe auf dem Gesicht des Opfers<br />
plattdrücken.<br />
Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier<br />
słowo/obraz terytoria<br />
Gdańsk 2007<br />
167 × 215 • 440 pages<br />
paperback<br />
Translation rights:<br />
słowo/obraz terytoria<br />
Agnieszka Taborska Verschwörer der Phantasie. Der Surrealismus<br />
85<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bianka Rolando Italienische Gesprächsbücher<br />
86<br />
Photo: Bianka Rolando<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Für Bianka Rolandos Debüterzählband waren ihre Herkunft<br />
wie ihre Ausbildung von großer Bedeutung. Italienische<br />
Gesprächsbücher ist der Versuch, von einer Identität zu erzählen,<br />
die durch vier Kulturkreise geprägt wird: das Polnische, das Italienische,<br />
die Malerei und die Literatur.<br />
Ins Spiel kommt hier eher Impression als autobiographisches<br />
Erzählen, die Schriftstellerin spricht nämlich nur selten über<br />
sich selbst und sucht dann Zuflucht bei Fakten aus ihrem Leben.<br />
Doch nicht Fakten konstituieren dieses Buch, sondern die<br />
Art, wie Rolando spricht. Wie sie auf ihre Zweisprachigkeit<br />
und ihre Bikulturalität Bezug nimmt und wie sie Wort und Bild<br />
verknüpft. Jeder der elf Texte, die den Erzählband bilden, wurde<br />
durch ein ausgewähltes Meisterwerk der italienischen Malerei<br />
inspiriert und wird von einer graphisch-fotographischen Arbeit<br />
begleitet. Sichtbares und Lesbares<br />
sind hier aufs Engste miteinander<br />
verbunden.<br />
Daraus entstand eine originelle und<br />
eindrucksvolle Mischung. Sie umschließt<br />
eine zeitgenössische Interpretation<br />
der Szenen auf den Bildern und den Versuch, diese<br />
Darstellungen zur heutigen Mentalität in Bezug zu setzen; der<br />
Mentalität derer, die in der Betrachtung des jeweiligen Bildes<br />
ihre eigenen Probleme wiederfinden. Rolando siedelt sich selbst<br />
unter den potentiellen Betrachtern oder den Porträtierten an: Sie<br />
belauscht sie nicht nur, sondern lauscht auch in sich hinein.<br />
Die kleinen „Bildchen“ changieren zwischen verschiedenen<br />
Schattierungen und bieten viele Spuren, denen man bei der Lektüre<br />
folgen kann. Dieses Spiel spiegelt sozusagen den Lernprozess<br />
und die Entdeckung des Reichtums der Sprache – angefangen<br />
von Abzählreimen für Kinder, Sprichwörtern oder Liedern,<br />
die kunstvoll in den Erzählfluss eingeflochten werden.<br />
Auch wenn der Gegenstand der Analyse hier ungewöhnlich bedeutsam<br />
ist, scheint das von Rolando aufgezeigte Problem der<br />
Multikulturalität eine nicht minder wichtige Frage zu sein. Die<br />
Autorin konzentriert sich nicht auf die Unterschiede, sondern<br />
das Gemeinsame. Auf universelle Symbole und dem allen Europäern<br />
gemeinsamen Traditionsstrang der Kultur. Italienische Ge-<br />
sprächsbücher ist ein ausgezeichneter Beweis dafür, dass, auch<br />
wenn uns die Sprache trennt, immer noch andere Verstehensebenen<br />
bleiben – die Geste, der Gesichtsausdruck oder der<br />
Tonfall der Stimme.<br />
Marta Mizuro<br />
Bianka Rolando (geb. 1979) stammt aus einer<br />
polnisch-italienischen Familie, schafft hauptberuflich<br />
Grafiken und lehrt an der Warschauer Akademie für<br />
Bildende Künste.<br />
Bianka Rolando Italienische Gesprächsbücher<br />
87<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bianka Rolando Italienische Gesprächsbücher<br />
88<br />
Marta<br />
bricht nach Putzmitteln duftend<br />
(ihre angeborene Liebe zum Badezimmerschrubben)<br />
zu ihrer<br />
Schwester Maria auf. Sie legt ihren grauen Umhang um.<br />
Heute trägt sie ein blaues Kleid.<br />
Gib deiner Schwester die Puppe zurück, zieh sie nicht an<br />
den Haaren. Immer ist es dasselbe, immer ist sie unschuldig,<br />
weil sie jünger ist.<br />
Marta hat eine auf Kredit gekaufte kleine Einzimmerwohnung,<br />
die leer steht. Im Augenblick steht dort nur ein Ikea-<br />
Bett aus dem Sonderangebot. Sie ist einsam. Die Schenkel<br />
verwachsen miteinander, die Brüste füllen den BH nur der<br />
Form halber.<br />
Sie kann ihre Schwester nicht ausstehen. Nie waren sie<br />
zusammen einkaufen gegangen, um sich Handtaschen oder<br />
die widerlichen, billigen Ballerinas mit den Punkten zu<br />
kaufen.<br />
Maria hat, als sie klein war, ihre Schwester gebissen. Sie<br />
hat angefangen. Gar nicht wahr, sie war’s. Sie waren einander<br />
nicht ähnlich, auch wenn manche in der Familie witzelten,<br />
sie seien beide füllig wie frische Brötchen.<br />
Vater, Gott hab ihn selig, der in einem winzigen Tümpel<br />
angelte (nie hatte er auch nur einen einzigen Fisch geangelt),<br />
sprach von seinen Töchtern als schönen Schiffen. Verkalkung.<br />
Nette, sehr schlichte Metaphern.<br />
Zwei Windjammern mit sehr ähnlichen Ausmaßen können<br />
mit verschiedener Verzögerung auf die Bewegung des<br />
Steuerrads reagieren. Sie können andere Eigenschaften<br />
im Wind haben. Sie können ihre Merkmale verändern –<br />
abhängig von der Windstärke und der Höhe der Wellen.<br />
Maria bekam immer die interessanteren Geschenke (die<br />
Hawaii-Barbie mit Pferdchen, das jeden mit seinem verlangenden<br />
Blick anschaute). Sie war verwöhnt und beliebt,<br />
die fette Robbe. Das arme Mariele. Ihr Haar war zu einem<br />
Zopf geflochten. Ihre Zähne waren immer braun von Schokolade.<br />
Gib ihr dies zurück, gib ihr jenes zurück.<br />
Marta fährt in einem überfüllten Bus zur Schwester. An<br />
jeder Haltestelle steigen Unmengen von Menschen ein.<br />
An jeder Haltestelle ein Superkraftakt. Der Bus kommt<br />
zur Endhaltestelle. Von dort ist es nicht mehr weit bis zur<br />
Schwester. Sie zerbeißt ein hartes Minzbonbon, um ihren<br />
Atem zu erfrischen. Heute will sie mit ihr sprechen, vielleicht<br />
streiten.<br />
Maria öffnet ihr die Tür. In ihrer Wohnung ist der Strom<br />
abgestellt (die Stromrechnungen für März und April sind<br />
nicht bezahlt). Sie sitzt im Halbdunkel, kämmt ihr Haar.<br />
Warum wurde der Strom abgestellt? Warum bist du<br />
arbeitslos? Du bist völlig verantwortungslos – wie immer.<br />
Wirst du in alle Ewigkeit auf meine Hilfe rechnen?<br />
Ihre Hände geraten in Bewegung. Sie werden sich nicht<br />
prügeln wie Grundschulgören auf dem Schulsportplatz<br />
nach dem Unterricht. Das ist nur Navigation per Hand.<br />
Die linke Hand nach unten, die rechte hebt den Zeigefinger.<br />
Die Rechte hebt den Zeigefinger, die Linke zeigt nach<br />
unten. Das sind alle Vorschriften, die auf binnenländischen<br />
Wasserwegen gelten, ergänzt von den Anordnungen binnenländischer<br />
Genueser Schiffahrtsinspektoren in Fragen<br />
lokaler Familienkonflikte.<br />
Du bist nicht meine Schwester. Ich sehe in den Spiegel,<br />
und dort sehe ich meine Schwester, aber nicht hier. Hier<br />
sehe ich nur einen feisten Hampelmann, der von Kindheit<br />
an Flanellunterhosen trägt. Jetzt trägst du sie sicher wieder.<br />
Musst du immer so fürchterlich umsichtig sein? Immer<br />
wirfst du mir vor, dass ich mehr bekommen habe als du.<br />
Kannst du dich erinnern, wie fest du mich geschlagen hast?<br />
Du hast meine Hawaii-Barbie kaputtgemacht, ihr den Kopf<br />
abgerissen und die Finger abgebissen. Du bist die Nacht,<br />
ich bin der Tag.<br />
Die Wettervorhersage. In der Nacht bedeutend kälter als<br />
tagsüber. Eventuell Gewitter mit vorüberziehenden Tränenschauern.<br />
Ich bin völlig einsam. Ich führe Selbstgespräche. Nie<br />
haben wir einander geholfen. Als unsere Eltern gestorben<br />
waren, hast du aufgehört, dich für mich zu interessieren.<br />
Ich habe mir so sehr gewünscht, dass wir zusmmen<br />
einkaufen gehen. Wir hätten uns drollige Handtaschen<br />
gekauft und diese widerlichen Ballerinas mit den Punkten.<br />
Jetzt habe ich es sehr schwer. Ich brauche dich, denn<br />
schließlich ist der Abstieg von der Untiefe einer großen<br />
Windjammer wirklich schwer. Es gibt außergewöhnlich un-<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
glückliche Umstände. Wenn es schon zu einer so schweren<br />
Situation kommt, muss man einen Schlepper oder ein Rettungsschiff<br />
rufen.<br />
Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier<br />
Wydawnictwo Sic!<br />
Warsaw 2007<br />
135 × 205 • 104 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-60457-27-6<br />
Translation rights:<br />
Wydawnictwo Sic!<br />
Bianka Rolando Italienische Gesprächsbücher<br />
89<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ignacy Karpowicz Die Neue Blume des Kaisers (und die Bienen)<br />
90<br />
Photo: Grażyna Samulska<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bereits in seinen ersten beiden Romanen Nicht der Hit und Das<br />
Wunder zeigte sich Ignacy Karpowicz als origineller und überaus<br />
einfallsreicher Prosaist. Doch mit Die Neue Blume des Kaisers<br />
hat sich der Autor selbst übertroffen. Es fällt schwer, diesen<br />
Text einer bestimmten Gattung zuzuordnen, er enthält Elemente<br />
der Reportage, des Romans, des Reisetagebuchs und von etwas,<br />
das man als romantisch-ironisches Prosaepos bezeichnen<br />
könnte. Karpowicz selbst charakterisiert seine Erzählweise – mit<br />
der ihm eigenen Hintergründigkeit – folgendermaßen: „Ich bin<br />
ein Schwarzfahrer des Exkurses [...] Alles, worüber ich schreibe,<br />
interessiert mich – und gleichzeitig ist mir nichts besonders<br />
wichtig“. Er erzählt von seinen Reisen nach Äthiopien, einem von<br />
der Geschichte gezeichneten, armen afrikanischen Land, das<br />
bereits im Mittelpunkt von Ryszard Kapuścińskis ausgezeichneter<br />
Reportage König der Könige. Eine Parabel der Macht stand. In<br />
seiner ausschweifenden Narration,<br />
die so flirrend ist wie die heiße afrikanische<br />
Luft, erzählt Karpowicz von<br />
seinem Aufeinandertreffen mit einer<br />
anderen Kultur (in der man Weißen auf eine sehr spezifische Art<br />
begegnet), berichtet von seinem Kampf mit einer nahezu kafkaesken<br />
Bürokratie, beschreibt das heutige Äthiopien und seine<br />
Einwohner, gibt einen Abriss der Geschichte dieses Landes und<br />
präsentiert die faszinierenden Denkmäler und Landschaften,<br />
über die in Europa kaum etwas bekannt ist. Und all das würzt<br />
er mit einer großen Portion Ironie und feinen Humors, die fast<br />
schon zu seinem Markenzeichen geworden ist.<br />
Wenn ich an Ignacy Karpowiczs neuen Roman denke, kommt<br />
mir unweigerlich das Wort „seltsam“ in den Sinn. Ja, es ist eine<br />
seltsame Prosa, doch diese (vor allem formale) Seltsamkeit ist<br />
– so meine ich zumindest – vom Autor beabsichtigt. Auf eben<br />
diese Weise versucht Karpowicz die „Seltsamkeit der Existenz“,<br />
die ihn während seiner Reisen durch Äthiopien anfiel, in Worte<br />
zu fassen.<br />
Robert Ostaszewski<br />
Ignacy Karpowicz (geb. 1976), Prosaist,<br />
Übersetzer aus dem Englischen, Spanischen und<br />
Amharischen.<br />
Ignacy Karpowicz Die Neue Blume des Kaisers (und die Bienen)<br />
91<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ignacy Karpowicz Die Neue Blume des Kaisers (und die Bienen)<br />
92<br />
Addis<br />
liegt 2400 Meter über dem Meeresspiegel<br />
und ist somit die am<br />
dritthöchsten über Meeren und<br />
Ozeanen emporragende Hauptstadt weltweit. Der Reiseführer<br />
von Herrn Briggs ist nicht der Einzige. Aus einem anderen<br />
(bei Camerapix erschienenen) Werk fördere ich die folgende<br />
charmante Beschreibung zutage, die aus sicherer Realitätsferne<br />
geschrieben wurde, oder von jemandem, den man dafür<br />
bezahlt hat: „Breite, dreispurige Straßen, eine eindrucksvolle<br />
Architektur, herrliches Wetter und Karawanen von Eseln,<br />
die malerisch durch die Boulevards ziehen, machen die Neue<br />
Blume zu einem empfehlenswerten Reiseziel“. Als sei dies<br />
noch nicht genug führt der Autor auch noch die Fülle von<br />
gemütlichen Cafés und Konditoreien ins Feld, die ein wenig<br />
an Rom erinnert. Klar doch. […]<br />
Ich biege nach rechts in eine Straße mit dem vertrauten<br />
Namen Wavel. Ich werde noch bei verschiedenen Gelegenheiten<br />
die Namen von Straßen nennen – obwohl es nicht<br />
den geringsten Nutzen hat. In erster Linie weil die Straßen<br />
hier überhaupt nicht gekennzeichnet sind und ihre Namen<br />
lediglich auf den Stadtplänen erscheinen. Die Einzigen, die<br />
von ihnen Gebrauch machen, sind weiße Touristen und – zu<br />
diesem Punkt gibt es widersprüchliche Aussagen – die äthiopische<br />
Post. Eine gewisse Erschwernis stellt auch die Tatsache<br />
dar, dass jede einigermaßen ansprechende Straße oder Allee<br />
ein Recht auf zwei, drei oder sogar noch mehr Synonyme für<br />
sich in Anspruch nimmt. Diese Bezeichnungen sind generell<br />
austauschbar. Und es wäre gar nichts an einem solch verschwenderischen<br />
Umgang mit Straßennamen auszusetzen,<br />
wenn jeder sie alle kennen würde.<br />
Leider ist dies nicht der Fall. Wenn ihr euch verirrt, wird<br />
kaum jemand, den ihr nach dem Weg fragt, euer topografisches<br />
Wissen mit euch teilen. Und selbst wenn sich herausstellen<br />
sollte, dass sowohl ihr als auch die von euch gefragte<br />
Person denselben Begriff wiederholt, ist noch lange nichts<br />
gewonnen. Die Gründe hierfür können vielfältig sein. Um<br />
die Dramatik der Situation zu verdeutlichen, möchte ich die<br />
wahrscheinlichsten einmal nennen. Euer Gegenüber versteht<br />
kein Englisch und spricht einfach nach, was ihr gerade gesagt<br />
hat. Euer Gegenüber versteht Englisch, weiß aber nicht,<br />
wovon ihr redet, und spricht euch nach, um ein wenig mit<br />
euch zu schwatzen. Euer Gegenüber versteht Englisch und<br />
weiß, wovon ihr redet, hat jedoch keine Ahnung, wo sich die<br />
gesuchte Straße befindet, und spricht euch nach, um euch<br />
nicht zu kränken. Euer Gegenüber versteht Englisch, weiß,<br />
wovon ihr redet, und kennt – wie er euch versichert – sogar<br />
den Weg dorthin.<br />
Armer, einfältiger Tourist! Du bist noch längst nicht gerettet!<br />
Im besten Fall denkt euer Gegenüber an den dritten Namen<br />
einer Straße, der bereits seit Jahren nicht mehr in Gebrauch<br />
ist (außer in dem Stadtteil, in dem du dich gerade befindest),<br />
während du an den ersten Namen einer Straße denkst, der<br />
so alt ist, dass ihn längst alle vergessen haben. Folgst du nun<br />
also jener mühsam errungenen Wegbeschreibung, kannst du<br />
sicher sein, auf gänzlich unerforschte Gegenden zu stoßen.<br />
Es lohnt sich. Deine Situation erfährt keine wesentliche Änderung:<br />
Noch mehr verirren kann man sich nicht. Entweder<br />
man hat sich verirrt oder nicht, dazwischen gibt es nichts,<br />
so mahnt uns die protestantische Prädestinationslehre. Du<br />
wolltest reisen und jetzt hast du, was du wolltest: Du besuchst<br />
Orte, an denen du noch nie zuvor gewesen bist.<br />
Entgegen allem Anschein entspringt die äthiopische Vorliebe<br />
für Wort- und Namensschöpfungen einer zutiefst ästhetischen<br />
und philosophischen Grundhaltung. Man muss<br />
nur ihre Denkweise verstehen: Irgendein hohes Tier denkt<br />
sich einen Namen aus. In der Regel fragt er die Einwohner<br />
nicht, ob ihnen der neue Name gefällt und ob er die topografische<br />
Realität angemessen wiedergibt. Er macht sich auch<br />
nicht die Mühe zu überprüfen, wie man zum Beispiel diese<br />
Allee bis dahin eigentlich genannt hat. Denn irgendwie muss<br />
man sie ja schließlich genannt haben, die Stadt duldet kein<br />
Vakuum. Und was nun? Soll man sich etwa einfach so mit<br />
der Inkompetenz irgendeines Beamten abfinden? Niemals!<br />
Soll er sich doch von seinem Schreibtisch herab so viele Namen<br />
ausdenken, wie er will.<br />
Folgen wir dieser Spur. Sie ist sicher. Wir werden uns nicht<br />
verirren.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Wir haben also einen Namen. Doch die Welt steht nicht<br />
still, überall entstehen neue Gebäude, die alten zerfallen, die<br />
Straße lebt, verändert ihren Charakter, vielleicht wird sie sogar<br />
asphaltiert. Und was nun? Soll ein einziger Name sie für<br />
alle Zeiten beschreiben?<br />
Blödsinn!<br />
Der Name muss geändert, an die jeweilige Situation angepasst<br />
werden. Nur so bleibt sein Bezug zur Realität erhalten.<br />
Nur so vermag er der schillernden Vielfalt des Universums<br />
gerecht zu werden. Aus diesem Grund operieren die Äthiopier<br />
mit mehreren Namen gleichzeitig. Nicht selten kommt<br />
es auch zu Namenswanderungen. Früher hieß diese Straße<br />
einmal Schöne Straße, doch dann wurde hier ein Hochhaus<br />
gebaut: Und vielleicht war sie früher einmal schön, aber heute<br />
ist sie es nicht mehr. Dafür wurden ganz in der Nähe Eukalyptusbäume<br />
gepflanzt, die sehr schön aussehen, also wird<br />
diese Straße zur Schönen Straße. Leider hat die Polizei nicht<br />
richtig auf die Eukalyptusbäume aufgepasst, sodass sie schon<br />
bald darauf zu Brennholz verarbeitet wurden. Im Grunde<br />
waren aber nur die Eukalyptusbäume schön gewesen, jetzt<br />
war die Straße war nur noch die Schmale Straße. Ganz in<br />
der Nähe jedoch...<br />
Darüber hinaus lässt diese Form der sprachlichen Aktivität<br />
auch Raum für den Ausdruck der eigenen Individualität:<br />
Mir gefällt dieses Hochhaus, ändert den Namen, soviel ihr<br />
wollt, für mich bleibt es die Schöne Straße.<br />
Ich muss zugeben, dass ich diese ständig neu bezeichnete,<br />
immer wieder aufs Neue geschaffene, wie ein Regenbogen<br />
flüchtige Welt, im ersten Moment als feindlich empfand,<br />
quasi als afrikanische Spielart des Großstadtdschungels. Später<br />
jedoch, als ich den schmerzhaften Prozess der Anpassung<br />
bereits hinter mir hatte, lernte ich diese Tradition der Unordnung<br />
und Lebendigkeit bedingungslos zu lieben.<br />
Aus dem Polnischen von Heinz Rosenau<br />
Państwowy <strong>Instytut</strong><br />
Wydawniczy<br />
Warsaw 2007<br />
145 × 230 • 256 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-06-03077-8<br />
Translation rights:<br />
Ignacy Karpowicz<br />
Contact: PIW<br />
Ignacy Karpowicz Die Neue Blume des Kaisers (und die Bienen)<br />
93<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
94<br />
Alles über Lem<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Stanisław Lem (1921-2006) seiner Ausbildung<br />
nach Arzt und Theoretiker der Wissenschaft, aus<br />
Neigung Schriftsteller, Klassiker der Science-Fiction.<br />
95<br />
Maciej Płaza<br />
O poznaniu<br />
w twórczości<br />
Stanisława Lema<br />
Wydawnictwo<br />
Uniwersytetu Wrocławskiego<br />
Wrocław 2006<br />
150 × 210 • 579 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 83-229-2765-7<br />
Translation rights: Maciej Płaza<br />
Contact: Wydawnictwo<br />
Uniwersytetu Wrocławskiego<br />
Wojciech Orliński<br />
Co to są sepulki?<br />
Wszystko o Lemie<br />
Znak<br />
Cracow 2007<br />
144 × 205 • 282 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-240-0798-1<br />
Translation rights: Znak<br />
Paweł Majewski<br />
Między zwierzęciem<br />
i maszyną. Utopia<br />
technologiczna<br />
Stanisława Lema<br />
Wydawnictwo<br />
Uniwersytetu Wrocławskiego<br />
Wrocław 2007<br />
150 × 210 • 295 pages<br />
hardcover<br />
Translation rights:<br />
Paweł Majewski<br />
Contact: Wydawnictwo<br />
Uniwersytetu Wrocławskiego<br />
Alles über Lem<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
96<br />
Alles über Lem<br />
Vor gut einem Jahr starb Stanisław Lem, ein ungemein<br />
bekannter Schriftsteller, der aber von der polnischen Kritik<br />
nicht durch allzu viele wissenschaftliche Analysen verwöhnt<br />
wurde. Das ändert sich allmählich, dank neuer Autoren in<br />
diesem Fachgebiet.<br />
Beginnen wir mit einer populären Ausgabe, dem kurzen<br />
Wörterbuch der Begriffe, die von Lem benutzt wurden und<br />
mit seinem Werk verbunden sind. Wojciech Orlińskis Buch<br />
Was sind Sepulken? Alles über Lem ist leicht und überaus witzig<br />
und zugleich intelligent und mit großer Sachkunde geschrieben.<br />
Orliński, Journalist bei der „Gazeta Wyborcza“,<br />
der sich mit literarischen Dingen ebenso beschäftigt wie mit<br />
Problemen der neuesten Wissenschaft, hat in sein Kompendium<br />
Stichwörter aufgenommen, die sich auf die Werke Lems<br />
beziehen, seine Biographie, seine Verwandten, Freunde und<br />
Gegner, auf die Welt, die in seinen Werken dargestellt wird,<br />
auf Probleme und Themen, die in den Büchern angeschnitten<br />
werden, auf Kritiker, die sich mit Lem befaßt haben, auf<br />
Filmemacher, die seine Werke als Vorlage verwendet haben,<br />
und schließlich auf die realen Länder der Erde, die Lem in<br />
seinen Büchern beschrieben hat.<br />
Die Stichwörter enthalten viele durchaus seriöse Informationen<br />
über das Werk Lems, aber sie sind, wie dieses Werk<br />
selbst, voller Humor, wie etwa der Eintrag über die titelgebenden<br />
Sepulken:<br />
Sepulken – wichtiges Element der Zivilisation der Ardriten<br />
(s. d.) auf dem Planeten Enteropia (s. d.); s. Sepulkaria<br />
Sepulkaria – zum Sepulieren (s. d.) dienende Objekte<br />
Sepulieren – Tätigkeit der Ardriten (s. d.) auf dem Planeten<br />
Enteropia (s. d.); s. a. Sepulkaria<br />
Dieses Stichwort fand Ijon Tichy in der von Professor<br />
Tarantoga entliehenen Kosmischen Enzyklopädie. Fasziniert<br />
von den rätselhaften Sepulken (und anderen Attraktionen<br />
Enteropias wie den Kulupen und Okteseln), beschloß er, der<br />
Sache auf der vierzehnten Reise auf eigene Faust nachzugehen.<br />
Auf Enteropia angekommen, bemerkte Tichy, daß alle<br />
Medien, Werbung und Kunstwerke von Anspielungen auf<br />
Sepulken nur so wimmeln. Aus Neugier begab er sich in ein<br />
entsprechendes Geschäft und bestellte eine, woraufhin der<br />
Verkäufer ihn nach seiner Ehefrau fragte. „Ich habe keine<br />
Frau“, erwiderte Tichy. „Sie… Sie haben… keine Frau?“<br />
stammelte der errötende Verkäufer entsetzt, „und da wollen<br />
Sie eine Sepulke…? Ohne Gattin…?“ Noch schlimmer endete<br />
der Versuch, dieses Thema mit einem Bekannten zu erörtern,<br />
einem Ardriten, der sich mit seiner Familie in einem<br />
Nachtlokal vergnügte. „Darf ich, weil ich keine Frau habe,<br />
keine Sepulke sehen?“, fragte Tichy. „Diese Worte fielen in<br />
eine plötzlich entstandene Stille. Die Frau meines Bekannten<br />
sank ohnmächtig zu Boden, er stürzte zu ihr […]. In diesem<br />
Augenblick erschienen drei Kellner; sie packten mich am<br />
Kragen und warfen mich auf die Straße“.<br />
Vor Orlińskis Buch war ein ungemein interessantes wissenschaftliches<br />
Werk erschienen: Über die Erkenntnis in den<br />
Schriften Stanisław Lems von Maciej Płaza. Płaza beschreibt<br />
das Werk Lems in vier großen Kapiteln: „Lems Strukturen<br />
und Strategien“, „Futurologie der empirischen Wissenschaften“,<br />
„Das literarische Gedankenexperiment“ und „Fiktion<br />
der Logik oder Logik der Fiktion“. Die Arbeit untersucht<br />
die Erkenntnisproblematik, die das grundlegende Thema<br />
der Lemschen Phantastik darstellt. Man könnte fragen, ob<br />
ein Phantast überhaupt etwas erkennen kann. Nun beweist<br />
Maciej Płaza, wie eng die wissenschaftlich-philosophischen<br />
Essays Lems mit seinem belletristischen Werk zusammenhängen,<br />
das einen Raum bildet, in dem bestimmte Ideen aus<br />
den Bereichen der Soziologie, der Kulturwissenschaft oder<br />
der Technik unter Beachtung literarischer Konventionen im<br />
Material der fiktiven Fabeln modelliert werden. Auf genau<br />
diese Weise fand das Prognostizieren künftiger Zustände der<br />
Technik und der menschlichen Kultur bei Lem seine Fortsetzung<br />
in etwas, das Płaza als „literarisches Gedankenexperiment“<br />
bezeichnet, aber auch in der vom dem Forscher<br />
ungemein interessant analysierten Metaliteratur, den Lemschen<br />
Apokryphen: Rezensionen und Vorworten zu fiktiven<br />
Büchern. Płazas Buch wird für künftige Erforscher des Lemschen<br />
Schaffens zweifellos zur Pflichtlektüre gehören.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
In derselben renommierten Verlagsreihe wie Płazas Buch<br />
erscheint eine weitere wertvolle wissenschaftliche Abhandlung<br />
über Lems Werk: Zwischen Tier und Maschine. Die technologische<br />
Utopie Stanisław Lems von Paweł Majewski. Darin<br />
befaßt sich der Warschauer Gelehrte im Grunde mit nur zwei<br />
wichtigen essayistischen Büchern Lems, den Dialogen und<br />
der Summa technologiae. Er behandelt unter anderem Lems<br />
Verhältnis zur Kybernetik, die Frage der sich verwischenden<br />
Grenzen zwischen dem Künstlichen und dem Natürlichen,<br />
das Problem der Konstruktion des Cyberraums und all seine<br />
– sehr weitläufigen – Kontexte. Seine Ausführungen münden<br />
in das wichtigste Thema, das nach Ansicht des Verfassers<br />
bei Lem das Projekt der Autoevolution des Menschen ist,<br />
ein Projekt, das entweder eine radikale Umgestaltung des<br />
Körpers erfordert oder dessen gänzliche Verwerfung zugunsten<br />
einer spezifischen Komposition aus biologischen und<br />
maschinellen Elementen, mit der Perspektive, die menschliche<br />
Physis einer vollständigen und radikalen Umwandlung<br />
zu unterziehen. Dieses durch seine Kühnheit schockierende<br />
Projekt vergleicht der Verfasser mit der aktuellen Strömung<br />
des Posthumanismus, und er zeigt, das der Autor der Summa<br />
dessen Vorläufer war. Am Schluß des Buches wird Lem als<br />
Visionär dargestellt, der sich auf das Projekt der Autoevolution<br />
verlegte, um die Widersprüche der conditio humana zu<br />
beseitigen und uns um den Preis der Vernichtung aller kulturellen<br />
Errungenschaften zu befreien von der „schrecklichen<br />
Mühsal, ein Mensch zu sein“.<br />
Jerzy Jarzębski<br />
97<br />
Alles über Lem<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Julia Hartwig Dank für die Gastfreundschaft<br />
98<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
„Von dem Augenblick an, in dem ich in Frankreich war, bestimmte<br />
alles dort Erlebte meinen weiteren Weg, beeinflusste meine<br />
Interessen, mein Verhältnis zur Welt, meine Leidenschaften,<br />
meine Arbeit“, schreibt Julia Hartwig in ihrem neuesten Buch,<br />
dem Titel entsprechend ein Dank für die Gastfreundschaft. Der<br />
Dank geht nicht so sehr an konkrete Personen, auch wenn von<br />
ihnen oft die Rede ist, als an die französische Kultur und Zivilisation,<br />
die Literatur und insbesondere die Poesie des Landes an<br />
der Seine.<br />
Julia Hartwig revanchierte sich für die „Gastfreundschaft“ wahrlich<br />
königsgleich: mit brillanten Büchern über französische Dichter,<br />
Rimbaud-Nachdichtungen, Essays zur französischen Kultur,<br />
der alten und der heutigen, wie auch zur Geschichte, auch der<br />
schwierigen jüngsten Vergangenheit. Der Dank für die Gastfreundschaft<br />
besteht neben Essays auch in Reisetagebüchern,<br />
Gedichten der Lyrikerin mit französischen Motiven, Übersetzungen.<br />
Viel Raum widmet die Autorin Pariser Außenseitern, Fremdlingen<br />
gleich ihr, die sich diese außergewöhnliche Stadt vertraut<br />
zu machen und ihr Schaffen zu bereichern verstanden wie Blaise<br />
Cendrars, wie Max Jacob, wie Henri<br />
Michaux oder Marcel Duchamp.<br />
Für Julia Hartwig bleibt Paris auf immer Hauptstadt der Weltkultur,<br />
selbst wenn es nicht mehr das Paris bis zur Studentenrevolution<br />
Ende der 60er Jahre ist, als London und später New York<br />
diesen Titel übernahmen. In der Nachkriegszeit war das jedoch<br />
anders, und das, was ringsum die Champs Élysées entstand,<br />
beeinflusste das künstlerische Leben in West und Ost, Nord<br />
und Süd. Gleichgültig, ob es Lied, Bild, Theaterstück, Film oder<br />
Buch war. Apropos Buch: „Das Verblüffende an der französischen<br />
Literatur“, schreibt Julia Hartwig, „ist ihre Bandbreite: das<br />
Hugosche Genie französischen Esprits und Rabelais’sche Grobschlächtigkeit,<br />
Mussetsche Eleganz und der ergreifende Gesang<br />
Apollinaires, der Wahnsinn Lautréamonts, die unerschöpfliche<br />
Schaffensgewalt der Lyrik Rimbauds, die verschlossene Sensiblität<br />
des Kubismus Reverdys, der Erfindungsreichtum des lyrischen<br />
Paradoxon bei Jacob. Alt und neu, einzeln und vereint wie<br />
Wurzel, Halm, Blatt und Blüte einer Pflanze.“<br />
Krzysztof Masłoń<br />
Julia Hartwig (geb. 1921), Dichterin, Essayistin,<br />
Übersetzerin.<br />
Julia Hartwig<br />
Podziękowanie za gościnę<br />
słowo/obraz terytoria<br />
Gdańsk 2007<br />
140 × 220 • 424 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-7453-707-0<br />
Translation rights: słowo/obraz terytoria<br />
Julia Hartwig Dank für die Gastfreundschaft<br />
99<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Jacek Antczak Die Reporterin. Gespräche mit Hanna Krall<br />
100<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch geht über das dem Leser Vertraute weit hinaus.<br />
Nicht nur, weil eine unverwechselbare Persönlichkeit im Zentrum<br />
steht und das, was sie über ihre Arbeitsmethoden oder<br />
ihre Sicht des Lebens zu sagen hat, bisweilen verblüfft. Von einem<br />
großen Menschen lässt sich schwerlich Anderes erwarten.<br />
Doch könnte man annehmen, dass Hanna Krall nicht abgeneigt<br />
ist, ihr eigenes subjektives Empfinden in Textform zu bringen.<br />
Stattdessen verkündet sie: „Niemals werde ich über mich selbst<br />
in der ersten Person schreiben“. Aber „ich werde nicht schreiben“<br />
heißt natürlich nicht „ich werde nichts sagen“. Mit der Reporterin<br />
wurden Dutzende ausgezeichneter Interviews geführt.<br />
Doch keines davon war ein Gesprächsstrom, der die Funktion<br />
einer Biographie erfüllte.<br />
Die zehn Gespräche, die im Buch vorgestellt werden, wurden<br />
geführt und nicht geführt. Jedes ist eine Collage, die aus bereits<br />
fertigen Interviews komponiert wurde.<br />
Der Kompilator Jacek Antczak<br />
schnitt ganz wörtlich vorhandene<br />
Texte auf einzelne Fragen zu und<br />
stellte sie so zusammen, dass sie<br />
eine thematische Einheit bildeten.<br />
Die ursprünglichen Interviews wurden<br />
selbstverständlich in den Anmerkungen aufgeführt, aber<br />
bisweilen mussten die Fragen durch andere ersetzt werden,<br />
damit der geschaffene Wortwechsel seine logische Ordnung<br />
behielt. Die Spuren dieser Eingriffe bleiben unsichtbar: Die<br />
Gespräche haben ihr eigenes Tempo und bewahren sogar die<br />
Hitzigkeit einer „Diskussion“. Dennoch bleibt am wichtigsten,<br />
dass das Verwischen der Identität der Interviewer es erlaubt,<br />
die Stimme Hanna Kralls um so deutlicher herauszuschälen. In<br />
der ersten Person.<br />
Die Gespräche sind in drei Teile untergliedert. Im ersten erläutert<br />
Krall, was es für sie bedeutet, Reporterin zu sein. Im zweiten gewährt<br />
sie Einblicke in das Nähkästchen des Reporterhandwerks.<br />
Im dritten spricht sie über ihr Verhältnis zu den Lesern. Immer<br />
eindrucksvoll: ob sie eine Anekdote anführt, ob sie Verallgemeinerungen<br />
formuliert oder einen inneren Zwiespalt schildert.<br />
Hanna Krall spricht sich dafür aus, dass eine Reportage nicht<br />
nur als Sachliteratur gelesen wird, sondern dass man in ihr eine<br />
tiefere Bedeutung sucht. Die Reporterin ist also für die Fangemeinde<br />
der Autorin von Schneller als der liebe Gott genauso<br />
wertvoll wie für diejenigen, die beruflich mit literarischen Stoffen<br />
umzugehen haben.<br />
Marta Mizuro<br />
Hanna Krall, brillante Reporterin und Schriftstellerin.<br />
Übersetzt ins Englische, Tschechische,<br />
Finnische, Hebräische, Spanische, Holländische,<br />
Deutsche, Rumänische, Slowakische, Schwedische,<br />
Ungarische und Italienische.<br />
Jacek Antczak<br />
Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall<br />
Rosner & Wspólnicy<br />
Warsaw 2007<br />
120 × 190 • 168 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-60336-15-1<br />
Translation rights: Rosner & Wspólnicy, Jacek Antczak<br />
Contact: Rosner & Wspólnicy<br />
Jacek Antczak Die Reporterin. Gespräche mit Hanna Krall<br />
101<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ryszard Legutko Traktat über die Freiheit<br />
102<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Thema des Traktats über die Freiheit von Ryszard Legutko ist die<br />
Freiheit – ein Schlüsselbegriff für die Philosophie wie für das<br />
gesellschaftliche Leben von heute. Für demokratische Gesellschaften<br />
ist der Begriff kein Problem an sich mehr. Niemand, der<br />
bei Verstand ist, stellt das Bedürfnis, ja sogar die Notwendigkeit<br />
der Freiheit in Frage.<br />
Zum Problem wird dagegen die Verteilung der Freiheit, ihr von<br />
uns gewünschter Umfang. Der Traktat über die Freiheit bringt<br />
eine Übersicht über die klassischen Auffassungen des Freiheitsbegriffs,<br />
von der platonischen bis zur liberalen Konzeption; in<br />
den Vordergrund rückt dabei die Frage der sogenannten negativen<br />
Freiheit, über die allgemeines Einverständnis besteht, freilich<br />
mit dem Hinweis, daß es an klaren Kriterien fehlt, von denen<br />
ihre Dauer abhängig ist. Besonders interessant ist das vom Verfasser<br />
angeschnittene Problem des Verhältnisses zwischen der<br />
negativen Freiheit und dem Kommunismus. Legutko stellt den<br />
wie ein Mantra ständig wiederholten Gegensatz zwischen sowjetischem<br />
Totalitarismus und westlichem<br />
Liberalismus in Frage. Die<br />
völlige Erniedrigung des Menschen<br />
im Kommunismus beruhte ihm zufolge<br />
vielleicht auf einem anthropologischen Irrtum, dem der<br />
Kommunismus erlag. Dieser richtete sich nämlich gegen „die<br />
gesamte menschliche Existenz, gegen fast alle Bestrebungen und<br />
Potentialitäten, über die der Mensch noch verfügte“.<br />
Ryszard Legutkos Buch ist fest im polnischen Hier und Jetzt verwurzelt.<br />
Daher erwähnt er auch den „merkwürdigen ideologischen<br />
Krieg“ in den frühen neunziger Jahren, „in dem auf der<br />
einen Seite die Anhänger einer radikalen Zurückweisung des<br />
Erbes und metaphysischer Begründungen als Formen des Vorurteils<br />
standen, auf der anderen Seite dagegen jene, die sich<br />
nicht vorstellen konnten, wie sich ohne solche historischen oder<br />
metaphysischen Begründungen die negative Freiheit organisieren<br />
läßt“. Ob es, wie der Autor sagt, glücklicherweise zum Waffenstillstand<br />
kam, weiß ich nicht; jedenfalls haben die Anhänger<br />
der letzteren Orientierung Stimmrecht erlangt. Und das bedeutet,<br />
daß der Streit um grundlegende Werte – darunter auch der<br />
Umfang der Freiheit – weitergehen wird.<br />
Krzysztof Masłoń<br />
Ryszard Legutko (geb. 1950), Philosoph,<br />
Professor der Philosophie an der Jagiellonen-<br />
Universität.<br />
Ryszard Legutko<br />
Traktat o wolności<br />
słowo/obraz terytoria<br />
Gdańsk 2007<br />
140 × 225 • 248 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 978-83-7453-763-6<br />
Translation rights: słowo/obraz terytoria<br />
Ryszard Legutko Traktat über die Freiheit<br />
103<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Piotr Matywiecki Tuwims Gesicht<br />
104<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Was ist Tuwims Gesicht? Eine Biographie jedenfalls nicht – der<br />
Lebenslauf des Dichters nimmt einen gewissen, wichtigen Teil<br />
des Buches ein, ohne jedoch zu dominieren. Eine Werk-Monographie<br />
ist es auch nicht – denn es löst trotz seines Umfangs<br />
nicht alle von Tuwim aufgeworfenen Fragen, sondern signalisiert<br />
sie und stellt lediglich ein Bruchstück der literarischen Aktivität<br />
des Helden des Bandes dar. Am treffendsten bezeichnet<br />
man diese Veröffentlichung wohl als einen erweiterten Essay,<br />
ein wissenschaftliches Zeugnis der Faszination durch die Lektüre<br />
und zugleich als einen kleinen Führer durch den aktuellen Forschungsstand<br />
in Sachen Tuwim.<br />
Matywiecki verzichtet auf die „traditionelle“, chronologische<br />
Darstellung des Themas – Elemente der Biographie und der Interpretation<br />
sind über das ganze Buch verstreut. Mutige Lösungen<br />
der thematischen Gliederung gestatten dem Autor, Tuwims<br />
Gestalt aus einer bisher ungenutzten Perspektive zu beleuchten<br />
und eine neue Art des Redens über<br />
den Dichter zu erarbeiten. Der essayistische<br />
Schlüssel scheint bei<br />
Matywiecki die Interpretation zu<br />
sein – der Rhythmus der Lektüre bestimmt die Entwicklung der<br />
„Narration“, der Rhythmus der Lektüre der Gedichte, Erinnerungen<br />
und Briefe Tuwims ist hier ein Substitut der „Kenntnis“.<br />
Matywiecki wuchs mit einem regelrechten Tuwim-Kult auf. In<br />
Ermangelung persönlicher Kontakte und angesichts der nicht<br />
ganz gegebenen Möglichkeit, Tuwim durch Erforschung seines<br />
Werkes „kennenzulernen“, greift Matywiecki auf Äußerungen<br />
von Angehörigen des Dichters zurück, die er aus Monographien,<br />
Lebensläufen, Interviews, Rezensionen und Berichten schöpft.<br />
Gleichzeitig versucht Matywiecki, neben der Charakterisierung<br />
des Werkes Tuwims den literarischen Kontext zu präsentieren.<br />
In Tuwims Gesicht löst der Forscher Zusammenhänge auf, die<br />
reich an Bedeutungen sind, beschwört er Themen, auf die bisher<br />
nur wenige in der Dichtung Tuwims hingewiesen haben – die<br />
Frage des Gesichts, des Körpers, des Schicksals, der Identität,<br />
Tuwim aus der Sicht Lechońs, das Problem der Melancholie und<br />
des Vitalismus, das Motiv der Pflanzen, der Zahlen, der Mathematik,<br />
der Marionetten und der Religion, der Welt der Materie.<br />
Matywiecki beruft sich oft auf die Philosophie, oft interpretiert er<br />
Tuwim aus der Sicht verschiedener Weltanschauungen.<br />
Izabela Mikrut<br />
Julian Tuwim (1894-1953), einer der grössten<br />
Dichter Polens des 20. Jahrhunderts.<br />
Piotr Matywiecki<br />
Twarz Tuwima<br />
W.A.B.<br />
Warsaw 2007<br />
142 × 202 • 774 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 978-83-7414-041-6<br />
Translation rights: W.A.B.<br />
Piotr Matywiecki Tuwims Gesicht<br />
105<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die geisteswissenschaftlichen Neuerscheinungen des letzten Jahres<br />
106<br />
Witold M. Orłowski<br />
Stulecie chaosu.<br />
Alternatywne dzieje<br />
XX wieku<br />
Open Wydawnictwa<br />
Naukowe i Literackie<br />
Warsaw 2006<br />
170 × 240 • 544 pages<br />
paperback<br />
ISBN: 83-85254-86-7<br />
Translation rights: PUENTA<br />
Literary Agency<br />
Contact: PUENTA<br />
Ewa Majewska,<br />
Janek Sowa<br />
Zniewolony umysł 2<br />
Korporacja Ha!art<br />
Cracow 2007c<br />
125 × 195 • 400 pages<br />
paperback<br />
ISBN 83-89911-61-2<br />
Translation rights: Authors<br />
Contact: Ha!art<br />
Artur Żmijewski<br />
Drżące ciała.<br />
Rozmowy z artystami<br />
Korporacja Ha!art & Galeria<br />
Kronika Ha!art.<br />
Bytom - Cracow 2006<br />
160 × • 365 pages<br />
paperback<br />
ISBN 83-89911-66-3<br />
Translation rights:<br />
Author, Foksal Gallery<br />
Fundation, Kronika<br />
Contact: Ha!art<br />
Tadeusz Bartoś,<br />
Krzysztof Bielawski<br />
Ścieżki wolności.<br />
Z Tadeuszem Bartosiem<br />
OP rozmawia<br />
Krzysztof Bielawski<br />
Wydawnictwo Homini<br />
Cracow 2007<br />
125 × 195 • 250 pages<br />
paperback<br />
ISBN 978-83-895988-82-0<br />
Translation rights:<br />
Tadeusz Bartoś,<br />
Krzysztof Bielawski<br />
Contact:<br />
Wydawnictwo Homini<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Krystyna Kłosińska<br />
Miniatury. Pisanie<br />
i czytanie ‚kobiece’<br />
Wydawnictwo<br />
Uniwersytetu Śląskiego<br />
Katowice 2006<br />
130 × 205 • 157 pages<br />
paperback<br />
ISBN 83-226-1599-X<br />
Translation rights:<br />
Wydawnictwo<br />
Uniwersytetu Śląskiego<br />
Izabela Filipiak<br />
Obszary odmienności<br />
słowo/obraz terytoria<br />
Gdańsk 2007<br />
225 × 140 • 584 pages<br />
hardcover<br />
ISBN: 978-83-7453-719-3<br />
Translation rights:<br />
słowo/obraz terytoria<br />
Max Cegielski<br />
Pijani Bogiem<br />
W.A.B.<br />
Warsaw 2007<br />
145 × 205 • 260 pages<br />
paperback<br />
ISBN 978-83-7414-266-3<br />
Translation rights: W.A.B.<br />
Rafał Górski<br />
Bez państwa.<br />
Demokracja<br />
uczestnicząca<br />
w działaniu<br />
Korporacja Ha!art<br />
Cracow 2007<br />
125 × 195 • 250 pages<br />
paperback<br />
ISBN 83-89911-76-6<br />
Translation rights:<br />
Rafał Górski<br />
Contact: Ha!art<br />
Die geisteswissenschaftlichen Neuerscheinungen des letzten Jahres<br />
107<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die geisteswissenschaftlichen Neuerscheinungen des letzten Jahres<br />
108<br />
Das vergangene Jahr hat uns zahlreiche interessante Neuerscheinungen<br />
im Bereich der Geisteswissenschaften beschert.<br />
Ihr vorherrschendes Merkmal ist die Interdisziplinarität: Es<br />
fällt schwer, die einzelnen Werke einer bestimmten Thematik<br />
zuzuordnen. Durch ihre breite thematische Streuung richten<br />
sie sich nicht mehr nur an einen bestimmten Leserkreis: Die<br />
Lektüre zeitgenössischer künstlerischer Programme führt<br />
uns direkt zu Fragen der gesellschaftlichen Kommunikation<br />
und der Politik.<br />
In manchen Fällen ist diese faszinierende Hybridität bereits<br />
in der Konzeption angelegt, wenn zum Beispiel in einem allen<br />
Anschein nach geschichtlichen Buch ein wirtschaftlicher<br />
Berater des polnischen Präsidenten mithilfe einer ökonomischen<br />
Simulation untersucht, was geschehen wäre, wenn<br />
Stalin oder Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten,<br />
wenn es die Oktoberrevolution nicht gegeben hätte oder<br />
wenn China nicht von Japan erobert worden wäre... (Witold<br />
M. Orłowski: Hundert Jahre Chaos. Eine alternative Geschichte<br />
des 20. Jahrhunderts).<br />
Kurz gesagt: Allein die Tatsache, dass das Buch, das du<br />
liest, einer bestimmten Fachrichtung angehört, bedeutet<br />
nicht, dass sich deine Lektüre auf einen klar abgesteckten<br />
Bereich mit einer festen Terminologie beschränken wird.<br />
Unter dieser Prämisse werde ich versuchen, einen kurzen<br />
Überblick über die geisteswissenschaftlichen Neuerscheinungen<br />
des letzten Jahres zu geben. Es liegt nahe, mit der<br />
Politik zu beginnen, denn der mit dem Etikett der „Vierten<br />
Polnischen Republik“ versehene politische Wandel führte<br />
zu zahlreichen kritischen Auseinandersetzungen sowohl mit<br />
der älteren als auch mit der neueren polnischen Geschichte.<br />
Nachdem 2005 zwei differenzierte Studien über die Chefideologen<br />
der beiden wichtigsten polnischen Parteien, PO<br />
und PIS erschienen (Paweł Śpiewak: Die Erinnerung an den<br />
Kommunismus und Zdzisław Krasnodębski: Periphere Demokratie)<br />
veröffentlichte im Jahr darauf der bekannte Publizist<br />
Rafał A. Ziemkiewicz ein wütendes Pamphlet gegen die Zeit<br />
der „Dritten Polnischen Republik“ (Die Michnik-Herrschaft.<br />
Chronik einer Krankheit). So sehr sich diese Autoren auch<br />
in ihrem Temperament unterscheiden, verbindet sie doch<br />
ein gemeinsamer Ansatz, der aus der „Hermeneutik der Verdächtigung“<br />
entsteht und sich vor allem der Demaskierung<br />
widmet: Die erste Phase der polnischen Unabhängigkeit<br />
wird als eine pathologische Erscheinung in liberaler Kostümierung<br />
beschrieben.<br />
Auch der linke Flügel der polnischen intellektuellen Szene<br />
widmet sich der Demaskierung des Liberalismus (und des<br />
Neoliberalismus): Der in Krakau ansässige Verlag Ha!art<br />
startete eine Reihe mit dem Titel „Radikale Linie“, der die<br />
polnische Gesellschaft aus der Perspektive der an den Rand<br />
Gedrängten beschreiben soll. Die Initiatoren dieser Reihe<br />
bekennen sich zu „einer freiheitlichen Weltanschauung und<br />
einer Perspektive des selbstbestimmten Aktivismus“. Der erste<br />
Band nimmt direkten Bezug auf Czesław Miłoszs Verführtes<br />
Denken (Ewa Majewska & Janek Sowa [Hrsg.]: Verführtes<br />
Denken 2), handelt jedoch nicht mehr von der „kommunistischen“<br />
sondern von der „liberalistischen Verführung“. Der<br />
zweite Band nimmt eine noch radikalere Position ein, indem<br />
er das Bild einer Demokratie „ohne Politiker“ entwirft (Rafał<br />
Górski: Ohne den Staat. Die aktiv partizipierende Demokratie.<br />
Mit einem Vorwort von Jan Sowa)<br />
Diesen radikalen Protesten gegen die liberale Mythologie<br />
nähern sich auch die Aussagen polnischer Künstler an, die<br />
von Artur Żmijewski in dem hervorragenden, ebenfalls bei<br />
Ha!art in der Reihe Politische Kritik erschienenen Buch Zitternde<br />
Körper gesammelt wurden. Neben den Gesprächen<br />
mit bildenden Künstlern aus dem Umfeld der so genannten<br />
„Kritischen Kunst“ (wie Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra<br />
und Zbigniew Libera) finden sich in diesem Buch auch<br />
diverse intime Zeugnisse (Tagebucheinträge, Projekte) und<br />
zahlreiche Illustrationen. Wie Żmijewski bereits im Vorwort<br />
des Buches erklärt, fordert diese Bewegung eine radikale Einbindung<br />
der Kunst in die öffentliche Diskussion, indem sie<br />
die künstlerische Äußerung als Form des Diskurses versteht.<br />
Eine besondere Position im polnischen Dialog zwischen<br />
Tradition und Moderne nehmen die Stimmen der katholischen<br />
Dissidenten ein. Ein hervorragendes Beispiel dafür<br />
sind die Gespräche mit dem ehemaligen Dominikanermönch<br />
Tadeusz Bartoś kurz vor dessen Austritt aus dem<br />
geistlichen Stand (Wege der Freiheit. Über die Theologie, die<br />
Säkularisierung, die Demokratie in der Kirche, das Zölibat...<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Mit O. P. Tadeusz Bartoś spricht Krzysztof Bielawski). Obwohl<br />
sich Bartoś von der realen Politik der katholischen Kirche distanziert,<br />
hält er doch gleichzeitig eine Lobrede auf die Theologie.<br />
Mit Wege der Freiheit erschien bereits die dritte in den<br />
letzten Jahren kritische Auseinandersetzung eines polnischen<br />
Geistlichen mit seiner eigenen Institution.<br />
Auch im Bereich der Literaturwissenschaft gab es einige<br />
wichtige Neuerscheinungen: Die Rückkehr der Zentrale<br />
von Przemysław Czapliński (dem emsigsten Kritiker der<br />
zeitgenössischen Literatur), der die marktwirtschaftliche<br />
Reintegration des polnischen Literaturlebens (nach seiner<br />
Zersplitterung in den Anfangsjahren der Transformation) beschreibt;<br />
die von Włodzimierz Bolecki herausgegebene und<br />
mit einem fast sechshundertseitigen (!) kritischen Anhang<br />
versehene, fundamentale Neuausgabe von Witold Gombrowiczs<br />
Ferdydurke; die kritisch-feministischen Essays von<br />
Krystyna Kłosińska (Miniaturen. Über ‚weibliches’ Schreiben<br />
und Lesen) sowie Maria Janions Versuch einer postkolonialen<br />
Lesart der polnischen Phantasmen des Slawischen (Das unheimliche<br />
Slawentum. Literarische Phantasmen). Mithilfe der<br />
Terminologie Sigmund Freuds beschreibt Janion das Slawische<br />
als etwas Vertrautes, das durch die Verdrängung zum<br />
Unheimlichen wurde.<br />
Besondere Aufmerksamkeit verdienen zwei beeindruckende<br />
biografische Studien, die – aus feministischer Perspektive<br />
– die Schicksale in Vergessenheit geratener Frauen nachzeichnen<br />
(Grażyna Kubica: Malinowskis Schwestern oder die<br />
moderne Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowie Izabela<br />
Filipiak: Regionen des Anderen. Über Maria Komornicka).<br />
Zum Abschluss sollen noch zwei Reisereportagen erwähnt<br />
werden: Mariusz Szczygieł schrieb eine Art tschechisches<br />
Verführtes Denken (Gottland) und Max Cegielski versuchte<br />
in Pakistan einen Dialog mit Vertretern verschiedener Richtungen<br />
des Islam zu führen (Die Gottestrunkenen).<br />
Die geisteswissenschaftlichen Neuerscheinungen des letzten Jahres<br />
109<br />
Krzysztof Kłosiński<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
110<br />
Adressen der Verlage und Agenten<br />
Czarne<br />
Wołowiec 11<br />
PL 38-307 Sękowa<br />
phone/fax: +48 18 351 00 70<br />
fax: +48 18 351 02 78<br />
redakcja@czarne.com.pl, www.czarne.com.pl<br />
De Geus<br />
P.O. Box 1878<br />
NL 4801 BW Breda, The Netherlands<br />
phone: +31 76 522 8151<br />
fax: +31 76 522 25 99<br />
a.v.rijsewijk@degeus.nl, www.degeus.nl<br />
Institut Littéraire Kultura<br />
91, avenue de Poissy<br />
Le Mesnil le Roi, FR 78600 Maisons-Laffitte<br />
phone: +33 1 39 62 19 04<br />
fax: + 33 1 39 62 57 52<br />
kultura@club-internet.fr<br />
korporacja ha!art<br />
Pl. Szczepański 3a<br />
PL 31-011 Kraków<br />
phone/fax: +48 12 422 81 98<br />
korporacja@ha.art.pl, www.ha.art.pl<br />
OPEN Wydawnictwo Naukowe i Literackie<br />
ul. Batystowa 10A m.6<br />
PL 02-798 Warszawa<br />
fax +48 22 648 3031<br />
tel. +48 600 838 593<br />
mdrabikowski@o2.pl<br />
PIW<br />
ul. Foksal 17<br />
PL 00-438 Warszawa<br />
phone: +48 22 826 02 01 ext. 216<br />
fax: +48 22 826 15 36<br />
piw@piw.pl, www.piw.pl<br />
PUENTA Literary Agency<br />
puenta@vp.pl<br />
Rosner & Wspólnicy<br />
ul. Okrzei 1a<br />
PL 03-715 Warszawa<br />
phone/fax: +48 22 333 80 00<br />
biuro@riw.pl, www.riw.pl<br />
Wydawnictwo Sic!<br />
ul. Chełmska 27/23<br />
PL 00-724 Warszawa<br />
phone/ fax: +48 22 840 07 53<br />
biuro@wydawnictwo-sic.com.pl,<br />
www.wydawnictwo-sic.com.pl<br />
słowo/obraz terytoria<br />
ul. Grunwaldzka 74/3<br />
PL 80-244 Gdańsk<br />
phone: +48 58 341 44 13<br />
fax: +48 58 345 47 07<br />
slowo-obraz@terytoria.com.pl,<br />
www.terytoria.com.pl<br />
Syndykat autorów<br />
ul. Garażowa 7<br />
PL 02-651 Warszawa<br />
phone: +48 22 607 79 88<br />
fax: +48 22 607 79 88<br />
info@syndykatautorow.com.pl,<br />
www.syndykatautorow.com.pl<br />
Świat Książki<br />
Bertelsmann Media<br />
ul. Rosoła 10<br />
PL 02-786 Warszawa<br />
phone: +48 22 645 80 72<br />
fax: +48 22 648 47 34<br />
grazyna.brzezinska@bertelsmann.com.pl,<br />
www.swiatksiazki.pl<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
W.A.B.<br />
ul. Łowicka 31<br />
PL 02-502 Warszawa<br />
phone/ fax: +48 22 646 05 10, 646 05 10<br />
a.pieniazek@wab.com.pl, www.wab.com.pl<br />
Więź<br />
ul. Trębacka 3<br />
PL 00-074 Warszawa<br />
phone: +48 22 827 96 06<br />
fax: +48 22 828 18 08<br />
wiez@wiez.com.pl, www.wiez.com.pl<br />
Wydawnictwo Dolnośląskie<br />
Oddział Publicat SA we Wrocławiu<br />
ul. Podwale 62<br />
PL 50-010 Wrocław<br />
phone: +48 71 785 90 40, + 48 71 785 90 59<br />
fax: +48 71 328 89 66<br />
sekretariat@wd.wroc.pl, www.wd.wroc.pl<br />
Wydawnictwo Homini<br />
ul. św. Sebastiana 33/6<br />
PL 31-051 Kraków<br />
phone/fax: +48 12 430 74 27<br />
homini@homini.com.pl, www.homini.com.pl<br />
Wydawnictwo Literackie<br />
ul. Długa 1<br />
PL 31-147 Kraków<br />
phone: +48 12 619 27 40<br />
fax: +48 12 422 54 23<br />
j.dabrowska@wydawnictwoliterackie.pl,<br />
www.wydawnictwoliterackie.pl<br />
Wydawnictwo Pierwsze<br />
Lasek, ulica Słoneczna 20<br />
96-321 Żabia Wola<br />
phone: +48 605 100 691<br />
wydawnictwo@pierwsze.pl, www.pierwsze.pl<br />
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego<br />
ul. Bankowa 12B,<br />
PL 40-007 Katowice<br />
phone: +48 32 359 20 56<br />
fax : +48 32 359 20 57<br />
www.wydawnictwo.us.edu.pl,<br />
wydawus@us.edu.pl<br />
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego<br />
pl. Uniwersytecki 15<br />
PL 50-137 Wrocław<br />
phone: +48 71 375 28 09<br />
fax: +48 71 375 27 35<br />
biuro@wuwr.com.pl, www.wuwr.com.pl<br />
Zeszyty Literackie<br />
ul. Foksal 16<br />
PL 00-372 Warszawa<br />
phone /fax: +48 22 826 38 22<br />
biuro@zeszytyliterackie.pl,<br />
www.zeszytyliterackie.pl<br />
Znak<br />
ul. Kościuszki 37<br />
PL 30-105 Kraków<br />
phone: +48 12 619 95 01<br />
fax: +48 12 619 95 02<br />
rucinska@znak.com.pl, www.znak.com.pl<br />
Zysk i s-ka<br />
ul. Wielka 10<br />
PL 61-774 Poznań<br />
phone: +48 61 853 27 51<br />
fax: +48 61 852 63 26<br />
biuro@zysk.com.pl, www.zysk.com.pl<br />
111<br />
Adressen der Verlage und Agenten<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Das Buchinstitut<br />
ul. Szczepańska 1, II p.<br />
31-110 Kraków<br />
Tel: +48-12 433 70 40<br />
Fax: +48-12 429 38 29<br />
office@bookinstitute.pl<br />
www.bookinstitute.pl<br />
Warschauer Filiale<br />
P. Defilad 1, IX p., pok. 911<br />
00-901 Warszawa<br />
Tel: +48-22 656 63 86<br />
Fax: +48-22 656 63 89<br />
warszawa@instytutksiazki.pl<br />
Warszawa 134, P.O. Box 395<br />
112<br />
© Das Buchinstitut, Krakau 2007<br />
Redaktion:<br />
Izabella Kaluta, Joanna Czudec, Elżbieta Kalinowska<br />
Übersetzung:<br />
Friedrich Griese, Bernd Karwen, Ursula Kiermeier, Esther Kinsky, Olaf Kühl, Martin Pollack, Heinz Rosenau,<br />
Paulina Schulz, Andreas Volk<br />
Weitere Informationen über die polnische Literatur auf: www.bookinstitute.pl.<br />
Eine englische Ausgabe dieses Katalogs unter dem Titel 38 New Books from Poland. Fall 2007 kann über<br />
das Buchinstitut bezogen werden.<br />
Graphik und Satz: Studio Otwarte<br />
studiotwarte<br />
www.otwarte.com.pl<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
ÜBERSETZUNGSPROGRAMM ©POLAND gehört zum Programmbereich<br />
des Buchinstituts.<br />
Ziel des Programms ist es, Übersetzungen der polnischen Literatur<br />
zu fördern sowie deren Präsenz auf den ausländischen<br />
Buchmärkten zu stärken.<br />
Das Programm umfasst insbesondere:<br />
» Belletristik und Essayistik<br />
» sowohl alte als auch zeitgenössische geisteswissenschaft-<br />
liche Werke im weitesten Sinne (unter besonderer Berücksichtigung<br />
von Büchern, die der Geschichte, Kultur und Literatur<br />
Polens gewidmet sind)<br />
» Kinder- und Jugendliteratur<br />
» Sachbücher<br />
gestellt werden. Das Angebotsformular des Programms kann<br />
bei dem Buchinstitut angefordert werden oder von der Website<br />
www.bookinstitute.pl heruntergeladen werden:<br />
Die Angebote der Verlage werden von einer Expertengruppe<br />
beurteilt. Die endgültige Entscheidung trifft der Direktor des<br />
Buchinstituts.<br />
KONTAKT:<br />
E-mail: j.czudec@bookinstitute.pl<br />
Das Buchinstitut<br />
ul. Szczepańska 1, PL 31-011 Kraków<br />
Tel. (+48) 12 426 79 12, Fax (+48) 12 429 38 29<br />
Im Rahmen des Programms können u.a. folgende Kosten finanziert<br />
werden:<br />
» bis zu 100 % der Kosten des Lizenzerwerbs<br />
» bis zu 100 % der Übersetzungskosten eines Werkes aus<br />
dem Polnischen<br />
Angebote können von allen Verlagen abgegeben werden, die<br />
ein in polnischer Sprache geschriebenes Buch in eine fremde<br />
Sprache übersetzen lassen und herausgeben wollen.<br />
Dem Angebot müssen folgende Unterlagen beigefügt werden:<br />
» das ausgefüllte Angebotsformular<br />
» Kopie des Lizenzvertrags (oder Kopie des Vorvertrags)<br />
» Kopie des Übersetzervertrags (oder Kopie des Vorvertrags)<br />
» aktuelles Verlagsprogramm und allgemeine Informationen<br />
zum Verlag<br />
» Bibliographie des Übersetzers<br />
» kurze Begründung für die Wahl des jeweiligen Werks<br />
» detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan der Publikation<br />
unter Angabe der Vertriebsform<br />
Anträge auf die Förderung von Übersetzungen polnischer<br />
Literatur können von Verlegern bei dem Buchinstitut in Krakau