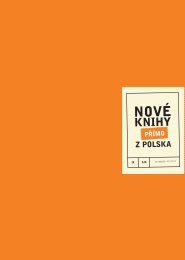Untitled - Instytut KsiÄ Å¼ki
Untitled - Instytut KsiÄ Å¼ki
Untitled - Instytut KsiÄ Å¼ki
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
NEUE<br />
BÜCHER<br />
AUS<br />
POLEN
DAS POLNISCHE<br />
BUCHINSTITUT<br />
Das Polnische Buchinstitut ist eine staatliche Kultureinrichtung,<br />
deren Hauptziele darin liegen, die Lesebereitschaft zu fördern,<br />
das Buch als Medium und die Leselust in Polen zu verbreiten<br />
sowie weltweit für die polnische Literatur zu werben. Diese<br />
Ziele werden umgesetzt durch:<br />
» Vorstellung der besten polnischen Bücher und Werbung für<br />
ihre Autoren<br />
» Bildungsmaßnahmen, die die Vorteile aus einem vertrauten<br />
Umgang mit dem Buch verdeutlichen<br />
» Programme zur Leseförderung<br />
» Präsentation der polnischen Literatur im Ausland<br />
» Übersetzerkolleg<br />
» Seminare für Verleger<br />
» Übersetzungsprogramm © POLAND<br />
» Sample Translations © POLAND<br />
» Informationszentrum für Kinderbücher<br />
» Informationsportal zur polnischen Literatur<br />
www.bookinstitute.pl<br />
Das Buchinstitut organisiert Literaturprogramme bei polnischen<br />
Auftritten auf ausländischen Buchmessen, bereitet Lesungen<br />
polnischer Schriftsteller bei Literaturfestivals vor, gibt regelmäßig<br />
den Katalog „NEUE BÜCHER AUS POLEN“ heraus, in dem<br />
literarische Neuerscheinungen präsentiert werden, organisiert<br />
Studienreisen und Seminare für Übersetzer polnischer Literatur,<br />
zu denen es ständigen Kontakt pflegt, und verleiht den Preis<br />
„TRANSATLANTYK“ für den besten Vermittler polnischer Literatur<br />
im Ausland.<br />
Das Programm der Leseförderung besteht aus einer Reihe von<br />
Maßnahmen, die sich an Schulen, Bibliotheken und NGOs richten.<br />
Dazu gehört u.a.: das Projekt Buchdiskussionsklubs.<br />
www.bookinstitute.pl bietet Informationen zu aktuellen literarischen<br />
Erscheinungen und Events in Polen und im Ausland, präsentiert<br />
Neuerscheinungen und Verlagsprogramme und betreibt<br />
einen regelmäßigen Rezensions-Service. Man findet dort außerdem<br />
über 100 Kurzporträts zeitgenössischer polnischer Autoren,<br />
die Vorstellung von über 500 Publikationen, Fragmente, Essays,<br />
Anschriften der Verleger und Literaturagenten. Alles über polnische<br />
Bücher – auf Polnisch, Englisch, Deutsch und Hebräisch.
AUSGEWÄHLTE PROGRAMME<br />
DES BUCHINSTITUTS<br />
DAS ÜBERSETZUNGSPROGRAMM ©POLAND<br />
Ziel des Programms ist es, Übersetzungen polnischer Literatur zu<br />
fördern und ihre Präsenz auf den ausländischen Buchmärkten zu<br />
stärken. Das Programm umfasst insbesondere Belletristik und Essayistik,<br />
Kinder- und Jugendliteratur, Sachbücher.<br />
Angebote können von allen Verlagen abgegeben werden, die ein<br />
in polnischer Sprache geschriebenes Buch in eine fremde Sprache<br />
übersetzen lassen und herausgeben wollen.<br />
Im Rahmen des Programms können u.a. folgende Kosten finanziert<br />
werden:<br />
• bis zu 100 % der Kosten des Lizenzerwerbs<br />
• bis zu 100 % der Übersetzungskosten eines Werkes aus dem<br />
Polnischen.<br />
SAMPLE TRANSLATIONS ©POLAND<br />
Das Ziel dieses Programms – es richtet sich an Übersetzer polnischer<br />
Literatur – ist es, im Ausland für polnische Literatur zu werben,<br />
indem man Übersetzer ermutigt, polnische Bücher ausländischen<br />
Verlegern zu präsentieren.<br />
Bezahlt werden 20 Seiten einer Probeübersetzung.<br />
Die Bewerbungsformulare beider Programme können postalisch<br />
beim Buchinstitut in Krakau angefordert, oder von der Website<br />
www.bookinstitute.pl heruntergeladen werden.<br />
ÜBERSETZERKOLLEGIUM<br />
Das Programm wird vom Buchinstitut in Zusammenarbeit mit dem<br />
Verein Villa Decius und der Jagiellonen-Universität durchgeführt.<br />
Es richtet sich an Übersetzer polnischer Literatur, die Belletristik,<br />
Essayistik, Dokumentarliteratur oder geisteswissenschaftliche Literatur<br />
im weitesten Sinne übertragen und bietet ein- bis dreimonatige<br />
Stipendienaufenthalte in Krakau.<br />
TRANSATLANTIK<br />
Transatlantik ist der alljährig von dem Buchinstitut vergebene<br />
Preis für Persönlichkeiten, die sich für die Verbreitung der polnischen<br />
Literatur im Ausland einsetzen. Der Preis, dotiert mit 10.000<br />
Euro, kann u. A. an Übersetzer, Verleger, Literaturkritiker, Polonisten<br />
verliehen werden.<br />
KONTAKT:<br />
Das Polnische Buchinstitut<br />
ul. Szczepańska 1<br />
PL 31-011 Kraków<br />
E-mail: office@bookinstitute.pl<br />
Phone: +48 12 433 70 40<br />
Fax: +48 12 429 38 29<br />
www.bookinstitute.pl<br />
Direktor des Polnischen Buchinstituts:<br />
Grzegorz Gauden
INHALT<br />
SEITE<br />
6<br />
8<br />
10<br />
12<br />
14<br />
16<br />
18<br />
20<br />
22<br />
24<br />
26<br />
28<br />
30<br />
32<br />
34<br />
36<br />
38<br />
40<br />
42<br />
44<br />
46<br />
AUTOR<br />
DOROTA MASŁOWSKA<br />
JOANNA BATOR<br />
TOMASZ RÓŻYCKI<br />
ZYTA ORYSZYN<br />
KRZYSZTOF VARGA<br />
SYLWIA CHUTNIK<br />
IGOR OSTACHOWICZ<br />
ZOŚKA PAPUŻANKA<br />
MARIUSZ SIENIEWICZ<br />
ADAM WIEDEMANN<br />
ŁUKASZ ORBITOWSKI<br />
MAŁGORZATA SZEJNERT<br />
WOJCIECH JAGIELSKI<br />
JACEK HUGO-BADER<br />
KATARZYNA SURMIAK-DOMAŃSKA<br />
PAWEŁ SMOLEŃSKI<br />
MARIUSZ WILK<br />
OLGA TOKARCZUK<br />
FILIP SPRINGER<br />
MARTA GUZOWSKA<br />
ADRESSEN DER VERLAGE UND AGENTEN<br />
TITEL<br />
Liebling, ich habe die Katzen getötet<br />
Dunkel, beinah Nacht<br />
Bestiarium<br />
Die Rettung von Atlantis<br />
Späne<br />
Die Schlawinerinnen<br />
Die Nacht der lebenden Juden<br />
Das Affenhaus<br />
Dornröschens Beichte<br />
Entsprechungen<br />
Gespenster<br />
Das Heim der Schildkröte. Sansibar<br />
Brennendes Gras<br />
Kolyma-Tagebücher<br />
Sumpflein<br />
Der Araber schießt, den Juden freut‘s<br />
Der Zug der Gänse<br />
Der Moment des Bären<br />
Von schlechter Geburt<br />
Die Opferung der Polyxena
6<br />
DOROTA MASŁOWSKA<br />
DOROTA MASŁOWSKA (GEB. 1983),<br />
SCHRIFTSTELLERIN, DRAMATIKERIN.<br />
DEBÜTIERTE 2002 MIT IHREM<br />
ROMAN „SCHNEEWEISS UND<br />
RUSSENROT“. DER ZWEI JAHRE<br />
SPÄTER ERSCHIENENE ROMAN<br />
„DIE REIHERKÖNIGIN“ BRACHTE<br />
IHR DEN NIKE-PREIS EIN. IHR<br />
DRAMA „ZWEI ARME POLNISCH<br />
SPRECHENDE RUMÄNEN“ WURDE<br />
U. A. IN AUSTRALIEN, IN DEN USA<br />
UND AUF DER INSEL SACHALIN<br />
AUFGEFÜHRT.<br />
Photo: Marcin Nowak<br />
Liebling, ich habe die Katzen getötet<br />
Dieser Roman ist eine Offenbarung! Wer hätte geglaubt, dass das sensationelle<br />
„Schneeweiß und Russenrot” noch zu übertreffen wäre? Aber Dorota<br />
Masłowska, die begabteste Autorin der jungen Generation, ausgezeichnet<br />
u.a. mit dem Paszport Polityki und dem Nike-Preis, hat ihr vermutlich bisher<br />
bestes Buch veröffentlicht.<br />
Eine Überraschung folgt hier auf die andere: Nicht, wie bisher, in Polen<br />
spielt der Roman, sondern in New York. Die Erzählform, bisher meist ein gigantisches<br />
Experiment, ist hier zurecht gestutzt, geglättet – hurtig geht es<br />
voran, ohne auch nur ein bisschen an Ausdruckskraft, ja magnetisierender<br />
Anziehungskraft einzubüßen. Die Sätze kommen so unangestrengt daher,<br />
als hätten sie sich von allein geschrieben. Gleichwohl muss hinter ihrer Eleganz,<br />
Präzision, hinter treffenden Vergleichen und Metaphern und dem Witz<br />
eine konzentrierte schriftstellerische Arbeit gestanden haben. Die Erzählung<br />
rankt sich um die weibliche Hauptperson. Was unverändert geblieben<br />
ist, sind die treffenden Beobachtungen und Ausbrüche von Humor, an die<br />
wir bei dieser Autorin gewohnt sind (deren Gestalt auch diesmal im Buch<br />
auftaucht!).<br />
Die Hauptperson ist Farah („der Farrer“, wie ihre Bekannten schnippisch sagen)<br />
– ein auf die Dreißig zugehender Single – auch wenn ihr Geisteszustand<br />
eher den Begriff der alten Jungfer rechtfertigen würde. Farah verbringt ihre<br />
Zeit mit der Lektüre von Ratgebern für geistige Entwicklung, grübelt über<br />
ihr verpatztes Leben nach und übt sich überhaupt im Totschlagen der Zeit.<br />
Außerdem achtet sie fanatisch auf eine gesunde Lebensweise und geht so<br />
weit, dass sie vor der versuchten Selbstverstümmelung die Rasierklinge<br />
desinfiziert. Zu einer persönlichen Tragödie wird es für sie, als ihre Herzensfreundin<br />
Jo einen Freund findet. Wir lernen eine ganze Heerschar ihrer<br />
(eher entfernten als nahen) Bekannten kennen, die Mittel gegen Depressionen<br />
nehmen und versuchen, in der Welt der Avantgardekunst Karriere zu<br />
machen...<br />
„Liebling, ich habe die Katzen getötet“ ist eine Persiflage auf die westliche,<br />
großstädtische Lebensweise und alle dazugehörigen, zeitgenössischen Modeerscheinungen:<br />
den wohlfeilen, vom Osten abgekupferten geistigen Tiefgang,<br />
den Zwang zum Gutaussehen, zur gesunden Ernährung, vor allem aber<br />
dazu, ostentativ glücklich zu sein. Masłowska bringt uns wie üblich nur deshalb<br />
zum Lachen, damit uns dieses nach einer Weile im Hals stecken bleibt<br />
und wir unserer eigenen Dummheit, Flachheit und Unvernunft ins Auge<br />
schauen. Und schließlich die Einsamkeit – eines der Hauptthemen in diesem<br />
reifsten Buch der „Reiherkönigin“-Autorin ist der unaufhörliche, verzweifelte<br />
und zum Scheitern verurteilte Versuch, den anderen Menschen zu<br />
erreichen. All das beschrieben in einer explosiven Sprachmixtur, die amerikanische<br />
Fernsehserien, den Straßenslang der Großstadt, Google Translator<br />
und poetische, nur dieser Autorin zugängliche Register miteinander<br />
vereint. Ein tolles Buch.<br />
Patrycja Pustkowiak<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
7<br />
Ja,<br />
hier trifft man Jedermann: Bettler wie Fürsten. Den nackten König<br />
auch, sobald nur einer dieser bekloppten Modeschöpfer verkünden<br />
würde, dass in dieser Saison aus Luft genähte Klamotten<br />
der Renner sind...<br />
Luftig, durchscheinend, ultrasexy, und am allerwichtigsten: man braucht<br />
sie nicht zu waschen... Nachteile: die Mängel der Figur kann man schlecht<br />
darunter verbergen. Ja, und andere Leute atmen deine Kleidung. An einer<br />
Ecke drängt dir jemand Hip-Hop auf, frisch aufgenommen bei MacDonalds<br />
auf dem Klo, oder eine Tasche Original chenel, obgleich die Tüte, in der sie<br />
verpackt ist, eher die vier Dollar wert zu sein scheint. An der anderen Ecke will<br />
dich ein beinloser Säufer dazu überreden, dein Leben Jesus zu schenken und<br />
dein Geld ihm, Prophet sein kostet schließlich auch... Und gleich an der dritten<br />
im Boutique-Hotel auf dem goldenen Sofa, unter Bildern von Kjowebiyr<br />
Anogiw, der jetzt schwindelerregende Preise erzielt, sitzen wie die Unschuld<br />
vom Lande die Töchter von Senatoren und diversen Prominenten, saufen sich<br />
die Hucke voll und blättern dabei in „Die widerlich reiche Muschi heute“...<br />
„Womit wirft man am besten nach dem Plasma-Bildschirm? Wir testen<br />
Champagner-Gläser.“<br />
„Nach der Ausschabung in fünf Minuten wieder topfit? Kein Problem. Express-Schminke<br />
für den Notfall.“<br />
„Sexy auf Entzug. Zehn Tricks, um nach einer Million Dollar auszusehen,<br />
wenn du dich in Wirklichkeit wie fünfzehn alte Deutschmark fühlst.“<br />
„Papa, ich habe deinen Hubschrauber zu Schrott geflogen! Wie münze ich<br />
einen amüsanten Fehltritt in Erfolg um.“<br />
„Was tun gegen den Schnauzengeruch des Pekinesen.“<br />
„Weißt du, dass Hunde Säugetiere sind?! Neues aus der Wissenschaft.“<br />
Diese jungen Dinger sind vielleicht nicht gut in der Schule, aber eins muss<br />
man ihnen lassen, in der Mode kennen sie sich bestens aus. Die neueste Kollektion<br />
von Zach de Boom, die sie anhaben, bekam den Namen „Holy“, und<br />
ratet mal, warum. Es ist das „Pilgerermädchen“, das in der letzten Saison die<br />
Phantasie der Modeschöpfer befruchtet hat. Louboutine hat eine Pumps-Serie<br />
herausgebracht, inspiriert von Orthopädie-Sandalen gegen Hühneraugen, und<br />
Vivienne Westwood bietet dazu weiße dicke Herrenstrümpfe mit dem Bild<br />
gekreuzter Tennisschläger in Knöchelhöhe, oder ganz einfach nackte Füße,<br />
aussätzig, mit einem karierten Taschentuch verbunden. Die Haare haben in<br />
dieser Saison unfrisch zu sein, „unattraktiv“, und ganz wichtig: „fettendes“<br />
Make-up, trockene Lippen, am besten aufgeplatzt beim Küssen des Kruzifixes,<br />
leichte Selbstverstümmlungen. Von weitem könnte man denken, das seien<br />
irgendwelche durchgeknallten Dämchen, die auf den Knien von Lourdes hierher<br />
gerutscht sind, um das Wort Christi zu verkünden, aber schaut man genauer<br />
hin, sieht man zwischen den Polyesterlippen perlweiße Zähne blinken,<br />
die teurer sind als deine Seele, als dein ganzes beschissenes Dasein.<br />
Schon will dir scheinen, ihre einzige Beschäftigung sei das Schreien: O mein<br />
Gott! O mein Gott! und der prüfend schweifende Blick, ob der große Eindruck,<br />
den sie machen, sich gleichmäßig über dieses Tal der Tränen verteilt.<br />
Doch versuch nur einmal, dich wie ein Sack unnützen Mülls an sie heranzuwanzen,<br />
Erbarmen kannst du von ihnen nicht erwarten, sie nehmen dich in<br />
die Mangel. Wenn du kein Brot hast, sagen sie erst, dann iss Kuchen; und<br />
wenn du keinen Kuchen hast, dann iss Sahnetorte mit organischen Himbeeren.<br />
„Ich habe keine solche Torte“, flüsterst du und schluckst schmerzhaft.<br />
„Dann lass dir eine mit dem Flugzeug aus der Schweiz schicken.“ Da gibt es<br />
nichts, sie hassen einstudierte Hilflosigkeit, auch für sie war das Leben kein<br />
Zuckerlecken. Auch sie waren einmal obdachlos und haben nicht lange gejammert,<br />
sondern sich einen Palast in Florenz gekauft. Auch sie hatten einmal<br />
keinen Porsche, da haben sie sich einen Ferrari gekauft. Also wenn du schon<br />
so ein verrenktes Stück Ich-Scheiße bist, dann hab wenigstens Mitleid und<br />
verpiss dich von hier, sonst rufen sie die Wachleute. Sie kennen keinen Gnade,<br />
kein Schönheitschirurg, der etwas auf sich hält in dieser Stadt, trägt diesen<br />
Namen!<br />
So ist das in der Bohemian Street, da braucht man nicht lange drum herumzureden;<br />
demokratisch ist hier allein das Donnerleuchten der Stadt aus<br />
der Ferne und dieser Gestank, den man letzten Endes auch lieb gewinnen<br />
kann: eine Mischung aus Müll, frisch gebackenen Muffins, teuersten Parfüms,<br />
Menschen-Aa und Blechzeug aus den Eingeweiden der Metro. Das obsessive<br />
Leben dieses Distrikts endet nie, und des Nachts wird es erleuchtet vom petrochemischen<br />
Schimmer der nahegelegenen Maklergebäude.<br />
Genau hier arbeitete Joanne Jordan, zwischen der Chase und dem Laden<br />
mit Ajurveda-Kosmetika.<br />
Viele assoziieren den Salon mit seinem auffällig an den Haaren herbeigezogenen<br />
Namen: „Hairdonism“. Was soll’s... Ausgedacht hat ihn sich der Besitzer,<br />
ein Kunstliebhaber mit dem Vornamen Jed, der sich bei Künstlern gern<br />
lieb Kind macht, aber im Grunde verzehrt wird von einem nie erlöschenden<br />
Groll auf das Karma, weil er selbst nicht als einer von ihnen geboren wurde.<br />
Und aus noch ein paar anderen Gründen. Wie so viele versucht er, diese Unzufriedenheit<br />
mit Hilfe von Äthylalkohol abzutöten; darin ist er konsequent, geduldig<br />
und imprägniert gegen die unausbleiblichen Niederlagen. Denn dieser<br />
Groll scheint nie zur vergehen, sondern im Gegenteil, wie das so ist, literweise<br />
begossen mit Wein, unverdünntem Whisky und „Stolitschnaja“, aufzuquellen<br />
und, Knospen gleich, immer neue Handlungsstränge zu treiben, sich neue<br />
Objekte zu suchen und weitere Schichten seiner ziemlich einsamen Lebensweise<br />
zu durchdringen.<br />
Jed ist ein großer, dicker Kerl mit recht sympathischem Gesicht, das dazu<br />
neigt, in sämtlichen Rottönen zu schillern, was ziemlich genaue Schlüsse auf<br />
den Grad seines Wirklichkeitsverlustes zulässt: von leichtem Wangenrouge bis<br />
hin zum melancholisch blinkenden Scharlachrot des nicht durchgebratenen<br />
Beefsteaks. In ganz passablen Jacketts und italienischen Schuhen versucht er,<br />
seinem Betrieb künstlerischen Schick zu verleihen, indem er jede Spalte mit<br />
Büchern voll stopft, wie es gerade kommt und stapelweise für einen Dollar<br />
zu kaufen war (Moby Dick, Mit der Osteoporose auf du und du, Leben und Tod<br />
Stalins, Decoupage an einem Wochenende, Sein wie Elton John). Er behauptet,<br />
einmal vergleichende Literaturwissenschaft studiert zu haben, dann aber drogenabhängig<br />
geworden zu sein, zum Glück hat er da heil wieder heraus gefunden,<br />
was nicht gerade oft vorkommt... Wenn er das wieder einmal erzählte,<br />
sturzbetrunken, Hand aufs Herz, dann musste man ihm einfach abnehmen,<br />
dass aus ihm ein ganz guter Essayist geworden wäre. Wenn sie gerade keinen<br />
Kunden hat, wirft Joanne manchmal einen Blick in diese bizarre Büchersammlung,<br />
liest aufs Geratewohl herausgepickte Sätze vor und wahrsagt<br />
sich selbst daraus oder setzt sie auf ziemlich sinnlose Weise mit ihrer eigenen<br />
Meinung zum betreffenden Thema in Bezug, zum Beispiel:<br />
„Er ließ sich nicht ablenken: Hör mal, der alte Köter quält sich nur!“ las sie<br />
und fügte von sich aus hinzu:<br />
„Der arme Hund. Ich hasse es, Tiere leiden zu sehen“, bevor sie den Steinbeck<br />
ins Regal zurück stellte. Oder so wie jetzt:<br />
„Zum Glück habe ich Reste von Karriere und phantastische Kinder.“ He,<br />
soll ich das als Prophezeiung nehmen? Meine Periode ist längst überfällig!<br />
„Schon wieder? seufzte Mallery, die gerade ins Magazin ging, um Bleichmittel<br />
zu holen.“<br />
„Schon wieder“, sagt Joanne, streckt ihr die Zunge heraus und greift sich ein<br />
anderes Buch: „Soweit mir bekannt ist, enden Gebiete nicht plötzlich, sondern<br />
gehen unmerklich in die benachbarten über.“<br />
Das war dann doch zuviel für sie.<br />
„Was für ein Unsinn“, sagte sie und drehte das Radio lauter (Beyoncé lief,<br />
die fand sie toll). „Ist dieser Beckett nicht ein Tennisspieler? Eins ist sicher: der<br />
Typ ist ganz schön durchgeknallt.“<br />
Und genau als sie das sagte, kam ein Mädchen in den Salon.<br />
Aus dem Polnischen von Olaf Kühl<br />
© Dorota Masłowska 2012 in Absprache mit Author’s Syndicate Literary Agency<br />
Für die polnische Ausgabe © 2012, Editions Noir sur Blanc, Warszawa<br />
NOIR SUR BLANC, WARSZAWA 2012<br />
145 × 235, 160 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7392-393-5<br />
TRANSLATION RIGHTS: AUTHORS’ SYNDICATE LITERARY AGENCY<br />
RIGHTS SOLD TO: FRANCE / NOIR SUR BLANC<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
8<br />
JOANNA BATOR<br />
JOANNA BATOR (GEB. 1968) IST PROSAISTIN,<br />
PUBLIZISTIN UND EHEMALIGE LEHRBEAUFTRAGTE<br />
AN DER UNIVERSITÄT WARSCHAU. SIE BEFASST<br />
SICH U.A. MIT FEMINISMUS, POSTMODERNE<br />
UND PSYCHOANALYSE. BISHER SIND DIE<br />
BEIDEN ROMANE SANDBERG UND WOLKENFERN<br />
ERSCHIENEN, DEREN HANDLUNG IN BATORS<br />
HEIMATSTADT WAŁBRZYCH SPIELT, SOWIE<br />
DER JAPANISCHE FÄCHER, EIN EXZELLENTES<br />
BUCH, DAS JEDER JAPANLIEBHABER GELESEN<br />
HABEN SOLLTE.<br />
Photo: Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute<br />
Dunkel, beinah Nacht<br />
Mit ihrem neuen Buch beweist Joanna Bator wieder einmal, dass sie eine der<br />
interessantesten polnischen Schriftstellerinnen der mittleren Generation<br />
ist. Dunkel, beinah Nacht entführt den Leser – ähnlich wie die hervorragend<br />
aufgenommenen Vorgängerromane Sandberg und Wolkenfern – auf eine Reise<br />
nach Wałbrzych in Schlesien. Diesmal ist es allerdings eine etwas düsterere<br />
Erkundungsfahrt. Zusammen mit der Protagonistin des Buches, der<br />
Zeitungsreporterin Alicja Tabor, erfährt der Leser die schmerzliche, bis in<br />
den Zweiten Weltkrieg zurückreichende Geschichte ihrer Familie und nahestehender<br />
Personen.<br />
Alicja fährt von Warschau in ihre Heimatstadt Wałbrzych, um einen Artikel<br />
über das geheimnisvolle Verschwinden dreier Kinder – Andżelika, Patryk<br />
und Kalinka – zu schreiben. Doch der Fall verbindet sich mit anderen, bislang<br />
unaufgeklärten Ereignissen: In der Stadt ist es zu einer Reihe von Fällen<br />
grausamer Tierquälerei gekommen, und selbsternannte Propheten sind<br />
am Werk. Alicja quartiert sich in dem alten, von den Deutschen erbauten<br />
Wohnhaus ihrer Kindheit ein und tritt mit den sich äußerst seltsam benehmenden<br />
Einwohnern der Stadt in Kontakt, um Material für die Reportage zu<br />
sammeln. Den verworrenen Geschichten entnimmt sie nach und nach die<br />
Wahrheit über sich selbst und ihre tragische Kindheit, auf die der Wahnsinn<br />
der Mutter und der Tod der Schwester, die von der Legende um Schloss Fürstenstein<br />
und seine schöne, von einem Bann belegte Bewohnerin Prinzessin<br />
Daisy fasziniert war, ihren Schatten warfen...<br />
Ähnlich wie in ihren bisherigen Büchern nutzt Bator auch hier die verschiedensten<br />
literarischen Gattungen, um daraus eine einzigartige Geschichte zu<br />
weben. Beherzt bedient sie sich der Konvention der Gothic Novel, aber auch<br />
des psychologischen und des Kriminalromans. Das Ergebnis dient jedoch<br />
nicht, wie man glauben könnte, der scherzhaften Parodierung literarischer<br />
Gattungen. Interessant ist nämlich, dass sich – auch wenn der Roman an die<br />
heute sehr zur humoristischen Lesart verleitende Schauerliteratur anknüpft<br />
– aus Dunkel, beinah Nacht eine ernsthafte Reflexion der Welt herauskristallisiert,<br />
einer Welt, durchdrungen vom Bösen (das hier den Phantasienamen<br />
der „Katzenfresser“ trägt), von historischem Leid, vom Wahnsinn und von<br />
der Tragödie derer, die diese Last ihrer Empfindsamkeit wegen nicht zu tragen<br />
imstande sind.<br />
Die Vergangenheit erweist sich als schwere, wenn nicht gar untragbare<br />
Bürde; die Geschichte wiederholt sich gern, schlafende Dämonen können<br />
jederzeit geweckt werden. Und irgendwo außerhalb dieser allgemeinen<br />
Reflexionen spielt sich schließlich auch noch die einsame Geschichte der<br />
Hauptfigur ab, die an der Unfähigkeit leidet, tiefere, zufriedenstellende Beziehungen<br />
mit anderen Menschen einzugehen. Bator beschreibt dies alles<br />
in einer Sprache, in der die stilistische Einfachheit dicht neben der Poesie<br />
liegt, die Legende sich mit der rauen Gegenwart verflicht. Ein interessantes,<br />
originelles Buch.<br />
Patrycja Pustkowiak<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
9<br />
Als<br />
ich die Tür hinter ihm zuknallte, fiel das Hufeisen herunter,<br />
das an ihrer Innenseite aufgehängt worden war, um Glück zu<br />
bringen – wobei das Glück diesen Wink jedoch übersehen haben<br />
musste. Und das Hufeisen war nicht die letzte Sache, die an diesem Tag abfiel,<br />
auseinanderfiel oder sich als hoffnungslos kaputt erwies. Das Haus starb vor<br />
meinen Augen, als wollte es sich dafür rächen, dass ich es so lange alleingelassen<br />
hatte. Im Tageslicht wurden Flecken abblätternder Farbe an der Decke<br />
und von Feuchtigkeit ausgebeulte Blasen unter den Tapeten sichtbar, verzogene<br />
Böden und Sofas, die von Motten so zerfressen waren, dass man an einigen<br />
Stellen nur noch den weißen Kettfaden sah. Das Abziehbild mit den Veilchen<br />
an der Badezimmertür hatte die Farbe verloren und die einst helllila Blüten<br />
und grünen Blätter sahen nun wie die Flügel toter Insekten aus. Ich stand in<br />
der rostgesprenkelten Wanne und wartete darauf, dass die betagte Gastherme<br />
ansprang und ich duschen konnte, doch als das warme Wasser endlich zu fließen<br />
begann, gab der Duschschlauch auf und platzte entzwei. „Wir machen Keramik-<br />
und Terrakottafliesen“, hatte mein Vater versprochen, „oder vielleicht<br />
statt einfacher Terrakotta lieber einen Zedernholzboden? Dazu ein Whirlpool,<br />
ihr könnt im Whirlpool herumplantschen wie die kleinen Seehunde im Zoo<br />
von Wrocław, was haltet ihr davon? Oder wir lassen uns aus Frankreich eine<br />
Messingwanne auf Löwenfüßen kommen?“, hatte er weiter überlegt und in<br />
großer Geste mit dem imaginären Geld um sich geworfen. Laufende Reparaturen<br />
schienen ihm bei solch hochfliegenden Plänen nicht der Rede wert gewesen<br />
zu sein. Ich ließ Wasser in diese schreckliche Wanne einlaufen und tauchte<br />
ganz unter, auch mit dem Kopf, wie als Kind, wenn meine Schwester daneben<br />
gesessen und aufgepasst hatte, dass ich nicht ertrank. Damals hatten mich die<br />
Geräusche unter Wasser fasziniert: das Klopfen, das Knirschen von Metall auf<br />
Stein, Rufe in verschiedenen Sprachen, hohle Klänge, Ächzer. Das war die<br />
Welt, in die unser Vater hinabstieg und für die er schlussendlich mit dem Leben<br />
bezahlt hatte. Es war vorgekommen, dass er an einem beliebigen Ort mit dem<br />
Finger nach unten zeigte, vor unsere Füße, und im Brustton der Überzeugung<br />
sagte: Irgendwo hier ist er. Irgendwo. Hier. Ist Hitlers Schatz. Wenn ich ihn<br />
finde, und ich habe jetzt eine Karte von wunderbarem Wert und zuverlässiger<br />
Zielsicherheit, ändert sich unser Leben bis zur Unkenntlichkeit. Er würde uns<br />
so glücklich machen, dass wir einander von Neuem kennenlernen müssten.<br />
Irgendwo unter dieser alten Wanne, in der die Geräusche der unterirdischen<br />
Stadt widerhallten, war der Schatz, den unser Vater gesucht hatte, wenn er sich<br />
in seinen ausgetretenen tschechoslowakischen Schuhen auf den Weg machte,<br />
eine Bergarbeiterleuchte vor der Stirn. Ich hatte versucht zu verstehen, warum<br />
er lieber dort war als hier, bei Ewa und mir. „Bitte sehr, meine Damen und<br />
Herren“, hatte meine Schwester gewitzelt, wenn ich tauchte, „hier sehen Sie<br />
Alicja Tabor, die Wasserkameldame, Forscherin der Meere und Ozeane, in<br />
die sie sich begibt, wenn sie von der Wüste genug hat! Die einzige Kameldame<br />
mit Flossen und Kiemen. Eine seltene Gattung. Unter strengem Artenschutz.<br />
Heute erzähle ich Ihnen, was sie im Unterwasserreich unserer Badewanne alles<br />
gesehen und gehört hat.“ Der Spaß hatte darin bestanden, dass ich wahrheitsgemäß<br />
erzählte, was ich gehört hatte – ein Klopfen, wie jemand auf Deutsch<br />
oder einer ähnlichen Sprache zählte, in der es ein statt eins hieß, wie ein Glas<br />
auf Steinboden fiel –, und Ewa dann den Rest dazudichtete. Sie hatte sich<br />
Geschichten ausgedacht, das konnte sie am besten. Und ich konnte zuhören.<br />
Vielleicht irrte ich mich ja, wenn ich glaubte, schon so stark zu sein, dass<br />
dieses Haus voller Tod und Geister mir nichts anhaben könnte. Ich wusste,<br />
dass ich der Angst nicht nachgeben durfte, und war deshalb hier abgestiegen<br />
und nicht in dem von der Redaktion reservierten Hotel, in der niemand eine<br />
Ahnung hatte, dass mir ein altes Haus in Wałbrzych gehörte. Ich redete nicht<br />
gern über die Vergangenheit und knüpfte selten so enge Kontakte mit anderen<br />
Menschen, dass Vertraulichkeiten von mir erwartet wurden. „Ich habe keine<br />
Familie“, sagte ich, wenn die Frage nach meinen Eltern und Geschwistern<br />
kam, die Frage, die meine Bekannten so liebten, denn sie konnten sich Ewigkeiten<br />
über das ihnen widerfahrene Unrecht auslassen, die Traumata und die<br />
Arten, mit ihnen fertigzuwerden, oder eher: nicht fertigzuwerden, indem man<br />
sich jahrelangen Therapien unterzog. Ich dagegen hatte mein ganzes erwachsenes<br />
Leben hindurch meine Kräfte gesammelt, wie man Vorräte für einen<br />
langen Winter zusammenträgt, und ich hatte das Gefühl gehabt, ganz gut<br />
auf diese Reise vorbereitet zu sein. Als in Wałbrzych Kinder zu verschwinden<br />
begannen, wusste ich, dass der Moment gekommen war und dass ich, die von<br />
den Kollegen aus der Redaktion „Alicja Panzernashorn“ genannt wurde, über<br />
sie schreiben musste. Nun war ich hier und das Haus, dessen Schlüssel ich<br />
immer bei mir trug, bleckte sein schadhaftes nachdeutsches Gebiss.<br />
Nach Bad und unterirdischem Konzert beschloss ich, durch alle Räume zu<br />
gehen und nachzusehen, wozu diese Bruchbude imstande war und wozu ich,<br />
Alicja Panzernashorn, imstande war. Im ersten Stock waren zwei Schlafzimmer,<br />
eins davon hatte früher Ewa und mir gehört, und hier, auf dem alten<br />
Doppelbett mit dem Eichenrahmen und der durchgelegenen Matratze, wollte<br />
ich auch jetzt schlafen. Der Tisch, an dem wir früher unsere Hausaufgaben<br />
gemacht hatten, zwei Stühle, ein leerer Schrank, ein Flickenteppich, weiter<br />
nichts. Das zweite Schlafzimmer war seit Jahren leer, dort stand nur ein matratzenloses<br />
Metallbett, traurig wie ein verlassenes Schiffswrack auf einer<br />
Sandbank. Früher einmal, in Zeiten, an die ich mich nicht erinnerte, war es<br />
das Ehebett meiner Eltern gewesen, aber später zog mein Vater nach unten<br />
um, und von da an war das Arbeitszimmer für ihn Schlafzimmer, Esszimmer<br />
und Zufluchtsort in einem. Dorthin ging ich als nächstes, über die Treppe,<br />
die so knarrte, dass ich fürchtete, sie könnte unter meinem geringen Gewicht<br />
zusammenbrechen. Die Banalität des Verfalls ärgerte mich, vielleicht weil ich<br />
im tiefsten Innern erwartet hatte, dieses Haus würde auf irgendeine spektakulärere<br />
und weniger absehbare Weise sterben. Als ich die Tür zu Vaters Zimmer<br />
öffnete, schlug die verdichtete Zeit mir wie eine Woge entgegen. Vor dem<br />
Fenster wuchs das Schloss Fürstenstein aus einem Buchenwald empor, und<br />
wenn unser Vater am Schreibtisch arbeitete, der immer von Stapeln verstaubter<br />
Papiere und Bücher überhäuft war, hatte er, sobald er den Blick von seinen<br />
historischen Abhandlungen, Karten und Plänen hob, dieses Gebäude gesehen.<br />
Nun blickte ich, seine jüngere Tochter, auf Schloss Fürstenstein und die Nebelschwaden<br />
am Fuße seiner Mauern, und es gehörte zu den wenigen Dingen,<br />
die mir immer noch so groß und schön erschienen wie in meiner Kindheit.<br />
Ich zog die alte Wanduhr auf, und als ihr Pendel zu schwingen begann, spürte<br />
ich, wie die hier gefangene Zeit in Bewegung geriet. Etwas machte Klick,<br />
als hätten die Zeit dieses Hauses und meine Zeit sich erst jetzt miteinander<br />
verflochten. Das mit gelblichem Leder bezogene Sofa, auf dem ich als Kind<br />
in den seltenen Momenten gesessen hatte, in denen unser Vater nicht mit der<br />
Schatzsuche beschäftigt war und sich gewachsen fühlte, dem Vatersein die<br />
Stirn zu bieten, gab unter meinem Gewicht einen seufzerähnlichen Ton von<br />
sich. Eine Zeitlang saß ich regungslos da und bemühte mich sogar, nicht zu atmen,<br />
aber ich spürte nichts als Trauer. Das Leder des Sofas war rau und rissig<br />
wie die Ferse eines alten Menschen, ich streichelte es zur Begrüßung. Ich warf<br />
einen Blick in die Küche, die in einem grauen Lichtschein schwamm, als wäre<br />
sie voller Wasser, und Wasser war es tatsächlich, das ununterbrochen in die<br />
Spüle tropfte, von einem kleinen Stalaktiten herab, der sich im Lauf der Jahre<br />
gebildet hatte. Von der Tür, die in den Garten führte, zog es kalt herüber,<br />
Nebel drängte gegen die Fensterscheiben. Der Tisch und die vier Stühle sahen<br />
aus wie die Skelette längst ausgestorbener Tiere, die niemand je zu benennen<br />
oder ins Herz zu schließen vermocht hatte.<br />
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes<br />
W.A.B., WARSZAWA 2012<br />
123 × 195, 528 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7747-628-4<br />
TRANSLATION RIGHTS: W.A.B.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
10<br />
TOMASZ RÓŻYCKI<br />
TOMASZ RÓŻYCKI (GEB. 1970), LYRIKER, ESSAYIST,<br />
ÜBERSETZER AUS DEM FRANZÖSISCHEN, VERFASSER<br />
VON SIEBEN GEDICHTBÄNDEN, DARUNTER DAS<br />
WEITHIN BESPROCHENE POEM ZWÖLF STATIONEN<br />
(2004). GEBOREN UND UNUNTERBROCHEN<br />
WOHNHAFT IN OPPELN.<br />
Photo: Krzysztof Dubiel<br />
Bestiarium<br />
Bestiarium ist das späte Romandebüt dieses anerkannten Lyrikers, eines<br />
der interessantesten Autoren der mittleren Generation. Ein ungewöhnlich<br />
origineller Prosatext – eine sehr dichte, metapherngesättigte literarische<br />
Vision, die sich schwer in diskursive Sprache „übersetzen“ lässt. In einer<br />
Julinacht erwacht der namenlose Held in einer fremden Wohnung. Er verhehlt<br />
nicht, dass er dem Alkohol übermäßig zugesprochen hat. Desorientiert<br />
und gleichsam bewusstlos will er nach Hause zurückkehren, wo Frau<br />
und Kinder auf ihn warten, doch dieses banale Vorhaben gerät ihm zu einer<br />
geheimnisvollen, phantasmagorischen Reise – gar nicht einmal so sehr<br />
durch die Stadt, in der sich die Züge von Oppeln erkennen lassen, sondern<br />
durch die mäandernde Düsternis der Erinnerung. Es ist weniger die individuelle<br />
Erinnerung des Helden, als vielmehr eine Familienerinnerung von unbestimmtem<br />
zeitlichen Zuschnitt, und auch die Erinnerung des Ortes, einer<br />
Stadt also, die selbst aus vielen historischen Schichten (den Ebenen von<br />
Geschichte und Kultur) besteht und an ein Palimpsest erinnert.<br />
Von einer Handlung kann man schwerlich sprechen. Wollte man sie aber in<br />
ganz allgemeinen Zügen rekonstruieren, sähe sie folgendermaßen aus: zuerst<br />
kommt der Held – über der Stadt schwebend – in eine Wohnung, in der<br />
er seine Urgroßmutter Apolonia findet; diese händigt ihm einen Schlüssel<br />
aus, den er ihren Schwestern zukommen lassen soll (sowohl diesem Schlüssel<br />
wie praktisch allen Motiven im Bestiarium verleiht der Autor metaphorische<br />
Bedeutung). Dann taucht Onkel Jan auf, mit dem der Held eine<br />
seltsame Reise durch die unterirdische Stadt unternimmt. Der Onkel sagt<br />
eine Sintflut voraus, die gleich darauf zu einem Motiv wird, das die phantastischen<br />
Ereignisse miteinander verknüpft. Den Sinn der großen Sintflut<br />
wiederum versucht ein anderer Verwandter zu deuten – der Bruder des Vaters.<br />
Es geht um eine tiefe Reinigung – vielleicht der Geschichte, vielleicht<br />
der Gegenwart. Klar wird das nicht. Auch andere Ereignisse des Romans (die<br />
endlosen Wanderungen durch das Labyrinth der Keller, die unterirdischen<br />
Kanäle, Begegnungen mit Verwandten oder ihren Geistern) entziehen sich<br />
einer stabilen Deutung. Wie dem auch sei, die Sintflut kommt, und die vom<br />
Onkel gebaute Arche, die die Familie retten sollte, geht unter, auch wenn<br />
das Finale selbst keineswegs grauenerweckend ist. Dem Helden gelingt es<br />
am Ende, seinem Traum, oder waren es nur Übungen der Einbildungskraft,<br />
zu entsteigen. Nichts ist endgültig entschieden. Sicher ist dagegen, dass<br />
Różycki seinen früheren Themen und Obsessionen treu bleibt und uns Angelegenheiten<br />
serviert, die wir – zu einem gewissen Grad – aus seinen vorzüglichen<br />
Gedichten kennen, was keineswegs heißt, dass Bestiarium hinter die<br />
lyrische Erfahrung des Autors zurückfiele, es ergänzt sie vielmehr auf ganz<br />
erlesene Weise.<br />
Dariusz Nowacki<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
11<br />
Mein<br />
Onkel, den funkelnden und wenig gegenwärtigen Blick<br />
nach vorn gerichtet, nahm mitten im Zimmer Aufstellung,<br />
hob den Finger und gebot mir ihm zu folgen. Er schaltete<br />
das Licht im Nachbarzimmerchen an, und meinen Augen bot sich ein ungewöhnliches<br />
Bild: In der Ecke am Fenster stand ein zerwühltes Bett, die<br />
Wäsche zerzaust, zerknüllt und wieder aufgebauscht zu skurriler Blüte. Der<br />
Rest des Zimmers war bis zur Decke mit Regalen vollgestellt, in denen Stapel<br />
von dunklen und durchsichtigen Flaschen lagerten, dicht aneinander wie edle<br />
Weine, die in irgendeinem Kellerchen besserer Zeiten harren. Erstaunlich war<br />
die Anzahl der Flaschen, von denen viele bemoost und verstaubt, andere glänzend<br />
und sauber waren. Die Regale, hergestellt von einem Fachmann für die<br />
Weinlagerung, belegten drei Wände und reichten so hoch, dass die zuoberst<br />
liegenden Flaschen, gar nicht mehr sichtbar, irgendwo verschwanden. Eine an<br />
die Regale gelehnte Leiter erleichterte dem Hausherrn den Zugang zu diesen<br />
entferntesten Regionen der Trunkenheit. Doch als ich genauer hinsah, stellte<br />
ich fest, dass die Flaschen, auch wenn jede von ihnen ihre eigene Form und<br />
Farbe besaß – und darunter waren Wodka-, Milch- und Limonadeflaschen,<br />
Bierflaschen, Öl- und Essigflaschen, Wein- und Cognacflaschen, Whisky-,<br />
Grappa-, Likör-, Champagner- und Bourbon-Flaschen, Porto- und Malaga-<br />
Flaschen, Portwein- und Eiercognac-Flaschen, Becherovka-, Żubrówka- und<br />
Ebereschenbranntwein-Flaschen, Krupnikflaschen, Mineralwasser-, Pfirsichwasser-,<br />
Met-, Calvados- und Raki-Flaschen, Flaschen von Selbstgebranntem,<br />
von Pfeffer- und Zuckerbranntwein, Bimber und Magenbitter, Saft-, Cider-,<br />
Brot-, Kwaß- und Sahneflaschen, Slivovitz- und Rumflaschen, Palinka- und<br />
Spiritusflaschen, Limoncello- und Amaretto-, Armaniak- und Bergerac-Flaschen,<br />
Wermut- und Absinth-Flaschen und Coca-Cola-Flaschen, Sake- und<br />
Reisweinflaschen, Arak-, Puntsch-, Grog- und Goldwasserflaschen, Ginflaschen,<br />
Kümmellikör-, Anis-, Himbeer- und Kirschwasserflaschen, Pastis- und<br />
Ouzoflaschen, Kornelkirschenlikör-, Brandy- und Malibuflaschen, Mondwasser-,<br />
Nusslikör-, Ratafia- und Tequila-Flaschen, Weinbrand-, Fusel- und<br />
Schnapsflaschen, Cherry-, Sangria-, Ciociosan- und Martiniflaschen, Campari-,<br />
Kumiss-, Dünnbier-, Porter- und Ale-Flaschen, Muskat-, Riesling-,<br />
Bordeaux-, Burgunder- und Tokajer-Flaschen, Flaschen von Rhein, Mosel,<br />
Cabernet, Sauternes, Retsina, Madera, Lager, Budweiser, Okowice, Gorzałka,<br />
Dom Perignon, Köllnisch Wasser, Birkenwasser, Gurkenwasser, Sirup, Rizinusöl,<br />
Formalin, Jodin und Atropin, Borsäure, Ameisenwasser, Glyzerin und<br />
Äthanol, Herbavit, Kefir, geweihtem Wasser aus Lourdes, Öl, Klemastin und<br />
Aldehyd – dass all diese Flaschen leider leer waren. Alle waren leer, doch steckte<br />
in jeder ein Korken oder sie war zugedreht, mit einem Lappen, zugestopft<br />
mit einem Papier oder mit rotem Lack versiegelt, abgesehen von denen auf den<br />
untersten Regalen – die ruhten geöffnet an ihrem Ort.<br />
die von Zeit zu Zeit irgendwo im Geäst zwitscherten und pfiffen, langsame<br />
Schritte auf einem Kiesweg. Dann gleich noch etwas, etwas dazwischen, herauszuhören<br />
unter diesen Stimmen, ein dumpfes, unterdrücktes Schluchzen.<br />
Weiter hatte ich den Eindruck, Geräusche eines Bahnhofs zu hören, die Menschenmenge,<br />
Männer- und Frauenrufe, Kinderweinen, Gelächter, die Pfiffe<br />
der Lokomotiven, das Keuchen der Dampfloks, das Klopfen der Wagenräder,<br />
man hörte Tiere, Hühnergegacker und Pferdewiehern, das Stimmengewirr einer<br />
Unterhaltung und das Geschrei von Streitenden, Flüche und das Geräusch<br />
vieler Schritte. Schließlich mächtiges Knallen, Rufe der Verabschiedung und<br />
Stille, und in ihr das anfangs gemächliche, dann immer schnellere Dröhnen<br />
der Zugräder.<br />
Die nächste Flasche enthielt den Klang einer Straßenbahnbimmel und eines<br />
von jemandem gesummten Liedes, dann Stimmen vom Markt, Zurufe und<br />
fröhliches Necken. Eine andere barg ein Gebet, wieder eine andere Kinderquietschen,<br />
Geräusche aus einer Wäscherei, einer Druckerei, einem Geschäft,<br />
einer Kirche, einer Schusterwerkstatt, die Stimme von jemandem, der seine<br />
eigene Kindheit in einer offenbar fremden und doch sehr gut verständlichen<br />
Sprache erzählte, irgendwelche Abenteuer, Schule, Ferien, Arbeit, Krieg, lächerliche<br />
und furchtbare Ereignisse, eine Stimme, die von den Kindern erzählte,<br />
von ihren Eltern, Freunden, Onkeln und Tanten, von Feiertagen und<br />
Sitten, eine Stimme, die von Zeit zu Zeit ein Lied sang, aber niemals das ganze,<br />
nur das ihr in Erinnerung gebliebene Fragment, oder ein Stück von einem<br />
Gedicht aus der Schule rezitierte, die Stimmen vermischten und überlagerten<br />
sich, nach kurzer Zeit schon schrie die Luft ringsum mit Tausenden von Stimmen<br />
und Lauten, doch all das in einem einzigen Seufzer, in etwas, das gleich<br />
darauf zuging, wie der schwere Deckel einer Kiste.<br />
„Hörst du?“ rief der Onkel, „ich habe sie hier alle, ein ganzes Archiv, in<br />
Flaschen abgefüllt, verstehst du? Ein ganzes Leben habe ich daran gesammelt,<br />
ein ganzes Leben. Zwanzig Jahre mit Flaschen herumgezogen. Ha!“ Und sein<br />
Blick war fürchterlich.<br />
Aus dem Polnischen von Olaf Kühl<br />
Der Onkel holte eine verstaubte grüne Weinflasche hervor, die mit einem zusammengerollten<br />
bunten Lappen verstopft war, und hielt sie gegen das Licht.<br />
Ich sah, wie ein Glühbirnenfunke durch das matt gewordene, märchenhafte<br />
Glas im Farbton von Seegras fuhr. Darinnen war nichts. Jetzt gebot er mir mit<br />
einer Fingerbewegung Schweigen, entkorkte die Flasche langsam und hielt<br />
mir ihren schlanken Hals ans Ohr. Ich hörte zuerst ein Rauschen, so etwas wie<br />
ein schwaches, doch aufbrandendes Seufzen, das ferne, gedämpfte Summen<br />
eines Bienenschwarms. Das Rauschen wurde lauter, und bald darauf konnte<br />
ich ihm schon einzelne Laute entnehmen, Geräusche, ein Rascheln und Reiben.<br />
Aus diesem Abgrund, wie aus einem Meer, waren bald darauf einzelne<br />
Laute herauszuhören, Stimmen wie aus einer Ferne, Schritte auf Treppen, das<br />
Öffnen einer quietschenden Tür, ein Krachen, Schläge von einem Hammer,<br />
das Geschrei der Kinder, die aufgeregt im Kreise laufen, eine scharfe, ermahnende<br />
Frauenstimme. Dann Geschirrklappern, Besteckgeklingel, irgendwelche<br />
Geräusche und Laute, eine brummend böse Männerstimme, und dann<br />
wieder der Hammer, der etwas zerschlug. Ich hörte auch so etwas wie das<br />
Knurren eines Motors, das Rauschen von einer nahegelegenen Straße und ein<br />
Radio, das eine fünfzig Jahre alte Melodie spielte. „Pisma twoji polutschaja,<br />
slyschu ja golos rodnoj“ und weiter auf Russisch, das ich wegen des Knackens<br />
und Klopfens nicht verstand. Das alles verschloss sich langsam in Stille, das<br />
Stöhnen ließ nach, der Gesang der Teilchen verstummte.<br />
Mein Onkel öffnete eine zweite, kleine und bauchige Flasche. Feiner, schwer<br />
definierbarer Geruch, süßlich, eine Blume, ein Kraut? Eine Wiese? Eine Blüte,<br />
doch verwelkt. Das Rauschen, das ihr entstieg, verwandelte sich bald in Vogelgesang<br />
und so etwas wie das Rauschen des Windes in den Zweigen. Vögel,<br />
ZNAK, KRAKÓW 2012<br />
124 × 190, 198 PAGES<br />
ISBN: 978-83-240-1891-8<br />
TRANSLATION RIGHTS: ZNAK<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
12<br />
ZYTA ORYSZYN<br />
ZYTA ORYSZYN (GEB. 1940),<br />
SCHRIFTSTELLERIN UND PUBLIZISTIN,<br />
IN DEN ACHTZIGER JAHREN WAR SIE<br />
AKTIVISTIN DER OPPOSITION UND ALS<br />
REDAKTEURIN VON ZEITSCHRIFTEN TÄTIG,<br />
DIE INOFFIZIELL UND AUSSERHALB DER<br />
ZENSUR ERSCHIENEN. SIE DEBÜTIERTE<br />
1970 MIT DEM ROMAN NAJADE, SPÄTER<br />
PUBLIZIERTE SIE U. A. DIE ERZÄHLBÄNDE<br />
SCHWARZE ERLEUCHTUNG (1981) UND<br />
MADAME FRANKENSTEIN (1984). BIS<br />
ZUM ERSCHEINEN DER RETTUNG VON<br />
ATLANTIS (2012) GALT DER ROMAN<br />
GESCHICHTE EINER KRANKHEIT,<br />
GESCHICHTE EINER TRAUER (1990) ALS<br />
IHR AUFSEHENERREGENDSTES WERK.<br />
Photo: private<br />
Die Rettung von Atlantis<br />
Die Rettung von Atlantis ist kein klassischer Roman, es ist eher eine Sammlung<br />
von Erzählungen, die – durch Figuren, Ereignisse und die Erzählsituation<br />
– eng miteinander verbunden sind. In gewisser Hinsicht ist dieses Werk<br />
eine Zusammenfassung des bisherigen Schaffens der Autorin, es ergänzt<br />
Handlungsstränge aus ihrer früheren Prosa und führt sie zu Ende. Die Erzählungen<br />
in Die Rettung von Atlantis kreisen im Prinzip um ein Thema: die Auswirkung<br />
der großen Geschichte im Leben einfacher, durchschnittlicher Menschen.<br />
Die Autorin interessiert sich unverändert für die destruktive Kraft<br />
der Geschichte – vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bis zu den Jahren des<br />
Kriegsrechts in Polen. Zunächst führt uns Oryszyn in die östlichen Vorkarpaten,<br />
wo sich in einem Bunker, bzw. eher einem unterirdischen Versteck, eine<br />
polnische Familie zusammen mit Kriegsflüchtlingen aus dem Zentrum des<br />
Landes verbirgt. Draußen ziehen die Armeen, wüten die Partisanen. Oryszyn<br />
konzentriert sich auf die Emotionen der einfachen und unschuldigen<br />
Protagonisten. Hier regiert die Angst, und die Situation wird verglichen mit<br />
einer niemals endenden Jagd. Später befinden wir uns in der Realität der<br />
unmittelbaren Nachkriegsjahre. Die Familie verlässt den Osten, geht nach<br />
Niederschlesien und bezieht eine Wohnung in einem ehemals deutschen<br />
Haus. Die Traumata der jüngsten Geschichte überschneiden sich scheinbar<br />
mit aktuellen Traumata – Polen tritt in die Epoche des Stalinismus ein, das<br />
Misstrauen nimmt zu, es mehren sich die Denunziationen, es verschwinden<br />
Menschen, die vom Repressionsapparat verhaftet werden. Der Ort selbst<br />
(Leśny Brzeg, kurz zuvor noch das deutsche Waldburg) ist vom Drama der<br />
Vertreibungen gezeichnet, dem Leid der ehemaligen Bewohner, die einst für<br />
Hitler waren und an denen nach 1945 Rache geübt wurde. Von all diesen<br />
Dingen erzählt Oryszyn aus einer naiven und scheinbar verengten Perspektive.<br />
Die Protagonisten rechnen nicht mit der Geschichte ab, sie analysieren<br />
die Welt nicht nach moralischen oder soziopolitischen Kriterien – sie sagen,<br />
was ihnen oder jemandem aus ihrem engsten Umfeld widerfahren ist. Das<br />
ist ein Blick von unten, der auf konkreten Erfahrungen beruht, weitab von<br />
jeder Erhabenheit, und deshalb authentisch und berührend ist. Im letzten<br />
Kapitel des Buches findet sich ein Bezug auf den paradoxen Titel – das Leben<br />
wurde gerettet, aber es trägt schwer an der Gewalt, und unter so widrigen<br />
Bedingungen sollte es verschwinden wie Atlantis.<br />
Dariusz Nowacki<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
13<br />
Die Gleise<br />
verschwanden im Wald hinter der<br />
Kurve.<br />
Hinter der Kurve begann die Welt.<br />
Durch die Welt fuhr man mit dem Zug bis nach Wrocław. Hinter Wrocław<br />
begann das Universum.<br />
Das Universum war von einem eisernen Vorhang in zwei ungleiche Teile<br />
geteilt.<br />
Die Hauptstadt des Universums von Olek Walewski war Moskau. Was die<br />
Hauptstadt des zweiten Universums war, war nicht so ganz klar. Die Amerikaner<br />
meinten, es sei Washington, aber die standen ja auf dem Kopf. Die<br />
Franzosen erklärten, es sei Paris, aber die aßen jeden Tag Frösche und Schnecken.<br />
Die Engländer beharrten darauf, es sei London. Was für ein lustiger<br />
Einfall. Olek Walewski konnte ihre Inselchen unter einem kleinen Tintenfass<br />
verschwinden lassen.<br />
Die Welt wurde von Buchen, Hainbuchen und Eichen, auch von Fichten<br />
und Tannen verdeckt. Einmal kletterte Olek Walewski auf die höchste Eiche.<br />
Das Wetter war kristallklar, wie die Oma bemerkte. Die Kokereien qualmten<br />
nicht, weil es einen Unfall gegeben hatte. Olek dachte sich, dass er unter so<br />
glücklichen Umständen nicht nur die Hügel Gedymina und Sobótka würde<br />
sehen können, sondern auch die Schneekoppe, auf der die Grenze verlief. Und<br />
wenn er schon die Schneekoppe sehen würde, dann auch den eisernen Vorhang,<br />
denn schließlich musste dieser Vorhang bis zum Himmel hinaufreichen.<br />
Es war überhaupt nicht klar, ob der eiserne Vorhang bis zum Himmel hinaufreichte,<br />
oder nur bis zu den erstbesten Wolken. Mietek Szczęsny meinte,<br />
dass er nur bis zu den ersten Wolken gehe. Denn wenn er bis zum Himmel<br />
hinaufreichen würde, dann müsste es in ihm irgendwelche Schleusen oder so<br />
geben, damit die Flugzeuge hindurchfliegen konnten.<br />
Es war auch nicht klar, wie weit dieser Vorhang nach unten ging. Ob er nur<br />
die Erde berührte. Oder ob er sich auch tief in sie eingegraben hatte. Denn<br />
wenn er sich eingegraben hatte, dann brauchte man unbedingt eine Pionierschaufel,<br />
um einen Gang darunter hindurchzugraben.<br />
Die Oma von Olek Walewski war der Meinung, dass der Vorhang nicht<br />
besonders hoch sei und dass man ihn wie einen Eisberg bezwingen könne, und<br />
sie überredete die anderen, sich mit Seilen und Haken einzudecken.<br />
Ihre Flitterwochen hatte sie vor dem Ersten Weltkrieg in Chamonix verbracht,<br />
und dort hatte sie gesehen, wie angeseilte Alpinisten den Gletscher<br />
Bosson bezwangen. Sie hatten Spezialschuhe. Solche mit hervorstehenden<br />
Nägeln. Die Oma bestand darauf, dass sich alle vor der Expedition hinter<br />
den Vorhang die Schuhe mit Nägeln beschlügen. Und dass diese Nägel extra<br />
hervorstünden.<br />
Mietek Szczęsny und Franka Salatycka stimmten für die Pionierschaufel.<br />
Gegen die Seile und extra beschlagenen Schuhe.<br />
Erstens: Sie hatten keine Schuhe, nur Latschen mit Gummisohle.<br />
Zweitens: Interessant, wie Frau Walewska Senior am Eisen hinaufklettern<br />
wollte, selbst wenn es ein wenig rau war. Denn vermutlich war es rau, wo es<br />
doch die Sonnenstrahlen nicht so stark reflektierte, dass der Widerschein in<br />
Leśny Brzeg zu sehen war. Dieser Widerschein hätte einen geblendet und geleuchtet<br />
wie Schnee, und Olek Walewski blendete nichts, auch leuchtete ihm<br />
nichts entgegen, als er auf jener allerhöchsten Eiche saß.<br />
Der eiserne Vorhang hatte sich einige Monate vor dem Referendum gesenkt.<br />
Genau am fünften März 1946.<br />
Olek Walewski hockte gerade auf der Baustelle und beobachtete den Vorfrühling.<br />
Der Vorfrühling sah aus wie Frau Pitkowa im Morgenmantel, wenn<br />
sie morgens die Asche auf den Müll brachte. Unter dem Morgenmantel waren<br />
ihre gebräunten, rissigen Fersen und ein zerschlissenes, schmutzig graues<br />
Nachthemd zu sehen. Die von der ständigen Dauerwelle versengten Haare<br />
ragten im Wind empor wie ausgebleichtes, trockenes, knacksendes Unkraut.<br />
Frau Pitkowa atmete durch den Mund. Ihr halb geöffneter Mund zeigte<br />
schwarze Zähne. Der Mund und die Zähne sahen aus wie eine Baugrube.<br />
Die Baustelle, das waren Erdhaufen und eine Grube neben dem Mietshaus.<br />
Das waren mitsamt den Wurzeln ausgerissene und auf einen Haufen geworfene<br />
Bäume. Backsteine und Säcke mit versteinertem Zement. Zigarettenstummel,<br />
verdorrtes Gras und ein rostiger Bagger mit hoch erhobener Schaufel. Die<br />
Schaufel ähnelte einem Galgen.<br />
Unter dem Galgen standen zwei Hütten. Eine für Hunde und eine für<br />
Menschen. In der Hundehütte kläffte, ohne dass sie herauskam, tagelang eine<br />
schwarze Hündin. Nachts heulte sie, angeblich knabberte sie an ihren eigenen<br />
Pfoten. Das sagte der Wächter, und er gab ihr den Namen Fiśka.<br />
Der Wächter wohnte in der Hütte für Menschen. Er hatte einen Karabiner<br />
und ein Radio. Die Hütte hatte keine Fenster. Nur Ritzen in der Verschalung.<br />
In der Hütte stand eine Liege. Es gab darin elektrisches Licht.<br />
Der Wächter saß oft vor der Hütte für Menschen und hörte zu, wie Fiśka<br />
bellte. Manchmal schnappte er sich den Karabiner und schwor: „Es wird der<br />
Tag kommen, an dem ich dich umlege, du Dreckstöle.“<br />
Er hörte auch Radio. Er war der Meinung, dass alle Bewohner des Mietshauses<br />
Radio hören sollten. Weil man im Radio erfahren kann, wer fremd ist,<br />
und wer dazugehört. Und Fremden ist das Betreten der Baustelle verboten.<br />
Spionen zum Beispiel. Und jeder Spion ist ein Fremder. Auf einen Fremden<br />
muss man den Karabiner anlegen wie auf Fiśka und laut ausrufen: Halt, wer<br />
da, du Spion!<br />
Niemand wusste, wie der Wächter hieß. Es war komisch, eine Amtsperson<br />
nach dem Vornamen, Nachnamen und Geburtsort zu fragen wie beim Verhör.<br />
Als Olek Walewski genau am fünften März 1946 neben der Hütte für<br />
Menschen hockte und den Vorfrühling beobachtete, schaltete der namenlose<br />
Wächter das Radio ein. Fiśka begann zu bellen, und das Radio bummerte<br />
plötzlich los – bumm, bumm, bumm, bumm – und stellte sich um: „Hier<br />
spricht Radio London. Olek wunderte sich, dass der Wächter ein englisches<br />
und kein Radio von den Deutschen hatte, und als er sich genug gewundert<br />
hatte, hörte er in diesem englischen Radio, dass sich ein eiserner Vorhang auf<br />
die Erde gesenkt hatte. Einmal quer über den europäischen Kontinent.<br />
Daraus ging hervor, dass sich solche Hauptstädte wie Warschau, Berlin, Sofia,<br />
Prag oder Budapest und Bukarest vor diesem eisernen Vorhang befanden –<br />
auf der Seite Moskaus. Und der Rest des Universums hinter dem Vorhang war.<br />
Olek Walewski sprang auf, denn das war eine Hiobsbotschaft. Hals über<br />
Kopf lief er zur Oma, um ihr die Hiobsbotschaft zu überbringen. Unterwegs<br />
wiederholte er für sich, wer und wo entdeckt hatte, dass dieser Vorhang niedergegangen<br />
war: und zwar ein gewisser Churchill in der Ortschaft Fulton.<br />
Die Oma versteckte sich leider schon wieder. Er suchte sie an den üblichen<br />
Stellen – hinter der verzinkten Wanne im Flur, in der Wohnung unter dem<br />
Bett, hinter dem Schrank, aber er fand sie nicht.<br />
Aus dem Polnischen von Benjamin Voelkel<br />
ŚWIAT KSIĄŻKI, WARSZAWA 2012<br />
135 × 215, 272 PAGES<br />
ISBN: 978-83-273-0040-9<br />
TRANSLATION RIGHTS: ŚWIAT KSIĄŻKI<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
14<br />
KRZYSZTOF VARGA<br />
KRZYSZTOF VARGA (GEB. 1968),<br />
SCHRIFTSTELLER UND JOURNALIST,<br />
AUTOR VON 11 PROSABÄNDEN,<br />
VERÖFFENTLICHTE ZULETZT<br />
DIE ROMANE EIN GRABSTEIN<br />
AUS TERRAZZO (2007) UND<br />
UNABHÄNGIGKEITSALLEE (2010).<br />
Photo: Krzysztof Dubiel<br />
Späne<br />
Protagonist und gleichzeitig Erzähler von Späne ist der fünfzigjährige Piotr<br />
Augustyn, der als Handelsvertreter eines Warschauer Unternehmens<br />
unentwegt durch Polen reist. Der Roman enthält den Monolog dieser Figur,<br />
gestaltet als eine Art umfassende Beichte, als Generalabrechnung mit dem<br />
Leben, als Gewinn- und Verlustrechnung, obwohl von Gewinn eigentlich gar<br />
keine Rede sein kann. Schließlich bleibt diese Biografie in jeglicher Hinsicht<br />
unerfüllt, sie ist verdammt zu unzähligen Niederlagen, Enttäuschungen und<br />
Demütigungen; der unglückliche und im Grunde groteske Vertreter legt einen<br />
Widerwillen gegen alles und jeden an den Tag. Er verflucht seine Eltern,<br />
die ihm keine anständige Kindheit ermöglicht haben, seine gierige Frau, die<br />
sich, enttäuscht von ihrem Angetrauten, vor Jahren von ihm getrennt hat,<br />
seine Mitreisenden im Zug (er ist unterwegs von Warschau nach Wrocław),<br />
er verachtet die Mitarbeiter des Mutterkonzerns und die Angestellten anderer<br />
Firmen, mit denen er sich ständig trifft, er hasst Erfolgsmenschen<br />
und Verlierertypen, versnobte Jugendliche und modische Künstler. Diese<br />
Aufzählung ließe sich endlos fortsetzen, Augustyn ist zutiefst frustriert,<br />
permanent läuft ihm die Galle über. Das einzige positive Merkmal des (gelinde<br />
gesagt) unsympathischen Vertreters ist seine große Liebe zur alten<br />
Musik, in der er sich bestens auskennt. Doch auch dieses Attribut wendet<br />
sich gegen ihn – Augustyn fühlt sich von der Gegenwart abgeschnitten und<br />
kann sie weder verstehen noch akzeptieren, das heutige Polen (der Protagonist<br />
monologisiert im Jahr 2011) gilt ihm als in jeder Hinsicht schlecht<br />
eingerichtet, seine Einwohner sind Versager wie er, nur unvergleichlich<br />
verlogener. Hier liegt der vielleicht größte Reiz von Späne. Vargas Roman<br />
lässt sich als radikales Pamphlet über die Gegenwart lesen. Die titelgebenden<br />
Späne sind der kümmerliche Stoff, aus dem die Seele des Protagonisten<br />
gemacht ist, sie kennzeichnen sein Bewusstsein, repräsentieren aber<br />
gleichzeitig, oder vielleicht sogar in erster Linie – so der Autor – das Wesen<br />
der Gesellschaft. Die Späne stehen für die allgemeine Verlogenheit, die allgegenwärtige<br />
Heuchelei und den billigen Schund, Verblödung, Neid und den<br />
Triumph des Zynismus, für intellektuellen und mentalen Murks. Natürlich<br />
entsteht so ein bewusst überzeichnetes, karikaturistisches Bild, das aber<br />
dennoch bezwingt. Das Finale, in dem ein letztlich unmotiviertes Verbrechen<br />
geschieht, darf als eigenwilliges Memento interpretiert werden. Der<br />
Autor legt nahe, dass Soziopathie und gewohnheitsmäßiger Hass auf die<br />
Mitmenschen nicht nur einer Geisteshaltung entspringen, sondern auch einer<br />
kriminellen Veranlagung.<br />
Dariusz Nowacki<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
15<br />
Ich<br />
bin Vertreter für Verzichtbares, mein Job ist es, durch Polen<br />
zu fahren, mich mit fremden Menschen zu treffen, die ich gar<br />
nicht treffen möchte, mit ihnen Zeit zu verbringen, die ihren<br />
festen Preis hat, obwohl sie keinerlei Mehrwert erzeugt, dann nach Warschau<br />
zurückzukommen oder den nächsten Ort anzufahren, mal mehr, mal weniger<br />
weit entfernt. Ich bin ein professioneller Pilger, der für seine Akkordpilgerei<br />
bezahlt wird, der Geld bekommt für die vielen hundert Wallfahrtskilometer,<br />
die er fast täglich zurücklegt. Ich pilgere durch Polen, und das ist die schwerste<br />
Bußübung, die überhaupt verhängt werden kann, sie wird aber verständlich,<br />
wenn man bedenkt, dass derjenige, der sie verhängt hat, mir zuvor die Beichte<br />
abgenommen hat. (…)<br />
Ich werde wohl im Laufe meiner (nennen wir es hochtrabend) Berufslaufbahn<br />
in vielleicht hundert Städten gewesen sein, natürlich hauptsächlich in<br />
solchen der mittleren Kategorie, dieses Jahr waren es sechsunddreißig Städte,<br />
also rein statistisch drei Städte pro Monat, aber die Statistik verschleiert ja<br />
üblicherweise mehr als sie aufklärt, schließlich war ich in mehreren Städten<br />
mehr als einmal, und es ist gewiss keine Überraschung, dass dies vor allem die<br />
größten Städte betrifft, die Metropolen, jedenfalls für polnische Verhältnisse.<br />
Ich weiß genau, wo ich wie oft war, weil das alles in einem eigens angelegten<br />
Notizbuch mit festem Einband verzeichnet ist, das ich pedantisch führe:<br />
An- und Abreisedatum, Stadt, Hotel. Natürlich mache ich diese Buchführung<br />
nicht aus Sentimentalität, sondern aus Abrechnungsgründen, ich stelle meine<br />
Reisekosten in Rechnung, das heißt, ich bekomme die Fahrtkosten erstattet,<br />
leider nur 2. Klasse, immerhin Intercity, was aber auch nicht viel heißt, weil<br />
die sowieso immer Verspätung haben, und die Hotelkosten, natürlich maximal<br />
drei Sterne. Dieses Buch mit seinen Daten und Zahlenkolonnen ist meine<br />
Lebensgeschichte. (…)<br />
Meine Auslagen für Essen führe ich nicht auf, für die Verpflegung zahle ich<br />
nämlich selbst, deshalb kaufe ich mir Durchschnittsessen zu Durchschnittspreisen,<br />
nichts Repräsentatives, meistens Kaffee, meistens in einer Kette, Coffee<br />
Heaven, Starbucks oder so etwas, meine Vertragspartner haben ein Faible<br />
für Caféketten, sie denken, das steigere ihr Prestige, außerdem wissen sie, dass<br />
ich zahle, und es ist ja auf jeden Fall besser, im Starbucks seinen Kaffee zu<br />
bekommen als in irgendeinem Marysieńka’s oder so.<br />
Sie haben bei den Ketten dieses Profi-Gefühl; es geht nicht einmal darum,<br />
dass die Kaffeemenge größer ist und der Becher, oder dass statt der müden<br />
Frau mit nachgedunkeltem Haaransatz, die gelangweilt die Tassen bringt,<br />
eine forsche, junge Bedienung sie an den Tresen ruft, es geht allein darum,<br />
dass der Kunde dort dieses Profi-Gefühl hat. Jeder Versager mit seinem Pappbecher<br />
Café latte in der Hand, der so tut, als hätte er es eilig, vermittelt dieses<br />
Profi-Gefühl. Alle Vertragspartner verabreden sich mit mir an solchen Orten,<br />
der Pappbecher Café latte befördert sie von einem Niemand zu einem Niemand<br />
Plus, außerdem hoffen sie, von einem Bekannten gesehen zu werden,<br />
der sich zur selben Zeit mit einem meiner Vertreterkollegen trifft. Unmengen<br />
dieser mürrischen Burschen und genervten Frauen mit Pappbechern in<br />
der Hand habe ich auf meinen Wanderungen an mir vorbeiziehen sehen, in<br />
furchtbarer Eile zu einem Meeting von geradezu unsagbarer Wichtigkeit unterwegs,<br />
auf allen Kanälen funkend: Ich bin hier der Profi, ich habe keine Zeit<br />
für irgendetwas außer meinem Job, ich treffe mich nur mit Leuten meiner<br />
Kragenweite, ich interessiere mich nicht für Leute, die es nicht eilig haben<br />
und die nicht den Kaffee mit aufgeschäumter Milch von der Kette trinken,<br />
bei der ich ihn immer kaufe (obwohl ich jedes Mal heulen könnte, wenn es<br />
ans Bezahlen geht). Der einzige Trost für die Frauen ist, dass sie nur Geld<br />
für Kaffee und Wasser ausgeben, wenn es um – übertrieben gesprochen –<br />
Ernährung geht, manche auch noch für Mentholzigaretten, aber das immer<br />
seltener, ausnahmslos alle sind schlank und balancieren ihre bleichen Leiber<br />
auf dem schmalen Grat zum Untergewicht, diesen ewigen Kampf mit dem<br />
eigenen Körper können sie nur mit ihrem unsympathischen Auftreten kompensieren;<br />
bei meinen zahllosen Meetings hatte ich nicht ein einziges Mal mit<br />
einer sympathischen Vertragspartnerin zu tun, alle sind sie unterkühlt und<br />
zeigen unverhohlen, wie es sie ekelt, sich, und sei es nur beruflich, mit einem<br />
übergewichtigen Fünfzigjährigen mit zunehmend raumgreifender Platte treffen<br />
zu müssen.<br />
Die Caféketten haben w-lan, meine Partner kommen grundsätzlich mit<br />
Laptop, den sie während des Meetings hastig und ohne den geringsten Anlass<br />
hochfahren, aber ihre Laptops sind immer im Standby, ein Klick und über<br />
ihre Gesichter flackert ein zufriedenes Lächeln, das gleich wieder gespielter<br />
Konzentration weichen muss.<br />
Ich gebe ihnen meine Unterlagen, sie geben mir ihre Unterlagen, ich schaue<br />
mir ihre an, sie sich meine, unter Umständen ist eine Unterschrift gefragt, aber<br />
nicht zwangsläufig, es besteht keinerlei Notwendigkeit, den Laptop mitzunehmen,<br />
alle Details sind vorab geklärt worden, per E-Mail, bei Meetings brauche<br />
ich keinen Laptop, ich habe ihn nur, um abends in meiner Hoteleinsamkeit,<br />
untermalt von Straßenlärm und Aufzuggeräuschen, meinen Posteingang zu<br />
überprüfen und der Zentrale die jüngsten überwältigenden Firmenerfolge zu<br />
melden.<br />
So sitzen wir mit unseren Café latte-Bechern herum, sehen wortlos die Papiere<br />
durch und unterschreiben sie anschließend, aber auch das nicht immer,<br />
manchmal unterbreiten wir einander auch lediglich Angebote, ich lege ihnen<br />
eine Offerte vor, sie nehmen sie entgegen, wie ein Einschreiben bei der<br />
Post, und tragen sie zu ihren Vorgesetzten, zu denjenigen, die tatsächlich entscheidungsbefugt<br />
sind, ich bin ja im Grunde eine gemeine Brieftaube, keine<br />
weiße, sondern ein grauer Straßentäuberich. Die Leute, mit denen ich mich<br />
treffe, haben meist keinerlei Befugnisse, sie sind Dienstboten, Piccolos, Laufburschen<br />
auf dem Caféketten-Parcours, die sich im Auftrag ihrer Arbeitgeber<br />
mit meinesgleichen treffen, obwohl sie natürlich ungeheuer wichtig tun, sich<br />
aufplustern, in die Brust werfen und ihr kümmerliches Pfauenrad zu schlagen<br />
versuchen, das ihnen die Vorgesetzten schon ordentlich gerupft haben. Sie<br />
sind belanglos, genau wie ich, alles nur Spiegelfechtereien, und dabei sind sie<br />
immer jünger als ich, Mitte zwanzig, höchstens dreißig, sie könnten meine<br />
Kinder sein, den mühseligen Aufstieg haben sie noch vor sich und sie glauben,<br />
sie könnten den Gipfel erreichen, ich weiß aber, dass sie jahrelang auf<br />
ihrem schmalen Felsvorsprung sitzen und sich daran festklammern werden,<br />
um durchzukommen.<br />
Aus dem Polnischen von Thomas Weiler<br />
CZARNE, WOŁOWIEC 2012<br />
125 × 205, 368 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7536-366-1<br />
TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
16<br />
SYLWIA CHUTNIK<br />
SYLWIA CHUTNIK (GEB. 1979), SCHRIFTSTELLERIN UND STADTFÜHRERIN DURCH WARSCHAU,<br />
HAT KULTURWISSENSCHAFTEN UND GENDER STUDIES STUDIERT, IST SOZIAL ENGAGIERT UND<br />
VORSITZENDE DER STIFTUNG MAMA, DIE SICH IN POLEN FÜR DIE RECHTE VON MÜTTERN EINSETZT.<br />
CWANIARY (DT. DIE SCHLAWINERINNEN) IST IHR DRITTER ROMAN.<br />
Photo: Mikołaj Długosz<br />
Die Schlawinerinnen<br />
„Es gibt keinen größeren Schlawiner als den Warschauer“, sang einst<br />
Stanisław Grzesiuk, polnischer Liedermacher im Warschau der Vorkriegszeit<br />
und unbestrittener Patron des neuesten Romans von Sylwia Chutnik. Der<br />
Rhythmus seiner Balladen, die hier so manches Mal zitiert werden, und er<br />
selbst, der namentlich genannt wird, machen den Ton, den Schick und den<br />
Charme des ganzen Romans aus. Chutnik zeigt, dass Grzesiuks Welt – oder<br />
eher Unterwelt – die nur selten mit der sogenannten großen Welt zusammentrifft,<br />
die Macht hat, die zeitgenössische, entzauberte, getünchte und<br />
modernisierte Wirklichkeit Warschaus zu überdecken. Man muss lediglich die<br />
Literatur und die Geschichte gut kennen, und den Rhythmus der Geschichten<br />
über Stasiek Messerstecher, Antek, den Sohn der Straße, über Geliebte,<br />
Säufer und Dirnen, und am Ende über den Henker, der schon am Galgen<br />
wartet, aufnehmen können. Sylwia Chutnik hat ein besonderes Gespür für<br />
diese Rhythmen. Und sie ist außergewöhnlich einfallsreich. Sie lässt sich<br />
inspirieren von Grzesiuks Balladen über Warschau, von Pola Gojawiczyńskas<br />
„Die Mädchen aus Nowolipki“ (dem Kultroman über das Leben junger Frauen<br />
im Warschau der Zwischenkriegszeit) und vom Anarcho-Punk-Feminismus.<br />
Sie hat einen eigenständigen, originellen Stil entwickelt, einen sowohl witzigen<br />
als auch bewegenden, melodramatischen, grausamen und politischen<br />
Roman. Denn es gibt durchaus einen größeren Schlawiner als den Warschauer<br />
– das ist die Schlawinerin, das unbesiegbare Banditen-Mädchen, das<br />
immer für eine gerechte Sache kämpft. Jedenfalls fast immer. Manchmal<br />
kämpft sie aus purem Vergnügen. Vor allem agiert eine Schlawinerin nicht<br />
allein. Chutniks Roman besingt die Erfolge einer ganzen Bande weiblicher<br />
Rächerinnen. Einer Bande, die soziale Schichten, Stadtbezirke und Generationen<br />
vereint, so wie einst in den Schulklassen. Celina, Halina, Stefa und<br />
Bronka spielen hier die erste Geige. Sie sprechen selbst Recht. Die Haupthandlung<br />
ist ein Rachefeldzug gegen einen brutalen Bauunternehmer, der<br />
eine Aktivistin der Mieterbewegung angezündet hat. Sie beruht auf einer<br />
wahren Geschichte, die in Warschau passiert ist. Die Täter wurden nie gefunden<br />
– die Schuld des Bauunternehmers ist lediglich eine symbolische. Im<br />
Roman nehmen sich die jungen Frauen der Sache an, und nur dank ihrer siegt<br />
die Gerechtigkeit. Die Geschichte beginnt auf dem Friedhof in Bródno und<br />
endet gewissermaßen auch auf einem Friedhof, denn das ist das Schicksal<br />
der Kriegerinnen, das grausame und traurige Ende der Ballade.<br />
Kazimiera Szczuka<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
17<br />
Halina,<br />
die Klinge, begann gedankenversunken ihre Hände<br />
zu bewegen. Erst als die Gabel herunterfiel,<br />
schreckte sie hoch. Sie sah sich um. Dann begann<br />
sie zu sprechen, als stünde sie neben sich. Erst leise, dann immer lauter und<br />
schneller.<br />
In der Schule wurde ich jedes Jahr für vorbildliche Leistungen ausgezeichnet.<br />
Das hat mich gewurmt, verstehst du. Habe mich gefragt, was das soll.<br />
Vorbildlich? Für wen denn? Für die anderen Mädchen, die genauso sind wie<br />
ich? Mit Schürze, mit Pferdeschwänzen oder geflochtenen Zöpfen und in<br />
Strumpfhosen. Wir alle sind aufgewachsen mit Ala aus der Fibel, die sich mit<br />
ihrer Mutter wie eine Maschine in der Küche abrackert, deren Bruder Kosmonaut<br />
ist oder Feuerwehrmann, oder weiß Gott wer. Was war ich schon für ein<br />
Vorbild für die anderen Kinder? Weil ich fleißig war und artig? Gott, wie ich<br />
es gehasst habe, artig zu sein. Ich habe absichtlich Unfug getrieben, gespuckt,<br />
geflucht, meine Schönschreibhefte zerfleddert. Aber das hat nichts geholfen.<br />
Einmal hat mir einer im Hausflur aufgelauert. Ich war sechzehn, mein Kopf<br />
leer, ich bin ständig auf Konzerte gerannt, in Springerstiefeln, und hab direkt<br />
vor der Bühne Pogo getanzt. Der Typ hält mir ein Messer an die Kehle und<br />
schreit: „Ausziehen!“, „Hose runter!“. Ich rufe nach Hilfe, darauf der, dass<br />
ich das Maul halten soll, sonst bringt er mich um. Ich weiter, Hilfe, und er,<br />
dass mich hier keiner hört, und tatsächlich – keiner wollte mich hören, im<br />
Wohngebiet zweitausend Menschen, Sommer, die Fenster stehen offen, aber in<br />
diesem Moment, Scheiße, sind die auf einmal alle taub. Ich schreie, aber viel<br />
zu leise. So in mir drin, innen ein einziger Schrei, außen Stille. Der fummelt<br />
an seinem Hosenstall, keucht, völlig im Wahn. Es war schwül, um meinen<br />
Kopf sirrte eine Fliege, und ich war mit den Gedanken schon ganz woanders,<br />
ich tat, als hätte ich mit dieser unangenehmen Szene nichts zu tun, und dachte<br />
mir nur, ach, ich ruhe mich dann zu Hause aus, ziehe mir die Decke über den<br />
Kopf und niemand kann mir was Böses. Da kommt plötzlich ein Nachbar mit<br />
seinem Mülleimer und schaut in unsere Richtung, und der Typ rennt weg,<br />
schafft es aber noch, mich hinzuschubsen. Bin mit voller Wucht auf meine<br />
Hand gefallen, das hat ziemlich weh getan.<br />
Da lag ich nun mit halb heruntergezogenem Schlüpfer und schwerem<br />
Schock. Der Nachbar machte einen großen Schritt über mich hinweg, weil<br />
ich im Weg lag. Dann knallte der Mülltonnendeckel, bumm, und weg war er.<br />
Ich konnte nicht aufstehen, hatte gehofft, er würde mir helfen, aber er wollte<br />
mich nicht hören, nicht bemerken, hatte verdammt noch Mal seine eigenen<br />
Sorgen: Frau, Kinder und so weiter.<br />
Also wirklich, die Hormonbomben liegen jetzt überall herum, sonnen sich<br />
und drücken ihre Pickel aus, dass es erschöpften Menschen geradezu ins Gesicht<br />
spritzt. Warum schert sich denn keiner darum, warum berichtet keiner<br />
im Fernsehen darüber? Wo sind die Eltern und die Erziehungskommission?<br />
Wo?<br />
meine Hand losgelassen und war vom Hocker aufgestanden. Sie war plötzlich<br />
Xena, Hothead Paisan und Göttin Kali in einem. Sie sprach, eigentlich zischte<br />
sie ganze Wortströme in mein Ohr, hämmerte sie mir ein, so wie man jemandem<br />
mathematische Formeln und heilige Gebote einschärft.<br />
Sie war mein Mahomet, der erschien, um die Wahrheit zu verkünden:<br />
Rache bringt dir Erlösung. Nur Rache bringt dir Erlösung, Mädchen. So<br />
eine Lebensweisheit findest du nicht in der Zeitung. So eine Lebensweisheit<br />
wird nur unter Eingeweihten weitergegeben.<br />
Noch einen Wodka bitte. Für die Dame auf dem Hocker hier natürlich.<br />
Halina setzte sich aufrecht hin und hörte auf, nervös an ihren Fingernägeln<br />
zu knabbern, ihre Zöpfe zu öffnen, vor sich hin zu murmeln, zu transpirieren.<br />
Jetzt ist alles wieder gut, die böse Geschichte ist abgeheftet unter „erledigt“.<br />
Jetzt ist alles gut, jetzt kann ich Karate und spüre die scharfen Waffen, die ich<br />
unterm Kleid trage.<br />
Es bringt nichts, über die Vergangenheit nachzusinnen. Schließen wir die<br />
verzierte Schatulle für Traumata und atmen tief durch. Hey, willkommen<br />
Abenteuer, morgen ist ein neuer Tag!<br />
Mädchengeschichten mögen plötzliche Wendungen in der Handlung. Da<br />
glaubst du, einfach ein bisschen zu plaudern, und plötzlich vertraut dir jemand<br />
so was an. Und schon nimmt das Gespräch eine andere Wendung, auf<br />
der Achterbahn geht es ganz nach oben, und dann saust der Wagen runter.<br />
Wenn du nicht hinterherkommst, halt den Mund.<br />
Halina wechselte das Thema, sprach über die neuesten Ausstellungen und<br />
das kaputte Fahrrad, das ihr Marek repariert hatte. Schnatter, schnatter, was<br />
für ein Tempo, was für eine Melodie! Die Geschichtenschatulle ist mit einer<br />
speziellen Mädchenchiffre verschlossen. Sie wird sich lange nicht öffnen lassen,<br />
weil sich kaum jemand diese Chiffre merken kann.<br />
„Ist das nicht ein bisschen viel Wodka?“, fragte Celina, als sie mit dem Essen<br />
fertig war.<br />
„Alkohol ist doch gesund, gut für die Verdauung, schwangere Frauen sollen<br />
Wodka trinken, weil das dem Babyblues und Blähungen vorbeugt. Das haben<br />
amerikanische Wissenschaftler bei Rattenexperimenten festgestellt. Da hatten<br />
die Weibchen die Wahl zwischen Wasser und Alkohol. Und sie entschieden<br />
sich für Letzteres. Na, die Ratten werden es wohl wissen. Dadurch wurde bewiesen,<br />
dass schwangere Frauen auf der ganzen Welt Alkohol trinken sollten.<br />
Sogar im Kreissaal fließt Spiritus statt Oxytocin aus dem Tropf, so hat das<br />
Neugeborene gleich zehn Punkte auf dem, na, wie heißt das gleich, auf dem<br />
Alko-Score.“<br />
Celina schaute ihre Freundin verwirrt an und wollte ihr schon widersprechen,<br />
es sei wohl ein symbolisches Glas Rotwein gemeint, aber sie war nicht<br />
mehr sicher und fürchterlich müde.<br />
Aus dem Polnischen von Antje Ritter-Jasińska<br />
Der Nachbar ging. Ich nicht.<br />
Die Clique tanzte. Ich nicht.<br />
Nach einer Weile erhob ich mich, stöhnte vor Schmerz und ging nach Hause.<br />
Und da drehte ich das kalte Wasser auf und hielt den Kopf drunter.<br />
Ist ja gar nichts passiert, dachte ich. Schließlich hatte er mich nicht vergewaltigt.<br />
Ich zitterte am ganzen Leibe und ging ins Treppenhaus, um eine zu<br />
rauchen.<br />
Da traf ich eine Bekannte, und die sagte: „Wie geht’s dir? Siehst so blass aus.“<br />
Die Hand, auf die ich geknallt war, war dick angeschwollen, kugelrund, als<br />
würde sie gleich platzen. Keine Ahnung, wieso ich genau in dieser Pfote die<br />
Kippe hielt und nichts sagte. Mir liefen die Tränen, aber ich schwieg, und die<br />
Bekannte zu mir: „Eh, hat dich dein Alter geschlagen?“ Ich schwieg weiter,<br />
und sie hat bestimmt gedacht, dass ich mich schäme, das zuzugeben, und<br />
wahrscheinlich tat ich ihr leid.<br />
Abends hatte ich den Eindruck, dass es mir besser geht. Dass diese dumpfe<br />
Wut nur ein vorübergehender Rausch ist. Eine Woche später habe ich mir zum<br />
ersten Mal die Pulsadern aufgeschnitten.<br />
Im Krankenhaus war eine tolle Schwester. Ich erzählte ihr, was passiert war,<br />
und dass ich mich lieber selbst umbringen würde, als den, der mir das angetan<br />
hatte.<br />
Sie wandte sich ab und schwieg lange. Als sie mich wieder ansah, war sie<br />
nicht mehr die freundliche Krankenschwester mit Käppi und Kittel. Sie hatte<br />
ŚWIAT KSIĄŻKI, WARSZAWA 2012<br />
135 × 215, 240 PAGES<br />
ISBN: 978-83-273-0187-1<br />
TRANSLATION RIGHTS: ŚWIAT KSIĄŻKI<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
18<br />
IGOR OSTACHOWICZ<br />
IGOR OSTACHOWICZ (GEB. 1968), STUDIERTE INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN, ARBEITETE ALS PFLEGER<br />
AN EINEM PSYCHIATRISCH-NEUROLOGISCHEN INSTITUT UND IM MANAGEMENT ZAHLREICHER FIRMEN,<br />
SEIT EINIGEN JAHREN IM STAATSDIENST. GEGENWÄRTIG IST ER ALS STAATSSEKRETÄR IN DER KANZLEI<br />
DES POLNISCHEN MINISTERPRÄSIDENTEN DESSEN PR-BERATER UND REDENSCHREIBER.<br />
Photo: Maciej Śmiarowski<br />
Die Nacht der lebenden Juden<br />
„Die Nacht der lebenden Juden“ ist aus mehreren Gründen bemerkenswert.<br />
Vor allem aber, weil es dem Autor gelungen ist, ein gewichtiges Thema des<br />
polnischen kollektiven Bewusstseins literarisch zu bearbeiten und eine Geschichte<br />
zu erzählen, die schon seit Jahren erzählt sein will: Das im Zweiten<br />
Weltkrieg dem Erdboden gleichgemachte Warschau als verwilderter Friedhof<br />
im Dämmerzustand, mit den damals Ermordeten als unvermittelt Fleisch<br />
gewordenen Geistern. Lebende und Tote – Aug in Auge. Wer ist nun wirklich<br />
zu Hause in Warschau, in Polen, an diesem vom Genozid gezeichneten Ort?<br />
Der wunderbar geschriebene Roman sucht nach Antworten und bedient sich<br />
dabei verblüffender, irritierend unkonventioneller Mittel. Die krasse, humoristische<br />
Poetik des popkulturellen Horrorgenres scheint im Grunde unvereinbar<br />
mit dem Shoah-Stoff. Schon der Titel, der in Anspielung auf einen<br />
Horrorfilm-Klassiker die „Toten“ durch „Juden“ ersetzt, wirkt verstörend.<br />
Ins Rollen gebracht wird die ganze Geschichte durch ein den Juden gestohlenes<br />
Amulett in Form eines silbernen Herzens, das seinem Besitzer Glück<br />
und Erfolg verheißt. Der Protagonist, der im Handlungsverlauf zunehmend<br />
an einen Comic-Superhelden im Kampf gegen die Judenvernichtung erinnert,<br />
lebt mit seiner Freundin in Muranów, einem auf den Trümmern des<br />
Ghettos errichteten Stadtteil von Warschau. Eines Tages entsteigen der Kellerluke<br />
(…) tote Juden in zerschlissenen Mänteln. Nach und nach wird deutlich,<br />
dass sie sich am liebsten im Arkadia aufhalten, einem nahe gelegenen<br />
Einkaufszentrum.<br />
Bei allen Pop-Elementen ist „Die Nacht der lebenden Juden“ ein stark reflektiertes,<br />
ein reifes Werk. Der Autor legt die Prinzipien der aus sich selbst<br />
geschaffenen Stadt nachvollziehbar offen. Das Einkaufszentrum Arkadia als<br />
Hort ewiger Glückseligkeit, geheiligt durch Handel und Umsatz, wird mit der<br />
gespenstisch anmutenden Aura von Muranów konfrontiert. Das hinlänglich<br />
bekannte Gefühl des Grauens und der Fremdheit, das über dem modernisierten,<br />
verwestlichten Stadtraum liegt, bricht sich in der Realität Bahn. Aus<br />
dem Horrorgenre entlehnt, ist das Romankonzept gleichzeitig poetisch und<br />
erstaunlich pointiert, vorgegeben durch historische Realien. Die jüdische<br />
Geschichte des Nicht-Seins muss ergänzt werden um das Grauen, die Materialisierung<br />
dessen, was verdrängt werden will. Die Bewusstwerdung des Protagonisten<br />
über diesen Prozess (und über die symbolische Macht des Amuletts)<br />
gibt die überzeugende, frappierende Dramaturgie des Romans vor.<br />
Kazimiera Szczuka<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
19<br />
Ich<br />
will nicht behaupten, sie wären überhaupt nicht angestarrt<br />
worden, aber man nimmt die anderen doch nur sehr flüchtig<br />
wahr, meist nur die Kleidung, wenn nicht erotische Attraktionen<br />
vorliegen, vielleicht ist es aber auch ein Zauber, der sie unsichtbar macht,<br />
geriet ich ins Grübeln. Mir war der Unterschied gleich aufgefallen, noch bei<br />
mir im Treppenhaus – nicht das übliche, akustisch verstärkte Gelächter und<br />
Geschrei, stattdessen merkliche Konzentration, das Knistern neuer Kleider<br />
und das Knirschen verdorrter Gelenke. Ich hatte ein ganzes Heftchen mit<br />
Fahrscheinen gekauft, jeder wollte seinen selbst entwerten, neugierige Blicke<br />
aus dem Fenster, nichts Besonderes, ein Betreuer fährt mit einer Gruppe Teenie-Leichen<br />
spazieren.<br />
Das Arkadia hatte sie schwer beeindruckt, Rachel und David spielten<br />
Stammkundschaft und trugen die Nase höher als alle anderen. Rachel begrüßte<br />
Chirico übertrieben herzlich, um aller Welt zu zeigen, dass sie eine<br />
lebendige Freundin hat, noch dazu aus Fernost. Selbstverständlich packte sie<br />
alle der Kaufrausch, und ich musste eine Pro-Kopf-Deckelung einführen, ich<br />
konnte ja nicht jedem in Warschau ermordeten Bengel Klamotten und Technik<br />
finanzieren. „Ich geh noch in die Insolvenz wegen euch.“ Und ständig<br />
aufpassen, dass sie zusammen bleiben, dass keiner verloren geht, ich war völlig<br />
fertig.<br />
„Die machen Fotos von ihnen.“<br />
Bei meinen mühsamen Versuchen, die Ordnung in der Gruppe aufrecht zu<br />
erhalten, drang diese Information nicht gleich zu mir durch. Meine Kids hielten<br />
im Empik-Store alle CD-Hörstationen besetzt, manche wälzten Bücher,<br />
Alben, Papierkram, dauernd fiel etwas herunter oder kippte um und ich fühlte<br />
mich zuständig, außerdem vergoss der kleine Aron, der nur noch ein Auge hat,<br />
mit diesem einen Auge bittere Tränen und schluchzte herzzerreißend, weil er<br />
nebenan im Musikgeschäft eine Geige entdeckt hatte, die er jetzt unbedingt<br />
haben musste, ich durfte ihm nun auseinandersetzen, dass solche Sonderwünsche<br />
über mein Budget gingen. Erst im dritten oder vierten Anlauf erreichte<br />
Chirico, die an meinem Ärmel zerrte, mit ihrer Meldung mein Gehirn:<br />
„Die machen Fotos von ihnen.“<br />
Tatsächlich, grinsende Skinheads fotografierten meine Schützlinge. Da ruft<br />
mich Chuda an. Sie schlürft ihren Kaffee und lässt mich wissen, dass gerade<br />
die Ambulanz da war und den alten Kerl und die dicke Omi mitgenommen<br />
hat, jetzt ist es endlich schön still in der Wohnung.<br />
„Wer heult denn da so?“, fragt sie.<br />
„Aron will eine Geige“, antworte ich.<br />
„Dann sei doch nicht so, kauf sie ihm“, kriege ich zu hören. „Der arme Junge,<br />
das ist doch der ohne Auge, sei so gut, schenk ihm ein bisschen Wärme.“<br />
Jetzt platzt mir doch der Kragen:<br />
„Ich bin hier mit fünfzehn Leichen im Einkaufszentrum unterwegs!“, brülle<br />
ich, aber Chuda kommt nicht mehr dazu, sich davon beeindrucken zu lassen.<br />
„Es hat geklingelt“, sagt sie. „Ich ruf nachher nochmal durch.“<br />
die ganze Truppe, instinktiv, wie die Hunde der Katze. Chirico bekommt von<br />
mir das Fahrscheinheft und den Auftrag, die Gruppe geschlossen nach Hause<br />
zu bringen, in den Keller. Ich nehme die Verfolgung von Szymek und den<br />
anderen auf. Zehn Skins und zwei Wachleute, es sieht aus, als liefen sie alle vor<br />
mir davon, jetzt müsste ich mich nur noch kurz umziehen, das blaue Trikot<br />
mit dem rot-gelben „S“ auf der Brust und das knappe rote Mäntelchen um die<br />
Schultern, ich verstoße gegen meine heilige Nichteinmischungsdoktrin, bin<br />
gleich als Held mit blankem Hintern vor Ort, kassiere meine Tracht Prügel<br />
und gut ist es, klassisches romantisches Verhaltensmuster, ich sollte besser in<br />
ein leeres Haus rennen, zu Chuda, einen schönen Grüntee trinken, solange ich<br />
noch alle Zähne habe. Was macht schon ein totes Jüdlein mehr oder weniger<br />
– ich denke ganz nüchtern, laufe aber weiter, in Schweiß gebadet.<br />
Aus dem Polnischen von Thomas Weiler<br />
ZZ kontrollierte die Herztätigkeit, indem er einer Frau, die gerade jemanden<br />
zum Krankenwagen brachte, ungestraft in den Busen zwickte. Er glaubte<br />
sie zu kennen, wusste aber nicht mehr genau, woher. Aus Norwegen? Aber war<br />
ich denn in Norwegen gewesen? Bevor sie wegfuhr, ließ er sich Telefon und<br />
Adresse diktieren, sie diktierte anstandslos.<br />
Sie stiegen die Treppe hinauf. In der Wohnung war nur das Yoga-Mädchen.<br />
„Wo ist er?“, fragte ZZ und versuchte ihr unter den Rock zu fassen. Sie<br />
schüttelte ihn erschrocken ab. Unfähig etwas zu sagen, kreischte sie nur:<br />
„Hilfe!“<br />
Also wirkt das Artefakt bei ihr genauso wenig, wie bei ihrem Freund, dachte<br />
ZZ. Sie zogen die Tür hinter sich zu.<br />
„Das sind meine Kumpels, Bolo und Bandzioch, die werden dich liebend<br />
gerne durchpimpern.“<br />
Mist, ich will sie zusammentrommeln, kriege sie aber kaum los von ihren<br />
Kopfhörern, CDs, Comics und dem ganzen Kram, sie weinen, „ich hab noch<br />
fast nichts gehört, ich musste ja die ganze Zeit warten“ usw., ich bin schon<br />
ganz verschwitzt, jeder zweite heult laut, die Leute gucken schon, die Rechten<br />
knipsen mit ihren Fotohandys, zum Glück hilft Chirico mir ein bisschen.<br />
„Wir gehen jetzt, nichts wird gekauft, legt alles zurück in die Regale.“<br />
Die Skins lachen über die Tränen und über meine Panik, sie zeigen mir mit<br />
ihren Fäusten, was mich gleich erwartet. Als wir gehen, springt der Alarm an.<br />
Szymek rennt los, die Wachleute hinterher, dann folgen die Skins, zum Glück<br />
W.A.B., WARSZAWA 2012<br />
123 × 195, 256 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7747-700-7<br />
TRANSLATION RIGHTS: W.A.B.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
20<br />
ZOŚKA PAPUŻANKA<br />
ZOŚKA PAPUŻANKA (GEB. 1978),<br />
THEATERWISSENSCHAFTLERIN,<br />
ARBEITET ALS POLNISCHLEHRERIN.<br />
PROMOVIERT IN LITERATURWISSEN-<br />
SCHAFT. „DAS AFFENHAUS“ IST IHR<br />
LITERARISCHES DEBÜT.<br />
Photo: Dawid Kozłowski<br />
Das Affenhaus<br />
Dieser Roman ist gewunden wie eine Sprungfeder. Komponiert aus kurzen<br />
Szenen erzählt er von mehreren Jahrzehnten einer Krakauer Familie, von einem<br />
Leben voller Spannungen, Konflikte und so tiefem Unverständnis, dass<br />
sich dem Leser die ganze Lektüre hindurch geradezu die Frage aufdrängt:<br />
Wieso hält das, warum bricht das nicht auseinander? Natürlich gibt es Hinweise,<br />
aus denen man die eine oder andere Antwort entnehmen kann, aber<br />
sie überzeugen nicht ganz: weil sie das heilige Sakrament der Ehe verbindet,<br />
weil Vorfälle aus der Vergangenheit auf ihr lasten, weil sie – zumindest für<br />
den Mann – eine Art Buße ist, und weil sich Gegensätze anziehen usw. Hier<br />
wird nichts endgültig geklärt – wir haben es nicht mit einem zweitklassigen<br />
Roman über die Hölle des Familienlebens zu tun. Das ist wirklich Literatur.<br />
Und zwar ernste Literatur. Mit Verve geschrieben, mit Ergriffenheit und literarischem<br />
Können. Papużanka operiert mutig mit der Literatursprache,<br />
ergeht sich in leichtfüßigen Wortspielen, beweist Feingefühl für die individuellen<br />
Sprachstile, die die Figuren besser charakterisieren als das eine<br />
potenzielle, von einem Erzähler gelenkte Beschreibung tun würde. All das<br />
ist großartig, die schriftstellerische Gerissenheit eingeschlossen, mit der<br />
die Autorin den Roman erdacht hat, , wobei sie sich gewiss von etwas hat<br />
lenken lassen, das man „schriftstellerische Bescheidenheit“ nennen mag<br />
– sie konstruiert keine ausschweifende Erzählung, was sich bei dem Thema<br />
eigentlich anbieten würde, sie entwickelt keine Familiensaga, sondern<br />
beschreibt lediglich in einer Art Telegrammstil Szenen aus verschiedenen<br />
Zeitabschnitten des Familienlebens, wobei sie die Erzählperspektive wechselt,<br />
so wie es im Übrigen im ersten Absatz des Romans angekündigt wird.<br />
Dieser Roman ist eine Art Konzentrat, zu dem man – um ein konventionelles<br />
Werk zu erhalten – „Wasser zum Verdünnen hinzufügen“ müsste. Allerdings<br />
bin ich nicht sicher, ob das dem Roman in der Gesamtbewertung gut tun würde,<br />
denn womöglich würde das die Kraft seiner Wirkung mindern, die sich<br />
mit einem Faustschlag vergleichen lässt.<br />
Leszek Bugajski<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
21<br />
Es<br />
ist immer das Gleiche. Kinder verlaufen sich im Wald – die alte<br />
Leier. Da lässt sich nichts machen. Selbst wenn wir dem Instinkt<br />
ein Schnippchen schlagen wollten, nehmen wir die ausgetretenen<br />
Pfade. Verlorene Zeit, die man nie wieder bekommt. Selbst wenn wir nur einen<br />
Augenblick in Erinnerung behalten wollten, zeigt sich immer wieder, dass<br />
es anders war, dass keiner mehr weiß, wer was getan hat, wer was gesagt hat,<br />
dass uns nur Fetzen bleiben, Reste auf den Tellern, die zu niemandem gehören.<br />
Nie wird man wissen, wer Erzähler ist, wer Protagonist, wer Figur im<br />
Hintergrund, wessen Worte niedergeschrieben werden. Nur wer verliert und<br />
wer gewinnt, steht immer schon am Anfang fest.<br />
Es gab keinen Grund für diese Ehe. Keinen einzigen. Weder einen rationalen<br />
noch einen irrationalen. Keinerlei Gefühle, ganz sicher. Keine Situation,<br />
keinen Zufall, nicht einmal Geld. Weder mochten sie sich, noch passten sie<br />
zueinander. Sie war schon einmal verheiratet gewesen. Der Mann war zwar<br />
längst begraben, aber sie hätte es ja auch dabei belassen können. Man wusste<br />
nicht viel über ihn, sie selbst erzählte gern, dass er wunderschön gesungen<br />
hatte, weniger gern, dass er geplündert, Verbotenes getan und sie auf diese<br />
Weise unterhalten hatte.<br />
Als dieser Mann, der als Jánošík galt, Dreck in eine Wunde am Bein bekommen<br />
hatte und gestorben war, kehrte sie ins Elternhaus zurück, mit einem<br />
Koffer und einer dreijährigen Göre mit aufgeschürften Knien, die sie halb zog,<br />
halb trug. Ihre Mutter öffnete die Tür, seufzte, und ohne die heimkehrende<br />
verlorene Tochter eines Blickes zu würdigen, wandte sie sich ihren eigenen<br />
Dingen zu. Na bitteschön, eben erst waren wir diesen Lärm los, da ist er gleich<br />
doppelt wieder zurück. Die verlorene Tochter beachtete die Mutter gar nicht,<br />
setzte das Kind in eine Ecke, drückte ihm eine Scheibe Brot in die Hand,<br />
krempelte die Ärmel hoch und machte sich an die Arbeit.<br />
Sie nahm von niemandem etwas an, half aber allen hier und da. An sich<br />
selbst dachte sie fast gar nicht. Es wurde Herbst, es wurde Winter, es wurde<br />
Frühling, die alten Kleider begannen, über ihrem Bauch zu spannen,<br />
ihre Hände waren abgearbeitet vom Wäschewaschen und der Feldarbeit. Sie<br />
stemmte die Arme in die Hüften, stellte die Beine weit auseinander, um so viel<br />
Welt wie möglich hinter sich zu verdecken. Sie neigte den Kopf leicht, wie ein<br />
Huhn, das so tut, als verstünde es etwas. Sie sagte allen immer die Wahrheit,<br />
und zwar auf der Stelle, selbst Wahrheiten, die man nicht hören wollte. Dass<br />
der eine zu dünn sei, der andere verpickelt, und eine dritte nie einen Kerl<br />
finden würde, und schon gar nicht bei Tageslicht. Alle schätzten sie. Keiner<br />
mochte sie. Und genau das war ihr Ziel. Wenn sie die Kartoffelsetzlinge aus<br />
dem Korb genommen hatte, beugte sie sich über das schnurgerade Beet und<br />
platzierte ihren großen festen Hintern auf dem stabilen Gestell ihrer Beine, so<br />
dass alle wussten, wo sie sie mal konnten.<br />
Warum er sie geheiratet hat? Eine Witwe mit Kind? Gemein und ewig unzufrieden?<br />
Wahrscheinlich tat sie ihm leid.<br />
*<br />
„Lieber Bruder“, schrieb Bronek, „ich sende dir herzliche Grüße. Krakau ist<br />
riesig, es gibt hier viele Sehenswürdigkeiten. Wenn ich Zeit habe, gehe ich spazieren<br />
und besichtige sie, ich war bereits auf dem Wawel und in der Drachenhöhle.<br />
Hier ist alles anders. Ich habe eine gute Stelle in einem Geschäft. Im<br />
Moment wohne ich bei einem Bekannten, lege aber Geld zurück, um endlich<br />
etwas Eigenes zu kaufen. Ich habe nämlich ein Mädchen kennengelernt, als<br />
ich in einem Café war. Sie arbeitet dort als Kellnerin, kommt aber vom Lande.<br />
Wir wollen heiraten. Ja, es gibt viel Neues bei mir. Überleg nicht lange, pack<br />
deine Sachen und komm her, ich helfe dir, Arbeit zu finden, und auf meiner<br />
Hochzeit lernst du sicher jemanden kennen. Wie lange kann man denn allein<br />
leben? Dein dich liebender Bruder Bronisław.“<br />
„Lieber Bruder“, flitzte die fertige Antwort erst durch den Kopf und dann<br />
aufs Papier, „ich denke schon lange darüber nach. Mutter läuft im Zimmer<br />
auf und ab, die Kuh musste sie verkaufen, weil es zuhause immer schlechter<br />
geht. Stasia und ihr Mann wohnen noch immer bei uns, weil sie nirgends unterkommen,<br />
im Frühling kommt das dritte Kind. Valentin wird auch heiraten,<br />
und wo sollen sie wohnen, wenn nicht in unserem Haus? Jan als vollwertiger<br />
Landwirt sitzt hingegen auf seinen Hektars, die die Frau mit in die Ehe gebracht<br />
hat, und lässt niemanden über die Schwelle. Keiner braucht mich hier,<br />
ein hungriges Maul weniger, ich habe meine Sachen schon gepackt. Jan borgt<br />
mir Geld für die Fahrkarte, wenn ich verspreche, nie zurückzukehren.“<br />
Kaum war er aus dem Zug gestiegen, wurde er wie ein Schaf unter die Wölfe<br />
geschoben, auf halbem Wege zwischen Wodka und Häppchen, auf halber Zeit<br />
zwischen Bronek im neuen Anzug und seiner Braut mit den dicken Zöpfen<br />
und dem symbolischen Jungfrauenkranz – den echten hatte ihr Bronek eine<br />
Woche zuvor bereits in der Scheune entwendet, er hatte darauf bestanden,<br />
obwohl ihm dabei das Heu ordentlich in den Hintern gepiekt hatte. Man<br />
setzte ihn zwischen den Edelmann, den Schulzen und den Pfarrer auf einer<br />
unpoetischen Hochzeit bei Krakau, ohne Rachel, ohne goldene Hufe, dafür<br />
unter lauter Strohpuppen. Bronek schenkte dem Bruder immerfort Wodka<br />
nach, wie einer exotischen Pflanze, die Tanten der Braut kümmerten sich um<br />
ihn, wobei sie ihre Wurst- und Gurkenargumente anwendeten.<br />
Ein Opa – niemand wusste wessen, dafür war er mit Sicherheit hundert Jahre<br />
alt –, dessen gewaltiges Schnarchen die Tischdecke flattern ließ, erwachte<br />
plötzlich, und rief „Wer sagt denn, dass ich ein Hirsch bin?“, woraufhin er<br />
erneut in Glücksseeligkeit verfiel, wobei er mit seinen Händen sein gewaltiges<br />
Geweih bedeckte. Eine lustige Cousine, die eben noch traurig gewesen war<br />
vom Trinken, fasste plötzlich Mut und beschloss, laut die ganze Wahrheit<br />
über ihren Mann zu sagen, woraufhin dieser ihr öffentlich den Hintern versohlte,<br />
wobei sich herausstellte, dass dieser Hintern keine Unterwäsche kannte.<br />
Alle Mädchen schauten sich aufmerksam den Bruder des Bräutigams an,<br />
der von weit her gekommen war und lautstark vorgestellt wurde, was ihn sehr<br />
beschämte. Alle Mädchen beobachteten die Bewegungen seiner schlanken<br />
Hände, die mit Käsekuchen und Bigos beschäftigt waren, alle Mädchen, auch<br />
die, die mit anderen tanzen, die aus den Massen an Röcken und Unterröcken<br />
freudig ihre dicken prallen Knie hervorholten, alle Mädchen, selbst die, neben<br />
der Bronek dem Bruder den Platz angewiesen hatte, die, die am lautesten lachte,<br />
die am meisten tanzte und am meisten trank, die, die sich gerade dazusetzte<br />
und sich an der Wand abstützte, als wolle sie das ganze Haus umstürzen,<br />
und jetzt ihr Haar zu einem Knoten band, wobei sie die runden Schweißflecken<br />
auf ihrer weißen gestickten Bluse offenbarte, die, neben die Bronek ihn<br />
absichtlich gesetzt hatte, denn wie lange kann man denn allein leben. „Das<br />
ist mein Bruder, aus Pommern ist er angereist, er wird in Krakau mit mir<br />
zusammen arbeiten, ist ein guter Junge, aber mutterseelenallein auf der Welt,<br />
der soll mal einen Wodka trinken, dann findet er bestimmt alles nett hier, ich<br />
finde es schon nett. Liebes Fräulein, mit mir trinken sie keinen?“ „Von wegen<br />
Fräulein“, sagten zwei kräftige Zahnreihen, und kauten auf dem rosafarbenen<br />
saftigen Zungenfleisch, „von wegen Fräulein, Frau bitte, ich bin Witwe, ja, ja,<br />
so jung und schon Witwe.“ Das klang stolz, nicht traurig. „Mein Mann ist vor<br />
zwei Jahren gestorben, aber was soll ich mir das groß zu Herzen nehmen, das<br />
Leben ist beschissen genug, hat mir noch gefehlt, mir was zu Herzen zu nehmen,<br />
wir alle sterben doch, sind Sie für länger in Krakau?“ „Wahrscheinlich<br />
für immer, meine Liebe, wahrscheinlich für immer.“<br />
Aus dem Polnischen von Antje Ritter-Jasińska<br />
ŚWIAT KSIĄŻKI, WARSZAWA 2012<br />
135 × 215, 208 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7799-824-3<br />
TRANSLATION RIGHTS: ŚWIAT KSIĄŻKI<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
22 MARIUSZ SIENIEWICZ<br />
MARIUSZ SIENIEWICZ (GEB. 1972),<br />
PROSASCHRIFTSTELLER UND FEUILLETONIST,<br />
GILT ALS EINER DER VIELVERSPRECHENDEN<br />
AUTOREN DER JÜNGEREN GENERATION,<br />
ZULETZT ERSCHIENEN DIE REBELLION (2007)<br />
UND DIE STADT DER GLASELEFANTEN (2010).<br />
Photo: private<br />
Dornröschens Beichte<br />
Mariusz Sieniewicz, einer der wichtigsten Prosaautoren seiner Generation,<br />
bleibt auch in seinem jüngsten Roman den Themenkreisen verhaftet, die<br />
ihn besonders interessieren. Die Dekonstruktion der nationalen wie lokalen<br />
kulturellen Identität, die schon seine früheren Arbeiten „Der vierte Himmel“<br />
und „Jüdinnen werden nicht bedient“ geprägt hatte, spielt auch in<br />
„Dornröschens Beichte“ eine gewichtige Rolle.<br />
Protagonistin des in drei Teile gegliederten Romans und gleichzeitig dessen<br />
Erzählerin ist die dreißigjährige Emila, die als Single ständig neue toxische<br />
Verbindungen mit Männern eingeht. Außerdem ist Emila Narkoleptikerin,<br />
sie erleidet täglich mehrere Schlafattacken. Dabei träumt sie die unglaublichsten<br />
Geschichten mit einem beharrlich wiederkehrenden Motiv – Selbstmord.<br />
Allerdings wird sie an der Ausführung immer wieder gehindert. Eines<br />
Tages tritt Swietka in ihr Leben, eine geheimnisvolle Belarussin, die erklärt,<br />
sie sei Emilas Schwester. Und weiter geht die Jagd nach dem nächsten Mann,<br />
dem nächsten „Bärchen“. Das Bärchen ist eine besondere Gattung Mann, die<br />
jedoch zahlreiche Untergruppen kennt: Selbstverliebte, Depressive, fanatische<br />
Patrioten …<br />
Die Welt in „Dornröschens Beichte“ balanciert auf dem schmalen Grat zwischen<br />
Traum und Wachzustand, für zusätzliche Effekte sorgt der spöttischgroteske<br />
Erzählstil. Unter dem Deckmantel einer leicht absurden Märchengeschichte,<br />
wirft der Autor einen kritischen Blick auf die Lebenswirklichkeit<br />
im heutigen Polen (im Hintergrund spielen auch die 1980er Jahre eine<br />
Rolle) mit ihren kulturell verankerten Erwartungen an Rollenbilder (für die<br />
unter anderem das titelgebende Dornröschen steht) und den Möglichkeiten<br />
der virtuellen Kommunikation im Netz. Sieniewicz bedient sich sprachlicher<br />
Floskeln, die er mit seiner einzigartigen Erzählweise als lächerlich bloßstellt,<br />
und zeigt so die ganze Absurdität der beherrschenden Kultur. Hier<br />
erklingt die ausdrucksstarke, groteske, polen- und gegenwartskritische<br />
Stimme eines Vierzigjährigen.<br />
Marcin Wilk<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
23<br />
Emilas<br />
aktuellen Geliebten kann man nicht gerade als<br />
ausgemachten Single bezeichnen, der die ganze<br />
Welt als seine Geburtstagstorte begreift und beim<br />
bloßen Klang des Wortes „Ich“ nicht nur mentale Erektionen bekommt. So<br />
eine Emila könnte dem Single höchstens eine von vielen Kerzen sein, die er<br />
auspusten darf, nachdem er sich etwas gewünscht hat. Als Emila damals die<br />
Gombrowicz-Tagebücher gelesen hatte, war ihr sofort aufgefallen, dass der<br />
Autor auf der ersten Seite die Verfassung des Singles niedergeschrieben hatte.<br />
Die in einen Single verschossene Frau hat ihren Wochenrhythmus nach dem<br />
folgenden Muster zu organisieren: Montag – er, Dienstag – er, Mittwoch und<br />
Donnerstag – er und er, Wochenende – er, mit ihm, ihn, ihm, über ihn. Die<br />
sieben Single-Fälle.<br />
Das hat Emila zu einem apokalyptischen Schluss kommen lassen: Der<br />
Menschheit steht eine Katastrophe bevor, die alles bisher Dagewesene in den<br />
Schatten stellt, schlimmer als der Dschihad. Die Ichitis. Denn der Tag wird<br />
kommen, da nur noch Singles diese Welt bevölkern. Und es wird ekstatisch<br />
schallen von überall her: ich, für mich und über mich vor allen Dingen! Die<br />
Singles werden sich gegeneinander wenden, wenn ihr Verlangen nach Verehrung<br />
auf taube Ohren stößt. Und ein Single wird die Hand erheben wider<br />
seinen Single-Bruder. Und mit dem Hohelied des „Ich“ auf den Lippen werden<br />
sie übereinander herfallen. Sie werden einander hinterrücks erschießen,<br />
sich sehenden Auges mit Stöcken erschlagen. Und die Erde wird in Single-<br />
Blut ertrinken. Und ein Krieg wird ausbrechen, wie ihn die Welt noch nicht<br />
gesehen hat. Ein Krieg der Ein-Mann-Heere. Und diese Heere werden in die<br />
Millionen gehen. Emila hofft nur, dass sie diese blutigen Konsequenzen der<br />
Ichitis nicht mehr miterleben muss.<br />
Mit ihrem Verlobten verhält es sich anders. Er ist jederzeit verfügbar. Nachts<br />
genauso wie am helllichten Tag, selbst während der sonntäglichen Messe, ihr<br />
Geliebter kann das geheime Spiel der Lust eröffnen, dem Emila sich nicht<br />
entziehen kann und will: streichelnde Finger, heißer Atem, behutsame Berührungen<br />
an Brüsten und Hüfte. Will Emila lieber alleine sein, wartet er geduldig<br />
in der Küche oder im Esszimmer. Auch er hat seine Ruhephasen. Alle<br />
drei bis vier Tage liegt er einmal rücklings vor ihrem dem Bett, das schwarze<br />
Köfferchen im Arm.<br />
Emilas Liebhaber ist nicht der Gesprächigste, das schätzt sie an ihm ganz<br />
besonders. Er langweilt sie nicht mit diesen im Fernsehsessel geschauten typischen<br />
Bärchen-Weisheiten über diese unsere Welt, schon gar nicht mit denen<br />
aus Discovery Science. Sie brechen sich in aller Regel nach dem Mittagessen<br />
Bahn. Emila nennt diese Philosophie nur den „Nachmittagismus“. Der Nachmittagismus<br />
ist eine Kombination aus „Scheißegalismus“ und „Neopenetrantismus“.<br />
Und wie Cato immer gepredigt hat, dass Karthago zerstört werden<br />
müsse, so beschließen diese Philosophen ihre Weisheitsausbrüche mit dem<br />
Ausruf:<br />
– Alles Verbrecher! Alle wegsperren! Steht noch ein Bier kalt?<br />
Papi und Mami stehen ihrer Beziehung nicht im Weg. Sie protestieren nicht<br />
einmal, wenn Emila ihn beim Essen begehrlich berührt und unter ihren Fingerkuppen<br />
die Lust aufleben lässt. Nie würde ihnen einfallen, ihre Tochter mit<br />
Fragen nach Verlobung oder Hochzeit zu bedrängen.<br />
Einmal nur hatte ihre Mutter gefragt, ob er nicht etwa Finne oder Schwede<br />
sei, sein Name wäre so komisch, so gar nicht polnisch. Und warum er denn<br />
so ein Hänfling wäre, ein richtiger Däumling. Sicher, eine Basketballkarriere<br />
stand ihm nicht bevor, aber so hatte sie ihn wenigstens fest im Griff. Mäkeleien<br />
wären in ihrem Alter ohnehin ein unzulässiger Luxus. „Kugelrund, spindeldürr,<br />
riesengroß, miniklein – alle, alle, alle können Ehemänner sein“ – das<br />
Lied war ihnen auf den Leib geschrieben.<br />
Und der Name? Weil er allzu fremd klang, nannte sie ihn irgendwann einfach<br />
Eryk. Ihre Eltern behandeln Eryk wie Luft. Nur ganz ab und zu bitten<br />
sie ihn reichlich kühl, etwas für sie zu erledigen: Schlangestehen vor dem Ärztehaus,<br />
die Gasrechnung überprüfen oder rausfinden, was es bei Tante Krystyna<br />
in Deutschland neues gibt. Eryk erfüllt jeden Wunsch im Handumdrehen.<br />
Er ist ausgesprochen hilfsbereit und würde sich – im Gegensatz zu ihren<br />
verflossenen Bärchen – nie ein abfälliges Wort erlauben, keine aufgetakelten<br />
Perückenschnepfen oder verklemmten Betbrüder.<br />
Eryk hat noch einen weiteren, viel wichtigeren Vorzug: Er hat vollstes Verständnis<br />
für Emilas krankhafte Neigungen, die für ihre meisten Bärchen ein<br />
unüberwindliches Hindernis darstellten. Schon nach zwei oder drei Anfällen<br />
suchten ihre potenziellen Zukünftigen panisch das Weite. Sie gaben Emila<br />
und ihren Zweitzahnbürsten den Laufpass. Der lachende Dritte war ihr Vater.<br />
Der Zahnbürstenvorrat, den er für seine wenigen noch verbliebenen Zähne<br />
angesammelt hatte, würde bis ans Ende seiner Tage reichen. Oder ihrer.<br />
Eryk fürchtete Emilas Krankheit nicht. Allerdings muss man Frauen ohne<br />
Anomalien heutzutage auch mit der Lupe suchen. Jede hat ihre Wehwehchen<br />
und einen bunten Strauß psychischer Devianzen.<br />
So auch Emila. Aber der Reihe nach: Wenn es Schnapsdrosseln und<br />
Kräuterhexen gibt, wenn man auf Schritt und Tritt über Ökofaschistinnen,<br />
Gralshüterinnen von Männerkonten, über Fitness- und Vollkornpäpstinnen<br />
stolpert, wenn man die Mitglieder der als Club der Cappuccino-Freunde getarnten<br />
Geheimen Silikon- und Botox-Schwesternschaft identifizieren kann,<br />
wenn man auf den ersten Blick erkennt, wer der Hedone zu Diensten ist, wer<br />
aus der heilen Pfarrei-Idylle ins kalte Lebenswasser gestürzt ist und wer den<br />
Hammerhai im Rock spielt, dann ist Emila …<br />
Emila ist narkoleptikerin.<br />
Da hilft keine Spezialdiät und auch kein Nordic Walking. Also gibt Emila<br />
ihrer Krankheit nach, statt gegen sie zu kämpfen. Sie räumt der Narkolepsie<br />
ein, nicht ihre zweite, sondern ihre erste Natur zu werden. So kommt Emila<br />
zu einer zusätzlichen Biografie. Die eine ist korrekt und glatt wie der Lebenslauf<br />
aus einer Bewerbung als Bürokraft. Die andere ist verschlafen, verborgen,<br />
unterirdisch, eine Art venezianischer Spiegel.<br />
Wenn Emila kollabiert und ihre Flashbacks hat – die zynischen Wachseins-<br />
Apostel sprechen vom „Nageleinschlagen“ – kann nur Eryk sie wieder zu Bewusstsein<br />
bringen. Die narkoleptischen Schübe dauern mal eine Minute, mal<br />
eine halbe Stunde, aber wenn es vorbei ist, fragt Eryk nicht blöde, was sie<br />
geträumt hat, oder ob er den Krankenwagen rufen soll.<br />
Gerade summt Eryk, der auf dem Rand des Kissens liegt, Never Ending<br />
Story. Emila spielt die Verschlafene. Sie streckt die Hand nach ihm aus, um<br />
sich sogleich auf die andere Seite zu drehen. Eryk verstummt und gönnt seiner<br />
Liebsten ein paar Minuten Schlaf.<br />
Aus dem Polnischen von Thomas Weiler<br />
ZNAK, KRAKÓW 2012<br />
140 × 205, 260 PAGES<br />
ISBN: 978-83-240-1896-3<br />
TRANSLATION RIGHTS: ZNAK<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
24<br />
ADAM WIEDEMANN<br />
ADAM WIEDEMANN (GEB. 1967), LYRIKER,<br />
PROSASCHRIFTSTELLER, LITERATUR- UND<br />
MUSIKKRITIKER, ZEICHNER, ÜBERSETZER<br />
AUS DEM UKRAINISCHEN, SLOWENISCHEN<br />
UND ENGLISCHEN (U.A. HARRY MATHEWS<br />
UND GERTRUDE STEIN)<br />
Photo: <strong>Instytut</strong> Książki<br />
Entsprechungen<br />
Adam Wiedemann, der in letzter Zeit eher als Lyriker in Erscheinung getreten<br />
ist, hat ein neues Prosawerk vorgelegt. Seit seinem letzten Erzählband<br />
(„Gewaltige Verschlechterung des Gehörs“, Hainholz Verlag 2001) ist mehr<br />
als ein Jahrzehnt vergangen, die Neuerscheinung ist also bezeichnend, bemerkenswert<br />
und obendrein gelungen. Bei den „Entsprechungen“ handelt<br />
es sich wiederum um eine Sammlung von (insgesamt 20) mal längeren, mal<br />
kürzeren Geschichten. Diese in Polen heute nicht sonderlich beliebte Form<br />
liegt Wiedemann immer noch am besten, glücklicherweise verfällt er nicht<br />
in die verbreitete Unsitte, Erzählungen zu Romanen aufzublasen.<br />
Abgesehen von wenigen pasticheartigen Texten erzählt Wiedemann über<br />
das, was er am besten kennt – über sein Leben. In diesem Erzählen über sich,<br />
einen Künstler mittleren Alters, der in reichlich mittelmäßigen Zeiten sein<br />
Leben lebt, legt er allerdings eine Verve und einen Humor an den Tag, die<br />
von jeglichem Mittelmaß weit entfernt sind; er stellt sich mit unverhohlener<br />
Sympathie in die Traditionslinie eines Modus des Erzählens über das eigene<br />
Leben, den in der polnischen Literatur Miron Białoszewski geprägt hat. Nur<br />
überwiegt in den „Entsprechungen“ nicht die Beschreibung des häuslichen<br />
Treibens, sondern das Auswärtsspiel in reportageartigen Erzählungen über<br />
die Abenteuer („Geschehnisse“ wäre der treffendere Ausdruck) bei den zahlreichen<br />
Festivals, Messen und Stipendienaufenthalten im Ausland, die sich<br />
über die Jahre angesammelt haben.<br />
Wir haben es also mit sehr persönlichen Berichten über ein „normales“<br />
Einzelleben mit (zumal für Leser jenseits des Literaturbetriebs) durchaus<br />
exotischen Zügen zu tun, die sich stets der sprachlichen Fallstricke bewusst<br />
sind, die alles Erzählen durchkreuzen. „Du denkst, du erlebst etwas, du erlebst<br />
es sogar wirklich, und dann weißt du plötzlich, du hast nichts erlebt,<br />
und das ist auch kein Schaden.“ Wir haben sogar alle einen ästhetischen,<br />
ja einen existenziellen Nutzen davon. „Es ist kein Schaden, dass du nichts<br />
mehr davon weißt, was du nicht erlebt und was du erlebt hast, obwohl du<br />
dachtest, du würdest es vielleicht nicht mehr erleben. Du hast es noch erlebt,<br />
und es hat dir sogar etwas gebracht“, schreibt Wiedemann in seinem<br />
kurzen Text über eine Stipendiatenepisode in Iowa City.<br />
Freuen wir uns, dass es Wiedemann (und den Lesern) so viel gebracht hat.<br />
Marcin Sendecki<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
25<br />
Du<br />
denkst, du erlebst etwas, du erlebst es sogar wirklich, und dann<br />
weißt du plötzlich, du hast nichts erlebt, und das ist auch kein<br />
Schaden. Es ist kein Schaden, dass du nichts mehr davon weißt,<br />
was du nicht erlebt und was du erlebt hast, obwohl du dachtest, du würdest<br />
es vielleicht nicht mehr erleben. Du hast es noch erlebt, und es hat dir sogar<br />
etwas gebracht.<br />
Ich erinnere mich dunkel an Zimmer, Häuser. An Menschen. Diese Menschen<br />
gibt es nicht und ich weiß nicht mehr, wovor sie Angst hatten.<br />
Mary hatte mich geweckt, sie hatte einen Umschlag mit meiner EC-Karte<br />
dabei. Ich hatte auf etwas Netteres gehofft, möglichst ohne Mary-Dreingabe,<br />
dabei war Mary höchst wahrscheinlich. Mary ist wie eine Mutter für uns, sie<br />
liebt uns, weil sie uns geboren hat, was verständlicherweise für Unmut sorgt,<br />
denn wer will schon das Kind von einer wie Mary sein.<br />
Jetzt frage ich mich nur noch, ob dieser ganze düstere Alptraum durch<br />
das Poltern an der Tür ausgelöst wurde, oder ob das Poltern mich vor dem<br />
Schlimmsten bewahrt hat.<br />
Die Karte war sehr hübsch und es stand drauf, man sollte etwas mit ihr tun.<br />
Das verschob ich auf später, so schnell geht das nicht, vor dem Aufstehen, vor<br />
dem ersten Drink. Ich ließ sie auf der Schlafcouch zurück und machte mich<br />
an Gertrude Stein, die auf dem Tisch lag. Man stelle sich nur einmal vor,<br />
Gertrude Stein hat das alles im nüchternen Zustand geschrieben. Sie hat das<br />
alles im nüchternen Zustand geschrieben, heißt es. Ein nüchterner Mensch.<br />
Ordentlich. Solche Menschen muss man lieben. Ich muss Schwester Teresa<br />
schreiben, dachte ich.<br />
Aber ich schrieb nicht. Ich übersetzte ein paar Seiten „Useful Knowledge“,<br />
bis sie for, four und fortunately stapelte, das war zu viel. Es war schon halb fünf.<br />
Auf der Schlafcouch sah ich die Karte liegen.<br />
Die Karte ließ mir drei Optionen: hingehen, mailen oder anrufen. Ich rief<br />
an. Es meldete sich ein Automat, ließ mich verschiedene Dinge tun, ich tat<br />
sie, solange ich konnte. Als ich nicht mehr konnte, meldete sich eine andere<br />
Stimme. Bist du ein echter Mensch?, fragte ich.<br />
Jawohl, das bin ich, antwortete die Stimme. Sie ließ mich dasselbe tun wie<br />
der Automat. Das war ganz einfach. Wir verabschiedeten uns in beiderseitigem<br />
Einvernehmen auf das herzlichste. Diese Stimme gibt es noch. Ich mag<br />
sie. Ich könnte sie noch einmal anrufen.<br />
Ich könnte sie in der Realität treffen. Ich könnte mich mit ihr verabreden.<br />
Ich könnte, könnte, aber nüchtern betrachtet, was soll die Quälerei.<br />
Ich zog mich an und verließ die Wohnung. In einem Antiquariat gab es das<br />
Buch „Wars I Have Seen“ für 6 $, ich nahm es und ging zur Kasse. Könnte ich<br />
das kaufen?, fragte ich.<br />
Ich denke, du könntest, sagte die Kassiererin. Sie war dick. Ich lachte laut.<br />
Ich bezahlte 6.80 inklusive tax. Und ich ging in die Bar nebenan, eine Hamburger-Bar.<br />
John hatte nämlich gesagt, dort gibt es die authentischsten Hamburger,<br />
die muss man probiert haben.<br />
Ich setzte mich und nahm mir die Karte, es gab alle Arten von Hamburgern.<br />
Ich wollte einen ganz normalen, bestellte aber einen mit Speck, das klang irgendwie<br />
besser. Und eine Limo, hier haben sie überall Limo und man kann sie<br />
einfach so bestellen, ohne zu erklären, was man will und wie das geht. Willst<br />
du was zum Hamburger dazu?, fragte die Bedienung. Pommes? Für Hamburger<br />
mit Pommes ist es noch zu früh, antwortete ich und meinte damit,<br />
vielleicht beim nächsten Mal. Die Bedienung ging den Hamburger holen. Ich<br />
zog „Wars I Have Seen“ heraus und begann zu lesen. Gertrude kann man in<br />
der Bar lesen. Man kann sie überall lesen, sie gebraucht keine überqualifizierten<br />
Verben. Die Bedienung brachte die Limo, sie war riesig. Mir gegenüber<br />
setzte sich ein älterer Mann ohne Arm, er war sehr unglücklich oder verrückt.<br />
Er bestellte etwas und beklagte dann lauthals sein Schicksal. Adam, beruhige<br />
dich, rief eine Bedienung von hinten.<br />
Der Mann ohne Arm beruhigte sich. Wir bekamen unsere Hamburger. Der<br />
Speck in meinem war gut gewürzt, das Brötchen gut gebacken, man konnte<br />
das gut essen. Willst du noch was?, fragte die Bedienung und setzte sich zu den<br />
Leuten am Nebentisch.<br />
Oh, Adam, sagten die, wie geht’s, schön dich hier zu sehen. Lesend leerte ich<br />
die Limo, Gertrude wurde immer besser, die Limo wurde wässrig.<br />
Ich stand auf und ging zur Kasse, ich hatte 6 $ klein. Die Rechnung belief<br />
sich auf 6,41 inklusive tax, ich hielt einen Hunderter hin. Ich muss dir in Fünfern<br />
rausgeben, sagte die Kassiererin. Und wenn ich mit Karte zahle?, sagte ich<br />
und zahlte mit Karte, obwohl ich die Karte das erste Mal vielleicht lieber unter<br />
erhebenderen Umständen gebraucht hätte. Hier ist Platz für den tip, sagte die<br />
Kassiererin, schreib soviel du willst. Aber der tip war doch schon mit drin?,<br />
sagte ich und verwechselte tip mit tax. Tax ist immer schon mit drin, sagte<br />
die Kassiererin, hier kannst du den tip für mich hinschreiben. Ich schrieb 29<br />
Cent, damit es aufging, trat vor die Tür und machte mir klar, dass ich 69 hätte<br />
schreiben sollen. Nein, 59, was habe ich nur mit den Zahlen?<br />
Ich ging die Straße hinab und dachte an die tips oder taxes. Dass man nie<br />
wusste, wie viel man zahlt. Was schert mich die Kassiererin, was schert mich<br />
die Bedienung, ich gehe da nie mehr hin, das waren meine Gedanken. Zwei<br />
Jungs joggten vorbei, einer oben ohne, sehr attraktiv. Ich ging um ihn herum,<br />
er hatte nämlich an einer Ampel gestoppt, Schweißtropfen auf der Haut,<br />
schwer atmend, umsonst. In einem Geschäft suchte ich Kuchen, ich fand Bio-<br />
Kekse für 3 $. Der Kassierer war komplett tätowiert, er bekam tax. Tax bekommen<br />
die, die es nicht verdienen, dachte ich, obwohl dieser tax tip für den<br />
Kassierer war. Alle sind hier total tattooed, machen aus sich einen Text.<br />
Aus dem Polnischen von Thomas Weiler<br />
RITA BAUM, WROCŁAW 2012<br />
130 × 178, 228 PAGES<br />
ISBN: 978–83–924251–8–2<br />
TRANSLATION RIGHTS: ADAM WIEDEMANN<br />
CONTACT: RITA BAUM<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
26<br />
ŁUKASZ ORBITOWSKI<br />
ŁUKASZ ORBITOWSKI (GEB. 1977), PROSAIST UND<br />
POPULÄRER PUBLIZIST, AUTOR REALISTISCHER<br />
HORROR- UND SCIENCE-FICTION-LITERATUR, VON<br />
SEINEN LESERN WIRD ER AUCH FÜR DIE SAMMLUNG<br />
MÄRCHENHAFTER ERZÄHLUNGEN DER VORSITZENDE<br />
UND DER STRICH. WIE KATZEN SICH DIE WELT<br />
ERKLÄREN GESCHÄTZT.<br />
Photo: Bartłomiej Kwasek<br />
Gespenster<br />
Łukasz Orbitowski beweist in Gespenster, dass er zu jenen Autoren gehört,<br />
die die ungezügelte narrative Imagination der phantastischen Literatur<br />
geschickt mit der Aufmerksamkeit eines scharfsinnigen Psychologen und<br />
Beobachters der Wirklichkeit zu verbinden wissen.<br />
Die breit angelegte Handlung des Romans beginnt mit einer beunruhigenden<br />
Szene, an der ein kleines Mädchen und ein Soldat beteiligt sind. Die geheimnisvolle<br />
Schachtel, die hier auftaucht, ist das Leitmotiv, das sich durch<br />
die gesamte Erzählung zieht. Die eigentliche Verbindung wird jedoch nach<br />
einem guten Dutzend Seiten hergestellt, vor dem für den 1. August 1944<br />
geplanten Warschauer Aufstand. Krzyś (er ist dem jungen und berühmten<br />
Dichter Krzysztof Kamil Baczyński nachempfunden, der im Aufstand ums<br />
Leben kam) wird daran teilnehmen, er ist auf dem Weg zum Sammelpunkt.<br />
Seine Verlobte, Basia, soll eine Schachtel verstecken, ohne dass ihr zukünftiger<br />
Mann etwas davon mitbekommt. Aber es kommt nicht zum Aufstand.<br />
Die Waffe funktioniert nicht. Die Geschichte Polens nimmt einen anderen –<br />
alternativen – Lauf, auch für Krzyś, der in Orbitowskis Buch nicht bei Kampfhandlungen<br />
ums Leben kommt. Jener Krzysztof lebt im sozialistischen Polen<br />
und versucht einen Roman zu schreiben, der den aktuellen politischen<br />
Bedürfnissen gerecht wird. Das bereitet ihm riesige Schwierigkeiten. Außerdem<br />
kämpft er mit gewöhnlichen Alltagsproblemen im Kontakt mit anderen<br />
Menschen und sich selbst. Im Hintergrund der Abenteuer von Krzysztof<br />
kommt es zur gleichen Zeit zu schicksalshaften Ereignissen zwischen dem<br />
Milizionär Wiktor und dem politischen Gefangenen Janek.<br />
Der Roman Orbitowskis schillert in vielen Farben. Die phantastische Narration<br />
vermischt sich mit realistischen Schilderungen, von einer historischen<br />
Aura umgebene Motive entpuppen sich plötzlich als identisch mit der Gegenwart,<br />
und der Elan bei der Darstellung der Figuren hat direkt zu tun mit<br />
der psychologischen Beobachtung zwischenmenschlicher Beziehungen. Auf<br />
diese Weise jongliert Orbitowski ausgezeichnet mit Stilen, Perspektiven und<br />
Atmosphären. Seine solide, mitunter filmische Prosa hat ohne Zweifel ihren<br />
Platz im Kreis der wichtigsten Autoren der phantastischen polnischen Gegenwartsliteratur.<br />
Marcin Wilk<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
27<br />
Krzyś<br />
zog die Papiere aus dem Versteck, es waren dort ein<br />
paar Untergrundzeitungen, zerknitterte Exemplare<br />
des Neuen Spatzen, militärische Lehrbücher aus<br />
der Vorkriegszeit und das schon unter deutscher Besatzung im Untergrund<br />
herausgegebene Buch Emotionale Psychologie von Petrażycki. Darunter lagen<br />
Karten und Schulungsmaterialien, die die wahren Schätze verdeckten: eine<br />
Thompson mit langem Kolben, zwei Sten Guns, eine Schmeisser, außerdem<br />
ein paar Granaten und ein wenig Munition. General Monter hatte gesagt,<br />
falls jemand keine Waffe habe, solle er einen Stein nehmen und eine erbeuten.<br />
Krzyś hatte eine Waffe.<br />
Er krümmte sich einen Moment über dem kleinen Kasten zusammen, aber<br />
nicht wegen des Asthmaanfalls, wer hätte sich an so einem Tag um Asthma<br />
geschert? Krzyś überlegte, was er nehmen sollte, schließlich gehörten ihm die<br />
Waffen nicht, aber mit leeren Händen in die Focha-Straße zu gehen hatte nun<br />
auch keinen Sinn. Und was ist, wenn ihn eine Patrouille anhält?<br />
Es war ein warmer Tag, eine Sten würde er unter dem Mantel verstecken<br />
können, nur dass ein Mantel am 1. August verdächtig aussah. Doch sollten<br />
an jenem Tag auf Warschaus Straßen jede Menge Menschen im Mantel zu<br />
sehen sein. Krzyś wusste, dass Soldaten außer Mänteln und Stens auch Schuhe<br />
brauchten, und er musste sich welche organisieren. Es war nicht genug Zeit.<br />
Er verspürte einen komischen Unwillen, es war, als ob ihm mit diesem Auftrag<br />
zu verstehen gegeben worden wäre, dass er sich im Hintergrund halten<br />
und den Kämpfenden behilflich sein sollte, als ob man den Gedanken von<br />
seinen Augen hätte ablesen können, dass Kämpfen bedeutete zu töten; Krzyś<br />
hingegen schien ein Mensch zu sein, der stirbt, ohne zu murren, aber mit dem<br />
Töten ein Problem hat. Er verscheuchte diese Gedanken und tröstete sich damit,<br />
dass jetzt alle in Warschau von Zweifeln geplagt wurden und ein jeder<br />
anderswo sein wollte, in einem anderen Kommando, in einem anderen Haus<br />
oder einer anderen Einfahrt als der, in der er gerade saß, und ganz sicher gab<br />
es Menschen, die in diesem Moment gerne vor einem Versteck voller Waffen<br />
gekniet hätten.<br />
Er legte zwei Granaten aufs Bett, räumte das Papier zurück und setzte die<br />
Parkettstäbe wieder ein. Er schob die Couch zur Seite und setzte sich darauf, er<br />
war außer Atem. Basia fehlte ihm, ihre Worte und ihr Mund am allermeisten,<br />
aber auch dieser einfache Handgriff: immer, wenn er das Versteck geschlossen<br />
hatte, war Basia mit Besen und Wischlappen gekommen, sie war erstaunlich<br />
vorsichtig, dafür, dass sie so ein schönes Mädchen war. Er konnte sich nicht<br />
erklären, warum Basia das tat, schließlich war es überflüssig; wenn jemand<br />
sie denunziert hätte oder irgendein Deutscher zufällig hereingekommen wäre,<br />
hätte er sofort die Couch bemerkt und an die Dielen darunter gedacht, da<br />
hätte kein Fegen geholfen. Aber Basia fegte, sie fegte immer wieder.<br />
Er dachte jetzt daran, wo sie wohl sein mochte, ob sie schon in der Pańska-<br />
Straße war, und falls nicht, ob sie dorthin gelangen wird, bevor es losgeht,<br />
schließlich muss man kein General sein, um zu wissen, was sich zusammenbraut.<br />
Die Mobilmachung dauerte schon einige Tage an, von Praga, von<br />
Radzymin und Otwock feuerte die sowjetische Artillerie ihre Salven ab, und<br />
Fischers Befehl, Gräben auszuheben, war anstelle der ganzen Stadt nur eine<br />
Handvoll Idioten nachgekommen. Basia – die nie etwas hatte wissen wollen<br />
– weiß Bescheid, es lohnt sich zu fragen, was sie mit diesem Wissen macht,<br />
verkriecht sie sich irgendwo oder folgt sie Krzyś? Diese Frage setzte ihm zu,<br />
und ein Schmerz breitete sich in seinem Körper aus, arm und dürr wie er war.<br />
Krzyś wusch sich das Gesicht, steckte die Granaten in die Hose und verdeckte<br />
sie mit seinem sandfarbenen Mantel, der für seine schmalen Schultern<br />
zu groß war, aus den überlangen Ärmeln ragten dünne Handgelenke, aus<br />
dem gestärkten Kragen der Kopf eines Jungen mit ängstlichen Augen hervor.<br />
Er warf einen Blick durch das Fenster, auf die Uhr und wieder durch das<br />
Fenster, dort eilten Menschen über gepflasterte Gehwege, strebten in chaotischen<br />
Grüppchen den ihnen bekannten Zielen zu; wenn irgendein Gesicht<br />
im Fenster erschien, dann nur, um gleich wieder zu verschwinden, aus einer<br />
dunklen Einfahrt sprang barfuß ein stinkender Hosenmatz hervor, auch ihn<br />
verschluckte umgehend eine andere dunkle Einfahrt. Die Phantasie des Poeten<br />
ergänzte den Rest: die Mauern des Wohnhauses in der Hołówka-Straße<br />
reißen auf wie frisch vernarbte Wunden, unter dem Putz scheinen feuchte rote<br />
Backsteine hervor, die Tore sind hoch, schmal, haben die Form uralter Steine,<br />
das leere Abbild heidnischer Kreise, aus denen diejenigen herausfallen, die<br />
von Warschau gefressen wurden, die auf die Teller der Moskowiter, Sowjets<br />
und Deutschen geworfen wurden, sie werden verputzt mit Besteck aus den<br />
Knochen der Volksdeutschen, zerbissen, zerkaut – nun sind sie wieder heil,<br />
sie stürmen in die Freiheit – die beim Massaker von Praga abgeschlachteten<br />
Jungs, die vom sibirischen Frost Dahingerafften, die auf der Szuch-Allee Erschossenen,<br />
die Verhungerten, das Lebendige in der Asche des vor kurzem<br />
noch existierenden Ghettos, alle sausen im Wind aus den Eingeweiden der<br />
Stadt. Über dieses Bild schob sich ein anderes, das sogar Krzyś überraschte:<br />
Es herrscht Frieden, die Deutschen sind vernichtet, die befreiten Geister<br />
verbrüdern sich, Freunde und Liebende finden zueinander, endlose Kolonnen<br />
schwarzer Autos jagen zum Spaß dahin und feiern den Sieg, wo furchterregende<br />
Kapellen lebhaft spielen, suchen sich Verliebte einen Platz in den oberen<br />
Rängen oder paaren sich direkt vor aller Augen, überzeugt davon, dass sie,<br />
da sie doch tot sind, für ihre Ausschweifungen nicht werden büßen müssen.<br />
Erschlagene Legionäre dreschen einen Skat oder Poker, abgestochene Huren<br />
flirten mit ihnen, von den Toten auferstandene Kinder werfen fröhlich die<br />
Scheiben in den Häusern ein, schließlich sind sie schon im September, vor<br />
fünf Jahren, zu Bruch gegangen.<br />
Und dann schweben die Gespenster, was noch schöner ist, in Richtung Altstadt,<br />
auf die Marszałkowska-Straße, wo sie sich in einen Leichenreigen ergießen,<br />
der erstrahlt im Glanze des Sieges. Jeder trägt eine lustige Mütze oder<br />
farbige Kleidung, rotes Konfetti schießt in den Himmel, es ertönt Gelächter,<br />
es erklingt ein Lied von Akkordeons, Gitarren und Leierkästen, und jene<br />
Fröhlichen, Siegreichen, Verstorbenen reißen die Lebenden mit sich in ihren<br />
freudigen Taumel, heben die Krüppel aus ihren Rollstühlen, stoßen den Greisen<br />
ihre Stöcke weg und ziehen sie mit sich, sie drücken Soldaten, deren Frauen,<br />
Mütter an sich, feuern Salutschüsse ab, schneller und schneller, Lebende<br />
und Tote, Könige und Unteroffiziere, vereint in einem Reigen auf den Straßen<br />
Warschaus. Wo auch immer man hinblickt, kein einziges trauriges Gesicht,<br />
es sei denn die Fresse eines Schmalzowniks oder Volksdeutschen – oder eines<br />
an der Laterne aufgeknüpften Blauen Polizisten, der eine wütende Grimasse<br />
schneidet. Warschau lacht, Warschau tanzt, zusammen mit den Menschen<br />
tanzen Tiere und Häuser, die Stadt fährt auf in den Himmel in diesen heiligen<br />
Tagen des August. So sah es zumindest Krzyś, eindeutig erschrocken über sich<br />
selbst überlegte er, ob er das nicht aufschreiben und irgendwie Basia geben<br />
sollte, als gutes Omen – wenn man dem Dichter den Kopf aufschneiden und<br />
daraus die Zukunft lesen könnte, wäre das Leben einfacher. Er lächelte bei<br />
diesem Gedanken – dem Anblick der Priester über dem gespaltenen Schädel<br />
des einen oder anderen Dichterpropheten – und entschied, dass er es nicht<br />
aufschreiben würde, weil er sich beeilen musste. Wo auch immer Basia war,<br />
sie würde sicher warten.<br />
Aus dem Polnischen von Benjamin Voelkel<br />
WYDAWNICTWO LITERACKIE, KRAKÓW 2012<br />
145 × 205, 544 PAGES<br />
ISBN: 978-83-08-04774-3<br />
TRANSLATION RIGHTS: WYDAWNICTWO LITERACKIE<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
28<br />
MAŁGORZATA SZEJNERT<br />
MAŁGORZATA SZEJNERT (GEB. 1936),<br />
JOURNALISTIN, REPORTERIN,<br />
SCHRIFTSTELLERIN. MITBEGRÜNDERIN<br />
DER ZEITUNG „GAZETA WYBORCZA”,<br />
BEI DER SIE 15 JAHRE LANG DAS<br />
REPORTAGERESSORT LEITETE UND<br />
ZAHLREICHE JUNGE REPORTER<br />
AUSBILDETE UND SCHULTE.<br />
Photo: Andrzej Bernat<br />
Das Heim der Schildkröte. Sansibar<br />
Małgorzata Szejnerts neues Reportageabenteuer nahm seinen Anfang bei<br />
der Begegnung mit einer … Schildkröte.<br />
Szejnert fuhr nach Sansibar, um tauchen zu lernen. Kaum unter Wasser, begegnete<br />
sie einer Grünen Meeresschildkröte, der heute äußerst seltenen Königin<br />
der sansibarischen Gewässer. – „Die Sonnenstrahlen beleuchteten sie;<br />
sie sah aus wie eine goldene Honigwabe“, sagte Szejnert später.<br />
Als sie aufgetaucht war und das Tauchgerät abgenommen hatte, setzte<br />
Małgorzata Szejnert sich an den Computer, um mehr über die Grüne Meeresschildkröte<br />
zu erfahren. Und erfuhr, dass diese Tiere 170 Jahre alt werden<br />
– könnten, gäbe es da nicht den Schädling namens Homo sapiens. Dass<br />
das Schildkrötenweibchen seine Eier an dem Strand ablegt, an dem es selbst<br />
geboren wurde. Und dass es an diesem Strand immer häufiger ein vom Homo<br />
sapiens errichtetes Hotel vorfindet. Und Beton, durch den die Schildkrötenflossen<br />
sich keinen Weg bahnen können.<br />
„Diese Heimatlosigkeit der Schildkröte, die schließlich auf dem Rücken ihr<br />
eigenes Heim mit sich herumträgt, hat mich sehr berührt“, sagt Małgorzata<br />
Szejnert. Und so wurde die Schildkröte zum Leitmotiv ihres Buches, das die<br />
Geschichte der Insel im Zeitraum von ebendiesen 170 Jahren schildert.<br />
Dabei zeigt sich, dass die Menschen im Laufe des Lebens einer einzigen<br />
Schildkröte imstande sind, sich ein wahres Kaleidoskop von Geschehnissen,<br />
Haltungen, Ideologien, Kriegen, Revolutionen, Wortbrüchen und Fanatismen<br />
zu bereiten. Małgorzata Szejnerts Sansibar sprudelt über von außergewöhnlichen<br />
Ereignissen und Gestalten – kaum zu glauben, dass das alles auf<br />
einer einzigen kleinen Insel geschehen sein soll. Ein fieser Sklavenhändler<br />
rettet einen eingefleischten Gegner der Sklaverei vor dem Tod; ein polnischer<br />
Aufständischer ertränkt (als französischer Konsul) seinen Kummer in<br />
der Dichtkunst; ein britischer Reisender bricht zum Herzen Afrikas auf und<br />
verfällt dem Wahnsinn, woraufhin Träger ihn neun Monate lang weitertransportieren,<br />
damit er in Westminster beerdigt werden kann.<br />
Das Sansibar Małgorzata Szejnerts ist die Welt im Miniaturformat; hier<br />
finden alle großen Übel der vergangenen zwei Jahrhunderte ihren Widerhall.<br />
Zuerst der Kampf um die Rechte der schwarzen Sklaven, später dann<br />
der Schatten des im fernen Deutschland aufkeimenden Imperialismus, der<br />
sich mit der Zeit zum Faschismus auswuchs. Der Kommunismus, der sich in<br />
eine blutige Revolution verwandelte. Schlussendlich dann die heutigen<br />
Zeiten: das wachsende Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich. Und die<br />
Zubetonierung der Strände, an denen reiche Touristen sich wie zu Hause<br />
fühlen und Schildkrötenweibchen keinen Platz zur Eiablage finden. Dafür<br />
allerdings scheint sich, außer der polnischen Reporterin, kaum jemand zu<br />
interessieren.<br />
Witold Szabłowski<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
29<br />
Gewürznelken. Unguja und Pemba, Sansibar<br />
Die Zeugnisse der Sklavenarbeit sind verschwunden – die Rikschas von den<br />
Straßen in Stone Town, die Nelkenknospen von Sansibars Flagge.<br />
Pflückt man die Knospen nicht rechtzeitig, sind sie, wie man weiß, nichts<br />
mehr wert. Doch wer sollte sie pflücken? Vor der Revolution sammelten Saisonarbeiter<br />
vom afrikanischen Festland sie ein. Jetzt halten Engpässe bei der<br />
Nahrungsversorgung auf den Inseln die Arbeiter von der Herfahrt ab. Die<br />
Ernten werden zusätzlich dadurch beeinträchtigt, dass die Vereinigung der<br />
Nelkenanbauer der staatlichen Kontrolle unterstellt wurde und ihre Erfahrungen<br />
kaum noch weitergeben kann. Die Organisation der Arbeit verkommt. Es<br />
ist bequemer, nur die Knospen von den unteren Zweigen zu pflücken und die<br />
oberen am Baum zu lassen. Auf einigen Plantagen bleiben angeblich vierzig<br />
Prozent der Knospenstände an den Bäumen. Die von der Regierung festgelegten<br />
Nelkenpreise sind um vieles niedriger als die auf dem Weltmarkt, und<br />
so wird bereits ein Teil der Ernten nach Festlandafrika geschmuggelt. Die<br />
Behörden drohen mit Todesstrafe für dieses Verbrechen, aber Unguja und<br />
Pemba verfügen über historische Erfahrung im Schmuggeln: So wie einst<br />
Sklaven unter einer Abdeckung in den kleinen dhows befördert wurden, fahren<br />
die flinken und leisen Segelboote heute mit Gewürznelken beladen gen<br />
Westen, hauptsächlich nach Kenia, und bringen wertvolle Gebrauchsartikel<br />
mit zurück, Zucker, Mehl, Öl, Kleidung, Zahnpasta, Seife, Streichhölzer und<br />
so weiter. Der Nelkenschmuggel nimmt solch mächtige Ausmaße an, dass<br />
sein jährlicher Wert in die Millionen Dollar geht. Die Regierung schätzt, dass<br />
1975 ein Drittel der Ernte aus Sansibar herausgezogen wurde.<br />
An Daten zu kommen, ob und wie viele Personen mit dem Tod bezahlen<br />
mussten, ist nicht möglich. Vielleicht bekam sogar niemand je die Höchststrafe,<br />
weil die Schmuggler so viel verdienten, dass sie Aufseher und Gerichte<br />
bestechen konnten.<br />
Ajit Singh. Ng’ambo, Sansibar<br />
Ajit Singh Hoogan verlässt Sansibar nicht, obwohl er diese Möglichkeit sicher<br />
in Betracht zieht. Doch er muss sein Haus bewachen. Pretty One ist prächtig<br />
genug, um sich auf der Verstaatlichungsliste wiederzufinden, die von Ali Sultan<br />
Issa, Vater von Raissa, Fidel, Maotushi und Stalin, aktuell gehalten wird.<br />
Der Verlust dieses Hauses, bei dessen Bau er Gottes Liebe gespürt hatte,<br />
wäre sehr schmerzlich für Singh. Aber nicht nur deshalb bleibt er auf der Insel.<br />
Die neue Regierung will die Stadt Sansibar völlig umgestalten. Bislang wurde<br />
das arabische Stone Town mit der Hauptstadt gleichgesetzt, und daran änderten<br />
auch Duttons und Singhs frühere Projekte auf der anderen Seite nichts.<br />
Obwohl Sansibars revolutionäre Regierung selbst die vornehmen, von der<br />
Vorgängerregierung übernommenen Gebäude nutzt, entthront sie das arabische<br />
Stone Town und lenkt den gesamten Investitionsstrom nach Ng’ambo.<br />
Auf Ajit Singh, den Gestalter des Raha Leo Civic Centers, das bei der Revolution<br />
eine so wichtige Rolle spielte, warten große Aufgaben.<br />
In der Hoffnung auf Arbeit und Aufstieg strömt Sansibars Bevölkerung in<br />
die Stadt. Die Populationskurve der Hauptstadt, in weit gefassten Grenzen,<br />
steigt ab 1964 steil nach oben. Im Jahrzehnt nach der Revolution verdoppelt<br />
sich die Stadtbevölkerung und übersteigt gegen Ende die Hundertfünfundzwanzigtausend.<br />
Transparente werben für die Idee einer sozialistischen Stadt,<br />
und der beliebteste Slogan der damaligen Zeiten lautet: Unsere Mutter ist die<br />
Revolution, unser Vater die Afro-Shirazi-Partei.<br />
Das Vorzeigeprojekt trägt den Namen Michenzani.<br />
Abdul Sheriff, Historiker und Professor an der Universität von Daressalam<br />
und Autor zahlreicher Bücher über Sansibar, nannte dieses Projekt Die Kreuzigung.<br />
Heute, im Jahr 2010, braucht man nur eine Satellitenaufnahme der Hauptstadt<br />
auf dem Computer aufzurufen, um die Richtigkeit dieser Behauptung zu<br />
überprüfen. Von oben sieht die Stadt aus wie eine kunstvolle Patchworkarbeit<br />
aus lauter winzigen Rechtecken und Quadraten. Die linke Seite – Stone Town<br />
– ist dicht gearbeitet, keine Spur von Rissen oder platzenden Nähten. Die<br />
rechte Seite – Ng’ambo – durchschneiden von Ost nach West, Nord nach Süd<br />
die Arme eines riesigen Kreuzes. Sogar auf einem Foto aus großer Höhe weckt<br />
sein Anblick Besorgnis und Neugier. Das Kreuz erinnert nicht an Gebäude,<br />
sondern an Ingenieurskonstruktionen – Festungen, Kanäle, Startbahnen?<br />
Es sind aber Häuser, oder eher Blocks. Der undeutliche Kreis an der Stelle,<br />
wo die Arme des Kreuzes sich überschneiden, ist das Becken eines Springbrunnens.<br />
Auf der Luftaufnahme sieht man, dass kein Wasser darin ist,<br />
sondern Müll, und dass verrostete Rohre herausragen. Im Übrigen kommt<br />
niemand an das mit Beton ausgekleidete Becken heran; es liegt in der Mitte<br />
eines Kreisverkehrs. Die Wohnblocks sind je dreihundert Meter lang und haben<br />
fast alle sechs Stockwerke. Sie sind aus grauem Beton gebaut und werden<br />
von Außengalerien im Zickzack gekreuzt. Alle Module sind gleich schmutzig,<br />
abgeblättert, rissig, Aufgänge und Wohnungen sind nicht gekennzeichnet;<br />
unverständlich, wie Tausende von Bewohnern hier ihre Wohneinheiten wiederfinden.<br />
Wohneinheiten sind es nämlich, und die haben mit der afrikanischen<br />
Art des Haushalts und familiären Zusammenlebens nichts gemein; zwei<br />
Zimmer und Küche in Beton. Die Blocks bilden endlose, wie ausgestorbene<br />
Perspektiven, die auch heute – im Jahr 2010 – kein Straßenverkehr beleben<br />
kann, keine an die Mauern gesprayten Schriftzüge, kein Handel mit Sofas,<br />
Sesseln, Puffs, die an den Wänden im Erdgeschoss entlang aufgestellt werden<br />
wie Reihen von alternativen, niedrigen, aber – der Abwechslung halber – weichen<br />
und bunten Gebäuden.<br />
Nicht Ajit Singh ist jedoch verantwortlich für dieses Kreuz. Abeid Karume<br />
ist es, der sich mit der Bitte um Hilfe beim Umbau der Hauptstadt an Architekten<br />
aus der Deutschen Demokratischen Republik wendet. Der leitende<br />
Architekt heißt Hubert Scholz. Das Architektenteam sieht den Bau von zweihundertneunundzwanzig<br />
Gebäuden mit insgesamt fast sechstausend Wohnungen<br />
für dreißigtausend Menschen vor. Das erfordert den Abriss von über<br />
fünftausend alten Häusern in Ng’ambo.<br />
Doch die Eltern Partei und Revolution sind nicht in der Lage, Scholz’ Projekt<br />
in Gänze zu verwirklichen. Das Land ist zu arm, und Ng’ambo wird nicht<br />
vollständig in eine sozialistische Stadt umgestaltet. Bi Kidude wohnt noch immer<br />
in ihrem kleinen Haus in der Nähe von Raha Leo, sitzt auf dem steinernen<br />
Treppchen davor und raucht Zigarette um Zigarette. Manchmal nimmt<br />
sie sich ein Stück Schokolade, manchmal einen Schluck aus der Flasche. Ihrer<br />
Stimme schadet das nicht; sie ist bei guter Gesundheit. In Berlin, wie sie die<br />
Wohnblocks nennt, hätte sie nicht lange überlebt, meint sie.<br />
Garth Andrew Myers, ein amerikanischer Professor mit dem Fachgebiet der<br />
afrikanischen Urbanistik, meint, die enormen Investitionen in Ng’ambo, die<br />
größten in der Geschichte der Stadt Sansibar, hätten das Problem der Überbevölkerung<br />
in der Stadt nicht gelöst. Sie hätten so gut wie gar nichts genützt.<br />
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes<br />
ZNAK, KRAKÓW 2011<br />
165 × 235, 400 PAGES<br />
ISBN: 978-83-240-1819-2<br />
TRANSLATION RIGHTS: ZNAK<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
30<br />
WOJCIECH JAGIELSKI<br />
WOJCIECH JAGIELSKI (GEB. 1960),<br />
JOURNALIST, REPORTAGENSCHREIBER.<br />
THEMEN SEINER BERICHTE SIND<br />
DIE WELTWEIT WICHTIGSTEN<br />
POLITISCHEN EREIGNISSE RUND UM<br />
DIE JAHRTAUSENDWENDE, WOBEI ER<br />
SICH AUF DIE LÄNDER AFRIKAS, DES<br />
MITTLEREN OSTEN UND DES KAUKASUS<br />
SPEZIALISIERT. JAGIELSKIS BÜCHER<br />
WURDEN BEREITS INS ENGLISCHE,<br />
SPANISCHE, NIEDERLÄNDISCHE,<br />
ITALIENISCHE UND DEUTSCHE<br />
ÜBERSETZT, UND ER SELBST WIRD<br />
HÄUFIG MIT RYSZARD KAPUŚCIŃSKI<br />
VERGLICHEN.<br />
Photo: Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute<br />
Brennendes Gras<br />
Wojciech Jagielskis aktuelles Buch handelt von einem Land, das es in dieser<br />
Form – glücklicherweise – nicht mehr gibt. Doch die Idee, die hinter der<br />
Organisation dieses Landes steckte, war so voller Gift, und das Leben seiner<br />
Einwohner so bis ins Detail strukturiert, dass die neuen Regelungen eine<br />
Sache sind, der Alltag aber eine ganz andere; eigentlich hat sich alles geändert,<br />
aber so, dass sich fast nichts änderte. Da wirkliche Veränderungen<br />
gewöhnlich viel länger brauchen, als es jedermann scheinen mag, lassen<br />
sie sich nicht verordnen, und ihr willkürlich festgelegter Beginn bezeichnet<br />
nicht den Zeitpunkt, an dem sie tatsächlich Wurzeln schlagen.<br />
Die Republik Südafrika, eine Kleinstadt in der Provinz Transvaal mit dem Namen<br />
Ventersdorp: Hier herrschte Eugène Terre’Blanche, Bure und Nachfahre<br />
holländischer calvinistischer Siedler, Populist und Poser, mit Sicherheit leidenschaftlicher<br />
Redner und Mythomane, vor allem aber eifriger Anhänger<br />
der Apartheid, die Liebesbeziehungen zwischen Schwarzen und Weißen,<br />
gemeinsame Schulen, Krankenhäuser, Strände, Sportplätze, Parkbänke<br />
und Bushaltestellen verbot, ganz zu schweigen von den Bussen selbst. Die<br />
Regeln für die Menschen sollen ebenfalls auf die Tiere übertragen worden<br />
sein – Friesenpferde wurden nicht mit Arabern gekreuzt, schreibt Jagielski<br />
in Brennendes Gras.<br />
Obwohl Terre’Blanche in der Kleinstadt offiziell keinerlei Funktion ausübte,<br />
galt er als ihr König. Darüber hinaus hatte er zahlreiche Anhänger in der<br />
ganzen Republik Südafrika. Sein Traum war eine unabhängige Burenrepublik,<br />
in der die rassistischen Regelungen für weitere Jahrhunderte beibehalten<br />
werden sollten. Er starb, zu Tode geprügelt von schwarzen Arbeitern seiner<br />
eigenen Plantage; der Grund war ein Streit um die Lohnauszahlung. Mit<br />
dem Tag des Mordes an diesem weißen Volksführer beginnt Jagielskis Buch.<br />
Es ist jedoch weder eine Kriminalgeschichte mit gesellschaftspolitischem<br />
Aufhänger noch eine Reportage von der Art, für die sein Autor berühmt ist:<br />
Jagielski setzte sich hier anspruchsvollere Ziele. Seine bis ins kleinste Detail<br />
gehende Analyse der Apartheid zeigt die finsteren Seiten der menschlichen<br />
Natur, die uns einerseits andere verachten und andererseits niemals<br />
den Wunsch nach Rache vergessen lassen. Eher als die klassische Reportage<br />
ist das Buch daher ein Studium eines durch ein vorsehungshaftes Verständnis<br />
der Glaubenswahrheiten gestützten ideologischen Wahnsinns. Für ein<br />
solches Studium eignet sich die Sprache der Reportage ganz ausgezeichnet.<br />
Paweł Smoleński<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
31<br />
Bereits<br />
den ganzen Nachmittag versuchte Martha<br />
Terre‘Blanche, ihren Mann am Telefon zu erreichen.<br />
Eugène führte schon immer sein eigenes Leben, zu dem sie keinen Zugang<br />
hatte. Er konnte für ganze Tage verschwinden oder sich in seine Gedankenwelt<br />
zurückziehen. Sie wohnten sogar getrennt: Er auf der Farm, sie in der<br />
Stadt. An Einsamkeit und Schweigen hatte sie sich gewöhnt. Die Unruhe, die<br />
die Abwesenheit ihres Mannes gerade an diesem Tag in ihr weckte, überraschte<br />
sie selbst. Sie wuchs mit jedem vergeblichen Anruf, schnürte ihr den Hals<br />
zu, lähmte.<br />
Durch das Fenster sah sie einige Schwarze beim Zaun warten. Sie erkannte<br />
Chris, den Eugène ein halbes Jahr zuvor zum Rinderhüten auf der Farm<br />
und für Gartenarbeiten beim Haus in der Stadt angestellt hatte. Er stand mit<br />
einem Jungen, den sie auch schon auf der Farm gesehen hatte, vor dem Tor.<br />
Später fuhr Eugène in einem weißen Lieferwagen vor. Er wies die Schwarzen<br />
an, sich auf die Ladefläche hinter dem Fahrerhäuschen zu setzen, und<br />
machte sich dann zurück auf den Weg zur Farm nach Ratzegaai, etwa fünfzehn<br />
Kilometer hinter der Stadt. Von da an ging er nicht mehr ans Telefon.<br />
Ernsthaft besorgt beschloss sie gegen Abend, die van Zyls anzurufen, deren<br />
Landbesitz der Farm der Terre‘Blanches gegenüberlag, nur durch einen Weg<br />
getrennt. Am Telefon meldete sich Dora, Eugènes Schwester, die er sehr liebte.<br />
„Nein, ich habe ihn heute noch nicht gesehen“, sagte sie. „Aber am Abend<br />
wollte er bei uns vorbeikommen.“<br />
An diesem Samstagabend vor dem Ostersonntag, dem Fest der Auferstehung<br />
und Erlösung, wollten sie den Geburtstag ihres ältesten Sohnes feiern.<br />
„Er ist sicher ausgeritten und hat das Telefon zu Hause gelassen“, sagte Dora.<br />
„Ich sage Dan, dass er nachsehen soll, was drüben los ist.“<br />
Auf der Veranda warf Dan van Zyl einen Blick auf die Uhr. Es war fast fünf.<br />
Die Schatten im Tal wurden länger und dichter. Dan van Zyl setzte sich, um<br />
dem Schauspiel zuzusehen.<br />
Normalerweise verbrachte er seine Abende nicht so, für solche Dinge hatte<br />
er keine Zeit. Aber an diesem Tag setzte er sich auf die Veranda seines Hauses<br />
und schaute zu, ganz so, als folge er einer inneren Eingebung.<br />
Von seinem Haus auf dem Hügel hatte er einen guten Blick auf den Feldweg<br />
im grünen Tal und die dichten Haine, die das Gelände der Farm am gegenüberliegenden<br />
Abhang bewuchsen. Sie gehörte seinem Schwager, Eugène<br />
Terre‘Blanche. In den letzten Jahren war Eugènes Hof stark verfallen. Van<br />
Zyl saß auf der Veranda und sann darüber nach, wie das mit der Erde so war.<br />
Wenn jemand nicht das Herz oder den Kopf für sie hatte, war auch sie ihm<br />
nicht geneigt und hörte auf, Früchte hervorzubringen.<br />
Eugène lebte für die große Politik. Seine Welt, das waren endlose Debatten<br />
darüber, wie schlecht die Dinge im Land vorangingen und wie schlimm es<br />
noch werden würde, wenn die Schwarzen am Ende die Macht übernähmen.<br />
Er trommelte seine Anhänger zu Beratungen und Demonstrationen zusammen,<br />
zerbrach sich den Kopf, wie eine Regierung der Schwarzen verhindert<br />
werden konnte. Und die Erde verkam.<br />
Eugènes Welt, das waren nächtliche Kundgebungen im Fackelschein. Er<br />
pflegte zu Pferd einzureiten, hielt festlich herausgeputzt in einer Paradeuniform<br />
und inmitten flatternder Fahnen flammende Reden und drohte mit<br />
Krieg. Konnten Menschen wie er sich mit der Erde befassen?<br />
Eugène schmeichelte es, dass die Zeitungen ihn einen Burenkommandanten,<br />
General, den letzten Verteidiger der weißen Rasse nannten. Obwohl er<br />
im heimischen Ventersdorp kein besonderes Amt ausübte, galt er als der wichtigste<br />
Bürger der Stadt, als unantastbar und keinen Rechten unterlegen außer<br />
denen, die er selbst festgesetzt hatte. Bei den Schwarzen rief er echte Furcht<br />
hervor, aber auch die Weißen wagten nicht, sich ihm zu widersetzen.<br />
„Was für eine Verschwendung“, seufzte Dan van Zyl mit einem Blick auf die<br />
Familienfarm der Terre‘Blanches, die Eugène vom Vater übernommen hatte.<br />
Das Unkraut breitete sich mit jedem Jahr mehr im hohen, ungemähten Gras<br />
aus, auf dem Terre‘Blanche das Vieh weiden ließ, und auf dem Weideland<br />
waren hier und da Gruppen junger Bäume und Büsche aufgeschossen.<br />
Abwesend und in Gedanken versunken betrachtete Dan van Zyl die wandernden<br />
Schatten im Tal. Er rührte sich nicht einmal, als im Wohnzimmer<br />
das Telefon klingelte. Das Klingeln hörte auf, setzte aber nach einer Weile<br />
noch lauter und drängender wieder ein.<br />
Er hörte die Stimme seiner Frau. Am Apparat war Terre‘Blanches Ehefrau<br />
Martha. Sie wohnte nicht auf der Farm, sondern im Städtchen. Auf dem weitab<br />
gelegenen Landgut fühlte sie sich nicht sicher. In den letzten Jahren war es<br />
auf den rund um die Kleinstadt gelegenen Farmen immer häufiger zu Überfällen<br />
und Morden gekommen, und viele Farmer hatten für ihre Familien<br />
Häuser in Ventersdorp gekauft. Auf ihre Farmen fuhren sie wie ins Büro und<br />
kehrten für die Nacht in die Stadt zurück.<br />
Die Sonne ging langsam unter, und Dan wollte schon ins Haus gehen, als<br />
sich von Terre‘Blanches Hof den Hügel herab ein schwarzes Pferd näherte. Es<br />
durchquerte die Wiese am Abhang, wobei es eine Spur in dem hohen gelblichen<br />
Gras hinterließ, und galoppierte bis zum Zaun am Feldweg, dann machte<br />
es kehrt und jagte im selben Tempo in Richtung des Hauses zurück.<br />
Van Zyl kannte dieses Pferd gut und wusste sofort, dass etwas Schlimmes<br />
geschehen war.<br />
Chris Mahlangu und Patrick stiegen durch das nicht ganz geschlossene<br />
Fenster ins Schlafzimmer ein. Drinnen herrschte Halbdunkel. Der Farmer<br />
lag auf dem Rücken auf einem ausladenden Bett, die Arme weit ausgebreitet,<br />
vollständig angekleidet, nur die Hose war aufgeknöpft. Er schlief.<br />
Eine Weile standen sie da und betrachteten den schlafenden Mann. Schon<br />
der erste Schlag, den Mahlangu ihm mit einer Metallstange versetzte, raubte<br />
Terre‘Blanche das Bewusstsein.<br />
Chris Mahlangu schlug weiter zu, wieder und wieder, legte in jeden Schlag<br />
all seine Kraft, seinen Hass, seine Wut und Angst. Die Schläge trafen den<br />
liegenden Farmer am Kopf, den Schultern, der Brust. Mahlangu hörte das<br />
Krachen berstender Knochen, roch Blut in der Luft.<br />
Als die Kräfte ihn verließen, reichte er die Eisenstange an Patrick weiter, der<br />
danebenstand und ihm unverwandt beim Morden zusah. Nun jedoch ergriff<br />
er wortlos die Stange und ließ sie drei Mal auf Kopf und Brust des Weißen<br />
niedersausen. Jeder der Schläge riß Terre‘Blanches Körper hoch, als gebe er<br />
ihm das Leben zurück.<br />
Im Schlafzimmer war es nun fast ganz dunkel und sehr stickig. Schwer atmend<br />
betrachteten sie den blutüberstömten Leichnam, der in nichts mehr an<br />
den furchteinflößenden weißen Farmer erinnerte. Sein Gesicht war bis zur<br />
Unkenntlichkeit entstellt, einer der Schläge hatte den Kiefer zertrümmert,<br />
Wange und Zunge zerfetzt. Das Blut schien überall zu sein, auf dem Bett,<br />
dem Kopfkissen und dem Körper des Opfers, an Wänden und Decke, den<br />
Kleidern und Händen der Mörder, auf ihren Gesichtern und in ihren Haaren.<br />
Chris Mahlangu zog ein Messer hinter seinem Gürtel hervor. Gerade beugte<br />
er sich über den geschundenen Körper des Toten, als Terre‘Blanches Handy<br />
und Autoschlüssel aus der Tasche seiner verrutschten Hose auf den Boden<br />
fielen. Das metallische Klirren tönte unangenehm laut in der Stille. Mahlangu<br />
zuckte zusammen. Er warf noch einen Blick auf den übel zugerichteten Leichnam,<br />
verstaute jedoch wortlos das Messer in seiner Hosentasche und bückte<br />
sich nach Handy und Schlüsseln. Das Handy läutete, kaum dass er es berührte.<br />
Er steckte es tief in seine Tasche und gab Patrick ein Zeichen.<br />
„Gehen wir.“<br />
Beim Hinausgehen warfen sie die Küchentür hinter sich zu.<br />
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes<br />
ZNAK, KRAKÓW 2012<br />
140 × 205, 256 PAGES<br />
ISBN: 978-83-240-2255-7<br />
TRANSLATION RIGHTS: ZNAK<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
32<br />
JACEK HUGO-BADER<br />
JACEK HUGO-BADER (GEB. 1957), POLNISCHER<br />
JOURNALIST UND REPORTER, ARBEITET SEIT 1990 FÜR<br />
DIE „GAZETA WYBORCZA”. SEIN ZUVOR ERSCHIENENES<br />
BUCH „WEISSES FIEBER“ ERHIELT SEHR POSITIVE<br />
REZENSIONEN IN AUSLÄNDISCHEN MEDIEN.<br />
Photo: Julia Pychałowa<br />
Kolyma-Tagebücher<br />
Das neueste Buch von Jacek Hugo-Bader, Journalist der Gazeta Wyborcza<br />
und Autor von „Weißes Fieber“ sowie „W rajskiej dolinie wśród zielska“ (Im<br />
paradiesischen Tal inmitten von Unkraut), ist eine Wegerzählung. Denn die<br />
„Kolyma-Tagebücher“ sind Reiseaufzeichnungen, die der Reporter während<br />
seiner Fahrt entlang der Kolyma-Trasse gemacht hat. Er hat 2025 Kilometer<br />
zurückgelegt - das sind über zwei Millionen Meter, wie er selbst ausrechnet.<br />
Millionen Meter von Erfahrungen, Begegnungen, Emotionen.<br />
Die Kolyma ist wegen des Klimas und ihres düsteren Erbes aus den Zeiten<br />
der Sowjetunion ein besonders attraktiver Ort. Hugo-Bader bezieht sich<br />
mehrmals auf den „Archipel Gulag“ von Solschenizyn und noch öfter auf<br />
die „Erzählungen aus Kolyma“ von Warlam Schalamow. Doch auch wenn in<br />
Hugo-Baders Buch das kommunistische Regime hier und da auftaucht, so<br />
sind seine wichtigsten Protagonisten die Menschen. Aber vielleicht sollte<br />
man eher schreiben: die Wesen dort, die fähig sind, in den schweren sozialen,<br />
kulturellen und klimatischen Bedingungen zu überleben.<br />
Da ist der Tschekist Dima, der „am lautesten spricht, am unflätigsten<br />
flucht, am häufigsten rülpst. Alles was er macht, macht er widerwärtiger,<br />
abscheulicher, ekelhafter als andere. Groß, dick, verkatert“. Die neunundsiebzigjährige<br />
Natascha, Tochter von Nikolai Iwanowitsch Jeschow, der die<br />
„eiserne Faust Stalins genannt wurde, Chef der sowjetischen Geheimpolizei<br />
war und Hunderttausende auf dem Gewissen hat... Ach wo - Millionen von<br />
menschlichen Existenzen“. Aleksandr Basanski, der goldene Oligarch, der<br />
unter anderem an „sechsundzwanzig Arten von Süßwasser für eine Million<br />
Dollar im Jahr“ verdient. Bobik, der Hund, „ein hohes Tier, außerdem ein<br />
Genie, aristokratisch, und obwohl ein Mischling, so doch wahrscheinlich<br />
entfeeeernt verwandt mit einem Laika“.<br />
Hugo-Baders Reise dauert ein paar Wochen, und die einzelnen Etappen der<br />
Trasse verleihen der Erzählung einen gleichmäßigen literarischen Rhythmus.<br />
Die kurzen Reportagen, die eigentlich Porträts sind, wechseln sich ab<br />
mit Tagebuchnotizen. Der Autor versteckt sich nicht hinter seinen Protagonisten,<br />
ganz im Gegenteil: man spürt seine Anwesenheit. Auf diese Weise<br />
markieren die „Kolyma-Tagbücher“ - als Erzählung über die journalistische<br />
Arbeit eines Menschen, der in Russland zu überleben versucht – eine neue<br />
Qualität der polnischen Schule zeitgenössischer Reportage, deren Meister<br />
auf der einen Seite Ryszard Kapuścinski und auf der anderen Mariusz Wilk<br />
sind.<br />
Marcin Wilk<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
33<br />
Die<br />
Hauptschlagader, der Hauptnerv der Kolyma war und ist der<br />
Kolyma-Trakt, also die Trasse. Ich werde – so wie viele ältere<br />
Bewohner der Kolyma – trakt und trasse groß schreiben.<br />
Denn es handelt sich um eine über zwei Tausend Kilometer lange Straße, die<br />
mit Menschenleben gepflastert ist. Sie liegt auf Knochen. Und das ist keine<br />
Metapher. Denn wieso gibt es entlang der ganzen Trasse nicht einen einzigen<br />
alten Friedhof?<br />
Deshalb, weil die Toten einige Zentimeter unter der Straßenoberfläche<br />
liegen. Tausende Menschen. Die Arbeit am Bau des Trakts war neben dem<br />
Goldabbau die schwerste in Kolyma. Wer dabei umgefallen war, dem wurden<br />
die Lager-Lumpen heruntergerissen (sie würden noch von Nutzen sein), er<br />
wurde mit dem Gesicht nach oben hingelegt und mit der Erde der Kolyma<br />
zugedeckt, mit der die Trasse aufgeschüttet ist.<br />
Worüber denken die Leute in den ersten Tagen der Reise am intensivsten<br />
nach? Wie kann man hier pissen? Ich steige aus dem Wagen und in meinem<br />
Schädel bohrt ständig der Gedanke, dass ich irgendeinem armen Teufel auf<br />
den Kopf pinkle.<br />
Vielleicht ist es einer von uns, ein neunzehnjähriger, kleiner Soldat, der nach<br />
dem Überfall auf Polen 1939 unter dem Befehl meines Großvaters stand, ein<br />
armer Junge aus meinem Warschau, der noch nie ein Mädchen hatte, und als<br />
er vor Hunger starb, flüsterte er... Eben, was hat er wohl gesagt? Und ich alter<br />
Zyniker schäme mich jetzt, dass ich so einen Schwachsinn, wie für eine Telenovela,<br />
schreibe. Doch wenn du am Ende der Welt, in einem schäbigen Hotel<br />
alleine da sitzt und dir zum Heulen ist, weil dich die MS überfällt, schreibst<br />
du, um Hände und Hirn zu beschäftigen, ein Tagebuch, und dann entstehen<br />
solche Stilblüten. (MS steht nicht für Multiple Sklerose sondern für Melancholie<br />
des Schreibenden).<br />
Der Bau der Trasse beginnt 1932, als Trust Dalstroj gegründet wird. Am<br />
Ende des Jahrzehnts zieht sich die Straße bis zur Siedlung Ust-Nera beim Kilometer<br />
1007. In den vierziger Jahren wird sie bis Chandyga verlängert, das am<br />
Angara-Fluss, Kilometer 1065, liegt. Das ist die westliche Grenze des Trusts.<br />
Der Bau am letzten Abschnitt bis Jakutsk, Kilometer 2025, wurde Anfang der<br />
fünfziger Jahre beendet, doch das ist ein so genannter zimowik – eine Straße,<br />
die man nur im Winter benutzen kann, wenn der Matsch gefriert. Erst seit<br />
den neunziger Jahren ist auch im Sommer der ganze Kolyma-Trakt passierbar.<br />
Ich folge ihm auf den Spuren von Warlam Tichonowitsch Schalamow, mit<br />
seinem dicken Sammelband Erzählungen aus Kolyma, der über tausend Seiten<br />
zählt. Das ist große, russische Literatur – das erschütterndste, ungewöhnlichste<br />
Bild einer Lagerzivilisation, die Schalamow in drei Gebote zu verdichten<br />
weiß: glaube nicht, hab keine Angst, bitte nie um etwas. Und noch eine ’Tugend’,<br />
ohne die du im Lager nicht überlebst: du musst stehlen können, angefangen<br />
mit dem Brot deiner Mitgefangenen. Im Lager kann der Mensch nur<br />
schlechter werden. Schalamow entdeckt, dass dort auch Gott stirbt, während<br />
für Aleksander Solschenizyn der Gulag den Charakter auf die Probe stellt –<br />
eine Situation, aus der der Gefangene als Sieger hervorgehen kann.<br />
Schalamow sitzt achtzehn Jahre in den Lagern, plus zwei als ‚Freier’, doch<br />
ohne das Recht, wegzufahren (davon verbringt er siebzehn Jahre in Kolyma).<br />
Er wird nach Stalins Tod 1953 entlassen. Bis zum Ende seines Lebens bleibt er<br />
dem Lager-Thema besessen treu.<br />
Er ist also mein erster, ständiger Paputschik. Paputschik, das ist eins meiner<br />
russischen Lieblingswörter. Es bedeutet Reisebegleiter, ein Mensch, der denselben<br />
Weg einschlägt (auf Russisch: po puti). Wörtlich und im übertragenen<br />
Sinne. Jemand, mit dem du dieselbe Route fährst, in demselben Zugabteil und<br />
mit dem du dich zum Beispiel in politischen Dingen gut verstehst. Ihr habt ein<br />
Ziel, das ihr verfolgt. Dieses Buch ist im Grunde über solche Menschen, doch<br />
nicht nur über diejenigen, mit denen ich gefahren bin, sondern auch über<br />
solche, die ich auf der Strecke getroffen habe.<br />
In diesem Teil werden viele Fahrer vorkommen. Die Lastwagenfahrer werden<br />
in Russland meistens Dalnobojeschtschiks genannt. Das sind Menschen<br />
des weiten Kampfes (auf Russisch: dalno – weit; boj – Kampf), der langen<br />
Trasse, bei uns heißen sie Fern- oder Brummifahrer. Manchmal werden sie<br />
auch Kamazisten genannt, auch wenn ihre Lastwagen keine Kamaz sind, oder<br />
Ugolschtschiks, wenn sie Kohle transportieren, weil ‚ugol’ Kohle bedeutet.<br />
Doch in der Kolyma wurde schon zu Zeiten des Gulags ein eigenes Wort für<br />
sie erdacht: Die einheimischen Fahrer heißen die Trassowiks (von Trasse).<br />
Die Kolyma-Trasse ist ein sehr gefährlicher Weg. Sie besteht aus aufgeschüttetem,<br />
gelblichem Kolymer Boden, in dem mehr Steine sind als Erde.<br />
Die Straße hat keinen festen Straßenbelag, also wird sie von jedem stärkeren<br />
Regenschauer unterspült, der Dauerfrostboden bricht und zerbröckelt sie. Im<br />
Winter macht der Schnee das Leben schwer, und wenn nicht viel von ihm da<br />
ist, wandelt er sich zum rutschigen, weißen Asphalt. Im Sommer setzt einem<br />
der furchtbare, gelbe Staub zu, der lange in der Luft wirbelt; dann gibt es Auffahrunfälle<br />
wie im Nebel. Am Weg sind viele ’Grabmale’: statt eines Kreuzes<br />
hängt an einem kleinen Pfahl ein zerbrochenes Lenkrad, statt eines Grabsteins<br />
– eine Komposition aus Reifen oder ein löchriger Kühler.<br />
An vielen Stellen am Rand stehen Zaunreste gegen Schneeverwehungen.<br />
Die Gulag-Gefangenen haben sie aus Lärchenzweigen geflochten. Der Trakt<br />
ist für die Fahrt gefährlich, doch das Leben auf ihm ist sicher. Das allgemeine<br />
Banditentum ist selten. Hier gab es sogar in den schrecklichen neunziger Jahren<br />
keinen, damals ganz Russland quälenden, Straßenraub, als Schutzgelder<br />
für die Durchfahrt erpresst wurden.<br />
Die schlimmste Zeit, was die Kriminalität angeht, macht Kolyma 1953<br />
durch, als sich nach Stalins Tod die Lager leeren und Tausende von Menschen<br />
in die Freiheit entlassen werden. Darunter sind viele Kriminelle, denen jedoch<br />
nicht erlaubt wird, auf den Kontinent zurückzukehren. Um sich in den Städten<br />
sicherer zu fühlen, laufen dort die Menschen in Gruppen herum. Männer<br />
bringen ihre Frauen zur Arbeit, weil viele der entlassenen Gauner seit Jahren<br />
keine Frau gesehen haben.<br />
In diesem Moment macht sich ein ehemaliger Politischer mit dem Nachnamen<br />
Riabokoń – ein Soldat der anarchistischen, revolutionär-aufständischen<br />
Ukrainischen Armee des Atamans Nestor Iwanowitsch Machno – entlang der<br />
Trasse auf den Weg. Schalamow widmet ihm eine Erzählung.<br />
Der Anarcho-Veteran bildet eine vierköpfige Bande, die mit leichter Hand<br />
über ein Jahr lang jeden, der ihren Weg kreuzt, ausraubt und mordet. Die<br />
Männer streiten sich jedoch bei der Aufteilung der Beute und verraten sich<br />
gegenseitig. Alle bekommen fünfundzwanzig Jahre Gulag.<br />
Diese Zeiten sind längst vorbei. Jede Begegnung mit einem Menschen auf<br />
der Trasse ist heute pures Vergnügen, und die Bars an der Kolyma-Straße<br />
liebe ich einfach. Es gibt vielleicht etwas mehr als zehn von ihnen zwischen<br />
Magadan und Jakutsk. Ich kann stundenlang drin sitzen und mir die einfachen,<br />
ehrlichen Gesichter, die Menschen aus der Taiga in Tarnanzügen, die<br />
Fernfahrer mit ölverschmierten Händen (Technikschmutz sei kein Schmutz<br />
– sagen sie) und die vom Rheuma gezeichneten Goldsucher anschauen. Ich<br />
fühle Erleichterung, dass ich nicht in die roten, überfressenen Gesichter der<br />
Oligarchen schauen muss, in die hervorstehenden Augen der versoffenen Offiziere.<br />
Endlich höre ich „danke“, „bitte“ und das Mütterchen, das in der Bar in<br />
Larjukowa, bei Kilometer 386, mit einem dreckigen Lappen über den Boden<br />
schmiert, sagt sogar „Entschuldigung“ zu mir. Das hört man von den Städtern<br />
aus Magadan nur selten.<br />
Aus dem Polnischen von Joanna Manc<br />
CZARNE, WOŁOWIEC 2011<br />
133 × 215, 320 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7536-292-3<br />
TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
34<br />
KATARZYNA SURMIAK-DOMAŃSKA<br />
KATARZYNA SURMIAK-DOMAŃSKA (GEB. 1967), POLNISCHE JOURNALISTIN. SIE PUBLIZIERT<br />
HAUPTSÄCHLICH REPORTAGEN UND INTERVIEWS ZU AKTUELLEN GESELLSCHAFTLICHEN THEMEN.<br />
Photo: Julia Domańska<br />
Sumpflein<br />
Die bekannte Reporterin der Gazeta Wyborcza, Katarzyna Surmiak-Domańska,<br />
hat – wie es scheint – ihr bestes Buch geschrieben. „Sumpflein“ ist ein<br />
realistisches, der Wirklichkeit entnommenes Porträt der tiefen polnischen<br />
Provinz. Doch es ähnelt nicht den stereotypen Bildern einer Marienfrömmigkeit,<br />
oder, zur Abwechslung, der anhaltenden Pathologie und Armut<br />
nach dem Ende des Kommunismus und dem Schock des Systemwechsels.<br />
Nichts dergleichen werden wir hier finden. Sumpflein ist aber auch kein typisches<br />
Dorf, schreibt die Autorin im Vorwort. Es ist eher die Vorstadtsiedlung<br />
einer mittelgroßen Stadt, eine Gegend, in der das patriarchale Muster<br />
der Familienbeziehungen in einer, seit Jahrhunderten unveränderten,<br />
Form fortzubestehen scheint, und wo die sichtlichen Anzeichen einer Idylle<br />
mit dem düstersten, unter der Oberfläche fließenden Strom des Gemeinschaftslebens<br />
verflochten sind. Sumpflein, das ist so etwas wie Dogville<br />
im Film des Regisseurs Lars von Trier; ein uralter Ort mit üppig blühenden<br />
Vorgärten, Schweigen, Lügen und Gewalt. Die Protagonisten der von Katarzyna<br />
Surmiak-Domańska festgehaltenen Welt sind eine Ansammlung von<br />
Archetypen wie Opfer, Henker, Richter und Kommentator: Mutter, Vater,<br />
Ehemann, Geliebter, Schwiegermutter, Freundin, Schwägerin. Ihre Stimmen<br />
bilden eine mehrdimensionale Studie der Gesellschaftspsychologie, die genauso<br />
flach und offensichtlich ist, wie undurchdringlich und rätselhaft.<br />
Die Autorin folgt der Protagonistin aus einem ihrer Interviews. Halszka<br />
Opfer (der Name wurde, ähnlich wie die Ortsnamen, geändert), eine reife,<br />
früher völlig unbekannte Frau, hat in Polen vor ein paar Jahren eine laute<br />
Diskussion ausgelöst. Sie publizierte ihre Bekenntnisse, in denen sie detailliert<br />
und drastisch über das Trauma berichtet, vom eigenen Vater sexuell<br />
missbraucht worden zu sein. Sie beschrieb, wie sie, ein vierjähriges Mädchen,<br />
von ihrer Mutter eigenhändig ins Bett des Vaters getragen wurde. Wie<br />
sie, während sie aufwuchs, zur ’bewussten’, auf die Geschenke erpichten,<br />
Geliebten des Vaters wurde. Wie die Mutter ihr ganzes Leben schwieg und<br />
sich einem düsteren, maskierten Schatten gleich durch das Haus bewegte.<br />
Dieses Buch – wie Surmiak-Domańska schreibt – wurde zu einem großen<br />
Erfolg in Sumpflein, dem Wohnort von ’unserer Halszka’. Ähnlich wie zuvor<br />
ein sehr ähnliches, doch aus dem Deutschen übersetztes Buch. In der Ortsbibliothek<br />
haben sich alle ‚normalen’, ’wir’, ’einfachen Leute’, auf die Liste<br />
setzen lassen, um das zu erfahren, was „einem nicht in den Kopf gehen will“.<br />
‚Unsere Halszka’, das ist klar, ist gar nicht ’unsere’. Sie ist fremd, merkwürdig,<br />
anders. Wie wir erfahren, war sie schon immer so. Das sagen die Ortsansässigen.<br />
Trotz der offensichtlichen Mechanismen ist für die Autorin eine<br />
Sichtweise, die lieber die Schuld dem Opfer gibt als den „Henker-Vater“ zu<br />
verurteilen, nicht ohne Belang. Im Gegenteil. Sie versucht, diese Sicht aufzuzeigen<br />
und zu vertiefen, sie anderen Erzählungen gegenüberzustellen. So<br />
gelingt es Katarzyna Surmiak-Domańska, etwas sehr Flüchtiges zu greifen:<br />
das Gefühl, dass die Wirkung des Bösen unumkehrbar ist und dass Schutzprojekte,<br />
Therapien und die Situation, wenn Opfer zu Wort kommen, sehr<br />
fragil sein können.<br />
Kazimiera Szczuka<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
35<br />
Sumpflein<br />
ist kein typisches Dorf. Hier gibt es<br />
keine Bauernhütten oder Scheunen,<br />
eher solide mehrstöckige Häuser mit<br />
Thujen vor den Eingängen und gepflegten Rasen auf der Rückseite. Niemand<br />
züchtet hier Kühe, die Männer fahren täglich mit ihren eigenen Autos in die<br />
nah gelegene Stadt zur Arbeit, die Frauen kümmern sich für gewöhnlich um<br />
den Haushalt. Obwohl die Böden hier feucht sind, an manchen Stellen geradezu<br />
sumpfig, wächst die Bevölkerung stetig, da die Gegend als die schlesische<br />
Enklave der Ruhe, der Natur und der sauberen Luft bekannt ist. Im Dorf gibt<br />
es einen Gasthof und ein Kulturhaus, und viele der zweitausend Einwohner<br />
nutzen regelmäßig die Ortsbibliothek, die selbst an Samstagen geöffnet hat.<br />
In der Geschichte der Bibliothek von Sumpflein gab es zwei Bücherhits; das<br />
erste Mal gegen Ende der 1990er Jahre. Damals handelte es sich um die deutsche<br />
Reportagen-Erzählung Monika B. Ich bin nicht mehr eure Tochter, die von<br />
der Journalistin Karin Jäckel in enger Zusammenarbeit mit der Titelheldin<br />
herausgegeben wurde. Monika B., eine über dreißigjährige Deutsche, enthüllte<br />
darin die Wahrheit über ihre Kindheit; über ihren Vater, der sie zehn Jahre<br />
lang regelmäßig vergewaltigte und den Söhnen zum Vergewaltigen überließ,<br />
sowie über die Mutter, die die Augen davor verschloss.<br />
’Für Monika’ trugen sich die Einwohner von Sumpflein auf einer Warteliste<br />
in der Bibliothek ein. Danach stellte so mancher fest, es sei das erschütterndste<br />
Buch gewesen, das er in seinem Leben gelesen habe. Die Bibliotheksleiterin<br />
erinnert sich an die allgemeine Solidarität, die der jungen Frau entgegengebracht<br />
wurde, an das Wettern gegen die Eltern: „Solche gehören mit dem Tod<br />
bestraft“, und an die Kommentare: „Wie war so etwas in der zweiten Hälfte<br />
des zwanzigsten Jahrhunderts möglich, in diesem – wie man meinen könnte<br />
– zivilisierten Deutschland?!“<br />
Zehn Jahre später kam der zweite Bücherhit heraus. Diesmal war es das polnische<br />
Buch Kato-tata. Nie-pamiętnik (Henker-Vater. Nicht-Erinnerungen),<br />
deren Autorin eine gewisse Halszka Opfer war.<br />
Auch bei diesem Buch handelte es sich um Tatsachenliteratur, und es erzählt<br />
eine ähnliche Geschichte wie die von Monika B. Die Autorin beschließt als<br />
reife Frau, sich ihre Vergangenheit genau anzuschauen. Sie beschreibt, wie sie<br />
über zwanzig Jahre die Geliebte des eigenen Vaters war. Laut Halszka hatte der<br />
Vater nicht nur sie zum Sex gezwungen, sondern auch ihre Geschwister und<br />
die Mutter körperlich und psychisch misshandelt. Er hatte zum Beispiel die<br />
Angewohnheit, seine Frau zu ’erziehen’, indem er sich in ihre Handtasche oder<br />
auf das nicht abgewaschene Geschirr entleerte. Sie hingegen brachte abends<br />
die gebadete und in ein Handtuch eingewickelte Halszka, die gerade ein paar<br />
Jahre alt war, zu ihm ins Bett und zog sich diskret in ein anderes Zimmer<br />
zurück.<br />
Auch ’Halszka’ haben fast alle in Sumpflein gelesen, und man musste sich<br />
wieder auf eine Warteliste setzen lassen. Und auch diese Bekenntnisse riefen<br />
große Emotionen hervor. Doch die Haltung gegenüber der Heldin war eine<br />
völlig andere als beim ersten Buch.<br />
Das, was die zwei Bücher vor allem unterscheidet, fasste die Bibliothekarin<br />
nach einiger Überlegung zusammen, ist die Tatsache, dass Monika B. in<br />
Deutschland wohnt und niemand hier sie persönlich kennt. Dagegen wissen<br />
alle im Dorf, dass sich hinter dem Pseudonym Halszka Opfer die eigene Nachbarin<br />
und langjährige Einwohnerin von Sumpflein verbirgt.<br />
Ich habe Halszka Opfer im Winter 2008 kennengelernt, als ich ein Interview<br />
zu ihrem Buch mit ihr führte. Schon damals machte mich, mehr als<br />
der degenerierte Vater, die Gestalt der Mutter neugierig: eine Frau, die unerschütterlich<br />
die Fakten verdrängte, Dinge rationalisierte, die – könnte man<br />
meinen – unmöglich zu rationalisieren sind, die jedoch dabei nicht für einen<br />
Moment aus ihrer Rolle als polnische Mutter, Christin und gute Hausfrau<br />
fiel. Für mich war es unvorstellbar, wie die zwei Frauen miteinander reden<br />
konnten, in einem Moment, als der Verfolger schon nicht mehr lebte, als es<br />
also niemanden mehr gab, vor dem sie sich hätten fürchten müssen und das<br />
Buch bereits erschienen war.<br />
Als ich zwei Jahre später nach Sumpflein zurückkehrte, nahm ich wieder<br />
Kontakt mit Halszka auf, und überredete sie, mich mit ihrer Mutter bekannt<br />
zu machen. Darauf fragte sie, ob ich mich einer delikaten Mission annehmen<br />
könnte, und diese Mission wurde zum Kern meiner Erzählung.<br />
Halszka Opfer bekam nach dem Erscheinen ihres Buchs viel Unterstützung<br />
und man bewunderte sie. Dank ihr haben viele Frauen den Mut gefunden,<br />
über den eigenen Missbrauch laut zu reden und sich damit von der Scham<br />
und dem Gefühl der Schuld zu befreien, die so erfolgreich die Täter schützen.<br />
Die Sache ist nur die, dass für all diese Personen Halszka als Person genauso<br />
weit weg ist wie Monika B. aus dem deutschen Buch für die Einwohner von<br />
Sumpflein.<br />
Ich wollte wissen, was Halszkas Buch in ihrem näheren Umfeld verändert<br />
hat. Ich wollte wissen, wie man im Alltag mit jemandem lebt, der sich selbst<br />
den Namen ‚Opfer’ gegeben hat. Deshalb habe ich außer der Mutter noch ein<br />
paar andere Personen aus Halszkas Umfeld besucht und sie gebeten, mir zu<br />
erzählen, wie sie die Autorin und ihr Buch sehen.<br />
Auf ihren Wunsch nenne ich keine Nachnamen und nicht die wirklichen<br />
Vornamen oder andere Details, die dazu führen könnten, dass man die Personen<br />
außerhalb ihrer Familie oder Nachbarschaft erkennen könnte. Ich behielt<br />
Halszkas Pseudonym bei, um vor allem ihre Mutter und ihre Geschwister zu<br />
schützen. Für andere Angehörige aus ihrer Familie, die in meinem Buch auftreten,<br />
habe ich die Namen übernommen, die Halszka in Kato-tata (Henker-<br />
Vater) und Monidło (Retusche), das 2011 herauskam, verwendet hatte. Für die<br />
übrigen Personen habe ich mir die Namen ausgedacht. Ich werde auch den<br />
wirklichen Namen von Sumpflein nicht preisgeben, sowie von Kormoranów,<br />
dem Heimatort von Halszka, wo ihre Mutter, Frau Karolina, immer noch<br />
wohnt – eine Frau, die von niemandem mit dem Namen Opfer oder mit irgendeinem<br />
Buch in Verbindung gebracht wird. Höchstwahrscheinlich.<br />
Aus dem Polnischen von Joanna Manc<br />
CZARNE, WOŁOWIEC 2012<br />
125 × 195, 144 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7536-364-7<br />
TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
36<br />
PAWEŁ SMOLEŃSKI<br />
PAWEŁ SMOLEŃSKI (GEB. 1959),<br />
REPORTER, PUBLIZIST, JOURNALIST.<br />
ARBEITET SEIT 1989 FÜR DIE „GAZETA<br />
WYBORCZA”, ZUVOR WAR ER FÜR DIVERSE<br />
UNTERGRUNDZEITSCHRIFTEN TÄTIG. SEIN<br />
BUCH „BEGRÄBNIS FÜR EINEN BANDITEN”<br />
WURDE 2003 MIT DEM PREIS FÜR<br />
POLNISCH-UKRAINISCHE VERSÖHNUNG<br />
AUSGEZEICHNET. DIES IST SEIN 10. BUCH.<br />
Photo: Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute<br />
Der Araber schießt, den Juden freut‘s<br />
Paweł Smoleński, Publizist und Reporter bei der „Gazeta Wyborcza“, setzt<br />
sich in seinen Texten seit Jahren mit israelischen Fragen auseinander. In<br />
seinem Buch mit dem provokanten Titel Der Araber schießt, den Juden freut‘s<br />
beschäftigt er sich größtenteils mit dem israelisch-arabischen Konflikt.<br />
Smoleńskis Erzählung beginnt auf sinnbildliche Weise, nämlich mit einem<br />
alten Fotoalbum. Es stammt von der armenischen Familie Kahvedjian aus<br />
dem christlichen Teil der Jerusalemer Altstadt, sodass die Bilder darin auf<br />
vielsagende Weise die Kreuzungspunkte der verschiedenen Kulturen festhalten.<br />
Doch nicht die Kultur an sich oder die sich aus dem kulturellen Leben<br />
ergebenden politischen Konsequenzen sollen Smoleński in Der Araber<br />
schießt, den Juden freut‘s interessieren. Die wichtigste Geschichte gestalten<br />
hier die Menschen selbst – jeder seine eigene, wahre Geschichte, die zusammen<br />
mit den anderen ein umfassendes, vielschichtiges Bild der Situation in<br />
Israel ergibt.<br />
Das Buch ist in Kapitel zu einzelnen Städten gegliedert. In jedem dieser Kapitel<br />
begegnet der Leser anderen Charakteren. In Akkon versuchen die Regisseure<br />
des städtischen Theaters – der sephardische Jude Moti, der Araber<br />
Chalid – das Wesen des Konflikts zu ergründen. Hauptperson in Be‘er Scheva<br />
wiederum ist Riad Abarii, Professor der Pharmakologie an der Ben-Gurion-<br />
Universität, an der bis vor Kurzem nur zwei Professoren von insgesamt 500<br />
arabischer Abstammung waren (mittlerweile sind es schon 20 arabische Professoren).<br />
Chalil aus Jaffa wiederum hält sich bedeckt, was sein Arabertum<br />
angeht – „ein Macho“ zwar, schreibt Smoleński, „aber nicht von arabischer<br />
Fasson“. Viel über den Konflikt weiß Wadi aus Haifa zu berichten: „Wir alle,<br />
Araber und Juden, haben dieselbe grässliche Eigenschaft. Jeder spricht nur<br />
über sich. Wir reden nur von unserem eigenen Leid.“<br />
In Smoleńskis Buch erhält jeder der Protagonisten seine „fünf Minuten“ –<br />
egal, welchen gesellschaftlichen Status er besitzt oder für welche Seite er<br />
sich einsetzt. Das Buch bildet ein Mosaik der verschiedensten Einstellungen,<br />
Gefühle, persönlichen Geschichten. Von der Qualität des Erzählten künden<br />
hingegen die einzelnen, so einfach wie möglich gehaltenen Sätze sowie die<br />
Distanz und der zeitweise sogar sarkastische Humor, die Smoleński stilistisch<br />
in die Nähe Etgar Kerets rücken.<br />
Marcin Wilk<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
37<br />
Fangen<br />
wir bei einem Foto an, das – denke ich – sinnbildlich<br />
für Israel ist. Die steinernen Wohnblocks<br />
sind die gleichen wie heute, und sogar die Pflanzen,<br />
die es geschafft haben, einen Platz in den Mauerritzen zu finden, sind die<br />
gleichen. Nur die Enge verwundert; die Häuser drängen sich geradezu gegen<br />
die Mauer, der Gehsteig ist schmal und überfüllt. Und die Mauer: eine Mauer<br />
eben, nichts weiter. Dennoch sehen wir ins Gebet versunkene Menschen direkt<br />
neben gleichgültigen Fußgängern, mit Waren beladene Esel, einen Händler<br />
und ekstatische Gesichter. Das ist die Klagemauer; heute erstreckt sich<br />
vor ihr herrschaftlich ein Platz. Der Anfang aller Dinge, für manche jedoch<br />
auch – das Ende von allem. Wäre diese uralte Mauer an anderer Stelle erbaut<br />
worden, gäbe es die heutigen Streitigkeiten nicht.<br />
Betrachten wir das Bild einiger weiser Männer. Sie sehen wie Wüstenscheiche<br />
aus: alt, bärtig und weißhaarig, in langen Gewändern, die auf dem Foto<br />
würdevoll wirken, in Wirklichkeit jedoch abgetragene Fetzen sein konnten.<br />
Sie beugen sich – so habe ich es in Erinnerung – über ein dickes Buch, fahren<br />
mit den Fingern die Zeilen nach, haben die Stirnen in Falten gelegt und tiefe<br />
Runzeln auf den Wangen. Es sind allerdings keine Scheiche, sondern sephardische<br />
Juden beim Studium der Thora.<br />
Nehmen wir nun die Mitleid erregenden Fotografien einiger Blinder; es sind<br />
die Jahre, in denen der damals unheilbare Grüne Star einen hohen Tribut<br />
forderte. Sitzen sie auf dem weißen Pflaster vor der Klagemauer, wissen wir,<br />
dass es Juden sind; sitzen sie auf dem weißen Pflaster des Innenhofes der Al-<br />
Aqsa-Moschee, müssen es Araber sein. Sie betasten die Steine, flüstern etwas,<br />
heben die vom Grünen Star getrübten Augen zur Sonne, vielleicht beten sie,<br />
vielleicht sprechen sie auch Verwünschungen aus. In ihrem Aussehen, und erst<br />
recht in ihrer Krankheit, unterscheiden sie sich in nichts voneinander; ihre<br />
Brüderschaft ist in ihrem Unglück mit eingeschlossen. Wären die Fotos nicht<br />
mit Ort und Datum versehen, könnte man meinen, es wären verschiedene<br />
Aufnahmen derselben Szene.<br />
Oder die Segelboote, die auf die Mündung des schmalen und flachen Flusses<br />
Yarkon zusteuern, der heute die Innenstadt von den reichen, nördlichen<br />
Vierteln Tel Avivs trennt. Rumpfform und Flaggstöcke sind wie bei den Booten,<br />
die sich auf den ältesten arabischen Abbildungen den Weg über das Meer<br />
bis nach Indien und zu den Molukken bahnen. Schwer zu erraten, was diese<br />
Segelboote geladen haben, aber von anderen Fotos wissen wir, dass der heutige<br />
Hafen von Jaffa, der vielleicht größte Hafen dieser Erde, die Anlegestelle für<br />
ein paar Dutzend Fischerboote war; Ufer und Mole sahen aus wie heute.<br />
Der Hafen von Tel Aviv dagegen muss sich – einem weiteren Bild zufolge<br />
– erst in jenen Hafen verwandeln, der den von Jaffa übertrumpfen wird, so<br />
wie auch Tel Aviv selbst Jaffa übertrumpfte. Heute kann man sich in dieser<br />
Stadt bis zum Morgengrauen in gut besuchten Bars und Clubs amüsieren.<br />
Man kann ein Vermögen in eleganten Boutiquen ausgeben. Den Hafen gibt<br />
es schon lange nicht mehr, auch wenn es vor nicht allzu langer Zeit ohne ihn<br />
Tel Aviv gar nicht gegeben hätte.<br />
Einige Bilder haben mich in ihren Bann gezogen: die Schuhputzer beim<br />
Jaffator in Jerusalem. Ein arabischer Mann, der Mokkakannen verkauft.<br />
Aber auch ein Beduinenmädchen hat es mir angetan. Auf dem Kopf trägt es<br />
einen Korb voller Kräuter, oder vielleicht auch frisch gewaschener Wäsche. Es<br />
ist sehr jung, hübsch und offensichtlich ohne Schamgefühl; das aufgeknöpfte<br />
Kleid gibt den Blick auf die nackten, kleinen Brüste frei. Wie kam es, dass Elia<br />
Kahvedijan in dieser Zeit und an diesem Ort ein solches Modell fand? Hat er<br />
den richtigen Moment abgepasst? Hat er sie überredet, für ihn zu posieren?<br />
Keine Ahnung.<br />
Unter diesen Bildern ist plötzlich eines, das wohl den Ausgangspunkt aller<br />
dieser Geschichten darstellt. Ein so trauriges Bild, dass es schmerzt. Es zeigt<br />
zwei alte Menschen, sicherlich Mann und Frau, oder auch ein Geschwisterpaar;<br />
sie müssen sich lieben, da sie sich so fest aufeinanderstützen. Sie haben<br />
runzlige Gesichter und tragen weiße Kopftücher. Ihre Kleider sind zerlumpt<br />
und schmutzig. Sie sind barfuß, was allerdings kaum verwundert, und – ob<br />
ihr es glaubt oder nicht – bis zu den Knien mit schwerem, lehmigem Schlamm<br />
beschmiert; zu all dem Unglück mussten sich auch noch ein Regenguss und<br />
(wir sehen es, spüren es fast körperlich) eine schneidende Kälte gesellen. Die<br />
Frau hält einen dicken Ast in der Hand. Der Mann stützt sich auf einen Stock.<br />
Sie blicken auf die Erde. Vor ihnen ist nur die vom Regen aufgeweichte, öde<br />
und traurige Landschaft.<br />
Wer ist dieses Paar? Der armenische Fotograf hat vergessen, zu fragen. Wohin<br />
gehen sie? Wir wissen es nicht. Das Foto ist wirkungsvoll genug, um uns<br />
die Antwort einzugeben: Sie gehen ins Ungewisse, einem schlimmen Schicksal,<br />
dem Verderben entgegen. Sie gehen dorthin, wo sie nicht hingehen wollen<br />
und sollten. Doch sie gehen, weil sie müssen. Unter dem Bild die Beschriftung:<br />
„An Nakba“, und das Datum: 1948. Soll es für die ganze Geschichte gelten.<br />
Für die Juden ist 1948 das Jahr des Unabhängigkeitskrieges: Einige verbündete<br />
arabische Länder überfielen damals das Land Israel, um das zu zunichte<br />
zu machen, was erst im Entstehen war, und die Juden im Mittelmeer zu ertränken.<br />
Für die in Palästina lebenden Araber (damals sagte noch niemand<br />
„Palästinenser“; dieses Volk, und nicht nur dieses, erschien erst später, und ich<br />
habe das Gefühl, dass an so etwas zu der Zeit noch niemand gedacht hätte)<br />
ist es „An-Nakba“ – die Katastrophe. Das Ende war eingetreten, die Endzeit<br />
erreicht. Ohne An-Nakba sähe alles anders aus.<br />
Jeder Krieg hat seine Symbole – sicher jede der kämpfenden Seiten ihre eigenen.<br />
Sie erklären, warum das geschah, was geschah. Für die palästinensischen<br />
Araber ist das Dorf Deir Yassin zweifellos so ein Symbol. Frühmorgens im April<br />
1948 wurde die Siedlung von der Irgun, einer rechtsextremen, paramilitärischen<br />
jüdischen Organisation, umstellt. Hundert Untergrundkämpfer (man<br />
sagt auch, nicht völlig zu Unrecht, Terroristen) töteten über hundert Araber,<br />
ohne Rücksicht auf Frauen, Säuglinge, alte Menschen; auf einen jüdischen<br />
Kämpfer kamen Eins-Komma-irgendwas arabische Tote. Alles zusammen<br />
dauerte nur wenige Stunden und hatte, scheint‘s, militärisch keine besondere<br />
Bedeutung. Es gab in diesem Krieg Ereignisse von größerem Gewicht, und<br />
auch dramatischere. Doch nach Deir Yassin ging ein Aufschrei durch Palästina:<br />
Flieht, Araber, sonst ergeht es euch ähnlich.<br />
So schrien manche Juden, aber auch die Politiker aus Amman, Damaskus,<br />
Kairo, Bagdad, Beirut, Riad. Wäre da nicht die Angst vor den Juden gewesen,<br />
aber auch das Zureden von arabischer Seite, hätten die 700.000 arabischen Bewohner<br />
Palästinas ihre Häuser nie verlassen. Was nicht heißt, dass das Morden<br />
in Deir Yassin irgendeine Rechtfertigung erfahren soll. In den israelischen Geschichtsbüchern<br />
wird es, wohlgemerkt, als ein Massaker beschrieben, das den<br />
Geburtstag Israels befleckt hat. Die arabischen Schulen in Israel begehen den<br />
Tag der Nakba. Das heißt – manchmal gibt es Politiker (in letzter Zeit leider<br />
immer öfter), die fordern, das zu verbieten, da es ihrer Meinung nach nicht sein<br />
dürfe, dass irgendein israelischer Bürger den Unabhängigkeitstag als den Tag<br />
einer Katastrophe in Erinnerung hat. Allerdings, und das wissen wir mit Sicherheit,<br />
reagiert das menschliche Gedächtnis nicht auf Gebote und Verbote.<br />
Nach dem Blutbad in Deir Yassin nannte David Ben-Gurion, der erste Premierminister<br />
des jüdischen Staates, den damaligen Leiter der Irgun und späteren<br />
Premierminister und Friedensnobelpreisträger Menachem Begin „Menachem<br />
Hitler“. Es hätte kaum stärkere Worte geben können; die Öfen der<br />
Krematorien waren noch warm. Die Araber griffen einen Sanitätskonvoi auf<br />
dem Weg nach Jerusalem an und ermordeten alle Verwundeten. In Kairo, Rabat<br />
und Tunis gab es antijüdische Pogrome. In der Jerusalemer Altstadt blieb<br />
nicht ein einziger Jude. Alle Synagogen der Altstadt wurden zerstört.<br />
Doch es sind die Juden, die letzten Endes diesen Krieg gewannen, auch<br />
wenn sie ihn nicht gewinnen sollten. Sieger richtet man nicht, heißt es. Was<br />
das betrifft, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kenne viele israelische Bürger –<br />
Juden und Araber –, die ähnlich denken. Und selbst Ben-Gurion hat einmal<br />
gesagt, dass man sein Glück nicht auf dem Unglück anderer aufbauen könne.<br />
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes<br />
ŚWIAT KSIĄŻKI, WARSZAWA 2012<br />
135 × 215, 272 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7799-006-3<br />
TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
38<br />
MARIUSZ WILK<br />
MARIUSZ WILK (GEB. 1955), PROSAIST,<br />
JOURNALIST, REISENDER, AKTIVIST DER<br />
DEMOKRATISCHEN OPPOSITION, DER ENDE<br />
DER ACHTZIGER JAHRE DIE POLITIK UND<br />
EUROPÄISCHE ZIVILISATION AUFGAB,<br />
UM SICH IM HOHEN NORDEN RUSSLANDS<br />
NIEDERZULASSEN.<br />
Photo: Piotr Wójcik<br />
Der Zug der Gänse<br />
Der neueste Teil des Nördlichen Tagebuchs von Mariusz Wilk mit dem Titel<br />
Der Zug der Gänse scheint den vorhergehenden Büchern der Serie zu ähneln,<br />
in denen der Autor seine Streifzüge durch den hohen Norden beschrieben<br />
hat. Noch immer scheint er in kurzen Tagebuchnotizen die Erlebnisse seiner<br />
realen und intellektuellen Streifzüge einfangen zu wollen, die ihn zu<br />
einer befreienden Leere führen, mit der er sich vom Trubel der Wirklichkeit<br />
abgrenzt, um in sich selbst vorzudringen und sich kontemplativen Betrachtungen<br />
der ihn umgebenden Welt hinzugeben. Noch immer scheint Wilk sich<br />
desselben, einzigartigen Stils zu bedienen, in dem er Phrasen und Worte<br />
aus dem Russischen mit dem Altpolnischen mischt – und doch ist Der Zug der<br />
Gänse im Werk des Autors von Voloki ein außergewöhnlicher Band.<br />
Wilk ist Vater geworden, seine Tochter Marta bewirkte, dass – wie er selbst<br />
anmerkt – „meine Welt durcheinandergeraten ist, das heißt, sie hat sich<br />
auf den Kopf gestellt. Obwohl manche meiner Bekannten behaupten, es<br />
sei umgekehrt – sie habe sich auf die Füße gestellt.“ Die Geburt des Kindes<br />
zwang den Autor und Vagabunden zu einer grundlegenden Revision seiner<br />
Lebensstrategien, zu neuen Zielsetzungen. Zwar begibt er sich weiterhin<br />
auf Wanderschaft und erstattet dem Leser Bericht von seinen Fahrten. In<br />
dem neuen Buch beschreibt er Petrosawodsk und Menschen, die mit der<br />
Stadt in Zusammenhang stehen (Wasserspiegel), einen Abstecher nach Labrador<br />
(Karibu-Hackfleisch) oder eine weitere Jahreszeit im alten Holzhaus<br />
am Onegasee (Hinter den Spiegeln), stellt weitere Lieblingsautoren vor (vor<br />
allem den Autor und Weltenbummler Kenneth White, den Schöpfer solcher<br />
Begriffe wie „intellektueller Nomade“ oder „Geopoetik“) und macht uns mit<br />
seinen geistigen Eingebungen bekannt. Jedoch hat er pausenlos das Bild<br />
des geliebten Töchterchens im Hinterkopf und den Gedanken, dass er von<br />
nun an der Spur, dem Pfad seines Lebens vor allem mit dem Ziel folgen wird,<br />
Marta darauf vorzubereiten, die Spur aufzunehmen, wenn er selbst nicht<br />
mehr weiter wird gehen können.<br />
Der Autor hat sich verändert, ebenso seine Prosa. Der Zug der Gänse ist vor<br />
allem eine berührende und tiefgründige Erzählung von den Freuden und<br />
Sorgen einer späten Vaterschaft.<br />
Robert Ostaszewski<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
39<br />
11. August<br />
Derweil werden die Nächte wieder dunkel und immer länger. Morgens steigt<br />
dichter Dampf (Peter zufolge ist es die Schlacke unter Pudosch) über dem<br />
aufgeheizten Zaoneschje auf. Am Himmel grollt es ein wenig und jeden Tag<br />
toben Gewitter mit unvorstellbarer Macht. Vielleicht hat die Erde es satt und<br />
versucht, uns abzuwerfen? Wie Rentiere, die hochgiftige Parasiten und Fliegen<br />
abschütteln.<br />
Der ängstliche Zustand der Natur ließ mich Die Straße von Cormac Mc-<br />
Carthy zur Hand nehmen, auch wenn ich keinen Geschmack an Katastrophenromanen<br />
finde. Die Straße handelt von einer postapokalyptischen Welt,<br />
durch die ein Vater mit seinem kleinen Sohn wandert. Man weiß nicht, was<br />
die Katastrophe ausgelöst hat, vielleicht ein Atomkrieg, vielleicht die Kollision<br />
unseres Planeten mit einem Asteroiden – aber das ist auch unwichtig … Die<br />
Welt liegt in Schutt und Asche, die Sonne scheint nicht, es gibt weder Vögel<br />
noch Pflanzen noch irgendwelche Nahrung, deshalb machen die wenigen<br />
Menschen, die überlebt haben, des Fleisches wegen Jagd aufeinander. Ich hätte<br />
Die Straße rasch beiseitegelegt, wenn ich nicht auf den Gedanken des Autors<br />
aufmerksam geworden wäre, dass, wenn du ein guter Vater bist, zwischen dir<br />
und deinem Tod einzig dein Kind steht. Etwas wurde mir klar.<br />
Seit unsere Marta auf die Welt gekommen ist, mache ich mir sehr oft Gedanken<br />
über den eigenen Weg. Die Geburt meiner Tochter hat mir das baldige<br />
Ende vor Augen geführt. Sie war ein eigenartiges Erwachen, der Stock des<br />
Zen-Meisters, der zuschlägt, um den Schüler aus der Lethargie einer wohligen<br />
Meditation zu reißen. Vielleicht mag sich jemand darüber entrüsten, dass ich<br />
vom baldigen Ende schreibe, obwohl ich gerade einmal fünfundfünfzig Jahre<br />
alt bin. Nun ja, aber vor ihr liegt der Weg eines ganzen Lebens, auf dem ich sie<br />
nur ein kurzes Stück begleiten kann, soweit die Beine mich tragen. Deshalb<br />
hat mich dieser Gedanke von McCathy so berührt.<br />
12. August<br />
Der Wind zerzaust die Pappeln vor dem Fenster, er wirft ein bewegliches Netz<br />
von Blättern auf die Wand – wie auf einen Bildschirm –, die Sonne flimmert<br />
und streut ihre Lichttupfen über den Boden. Der Schimmer auf der Holzdecke<br />
wiederholt das Spiel der Ohrenquallen im See, und selbst die Wiege, die<br />
an einem Deckenbalken aufgehängt ist, schaukelt im Rhythmus des Onega.<br />
Das ganze Haus ist in ein sanftes, zitterndes Netz aus Licht gehüllt.<br />
Marta ist ein Jahr alt. Obwohl sie, streng genommen, schon älter ist, denn<br />
für mich – genau wie für die Saami – beginnt das Leben des Menschen im<br />
Moment der Empfängnis und nicht beim Verlassen des Mutterleibes. Ich erinnere<br />
mich, wie wir sie beim Ultraschall betrachtet haben. Sie schwamm im<br />
Fruchtwasser wie im kosmischen Ozean aus Tarkowskis Solaris.<br />
Noch bis zu ihrer Geburt standen wir vor dem Dilemma, wo wir mit dem<br />
winzigen Kind leben sollten: in der Stadt oder hier, auf dem halb ausgestorbenen<br />
Dorf. Bekannte rieten uns zur Stadt, weil es sowohl einen Arzt in der<br />
Nähe als auch warmes Wasser aus der Wand gibt und hier bekanntlich die<br />
Wege im Winter nicht geräumt werden, und falls dann, Gott bewahre, etwas<br />
passiert, dann kommt kein Notarztwagen rechtzeitig. Genau, und außerdem<br />
– fragten sie –, wie kommt ihr denn ohne fließendes Wasser zurecht, in alten<br />
Zimmern, die man nie und nimmer bis zur durchschnittlichen Raumtemperatur<br />
aufheizen kann? Wo wascht ihr, wo badet ihr die Kleine?<br />
An Ärzte hatte ich nicht gedacht, denn wenn ich das Leben mit der kleinen<br />
Marta von einem Krankenhaus abhängig gemacht hätte, dann hätte ich<br />
mich sicherlich nie dafür entschieden, ihr so etwas anzutun. Und was den<br />
sogenannten Komfort betrifft, also fließendes Wasser und eine warme Toilette<br />
– das sind Bequemlichkeiten für die Eltern, folglich muss man sich nicht hinter<br />
dem Säugling verstecken. Dagegen hat das Leben in Konda unvergleichlich<br />
viel mehr Vorteile als in Petrosawodsk. Erstens Ruhe und Frieden, keine<br />
Autosirenen, die mit ihrem durchdringenden Geheul die Nacht in der Stadt<br />
zerreißen, keine Nachbarn hinter der Wand. Zweitens ist hier ringsum Natur,<br />
man muss weder Park noch Ufermauer suchen, um ein wenig frische Luft zu<br />
schnappen, es genügt, die Kleine im Kinderwagen vor das Fenster zu stellen,<br />
um sie im Auge zu haben, und das Rauschen des Sees und das Rascheln der<br />
Pappeln wiegen sie von selbst in den Schlaf. Drittens beginnt Marta ihr Leben<br />
hier umgeben von Schönem, schließlich ist die Umgebung das Erste, was<br />
den Verstand prägt (erst danach kommen Sprache, Schule …), zudem ist es<br />
von Beginn an von Bedeutung, was sie sieht, riecht, was sie berührt und in<br />
den Mund nimmt, ob das Holz, Lehm und Gras ist oder Duraluminium,<br />
Polyethylen und Beton. Hier wird ihr Bewusstsein geformt vom Raum eines<br />
großen Hauses, den bernsteinfarbenen Lichttupfen auf dem Fußboden, dem<br />
richtigen Feuer im Ofen, dem Rhythmus der Natur, dem Gesang der Vögel<br />
und den Gerüchen von draußen; dort würde sie pausenlos attackiert werden<br />
vom Gestammel der Reklame (das überall erschallt), von Neonlichtern und<br />
abwechselnd dem Geruch von Deodorants und Abgasen. Viertens wird hier<br />
der erste Geschmack geprägt von frischen Nahrungsmitteln – frisch aus dem<br />
Garten, See und Wald –, es ist also nicht verwunderlich, dass Marta das von<br />
ihrer Mutter gebackene Vollkornbrot und den Schnittlauch sehr gern hat, den<br />
sie selbst aus den Beeten reißt; in der Stadt würde sie bestimmt von irgendwelchen<br />
Bebivita-Gläschen kosten … Noch lange könnte ich so die Vorteile<br />
aufzählen, die das Leben mit dem Kind in Konda bietet, jedoch meine ich,<br />
dass ich den denkenden Leser überzeugt habe.<br />
Ich werde nicht so tun, als ob es einfach gewesen wäre. Vor allem der Winter<br />
hat uns zugesetzt, obwohl wir uns frühzeitig auf ihn vorbereitet hatten, indem<br />
wir die Böden erneuert haben, damit es nicht von unten zieht, und indem wir<br />
die Zimmer über uns abgedichtet haben, damit die Wärme nicht durch die<br />
Holzdecke entweicht. Wer hätte vorhersehen können, dass es wieder einen<br />
Jahrhundertwinter geben würde (der zweite in diesem Jahrhundert!), wir so<br />
einfrieren und eingeschneit werden, dass ich die meiste Zeit jeden Tages mit<br />
Schneeschippen verbringe?<br />
Trotz der Beschwerlichkeiten war es der zauberhafteste Winter in meinem<br />
Leben, denn alles war zum ersten Mal, obwohl es das zweite Mal war – der<br />
erste Schnee und die ersten Lichtlein am Weihnachtsbaum, der erste Heiligabend,<br />
das erste Silvester und das erste Neujahr. Auch wenn ich das selbst<br />
irgendwann schon einmal zum ersten Mal erlebt habe, ohne es zu verstehen, so<br />
konnte ich dank der Kontemplation von Marta dieses erste Mal wiederholen<br />
– mit ihr. Denn in Wirklichkeit habe ich mich, dank meiner Tochter, auf die<br />
weiteste Reise meines Lebens begeben – eine Expedition zum Ursprung begonnen.<br />
Dabei geht es nicht um eine Rückkehr zum eigenen Ursprung durch<br />
die Blutsgemeinschaft, das kommt später, wenn wir gemeinsam Märchen lesen<br />
werden, jetzt geht es ganz allgemein um die Anfänge des Menschen.<br />
Aus dem Polnischen von Benjamin Voelkel<br />
NOIR SUR BLANC, WARSZAWA 2012<br />
145 × 235, 210 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7392-372-0<br />
TRANSLATION RIGHTS: NOIR SUR BLANC<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
40<br />
OLGA TOKARCZUK<br />
OLGA TOKARCZUK (GEB. 1962)<br />
IST DIE BEKANNTESTE UND<br />
ANGESEHENSTE POLNISCHE<br />
SCHRIFTSTELLERIN. SIE WURDE MIT<br />
ZAHLREICHEN LITERATURPREISEN<br />
AUSGEZEICHNET UND IHR WERK<br />
IN 21 SPRACHEN ÜBERSETZT. AUF<br />
DEUTSCH ERSCHIENEN SIND ZULETZT<br />
SPIEL AUF VIELEN TROMMELN (2006),<br />
UNRAST (2008) UND DER GESANG DER<br />
FLEDERMÄUSE (2009).<br />
Photo: Wojciech Wojtkielewicz<br />
Der Moment des Bären<br />
Olga Tokarczuks neuestes Buch stellt eine besondere Art der Einheit dar,<br />
auch wenn es nicht als Einheit geschrieben wurde. Die Sammlung von Artikeln,<br />
Vorworten, Gelegenheitsauftritten, Gedankenspielen und manches<br />
Mal auch feuilletonistischen Scherzen wird unerwartet zu einem wichtigen<br />
Kompendium der Philosophie der Schriftstellerin. Und auch zu einem Manifest<br />
der politischen Ideen. Tokarczuk hat das politische Potenzial ihres<br />
Schreibens nie bestritten, es nie der eigenen künstlerischen Freiheit oder<br />
Vervollkommnung der literarischen Form entgegengestellt. Ganz im Gegenteil<br />
betrachtet sie gerade die Fähigkeit zur Reaktion auf Gewalt, Ausbeutung,<br />
propagandistische Lügen in der Welt der Herrschenden als eine ihrer<br />
schriftstellerischen Pflichten. Unter einer einzigen Bedingung allerdings:<br />
Dass sie selbst in ihrer eigenen Sprache und nach ihren eigenen Vorstellungen<br />
die Ideen formuliert und ausspricht, die heute Gesellschaft und Generationen<br />
zusammenhalten. Das Politische und das Literarische trennt die<br />
Autorin von Der Moment des Bären nie voneinander.<br />
Tokarczuk bedient sich häufig der Form des ausgebauten Aphorismus, schafft<br />
manches Mal eigentümliche, sich zu Zyklen zusammenfügende Gleichnisse<br />
und dann wieder scherzhafte Reiseführerartikel – wie den „Kleinen Polenführer<br />
für Deutsche zum Anlass des EU-Beitritts“. Den Vorrang gab sie<br />
hier jedoch den „Heterotopien“. Der hinterlistig im Untertitel ein „Gesellschaftsspiel“<br />
genannte Text „Wie erfindet man eine Heterotopie?“ ist ein<br />
gut verständlicher – und literarisch hervorragend verarbeiteter! – Vortrag<br />
über Olga Tokarczuks politische Philosophie. Diese ist, führt man sie auf ihre<br />
Grundlagen zurück, keine großartige Entdeckung. Eine Entdeckung ist die<br />
Sprache, welche die Schriftstellerin den Ideen gibt. „Eine andere Welt ist<br />
möglich. Man muss sie sich nur zuerst denken und dann aufschreiben“ – so<br />
lautet, in aller Kürze, das Credo, dem Tokarczuk ihr ganzes Werk verschreibt.<br />
Ihre Heterotopien sind Welten, die beispielsweise die Heteronorm mit ihrer<br />
Anprangerung sexueller Minderheiten in Frage stellen; es ist in ihnen auch<br />
großer Raum für einen heftigen Protest gegen die Misshandlung und den<br />
Verzehr von Tieren.<br />
Manches Mal ist Tokarczuk in Der Moment des Bären todernst, nur um dem Leser<br />
kurz darauf den goldenen Sand des Scherzhaften, Erdachten, Amüsanten<br />
in die Augen zu streuen. Radikale Gegnerin jeglicher nationaler Ideologien,<br />
vermag sie ihrem eigenen Polentum auf exzellente Weise Stimme zu verleihen.<br />
Und schließlich: der „Moment des Bären“ aus dem Titel, ein Gleichnis<br />
darüber, dass die Verzauberung der Welt nur unter der Bedingung gelingt,<br />
dass vom monotheistischen Verständnis des Wahrheitsbegriffs abgewichen<br />
wird. Ein entschiedenes „Ja!“ zur Literatur, diesem „seltsamen und von<br />
Kraft erfüllten Ort zwischen vielen individuellen Wahrheiten“.<br />
Kazimiera Szczuka<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Kleiner subjektiver Polenführer<br />
für Deutsche zum Anlass des EU-Beitritts<br />
41<br />
Lage<br />
Ungünstig. Großes Flachlandgebiet zwischen Osten und Westen, zwei raubgierigen<br />
Großmächten, zwei zivilisatorischen Urgewalten, erinnert an eine<br />
Ping-Pong-Platte. Von Napoleon bis zum Zweiten Weltkrieg Bühne aller großen<br />
Schlachten. Das Gute an einer solchen Lage: Überallhin ist es nah.<br />
Grenzen<br />
Recht flexibel. In einigen geschichtlichen Epochen weit, manchmal gar von<br />
der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. In anderen ganz verschwunden. Zuletzt<br />
in Jalta von drei Großmächten – USA, Großbritannien, Sowjetunion – nach<br />
eigenem Ermessen festgelegt, wodurch Polen Lwów und Wilno verlor und<br />
Wrocław und Szczecin gewann. Ob das gut oder schlecht ist, wird noch immer<br />
diskutiert.<br />
Sprache<br />
Slawisch, angeblich sehr schwierig wegen der vielen Zischlaute (wer das nicht<br />
glaubt, der lese laut „Chrząszcz brzmi w trzcinie“). Etablierte sich nach der<br />
Abschaffung des Lateinischen im multikulturellen polnischen Staat als gemeinsame<br />
Sprache und war, als es den polnischen Staat nicht gab, einziger<br />
Träger der gemeinsamen Identität. Wird deswegen von den Polen hoch geschätzt,<br />
die sogar den Ausdruck „ojczyzna-polszczyzna“ schufen, der so viel<br />
bedeutet wie: „Unsere Heimat ist die polnische Sprache“. Heute sprechen auf<br />
der Welt über 50 Millionen Menschen Polnisch.<br />
Bevölkerung<br />
Fast 40 Millionen im In- und um die 10 Millionen im Ausland (siehe „Emigration”).<br />
Das Ergebnis einer jahrhundertelangen ethnischen Durchmischung<br />
(Ukrainer, Juden, Weißrussen, Litauer, Deutsche, Schlesier und sogar Tataren).<br />
Dass jeder Pole einen Schnauzbart trägt, ist nicht wahr.<br />
Frauen<br />
Hier gibt es das noch nicht ganz aufgeklärte soziologische Phänomen, dass<br />
ein verhältnismäßig hoher Prozentsatz von Polinnen auswandert und im Ausland<br />
heiratet, wodurch inoffizielle diplomatische Minivertretungen entstehen.<br />
Dank diesen trifft man, wenn man als Pole durch die Welt reist, überall auf<br />
die Seinen. Möglicherweise befassen sich mit diesem Phänomen aber schon<br />
die Geheimdienste der anderen Länder.<br />
Religion<br />
Der polnische Katholizismus. Eine besondere Art des Katholizismus: Es kennzeichnen<br />
ihn eine starke Verbundenheit mit der nationalen Identität und dem<br />
Gefühl einer Mission (siehe „Große Mythen“) und ein besonders ausgeprägter<br />
Marienkult. Der Kirche zufolge ist die Muttergottes die unstürzbare und<br />
einzige Königin Polens. Von diesem Gesichtspunkt her kann die polnische<br />
Staatsform zu den Monarchien gezählt werden. Die Zugehörigkeit zur katholischen<br />
Kirche erklären in Polen 95,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung<br />
(in Spanien sind es 94,1 und in Italien 97,1 Prozent; die statistischen Jahrbücher<br />
geben nicht an, welcher Prozentsatz seinen religiösen Glauben auch<br />
praktiziert). Dieser Zustand besteht seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges,<br />
als Polen infolge dieses Krieges und der geopolitischen Verschiebungen (siehe<br />
„Grenzen“) aufhörte, ein multikultureller und multiethnischer Staat zu sein.<br />
Kunst und Kultur<br />
Der höchste Pro-Kopf-Poetisierungsfaktor. In Polen schreiben ungefähr hunderttausend<br />
Menschen Gedichte, darunter zwei Nobelpreisträger, die noch<br />
dazu in ein und derselben Stadt lebten – Krakau.<br />
Wissenschaft<br />
Polen ist eine der bedeutenderen Eliteschmieden der Wissenschaft. Die überwiegende<br />
Mehrheit der in Polen ausgebildeten Wissenschaftler arbeitet jedoch<br />
außerhalb Polens und trägt so zum Wohle der Menschheit bei (siehe „Emigration“).<br />
Achtung: In Polen hat niemand Zweifel daran, dass Kopernikus Pole war.<br />
Stabilisierter Krisenzustand<br />
Der natürliche gesellschaftspolitische Zustand, an den die Polen seit Generationen<br />
gewöhnt sind und mit dem sie wunderbar zurechtkommen. Es steht zu<br />
befürchten, dass jedwede Normalisierung der Verhältnisse zu gesellschaftlichen<br />
Unruhen führt.<br />
Nationaler Charakter<br />
Die Polen machen auf den ersten Blick einen recht mürrischen Eindruck, wirken<br />
manchmal gar arrogant. Individualisten kommen vor, Exzentriker eher<br />
nicht. Häufig verhalten sie sich um des lieben Friedens willen konformistisch,<br />
auch wenn paradoxerweise jede Art der Herrschaft ihr Misstrauen weckt und<br />
sie somit geborene Anarchisten sind. Achtung: Polenwitze mögen sie nicht.<br />
Ihre Laune pendelt zwischen Bewunderung für sich selbst und einem melancholischen<br />
Minderwertigkeitsgefühl.<br />
Große Mythen<br />
Erstens: Polen ist das Antemurale Christianitatis, das Bollwerk der Christenheit.<br />
Damit verbindet sich die Pflicht zur Verteidigung der westlichen Zivilisation<br />
gegen die Barbaren (hier findet sich eine entfernte Ähnlichkeit zum Selbstbild<br />
der Ungarn und Spanier). Zweitens: Vor zweihundert Jahren bildete sich aus<br />
einem sehr engen Zusammenleben mit der jüdischen Kultur bei den Polen der<br />
Begriff des nationalen Messianismus heraus. Das ist die Überzeugung von der<br />
eigenen Außergewöhnlichkeit und der Mission, den Rest der Welt zu erlösen,<br />
wobei die Leiden der Nation Teil dieser Mission sind. Die Polen sind bekannt<br />
dafür, überall auf der Welt sofort zur Hilfe zu eilen, wo Freiheit und Unabhängigkeit<br />
in Gefahr sind. Die Realisierung dieser Mythen ist sehr kostspielig und<br />
wird von den Verteidigten und Geretteten normalerweise nicht verstanden.<br />
Küche<br />
Wenig spektakulär, der deutschen recht ähnlich. Als typisch polnische Gerichte<br />
gelten ukrainischer Borschtsch, russische Piroggen und Karpfen nach jüdischer<br />
Art. Empfehlenswert sind hingegen die Pilzgerichte und der polnische<br />
Bergkäse. Polen gehört zu den unglückseligen Orten Europas, an denen keine<br />
Weinreben wachsen und die Bewohner somit lernten, Wodka zu produzieren.<br />
In letzter Zeit nimmt jedoch im Zusammenhang mit der Erderwärmung der<br />
Genuss importierter Weine zu. Es ist nicht wahr, dass der Pole in Europa den<br />
meisten Alkohol zu sich nimmt. Statistiken zeigen, dass der Alkoholgenuss<br />
sich nur leicht über dem Durchschnitt ansiedelt.<br />
Städte<br />
Warszawa – das Hongkong Mitteleuropas. Hauptstadt des Landes und Sitz<br />
der Politiker. Eine eilige Stadt mit einer Besessenheit für Neues, Erfolg und<br />
Geld. Polenweit die stärkste Invasion von Anglizismen. Bewohner der Provinzen<br />
verstehen hier nicht viel. Eine schöne neue Altstadt.<br />
Kraków – hält seit Jahren traditionell an der Einteilung der Bevölkerung<br />
fest: die Hälfte sind Künstler, die Hälfte Philister. Dank dieser dialektischen<br />
Spannung blühen hier Kunst und Kultur.<br />
Wrocław – eine deutsche Stadt, vollkommen zerstört von den Deutschen,<br />
wiederaufgebaut und bewohnt von den Polen, hauptsächlich aus Lwów und<br />
Umgebung.<br />
Land<br />
In westlichen Dokumentarfilmen über die polnische Landwirtschaft werden<br />
mit großer Vorliebe und in langen Sequenzen Pferdewagen gezeigt. Es besteht<br />
der Verdacht, dass irgendein Logistikunternehmen ihren Verleih organisiert.<br />
Verdienste für die Welt<br />
Erstens: die fachmännische und diskrete Demontage des Kommunismus.<br />
Zweitens: die Einführung des Kaffeetrinkens in Europa und Eröffnung der<br />
ersten Kaffeehäuser in Wien. Drittens: die Erfindung des Baseballs für die<br />
Amerikaner (was diese bis heute viel Aufmerksamkeit kostet); laut Norman<br />
Davies soll er vom Schlagballspiel der polnischen Emigranten abgeleitet sein.<br />
Viertens: die polnische Wurst.<br />
Was Polen in die EU einbringen kann<br />
Die Fähigkeit, in schwierigen Situationen zurechtzukommen (siehe „Stabilisierter<br />
Krisenzustand“).<br />
Das Talent, Löcher im Steuerrecht ausfindig zu machen. Den Bialowiezer<br />
Urwald. Etwas Chaos.<br />
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes<br />
WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ, WARSZAWA 2012<br />
125 × 195, 192 PAGES<br />
ISBN: 978-83-62467-36-5<br />
TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
42<br />
FILIP SPRINGER<br />
FILIP SPRINGER (GEB. 1982),<br />
JOURNALISTISCHER AUTODIDAKT,<br />
ARBEITET SEIT 2006 ALS<br />
REPORTER UND FOTOGRAF.<br />
VERGANGENES JAHR DEBÜTIERTE<br />
ER MIT DEM REPORTAGEBUCH<br />
MIEDZIANKA. HISTORIA ZNIKANIA<br />
[MIEDZIANKA. EINE GESCHICHTE<br />
DES VERSCHWINDENS].<br />
Photo: private<br />
Von schlechter Geburt<br />
Bücher und Ausstellungen wie David Crowleys Cold war modern haben gezeigt,<br />
dass die Architektur und die Ideologie der späten Moderne eine wichtige<br />
Front im ideologischen Krieg zwischen den beiden Seiten des eisernen<br />
Vorhangs waren. In den ehemaligen Ostblockländern fand sich diese Architektur<br />
auf der Müllhalde der Geschichte wieder. Besonders die kritiklos kapitalismusfaszinierten<br />
Polen zerstören bis heute mit der Leidenschaft von<br />
Neophyten alles an die Vergangenheit Erinnernde. Auf den Trümmern des<br />
Warschauer Supermarktes Supersam oder des brutalistischen Kattowitzer<br />
Bahnhofes erschien jedoch eine junge Generation von Aktivisten, Kunsthistorikern,<br />
Künstlern und Schriftstellern. Weitere Ausstellungen, Publikationen<br />
und Bücher verteidigen oder beschreiben ganz einfach die Kunst<br />
zur Zeit des Kommunismus, inklusive der sozialistischen Moderne, die sich<br />
als von „schlechter Geburt“ erwies, was der Titel von Filip Springers Buch<br />
ausgezeichnet wiedergibt. Der Journalist und Fotograf betrachtet die Denkmäler<br />
der vorherigen Epoche mit dem unschuldigen Blick des gerade einmal<br />
sieben Jahre vor den ersten freien Wahlen Geborenen und stellt fest, das sei<br />
doch „gute Architektur“!<br />
Von schlechter Geburt ist sowohl ein mit wertvollen archivalischen und Springers<br />
gegenwärtigen Aufnahmen gefülltes Fotoalbum als auch eine Sammlung<br />
von Reportagen über bauliche Stiefkinder. Beide Narrationen ergänzen<br />
einander hervorragend. Wichtiger als die gebrandmarkten Bauprojekte<br />
erweisen sich nämlich die Architektenschicksale, die die Wirklichkeit der<br />
Volksrepublik Polen in den vielfältigsten Schattierungen zeigen. Der Autor<br />
deckt die Schicksale der Kriegsgeneration auf, die nach dem Sieg des<br />
Kommunismus an Weichsel und Oder nach einer lokalen Version der Moderne<br />
suchte. Besonders spannend sind deren Spiele mit den Machthabern. In den<br />
Zeiten des Stalinismus, als die Behörden mit bitterem Ernst auf dem historisierenden<br />
Stil des Sozrealismus bestehen, errichtet der Kunsthistoriker und<br />
Architekt Marek Leykam für die Regierung eine eklektische Kopie der italienischen<br />
Renaissancedenkmäler. In Kattowitz bekommen die Architekten<br />
Buszko und Franta den besonderen Segen des lokalen Parteibonzen erteilt.<br />
Der Warschauer Architekt und Städteplaner Jerzy Hryniewiecki spottet öffentlich<br />
über die Regierung und ihre Machthaber und erhält trotzdem die<br />
Aufsicht über die wichtigsten und ehrgeizigsten Projekte, indem er sie dank<br />
seiner Beziehungen aus der Zeit in einem deutschen Gefangenenlager durch<br />
die entsprechenden Kabinette schleust.<br />
Der Reportagenschreiber Filip Springer baut daher im Grunde auf die Menschen<br />
und nicht auf die Architektur. Doch zwischen den Zeilen seines Buches<br />
scheinen auch die Schicksale der Gebäude nach dem Jahr 1989 durch,<br />
der Umbau und die Eingrenzung von Wohnsiedlungen, die Zerstörung ihrer<br />
Struktur durch neue Investitionen. Immer noch offen bleibt hingegen die<br />
Frage: Lässt es sich in diesen künstlerisch genialen, modernen Symbolen für<br />
den Stil eines offiziellen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ überhaupt<br />
wohnen?<br />
Max Cegielski<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Lord Vader gegen<br />
die Quelle der Wahrheit<br />
43<br />
In tiefstem Granitschwarz schimmernd tauchte er recht unvermittelt an der<br />
Bracka-Straße auf und füllte die Lücke in der südlichen Frontfassade an den<br />
Jerozolimskie-Alleen. Es war das Jahr 2011, eben waren die Baugerüste verschwunden,<br />
und so blieben die Vorbeigehenden stehen und legten den Kopf<br />
in den Nacken, um ihn sich anzusehen. Gewöhnlich schauten sie schweigend<br />
und gingen nach einer Weile in ihre Richtung weiter. Er zog jedoch magisch<br />
an, sie drehten sich noch einmal um und schenkten ihm einen letzten Blick.<br />
Vielleicht dachten sie sogar noch an ihn, wenn sie in den Bus stiegen oder um<br />
die Ecke bogen.<br />
Andere Bezeichnungen für Lord Vader: Sarkophag, Totenschuh, Monolith.<br />
Mit einem Wort: Die dunkle Seite der Macht.<br />
Es ist eines der letzten Bauprojekte Stefan Kuryłowiczs. Das pechschwarze<br />
Einkaufs- und Bürozentrum ließ die bekannte Krakauer Familie Likus hier<br />
erbauen. Mit seinen abgerundeten Ecken korrespondiert das von Kuryłowicz<br />
entworfene Gebäude mit dem gegenüberliegenden Zentralen Warenhaus,<br />
heute allgemein „Smyk“ („Knirps“) genannt. Der helle, modernistische Sandsteinblock<br />
des Smyk und Kuryłowiczs schwarzer Monolith begannen einen<br />
Dialog, eine architektonische Konversation. Das ist gut. Vielleicht blieben die<br />
Vorbeigehenden – wenn auch völlig unbewusst – gerade deshalb hier stehen,<br />
um sich diese Schwärze anzusehen.<br />
Darth Vader zog jedoch nicht nur magisch an. Der schwarze undurchdringliche<br />
Block hatte noch eine weitere Eigenschaft. Er konnte vernichten. Das,<br />
was er absorbierte, war seine Antithese, sein völliges Gegenteil. Es war eine<br />
Wolke aus Licht und Luft, ein Glänzen. Ein Kritiker schrieb gar darüber:<br />
„Wer das nicht gesehen hat, wird die Quelle der Wahrheit nie begreifen.“<br />
Diese Quelle nannte sich „Chemiepavillon”. Entworfen haben ihn Jan<br />
Bogusławski und Bohdan Gniewiewski, und in Trümmern lag er am elften<br />
April 2008.<br />
Die Kritiker konnten sich kaum fassen vor Begeisterung über das, was im<br />
Jahr 1960 an der Ecke Bracka- und Nowogrodzka-Straße im Entstehen begriffen<br />
war. Bereits der Ort war nicht zufällig gewählt – die Bracka war die<br />
natürliche Fußwegsverbindung zwischen dem Trzech Krzyży-Platz und dem<br />
Zentralen Warenhaus an den Jerozolimskie-Alleen und, etwas weiter, der<br />
Chmielna-Straße. Gerade aus städtebaulichen Gründen wurde hier ein Spalt<br />
in der Bebauung und ein kleiner Platz gelassen. Den Pavillon selbst beherrschten<br />
asymmetrische Formen und viel Licht. Er war fast vollständig verglast,<br />
stützte sich auf kunstvolle, V-förmige Pfeiler und einen von außen unsichtbaren<br />
Betonsockel. So erweckte er den Eindruck, ganz aus Glas zu sein und sich<br />
nur dank unsichtbarer Kräfte zu halten. Oder eben dank des Lichtes, das an<br />
den Abenden sein ganzes Inneres ausfüllte. Es war geradezu ein Übermaß an<br />
Licht, und so drang es durch die unsichtbaren Wände und überflutete die ganze<br />
Umgebung. Von der Straße sah der Chemiepavillon wie eine Lichtwolke<br />
aus, eine übernatürliche Kumulation von Energie. Er sah wie etwas Gutes aus.<br />
(Darth Vader sieht wie etwas Schlechtes aus, auch wenn er in Wirklichkeit<br />
nichts Schlechtes ist.)<br />
Ganze Jahre hindurch zog der Chemiepavillon auch wegen seines Warenangebots<br />
an, von dem wir heute sagen würden, dass es nicht besonders erlesen<br />
war und in jedem größeren Supermarkt eher einen unteren Rang einnähme.<br />
In den schlichten Zeiten ihrer Geburt lieferte die Quelle der Wahrheit aus<br />
Kunststoff gemachte Schüsseln und Schälchen, Eimer, Bürsten und Deckchen.<br />
Sie waren die in exakten Reihen angeordneten Beweise dafür, dass die<br />
heimatliche chemische Industrie nicht nur Düngemittel mit den wundersamen<br />
Eigenschaften von Raketentreibstoff produzierte.<br />
Als die Zeit der Lügen vorbei war, fiel die Quelle der Wahrheit in Ungnade.<br />
Sie wurde mit Werbeplakaten zugehängt und ihre Neonbuchstaben<br />
verschwanden unter immer neuen Bannern. Die Vitrinen vor dem Eingang<br />
wurden zerstört und mussten entfernt werden, um den dort parkenden Autos<br />
Platz zu machen. Drinnen richtete sich eine private Initiative ein. Alles wurde<br />
hoffnungslos schmutzig und grau. Die wie in einem Kaleidoskop wechselnden<br />
Mieter hatten nicht die Zeit, die Mittel und die Lust, sich um das Gebäude zu<br />
kümmern. Die Quelle der Wahrheit hatte keine begeisternde Wirkung mehr,<br />
sondern nur noch eine abschreckende. Es musste etwas mit ihr geschehen.<br />
Im Jahr 2001 kaufte die Krakauer Familie Likus den Abschnitt zwischen<br />
Nowogrodzka- und Bracka-Straße und den Jerozolimskie-Alleen. Der in seiner<br />
Mitte stehende verwahrloste, einst so ätherische Pavillon interessierte sie<br />
nicht im Geringsten. Für das Grundstück hatten sie dicke Millionen ausgegeben,<br />
die Investition musste sich lohnen. Sie beschlossen also, Darth Vader hier<br />
hinzustellen, die Verkörperung der dunklen Seite der Macht: ein randvoll mit<br />
Luxusartikeln angefülltes Einkaufszentrum, das die weltweit teuersten und<br />
namhaftesten Marken in sich versammelte. Es sollte ein in Warschau noch nie<br />
dagewesener Ort sein.<br />
Ein Konflikt war unausweichlich. Zur ersten Schlacht gegen das Imperium<br />
rückten die Bewohner eines nahen, in der Bracka-Straße 13 gelegenen Mietshauses<br />
aus. Nach den Plänen Stefan Kuryłowiczs sollte sich die schwarze und<br />
fast fensterlose Wand des neuen Einkaufszentrums gerade einmal zwölfeinhalb<br />
Meter vor ihren Fenstern und Balkonen befinden. Und das bedeutete de<br />
facto die völlige Verdunklung ihrer Wohnungen. Der gerichtliche Kampf um<br />
das Licht dauerte fünf Jahre – dann kamen Wojewodschafts- und Oberstes<br />
Berufungsgericht zu dem Schluss, die Klagen der Bewohner seien unbegründet<br />
und das Gebäude könne entstehen. Von Journalisten nach dieser Sache<br />
gefragt, antwortete Kuryłowicz: „Es tut mir ehrlich leid für die Bewohner der<br />
Bracka-Straße 13, aber das ist die Warschauer Innenstadt. Jahrelang war dort<br />
ein scheußlicher Parkplatz. Das Gebäude hat eine Bebauungslücke gefüllt.“<br />
Auf diesem scheußlichen Parkplatz stand auch die Quelle der Wahrheit.<br />
Kuryłowicz muss ihren Wert gekannt haben. Er hatte einen Professorentitel<br />
und zu seinen Seminaren an der Fakultät für Architektur am Warschauer Polytechnikum<br />
strömten die Studenten in Massen.<br />
Trotzdem wird am elften April 2008 der Platz eingezäunt und die ersten<br />
Bulldozer fahren beim Chemiepavillon vor. Sein Abriss dauert nicht lange.<br />
Viele Warschauer bemerkten ihn erst, als ihnen auffiel, dass mit dem Pavillon<br />
auch der Secondhandshop verschwunden war, in dem sie sich mit billiger,<br />
gebrauchter Kleidung eingedeckt hatten.<br />
Am Tag nach dem Abriss der Quelle der Wahrheit erscheint in der „Gazeta<br />
Wyborcza” ein Text von Jerzy Majewski. Er schreibt darin, dass die Sache<br />
mit dem Chemiepavillon vor allem ein Zusammenprall der bekanntesten Namen<br />
in der Geschichte der polnischen Architektur sei – auf der einen Seite<br />
Bogusławski und Gniewiewski, auf der anderen der absolute Star des freien<br />
Polen, Stefan Kuryłowicz: „Es ist auch ein Zusammenprall zweier verschiedener<br />
Denkweisen über die Stadt – die modernistische aus den 1960er Jahren,<br />
voller freier Räume, und die postkommunistische, zufällig erbaute Stadt. Und<br />
schließlich ist es ein Kampf zwischen David und Goliath, in dem zu unserer<br />
Verwunderung Goliath sich als der Gewinner herausstellt.“<br />
2011 ist Kuryłowiczs Einkaufszentrum schließlich fertig, die finstere<br />
schwarze Wand nimmt den Bewohnern der Bracka-Straße 13 erfolgreich die<br />
Sicht auf die Welt. Von der Quelle der Wahrheit, der ätherischen Lichtwolke,<br />
ist nicht die kleinste Spur geblieben. Man könnte sagen, die Dunkelheit ist an<br />
ihre Stelle getreten.<br />
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes<br />
KARAKTER, KRAKÓW 2012<br />
190 × 245, 272 PAGES<br />
ISBN: 978-83-62376-12-4<br />
TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
44<br />
MARTA GUZOWSKA<br />
MARTA GUZOWSKA, HAT EINEN<br />
DOKTOR IN ARCHÄOLOGIE UND IST<br />
SEIT ZWÖLF JAHREN MITGLIED DES<br />
AUSGRABUNGSTEAMS IN TROJA.<br />
„DIE OPFERUNG DER POLYXENA“<br />
IST DER ERSTE BAND DER REIHE<br />
VON ARCHÄOLOGIE-KRIMIS UM<br />
DEN PROTAGONISTEN MARIO YBL.<br />
DIE AUTORIN ARBEITET GERADE<br />
AM NÄCHSTEN BAND.<br />
Photo: Farkas Pinter<br />
Die Opferung der Polyxena<br />
Der polnische Kriminalroman wird immer vielseitiger. Zwar dominieren in<br />
diesem Genre immer noch Gegenwarts- und Retro-Krimis, doch immer interessanter<br />
präsentieren sich auch Unterarten dieser Gattung, zum Beispiel<br />
der archäologische Kriminalroman, der bei Ausgrabungen spielt und in dem<br />
Wissenschaftler als Ermittler fungieren. Für diese Variante des Genres entschied<br />
sich Marta Guzowska in ihrem Debüt „Die Opferung der Polyxena“. Der<br />
Roman eröffnet die Reihe um den Anthropologen Mario Ybl.<br />
Die Autorin hat einen Doktor in Archäologie und ist seit mehreren Jahren<br />
Mitglied des Ausgrabungsteams in den Ruinen des antiken Troja. Kein Wunder<br />
also, dass der Roman gerade an diesem Ort spielt. In einem außergewöhnlich<br />
heißen Sommer entdeckt ein internationales Team von Wissenschaftlern<br />
unterschiedlicher Fachrichtungen auf einer Nekropole in der<br />
Nähe von Troja ein ungewöhnliches Grab mit den Überresten einer Frau. Die<br />
Forscher vermuten, dass sie einen sensationellen Fund gemacht haben: die<br />
Knochen der mythischen Polyxena. Es stellt sich jedoch heraus, dass das<br />
Skelett durchaus modern ist. Die Wissenschaftler sind nicht nur frustriert,<br />
sondern auch entsetzt, denn jemand fängt an, nach dem Muster antiker<br />
Überlieferungen in Troja Frauen zu morden.<br />
Der Roman von Guzowska verzaubert vor allem aus zwei Gründen. Zum einen<br />
ist man von der Szenerie hingerissen: der Roman spielt in der Türkei und die<br />
Autorin beschreibt vor dem Hintergrund der Intrige das heutige Land, aus<br />
der Sicht eines westlichen Besuchers. Zum anderen fasziniert der Protagonist<br />
(und gleichzeitig der Erzähler der Story): der brillante Anthropologe<br />
Mario Ybl.<br />
Es ist schwer, diese Figur in wenigen Worten zu beschreiben. Ybl ist eine<br />
Kreuzung aus Adrian Monk, Indiana Jones und Philipp Marlowe, ein „Säufer,<br />
Possenreißer und Zyniker“, wie er sich selbst charakterisiert. Ein Mann mit<br />
einem ausgesprochen losen Mundwerk und der Gabe, sich die Menschen zu<br />
Feinden zu machen; ein unangepasster Typ, der stets nur das tut, war er will,<br />
ohne Rücksicht auf jegliche Regeln.<br />
Ybl leidet unter Nyctophobie, der krankhaften Angst vor der Dunkelheit,<br />
und er bändigt diese Angst auf die denkbar einfachste Art, indem er sich<br />
abends bis zur Besinnungslosigkeit betrinkt. Er ist ein einsamer Wolf, der<br />
letztlich – auf eigene Faust und unter zahlreichen Gefahren – das Rätsel der<br />
Morde klären wird.<br />
Robert Ostaszewski<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
45<br />
Wenn<br />
euch jemand erzählen sollte, dass die Arbeit eines<br />
Archäologen spannend sei, könnt ihr ihn gleich auslachen.<br />
Spannend sind Filme mit Indiana Jones und<br />
Lara Croft. Wobei die letzteren sogar noch besser sind, wegen der ästhetischen<br />
Vorzüge von Angelina Jolie in Shorts. Die Archäologie ist so dermaßen langweilig,<br />
dass es einem den Magen umdreht.<br />
Ihr denkt bestimmt, dass das alles so romantisch ist: ein Archäologe in coolen<br />
Klamotten steht über einem Erdloch und schaut zu, wie immer weitere<br />
Hiebe mit einer Spitzhacke immer weitere Schichten von Ruinen vergangener<br />
Zivilisationen enthüllen. Tut mir Leid, wenn ich euch enttäuschen sollte, aber<br />
das ist kompletter Schwachsinn. Erstens: vergesst die Spitzhacke. Die meiste<br />
Arbeit auf einer Ausgrabung wird mit einer kleinen Spachtel und einem Pinsel<br />
ausgeführt. Wisst ihr, wie lange es unter solchen Bedingungen dauert, nicht<br />
eine Zivilisation, sondern auch nur einen blöden kaputten Tonkrug auszugraben?<br />
Ihr wisst es nicht? Dann stellt es euch vor.<br />
Zweitens, meine werten Herrschaften: es gibt keine verborgenen Zivilisationen.<br />
Sie wurden allesamt schon längst entdeckt, katalogisiert und mit Laufzetteln<br />
versehen. Die Archäologie ist ungefähr genauso romantisch wie die<br />
Buchhaltung. Auch die Arbeit sieht ähnlich aus, denn sie besteht aus dem<br />
Notieren von Hunderten und Tausenden von Nummern. Nummern von Erdschichten,<br />
Nummern von Objekten, Nummern von Scherben, Nummern von<br />
Was-Auch-Immer, verdammt noch mal. Diese Nummern werden später in<br />
eine Datenbank eingearbeitet, analysiert, und anschließend wird ein Bericht<br />
verfasst, der so viel Romantik enthält wie die Quartalsabrechnung eines Zeitungskiosks.<br />
Außerdem fällt es einem normalen Menschen schwer, einen Arbeitstag zu<br />
ertragen, der mit Aufstehen um fünf beginnt, noch vor Sonnenaufgang, und<br />
der lange nach Mitternacht in einem Besäufnis endet – einen Tag, der voller<br />
unendlicher Stunden in der heißen Sonne ist, in einer Hitze, die durch die<br />
Genfer Konvention verboten werden sollte. Ich sage nur eines: wenn irgendein<br />
Gefangener, egal ob ein Politischer oder ein stinknormaler Krimineller, unter<br />
solchen Bedingungen arbeiten müsste, hätte Amnesty International schon<br />
längst eingegriffen.<br />
Heute war es genauso wie gestern, vorgestern und an jedem der beschissenen<br />
letzten vierzehn Tage. Die Sonne brannte wie ein atomarer Scheiterhaufen<br />
und der Himmel, von der Farbe und dem Gewicht wie flüssiges Blei, hing zwei<br />
Zentimeter über meinem armen Kopf. Die Erde erhitzte meine Füße durch die<br />
dicken Schuhsohlen hindurch. Nicht einmal der Wind brachte Linderung,<br />
sondern verbrannte die Haut und trieb mir Staub in den Rachen.<br />
Die Bäume waren schon längst zu raschelnden Skeletten geworden, der<br />
Fluss zu einem schlammigen Bachbett, und das Meer zu einem nach Algen<br />
stinkendem Brei. Hinter dem Vorhang aus vibrierender Luft schoben sich weiße<br />
Schiffe wie Gespenster durch den engen Hals der Dardanellen. Von dem<br />
Platz aus, an dem ich stehen geblieben war, um zu Atem zu kommen, konnte<br />
man nicht genau sehen, ob sie über das Wasser fuhren oder über die glühenden<br />
Felder marschierten. Ein feuchter Dunst verbarg die Inseln Bozcaada und<br />
Tavşan Adası. Nur abends fletschte die untergehende Sonne ihre Zähne und<br />
die Konturen der Eilande wurden lebendig, wie die Figuren aus Kamelhaut<br />
vor dem Seidenvorhang im türkischen Schattentheater.<br />
(…)<br />
Als mich Pola vor einem halben Jahr angerufen hatte, frühmorgens, schlief<br />
ich selbstverständlich noch.<br />
„Erzähl keinen Unsinn“, meinte sie. „Wie spät ist es eigentlich?“<br />
„Mmmm.“<br />
Ich versuchte, auf den Wecker zu schauen. Ich lupfte das Augenlid. Das<br />
Licht der Nachttischlampe blendete mich.<br />
„Egal. Du musst jetzt zuhören. Wir haben eine Nekropole. Die Bulldozer<br />
haben die Fundamente für irgendwelche Datschen gegraben und sind dabei<br />
direkt auf ein Grab gestoßen. Nicht in Troja selbst, zehn Kilometer weiter, an<br />
der Küste. Du weißt, was das bedeutet?“ Pola hielt einladend inne.<br />
„Eee …“<br />
Ich verzichtete auf einen erneuten Versuch, die Augen aufzumachen und<br />
tastete blindlings auf dem Nachtschränkchen herum, auf der Suche nach dem<br />
Wasserglas.<br />
„Erzähl mir nicht, dass du nicht weißt, was es zu bedeuten hat! Das bedeutet,<br />
dass es die Begräbnisstätte der Achaier sein könnte!“<br />
„Aha …“, murmelte ich.<br />
„Das erste Grab, das die Planierraupe zerstört hatte, war eine Urne. Also<br />
eine Feuerbestattung. Die Fotos sind ein bisschen undeutlich, aber alles<br />
spricht dafür, dass …“<br />
Sie verstummte.<br />
„Du weißt, wovon ich spreche, oder?“<br />
„Nein.“<br />
„Du Banause!“<br />
„Pola“, röchelte ich. „Rufst du mitten in der Nacht an, um mich zu beleidigen?<br />
Kannst du nicht bis um neun warten?“<br />
„Kann ich. Die Achaier kamen nach Troja, um die schöne Helena zurückzuholen.<br />
Der Trojanische Krieg, vielleicht sagt es dir etwas?“<br />
„Verdammte Scheiße!“<br />
Das Wasserglas tat genau das, was alle Gläser tun, wenn man sie im Dunkeln<br />
sucht: es fiel auf den Boden und zerstob in winzige Teilchen.<br />
„Genau!“ In Polas Stimme schwang Befriedigung mit. „Frank hat eine Lizenz<br />
und hat mir versprochen, dass ich die Grabung leiten werde. Im ganzen<br />
Abschnitt der Begräbnisstätte. Begreifst du das?“<br />
„Klar.“<br />
„Und du weißt, worum es mir geht?“<br />
„Sicher.“<br />
„Und du weißt, welchen Frank ich meine?“<br />
„Sicher.“<br />
Ein Moment der Stille im Hörer.<br />
„Du hast keine Ahnung, wovon ich spreche, oder? Und es interessiert dich<br />
nicht einmal besonders. Oder irre ich mich?“<br />
„Nein.“<br />
Ein Moment der Stille.<br />
„Ich werde einen Anthropologen brauchen.“<br />
Mit zugekniffenen Augenlidern setzte ich mich auf den Bettrand und stellte<br />
die Füße auf dem kalten Fußboden ab. Von den Fenstern her zog es fürchterlich;<br />
ich konnte mich die ganze Zeit nicht aufraffen, sie abzudichten. Ich rieb<br />
mit den Handflächen über die Stoppeln in meinem Gesicht und räusperte<br />
mich ein paar Mal.<br />
„Was hat das mit mir zu tun?“<br />
„Im Juli. Oder Anfang August. Und ich möchte, dass du mindestens zwei<br />
Studenten mitbringst.“<br />
„Pola …“<br />
„Ehrlich gesagt hätte ich gerne jemanden von den höheren Semestern. Oder<br />
Doktoranden, damit du sie nicht ständig beaufsichtigen musst.“<br />
„Pola …“<br />
Es gelang mir endlich, ein Auge aufzumachen und einen Blick auf den Wecker<br />
zu werfen. Der rote Doppelpunkt zwischen der Zwei und der Dreißig<br />
pulsierte in einem hypnotischen, schläfrigen Rhythmus.<br />
„Pola, es ist halb drei Uhr. Morgens. Am siebten Januar.“<br />
Sie verstummte für einen Augenblick und sagte dann leise:<br />
„Ich dachte, du würdest dich freuen …“<br />
Also freute ich mich. Hatte ich eine andere Wahl?<br />
Aus dem Polnischen von Paulina Schulz<br />
W.A.B., WARSZAWA 2012<br />
123 × 195, 432 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7747-646-8<br />
TRANSLATION RIGHTS: W.A.B.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
ADRESSEN DER VERLAGE<br />
UND AGENTEN<br />
CZARNE<br />
Wołowiec 11<br />
38-307 Sękowa<br />
phone: +48 18 351 00 70<br />
fax : +48 18 353 58 93<br />
redakcja@czarne.com.pl<br />
czarne.com.pl<br />
KARAKTER<br />
ul. Kochanowskiego 19/1<br />
31-127 Kraków<br />
redakcja@karakter.pl<br />
www.karakter.pl<br />
OFICYNA LITERACKA NOIR SUR BLANC<br />
ul. Frascati 18<br />
00-483 Warszawa<br />
phone: +48 22 625 19 55<br />
fax: +48 22 625 08 12<br />
redakcja@noir.pl<br />
www.noir.pl<br />
RITA BAUM<br />
Box 971<br />
50-950 Wrocław 68<br />
redakcja@ritabaum.pl<br />
www.ritabaum.pl<br />
ŚWIAT KSIĄŻKI<br />
W.A.B.<br />
ul. Usypiskowa 5<br />
02-368 Warszawa<br />
phone / fax: +48 22 646 05 10, +48 22 646 05 11<br />
b.woskowiak@wab.com.pl<br />
www.wab.com.pl<br />
WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ<br />
Ul. Nowy Świat 63<br />
00-042 Warszawa<br />
phone: +48 22 505 66 90<br />
fax: +48 22 505 66 84<br />
redakcja@krytykapolityczna.pl<br />
www.krytykapolityczna.pl<br />
WYDAWNICTWO LITERACKIE<br />
ul. Długa 1<br />
31-147 Kraków<br />
phone: +48 12 619 27 40<br />
fax: +48 12 422 54 23<br />
j.dabrowska@wydawnictwoliterackie.pl<br />
www.wydawnictwoliterackie.pl<br />
ZNAK<br />
ul. Kościuszki 37<br />
30-105 Kraków<br />
phone: +48 12 619 95 01<br />
fax: +48 12 619 95 02<br />
rucinska@znak.com.pl<br />
www.znak.com.pl<br />
Weltbild Polska LTD<br />
ul. Hankiewicza 2<br />
02-103 Warszawa<br />
phone: +48 22 517 50 18<br />
agata.pieniazek@weltbild.pl<br />
www.weltbild.pl<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis
DAS POLNISCHE BUCHINSTITUT / INSTYTUT KSIĄŻKI<br />
ul. Szczepańska 1<br />
PL 31-011 Kraków<br />
Tel. : +48 12 433 70 40<br />
Fax : +48 12 429 38 29<br />
office@bookinstitute.pl<br />
Warschauer Filiale des Polnischen Buchinstitutes<br />
Pałac Kultury i Nauki<br />
Pl. Defilad 1, IX piętro, pok. 911<br />
PL 00-901 Warszawa<br />
Tel. : +48 22 656 63 86,<br />
Fax : +48 22 656 63 89<br />
warszawa@instytutksiazki.pl<br />
Warszawa 134, P.O. Box 39<br />
©Das Polnische Buchinstitut, Krakau 2012<br />
Redaktion: Izabella Kaluta, Andre Rudolph<br />
Übersetzung: Olaf Kühl, Joanna Manc, Lisa Palmes, Antje Ritter-Jasińska,<br />
Paulina Schulz, Benjamin Voelkel, Thomas Weiler<br />
Weitere Informationen über die polnische Literatur auf:<br />
www.bookinstitute.pl<br />
Eine englische Ausgabe dieses Katalogs unter dem Titel<br />
New Book From Poland Fall 2012 kann über<br />
das Buchinstitut bezogen werden.<br />
Graphik und Satz:<br />
Studio Otwarte, Krakau<br />
studiotwarte<br />
www.otwarte.com.pl<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis