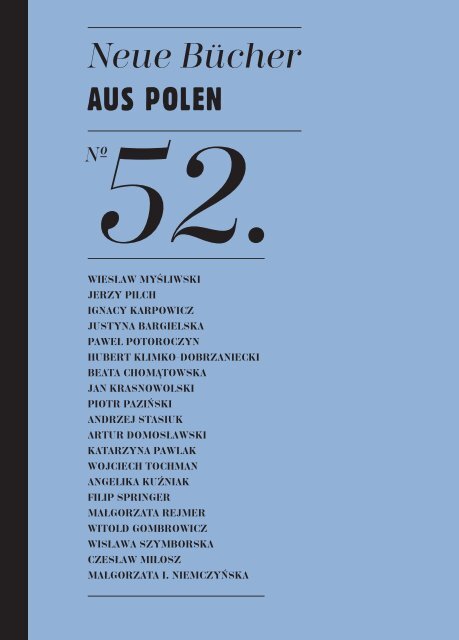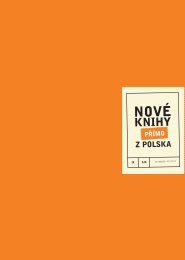Neue Bücher - Instytut Książki
Neue Bücher - Instytut Książki
Neue Bücher - Instytut Książki
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Neue</strong> <strong>Bücher</strong><br />
AUS POLEN<br />
N0<br />
52.<br />
WIESŁAW MYŚLIWSKI<br />
JERZY PILCH<br />
IGNACY KARPOWICZ<br />
JUSTYNA BARGIELSKA<br />
PAWEŁ POTOROCZYN<br />
HUBERT KLIMKO-DOBRZANIECKI<br />
BEATA CHOMĄTOWSKA<br />
JAN KRASNOWOLSKI<br />
PIOTR PAZIŃSKI<br />
ANDRZEJ STASIUK<br />
ARTUR DOMOSŁAWSKI<br />
KATARZYNA PAWLAK<br />
WOJCIECH TOCHMAN<br />
ANGELIKA KUŹNIAK<br />
FILIP SPRINGER<br />
MAŁGORZATA REJMER<br />
WITOLD GOMBROWICZ<br />
WISŁAWA SZYMBORSKA<br />
CZESŁAW MIŁOSZ<br />
MAŁGORZATA I. NIEMCZYŃSKA
DAS POLNISCHE BUCHINSTITUT<br />
INSTYTUT KSIĄŻKI<br />
Ul. Szczepańska 1<br />
PL 31-011 Kraków<br />
Tel: +48 12 433 70 40<br />
Fax: +48 12 429 38 29<br />
office@bookinstitute.pl<br />
Warschauer Filiale<br />
des Polnischen Buchinstitutes<br />
Pałac Kultury i Nauki<br />
Pl. Defilad 1, IX piętro, pok. 911<br />
PL 00-901 Warszawa<br />
Tel: +48 22 656 63 86,<br />
Fax: +48 22 656 63 89<br />
warszawa@instytutksiazki.pl<br />
Warszawa 134, P.O. Box 39
ADRESSEN DER VERLAGE<br />
UND AGENTEN<br />
AGENCE LITTÉRAIRE<br />
PIERRE ASTIER & ASSOCIÉS<br />
142, rue de Clignancourt<br />
750018 Paris<br />
T: +33 (0)1 53 28 14 52<br />
pierre@pierreastier.com<br />
www.pierreastier.com<br />
GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL<br />
ul. Foksal 17<br />
00-372 Warszawa<br />
T: +48 22 826 08 82, +48 22 828 98 08<br />
F: +48 22 380 18 01<br />
b.woskowiak@gwfoksal.pl<br />
www.gwfoksal.pl, www.wab.com.pl<br />
THE WYLIE AGENCY<br />
17 Bedford Square<br />
London WC1B 3JA<br />
T: +44 020 7908 5900<br />
F: +44 020 7908 5901<br />
mail@wylieagency.co.uk<br />
www.wylieagency.com<br />
AGORA<br />
KARAKTER<br />
WIELKA LITERA<br />
ul. Czerska 8/10<br />
00-732 Warszawa<br />
T: +48 22 555 60 00, +48 22 555 60 01<br />
F: +48 22 555 48 50, +48 22 555 47 80<br />
malgorzata.skowronska@agora.pl<br />
www.agora.pl<br />
ul. Kochanowskiego 19/1<br />
31–127 Kraków<br />
debowska@karakter.pl<br />
www.karakter.pl<br />
ul. Kosiarzy 37/53<br />
02-953 Warszawa<br />
T: +48 22 252 59 25<br />
wydawnictwo@wielkalitera.pl<br />
www.wielkalitera.pl<br />
CZARNE<br />
KORPORACJA HA!ART<br />
WYDAWNICTWO LITERACKIE<br />
Wołowiec 11<br />
38-307 Sękowa<br />
T: +48 18 351 00 70, +48 502 318 711<br />
F: + 48 18 351 58 93<br />
redakcja@czarne.com.pl<br />
www.czarne.com.pl<br />
Pl. Szczepański 3a<br />
31-011 Kraków<br />
T/F: +48 12 422 81 98<br />
korporacja@ha.art.pl<br />
www.ha.art.pl<br />
ul. Długa 1<br />
31-147 Kraków<br />
T: +48 12 619 27 40<br />
F: +48 12 422 54 23<br />
j.dabrowska@wydawnictwoliterackie.pl<br />
www.wydawnictwoliterackie.pl<br />
DOM WYDAWNICZY PWN<br />
NISZA<br />
ZNAK<br />
ul. Gottlieba Daimlera 2<br />
02-460 Warszawa<br />
T: +48 22 695 45 55<br />
F: +48 22 695 45 51<br />
sekretariat@domwydawniczypwn.pl<br />
www.dwpwn.pl<br />
T: +48 22 617 89 61<br />
nisza@intertop.pl<br />
www.nisza-wydawnictwo.pl<br />
ul. Kościuszki 37<br />
30-105 Kraków<br />
T: +48 12 619 95 01<br />
F: +48 12 619 95 02<br />
nowicka@znak.com.pl<br />
www.znak.com.pl<br />
FUNDACJA WISŁAWY<br />
SZYMBORSKIEJ<br />
Pl. Wszystkich Świętych 2<br />
31-004 Kraków<br />
T: +48 12 429 41 09<br />
copyright@szymborska.org.pl<br />
www. szymborska.org.pl<br />
POLISHRIGHTS.COM<br />
ul. Kochanowskiego 19/1<br />
31-127 Kraków<br />
debowska@polishrights.com<br />
www.polishrights.com
AUSGEWÄHLTE<br />
PROGRAMME<br />
DES BUCHINSTITUTS<br />
DAS ÜBERSETZUNGSPROGRAMM ©POLAND<br />
ÜBERSETZERKOLLEGIUM<br />
Ziel des Programms ist es, Übersetzungen polnischer Literatur<br />
zu fördern und ihre Präsenz auf den ausländischen<br />
Buchmärkten zu stärken. Das Programm umfasst insbesondere<br />
Belletristik und Essayistik, Kinder- und Jugendliteratur,<br />
Sachbücher.<br />
Angebote können von allen Verlagen abgegeben werden,<br />
die ein in polnischer Sprache geschriebenes Buch in eine<br />
fremde Sprache übersetzen lassen und herausgeben<br />
wollen.<br />
Im Rahmen des Programms können u.a. folgende Kosten<br />
finanziert werden:<br />
• bis zu 100 % der Kosten des Lizenzerwerbs<br />
• bis zu 100 % der Übersetzungskosten eines Werkes<br />
aus dem Polnischen.<br />
Das Programm wird vom Buchinstitut in Zusammenarbeit<br />
mit dem Verein Villa Decius und der Jagiellonen-Universität<br />
durchgeführt. Es richtet sich an Übersetzer polnischer<br />
Literatur, die Belletristik, Essayistik, Dokumentarliteratur<br />
oder geisteswissenschaftliche Literatur im weitesten Sinne<br />
übertragen und bietet ein- bis dreimonatige Stipendienaufenthalte<br />
in Krakau.<br />
TRANSATLANTIK<br />
Transatlantik ist der alljährlich von dem Buchinstitut vergebene<br />
Preis für Persönlichkeiten, die sich für die Verbreitung<br />
der polnischen Literatur im Ausland einsetzen. Der<br />
Preis, dotiert mit 10.000 Euro, kann u. A. an Übersetzer,<br />
Verleger, Literaturkritiker, Polonisten verliehen werden.<br />
SAMPLE TRANSLATIONS ©POLAND<br />
Das Ziel dieses Programms – es richtet sich an Übersetzer<br />
polnischer Literatur – ist es, im Ausland für polnische<br />
Literatur zu werben, indem man Übersetzer ermutigt, polnische<br />
<strong>Bücher</strong> ausländischen Verlegern zu präsentieren.<br />
Bezahlt werden 20 Seiten einer Probeübersetzung.<br />
Die Bewerbungsformulare beider Programme können<br />
postalisch beim Buchinstitut in Krakau angefordert, oder<br />
von der Website www.bookinstitute.pl heruntergeladen<br />
werden.<br />
KONTAKT:<br />
Das Polnische Buchinstitut<br />
ul. Szczepańska 1<br />
PL 31-011 Kraków<br />
E-mail: office@bookinstitute.pl<br />
Phone: +48 12 433 70 40<br />
Fax: +48 12 429 38 29<br />
www.bookinstitute.pl<br />
Direktor des Polnischen Buchinstituts:<br />
Grzegorz Gauden
WIESŁAW<br />
MYŚLIWSKI<br />
ENDSPIEL<br />
Wiesław Myśliwski (geb. 1932), Schriftsteller, Essayist,<br />
Dramaturg. Er debütierte 1967 mit dem<br />
Roman „Nagi sad”, drei Jahre später veröffentlichte<br />
er „Pałac”. Er ist der Autor eines der wichtigsten<br />
polnischen Nachkriegsromane „Kamień na<br />
kamieniu“ (1984). Er veröffentlicht selten, meistens<br />
im Abstand von 10 Jahren. Er erhielt zweimal<br />
den renommierten Nike-Preis – für die Romane<br />
„Widnokrąg“ (1996) und „Traktat o łuskaniu fasoli“<br />
(2006).<br />
In seinem Roman „Endspiel” verwendet der Schriftsteller erneut<br />
seine bevorzugte narrative Form: den sich über den ganzen<br />
Text erstreckenden inneren Monolog eines namenlosen<br />
Protagonisten, der am Ende seines Lebens mit seiner Biographie<br />
abzurechnen versucht. In diesen weitläufigen Monolog<br />
schneiden sich Reminiszenzen hinein, Bilder und Szenen aus<br />
der Vergangenheit, die ohne Rücksicht auf die Chronologie<br />
eingebaut werden. Diese zerstreuten Stücke sind meist dramatisiert,<br />
in dialogischer Form.<br />
Ein Novum ist das Auftauchen eines Liebesmotivs. Der<br />
Monolog wird ergänzt durch Briefe, die die alte Jugendliebe<br />
des Protagonisten, Maria, ihm durch die Jahrzehnte geschrieben<br />
hat. Eigentümlich ist, dass der Protagonist des „Endspiels“<br />
auf keinen dieser Briefe geantwortet hat – obwohl sie alle voller<br />
Emotionen und Leidenschaft waren, obwohl ihm Maria<br />
ewige Liebe geschworen hat.<br />
Während der Lektüre entdeckt der Leser, dass diese Grausamkeit<br />
Maria gegenüber eine tiefere Motivation hat: Der<br />
Protagonist hängt obsessiv an der Idee der Freiheit. Er hatte<br />
mehrmals und absichtlich Berufe und Wohnorte gewechselt,<br />
nie ein Haus oder Möbel besessen (aus freier Entscheidung<br />
lebte er lediglich in möblierten, gemieteten Wohnungen) und<br />
war niemals eine längere Beziehung eingegangen.<br />
Er spricht davon, dass er „sich selbst freiwillig von allem<br />
enterbt hatte”, und stellt sich die Frage: „Im Namen wessen?<br />
Der Freiheit? Unsinn. Es sei denn, man begreift die Freiheit<br />
als eine permanente Flucht vor sich selbst.” Die grausamste<br />
seiner Fluchten war die vor Maria – die dümmste die Flucht<br />
vor der Malerei und seinem Talent.<br />
Er war ein vielversprechender Maler, doch er gab sein Studium<br />
an der Akademie der Schönen Künste auf und begann<br />
eine Lehre als Schneider. Diese Wahl war, wie alles in seinem<br />
Leben, zufällig und flüchtig. Aber liegt dem Leser hier eine<br />
Erzählung über ein schlimmes Schicksal, ein verpfuschtes<br />
Leben vor? Mitnichten.<br />
Was bedeutet denn ein gelungenes oder nicht gelungenes<br />
Leben? Was ist das Leben an sich? Solcher Art Fragen – elementare,<br />
endgültige, mit philosophischem Anspruch – findet<br />
man in diesem Buch viele. Auch wenn es pathetisch klingt:<br />
Myśliwski versucht, den Sinn des Lebens und das Geheimnis<br />
der menschlichen Existenz zu durchdringen, ohne dabei jedoch<br />
endgültige Wahrheiten zu formulieren oder eindeutige<br />
Antworten zu geben.<br />
Es wäre wichtig, auf den Titel des Romans einzugehen.<br />
Der Held des Buches ist leidenschaftlicher Kartenspieler; am<br />
liebsten spielte er Poker mit dem Schuster Mateja; doch seine<br />
wichtigste Partie spielt er auf dem Friedhof – man kann es gar<br />
nicht anders verstehen – mit dem Geist Matejas.<br />
Im gewissen Sinne hebt der Autor die bedrohliche Bedeutung<br />
des Wortes „Ende“ im Titel wieder auf, was seine völlige<br />
Bestätigung im Finale des Werkes finden wird:<br />
Der letzte Brief Marias, einer lebensmüden alten Dame,<br />
informiert den Protagonisten über ihre Absicht, Selbstmord<br />
zu begehen. Dieser Abschiedsbrief ist jedoch keinesfalls der<br />
letzte – was sich nicht nur dadurch erklärt, dass Maria von<br />
ihrem Plan zurückgetreten war. Woher sie ihn abschickte, ist<br />
leicht zu erraten.<br />
Es ist schwer, eine schönere Coda für ein ergreifendes Liebeslied<br />
zu finden, als sie Myśliwski im „Endspiel“ anstimmt:<br />
Das Paar, das im Leben keine Erfüllung fand, findet sich im<br />
Jenseits, unter ungleich angenehmeren Bedingungen; dort,<br />
wo die vergehende Zeit keine Bedeutung hat, wo Jugend und<br />
Schönheit keine Rolle spielen.<br />
WIESŁAW MYŚLIWSKI<br />
„OSTATNIE ROZDANIE”<br />
ZNAK, KRAKÓW 2013<br />
140×205, 448 PAGES<br />
ISBN: 978-83-240-2780-4<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
ZNAK<br />
Dariusz Nowacki
ENDSPIEL<br />
ÜBER DEM SEE<br />
lag um diese frühe Zeit ein Nebel, der stellenweise so dicht<br />
war, dass man – wenn man vom hohen Ufer hinunterschaute<br />
– mit dem Blick den unten liegenden Wasserspiegel nicht<br />
erfassen konnte. Erst als die auf der anderen Seite, am gegenüberliegenden<br />
Ufer aufgehende Sonne begann, den<br />
Nebel zu durchdringen, tauchte der See allmählich aus der<br />
Tiefe auf. Es war etwas Einzigartiges in dieser Sonne, die<br />
sich so hartnäckig durch den Nebel kämpfte – der sich dabei<br />
zusammenzog, als würde er sich wehren. Vielleicht habe<br />
ich aber mittlerweile vergessen, wie die Sonne aufgeht, und<br />
ich entdeckte es in diesem Moment aufs <strong>Neue</strong>. Wann habe<br />
ich wohl zum letzten Mal den Sonnenaufgang gesehen, versuchte<br />
ich mich zu erinnern. Es musste schon so lange her<br />
sein, dass der Gedächtnisfaden abgerissen war.<br />
Ich bedauerte, dass ich nicht mehr malte. Würde ich<br />
malen, würde ich die Staffelei am Ufer aufstellen und versuchen,<br />
diese Sonne auf Leinwand zu übertragen. Ich hätte<br />
sogar einen Titel: „Die Geburt der Sonne“. Sie war beinahe<br />
lichtlos, der Strahlen und ihrer Wärme beraubt, verdünnt<br />
durch den Nebel, der sie aus der Welt heraussaugte; so<br />
dass nicht einmal die Erde stark genug war, ihr zu helfen.<br />
Ich spürte den Schmerz der Sonne, ihre unglaubliche Anstrengung,<br />
wenn sie sich selbst auf diese Welt presste. Es<br />
schien mir, als würde sie die ganze Erde mit sich reißen,<br />
zusammen mit diesem bodenlosen, endlosen Nebel. Und<br />
ich war geradezu erleichtert, als sie sich endlich freigekämpft<br />
hatte. Danach wanderte sie in einem breiten Band<br />
über den Wald, der wie speziell für sie herausgeschlagen<br />
worden war, damit sie nichts mehr auf ihrem Weg zum See<br />
aufhalten konnte. Sie erreichte auf der anderen Seite das<br />
Ufer und tauchte dort ein, wusch ihre Qualen ab. Und dann<br />
wandelte sie über den Wasserspiegel, offenbar auf uns zu,<br />
zerschnitt den Nebel mit ihren Strahlen, und ich spürte<br />
eine sonderbare Anspannung, die wohl jeder Erwartung<br />
inne wohnt. Ich wartete, bis sie an das hohe Ufer kam, wo<br />
ich mit meinem Oskar wartete. Er spürte wohl dasselbe,<br />
denn er ließ sich niemals fortziehen, bevor die Sonne so<br />
nahe an uns herangekommen war, dass ich sagen konnte:<br />
Ich danke dir, Sonne, dass du aufgegangen bist – und Oskar<br />
fröhlich bellte. Nach einigen Tagen zog er mich schon von<br />
alleine an dieses Ufer. Dort setzte er sich auf die Hinterpfoten<br />
und gab keinen Laut von sich, kein Winseln, Knurren<br />
oder Bellen. Er hob nur den Kopf und schaute mich beunruhigt<br />
an. Und wir warteten, bis die Sonne aufging. Erst,<br />
wenn sie an uns herangekommen war, ließ sich Oskar in<br />
den Wald führen.<br />
Auf der anderen Seite des Sees war ein Gebäude zu sehen,<br />
ein Ferienhaus oder eine Pension. Es schien viel größer
als das unsere, doch sogar in der vollen Sonne konnte man<br />
nichts weiter erkennen, außer, dass es da stand. Unsere<br />
Pension war nicht groß, man könnte sagen, bescheiden,<br />
aber die Anzeige in der Zeitung hatte mich gelockt: „Wo,<br />
wenn nicht hier, inmitten der Wälder, wollen Sie sich erholen?“<br />
Ich habe gedacht, dass es bestimmt nicht voll sein<br />
würde, denn wer sollte wegfahren zu einer Zeit, da die Blätter<br />
beinahe vollständig von den Bäumen gefallen sind und<br />
die Nächte kalt werden.<br />
Und tatsächlich: Außer mir wohnte dort nur der zuvor<br />
erwähnte Herr Dionizy. Wären die Besitzerin und ihr Sohn<br />
nicht gewesen (der zwei-drei Mal die Woche vorbeischaute,<br />
weil er woanders wohnte), hätte man meinen können,<br />
die Pension sei ausgestorben. Ich wohnte alleine im ersten<br />
Stock und Herr Dionizy im Erdgeschoss, weil er Schwierigkeiten<br />
mit dem Gehen hatte. Schwer stützte er sich auf<br />
seinen Stock, als ob er jeden Schritt mit Schmerzen bezahlen<br />
würde. Wahrscheinlich ging er gar nicht spazieren, zumindest<br />
habe ich ihn nie draußen gesehen, weder morgens<br />
noch nachmittags oder abends. Angeblich hatte er ein Auto<br />
voll mit <strong>Bücher</strong>n dabei. Der Sohn der Besitzerin (der die<br />
Versorgung der Pension und diverse Reparaturen besorgte,<br />
und im Herbst, so wie jetzt, das Laubrechen), erzählte,<br />
dass er zwei Mal gehen musste, um die <strong>Bücher</strong> ins Haus zu<br />
bekommen. Außerdem musste er jetzt auch noch Samstag<br />
Abend beinahe alle Zeitungen und Zeitschriften der ganzen<br />
Woche zusammensuchen und sie Herrn Dionizy vorbei<br />
bringen.<br />
Ich überlegte, wann er Zeit hatte zu schreiben, wenn er<br />
das alles las. Er hatte mir immer mal eine Zeitung oder eine<br />
Zeitschrift angeboten, in der, seiner Meinung nach, etwas<br />
Interessantes stand. Ich bedankte mich, sagte, ich würde<br />
es gerne lesen, aber dass ich ebenfalls zum Arbeiten her<br />
gekommen sei und keine Zeit habe. Außerdem bekam ich<br />
jedes Mal mit, wenn ich spazieren oder mit Oskar Gassi ging,<br />
dass Herr Dionizy Radio hörte. Entweder war er schwerhörig<br />
oder mochte es sehr laut, um nichts zu verpassen. Es gibt<br />
Menschen, die die Stille nicht vertragen, weil sie sich darin<br />
verlieren, wie im Nebel. Vielleicht ist für sie Stille gleichbedeutend<br />
mit Einsamkeit.<br />
Auch wenn ich schon ein gutes Stück von der Pension<br />
weg war, hörte ich das Radio noch. Abends wiederum, wenn<br />
die Nachrichten begannen, setzte sich Herr Dionizy regelmäßig<br />
in den Speiseraum vor den Fernseher. Er ließ keinen<br />
Tag aus, und oft schaute er bis tief in die Nacht. Nicht nur<br />
die Tagesschau, auch Talkshows, Pressekonferenzen, Kommentare,<br />
Interviews, er sprang zwischen den Sendern hin<br />
und her und drehte die Lautstärke so weit hoch, dass ich es<br />
noch hinter meiner Tür im ersten Stock hörte.<br />
Zugegeben: Er hatte er sich gefreut, als ich angekommen<br />
war. Er kam an seinem Gehstock herausgehumpelt und begrüßte<br />
mich herzlich, als hätten wir uns schon öfter in dieser<br />
Pension getroffen:<br />
„Ah, endlich jemand, mit dem man ein Wort wechseln<br />
kann. Ich heiße Sie hier hoffnungsvoll willkommen!“<br />
Schon am nächsten Tag beim Mittagessen (er verspeiste<br />
gerade das Hauptgericht), griff er sich seinen Teller und<br />
Besteck und setzte sich an meinen Tisch.<br />
„Sie erlauben? Es isst sich so schlecht alleine. Für wie lange<br />
sind Sie hergekommen?“<br />
Am nächsten Tag überreichte er mir seine Visitenkarte:<br />
„Da steht auch die Mobilnummer. Ich gebe sie nur vertrauenswürdigen<br />
Menschen. Sollten Sie in meiner Stadt<br />
sein, besuchen Sie mich bitte. Sie sind herzlich eingeladen.<br />
Nur rufen Sie bitte vorher an.“<br />
Ich warf einen Blick darauf. Dionizy Orzelewski. Die Adresse.<br />
Mehr nicht.<br />
„Danke“, erwiderte ich. „Wenn ich dort sein sollte, werde<br />
ich es nicht versäumen, Ihrer Einladung zu folgen.“ Ich<br />
stellte mich ebenfalls vor und schob seine Visitenkarte in<br />
die Brusttasche meines Jacketts. Später, zu Hause, nach<br />
meiner Rückkehr, steckte ich sie in mein Adressbuch, obwohl<br />
ich noch überlegte, warum ich es tue. Auch wenn<br />
ich jemals in die Stadt kommen sollte, in der Herr Dionizy<br />
wohnte, würde ich ihn eh nicht anrufen. Und ich hatte nicht<br />
vor, nochmal in diese Pension zu kommen. Ich habe seine<br />
Visitenkarte in meinem Notizbuch nie wieder gesehen;<br />
womöglich klebte sie an einer anderen. Visitenkarten hängen<br />
manchmal so aneinander, wenn man nicht regelmäßig<br />
reinschaut.<br />
Ein paar Tage später fing er an, mir zu erzählen, was er<br />
gerade in den Zeitungen gelesen hatte. Danach ging es darum,<br />
was im Radio kam und schließlich, was er am Abend<br />
zuvor im Fernsehen gesehen hatte. Ich tat so, als ob ich zuhören<br />
würde, doch mit den Gedanken war ich woanders. Ich<br />
habe mir diese Fähigkeit erarbeitet, damit niemand merkte,<br />
dass ich nicht zuhörte.<br />
Er hatte den Mund voller Essen, so dass sich die Worte<br />
da durch pressen mussten, undeutlich waren, wie vermengt<br />
mit den Speisen, so dass nur wenige zu verstehen waren.<br />
Und an einem weiteren Tag, seiner wohl sicher, dass er<br />
mich mit seinem Vertrauen bedenken konnte, wurde er<br />
hitzig – als ob er an einer der Fernsehdebatten teilnehmen<br />
würde, die er abends zuvor im Fernsehen gesehen hatte. Er<br />
hob die Stimme, sie schwoll vor Wut und Spott, er lästerte,<br />
lachte sarkastisch, warf mit Beleidigungen um sich, doch es<br />
fiel mir schwer zu erkennen, wen er denn meinte.<br />
„Was glauben die, wer sie sind, diese Idioten, dieses<br />
Pack!“ Vor Wut knallte er mit seiner Gabel auf den Teller,<br />
also verstand ich soviel, dass es um irgendwelche Idioten<br />
und irgendwelches Pack gehen musste.<br />
Ungefähr in der Mitte meines Urlaubs war ich so erschöpft<br />
von seiner Anwesenheit, dass ich überlegte, wie ich<br />
ihn loswerden könnte. Ich kam auf die Idee, schon früher<br />
zu den Mahlzeiten zu erscheinen, doch es half nichts. Dann<br />
ging ich später als gewohnt essen, aber auch das brachte<br />
nichts. Von irgendeinem Instinkt geführt, kam er ebenfalls<br />
früher oder später zum Essen. Ich überlegte schon, ob ich<br />
nicht abreisen sollte. Wenn ich mir seine Ausführungen bei<br />
jeder Mahlzeit anhören müsste, bis zum Schluss, würde ich<br />
mich nicht erholen. Und wegen der Erholung war ich doch<br />
hergekommen.<br />
Irgendwann setzte er sich beim Mittagessen wieder an<br />
meinen Tisch, offenbar aufgebracht, denn kaum machte er<br />
es sich auf dem Stuhl bequem (er hatte wegen seines kaputten<br />
Beins auch mit dem Sitzen Probleme) schon bombardierte<br />
er mich mit der Frage:<br />
„Was halten Sie davon, was gerade los ist?“<br />
Aus dem Polnischen von Paulina Schulz
JERZY<br />
PILCH<br />
DER DÄMONEN<br />
VIELE<br />
Jerzy Pilch (geb. 1952), einer der bekanntesten<br />
und beliebtesten polnischen Schriftsteller der Gegenwart.<br />
Autor von neunzehn <strong>Bücher</strong>n, übersetzt<br />
in siebzehn Sprachen. Pilch wurde sieben Mal für<br />
den Nike-Preis nominiert und erhielt ihn 2001 für<br />
den Roman „Pod Mocnym Aniołem“. „Wiele demonów”<br />
ist sein erster Roman seit fünf Jahren.<br />
Der von den Kritikern enthusiastisch aufgenommene neue<br />
Roman von Jerzy Pilch nimmt zwei große Themen der Weltliteratur<br />
auf: Liebe und Tod, Begierde und Verlust, Ekstase<br />
und das Nichts.<br />
Ein düsterer Pessimismus wechselt sich hier ab mit dem<br />
orgiastischen Rhythmus der Freude am Erzählen, Entzücken<br />
alterniert mit Spott, Glauben mit Gottlosigkeit. Überaus realistisch<br />
wird hier das Leben der polnischen Lutheraner in<br />
einem Ort namens Sigła dargestellt, in den sechziger Jahren<br />
des zwanzigsten Jahrhunderts.<br />
Das Lokale und das Private sind den Lesern von Jerzy Pilch<br />
wohlbekannt – denn Sigła ist nichts Anderes als der Heimatort<br />
des Schriftstellers Wisła; der Geburtsort nicht nur von Pilch,<br />
sondern beinahe seiner gesamten literarischen Welt. Die Symbolik<br />
von „Der Dämonen viele“ rührt aus der protestantischen<br />
Theologie, die Struktur ähnelt einem literarischen Mythos –<br />
zwar einem Mythos, der von dem Nichts und der Erschöpfung<br />
durchsetzt ist, der aber den Leser dennoch durch die Suggestivität<br />
der Bilder erstaunt und ihn mit dem Spannungsbogen<br />
des Plots und dem Tempo der Erzählung begeistert.<br />
Das Leben der Bewohner von Sigła ist scheinbar kalt und<br />
düster – denn die Protestanten sparen am Heizmaterial und<br />
sitzen in nicht ausreichend beleuchteten Räumen herum. Hier<br />
pulsieren Leidenschaften und Süchte, und dennoch herrscht<br />
hier Ordnung. Die Welt kann von schmerzhafter Schönheit<br />
sein, wenn morgens das Gras in der Oktober-Sonne dampft<br />
oder wenn „der Frost die Welt festhält wie ein kristallener<br />
Schraubstock“. Ebenso kann sie von durchdringender Widerlichkeit<br />
sein:<br />
„Der Mensch wird am Boden eines entsetzlichen Abgrundes<br />
geboren, lebt ohne jeglichen Sinn, und stirbt unter Qualen.“<br />
Der Tod – mit verschiedenen Formen und Gesichtern<br />
– sucht den Erzähler und die Romanfiguren heim, lockt und<br />
entsetzt sie gleichermaßen.<br />
Dabei ist der Erzähler eine durchsichtige Gestalt, die dem<br />
Autor selbst sehr nahe verwandt ist.<br />
Die kindlichen Ängste kennen den Tod besser als die Wirklichkeit.<br />
„Die Diele ist eine düstere, eiskalte Fieberphantasie.<br />
Sie werden sterben, sterben, sterben. Unter dem vom bräunlichen<br />
Frost bezogenen Dachfirst glimmt eine schwache Funzel.<br />
Jemand schleicht durch den Garten.“<br />
Das Verschwinden und die Suche nach einer der schönen<br />
Töchter des Pastors Mrak machen aus dem Roman eine Art<br />
Krimi; doch es ist nur scheinbar ein Krimi, dessen Wesen das<br />
Geheimnis, und nicht dessen Lösung ist.<br />
Zugegeben: Nach „Jahren der Überlegung“ weist der hellsichtige<br />
Briefträger tatsächlich auf einen Ort, an dem der<br />
„von niemals tauenden braungrünen Eisschollen zugewucherte,<br />
kirschrote, so dunkelkirschrote, dass er fast schwarz<br />
war“ Schlafanzug des jungen Fräuleins Mrak liegt. Doch die<br />
angebliche Leiche erscheint nur in gelegentlichem Aufblitzen,<br />
außerhalb des Erzählstranges. Es ist ein Verschwinden wie<br />
aus dem Film „Picknick on Hanging Rock“ von Peter Weir, wie<br />
es der Autor selbst beschreibt.<br />
Das Mädchen wird zu einem Geist dieses Romans, zu<br />
einem jungfräulichen Engel, eingetaucht in einen dichten,<br />
sinnlichen Nebel. Ola ist wie Ophelia, ein Symbol für die Unmöglichkeit<br />
der erotischen Erfüllung. Das Geheimnis um ihr<br />
Schicksal ist ein Köder für den Leser; ihr Körper ein immer<br />
weiter rückendes Versprechen, nicht nur für die Männer, sondern<br />
auch für ihre Mutter und ihre Schwestern.<br />
Das wahre Entsetzen spielt sich in den Häusern ab, im Alltag,<br />
im Leben, das man fleißig in die Hölle verwandelt. Das<br />
Dämonische, Teuflische der Existenz in einer religiösen Gemeinschaft<br />
ist ein Paradox der Pilch-Protestanten, die seine<br />
autobiographischen Romane bevölkern.<br />
Dennoch ist dieses Buch kein düsterer Horror. Es ist eine<br />
dichte, narkotische Erzählung über die Dämonen der Literatur<br />
und die Unausweichlichkeit des Todes.<br />
Kazimiera Szczuka<br />
JERZY PILCH<br />
„WIELE DEMONÓW”<br />
WIELKA LITERA, WARSZAWA 2013<br />
215×130, 480 PAGES<br />
ISBN: 978-83-63387-91-4<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
POLISHRIGHTS.COM
DER DÄMONEN<br />
VIELE<br />
In der Mitte<br />
des vergangenen Jahrhunderts arbeitete bei der Post in<br />
Sigła der Briefträger Fryderyk Moitschek, der das Geheimnis<br />
des menschlichen Lebens kannte, der wusste, wohin<br />
wir gehen und was nach dem Tode sein würde. Nur eine<br />
Handvoll Menschen glaubte ihm – obwohl alles, was er vorhergesagt<br />
hatte, oder vielmehr alles, was er aus einer dicken<br />
Kladde herauslas, auf Punkt und Komma stimmte.<br />
Die Menschen starben, erkrankten und wurden gesund<br />
nach seinen Prophezeiungen, das Wetter wurde so, wie er<br />
es gesagt hatte, gezielt sagte er die Föhnwinde voraus, stickig<br />
wie Friedhofserde, die Hochwasser, die so schlimm waren,<br />
dass sie Brücken abrissen, die Hitzewellen, die sich wie<br />
Öl über die Welt legten, sowie die unerwartet von allen Seiten<br />
herankommenden eiskalten und schneereichen Winter.<br />
An Fußball hatte er lediglich mittelmäßiges Interesse,<br />
nur hin und wieder; also konnte man ihn nur schwer überreden,<br />
die Ergebnisse vorauszusagen. Aber wenn er schon<br />
tippte, dann fehlerfrei: Real Madrid, Ruch Chorzów, FC<br />
Santos, Wisła Kraków, ja, sogar unsere Elf aus der A-Liga!<br />
Überhaupt schossen und verloren alle Mannschaften, auf<br />
die er seinen Blick richtete, immer genauso viele Tore, wie<br />
es ihm beliebte.<br />
Es geschah selten, denn er vermied Situationen, in denen<br />
seine Gabe nicht nur mit dem leichten Geldverdienen,<br />
sondern überhaupt mit irgendwelchen unanständigen Manipulationen<br />
in Verbindung gebracht werden konnte. Ohne<br />
den Schatten eines Zweifels – man spürte, dass Fryderyks<br />
Heiligkeit nicht darin begründet liegt, das Wunder der wöchentlichen<br />
Fußballergebnisse zu vollbringen, die Lotto-<br />
Zahlen vorherzusagen oder konsequent die Nieten bei einer<br />
Tombola zu vermeiden; man spürte es, man spürte es ganz<br />
eindeutig, und man drängte nicht, mit aller Diskretion.<br />
Bringe mich nicht auf böse Gedanken, Antichrist! Weiche<br />
von mir, Satan! „Und da der Teufel alle Versuchung<br />
vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeitlang.“ (Lukas 4, 13)<br />
Fryc war kein Illusionist, der seinen Lebensunterhalt mit<br />
atemberaubenden Tricks verdiente. Er war Prophet, mit<br />
Leib und Seele. Mit dem Leib unseres Herrn und der Seele<br />
des Heiligen Geistes. Sein Königreich war nicht von dieser<br />
Welt. Geld hatte er ohne Ende, woher, wusste keiner, aber<br />
es waren auf keinen Fall Honorare für prophetische Dienste<br />
an der Menschheit.<br />
Zuza Bujok hat er Koma und Aufwachen aus dem Koma<br />
geweissagt, Józek Lumentiger Abstinenz und das Verwerfen<br />
dieser Abstinenz, Polen den Kommunismus und das Ende<br />
des Kommunismus. Alles selbstverständlich gratis, im letzten<br />
Falle nicht nur gratis, sondern auch mit einem enormen<br />
patriotischen Enthusiasmus .
So war es mit allem und so war es immer: gratis, gratis<br />
und nochmal gratis. Niemals hatte er für etwas Geld genommen,<br />
keinen Pfennig, obwohl er oft genug Auslagen hatte,<br />
obwohl er Zeit ohne Ende opferte, obwohl er seine Gesundheit<br />
und somit sein Leben aufs Spiel setzte. Wohl nur Gott<br />
der Herr, der Geist der literarischen Fiktion und einige wenige<br />
andere Transzendenzen wissen, welcher Anstrengung<br />
Fryc seinen Körper unterwarf und welchen Raubbau er an<br />
seiner irdischen und somit fragilen Existenz betrieb.<br />
Seine Leute hat er immer ernst genommen, da kann<br />
man nichts sagen, mit großer Hingabe half er, wo er konnte,<br />
kümmerte sich überaus aufopferungsvoll, und unterstützte<br />
die Seinen nicht nur in Krankheit. Leider verwendete er seine<br />
Kräfte, Fähigkeiten und die glühende Leidenschaft eines<br />
begabten Heilers nicht nur an uns. Anderen diente er auch,<br />
oft vollkommen Fremden, die nicht aus Sigła, sondern aus<br />
aller Herren Länder kamen – er half ihnen mit derselben,<br />
oder sogar mit noch glühenderer Hingabe (man konnte es<br />
nur schwerlich erkennen); er löste ihre Probleme, kurierte<br />
sie von diversen Phobien, fand unrettbar verlorene Dinge<br />
wieder, warnte vor konkreten Gefahren, empfahl detaillierte<br />
Hauskuren.<br />
Und er diente vor allem (was sollen wir die Wahrheit<br />
verschleiern) überaus eifrig den Vertreterinnen des schönen<br />
Geschlechts: wenn er mit ihnen all die wichtigen und<br />
unwichtigen Details der Therapie besprach, ihnen eine positive,<br />
endlich positive Veränderung ihres Schicksals versprach,<br />
gut, kleinere Hindernisse sah er immer noch, aber<br />
er erklärte gleichzeitig, wie man sie mit links überwinden<br />
konnte und erörterte die Situation eingehend. Alles tipptopp,<br />
aber zu welchem Preis? Wenn man sagen würde, dass<br />
er Raubbau mit seiner Existenz, seiner körperlichen Form<br />
und seiner Kondition betrieb, wäre dies mehr als untertrieben;<br />
es war räuberisch und leichtsinnig, in seiner aufopferungsvollen<br />
Haltung unverantwortlich – denn nie sah<br />
jemand Fryc beispielsweise etwas essen.<br />
Niemand. Nie. Versteht ihr das? Niemand, niemals, und<br />
er musste doch etwas essen! Musste er nicht? Aß er gar<br />
nichts? Lebte er von Luft? Die ganzen Fälle und Unfälle beschäftigten<br />
ihn demnach so stark, dass er nicht einmal für<br />
ein belegtes Brot Zeit hatte? Nur ein Apfel zwischen Tür<br />
und Angel? Aber auch einen Apfel hat ihn keiner je essen<br />
sehen! Man sprach nur davon. Die Erzählungen und Legenden<br />
über Fryc' Apfel. Anekdoten? Dies und das. Hunderte<br />
von Fragen, doch im Grunde nur eine Frage: Hat unser Heiler<br />
und Wohltäter heute schon etwas gegessen? Einen Apfel,<br />
zum Mittagessen. Einen. Eher klein als groß. Fryc lebt von<br />
einem Apfel am Tag? So sieht es aus.<br />
Eines Tages wird er umfallen und alles wird vorbei sein.<br />
Schluss mit den Prophezeiungen, Schluss mit den Wundern,<br />
Schluss mit den Rezepten gegen Selbstmordgedanken. Nein,<br />
Fryc wird nicht umfallen, er sieht nicht schwächlich aus.<br />
Und das ist das Schlimmste! Es wäre tausend Mal besser,<br />
wenn man ihm seine Anstrengungen, seine Qualen, sein<br />
Hungern und seine Schwäche ansehen würde. Im Gesicht<br />
sieht es zwar schlimm aus, aber es ist nicht gefährlich. Unsichtbar,<br />
verborgen in Herz und Hirn droht es mit einer<br />
Explosion. Fryc explodierte, in der Tat – aber mit seinen<br />
Wundern.<br />
Aus dem Haus der Familie Kubatschke hatte er den Geist<br />
des Ehemannes vertrieben, der zu Lebzeiten eifersüchtig,<br />
und nach seinem Tode wahnsinnig eifersüchtig war. Dem<br />
Doktor Nieobadany hatte er vier Töchter vorausgesagt,<br />
und als er den Braten roch, korrigierte er auf sieben. Herrn<br />
Ujma, Direktor der Mineralbrunnen-Anlage, heilte er von<br />
seinen homosexuellen Neigungen. Emilka Morzolikówna<br />
schlug er die Selbstmordgedanken aus dem Kopf. Und das<br />
alles quasi fastend? Spürte er keinen Hunger, weil er keinen<br />
Appetit hatte? War sein sanfter Körper so von der Kraft<br />
seines Geistes erschlagen, dass er nicht einmal die Mindestrationen<br />
an Essbarem verlangte? Um es weiter zu fassen:<br />
die Verdauungsprozesse (von der Ausscheidung ganz zu<br />
schweigen) ziemen sich offenbar nicht für den wahren<br />
Propheten? Nein. Ehrlich gesagt sind für einen Propheten<br />
sogar die subtilsten somatischen oder biologischen Aspekte<br />
ungehörig. War Fryc ein Geist? Er hatte nie jemandem die<br />
Hand gegeben, und unvermeidlich ergibt sich die Frage, ob<br />
ihn jemals jemand berührt hatte? Wenigstens die zahlreichen<br />
Frauen, die ihn zu besuchen pflegten? Ihr würdet euch<br />
wundern, und wie! Und ihr werdet euch wundern, zweifelsohne,<br />
nur etwas später.<br />
Angeblich hatte Fryc bereits einige Jahre vor dem Krieg<br />
und einige Jahrzehnte vor dem Fall der Berliner Mauer in<br />
seinem Notizbuch neue Landkarten von Europa und Asien<br />
mit Bleistift gezeichnet. Diejenigen, die sie gesehen haben,<br />
behaupteten, dass mit Ausnahme von Ostpreußen und<br />
Turkmenistan alles bis auf den Millimeter stimmte.<br />
Ob er Tote ins Leben zurückgerufen hatte ist nicht gewiss.<br />
Doch mit absoluter Gewissheit hat er den praktisch<br />
toten Liebling der Pastorenfrau, Juda Tadeusz, die klügste<br />
der drei Pfarrkatzen, zurück ins Leben geholt. Greta und<br />
Maryna, den beiden Kühen von Józef aus Ubocze, hatte er<br />
die schmerzhafte Schwellung von den Eutern genommen<br />
– auf den ersten Blick nichts Besonderes, doch Fryc hat es<br />
aus der Entfernung getan. Den gelähmten Schäferhund,<br />
den Rädelsführer vom Rudel der Frau Scherschenick, rief<br />
er mit schrecklicher Stimme an: „Wirf deinen Stock von<br />
dir! So sage ich dir, wirf deinen Stock von dir!“ Das vor<br />
Angst beinahe wahnsinnig gewordene Tier hatte den Stock<br />
zwar nicht von sich geworfen, denn es hatte, man wird es<br />
beschwören, gar keinen benutzt, doch es erhob sich auf<br />
alle Viere. Nicht nur, dass sich der Hund erhoben hätte! Er<br />
schlich noch einige Jahre eher recht als schlecht durch die<br />
Welt. Und wenn er Fryc erblickte oder schon von Weitem<br />
seine Witterung aufnahm, so fuhren weitere heilenden<br />
Energien in ihn ein, denn er floh mit äußerst gesundem<br />
Heulen, wohin der Pfeffer wächst.<br />
Und ob; auch wenn Fryc Moitschek kein hundertprozentiger<br />
Wunderheiler sein mochte – aber er hatte eine<br />
Gabe. Er betrat ein Haus und bemerkte sofort und fehlerfrei<br />
eine sinnlose Bewegung in den elektrischen Leitungen.<br />
„Da leuchtet wo was“, sagte er und schaute sich in aller<br />
Ruhe um. „Irgendwo leuchtet was. Schon die ganze Zeit.<br />
Helllichter Tag, noch lange bis zum Abend, und bei Euch,<br />
guter Mann, brennt eine Glühbirne: seit gestern oder seit<br />
sonstwann.“ Alle Familienmitglieder sprangen auf die Beine<br />
und überprüften sämtliche Räume, in denen elektrische<br />
Leitungen vorhanden waren. Und immer, egal ob auf dem<br />
Dachboden oder im Keller oder in einer seit ewigen Zeiten<br />
verschlossenen und verriegelten Kammer, da fanden sie<br />
eine umsonst glimmende gelbliche 40-Watt-Birne.<br />
Aus dem Polnischen von Paulina Schulz
IGNACY<br />
KARPOWICZ<br />
HEITEN/KEITEN<br />
Ignacy Karpowicz (geb. 1976), Prosaautor, Reisender,<br />
Übersetzer; einer der spannendsten Autoren<br />
der jüngeren Generation. Seit seinem Debüt<br />
2006 sind vier weitere Romane erschienen; zwei<br />
Nominierungen für den NIKE-Preis, ausgezeichnet<br />
mit dem Paszport POLITYKI 2010.<br />
Ignacy Karpowicz, ausgezeichnet mit dem Literaturpreis Paszport<br />
Polityki, meldet sich mit einem neuen, interessanten Roman<br />
zurück. heiten/keiten erzählt humorvoll vom Bedürfnis<br />
nach Nähe und Liebe, vor allem aber vom Anderssein, das in<br />
der Romanlandschaft zur Normalität wird. Wieder einmal<br />
stellt der Autor unter Beweis, dass er in seiner Entwicklung<br />
nicht stehen bleibt – jedes seiner <strong>Bücher</strong> unterscheidet sich<br />
deutlich von den Vorgängern: Das enthusiastisch gefeierte Debüt<br />
Niehalo [Nicht der Hit] war eine groteske Tour durch die<br />
polnische Wirklichkeit im Zeitalter des Kapitalismus, Gesty<br />
[Gesten] analysierte eine schwierige Mutter-Sohn-Beziehung,<br />
und das preisgekrönte Balladyny i romanse [Balladynen und<br />
Romanzen] entpuppte sich als origineller Beitrag zur Präsenz<br />
der Religion in der modernen Welt.<br />
Diesmal setzt Karpowicz auf einen kollektiven Helden,<br />
wenn er seinen neugierig-warmen Blick auf (nicht gar so<br />
schreckliche) Vertreter des Bürgertums richtet, die in ihren<br />
persönlichen Sorgen, zumeist in Liebesdingen, befangen sind.<br />
Die Romanfiguren entstammen der polnischen Mittelschicht,<br />
sie decken das gesamte Spektrum an Einstellungen und Haltungen<br />
ab. Da wäre zum Beispiel Norbert, der nicht eben viel<br />
für Homosexuelle übrig hat, selbst aber mit dem Vietnamesen<br />
Kuan anbändelt (der sich abends in die berühmte Dragqueen<br />
Kim Lee verwandelt). Aber auch die Gesellschaft der brillanten<br />
Professorin Ninel ist ihm durchaus nicht unangenehm…<br />
Diese wiederum pflegt eine sonderbare Beziehung zu Szymon,<br />
dem Angetrauten der launischen Maja, ihrerseits Mutter eines<br />
pubertierenden Sohnes und Schwester der fanatisch katholischen<br />
Faustyna. Und Freundin von Andrzej, der mit dem chaotischen<br />
Krzyś zusammenlebt… Und so geht es immer weiter –<br />
eine Zusammenfassung des neuen Karpowicz läse sich wie das<br />
Drehbuch eines Almodóvar-Films. Nur präsentiert der Autor<br />
seine Truppe schillernder Figuren (die er übrigens stets wunderbar<br />
im Griff hat) ohne jeglichen Furor. Er erzählt eine stimmige,<br />
rundum vergnügliche Alltagsgeschichte, die etwas außer<br />
Kontrolle gerät, aber darüber keine Dramen auslöst, sondern<br />
im Gegenteil eine neue, zufriedenstellende (?) Ordnung stiftet.<br />
Die Brosamen, nein, die Gräten, die uns im Alltag im Halse<br />
stecken bleiben, sind im Grunde halb so wild. Karpowicz<br />
gelingt es nämlich, sie zu entschärfen, bevor sie ihre Sprengkraft<br />
entfalten können. Mit seinem engagierten Buch, seinem<br />
Entwurf einer idealen Gesellschaft, die offen ist für das Andere,<br />
tolerant und vorurteilsfrei, erzählt er die Geschichte einer<br />
Handvoll netter, leicht orientierungsloser Menschen, die geprägt<br />
ist von Normalität.<br />
Wie könnte es auch anders sein, ist doch unser Leben – wie<br />
der Autor zeigt – mag es uns noch so fundamental wichtig erscheinen,<br />
eingebunden in Millionen Strukturen und Systeme,<br />
die bedeutend größer und wichtiger sind als wir. Daher gibt<br />
gerade das Kleine den geeigneten Maßstab vor, diese Irrungen<br />
und Wirrungen zu beschreiben.<br />
Patrycja Pustkowiak<br />
IGNACY KARPOWICZ<br />
„OŚCI”<br />
WYDAWNICTWO LITERACKIE<br />
KRAKÓW 2013<br />
145×205, 472 PAGES<br />
ISBN: 978-83-08-05118-4<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
WYDAWNICTWO LITERACKIE
HEITEN/KEITEN<br />
– Maja,<br />
du bist der tollste Mensch der Welt.<br />
– Verzeihung, haben Sie etwas gesagt?<br />
Erst jetzt wurde Maja bewusst, dass sie vom Modus ‚lautloses<br />
Mantra‘ in den Modus ‚gesprochenes Mantra‘ gefallen<br />
war. Sie wurde rot. Nicht, weil sie etwas gesagt hatte.<br />
An den Irren, die in Bussen und Bahnen mit Gott und den<br />
Musen plauderten, konnte sie nichts Schlechtes finden.<br />
Die hatten wenigstens ein Anliegen, da sollten sich eher<br />
die schweigenden Fahrgäste schämen. Aber der Inhalt des<br />
Gesagten beschämte sie. Aus Sicherheitserwägungen heraus,<br />
und mit Rücksicht auf meine Würde, sollte ich wohl<br />
ein weniger persönliches Mantra wählen. Sie schwankte<br />
zwischen den in Sachen Ego neutralen ,,Drängeln Sie nicht<br />
so“ und ,,Die Fahrscheine bitte“; sie würde es mit der ersten<br />
Variante probieren, wenngleich sie bezweifelte, dass diese<br />
ähnlich schnell die Laune heben würde wie „Maja, du bist<br />
der tollste Mensch der Welt“.<br />
Kaum hatte sie den neuen therapeutischen Satz zweimal<br />
im Geiste gesprochen, war diese Stimme wieder da:<br />
– Ich habe es doch gehört. Sie haben etwas gesagt.<br />
Sie kapitulierte. Langsam hob sie den Blick, um die Quelle<br />
des nervenden Geredes ausfindig zu machen. Sie hatte<br />
nichts Besonderes erwartet, einen Lautsprecher vielleicht,<br />
am wenigsten aber das, was sie nun zu sehen bekam. Vor<br />
ihr stand ein breitschultriger Mann um die Dreißig; sorgsam<br />
gegeltes Haar, Rechtsscheitel, ebenmäßige Züge, tadellose<br />
Haut, keine Warze, kein Pickelchen, glatt rasierte<br />
Wangen, der Bartansatz so markant wie die Toleranzgrenze<br />
des Vatikans zur Gleichstellung von Mann und Frau. Unter<br />
dem offenen grauen Mantel blitzte ein schneeweißes Hemd<br />
hervor. Seine Hose hatte sie nicht beachtet, und jetzt wollte<br />
sie den Blick nicht mehr senken – das hätte sicher ausgesehen,<br />
als wollte sie seinen Schritt taxieren, als gehörte sie<br />
zu den sexuell Unterversorgten; selbst wenn es komplett<br />
anders ausgesehen hätte, nun hatte Maja einmal gedacht, es<br />
hätte so ausgesehen und nicht anders, deshalb hielt sie jetzt<br />
mit eisernem Willen den Nacken steif.<br />
Sie wollte ihn Auge in Auge fragen, was er für Hosen<br />
trug, da sie aus übergeordneten, quasi objektiven Gründen<br />
außerstande war, dies selbständig und eigenen Auges in Erfahrung<br />
zu bringen. Glücklicherweise verkniff sie sich die<br />
Frage. Der Mann präsentierte sich für Majas Geschmack<br />
derart aufgeräumt, ordentlich und sauber, dass seine Akkuratesse<br />
übertrieben und irritierend wirkte. Vor ihr stand<br />
der Bilderbuchsohn von Bilderbucheltern.<br />
Ein nervöser Schauder lief ihr über den Rücken: Dieser<br />
Mann war in einer kranken Familie aufgewachsen, allmorgendlich<br />
brachte seine sadistische Mutter ihm das Haar in
Form und zwängte ihn in die Kleider ihres modisch um ein<br />
Jahrhundert hinterherhinkenden Albtraums vom perfekten<br />
Kind, während Vater Rohrstock Morgen für Morgen wiederholte:<br />
„Denk dran, mein Sohn, sieh deinem Gegenüber<br />
immer in die Augen, wenn du sprichst.“<br />
Majas Fantasie kam allmählich auf Touren. Sie sah Meister<br />
Proper am Mittagstisch sitzen; auf seinem Teller, der so<br />
blank war, als wäre er immer schon leer gewesen, lag die<br />
letzte Erbse. Jeder normale Mensch hätte mit seiner Gabel<br />
diese Erbse minutenlang gejagt, nicht so Herr Sauber-Ausgeführt.<br />
Mit einer einzigen, präzisen Bewegung spießte er<br />
die Erbse auf und führte die Gabel zum Mund. Maja wurde<br />
immer unruhiger. Kein Zweifel, sie sah sich einem lebensgefährlichen<br />
brünetten Barrakuda gegenüber. Um jeden<br />
Preis musste jetzt ein positives Gegenbild her. Sie dachte an<br />
ihren Sohn, seinen Irokesenschnitt, seinen hemdsärmeligen<br />
Umgang mit Wasser und Seife, aber das Bild ihres Sohnes<br />
machte die Situation auch nicht besser. Entsetzt malte sie<br />
sich aus, wie ihr geliebter Bruno zufällig dieser Bestie im<br />
blütenreinen Kragen begegnet, sich infiziert, den Iro abrasiert<br />
und sich einen Seitenscheitel zulegt. Gütiger Gott, bitte<br />
nicht Bruno!<br />
– Ich hätte ein Taxi nehmen sollen.<br />
– Wie bitte?<br />
– Im Bus begegnet man immer so widerlichen Typen.<br />
– Typen wie mir, meinen Sie?<br />
– Gleich kommt eine Bedarfshaltestelle – ihre Stimme<br />
zitterte und wurde leiser. – Ich melde Bedarf an, dass Sie<br />
aussteigen.<br />
Er lächelte.<br />
– Sie würden meiner Mutter gefallen.<br />
– Ich bin schlecht in Müttern. Ich fürchte, ich könnte die<br />
Gefühle Ihrer Mutter nicht erwidern.<br />
Sie wollte noch anfügen: „schließlich hat sie ein Monstrum<br />
großgezogen“, konnte sich aber zurückhalten. Dieser<br />
schöne Erfolg – Maja gelang es nicht immer, nicht zu sagen,<br />
was sie nicht sagen wollte – gab ihr neuen Mut. Der Bus war<br />
voll besetzt, sie hatte nichts zu befürchten, höchstens eine<br />
Grippe oder einen Pilz von ihren Mitfahrern; Gewaltexzesse<br />
standen aller Voraussicht nach nicht an. Die Situation gestaltete<br />
sich so ungemütlich wie folgt: Sie unterhielt sich<br />
mit einem höflichen, erschreckend reinlichen, hochwertigen<br />
Mannsbild hyperrealistischer Machart.<br />
– Sie brauchen nicht an der nächsten Haltestelle auszusteigen<br />
– lenkte sie nach einer ausgedehnten Pause begütigend<br />
ein. – Steigen Sie aus, wann Sie wollen.<br />
Er neigte leicht den Kopf und räusperte sich verlegen.<br />
– Ich würde Sie gern näher kennenlernen. Ich muss gestehen,<br />
Sie haben mich mächtig beeindruckt.<br />
Jetzt sah sie ihn mit anderen Augen. Weil er sein Interesse<br />
bekundet hatte, konnte Maja ihre erste Einschätzung<br />
noch einmal korrigieren und den Sympathiefaktor erhöhen<br />
bzw. den Antipathiefaktor minimieren. Sie erkannte, dass<br />
man ihn nur ein wenig beschmutzen, die Haare zausen<br />
und zwei bis drei Pickel auf den Wangen platzieren müsste,<br />
schon sähe er den anderen Chef-Gorillas gar nicht mehr so<br />
unähnlich. Man könnte ihn sogar in den Club mitnehmen.<br />
Wahrscheinlich war er gar kein Psychopath, sondern nur<br />
geistig, kulturell oder hygienisch behindert.<br />
– Haben Sie im Novemberaufstand, aus dem Sie offenbar<br />
gerade kommen, erfolgreich fremde Bräute im ÖPNV abgeschleppt?<br />
Während er sich seine Antwort zurechtlegte, stellte sie<br />
sich vor, dass Meister Ich-pinkle-kohlensäurearmes-Mineralwasser<br />
mit jüngeren Geschwistern gesegnet war. Dass<br />
die ganze Sippe bei Tisch auf Kommando Erbsen aufspießt.<br />
Diese Szene geriet Maja so anrührend komisch, dass sie<br />
nicht einmal versuchte, ihr Lächeln zu verbergen.<br />
– Ich sehe mich – gestand er ernsthaft – zu einer intelligenten<br />
und geistreichen Antwort nicht in der Lage.<br />
– Bei mir ist das umgekehrt. Intelligente Antworten habe<br />
ich immer parat. Ist doch egal, dass ich die Fragen nicht abwarten<br />
kann!<br />
– Gestatten Sie mir eine Einladung zum Abendessen.<br />
Maja zeigte sich an dem Unbekannten und seinem untadeligen<br />
Äußeren zunehmend interessiert. Sie kam sich vor<br />
wie eine Archäologin, eine Epidemologin, eine Biologin bei<br />
der Erforschung einer extraterrestrischen Lebensform. Sie<br />
kam sich vor, als hätte sie das Teflon erfunden, die reinste<br />
Substanz überhaupt; na ja, vielleicht ex aequo mit der<br />
Hostie.<br />
– Schwitzen Sie?<br />
– Hmm. Ja, in diesem Moment habe ich beispielsweise<br />
vor Aufregung schwitzige Hände. Handflächen.<br />
– Haben Sie …<br />
– Ich beantworte all Ihre Fragen unter der Bedingung,<br />
dass wir uns treffen.<br />
– Gut. An einem öffentlichen, gut ausgeleuchteten Ort.<br />
Haben Sie manchmal Schnupfen? So richtig mit Rotz?<br />
– Ich muss gleich aussteigen, das ist meine Haltestelle.<br />
Bitte geben Sie mir Ihre Nummer.<br />
Maja diktierte, und er zog aus seiner manierlichen ledernen<br />
Brieftasche eine Visitenkarte.<br />
– Morgen rufe ich an. Die bekommen Sie für den Fall der<br />
Fälle. Auf Wiedersehen.<br />
Er stieg aus, und sie sah ihm nach. Sie wusste nicht, was<br />
sie mehr schmerzen würde: Wenn er stehen bliebe und<br />
schaute, oder wenn er sich abwandte und seiner Wege ging.<br />
Maja schaute nicht gerne, wenn sie nicht wusste, was sie sehen<br />
wollte. Undefiniertes Schauen konnte sehr riskant sein,<br />
und eine Bindehautentzündung wollte sie sich jetzt ganz bestimmt<br />
nicht einhandeln.<br />
In ihrem Kopf war ein Rauschen, aber nicht das zarte Gesäusel<br />
von Champagnerbläschen, etwas Massiveres, eindeutig<br />
Sanitäres. In etwa das Freilegen eines verstopften Jacuzzi.<br />
Bulb-bulb-bulb. Wie exakt ich den Klempner in meinem Kopf<br />
wiedergeben kann, staunte sie.<br />
Das Gespräch im Bus erschien ihr bald als völlig unglaubwürdiges<br />
Produkt ihrer Antidepressiva, bald als große Peinlichkeit,<br />
als hätte sie versucht, den Teenager zu spielen, der<br />
sie seit Jahren nicht mehr war. Es klang in der Endlosschleife<br />
mit dem ewigen verkorksten Prolog (Maja, du bist der tollste<br />
Mensch der Welt) hoffnungslos selbstgefällig. Wirklich intelligente<br />
und wohlerzogene Menschen sollten ihre Intelligenz<br />
und ihre gute Erziehung nicht so direkt herauskehren. Intelligente<br />
Menschen mit sozialen Umgangsformen hätten sich<br />
ein ordentliches Thema gesucht. Das Wetter. Die Erhöhung<br />
des Renteneintrittsalters. Ein Zugunglück. Opferzahlen.<br />
Aus dem Polnischen von Thomas Weiler
JUSTYNA<br />
BARGIELSKA<br />
KLEINE<br />
FÜCHSE<br />
Justyna Bargielska (geb. 1977), Lyrikerin und<br />
Prosaistin. Ausgezeichnet u.a. mit dem Literaturpreis<br />
Gdynia. Małe lisy [Kleine Füchse; 2013] ist<br />
ihr zweiter Prosaband.<br />
In „Kleine Füchse” gibt die glasklare Stimme einer jungen<br />
Frau Geschichten zum Besten, eigene Geschichten oder Geschichten<br />
geradewegs aus dem Leben. Der Gegenstand: die<br />
Kinder, der Ehemann, der Hund, die Mutter, die Schwester<br />
und die Nachbarinnen. Die Wohnsiedlung, daneben der Wald.<br />
Der Haushalt, in der U-Bahn aufgeschnappte oder zu Hause<br />
von der Tochter geträllerte Rhythmen, der Vorstadtbus. Im<br />
Heimeligen lauert jedoch das Unheimliche, im Vertrauten das<br />
Sündhafte. Der märchenhaft angehauchte Liebesroman, die<br />
weltweit populärste frauenliterarische Gattung, erhält hier<br />
eine komplexe, ironische Dimension. „Hattet ihr denn mal<br />
was, Mädels, mit einem Gangster aus dem Wald? Denn genau<br />
das, Mädels, hatte ich” – so beginnt „Kleine Füchse”.<br />
Der Titel ist so vieldeutig wie einleuchtend. Sie sind es, die<br />
biblischen kleinen Füchse, die kleinen Sünden – in diesem Fall<br />
die Sünden der Hausfrauen – die die Weinberge verwüsten.<br />
Wie ist es doch verlockend, ein kleiner Fuchs zu sein und einfach<br />
im Wald bei der Siedlung herumzustreifen! Die in einem<br />
Grenzbereich von Traum, Erinnerung und Phantasie gesponnenen<br />
Märchen über den Messerstecher als Geliebten fordern<br />
alles in allem doch ihren Preis. Das alltägliche Familienleben,<br />
seine Materie selbst unterliegt einer gewissen Erosion, da das,<br />
was die Welt zu einem verzauberten Ort macht – die Poesie,<br />
und manchmal sogar die Religion – sich nun auf einen Bereich<br />
außerhalb des Hauses verlagert, in den Wald. Der tiefe Blick<br />
in die Dynamik dieses Prozesses ist jedoch nicht identisch mit<br />
Schuldgefühl. „Das geht mir am A... vorbei” ist die Autorin imstande<br />
zu schreiben, die sonst fast nie zu Vulgarismen greift.<br />
Der Sinn dieser Umschreibung ist einfach. Für die Frau sind<br />
Freiheit und Schaffenskraft seltene und unschätzbare Werte,<br />
die es mit dem eigenen Körper zu schützen gilt.<br />
Bargielskas poetischer Redefluss spaltet sich in zwei Figuren<br />
auf, die alltägliche, aber dadurch nicht weniger dramatische<br />
existentielle Erfahrungen dokumentieren. Agnieszka, die<br />
„Forschontärin”, eine der „Damen von der Stiftung”, ist eine<br />
selbständige junge Singlefrau, die u.a. einen Schreibkurs im<br />
Kulturzentrum der Siedlung leitet. Die Figur des literarischen<br />
Schaffens erscheint hier als grenzenloses kollektives Projekt,<br />
welches das eindeutige Verständnis der Autorschaft in Frage<br />
stellt. Auf diese Weise deklariert Bargielska, die scheinbar<br />
obenhin verschiedenste Frauennamen in den Text einfließen<br />
lässt, „Kleine Füchse” zwar zu ihrem, aber nicht allein von ihr<br />
stammenden Werk. In diesem weiblichen, von der Definition<br />
her leicht obszönen Redeschreibfluss, in dessen Zuge Leiden<br />
und Begehren auf die Bühne des Alltags vordringen, erweisen<br />
sich Worte, Gedanken, Orte und Erfahrungen als gemeinsam.<br />
Agnieszkas Geschichte verflicht sich erstaunlich eng mit der<br />
Mikroperspektive einer anderen Figur, einer Hausfrau und<br />
Mutter, die zum Glück oder Unglück für die Wirklichkeit<br />
selbst eine empfindsame Intellektuelle ist. Beide Frauen schlafen<br />
ganz offensichtlich mit demselben betörenden Räuber aus<br />
dem Wald.<br />
In „Obsoletki” [Obsoletes], Bargielskas letztem Buch, war<br />
es die Trauer, die dem Ganzen seinen Ton verlieh. Eine tiefe<br />
und zugleich problematische Trauer, zeichnete die Autorin<br />
doch die Erfahrung einer Fehlgeburt nach, den Verlust einer<br />
Person, die es in der realen Welt noch gar nicht gegeben hatte.<br />
Die medizinische Erfahrung fand einen religiösen Rhythmus<br />
und eine religiöse Bebilderung, der dunkle Schein von Trauerritualen<br />
erfüllte die Welt. „Kleine Füchse” ist da ganz anders.<br />
Die Rückkehr auf die Seite des Lebens bedeutet den Eintritt in<br />
die Sphäre erhöhter Gefahr, illegaler erotischer Leidenschaften<br />
und der Phantasie, von zu Hause wegzulaufen, auch wenn<br />
man dafür durch die Kanalisation abfließen müsste. Doch wie<br />
zu erwarten bleibt die große Katastrophe hier aus. Die Kinder,<br />
imaginär beim Versuch eines erweiterten Selbstmords mit<br />
Schlaftabletten betäubt, wachen doch am Schluss wieder auf.<br />
Und auch ihre Mutter kehrt ins Leben zurück. Die Aspekte des<br />
schriftstellerischen Ichs fügen sich zusammen, gemeinsam gehen<br />
die beiden Geliebten des Messerstechers zum Wohnblock<br />
zurück, gemeinsam tragen sie die Kinder. Die Handlung ist bei<br />
dieser Erzählung zwar wichtig und fesselnd, aber dennoch in<br />
gewissem Sinne konventionell. Das Wichtigste ist die Begabung<br />
der Autorin, alles zu Literatur zu verdichten, zu einer<br />
bündigen, ironischen, manchmal etwas surrealen Literatur,<br />
die aber immer von der Schönheit und der Bedrohung handelt,<br />
die sich in der Unbestimmtheit der Existenz verbergen.<br />
JUSTYNA BARGIELSKA<br />
„MAŁE LISY”<br />
CZARNE, WOŁOWIEC 2013<br />
125×195, 112 PAGES<br />
ISBN 978-83-7536-505-4<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
POLISHRIGHTS.COM<br />
Kazimiera Szczuka
KLEINE<br />
FÜCHSE<br />
Hattet ihr<br />
denn mal was, Mädels, mit einem Gangster aus dem Wald?<br />
Denn genau das, Mädels, hatte ich.<br />
Aber heute haben wir den Dienstag, bevor irgendetwas<br />
begann, und ich bin immer noch Laborleiterin, Forscherin,<br />
und auch freiwillige Mitarbeiterin der Stiftung, Volontärin.<br />
Forschontärin. Aus dem Bus, der an einer roten Ampel steht,<br />
beobachte ich zwei Jungen mit Rucksäcken, die Eis aus einer<br />
Pfütze brechen. Sie halten große Stücke davon in den Händen.<br />
Die Ampel springt auf Grün, der Bus fährt an, ich überlege,<br />
wozu sie das Eis brauchen, die einzige Erklärung ist,<br />
dass sie die vorbeifahrenden Autos damit bewerfen wollen.<br />
Ich kehre zu meinem Buch zurück, aber ich sollte im Bus<br />
nicht lesen, denn es nimmt mich immer alles sehr mit, was<br />
ich lese. Am meisten nimmt mich Frauenliteratur mit, aber<br />
auch einige wissenschaftliche Werke haben emotionalen<br />
Einfluss auf mich.<br />
Ich bin erleichtert, dass mein Bus losgefahren ist, bevor<br />
die Jungen angefangen haben, die vorbeifahrenden Autos<br />
mit Eis zu bewerfen. Nicht ausgeschlossen, dass ich irgendeinen<br />
Sport machen sollte. Mir ist aufgefallen, dass ich meinen<br />
Zustand – je nachdem, wie kontrovers das Gelesene war<br />
– mit psychosomatischen Formulierungen beschreibe: dass<br />
mir die Knie zittern, die Hände oder überhaupt meine ganze<br />
kritische Person. Nach der Lektüre muss ich oft zu einem<br />
bestimmten Regalbrett gehen und etwas anderes, Bekanntes,<br />
Offensichtliches lesen, zur Beruhigung. Am liebsten<br />
Darwin. Ich glaube, mir fehlt Bewegung.<br />
Eigentlich mag ich frische Luft. Sie hilft, brachliegende<br />
Gehirnstrukturen zu nutzen. Einmal war ich in den Ferien<br />
auf dem Land und eines Tages fiel mir unvermittelt eine<br />
Entgegnung auf etwas ein, was eine Frau vom Ministerium<br />
beim Vorjahrestreffen gesagt hatte: dass sie uns über<br />
den Termin des nächsten Treffens informieren werde, aber<br />
verhandelt werde nicht, denn die Damen von der Stiftung<br />
hätten ja viel Zeit.<br />
Ich hätte ihr sagen sollen, dass die Damen von der Stiftung<br />
unbezahlt ihre Freizeit opfern, um das wieder geradezubiegen,<br />
was solche fetten Scheusale wie sie in ihren Amtsstunden<br />
für öffentliche Gelder kaputtmachen! Ich weiß nur<br />
nicht, ob ich es mit Ausrufungszeichen oder ohne hätte<br />
sagen sollen. Im Grunde ist es gut, dass mir diese scharfe<br />
Entgegnung nicht gleich vor Ort eingefallen ist, denn ich<br />
hätte dadurch, dass ich über das Ausrufungszeichen nachgegrübelt<br />
hätte, sowieso die ganze Wirkung verdorben.<br />
Für diese Gehirnstrukturen habe ich mir neulich einen<br />
Hund angeschafft. Einen Westie. Sein weißes Fell ruft keine<br />
Allergien hervor. Ich gehe zweimal am Tag mit ihm auf<br />
den Rasen hinter der Siedlung, und einmal am Tag in den
Wald auf der anderen Straßenseite. Im Schnee sieht man<br />
ihn schlecht.<br />
Und eines Tages bin ich mit meinem Westie im Wald,<br />
und es kommt aus einer Entfernung von ungefähr hundert<br />
Metern ein Mann auf mich zu. Groß, graumelierte lockige<br />
Haare, Anzughose, Flanellhemd und knielanger Mantel,<br />
aufgeknöpft.<br />
„Was für ein Arschloch muss man sein!“, ruft er.<br />
Er kommt näher, grüßt und erklärt, dass er denjenigen<br />
gemeint habe, der seinen Müll in den Wald geschmissen hat.<br />
Den Müll sieht man im Schnee sehr gut.<br />
„Da hinten liegen noch zwei Monitore“, sage ich. Der<br />
Hund des Mannes kommt angerannt und der Mann fragt,<br />
ob unsere Hunde miteinander spielen dürfen. Das dürfen<br />
sie, auch wenn sein Hund etwas lustlos ist und meinen Westie<br />
höchstens ein bisschen um sich herumspringen lässt.<br />
„Wir sind in Trauer“, erklärt der Mann. „Er hatte eine<br />
Freundin, aber ich musste sie einschläfern lassen, weil sie<br />
Krebs hatte. Es war dumm von mir, sie zu begraben, als er<br />
zusah. Er hat nicht kapiert, dass das ein Begräbnis war, das<br />
letzte Geleit, und so. Ist schließlich ein Hund, der muss das<br />
nicht verstehen.“<br />
An die hundert Meter tiefer im Wald habe ich einmal ein<br />
Portraitfoto von einer Bulldogge im Schnee liegen sehen.<br />
Die Glasscheibe hatte einen Sprung, wahrscheinlich vom<br />
Frost. Ich male mir aus, dass das ein Tierfriedhof ist, vor<br />
dem Winter habe ich hier manchmal Schnittblumen liegen<br />
sehen. Mein Westie gibt auf, der Hund des Mannes im aufgeknöpften<br />
Mantel will alleine sein.<br />
Die nächsten Tage führe ich meinen Westie auf der Wiese<br />
an der anderen Seite der Siedlung spazieren. Über der<br />
Wiese hören die niedrig gespannten Hochspannungsleitungen<br />
nicht auf zu sirren. Ich mag ihr Sirren, denn dank ihm<br />
habe ich eine Wiese nebenan und nicht die nächste Wohnsiedlung.<br />
Später kehre ich wieder zum Wald zurück.<br />
Einmal beim Spazierengehen habe ich ein Foto von etwas<br />
gemacht, das ich nicht verstehen konnte. Ich habe es<br />
auf meinen Computer geladen und vergrößert, aber ich<br />
weiß immer noch nicht, wozu diese Installation dienen sollte.<br />
An vier Bäumen, die grob gesehen im Quadrat wuchsen,<br />
hingen Beutel mit etwas, das gefroren war und sogar auf<br />
den Fotos hart aussah. In der Mitte stand ein großer Stein,<br />
aber kein Felsblock, sondern einfach ein Stein, der so groß<br />
war, dass er wie extra hergebracht aussah, und nicht wie<br />
zufällig im Wald gefunden. Neben dem Stein stand eine<br />
Blechdose, die so aufgeschnitten war, dass ihr Boden einen<br />
Greifer bildete und die Wände zwei schräge Schneiden.<br />
Also, ich weiß nicht.<br />
Ich habe den Mann in dem aufgeknöpften Mantel getroffen.<br />
Er hat mich wohl kaum an mir erkannt, denn ich hatte<br />
mich fast bis unter die Brauen in meinen Schal eingewickelt,<br />
so kalt war es. Wahrscheinlich hat er mich an meinem Westie<br />
erkannt.<br />
„Soll ich Ihnen was zeigen?“, fragte er.<br />
Wir gingen tief in den Wald, in die Tiefe zu dem Einfamilienhaus<br />
auf der anderen Seite hin. Er zeigte mir so etwas<br />
wie die Reste einer Hütte.<br />
„Hier hat Pajda gewohnt“, sagte er. „Mit seiner Geliebten.“<br />
Irgendwas hatte ich gelesen.<br />
„Ein Messerstecher, wissen Sie. Hat sich hier eine Hütte<br />
hingestellt, eigentlich ein Zelt, und das Zelt mit Zweigen<br />
überdeckt. Zur Tarnung. Den ganzen Sommer hat er hier<br />
gewohnt, mit der Geliebten und zwei Kindern.“<br />
„Und zwei Kindern?“<br />
„Schwangeren Geliebten.“<br />
Darüber hatte ich tatsächlich was gelesen. Unsere Siedlung<br />
bekommt keine Lokalzeitung, die Einfamilienhäuser<br />
rundherum natürlich schon, da wird das „Echo“ an die<br />
Gartentore gehängt, in speziellen Plastiktüten mit Henkel,<br />
aber bei uns wird es nicht ausgeteilt, wer würde es auch in<br />
die dreihundert Briefkästen stecken wollen, und vor allem<br />
wozu, wo doch mindestens die Hälfte von uns Wochenende<br />
für Wochenende in ihr richtiges Haus fährt, weit außerhalb<br />
von Warschau, und erst dort Interesse hat, sich die Lokalnachrichten<br />
anzueignen. Und auch, Steuern zu zahlen. Und<br />
so habe ich mir das „Echo“ eines Tages aus dem Laden geholt.<br />
Wie dieser Pajda sein Unwesen getrieben hat! In einem<br />
Vorstadtbus, mit dem er im Sommer vom Stausee zurückgekommen<br />
ist, an einem Juliabend, hat er den Fahrer überfallen.<br />
Der Bus stand an der Wendeschleife, und Pajda und sein<br />
Kumpel wollten noch was trinken und ein bisschen herumfahren.<br />
Der Fahrer hat sie gebeten, auszusteigen, denn es<br />
gibt ein Gesetz, das besagt, dass man an der Wendeschleife<br />
aussteigen muss. Da hat Pajda sein Messer gezogen und den<br />
Fahrer verletzt, der ins Krankenhaus musste, und so haben<br />
Pajda und sein Kumpel es zu einem Steckbrief gebracht.<br />
„Oh, hier“, sagte der Mann im aufgeknöpften Mantel.<br />
„Hier hatte er sein Zelt.“<br />
Vom Zelt war nur die organische Hülle geblieben: ein<br />
paar kahle Zweige, die an einem Balken zwischen zwei nebeneinanderstehenden<br />
Bäumen befestigt waren.<br />
„In diesem Zelt haben sie ihn geschnappt. Die Geliebte,<br />
ihre beiden Kinder, ein und drei Jahre alt, ja und diese<br />
Schwangerschaft, ich weiß nicht, wie man das mitzählen<br />
soll. Handys, Schmuck, DVDs.“<br />
„DVDs?“<br />
„Leider. Den ganzen Sommer haben sie hier gewohnt.“<br />
Mir fiel ein, ich könnte den Mann im aufgeknöpften<br />
Mantel beim nächsten Mal fragen, ob er der Mann aus der<br />
Anzeige ist. In unserem Treppenhaus hängt eine Vermisstenanzeige<br />
aus, es wird jemand gesucht, der auch hier gewohnt<br />
hat und jetzt verschwunden ist, aber ich kann auf<br />
dem Foto, oder eigentlich der Kopie von dem Foto, nicht<br />
genau erkennen, wie dieser Mann aussehen soll. Übrigens<br />
kann ich sowieso sehr schlecht Gesichter wiedererkennen,<br />
ich frage viel lieber einfach, ob jemand jemand ist, oder<br />
jemand anderer, oder überhaupt niemand.<br />
An Pajda denke ich hauptsächlich unter der Dusche.<br />
Meine Wohnsiedlung hat eine defekte Warmwasserinstallation,<br />
jedenfalls beurteile ich das so. Aber es ist auch<br />
möglich, dass meine Nachbarn von unten sich einfach seltener<br />
waschen. Wenn ich dusche, muss ich zwei Minuten<br />
warten, bis das Wasser so aus dem Hahn fließt, wie ich<br />
es angefordert habe, nämlich warm. Zuerst kommt kaltes<br />
Wasser, dann abwechselnd kaltes und heißes, schließlich<br />
stabilisiert sich die Temperatur und ich kann mich<br />
waschen. Wie man es auch nimmt, das ist für mich sehr<br />
lästig, und genau dann denke ich am häufigsten an Pajda<br />
in seiner Hütte.<br />
Ich denke auch an Pajdas Geliebte. Ich war noch nie<br />
schwanger, aber ich kann mir vorstellen, dass Hygiene in<br />
dieser Zeit entscheidend ist. Denn über Kinder wiederum<br />
habe ich gelesen, dass sie dreckig glücklich sind. Wasser<br />
laufen zu lassen, bis das mit der richtigen Temperatur<br />
kommt, ist unökologisch, aber daran will ich gar nicht<br />
denken. Eine Hütte aus Zweigen dagegen ist ökologisch,<br />
und an sie denke ich die ganze Zeit.<br />
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes
PAWEŁ<br />
POTOROCZYN<br />
IRREN IST<br />
MENSCHLICH<br />
Paweł Potoroczyn (geb. 1961), Diplomat, Verleger,<br />
Musik- und Filmproduzent. Er war Konsul in<br />
Los Angeles und Direktor der Polnischen Kulturinstitute<br />
in New York und London. Seit 2008 ist<br />
er Direktor des Adam-Mickiewicz-Instituts, einer<br />
Institution, deren Auftrag die Verbreitung der polnischen<br />
Kultur im Ausland ist. Irren ist menschlich<br />
ist sein literarisches Debüt.<br />
Ein spätes, überraschendes Debüt. Irren ist menschlich ist der<br />
Versuch, die Geschichte der polnischen Gesellschaft nicht mit<br />
Blick auf „den Hof“, sondern auf das Dorf zu skizzieren – auf<br />
Bauern, Juden, Pfarrer, Partisanen und natürlich volkstümliche<br />
Frauen. Das Dorf heißt Piórków. Seine Bewohner sind<br />
die Piórkówer; eine düstere, rachsüchtige, von Instinkten<br />
geschüttelte Gemeinschaft aufrechter Menschen, die übereinander<br />
wachen und sich über ganze Generationen hinweg<br />
Leid antun, ganz menschlich, ganz normal. Irren ist menschlich<br />
wurde von der Kritik gut aufgenommen, das Buch ist in einer<br />
sorgfältig präparierten, stilisierten, geschmeidigen Sprache<br />
geschrieben, die bäuerliche Wirklichkeit, Ironie des Autors<br />
und eine Umwertung der heroisch-martyrologischen polnischen<br />
Matrize miteinander vereint. Ein Element der Erzählung<br />
ist die groteske Deutlichkeit, die spöttische Reduktion<br />
nationaler Motive – beispielsweise des Widerstands gegen die<br />
deutschen Okkupanten – auf das Konkrete, die Erde, den Körper.<br />
Alles beginnt mit einem Begräbnis, denn, wie wir lesen,<br />
„die Begräbnisse in Piórków waren lebendiger als Hochzeiten,<br />
der Kinematograph oder die Elektrizität“. Dieser ländliche<br />
Brauch – denn auf eine Beerdigung geht jeder, es gibt weder<br />
Eintrittskarten noch Einladungen, und wenn ein Feind bestattet<br />
wird, dann ist es „die reine Freude“ – scheint eine Figur für<br />
die Existenzweise der gesamten polnischen Gemeinschaft zu<br />
sein, die sich auf Trauerrituale konzentriert und den finsteren,<br />
ursprünglichen Jähzorn hinter lobpreisenden Bildnissen<br />
des Erlösers und Marias verbirgt. Für den Autor von Irren ist<br />
menschlich gehört das Brauchtum der bäuerlichen Kultur an<br />
sich weder dem sacrum noch dem profanum an. Diese Sphären<br />
sind genauso von Zufall, Schicksal und Psychologie geprägt<br />
wie die Geschichte, die das Dorf überrollt. Gut und Böse<br />
hausen und mischen sich immer und überall. Die Pendelbewegung<br />
von Leben und Tod, dargestellt von durch das Dorf<br />
ziehenden Hochzeits- und Trauerzügen, ist weder in der Lage,<br />
das ungleiche Ausmaß der Tugenden und Missetaten zu beurteilen,<br />
noch es zu erfassen oder zu bändigen. Das eine besteht<br />
für sich und das andere besteht für sich.<br />
Im Roman sind mehrere zentrale Handlungsstränge verflochten,<br />
der markanteste von ihnen schildert die Liebesbeziehung<br />
von Jaś Smyczek, einem Musiker und Weiberhelden,<br />
und Wanda, der schönen Bäckerin. Das Leben in Sünde verzeihen<br />
weder der Pfarrer noch das Dorf, aber Smyczek stirbt in<br />
der ersten Szene des Romans, getroffen von einer deutschen<br />
Kugel, als Partisan. Wir dringen in die Vergangenheit vor,<br />
ins Gewirr der Piórkówer Schicksalswege. Von vornehmen<br />
Herren, Bauern und Juden, ja sogar von Deutschen. Es gibt<br />
hier Kommunistinnen, Künstler und Weltenbummler. Potoroczyn<br />
schreibt eine neue Dorfprosa, befreit von Eindeutigkeit<br />
und religiösem Patriarchalismus. Er wandelt die Traditionen<br />
Reymonts, Kawalec’ und Myśliwskis ab, aber man erkennt in<br />
dieser Prosa auch eine an Gombrowicz gemahnende Ironie<br />
und die deutlichen Rhythmen der lokalen Erzählungen Jerzy<br />
Pilchs. Die verborgene „Seite“ von Irren ist menschlich ist die<br />
Kunst, die Frage danach, wer Künstler ist und wer diese Rolle<br />
nur anstrebt, sich in ihr ausprobiert. Diese Fragen des frischgebackenen<br />
Autors sind reich an Selbstironie.<br />
Kazimiera Szczuka<br />
PAWEŁ POTOROCZYN<br />
„LUDZKA RZECZ”<br />
GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL<br />
WARSZAWA 2013<br />
123×195, 352 PAGES<br />
ISBN 978-83-7747-833-2<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL
IRREN IST<br />
MENSCHLICH<br />
Das Briefchen<br />
von Pfarrer Morga an Gutsherrn Radecki enthielt nur zwei<br />
Sätze. Erstens: „Grzegorz, am Samstag kündige ich mich<br />
zum Nachmittagskaffee und zur Préférence an.“ Und zweitens:<br />
„Was auch immer Du für den Unglückseligen tun wirst,<br />
der Dir dieses Briefchen überreicht, tu es, als tätest Du es<br />
für Deinen Bruder und mich selbst.“<br />
Beide Sätze nahm sich der Gutsherr zu Herzen. Für den<br />
Nachmittagskaffee legte er sich ins Zeug wie für ein Abendmahl:<br />
Steinpilzsuppe, Zander und Ente, Mohnkuchen, Honigwein,<br />
Liköre und Starka, für die Préférence war der<br />
Abend zu kurz. Smyczek wies er an, auf dem Dachboden<br />
Quartier zu beziehen, aber im Gutshof. Als die Britschka,<br />
die Morga nach Hause brachte, in der Pappelallee verschwunden<br />
war, machte er sich daran, ein Empfehlungsschreiben<br />
an einen Freund der Familie aus alten Tagen<br />
aufzusetzen.<br />
Herr Radecki hatte keinen Grund, Smyczek zu mögen.<br />
Er mochte ihn nicht, weil Wanda die Avancen des Gutsherrn<br />
zurückgewiesen hatte, obendrein zwei Mal. Einmal<br />
nach dem Tod des Bäckers, als sie vor den Menschen Trauer<br />
trug und es unter dem Federbett, wie sich herausstellte,<br />
mit Smyczek trieb. Und zum wiederholten Mal, als Jaś in<br />
Tarnów im Gefängnis saß.<br />
Er mochte ihn nicht, weil er zur Jagdzeit, wenn er den<br />
Gästen Rebhuhn oder Hasen auftischen wollte, Smyczek holen<br />
lassen musste, er selbst hätte nicht mal aus fünf Schritt<br />
Entfernung den Heuwagen getroffen.<br />
Er mochte ihn nicht, weil er ihn, nachdem er den Halunken<br />
bei sich aufgenommen hatte, unwillkürlich, sogar<br />
gegen seinen Willen, besser behandelte als den Rest der Dienerschaft,<br />
sogar besser als die Hausbewohner, damals war<br />
der Gutshof in Olszany noch ein Haus gewesen. Er mochte<br />
ihn nicht, weil er, nachdem er Smyczek den Flügel gezeigt<br />
hatte, dem er noch nie reine Klänge hatte entlocken können,<br />
das Instrument und den Rest seines Überlegenheitsgefühls<br />
verloren hatte.<br />
Nun, er mochte ihn ganz einfach nicht.<br />
Der Gutsherr wäre bereit gewesen für Talent über Leichen<br />
zu gehen, für irgendein Talent, für einen Talentersatz,<br />
für den Schatten eines Talents, in einer beliebigen Kunst,<br />
in der zu betätigen es sich schickte. Er konnte Noten lesen,<br />
aber kein Instrument spielen, allerhöchstens konnte<br />
er assistieren, die Seiten umblättern, sich beim Pianisten<br />
mit einer vielsagenden Verbeugung revanchieren, die zu<br />
verstehen gab, dass er mindestens ein ihm ebenbürtiger<br />
Künstler war, der sich nur aufgrund seiner Schüchternheit<br />
mit der Nebenrolle abfand, einer Verbeugung, welche die<br />
Überzeugung zum Ausdruck brachte, dass wahre Genies
escheiden und nur Talentierte hochmütig sind. Die Ermattung<br />
in seiner Darbietung war so überzeugend, er ließ so<br />
aufrichtig die Augenlieder sinken und legte seinen Kopf in<br />
den Nacken, er warf die Schöße seines Gehrocks mit einer<br />
solch vollkommenen Bewegung hinter sich, wenn er sich<br />
auf das Stühlchen im Rücken des Pianisten setzte, dass es<br />
schien, als sei der Maestro in den Gutshof gekommen, um<br />
der Hausmusik die Ehre zu erweisen. Die Etüden des Gutsherrn<br />
waren so suggestiv, dass ohne Zweifel ein Teil des<br />
Applauses, verdientermaßen und gerechterweise, ihm galt.<br />
Von seiner frühen Jugend an bis ins reife Alter versuchte<br />
sich der Gutsherr in der Poesie, von der Annahme ausgehend,<br />
dass diese keiner angeborenen Begabungen bedarf<br />
wie die Musik oder die Malerei, dass die Worte genauso<br />
Tauben und Blinden zugänglich sind und die Bedeutungen<br />
gerecht verteilt sind zwischen allen, die die Schrift beherrschen.<br />
Die Annahme war ebenso falsch wie seine Poesie,<br />
ohne Rücksicht darauf, ob er Oden auf Russisch schrieb,<br />
englische Sonette oder ein Haiku. Die verheerende Neigung<br />
zur Pointe, der Fallstrick der Lyrik, machte das zunichte,<br />
was Herr Radecki selbst als Wesen der Poesie ansah – die<br />
Freiheit von den der Literatur auferlegten Pflichten und die<br />
Freiheit des eigenen Ausdrucks. Die Rhythmen, Melodien<br />
und Farben, jenen vorbehalten, denen das Schreiben die<br />
allergrößte Schwierigkeit bereitet, und irgendwie gegenwärtig<br />
in seinen Gedichten, erklangen in allen Sprachen mit<br />
dem leichten blechernen Echo eines Emailleeimers.<br />
Malen konnte er wohl, aber es verriet ihn eine künstliche<br />
Distanz, die bewirkte, dass nicht einmal die schlechtesten<br />
Bilder aussahen, als hätte sie ein Weitsichtiger gemalt,<br />
der vier Schritte von der Leinwand entfernt stehen muss,<br />
um zu erkennen, welche Formen und Farben sich darauf<br />
ereignen, von Nahem hingegen sieht er nichts als Striche<br />
und Farbpartikel. Vielleicht konnte er es auch, aber mochte<br />
es nicht, es sei denn schüchterne Akte kleiner Jungen, deren<br />
zarte, in banalen Posen erstarrte Substanz die kognitive<br />
Unsicherheit beweist und deren kleine Münder und große<br />
Glieder den Zwiespalt des Künstlers erkennen lassen. Die in<br />
größtem Maße unangenehmen Bemühungen um Modelle<br />
trugen auch erheblich dazu bei, dass er selten und furchtsam<br />
malte.<br />
Das Unglück des Gutsherrn und der Fluch seiner sorgfältigen<br />
Ausbildung und seines wahrhaft guten Geschmacks<br />
war es, dass er sich dessen bewusst war. Was er leider nicht<br />
wusste, war, dass man, um sich ausdrücken zu können, wissen<br />
muss, wer man ist.<br />
Das Singen hatte er noch als Junge aufgegeben, als er<br />
eine gewisse Verlegenheit in den Gesichtern der eigenen<br />
Eltern bemerkte. „Du musst nicht singen, mein Sohn“, sagte<br />
die Mutter, „erzähl uns das doch vielleicht lieber.“<br />
Der Gutsherr hatte sich oft Gedanken darüber gemacht,<br />
warum Morga, letztlich ein Zugezogener – und für die Radeckis<br />
und Gieskaners, deren Wurzeln in jener Gegend<br />
vierhundert Jahre zurückreichten, ganz einfach ein Landstreicher<br />
–, warum Morga eine solche Geltung unter den<br />
Bauern besaß, dass sie alles, was er befahl, sofort taten, und<br />
das manchmal sogar ohne Murren und das übliche Meckern.<br />
Er war weder besonders klug noch gelehrt, in seiner Überheblichkeit<br />
gnadenlos, wenn auch auf seine Art gerecht.<br />
Wenn ihm wenigstens das Alter die Autorität verliehen<br />
hätte, aber Morga war nicht einmal sehr alt. Vielleicht genoss<br />
er deshalb weniger Respekt bei den Frauen, für die ein<br />
lebhafter Kerl, und sei es im Kleid, immer nur ein Kerl sein<br />
wird, vor allem wenn er keusch ist, denn nichts steigert die<br />
Neugier der Weiber so wie Lust- und Kraftlosigkeit, und<br />
nichts schwächt den Respekt mehr als diese Neugier. Und<br />
vielleicht wurde er aus demselben Grund von den Bauern<br />
geachtet, weil er noch nicht alt war, aber freiwillig schon<br />
so gut wie auf der anderen Seite.<br />
Bei alledem hatte der Gutsherr, ohne den Gehorsam<br />
Smyczeks zu verstehen, der auf Befehl Morgas die schönste<br />
Frau verlassen hatte, die er jemals gesehen hatte, seine<br />
eigenen Gründe und Verpflichtungen dafür, auf den Pfarrer<br />
zu hören. Er schrieb also einen Brief, der mit den Worten<br />
begann: „Werter Onkel, vergib mir, dass ich mich direkt an<br />
Ihn wende, aber ich habe keine Beziehungen im gunbatsu.<br />
Seit unserem letzten Treffen in den Gärten des Kaiserpalastes<br />
habe ich gnädigen Onkel um nichts gebeten, und ich<br />
würde niemals Seine Zeit in eigener Angelegenheit vergeuden<br />
oder Ihm Unannehmlichkeiten bereiten, doch die Zeit<br />
ist gekommen, dem einfachen Menschen zu helfen, den<br />
gnädiger Onkel damals erwähnte.“<br />
Der Brief endete mit den Worten: „... sonst kommt er<br />
wieder in den Knast, es ist eine Frage der Zeit.“<br />
Die Rechnung des Gutsherrn war einfach wie ein<br />
Stummfilm im Tschenstochauer Kinematographen. Im<br />
ersten Akt begibt sich der schändliche Smyczek in die verdiente<br />
Verbannung. Im zweiten legt der Gutsherr Wanda<br />
die Welt zu Füßen (berauschend schnelle Schlittenfahrt<br />
auf glitzerndem Schnee, die Sonne in den Baumkronen). Im<br />
dritten Akt erliegt Wanda dem Gutsherren (alles beginnt<br />
im Kreis herumzuwirbeln), im vierten plagen sie Gewissensbisse<br />
(Untertitel: Ach, was habe ich nur getan), doch der<br />
Gutsherr bittet um ihre Hand (der Verlobungsbrillant im<br />
Kerzenschein).<br />
Fünfter Akt: Der schändliche Smyczek erweist sich als<br />
unschuldig und flieht, insgeheim unterstützt durch den<br />
Gutsherrn, aus der Verbannung, aber er fügt sich in sein<br />
Schicksal und der Gutsherr heiratet Wanda.<br />
Oder:<br />
Fünfter Akt: Der zu Unrecht verurteilte Smyczek kehrt<br />
aus der Verbannung heim und vergibt Wanda, der Gutsherr<br />
bietet den Neuvermählten in einem Anfall von Reue eine<br />
großzügige Reise an.<br />
Oder:<br />
Fünfter Akt: Smyczek heiratet eine andere oder fällt im<br />
Krieg, der unglückliche Gutsherr löst unter dem Druck der<br />
Familie und Gesellschaft die Verlobung, Wanda schleudert<br />
den Ring in den Teich von Piórków und schluchzt ob ihres<br />
Schicksals (O was bin ich unglücklich!).<br />
Eine Antwort des Marschalls ist nie eingetroffen, obwohl<br />
der Brief Wirkung gezeigt hat. Nach zwei Monaten<br />
kam ein Militärkurier auf einem Motorrad zum Gutshof<br />
und brachte den Einberufungsbescheid für Smyczek.<br />
Das erste Mal unterschrieb Jaś einen Brief an Wanda<br />
mit einem Violinenschlüssel. Ohne aus dem Beiwagen des<br />
Motorrads zu steigen, gab er ihn Wawerek mit der Bitte,<br />
ihn zu überreichen. Wawerek erklärte sich einverstanden,<br />
zog den Hut und ging in Richtung Zatylna. Smyczek<br />
setzte vorschriftsmäßig die Brille auf, das Motorrad heulte,<br />
qualmte, wendete auf der Stelle und verschwand dann auf<br />
dem Weg nach Broniszewska in einer Staubwolke und dem<br />
aufregenden violetten Gestank der Abgase.<br />
Aus dem Polnischen von Benjamin Voelkel
HUBERT<br />
KLIMKO-DOBRZANIECKI<br />
GRIECHEN STERBEN<br />
ZU HAUSE<br />
Hubert Klimko-Dobrzaniecki (geb. 1967),<br />
Schriftsteller und Lyriker, lebt seit vielen Jahren<br />
im Ausland (unter anderem auf Island, gegenwärtig<br />
in Österreich). Er schrieb mehrere Erzählungen<br />
und Romane, bisher erschienen von ihm<br />
neun Bände. In seinen Werken wimmelt es geradezu<br />
von Sonderlingen, Verrückten, Eigenbrötlern,<br />
entwurzelten und verkrachten Existenzen,<br />
die entweder unfähig oder unwillig sind, einen<br />
festen Platz im Leben zu finden.<br />
Nach dem Ende des griechischen Bürgerkriegs und der Niederlage<br />
der linken Volksfront kamen Ende der 40er- und Anfang<br />
der 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts mehrere<br />
Tausend politischer Flüchtlinge nach Polen. Die meisten von<br />
ihnen siedelten sich in Niederschlesien an, z. B. in Bielawa, wo<br />
auch Hubert Klimko-Dobrzaniecki seine Kindheit und frühe<br />
Jugend verbrachte. Der Autor erzählt in seinem neuesten Roman<br />
von ebenjenen damaligen „Bielawa-Griechen“ und greift<br />
damit erneut ein Thema auf, das ihm sehr am Herzen liegt:<br />
die schmerzhafte Erfahrung eines Lebens in der Emigration.<br />
Das zentrale Thema ist das Gefühl des Fremdseins und der<br />
Wurzellosigkeit – übrigens in zweifacher Hinsicht. Der Held<br />
des Romans, Sakis Sallas, gilt in Polen, obwohl er in diesem<br />
Land geboren, zur Schule gegangen und vollständig assimiliert<br />
ist, sein Leben lang als ein Fremder. Als er 1980 in das<br />
Land seiner Vorfahren zurückkehrt, macht er dieselbe Erfahrung:<br />
In den Augen der Griechen ist er ein „Polonos“. Doch<br />
ist dies der Grund dafür, dass sein Privatleben eine einzige<br />
Abfolge von Misserfolgen ist? Wir begegnen ihm als einem<br />
verbitterten Fünfzigjährigen, ehemaligen Journalisten einer<br />
Athener Tageszeitung und beginnenden Schriftsteller, wie<br />
er gerade auf einer griechischen Insel ankommt, um im dortigen<br />
Schriftstellerhaus einen Roman über seine Eltern zu<br />
schreiben. Es geht ihm jedoch nicht darum, das Andenken<br />
seines über alles verehrten Vaters und seiner über alles geliebten<br />
Mutter zu wahren und einen nostalgischen Blick auf<br />
seine glückliche und unbeschwerte Kindheit zu werfen – das<br />
Buch soll vielmehr eine private Spurensuche werden. Sakis<br />
leidet darunter, dass er nur wenig über die Vergangenheit<br />
seiner Eltern weiß, die bis zu ihrem Tod nie über ihr Leben<br />
vor der Emigration gesprochen haben. Er hegt zu Recht den<br />
Verdacht, dass sie ein dunkles Geheimnis mit sich herumtrugen,<br />
dass sich hinter ihrer Ehe noch etwas anderes verbarg.<br />
Das schreckliche Geheimnis kommt im Finale des Romans ans<br />
Licht und stürzt den Helden endgültig in eine Krise.<br />
Die Geschichte des Romans entwickelt sich auf zwei Ebenen,<br />
der Vergangenheit und der Gegenwart. Die erste Ebene<br />
besteht aus zahlreichen, überwiegend humorvoll erzählten<br />
Kleinstadt-Anekdoten, in deren Mittelpunkt Sakis' exzentrischer<br />
Vater – ein unverbesserlicher Träumer und Fantast<br />
– steht. Daneben finden sich ergreifende Familienszenen. Auf<br />
der Gegenwartsebene geschieht hingegen nur wenig: Sakis<br />
geht Affären mit einer Bewohnerin und schließlich mit der<br />
Leiterin des Schriftstellerhauses ein, doch diese lassen sich<br />
kaum als Beziehungen bezeichnen. Eris und Maria führen<br />
dem Helden lediglich den Grad seiner emotionalen Verkrüppelung<br />
vor Augen.<br />
Alles in allem muss man festhalten, dass es in Griechen sterben<br />
zu Hause in erster Linie um die Gefühlswelten der Figuren<br />
geht und dass das „Griechentum“ – sowohl in geschichtlicher<br />
als auch in kultureller Hinsicht – lediglich als Kulisse dient.<br />
Im Vordergrund stehen familiäre Gefühle, vor allem die Beziehung<br />
zwischen Eltern und Kind, das Phänomen einer erfüllten<br />
Vaterschaft einerseits und die nach dem Tode des Vaters entstandene<br />
Leere andererseits. Das Letztere erscheint besonders<br />
wesentlich, weil Sakis' Vater gleich zweimal stirbt – zunächst<br />
real und später symbolisch, als die schreckliche Wahrheit<br />
über seine Vergangenheit in Griechenland zufällig ans Licht<br />
kommt.<br />
Dariusz Nowacki<br />
HUBERT KLIMKO-DOBRZANIECKI<br />
„GRECY UMIERAJĄ W DOMU”<br />
ZNAK, KRAKÓW 2013<br />
140×205, 244 PAGES<br />
ISBN: 978-83-240-2073-7<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
AGENCE LITTÉRAIRE PIERRE<br />
ASTIER & ASSOCIÉS
GRIECHEN<br />
STERBEN<br />
ZU HAUSE<br />
MEIN VATER<br />
nahm verschiedene Arbeiten an. Er konnte einfach nicht so<br />
wie Mama. Egal ob krank oder gesund. Auf den Gongschlag<br />
oder sogar etwas früher. Immer dasselbe. Tagein, tagaus.<br />
Rhythmus war nicht Papas Ding. Papa war ein König, Eigentümer<br />
eines grünen Throns, von dem er sich selbst nach<br />
dem Umzug nicht trennte. Er liebte Veränderungen, Bewegung,<br />
den Strudel des Lebens. Es musste immer etwas los<br />
sein. Irgendein kleines Chaos, eine Minirevolution, schließlich<br />
stellte sich Papa, Paps, Papschen, Papachen stets als Revolutionär,<br />
als Partisan aus den fernen Bergen vor. Da half<br />
er lieber beim Ausladen. Wenn der Zug in den Bahnhof einfuhr,<br />
war er immer der Erste. Wenn etwas umfiel, zerbrach<br />
oder nicht ankam, entwickelte er eine solche Kraft, dass er<br />
alles ganz allein aufheben, reparieren, zusammensetzen, hineinlegen<br />
oder herausnehmen wollte. Und hinterher kehrte<br />
er erschöpft, aber glücklich, mit Geld in der Tasche, nach<br />
Hause zurück. Dann gab er mir eine Münze und sagte: „Junge,<br />
hier hast du Geld, gutes, ehrlich verdientes Geld. Geh in<br />
die Konditorei und kauf dir etwas Süßes, und denk auch an<br />
deine Mutter, denk an den Windbeutel. Für deine Mutter<br />
einen Windbeutel, und für dich, was immer du willst.“ Und<br />
ich machte mich auf den Weg, mit meiner goldenen Münze,<br />
die der Herrscher der Meere und Ozeane mir dargereicht<br />
hatte. Manchmal blieb sogar noch etwas übrig.<br />
Später bekam er es mit dem Kreuz. Er wurde nun einmal<br />
älter. Man muss dazusagen, dass es noch mehr von uns<br />
in der Stadt gab, aber Papa traf sich nicht gern mit ihnen.<br />
Sie stammten von einem anderen Berg, aus einem anderen<br />
Wald, und hatten einen anderen Blick auf die Dinge. Vielleicht<br />
einen pragmatischeren Blick, außerdem ziemte es<br />
sich für einen König nicht, sich unter das gemeine Volk zu<br />
mischen. Einige von ihnen bezeichnete er als Verräter, weil<br />
sie zum Katholizismus übergetreten waren. Einige glaubten<br />
sogar an Gott, und andere waren nicht aus seiner Einheit.<br />
Jene hatten sich, aus was für Gründen auch immer, für die<br />
Tschechoslowakei entschieden. Sie waren irgendwo auf dem<br />
Weg zurückgeblieben und man hatte nie wieder etwas von<br />
ihnen gehört. Auch Mama war zum Katholizismus übergetreten,<br />
ging in die Kirche und ließ mich sogar taufen. Angeblich<br />
hatte mein Vater daraufhin einen Monat lang nicht<br />
mir ihr gesprochen. Aber sie war eben anders und durfte tun,<br />
was sie wollte, denn mein Vater war ihr dankbar für ihren<br />
Fleiß, vor allem jedoch für ihre Liebe. Als wir es sehr schwer<br />
hatten, noch ganz am Anfang, sagte Mama immer: „Wir haben<br />
Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch, wir werden schon<br />
nicht verhungern.“ Irgendwie schaffte sie es, meinem Vater<br />
aus diesen wenigen Zutaten alles Mögliche auf den Teller zu<br />
zaubern. „Was gibt es heute zu Mittag?“ „Heute, mein Liebs-
ter, gibt es gefüllte Weinblätter.“ Und Mama rieb Kartoffeln,<br />
gab ein Ei hinzu, ein wenig Knoblauch, Salz und Pfeffer,<br />
wickelte alles in dünne Zwiebelschichten ein und schob es<br />
in den Ofen. Siehe da, Dolmadakia Yalantzi! Ich sehe, wie<br />
Papa versucht, sich die Kartoffeln wegzudenken. Er genießt,<br />
lässt sich die gefüllten Weinblätter auf der Zunge zergehen,<br />
schluckt sie langsam hinunter. Jetzt ist er zu Hause, also dort.<br />
Die Sonne scheint, ein leichter Wind weht. Nach einer Weile<br />
hebt er die Augen zum Himmel und sagt, dass ein Wölkchen<br />
aufzieht, aber sicher gleich wieder vorüberzieht, und er lädt<br />
sich noch etwas von dem zauberischen Blendwerk auf seine<br />
Gabel. Und wieder kaut er langsam. Schluckt hinunter.<br />
„Hervorragend, Schatz, hervorragend. Eine ausgezeichnete<br />
Vorspeise. Und was gibt es als Hauptgang?“ „Na, was schon?<br />
Dein Lieblingsessen!“ „Nein?! Du hast Rindfleisch mit Kastanien<br />
gemacht?!“ In der Pfanne schmoren bereits in Scheiben<br />
geschnittene Kartoffeln. Mama lässt sie langsam goldbraun<br />
werden, von beiden Seiten. Bestreut sie mit Pfeffer und Salz.<br />
Legt sie auf einen Teller. Im Bratfett planschen bereits die<br />
Zwiebeln, und Mama gibt noch einen Löffel Zucker hinzu,<br />
sodass sie glänzend und goldbraun werden. Dann verteilt sie<br />
alles auf die Kartoffeln und streut noch ein wenig gehackten<br />
Knoblauch darüber. Kreas me Kastana! Papa gehen die<br />
Augen über. Jetzt lässt er sich nicht mehr so viel Zeit wie<br />
mit der Vorspeise. Sein Bart gerät in Wallung, hängt in den<br />
Teller. Das Rindfleisch mit Kastanien verschwindet im unermesslichen<br />
Magen meines Königs der Meere. „Und zum<br />
Nachtisch? Gibt es etwas zum Nachtisch?“ „Ich kann dir<br />
Revani machen, aber ohne Grieß, nur die Orangenzesten.“<br />
„Gerne.“ Mama nimmt ein paar steinhart getrocknete Orangenzesten,<br />
die sie wer weiß wo herhat, wahrscheinlich noch<br />
von den Deutschen. Sie legt sie in eine Pfanne, begießt sie<br />
mit kochendem Wasser, gibt etwas Fett und einen Teelöffel<br />
Zucker dazu. Fertig ist der Nachtisch. Der beste Nachtisch<br />
der Welt. Papa dankt ihr. Bürstet Mamas abgearbeitete<br />
Hände mit seinem roten Bart. Papas Bürstenbart auf Mamas<br />
Handflächen ist der schönste Dank. Nach diesem königlichen<br />
Mahl, durch das sich meinem Poseidon neue Gehirnwindungen<br />
erschlossen haben, denn es war reichlich Zucker<br />
darin gewesen, schön und festlich war es gewesen, sagt Papa<br />
zu Mama: „Ausladen ist nichts mehr für mich. Ich werde alt.<br />
In die Fabrik will ich auch nicht. Dort würde ich mich zu<br />
Tode langweilen, feste Arbeitszeiten würde mich umbringen.“<br />
„Und? Was willst du dann machen?“ Der König kratzt<br />
sich den Bauch. Streicht über seinen Bart. Steckt sich eine<br />
Zigarette in den Mund. Zündet ein Streichholz an. Blickt in<br />
die Flamme. Versinkt in Gedanken, bis das Streichholz von<br />
allein wieder verlischt. Die Rauchfahne legt sich über das<br />
Rote Meer. Verfängt sich in den Wellen und verschwindet in<br />
der Tiefe. „Ein Warszawa“, sagt er. „Einer aus Dół will seinen<br />
Warszawa verkaufen.“<br />
Als es meinen Eltern etwas besser ging, weil Vater ein<br />
wenig beim Kartenspiel gewonnen und ein wenig beim<br />
Ausladen verdient hatte, und weil Mama in der Spinnerei<br />
ständig zweihundert Prozent der Norm schaffte, und weil<br />
sie sich etwas zusammengespart, zusammengeliehen und<br />
ich weiß bis heute nicht, was sie noch alles angestellt hatten,<br />
auf jeden Fall kauften sie sich einen ausgemergelten Warszawa.<br />
Grau war er, wie ganz Polen es damals war. Wie die<br />
gleichnamige Hauptstadt, in der Paps schon einmal gewesen<br />
war. In der griechischen Botschaft. Irgendetwas hatte er<br />
dort gewollt, irgendetwas zu erklären versucht, aber er war<br />
traurig und mit leeren Händen zurückgekehrt, und hinterher<br />
erzählte er. „Denen ihr Warszawa ist genau wie unser<br />
Warszawa, grau und traurig, und hin und wieder knurrt<br />
es wie ein herrenloser Hund. Voller Beton und Baustellen.<br />
Viel größer als unser Warszawa. Oh, viel größer. Du guckst<br />
auf den Rücksitz, durch die Heckscheibe, und die Stadt geht<br />
einfach immer und immer weiter. Man sieht kein Ende, und<br />
auch kein Ende ihrer Traurigkeit. Wenn sie wenigstens an<br />
einem Berg oder am Meer läge. Aber alles ist flach und eben,<br />
mein Junge, und keine Zikaden zirpen, nur die Milizionäre<br />
regeln mit ihren Trillerpfeifen und Schlagstöcken den Verkehr.<br />
Aber was sollen sie da schon regeln, alle fahren sowieso,<br />
wie sie wollen. Bei uns ist es viel schöner. Viel schöner …“<br />
Unser Warszawa wurde ein Taxi. Eines von nur vieren<br />
in der Stadt. Und mein Vater einer von nur vier Taxifahrern,<br />
dazu noch der einzige Ausländer. Er stand am Taxistand<br />
am „Plac Wolności” und wartete auf einen Anruf, denn es<br />
gab dort ein Telefon, so eine Art Telefonzelle, aber nur für<br />
Taxifahrer. Papa wartete auf einen Anruf von den reichen<br />
Leuten, denn die gab es auch bei uns. Manchmal kamen auch<br />
arme Leute, die in Not waren. Die fuhr Papa dann umsonst<br />
oder fast umsonst. Die, die kein Geld oder nur wenig Geld<br />
hatten, brachten ihm hinterher zum Dank alle möglichen Sachen.<br />
Von Lebensmitteln bis hin zu Weidenkörben. Wegen<br />
seiner Gutmütigkeit wurde mein Vater fast so etwas wie eine<br />
rotbärtige Legende, und es kam so weit, dass die Leute, die<br />
zum Taxistand kamen, nur noch mit dem Griechen fahren<br />
wollten. „Der Grieche ist gut. Kennt alle Straßen und spricht<br />
immer so komisch. Wenn du beim Griechen einsteigst, dann<br />
kommst du auch ans Ziel. Und wenn du kein Geld hast, dann<br />
wartet der Grieche, oder du gibst ihm irgendetwas anderes.“<br />
Wenn sie zu viert, also alle zusammen, am Taxistand<br />
warteten, und das Telefon klingelte, und mein Vater war<br />
gerade der Zweite, Dritte oder Vierte, also der Letzte in der<br />
Schlange, und der Erste nahm den Hörer ab, dann fragte die<br />
Stimme am anderen Ende meistens, ob der Grieche da sei,<br />
ob der Grieche kommen könne. Aber Paps war nicht dumm,<br />
Könige sind im Allgemeinen klüger als Taxifahrer, und Papa<br />
war ja nicht einfach ein Taxifahrer, sondern der König der<br />
Taxifahrer, also musste er in solchen Situationen auch königliche<br />
Entscheidungen treffen. Er wollte keinen Ärger<br />
mit den Jungs. Drei gegen einen. Da hatte er keine Chance,<br />
wohl aber hatte er einen Kopf auf den Schultern. Wenn also<br />
das Telefon klingelte, und Papa war nicht der Erste in der<br />
Schlange, und jemand verlangte nach dem Griechen, dann<br />
ließ er den Ersten sagen, der Grieche sei gerade unterwegs.<br />
Und wenn die Leute an den Taxistand kamen und sich in<br />
den grauen Warszawa drängten, dann tat er einfach so, als<br />
würde er die Kiste nicht in Gang kriegen. Doch damit nicht<br />
genug, mit der Zeit stieg der rotbärtige Poseidon zum Chef<br />
der Taxi-Mafia auf und lange Zeit war in der Stadt kein Platz<br />
für ein fünftes Taxi. Alle waren der Meinung, vier seien ausreichend.<br />
Ausreichend für die Stadt und ausreichend für sie.<br />
Einmal versuchte es doch einer. Er kaufte sich einen Wagen,<br />
meldete ihn an und erhielt eine Erlaubnis. Aber irgendwann<br />
hatte er Sand im Tank, obwohl er gar nicht ans Meer gefahren<br />
war. Und schon waren es wieder nur vier Taxis. Für viele<br />
Jahre. Und welchen Nutzen hatte Paps davon, dass ihn seine<br />
Kumpel vom Taxistand zum Mafia-Chef ernannt hatten? Gar<br />
keinen, der Posten brachte sogar eher Nachteile mit sich.<br />
Nachdem Paps das Zepter am Taxistand übernommen hatte,<br />
eröffnete er seinen Kollegen: „Ich machen Sonntag frei. Ihr<br />
machen Touren. Gut?“ Worauf jene ihm voller Verwunderung<br />
und Begeisterung antworteten: „Ja, ja, ja!“ Fortan liebten<br />
sie ihn noch mehr, denn so waren sie an jenem Tag einer<br />
weniger, und das mit Sonntagszuschlag.<br />
Aus dem Polnischen von Heinz Rosenau
BEATA<br />
CHOMĄTOWSKA<br />
HOLLAND<br />
OHNE NOT<br />
Beata Chomątowska (geb. 1976), Journalistin,<br />
Autorin einer historischen Reportage namens<br />
„Stacja Muranów” über einen auf den Ruinen des<br />
Ghettos erbauten Warschauer Stadtbezirk. 1999<br />
fuhr sie per Anhalter nach Holland, um im Rahmen<br />
eines „Tempus“-Stipendiums anderthalb<br />
Jahre lang in Breda zu leben und zu arbeiten.<br />
Von ihrem Aufenthalt brachte sie zahlreiche, in<br />
ihrem aktuellen Buch verwertete, interkulturelle<br />
Erkenntnisse mit. Zur Zeit arbeitet Chomątowska<br />
bereits an einem neuen Buch.<br />
Das holländische Breda klingt nicht so vertraut wie London,<br />
wo man keine Straße entlanggehen kann ohne Polnisch zu hören,<br />
sondern scheint eigentlich sogar recht exotisch. Genauso<br />
exotisch wie Chomątowskas irre Geschichten aus ihrem Buch<br />
„Holland ohne Not”. Die Autorin der großartigen historischen<br />
Reportage „Station Muranów”, in der es um einen auf den<br />
Trümmern des Warschauer Ghettos erbauten Stadtbezirk<br />
geht, kehrt dieses Mal zu ihren Erinnerungen an einen anderthalbjährigen<br />
Stipendienaufenthalt in Holland zurück.<br />
Aber das Buch ist dieses Mal keine Reportage – sondern eine<br />
so gewitzt gewobene Geschichte, dass sie sich jeglicher Gattung<br />
entzieht: Auch wenn die Autorin eingesteht, selbst fest<br />
im Boden der Realität verwurzelt zu sein, lassen ihre künstlerische<br />
Verarbeitung und ihr Erzähltalent das Breda-Buch<br />
Richtung Roman segeln.<br />
Die Protagonistin ist eine Studentin, die gegen Ende der<br />
1990er Jahre mit ihrem Freund nach Holland geht und sich<br />
auf die Suche nach Abenteuern macht, die einer jungen Frau<br />
aus gutem Hause – wie ihr –‐ normalerweise nicht gebühren.<br />
Die Rede ist hier natürlich von verschiedensten Genussmitteln,<br />
aber auch von einer Freiheit der Sitten, die in diesem<br />
liberalen Paradies das tägliche Brot ist. In Breda geht sie zwar<br />
zunächst auf die Uni (wobei sie ohne besonderen Enthusiasmus<br />
Bekanntschaft mit den Kommilitonen schließt und nur<br />
unter Schwierigkeiten zur Kenntnis nimmt, dass es so etwas<br />
wie das „akademische Viertel“ in diesem Land der hundertprozentigen<br />
Pünktlichkeit nicht gibt), aber vor allem jobbt sie<br />
in einer – wie sich bald herausstellt – Kultkneipe und schließt<br />
Bekanntschaft mit einer Gruppe schräger, im Freiheitskult<br />
aufgewachsener Freunde.<br />
Äußerst amüsant und lebhaft beschreibt Chomątowska die<br />
jugendlichen Irrungen und Wirrungen der beiden Hauptfiguren<br />
und deren stetige Verwunderung angesichts der krassen<br />
Unterschiede zwischen dem Leben in Holland und dem Leben<br />
in Polen. Dabei ruft sie manches Mal auch Erstaunen und<br />
nicht allzu ferne Erinnerungen beim Leser hervor. Ja, denn<br />
vor kaum länger als einem Jahrzehnt wunderten wir Polen<br />
uns noch, dass es schöne, saubere öffentliche Toiletten mit<br />
einem schwer auffindbaren, geheimnisvollen Spülknopf geben<br />
konnte, und eine Münze in Fremdwährung schien uns das<br />
höchste Luxusgut überhaupt.<br />
Das Buch ist ein ironisches, ehrliches und stellenweise<br />
auch ziemlich freches Portrait der jungen polnischen Emigration<br />
zu Ende der 90er, die so ganz anders ist als die Emigration<br />
vor der Wende – sie sucht im Ausland kein Asyl mehr und legt<br />
nicht immer und ewig nur Geld für eine Wohnung in Polen<br />
zurück, sondern versucht zunehmend forsch (wenn auch<br />
unentwegt mit Herkunftskomplexen kämpfend) ihr eigenes<br />
Leben zu leben und Teil des berühmten und mythenumwobenen<br />
Vereinten Europas zu werden, das ein paar Jahre später<br />
bereits unwiderrufliche Tatsache für uns sein sollte.<br />
Patrycja Pustkowiak<br />
BEATA CHOMĄTOWSKA<br />
„PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ<br />
POZNAJE SIĘ W BREDZIE”<br />
CZARNE, WOŁOWIEC 2013<br />
125×205, 336 PAGES<br />
ISBN: 978-83-75365-55-9<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
POLISHRIGHTS.COM
HOLLAND<br />
OHNE NOT<br />
So berauscht<br />
war ich von meinen neuen Bekanntschaften, dass ich kaum<br />
einen Gedanken an die bevorstehende Prüfung verschwendete.<br />
Trotzdem bestand ich sie, völlig unerwartet. Zwar lag<br />
mein Notendurchschnitt im untersten Bereich, aber wen<br />
kümmerte das, Hauptsache bestanden. Vor lauter Freude<br />
stürzte ich mich mit Feuereifer in die Aufgabe, die uns Meneer<br />
Hors für das zweite Semester erteilt hatte: Wir sollten<br />
einen Werbeplan für eine Firma entwerfen, die holländische<br />
Weine herstellte. Zuerst fuhren wir mit der ganzen<br />
Gruppe hin, um uns den Hof anzusehen und mit dem Produzenten<br />
das Notwendige zu besprechen. Natürlich erwartete<br />
uns vor Ort, auf einem großen Weingut in der Nähe<br />
von Tilburg, zunächst eine Weinprobe. Wir probierten<br />
abwechselnd weiße und rote Weine und beteuerten dabei,<br />
dass sie keinesfalls schlechter schmeckten als Weine aus<br />
den traditionellen Anbauländern – auch wenn wir uns ums<br />
Verrecken nicht erklären konnten, wie um alles in der Welt<br />
es dem Weinbauer in diesem feuchtkalten Klima gelang,<br />
auch nur diese Plempe herzustellen. Ehrlich gesagt war<br />
der Katzenjammer nach diesen Weinen hier nicht weniger<br />
heftig, als wenn man edlere Trünke wild gemixt hätte, und<br />
somit war das nicht einmal ganz gelogen. Ich fuchste mich<br />
in das Thema ein, dachte mir in freien Momenten Strategien<br />
aus, wie man wirklich Werbung für diesen holländischen<br />
Wein machen könnte, wo es ihn schon einmal gab,<br />
und teilte meine Gedanken mit P. – weißt du, das ist tatsächlich<br />
interessant –, vor allem aber nahm ich voller Eifer<br />
an der Gruppenarbeit teil. Dieses Mal war ich mit Viktor<br />
und Katelin zusammen. Wir hatten massenweise Ideen, angefangen<br />
damit, den Wein als originelles Mitbringsel aus<br />
Holland über die Touristeninformation VVV zu vertreiben,<br />
bis hin zu den Schachteln für die Flaschen, die an traditionelle<br />
Embleme anknüpfen sollten: Hering, Holzschuh oder<br />
Windmühle. Der beste Einfall sollte in die Tat umgesetzt<br />
werden. Wir waren sicher, dass unsere Gruppe gewinnen<br />
würde. Wir waren ganz einfach die Besten. Als schließlich<br />
der Tag der Präsentation gekommen war, mussten wir Viktor,<br />
der unsere Weisheiten zum Besten geben sollte, nicht<br />
einmal die Daumen drücken, denn wir wussten, dass er<br />
das spielend meistern würde. Und so war es auch. Er trat<br />
vor, verbeugte sich und legte eine Wahnsinns-Performance<br />
hin, eine schmissige Freestyle-Rede, eine gerappte Story<br />
über holländischen Wein, hielt bei den entscheidenden<br />
Stellen inne und nahm Gesten zur Hilfe, und im Hintergrund<br />
leuchteten im Takt seiner Worte Dias auf. Das alles<br />
dauerte mindestens eine Viertelstunde, fünfzehn Minuten<br />
Knochenarbeit für den gemeinsamen Sieg. Bei der Vorbereitung<br />
hatten wir natürlich mitgemacht, aber auf Viktor
waren wir am stolzesten. Der Auftritt war zu Ende, Viktor<br />
wischte sich den Schweiß von der Stirn und wartete auf<br />
donnernden Applaus. Doch im Saal blieb es still. Die Studenten<br />
starrten ihn in stummer Verzückung an, man sah,<br />
dass es ihnen gefallen hatte; die Juroren hatten undurchdringliche<br />
Mienen, als hätte der Wort- und Klangschwall<br />
sie in Stein gemeißelt. Meneer Hors kam als Erster zu sich<br />
und hob eine Nummerntafel. Null! Viktor kniff die Augen<br />
zusammen, der alte Trottel musste sich vertan haben, gleich<br />
würde er mit fahrigen Händen hinter sich greifen und sein<br />
Fehlurteil korrigieren. Nun zog auch der Rest mit schneller<br />
Bewegung die Tafeln hervor: Null, Null, fünf Mal die Null,<br />
nur Janka Kapusta hatte uns mitleidig zwei Punkte gegeben<br />
und erstarrte jetzt, erschrocken, dass sie sich so hatte erweichen<br />
lassen. – „Nein, nein, das ist doch nicht möglich!” –<br />
Viktor ließ noch einmal den Blick durch den Saal schweifen<br />
um sicherzugehen, dass er sich nicht täuschte. Katelin und<br />
ich taten dasselbe. – „Ach, fickt euch doch! Lul!”, schrie er<br />
wütend auf Holländisch ins Publikum und rannte aus dem<br />
Saal, dass seine blonden Haare flatterten. Seine Schritte<br />
hallten noch auf der Treppe, als Meneer Hors in beherrschtem<br />
Tonfall, als sei nichts geschehen, das Zeichen gab: „Die<br />
Nächsten, bitte”, und sich zurück auf seinen Platz setzte,<br />
bereit zum Urteil. Die restlichen Präsentationen waren<br />
korrekt und fad wie Haferschleim. Stammelnde Mädchen<br />
in Kostümen, Jungs in Anzügen mit 08/15-Powerpoint-Bildern.<br />
Alle bekamen anständige Noten. Irgendwas stimmte<br />
hier nicht, aber was, das begriff ich erst später, als ich selbst<br />
in der zweiten Prüfung bei Hors durchfiel, obwohl ich mich<br />
wirklich ins Zeug legte und eine Million toller Ideen für die<br />
Werbung von Branntwein made in Holland hatte. Er hörte<br />
sich meine Ausführungen an, ohne mit der Wimper zu zucken,<br />
und sagte dann: „Hm, irgendwo anders könnten deine<br />
unbestreitbaren Talente sicherlich gewinnbringend eingesetzt<br />
werden”, und als ich mich schon über dieses höchste<br />
Lob freuen wollte, trug er mir ein „Ungenügend” ein. Sein<br />
zweifelhaftes Kompliment hatte wie Honig die bittere Pille<br />
umhüllen sollen, damit ich sie ohne Murren schlucken würde.<br />
Niemand hier erwartete Kreativität von uns, für die man<br />
in Amerika belohnt worden wäre; es ging rein um die Einhaltung<br />
des Procedere. Viktor hatte gleich zu Anfang bewiesen,<br />
dass er nichts darauf gab, er hatte das beleid der Schule<br />
gebrochen, denn was besagte sein ständiges Zuspätkommen<br />
sonst? Er hatte die Idee unserer Gruppe übertrieben theatralisch<br />
vorgestellt und damit seine Ignoranz gezeigt: Nach<br />
den unzähligen Konferenzproben hätte er schließlich wissen<br />
müssen, dass das nicht gern gesehen würde. In Holland<br />
werden ernsthafte Zuhörer nicht mit rhetorischen Mitteln<br />
betört, sondern anhand eines festgelegten Schemas mit Argumenten<br />
überzeugt. Und dann hatte er noch die so sorgfältig<br />
erarbeitete gute Stimmung verdorben. Zur Prüfung<br />
erschien er gar nicht, also wurde festgesetzt, dass er nicht<br />
bestanden habe; über seine Person und den von einem Mantel<br />
taktvollen Schweigens bedeckten Vorfall wurde kein<br />
Wort verloren. Ich dagegen sollte einen Monat später zur<br />
Nachprüfung erscheinen. Keiner der Lehrenden bot an, mir<br />
zu helfen, ich musste selbst darum bitten. In Holland gilt<br />
ein jeder als erwachsenes Individuum, das für seine eigenen<br />
Taten verantwortlich ist und nicht an die Hand genommen<br />
wird – es sie denn, er gibt diesen Wunsch ausdrücklich zu<br />
verstehen, dann kommt die auf solche Eventualitäten vorbereitete<br />
Bürokratie ins Rollen und leitet die entsprechenden<br />
Verfahren ein. Von den Polen und Ungarn bot als einzige<br />
Katelin ihre Unterstützung an, selbst mein polnischer<br />
Verehrer machte sich in diesem Moment der Prüfung aus<br />
dem Staub, vielleicht hatte ich ihn erfolgreich verschreckt.<br />
Vom Rest der Leute konnte ich sowieso nichts erwarten. Sie<br />
waren zu der Zeit ohnehin mit einem ganz anderen Drama<br />
beschäftigt, das sich vor unseren Augen abspielte: Krisztina<br />
und Istvan hatten sich getrennt. Aber es war keine normale<br />
Trennung. Istvan hatte sich als Loverboy entpuppt.<br />
Mit dieser englischen Bezeichnung ist im holländischen<br />
Slang nicht etwa ein feuriger junger Liebhaber gemeint,<br />
sondern eine spezielle Art Zuhälter, die Jagd auf ausländische<br />
Mädchen macht. Dieser Zuhälter drückt sich bei Universitäten<br />
und Studentenkneipen herum und versucht, sich<br />
eine oder am besten gleich mehrere Studentinnen herauszupicken,<br />
die einen traurigen Blick haben und leicht verloren<br />
wirken. Er weiß, dass in solchen Milieus nur scheinbar<br />
alle zusammenhalten und es schwer ist, einen wirklichen<br />
Vertrauten zu finden; zu Hause ist weit weg, die Mädchen<br />
fangen an, sich nach jemandem vor Ort zu sehnen, der ihnen<br />
nah ist, dem sie alle ihre Kümmernisse anvertrauen<br />
können. Bei manchen sieht man das sofort, andere, wie<br />
Krisztina, verstellen sich und spielen die Selbstsichere,<br />
aber das wachsame Auge des Loverboys hat schon viele solche<br />
Fälle gesehen und fischt sie alle ohne Probleme aus der<br />
Menge heraus. Und weil er sein Terrain gut erkundet hat,<br />
weiß er ganz genau, dass die jungen Frauen aus Osteuropa<br />
in Westeuropa nur zu gern für immer ihre zweite Hälfte<br />
finden würden. Am besten wäre ein Holländer, aber auch<br />
wenn ein in Holland geborener Marokkaner oder Türke<br />
sich als zivilisierter Mensch erweist, halten sie nicht gar<br />
zu eisern an ihrem ursprünglichen Plan fest. Wenn der<br />
Loverboy sich sein Zielobjekt ausgesucht hat, geht es ans<br />
Werk, nun gilt es, das Mädchen anzugraben und von seinem<br />
Interesse zu überzeugen. Das geht meistens schnell, nach<br />
ein paar mittelmäßig schicken Abendessen ist das Objekt<br />
weichgekocht, hat sich sogar verliebt. Als nächstes muss<br />
die Leidenschaft mit Komplimenten und kleinen Geschenken<br />
zwei, drei Wochen, höchstens einen Monat lang aufrechterhalten<br />
werden, bis die Etappe erreicht ist, wo er ihr<br />
vertraulich ernste Schwierigkeiten gestehen kann: Er hat<br />
da ein paar Schulden bei einem Bekannten. Der Bekannte<br />
arbeitet in einer schwierigen Branche, ist ein bisschen peinlich,<br />
davon zu reden, aber bei uns ist das, wie du ja sicher<br />
gemerkt hast, ein Beruf wie jeder andere auch. Er hat uns<br />
zusammen gesehen, du gefällst ihm. Wenn du nur einmal<br />
mit ihm ausgehen würdest, wäre die Sache vom Tisch.<br />
Wir erfahren nicht mehr, ob es Istvan gelungen ist,<br />
Krisztina dazu zu überreden, oder ob sie den Kontakt gerade<br />
noch rechtzeitig abgebrochen hat; wir sehen sie nur<br />
ein Mal, wie sie weint, die Wimperntusche verschmiert und<br />
läuft ihr über die Wangen, sie macht sich nichts aus unserer<br />
Anwesenheit. Wer sind auch wir schon, das Schlimmste ist,<br />
dass sie zum Schluss den Lehrern davon berichten musste,<br />
weil Istvan die Trennung nicht einsah und sie sich nicht<br />
mehr sicher fühlte.<br />
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes
JAN<br />
KRASNOWOLSKI<br />
AFRIKANISCHE<br />
ELEKTRONIK<br />
Jan Krasnowolski (geb. 1972), Schriftsteller, Autor<br />
der Erzählbände 9 leichte Stücke (2001) und<br />
Käfig (2006). Nach dem Besuch eines Kunstgymnasiums<br />
arbeitete er in vielen unterschiedlichen<br />
Berufen. 2006 zog er nach Großbritannien und<br />
lebt seitdem in Bournemouth. Auch in seiner neuen<br />
Heimat versuchte er sich in unterschiedlichen<br />
Berufen, gegenwärtig betreibt er eine Baufirma<br />
und schreibt – wie sein neuer Band „Afrikanische<br />
Elektronik“ belegt – Erzählungen.<br />
„Afrikanische Elektronik” ist bereits das dritte Buch von Jan<br />
Krasnowolski. Beim Lesen seiner neuesten Erzählungen<br />
(„Dirty Heniek“, „Afrikanische Elektronik“, „Hasta siempre,<br />
comandante“ und „Kindoki“) fühlt man sich unwillkürlich<br />
an die Worte Stanisław Lems erinnert, der im Vorwort zu<br />
Krasnowolskis Debütband schrieb: „Der Autor hat eine starke<br />
Abneigung gegen die heutige Zeit, worin man ihm übrigens<br />
Recht geben muss.” Bei Krasnowolski hält sich das Böse im<br />
Verborgenen, es liegt auf der Lauer, verändert seine Erscheinung,<br />
maskiert sich, schlägt unter die Gürtellinie und greift<br />
ohne Vorwarnung an. Dies ist alles andere als die beste aller<br />
möglichen Welten: Es gibt in ihr keine guten, redlichen Polizisten,<br />
sondern lediglich eine systemübergreifende Verstrickung<br />
und allumfassende Unredlichkeit. Die Hüter der Ordnung<br />
erweisen sich als Hüter der Unordnung (Krasnowolski<br />
erinnert auf witzige Weise daran, dass Gesetze nicht vom<br />
Himmel fallen, sondern das Ergebnis von Festlegungen und<br />
Kompromissen sind) und die Abrechnung mit der eigenen<br />
Vergangenheit erscheint als eine nahezu unlösbare Aufgabe.<br />
Der Autor von „Afrikanische Elektronik“ – ein erwachsen<br />
gewordenes Kind der Popkultur – entlarvt in seinen ganz und<br />
gar unglaublichen und gerade deshalb so wahrscheinlichen<br />
Geschichten Mythen, die noch immer lebendig sind. Und<br />
macht nebenbei sehr ernste Literatur: Seine Erzählungen sind<br />
leichtfüßig, filigran, grotesk, fantastisch und gerade dadurch<br />
äußerst realistisch. Krasnowolski äußert sich zu Themen der<br />
Geschichte – von der lokalen bis zur Weltgeschichte. Es geht um<br />
den Kriegszustand in Polen (alte Genossen in neuen, demokratischen<br />
Gewändern), um ideologischen Vampirismus (Ernesto<br />
„Che“ Guevara, der durch eine barmherzige Geste Unsterblichkeit<br />
erlangt und sich fortan vom Blut junger Mädchen ernährt,<br />
nicht nur jener, die T-Shirts mit seinem Konterfei tragen), um<br />
ein vom Teufel besessenes Kind, um Rassismus, Faschismus,<br />
und – was wohl am wichtigsten ist – das Wirken einer nichtinstitutionellen<br />
Gerichtsbarkeit. Aus dem Nebel auftauchende<br />
Massaker-Opfer und brennende Kriegsverbrecher rücken den<br />
Autor bisweilen in die Tradition unheimlicher (ein Porträt,<br />
das Unheil anzieht) und unaufgeregter Erzählungen, die sich<br />
von hinten an die Geschichte anschleichen, um Antworten auf<br />
quälende Fragen zu erhalten: Woher kommt die Unvollkommenheit?<br />
Die Mittelmäßigkeit? Und schließlich: Woher kommt<br />
das Böse?<br />
Krasnowolski umschifft die Untiefen der Lächerlichkeit<br />
vor allem mithilfe seines absurden Humors und seines Mutes<br />
zu ungewöhnlichen Auflösungen. Seine betrunkenen und<br />
bekifften, verblendeten und verzweifelten, an den Rand der<br />
Gesellschaft gedrängten Helden werfen Fragen nach den Grenzen<br />
und den Unterschieden zwischen Traum und Wirklichkeit,<br />
Wahnsinn und Normalität, Gut und Böse auf. Doch Krasnowolskis<br />
Erzählungen bieten weder einfache Antworten noch<br />
moralisierende Kommentare – ein weiterer Beleg für die frühe<br />
Einschätzung Stanisław Lems, dass Jan Krasnowolski „in der<br />
Tat bereits ein reifer Schriftsteller ist“.<br />
Anna Marchewka<br />
JAN KRASNOWOLSKI<br />
„AFRYKAŃSKA ELEKTRONIKA”<br />
KORPORACJA HA!ART<br />
KRAKÓW 2013<br />
140×200, 224 PAGES<br />
ISBN: 978-83-64057-05-2<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
HA!ART
AFRIKANISCHE<br />
ELEKTRONIK<br />
Er führte<br />
den Jungen in das Restaurant am Ende des ersten Passagierdecks.<br />
Die meisten Plätze waren bereits belegt, hauptsächlich<br />
von einer Gruppe von Fußballfans, die von einem<br />
Auswärtsspiel zurückkehrten. Mehrere Dutzend Männer<br />
in den Farben ihres Vereins – alle machten reichlich betrübte<br />
Gesichter, was eindeutig darauf hindeutete, dass das<br />
Spiel nicht zu ihren Gunsten ausgegangen war. Einige von<br />
ihnen öffneten bereits die ersten Bierdosen und fluchten<br />
lautstark auf die „beschissenen Franzosen“. Es gelang Rybka,<br />
sich einen Eckplatz zu erobern, direkt am Fenster und<br />
gleichzeitig mit Sicht auf den von der Decke hängenden<br />
Fernseher.<br />
„Wenigstens kannst du Fernsehen gucken“, sagte er zu<br />
dem Jungen. „Normalerweise würdest du jetzt das Meer sehen,<br />
andere Schiffe und Möwen, aber heute ist es neblig und<br />
man sieht überhaupt nichts.“<br />
Dann kam ihm der Gedanke, dass das Kind im Laufe seiner<br />
Überfahrt aus Afrika wahrscheinlich genug vom Meer<br />
gesehen hatte. Oder vielleicht auch nicht, schließlich wusste<br />
er nicht, unter welchen Bedingungen der Junge gereist war.<br />
Als blinder Passagier konnte er die gesamte Überfahrt eingesperrt<br />
in irgendeiner stickigen Kabine verbracht haben, oder<br />
sogar in einer Kiste im Laderaum. Wer wusste das schon, der<br />
Weg in ein besseres Leben war nicht für alle gleichermaßen<br />
bequem.<br />
„Warte hier und rühr dich nicht von der Stelle!“, sagte er,<br />
als das Vibrieren der Motoren stärker wurde und er spürte,<br />
wie sie von der Küste ablegten.<br />
Er stand auf, um etwas zu Essen zu bestellen. Während<br />
er in der Schlange stand, ließ er das Kind nicht eine Sekunde<br />
aus den Augen. Der Junge saß regungslos auf seinem Platz in<br />
der Ecke und starrte durch das Fenster, als habe er in dem<br />
dichten Nebel, der das Schiff einhüllte, irgendetwas Interessantes<br />
entdeckt.<br />
Der dunkelhäutige Junge verschlang seine Bohnen mit<br />
Speck, ohne dabei den Blick vom Cartoon Network abzuwenden,<br />
und Rybka kam der Gedanke, dass der Kleine keine<br />
Schwierigkeiten haben würde, sich einzugewöhnen. In<br />
einigen Monaten würde ihn niemand mehr von anderen<br />
Kindern, die auf den Britischen Inseln geboren und aufgewachsen<br />
waren, unterscheiden können. Er würde in der<br />
bunten Menge aufgehen, die die Straßen Londons bevölkerte,<br />
er würde beginnen, wie ein echter Londoner zu sprechen,<br />
er würde die Stadt kennenlernen und lernen in ihr zu leben.<br />
Und in einigen Jahren würde er sich nicht einmal mehr an<br />
Afrika erinnern, an das Dschungeldorf oder die Slums, in<br />
denen er bis jetzt gelebt hatte.<br />
„Hast du keine Sehnsucht nach Zuhause?“, fragte er.
„Mein Zuhause ist abgebrannt“, antwortete der Kleine,<br />
während er die letzten Bohnen auf seine Gabel häufte. „Es<br />
ist nichts davon übrig geblieben.“<br />
„Das tut mir leid“, brummelte Rybka verlegen und bedauerte,<br />
dass er dieses für den Jungen heikle Thema angeschnitten<br />
hatte. „Hoffentlich ist niemandem etwas passiert?“<br />
„Sie sind verbrannt. Alle. Mama, Papa, meine drei<br />
Schwestern und mein Bruder“, murmelte das Kind, ohne<br />
dabei den Blick vom Fernseher abzuwenden, auf dem SpongeBob<br />
Schwammkopf gerade über den Meeresboden hüpfte.<br />
„Da standen Männer mit Macheten, die haben aufgepasst,<br />
dass niemand dem Feuer entkam. Auf diese Weise ist mein<br />
Bruder gestorben, weil er versuchte, zu fliehen. Nur ich<br />
habe überlebt.“<br />
„Oh Gott, das tut mir wirklich sehr leid.“ Der schockierte<br />
Rybka bedauerte es, dass er überhaupt angefangen hatte,<br />
den Jungen auszufragen. „Du musst Schreckliches durchgemacht<br />
haben, Kleiner.“<br />
„Hm. Die Bohnen waren super, ich würde gerne noch eine<br />
Cola trinken“, sagte der Junge, schob den leeren Teller von<br />
sich und lächelte einschmeichelnd. „Darf ich?“<br />
Während er erneut in der Schlange vor der Kasse stand,<br />
überlegte Rybka, welche traumatischen Erlebnisse der Junge<br />
hinter sich haben musste. Man meinte zu wissen, was in diesen<br />
ganzen afrikanischen Ländern vor sich ging. Stammeskriege,<br />
Massaker, schmutzige Kriege, in denen verrückte<br />
Anführer selbst so kleine Knirpse zu Soldaten machten – sie<br />
mit Drogen vollstopften, ihnen Gewehre und Macheten in<br />
die Hand drückten und sie in gnadenlose Tötungsmaschinen<br />
verwandelten. Aber es war eine Sache, wenn man das<br />
alles durch den flachen Bildschirm des Fernsehers gefiltert<br />
betrachtete, und eine andere, wenn man jemandem gegenüberstand,<br />
der so etwas tatsächlich erlebt hatte. Dieser Junge<br />
hatte ganz offensichtlich das Pech gehabt, in einer von Konflikten<br />
geschüttelten Region geboren zu werden, und er hatte<br />
einen Albtraum erlebt, der sich sicherlich wie ein Schatten<br />
über sein gesamtes Leben legen würde. Ein Glück, dass<br />
es gelungen war, ihn dort herauszuholen. Der kleine Eugene<br />
verdiente es, in einer besseren Welt zu leben, in der Kinder<br />
zur Schule gingen, keine schrecklichen Dinge um sich herum<br />
sahen und eine wirkliche Kindheit hatten, anstatt mit<br />
einem Gewehr in der Hand durch die Gegend zu rennen und<br />
Tod und Verwüstung zu säen, bis ihnen irgendein anderes<br />
zugekifftes Kind eine Kugel verpasste.<br />
Der Kleine hatte mit ansehen müssen, wie seine Familie<br />
umgekommen war. Rybka konnte nur schwer begreifen, wie<br />
er so ruhig darüber sprechen konnte. Es musste ein Trauma<br />
sein, vielleicht stand er noch immer unter Schock. Das wäre<br />
vermutlich eine Erklärung für seine Ruhe und Emotionslosigkeit.<br />
Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit hatte er das Gefühl,<br />
genau das Richtige zu tun. Er half dabei, diesen Jungen zu<br />
retten, ihn aus der Hölle zu befreien und ihm ein neues Leben<br />
zu ermöglichen. Der kleine Eugene hatte mehr erlebt,<br />
als irgendein Mensch je erleben sollte, er hatte die Ermordung<br />
seiner Familie mit ansehen müssen und war selbst nur<br />
knapp dem Tode entronnen. Rybka schwor sich, dass er den<br />
Jungen nach London bringen würde, und wenn die Welt um<br />
ihn herum unterginge. Nicht des Geldes wegen, sondern<br />
weil es seine Pflicht war.<br />
Rybka war schon seit Jahren im Geschäft, der Schmuggel<br />
mit Kokain, oder „Charlie“, wie die Engländer das weiße<br />
Pulver umgangssprachlich nannten, sicherte ihm ein<br />
ständiges, nicht unerhebliches Einkommen. Und es ging so<br />
einfach, dass moralische Dilemmata ihm nachts nicht den<br />
Schlaf raubten. Es war einfach ein Job wie jeder andere. Der<br />
eine saß acht Stunden im Büro und wühlte in Papieren, ein<br />
anderer stand am Fließband. Rybka hatte sowohl das eine als<br />
auch das andere ausprobiert, und jetzt schmuggelte er eben<br />
Koks, einfach weil sich die Möglichkeit ergeben hatte, weil<br />
er den entsprechenden Leuten begegnet war. Wenn er es<br />
nicht täte, würde es ein anderer tun, nur ein ausgemachter<br />
Trottel würde sich eine solche Möglichkeit entgehen lassen.<br />
Großbritannien war wie ein riesiger Staubsauger: Tausende,<br />
Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende, vom Sozialhilfeempfänger<br />
bis hin zum Manager eines Großkonzerns,<br />
zogen sich tagtäglich Bahnen weißen Pulvers durch gerollte<br />
Geldscheine in ihre Nasen. Zugedröhnte Politiker regierten<br />
das Land, zugedröhnte Manager leiteten die Konzerne, zugedröhnte<br />
Polizisten machten Jagd auf zugedröhnte Verbrecher,<br />
und selbst der durchschnittliche Dave Smith von nebenan<br />
zog sich am Wochenende gerne eine Bahn. Das Land<br />
funktionierte dank Kokain. Wenn man plötzlich sämtliche<br />
Lieferungen stoppte, würde wahrscheinlich alles stillstehen,<br />
wie eine Maschine, der der Treibstoff ausgegangen war. Die<br />
Wirtschaft bräche zusammen, die gesamte Produktion käme<br />
zum Erliegen und das Land versänke in Chaos und Aufruhr.<br />
Ganz Großbritannien würde in den Abgrund stürzen. So in<br />
etwa stellte Rybka sich das vor, wenn er sein Gewissen beruhigen<br />
wollte.<br />
Er betrachtete sich selbst gar nicht als Schmuggler, sondern<br />
eher als eine Art Ein-Mann-Kurierdienst für besondere<br />
Aufträge. Schmuggler waren Volltrottel, die sich nach<br />
Kolumbien schicken und mit kokaingefüllten Kondomen<br />
vollstopfen ließen, Idioten, die ihr Leben für ein paar miese<br />
Tausender riskierten, mit denen sie es auch auf keinen grünen<br />
Zweig bringen würden. Oder Schlauberger, die ihren<br />
Kombi mit Zigarettenstangen und Schnaps vollpackten und<br />
vierundzwanzig Stunden durch Europa gurkten, nur um in<br />
Dover vom erstbesten Zollbeamten angehalten zu werden,<br />
der einen Blick auf ihr Auto warf.<br />
Dieser Auftrag war anders als die anderen. Als er hörte,<br />
dass es darum ging, einen siebenjährigen Jungen von Marseille<br />
nach London zu bringen, hatte er zunächst abgelehnt.<br />
Ein diskretes Päckchen, das er in einem Geheimfach seines<br />
Kofferraums verstecken konnte, war eine Sache, ein lebender<br />
Mensch eine andere. Das Risiko war wesentlich größer,<br />
außerdem hatte die britische Polizei zuletzt ein besonderes<br />
Auge auf die Schleusung illegaler Einwanderer geworfen,<br />
vor allem weil es plötzlich zu viele von den legalen gegeben<br />
hatte. Aus all diesen Erwägungen heraus sagte Rybka seinem<br />
Auftraggeber, er möge sich jemand anderen suchen. Doch<br />
jener Gentleman war es offensichtlich nicht gewohnt, dass<br />
man ihm eine Abfuhr erteilte.<br />
„Du wirst mir den Jungen bringen“, sagte er und zog ein<br />
Geldbündel aus der Innentasche seines teueren Mantels.<br />
Aus dem Polnischen von Heinz Rosenau
PIOTR<br />
PAZIŃSKI<br />
DIE<br />
VOGELSTRASSEN<br />
Piotr Paziński (geb. 1973), Journalist, Essayist,<br />
Literaturkritiker und Übersetzer, Chefredakteur<br />
der zweimonatlich erscheinenden jüdischen Zeitschrift<br />
Midrasz, Autor eines Buches über James<br />
Joyce. Für seinen Debütroman Die Pension (2009)<br />
wurde er mit dem Europäischen Literaturpreis<br />
ausgezeichnet, der vom Europäischen Parlament<br />
verliehen wird.<br />
„Wir sind nie über diese Straßen geschlendert. Niemand ist<br />
überhaupt auf die Idee gekommen; als ob wir uns selbst den<br />
Zutritt verwehrt hätten“, schreibt Piotr Paziński in „Das Manuskript<br />
Izaak Feldwurms“, einer von vier langen Erzählungen<br />
aus dem Band Die Vogelstraßen. Auf den Seiten des Buches<br />
wird das Verbot gebrochen, wir betreten einen Raum, der<br />
ungewöhnlich reich ist an Bedeutungen. Es ist das Gebiet des<br />
nördlichen Warschauer Vorkriegs-Stadtteils, aus dem später<br />
das größte jüdische Ghetto Europas gemacht wurde – denn<br />
genau dafür stehen „jene“ Straßen bzw. die „Vogelstraßen“;<br />
dazu verurteilt, „nie von den Toten aufzuerstehen“, sind sie<br />
doch voller Leben, sie nehmen uns mit ihrer seltsamen „Zwischenwelt“<br />
gefangen, die Zeit und Raum des gesamten Erzählbandes<br />
prägt. Bei Paziński verströmt dieser unsichtbare Ort,<br />
überlagert von der Nachkriegstopografie, getilgt auf Karten<br />
und in Gedächtnissen, ein so intensives posthumes Leben,<br />
dass die Realität der Gegenwart schwindet und verblasst,<br />
während die Phantome wieder zum Leben erweckt werden.<br />
„Das aktuelle Straßennetz wurde wahllos ausgeworfen, als<br />
hätte es dort zuvor keins gegeben, als hätte es sich nicht an<br />
den Boden geschmiegt, hätte im luftleeren Raum gehangen,<br />
unbeholfen das Nichts verdeckend.“ Die „Adler-, Gänse-,<br />
Krähen- und Entenstraße“ (im Grunde genommen alles Vogelnamen),<br />
„brachten die Luft zum Klingen, und es schien,<br />
als würde jede ihre eigene Melodie singen.“ Die wichtigen<br />
und die nur erwähnten Helden der Erzählungen sind alte Bekannte,<br />
ein familiärer Kreis von Überlebenden der polnischjüdischen<br />
Welt. Herr Sztajn, Frau Tecia, Dr. Kamińska, Herr<br />
Abram, Herr Rubin, die Oma, die Onkel, schließlich zwischen<br />
alledem der Erzähler, der der Generation der Enkel angehört,<br />
der ersten Generation nach dem Holocaust. Sie alle sind in<br />
Anspruch genommen vom phantastischen Leben, von der Tätigkeit,<br />
Erinnerung zu schaffen. Manche Figuren sind gänzlich<br />
phantasmagorisch wie der titelgebende Feldwurm oder<br />
der Zaddik aus der Erzählung „Trauerzug“. Andere – wie der<br />
von unkonzentrierten Trauergästen getragene Verstorbene<br />
oder Dr. Kamińska – erscheinen vorübergehend in Gestalt von<br />
wirklichen Leichen. Sie alle gehören jedoch jener Zwischenwelt<br />
an, der Welt von Menschen und Geistern, deren Domäne<br />
nicht das klassische Unheimliche, sondern die Literatur selbst<br />
ist, die erlahmende Magie der Fiktion, die ständig vom Leser<br />
wiederbelebt werden muss und in der die Vergessenen fortbestehen.<br />
So ähnlich wie in dem Debüt Die Pension, wenn auch tiefgründiger,<br />
beruht die Struktur der Prosa auf der Idee eines<br />
Ausflugs an einen Ort, an dem die Vergangenheit lauert, sich<br />
verbirgt, aber auch darauf wartet, dass sie jemand beim Namen<br />
nennt. Man kann sie wittern, sie sich vorstellen, sie erblicken.<br />
Kann man, muss es aber nicht. Die elegische Erinnerung<br />
geht zum Teil, unsicher, unbeständig in Erfüllung. Der Autor<br />
führt uns durch einen halb realen, halb geträumten und geisterhaften<br />
Raum, findet eine Form für die Abwesenheit, einen<br />
Begriff für die Nicht-Existenz, eine Darstellung für das Unsichtbare.<br />
Paziński erweist sich als ungewöhnlicher, ironischer<br />
Forscher und Chronist der jüdischen Welt. Der Stil, den<br />
er dabei geschaffen hat, ist zugleich ausdrucksstark und ruhig,<br />
virtuos, aber sich der eigenen Hilflosigkeit bewusst. Sein<br />
Schreiben ist die reiche, tief verinnerlichte Erkenntnis, dass<br />
sich das, was einst als Literatur der Erschöpfung bezeichnet<br />
wurde, infolge des Holocaust endgültig erfüllt hat: Die Notwendigkeit,<br />
in der Literatur über die Nicht-Existenz von Helden<br />
und sogar den Tod von Gegenständen zu schreiben, wie<br />
es in der meisterhaften Erzählung „Die Wohnung“ der Fall<br />
ist. Der gelehrte Stil, reich an Paraphrasen von Bruno Schulz,<br />
biblischer Travestie und Anspielungen auf den Talmud, ist<br />
eine besondere Form, die Philosophie des Verlustes zu praktizieren,<br />
die der schriftstellerischen Mission von Paziński<br />
zugrunde liegt.<br />
Kazimiera Szczuka<br />
PIOTR PAZIŃSKI „PTASIE ULICE”<br />
NISZA, WARSZAWA 2013<br />
135×210, 192 PAGES<br />
ISBN: 978-83-627-9521-5<br />
TRANSLATION RIGHTS: PIOTR<br />
PAZIŃSKI<br />
CONTACT: NISZA
DIE<br />
VOGELSTRASSEN<br />
Jakob<br />
antwortete nicht. Seit einer geraumen Weile hörte er nicht<br />
mehr zu, er beobachtete ein paar Eichhörnchen, die sich<br />
auf einem Ast nachjagten. Der Mann, der sich als Lejzer<br />
vorgestellt hatte, bemerkte es und verstummte. Auch die<br />
Stimmen vom Trauerzug waren nicht mehr zu hören. Jakob<br />
begann, sich Gedanken darüber zu machen, ob es wirklich<br />
gut gewesen war, mit jenem Menschen hier zu bleiben, der,<br />
wie man meinen musste, nicht viel mit den anderen Trauergästen<br />
gemeinsam hatte und der keinen Hehl aus seiner<br />
Abneigung gegenüber dem ganzen Zeremoniell machte.<br />
„Wir holen sie ein, sie werden noch mehr als einmal hier<br />
vorüberkommen“, beruhigte ihn jener. „Ich erzähle Ihnen<br />
lieber, wie das richtige Schreiben aussah. Ich erinnere mich<br />
an meinen Großvater, Schmuel den Sofer, wie er über den<br />
heiligen Rollen brütete. Er saß in aller Ruhe an einem Bogen<br />
bester Kalbshaut, und wir hatten Angst uns zu rühren.<br />
Wir waren kleine Kinder, Sie wissen schon. Normalerweise<br />
rennen kleine Kinder im Raum herum, aber nicht bei uns.<br />
Bei uns herrschte nicht so ein Trubel wie bei normalen Menschen.<br />
Das Haus war recht klein, und es waren viele Kinder,<br />
aber niemand lärmte, ha, niemand sagte ein Wort, manchmal<br />
hat uns nur Großmutter leise etwas zugeflüstert. Bei uns<br />
war es mucksmäuschenstill! Niemand wagte, sich am Kopf<br />
zu kratzen. Was sage ich da, wenn wir die Luft hätten anhalten<br />
können, hätten wir bestimmt nicht geatmet, genau wie<br />
Leichen, die auch nicht atmen. Hauptsache den Großvater<br />
nicht stören, der vom frühen Morgen bis spät in die Nacht<br />
die Thora abgeschrieben hat. Später, wenn alle schliefen,<br />
meditierte er über jedem geschriebenen Abschnitt und formte<br />
aus den heiligen Versen seine eigene Erzählung. Tagsüber<br />
waren alle Enkel vollzählig, aber es war nichts zu hören als<br />
das Schaben seiner Feder! Die Großmutter sorgte sich. Was<br />
geschieht, wenn der Großvater einen Fehler macht? Wenn<br />
ihm die Feder bricht? Aber der Großvater machte keinen<br />
Fehler, und manchmal erlaubte er mir, dem ältesten Enkel,<br />
und natürlich unter der Bedingung, dass ich schweige, hinter<br />
ihm zu stehen und zuzusehen ...“<br />
Jakob hielt Ausschau nach dem Trauerzug. Auf dem Weg<br />
kam niemand, aber Jakob hätte schwören können, dass er<br />
wiederholt Menschen hatte laufen hören, mal näher, mal<br />
weiter weg. Der Mann achtete nicht darauf. Er weilte irgendwo<br />
in weiter Höhe, für Jakob unsichtbar, und sprach<br />
immer erregter, als hätte er seit langem keine Gelegenheit<br />
dazu gehabt.<br />
„Ich sah also dem Großvater über die Schulter und las die<br />
Thora! Und sogar zwei auf einmal! Eine, die ganze Thora, lag<br />
auf Rollen gewickelt auf dem Tisch, genau wie in der Bima<br />
in der Synagoge. Aus ihr kopierte Großvater Vers um Vers,
in der Reihenfolge, wie sie einst sein Vorgänger geschrieben<br />
hatte, und davor noch ein anderer Sofer, bis hin zu Mojsche<br />
Rabejnu selbst. Jeder Buchstabe war gleich wichtig, genau<br />
wie jedes Krönchen über sieben von zweiundzwanzig<br />
Buchstaben, die gemeinsam einen Körper ergaben. Und die<br />
ganze Rolle war wie ein Name, den der Großvater geschickt<br />
in einzelne Ausdrücke teilte. Ich las sie, wenn sie auf dem<br />
Pergament erschienen, das auf eine für mich unverständliche<br />
Weise genau an den Stellen schwarz wurde, wo es sollte.<br />
Großvater berührte es nicht mit der Feder, sondern sprach<br />
in Gedanken zu ihm und erzeugte auf diese Weise Buchstaben<br />
und ganze Sätze. Und wenn es keine Gotteslästerung<br />
gewesen wäre, hätte ich gerufen: Wezot haTora aszef sam<br />
Mojsze lifnej bnej Isroel! Das ist das Gesetz, das Moses den<br />
Söhnen Israels gegeben hat! Aber damals fürchtete ich, Gott<br />
zu lästern, oder, um ehrlich zu sein, ich fürchtete mich eher<br />
vor Großvater und dessen Zorn. Denn wenn, Gott bewahre,<br />
ein Tropfen Tinte auf das Pergament gefallen wäre und einen<br />
Fleck gemacht hätte, wäre es aus gewesen ...“<br />
Jakob spürte, dass er nicht die Kraft hatte, den Mann allein<br />
zu lassen. Im Grunde genommen saß er trotz gewisser<br />
Beschwerden ganz angenehm, und auch die Erzählung des<br />
anderen war recht unterhaltsam. Er machte sich Vorwürfe,<br />
dass er nicht den Mut hatte, das Notizbuch hervorzuholen.<br />
Die Worte verloren sich so schnell in der Dunkelheit, dass es<br />
einen Moment später schwierig war, sie noch auszumachen.<br />
Trotzdem hörte Eliezer nicht zu sprechen auf.<br />
„Der schönste Moment kam, wenn Großvater die Namen<br />
ergänzte. Der ganze Bogen war scheinbar fertig, drei gleichmäßige<br />
Spalten, eine neben der anderen, jedes Wort und jeder<br />
Buchstabe erstrahlten, ich dachte, wir wären im Paradies,<br />
aber das Herrlichste hatte ich noch vor mir. Beim Schreiben<br />
hatte Großvater im Text Stellen frei gelassen für den unaussprechlichen<br />
Namen des Heiligen, gepriesen soll er sein.<br />
Dan ging er sich in der Mikwe reinigen und begab sich in<br />
feierlicher Stimmung wieder an die Arbeit. Nun leuchtete<br />
das Weiß des Pergaments, die Buchstaben waren nicht zu<br />
sehen, nur ihre weißen Konturen. Ich wartete gespannt darauf,<br />
dass er die Feder nehmen würde und dann die Namen<br />
des Allerhöchsten von selbst aufleuchten und alles in den<br />
Schatten stellen, was Großvater bislang geschrieben hatte.<br />
Und so geschah es auch. Ich sah sprachlos zu, denn wenn ich<br />
bisher Großvaters Schrift gefolgt war und in meinem Kopf<br />
ganze Sätze daraus geformt hatte, so war ich jetzt, wo mich<br />
die unaussprechlichen Namen mit ihrer Kraft blendeten,<br />
nicht dazu in der Lage. Der Großvater kam irgendwie damit<br />
zurecht. Ob er die Augen schloss und die fehlenden Buchstaben<br />
aus dem Gedächtnis kalligrafierte, weiß ich nicht.<br />
Vielleicht ließ er auch zu, dass sie ihm die Sicht nahmen? Ich<br />
wollte ihn danach fragen, aber einmal kam er aus der Mikwe<br />
zurück und erblindete. Er setzte sich an den Tisch, breitete<br />
den Bogen aus, prüfte das Tintenfass, sprach einen Segen ...<br />
Und das war alles! Er konnte nichts mehr schreiben. Und<br />
es war der Parschas Ki Tissa, außerdem eine Stelle, an der<br />
der Name zweimal hintereinander vorkommt. Er hat den<br />
Glanz nicht ertragen! Es wurde still, aber anders als bisher,<br />
schrecklich still. Alle Buchstaben flohen von der Rolle, und<br />
es blieb nichts als die reine Haut! Ich stand hinter Großvater<br />
wie behext. Ich wollte ihm helfen, aber ich wusste, dass es<br />
mir nicht erlaubt war. Schließlich war er der Sofer. Es dauerte<br />
lange, länger wohl als das Schreiben selbst. Ich blickte<br />
Großvater an, der sich zusammenkrümmte und den Kopf mit<br />
den Händen bedeckte, als wäre er erstarrt. Wir hörten, dass<br />
er weinte. Sehr laut. Das ist das einzige Geräusch, an das ich<br />
mich erinnere.“<br />
Hinter den Bäumen quietschte ein Karren. (...)<br />
„Ich suche nicht nach Großvaters Grab. Ich denke ich<br />
weiß, wo er liegt.“<br />
Sztajn nickte.<br />
„In unserem Garten, so stelle ich es mir vor. Denn wir<br />
hatten einen Garten, herrlich, der allerschönste auf der Welt,<br />
ganz sonnig, und es wuchsen dort wunderbare Bäume, die<br />
Vögel sangen, aber ich durfte nicht hinausgehen, ich wusste,<br />
dass ich im Zimmer bei Großvater bleiben und zusehen muss,<br />
wie er die heiligen Pentateuchrollen abschrieb, Bogen für<br />
Bogen. Und dort, hinter dem Fenster, wie es dort schimmerte,<br />
das Licht verfing sich in den Blütenkelchen der Blumen,<br />
die sich, noch bevor es sich der Sommer so richtig bequem<br />
gemacht hatte, unter seiner Last bogen. Es sah so aus, als<br />
würden sie gleich bersten, prall und randvoll gefüllt. Dieser<br />
Glanz lockte auch dann, wenn die Furchtbaren Tage näher<br />
rückten und die goldenen Reste, verfangen in den Netzen<br />
des Altweibersommers, direkt über dem verbrannten Gras<br />
verloschen. Ich schlich mich manchmal am Samstag nach<br />
dem Mittagessen dort hinaus, wenn Großvater ein Nickerchen<br />
machte und uns für einen Moment nicht beaufsichtigte.<br />
Wenn die Pforte verschlossen war, zwängte ich mich zwischen<br />
den Latten hindurch, dort gab es so einen schmalen<br />
Durchlass, nichts weiter als ein Spalt, aber groß genug für<br />
mich. Großvater wusste nichts davon, er hätte sich sehr geärgert,<br />
dass ich, anstatt den Raschi-Kommentar zu lesen, die<br />
Zeit mit Dummheiten vergeudete. Um Gottes Willen! Die<br />
Sünde hat sich in meinem Haus eingenistet. Die Sünde ist<br />
durch ein Loch im Zaun hereingeschlüpft, der verräterische<br />
Samen, da lässt man dich einmal aus den Augen, Distel und<br />
Kornrade! Er hätte den ganzen Abend lang geschimpft, ohne<br />
daran zu denken, dass man sich vom Samstag des Herrn<br />
würdig verabschieden soll, dabei heißt es doch, wer leicht<br />
zürnt, der leistet einen Götzendienst. Dabei war doch ich der<br />
Götzenanbeter, ich, der Apikojres, Elisza, der ins Paradies gelangte<br />
...“<br />
„... erblickte dort den schwarzen Engel auf Gottes Thron<br />
und verlor den Glauben“, unterbrach ihn Sztajn barsch.<br />
„Deshalb sind wir Rabbi Akiba Gehorsam schuldig, der lehrte,<br />
dass die Tradition ein Zaun für die Thora ist.“<br />
„... und der Zaun der Weisheit ist das Schweigen. Ich erinnere<br />
mich, wir haben das jeden Freitag bei Tisch gesagt. Nur<br />
auf welcher Seite ist die Weisheit? Ich habe mich dort auf<br />
die Erde gelegt wie ein Ungläubiger, vielleicht auch wie ein<br />
gewöhnlicher Junge, der nach Sonne dürstet, ich habe stundenlang<br />
gelegen, so kam es mir vor, obwohl es nur kurze Momente<br />
waren. Ich habe den Duft wilder Kräuter eingesaugt<br />
und die Äste des Apfelbaums angeschaut, wo erste Früchte<br />
wuchsen. Etwas ist damals in mir erwacht, eine Sehnsucht,<br />
Hitze legte sich auf meinen Kopf, der Körper drängte zum<br />
Leben ...“<br />
„Sünder!“ spottete Sztajn. Beide begannen zu lachen.<br />
Aus dem Polnischen von Benjamin Voelkel
ANDRZEJ<br />
STASIUK<br />
AN GELBEN<br />
STRASSEN GIBT’S<br />
KEINEN KAFFEE<br />
Andrzej Stasiuk (geb. 1960), Prosaschriftsteller,<br />
Dramaturg und Publizist sowie Verleger; Autor<br />
zahlreicher Prosabände. In den letzten Jahren<br />
publizierte er den Roman Taksim (2009, dt. „Hinter<br />
der Blechwand“, 2011), eine Sammlung von<br />
Erzählungen unter dem Titel Grochów (2012, dt.<br />
„Kurzes Buch über das Sterben“, 2013) sowie<br />
den Band mit essayistischer Reiseprosa Dziennik<br />
pisany później (2010, dt. „Tagebuch, danach<br />
geschrieben“, 2012). Er erhielt zahlreiche renommierte<br />
Preise, darunter 2005 den wichtigsten polnischen<br />
Literaturpreis Nike für Jadąc do Babadag<br />
(dt. „Unterwegs nach Babadag“).<br />
Die zahlreichen Texte, die in Andrzej Stasiuks neuem Buch<br />
unter dem Titel An gelben Straßen gibt’s keinen Kaffee versammelt<br />
sind, könnte man als Reisenotizen bezeichnen, und es<br />
sind – wie sich herausstellt – immer weiter von Europa entfernte<br />
Länder, die der Autor bereist. So bekommen wir hier<br />
Aufzeichnungen zu lesen, die unter dem Einfluss von Reisen<br />
in die Mongolei, nach China, nach Kirgisien und in den fernen<br />
Osten Russlands entstanden sind.<br />
Stasiuk sucht an diesen Orten eigentlich das, was er immer<br />
gesucht hat (ich denke an seine früheren Fahrten in das<br />
„schlechtere“ Europa, hauptsächlich in den Balkan), das heißt,<br />
er sucht eine nicht offensichtliche, im übrigen von ihm selbst<br />
geschaffene Mystik, die Epiphanie, die Bezauberung, bisweilen<br />
auch das effektvolle Paradoxon. So wundert es uns auch<br />
nicht – der Autor hat uns inzwischen daran gewöhnt – , dass<br />
er sich in der Einöde am wohlsten fühlt, in der mongolischen<br />
Steppe oder in der Wüste Gobi. Und wenn er von seiner Heimat<br />
(den Niederen Beskiden, wo er seit Jahren wohnt) oder<br />
von den Nachbarländern erzählt, dann konzentriert er sich<br />
auf die „slawische Wehmut“, auf die Zerbrechlichkeit und<br />
Merkwürdigkeit der Existenz, die an solchen Orten zu spüren<br />
sind. In einem der Feuilletons schreibt er (und meint damit<br />
seine nähere Umgebung): „Ich wohne in einem Reich der Geister“,<br />
und er erklärt genau, wie er zu dieser Diagnose kommt.<br />
Die Erklärungen sind zum Teil sehr präzise, weil einige der<br />
Texte aus dieser Sammlung ursprünglich für ausländische<br />
Leser bestimmt waren, denen man – beispielsweise – erläutern<br />
sollte, was früher die Kultur der Lemken war und unter<br />
welchen Umständen sie verschwunden ist.<br />
Den treuen Lesern der künstlerischen und diskursiven<br />
Prosa von Andrzej Stasiuk wird dieses Buch sehr gefallen.<br />
Obwohl wir schon zur Genüge wissen, was der Autor nicht<br />
ausstehen kann (z.B. alle Praktiken der Imitation, den „postmodernistischen<br />
Müll“) und was ihn fasziniert (z.B. jegliche<br />
postsowjetischen Spuren – sowohl in der Architektur als auch<br />
in der Mentalität – als Zeichen des Bankrotts einer gefährlichen<br />
Utopie), so verdirbt uns dieses erkenntnistechnische<br />
Unbehagen (wir erkennen das schon Bekannte) doch nicht<br />
die positiven Leseeindrücke. Stasiuks Pinselstrich ist sparsam<br />
und treffsicher zugleich, und seine kleinen Skizzen sind<br />
raffinierte literarische Miniaturen von hoher Qualität.<br />
Wie man sich unschwer denken kann, verweigert dieser<br />
Schriftsteller geradezu programmatisch eine Reaktion auf<br />
die Dinge, über die sich die Medien täglich echauffieren. Er<br />
bleibt sich absolut treu – seinen Faszinationen, seinen peripheren<br />
Räumen und seinen ganz persönlichen Geschichten.<br />
Was Letztere betrifft, so sind die wichtigsten diejenigen, die<br />
seine Kindheit und frühe Jugend betreffen. Das ist ein neuer<br />
Ton in Stasiuks Prosa – der Autor denkt immer lieber über<br />
seine plebejischen Vorfahren nach, taucht immer tiefer in<br />
die bäuerlich-proletarische Genealogie seiner Familie ein und<br />
wird unweigerlich zu einem unverbesserlichen Nostalgiker.<br />
ANDRZEJ STASIUK<br />
„NIE MA EKSPRESÓW PRZY<br />
ŻÓŁTYCH DROGACH”<br />
CZARNE, WOŁOWIEC 2013<br />
125×205, 176 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7536-628-0<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
POLISHRIGHTS.COM<br />
Dariusz Nowacki
AN GELBEN<br />
STRASSEN GIBT’S<br />
KEINEN KAFFEE<br />
Ich sitze<br />
in meinem Zimmer und stelle mir Süditalien vor. Ich schaue<br />
auf das grüne Tal, auf die schattigen Fichten- und Buchenwälder,<br />
das wogende Gras, die Holzhäuser in meinem Dorf<br />
und stelle mir Süditalien vor, Kalabrien und Basilikata. Dort<br />
war ich nie. In zwei Wochen werde ich mich in Warschau<br />
ins Flugzeug setzen und über Rom nach Brindisi fliegen.<br />
Von Brindisi fahre ich mit der Fähre nach Durrës in Albanien,<br />
um eine Woche im Norden dieses Landes zu verbringen,<br />
in der Nähe der Grenze zum Kosovo. Aber auf dem Rückweg<br />
werde ich auch eine Woche in Kalabrien verbringen.<br />
Immer wenn ich nach Italien fahren wollte, dachte ich an<br />
den entferntesten Teil der Halbinsel. Nie an Rom, Venedig,<br />
Florenz oder Mailand. Selbst Neapel lag mir zu nahe. Immer<br />
stellte ich mir den Süden vor, weil dort der Kontinent, weil<br />
dort Europa endet. Ich stellte mir vor, wie das Meerwasser<br />
und die Sonnenglut die Erde anfressen und sie den Menschen<br />
wegnehmen. Die Appeninenhalbinsel sieht auf der<br />
Karte wie ein archaischer Knochen aus, wie das Skelettfragment<br />
eines Urtiers. Wahrscheinlich habe ich mir deshalb<br />
den Süden immer als etwas sehr Altes, Archaisches und<br />
vom Vergehen der Zeit Gequältes vorgestellt. Weiße Steine,<br />
gnadenloses Licht und Schatten, schwarz wie Ruß – so sehe<br />
ich es. Und der reglose Blick der alten Frauen, die vor ihren<br />
Häusern sitzen. Sie machen den Eindruck, als hätten sie die<br />
ganze Vergangenheit gesehen und kennten die Zukunft. Die<br />
Männer unterscheiden sich vielleicht, aber die alten Frauen<br />
sind überall gleich. Hier in Polen, in der Slowakei, in Ungarn,<br />
auf dem Balkan. Sie sitzen da, in ihren schwarzen Witwenkleidern<br />
und Kopftüchern und blicken durch die Zeit hindurch.<br />
Genauso muss es auch in der Gegend von – sagen wir<br />
– Savelli oder Longobucco sein. Da bin ich mir sicher, aber<br />
ich werde hinfahren, um es mit eigenen Augen zu sehen. Ich<br />
werde hinfahren, um zu überprüfen, ob die kalabrischen<br />
Omas den Omas aus dem Dorf gleichen, in dem ich wohne.<br />
Ich werde mit wenig Gepäck fahren und die Ferienorte<br />
am Meer meiden wie der Teufel das Weihwasser. Die Strände<br />
erinnern im Sommer an die mittelalterliche Vision der<br />
Hölle. Ich werde fünfzig italienische Wörter lernen und<br />
schauen, wie es sich in dieser Gegend per Anhalter fährt.<br />
Mit einem leichten Schlafsack werde ich hier und da unter<br />
freiem Himmel schlafen und mir das Geld für die Hotels sparen.<br />
Natürlich werde ich mich vor der Vogelspinne fürchten,<br />
aber der Wein wird diese Angst lindern. In Städten und<br />
Dörfern werde ich Schatten suchen. Ich weiß, dass man auf<br />
dem Marktplatz eines gottverlassenen Städtchens den ganzen<br />
Tag verbringen kann, indem man sich mit der Sonne<br />
bewegt, und das ist manchmal großartiger und wichtiger<br />
als alle Museen von Rom und Florenz. Nach einer oder zwei
Stunden gewöhnen die Leute sich an die Anwesenheit eines<br />
Fremden, und du kannst behutsam in ihr Leben eintreten,<br />
fast als wärst du unsichtbar. Ein bisschen sehen sie dich,<br />
aber sie sind bemüht, sich zu verhalten wie immer, weil der<br />
Stolz es ihnen nicht erlaubt, wegen eines Dahergelaufenen<br />
irgend etwas anders zu machen. Ja, auf dem Marktplatz eines<br />
unbekannten Städtchens oder Dorfs in einem fremden<br />
Land zu sitzen, ist wie das Lesen eines schönen Buchs. Ein<br />
wenig verstehst du, aber den Rest musst du dir vorstellen.<br />
Die Leute führen die gleichen Gesten aus wie bei dir zu Hause,<br />
aber ihre Bedeutung ist nicht restlos klar. Nur die Tiere,<br />
Katzen und Hunde, verhalten sich wie überall; sie reagieren<br />
eher auf den Körpergeruch oder die Wärme der Stimme als<br />
auf Aussehen und Worte.<br />
So ist mein naiver Plan. Ich betrachte die Karte von Europa<br />
und sehe lediglich seine Grenzen, die Orte, von denen<br />
aus man nur umkehren kann. Ja, ich sollte „Paris“ denken,<br />
aber ich denke „Lissabon“. Ich sollte „Venedig“ denken, aber<br />
ich denke „Donaudelta“. Eben dort spürte ich eines Sommers,<br />
wie der Kontinent im Meer versinkt und sich geschlagen<br />
gibt, dort in Sulina, dem letzten Städtchen Europas, spürte<br />
ich die mit Freude gemischte Trauer, dass ich am Ende angelangt<br />
bin, am Rande dieser historisch-geographisch-ideologischen<br />
Abstraktion, die dort äußerst real ist: rostende Barken<br />
und Schiffe, in sandigen Dünen verscharrt, ein Friedhof<br />
mit Matrosennamen aus der ganzen Welt von vor hundert<br />
Jahren, die tristen Militäranlagen und die schwarzen Gitter<br />
der Radargeräte, die nach einer Invasion Ausschau halten,<br />
herrenlose Hunde und Sümpfe, die sich über Zehntausende<br />
von Hektar erstrecken. Stellt euch eine europäische Stadt<br />
vor, zu der man nur übers Wasser gelangen kann. Eine Stadt<br />
an der Mündung eines der größten unserer Flüsse. Achtzig<br />
Kilometer mit dem Boot, der Fähre, dem Tragflügelboot, weil<br />
es anders nicht geht.<br />
Ich habe nichts gegen das Zentrum, aber die Peripherie<br />
zieht mich mehr an. Schon jetzt wird die Mitte des Kontinents<br />
immer stärker vereinheitlicht. Die Metropolen unterscheiden<br />
sich kaum mehr. Bald wird man sie nur noch an ihren<br />
hoch geschätzten, toten Sehenswürdigkeiten erkennen<br />
können. Wenn man diese Sehenswürdigkeiten überhaupt<br />
noch wird wahrnehmen können unter der grellen Schicht<br />
der Gegenwart: die gleichen Namen der Hotelketten, die<br />
gleiche Werbung, die gleichen Bankautomaten, Biersorten,<br />
Parkuhren, die gleiche Anordnung der Regale in den Supermärkten,<br />
das gleiche Repertoire in den Kinos.<br />
Ich denke, bald werden wir eher in die Peripherien reisen,<br />
an die Grenzen des Kontinents, in die Gegenden, wo alte<br />
Frauen mit Kopftüchern sitzen. Natürlich, und zum Glück,<br />
werden nicht alle das tun. Nur diejenigen, die die Vergangenheit<br />
nicht als Anachronismus und Aberglaube interessiert,<br />
sondern als Ort der eigenen Herkunft.<br />
Mai<br />
Neulich machte mir im Gespräch jemand bewusst, dass wir<br />
in einem Land leben, das keine Langeweile in der Natur<br />
kennt. Du müsstest mal in den Tropen leben, sagte er. Ein<br />
halbes Jahr lang ergießt sich Wasser aus dem Himmel. In<br />
der anderen Hälfte eintönige, gleichgültige Hitze. Ich stellte<br />
mir dieses Gefängnis des Wetters vor, und jetzt lobe ich mir<br />
mein Land um so mehr für seine Wechselhaftigkeit, Unvorhersehbarkeit<br />
und die Folge der Jahreszeiten, die immer zu<br />
langsam kommen oder zu lange dauern, im Vergleich zu<br />
den Tropen aber eine große Vielfalt bieten.<br />
Ich lobe also mein Land, und umso mehr, umso stärker<br />
lobe ich die Ankunft des Mais: dieses plötzlichen Wunders,<br />
das nach der Leichenstarre des Winters die Nacktheit der<br />
Erde bedeckt, das dieses Skelett aus Schlamm, Gestrüpp<br />
und Resten des letzten Jahres bekleidet. Wie eine hochheilige<br />
Gnade fließt vom Himmel goldener Staub, ein grünlicher<br />
Schleier, der sich Stunde um Stunde, Tag um Tag im Laub<br />
verfestigt, in grünender Flur kondensiert und kristallisiert,<br />
tief in die Erde eindringt und wie ein übernatürlicher Katalysator<br />
warme Gerüche freisetzt. Ich könnte stundenlang<br />
vor dem Haus sitzen und schauen, schnuppern und lauschen,<br />
wie die schönste Jahreszeit an Kraft gewinnt. Doch das gelingt<br />
mir fast nie, immer muss ich irgendwo hinfahren, aufbrechen,<br />
den Raum durchqueren. Schicksal. Aber ich beklage<br />
mich nicht. Denn unterwegs, mit Ortswechseln, aus einer<br />
vorübergehenden Perspektive sieht es noch schöner aus. Als<br />
flösse ich mit dem Strom des grünen Blutes im Körper des<br />
Landes. Als durchquerte ich dieses auf dem Rücken liegende,<br />
heiße Polen in seinen Adern, Arterien und Venen, die vor<br />
Überfluss, vor Bereitschaft, vor Potenzialität pulsieren. Wir<br />
leben im Innern, in der Mitte, aber wir brauchen den Mai,<br />
um uns die Reize dieser Eingeweide vor Augen zu führen.<br />
Ein Samstagabend bricht an. Grüne Schatten legen sich<br />
quer über die Straße. Du hältst am Geschäft „Delikatessen<br />
Zentrum“ in Ciężkowice an, um dir Cola und Red Bull für<br />
unterwegs zu kaufen. Junge Burschen kommen angefahren,<br />
mit Musik. Sie tragen enge weiße Unterhemden, silberne<br />
Kettchen und fernöstliche Tätowierungen. Die Bässe dröhnen.<br />
Die Mädels sind wie durch ein Wunder schon gebräunt.<br />
Der Innenraum des Geschäfts ist groß, hell und bunt wie im<br />
Film oder im Traum. Und der Samstag und der Mai mischen<br />
sich zu einem feierlichen, ekstatischen Cocktail. Von den<br />
Jungs und Mädchen her weht ein Duft von Parfüm. Sie sehen<br />
aus wie glückliche, verschüchterte Ehepaare, wenn sie<br />
Bier, Wurst, Senf, Brot, Holzkohle und Anzünder in die Einkaufswagen<br />
laden. Die Jungs tragen Shorts und Sportschuhe.<br />
Die Mädchen haben einen schwarzen Strich unter den<br />
Augen. Die etwas älteren Frauen nehmen hundertfünfzig<br />
Gramm von dem, hundert Gramm von dem und wieder hundertfünfzig<br />
von noch etwas. Alles in Scheiben geschnitten.<br />
Diese Trägheit und herrschaftliche Laune des „geschnitten<br />
bitte“ nervt mich immer, als hätten sie allesamt zu Hause<br />
kein Messer. Aber heute nicht, heute sieht es aus wie die<br />
Vorbereitung auf eine Hochzeit, auf einen Empfang, ein<br />
Festmahl, etwas Üppiges. Drei Sorten Schinken, Presskopf<br />
für zwanzig Zloty das Kilo, Radieschen, Salat, zum Trinken<br />
etwas Orangerotes mit Kohlensäure in Zweiliterflaschen<br />
und obendrauf die gebauschten Kissen von Chips in vier<br />
Geschmacksrichtungen. Vor einem Regal mit Wein steht ein<br />
älteres Ehepaar in meinem Alter. Seine Erinnerung reicht<br />
in die Zeit, als Wein einfach Wein war. Einheimischer und<br />
bulgarischer. Lieblicher und trockener. Weißwein, Rotwein,<br />
Wermut. Und hier ein Regal bis zur Decke. Die beiden stehen<br />
da und flüstern einander ins Ohr. Diskret weisen sie mit dem<br />
Finger hierhin und dorthin. Verloren wie Kinder in diesem<br />
Delikatessen-Geschäft, umgeben von der samstäglichen<br />
Maiaura, die etwas von Dispens hat, etwas von einer Lizenz<br />
zu gemäßigter Spinnerei mit alten Freunden bei einer Flasche<br />
Tokajer Furmint.<br />
Aus dem Polnischen von Renate Schmidgall
ARTUR<br />
DOMOSŁAWSKI<br />
TOD<br />
IN AMAZONIEN<br />
Artur Domosławski (geb. 1967), Journalist und<br />
Publizist. Ihn interessieren vor allem Lateinamerika,<br />
gesellschaftliche Konflikte und Antiglobalisierungsbewegungen.<br />
Der Autor war ein<br />
Schüler von Ryszard Kapuściński, dem er das<br />
Buch Kapuściński. Non fiction gewidmet hat. Es<br />
erschien 2010 in Polen, ist kurz darauf in mehrere<br />
Sprachen übersetzt worden und wurde zu einem<br />
internationalen Bestseller.<br />
Brasilien, Bundesstaat Pará. Es ist der 24. Mai 2011. Unbekannte<br />
Täter schießen auf zwei Umweltschützer. José Claudio da<br />
Silva und seine Frau Maria sterben auf der Stelle. Die Mörder<br />
schneiden José ein Ohr ab – als Beweis für die Auftraggeber.<br />
Es stellt sich heraus, dass das kein Einzelfall ist. Die Anführer<br />
der Bauern und die Umweltschützer, die im Amazonas-Gebiet<br />
wohnen, bekommen Drohungen und leben in ständiger Angst.<br />
„Im Bundesstaat Pará wurden in den letzten fünfzehn Jahren<br />
205 Landaktivisten ermordet, in den letzten vier Jahrzehnten<br />
– über 800. In den Gefängnissen sitzen nicht einmal fünf<br />
der Auftraggeber dieser Verbrechen“, sagt einer der Protagonisten<br />
der Reportage. Die Polizei und die örtlichen Behörden<br />
schauen diesen Machenschaften untätig zu, vielleicht sind sie<br />
sogar daran beteiligt. Worum geht es hier?<br />
Wenn wir mit der Lektüre von „Tod in Amazonien“ beginnen,<br />
haben wir die Erwartung, den Autor bei seinen journalistischen<br />
Recherchen, die zur Lösung des Rätsels führen,<br />
begleiten zu können. Wir denken, dass wir die Namen der<br />
Schuldigen erfahren und etwas über ein gerechtes Urteil lesen<br />
werden, oder – im schlimmsten Fall – anfangen, über die<br />
Gleichgültigkeit der Gerichte in Lateinamerika nachzusinnen.<br />
Wir vermuten jedoch nicht, dass die Fäden der Verflechtungen,<br />
die bei den im Buch beschriebenen Ereignissen ihren<br />
Anfang nehmen, bis zu unseren Häusern reichen. Und dass<br />
wir am Ende der Lektüre die Welt anders betrachten werden<br />
– auch die, die uns am nächsten ist.<br />
Die drei hervorragenden Reportagen, die sich zu dem<br />
Band „Tod in Amazonien“ zusammenfügen, verbindet ein<br />
Thema: Die groß angelegte Zerstörung der natürlichen Umwelt<br />
(die Rodung der Amazonas-Regenwälder in Brasilien,<br />
der Goldabbau in Peru und die Ölförderung in Ecuador) und<br />
die damit einhergehende Vernichtung lokaler Gemeinschaften.<br />
Die Helden in Domosławskis Buch sind gewöhnliche und<br />
gleichzeitig ungewöhnliche Menschen, die für die Rettung<br />
der Umwelt und für ein Leben in Würde alles riskieren. Ihr<br />
Kampf – so scheint es – ist von vornherein zum Scheitern verurteilt,<br />
obwohl der letzte Text einen Funken Hoffnung lässt.<br />
Der Reporter spricht mit Bauern und den Aktivisten vor Ort,<br />
mit investigativen Journalisten, Juristen und Geschäftsleuten.<br />
Faden für Faden entwirrt er geduldig die komplizierte<br />
Vernetzung zwischen den Mördern, der lokalen Wirtschaft,<br />
der Politik und den transnationalen Konzernen. Er zeigt die<br />
Rücksichtslosigkeit der Geschäftsleute und Politiker auf, ihre<br />
Betrügereien, Manipulationen und Propagandatricks.<br />
Ausgehend von Details und konkreten Situationen eröffnet<br />
der Autor eine breite Perspektive. Und das ist einer der<br />
Momente, in denen die Lektüre besonders eindringlich wird.<br />
Wenn wir bis jetzt glaubten, wir hätten mit der Vernichtung<br />
der Amazonas-Regenwälder nichts zu tun, so ist es an der Zeit,<br />
sich in der eigenen Wohnung umzuschauen... Nach der Lektüre<br />
der zwei anderen Reportagen werden wir uns auch nicht<br />
besser fühlen.<br />
„Wir verurteilen ein Verbrechen – dieses und jedes nächste.<br />
Aber können wir schwören, dass wir an der Verteilung der<br />
Beute nicht beteiligt sind?“, fragt der Autor und bezieht sich<br />
dabei auf Sven Lindqvist, einen anderen hervorragenden Reporter.<br />
Das Buch von Artur Domosławski – verhalten, konkret,<br />
voller Fakten und Namen – hat die Kraft einer Sprengladung.<br />
Nach der Lektüre möchte man auf die Straße gehen und die<br />
Welt verändern. Es ist wohl an der Zeit.<br />
Małgorzata Szczurek<br />
ARTUR DOMOSŁAWSKI<br />
„ŚMIERĆ W AMAZONII”<br />
WIELKA LITERA, WARSZAWA 2013<br />
205×135, 328 PAGES<br />
ISBN: 978-83-64142-13-0<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
POLISHRIGHTS.COM
TOD<br />
IN AMAZONIEN<br />
Sein Körper<br />
war von siebzehn Kugeln durchlöchert.<br />
Vier Kugeln hatten die Bauchhöhle durchbohrt, sechs –<br />
den rechten Lungenflügel, eine – den äußeren Hals auf der<br />
linken Seite, noch eine andere blieb im Hinterkopf stecken<br />
und der Rest zerfetzte die übrigen Körperteile.<br />
Edmundo Bercerra – alle nennen ihn Esmundo – dreiundvierzig<br />
Jahre alt, tränkte gerade sein Vieh an einer Wasserstelle,<br />
die Pampa del Ahijadero genannt wird. Nicht weit<br />
von dem Dorf Yanacanchilla entfernt, wo er mit seiner Frau<br />
und dem vierjährigen Sohn wohnte.<br />
Die Schwester des Getöteten, Jovita, sah die Mörder aus<br />
einiger Entfernung: Zwei Männer – in einem roten und in<br />
einem blauen Poncho. Einer trug eine Mütze, der andere einen<br />
Hut. Später hat sich herausgestellt, dass auch noch ein<br />
dritter dort war. Vor der Hinrichtung soll einer der Mörder<br />
gesagt haben, die nächsten, solche wie Esmundo, würden<br />
auch so enden. Kurz danach fielen Schüsse. Siebzehn Stück.<br />
Die Mörder flüchteten in Richtung der Straße, die nach<br />
Bamabamarca führt. Sie hatten nichts gestohlen, ein Raubmotiv<br />
war also von vornherein ausgeschlossen.<br />
Ich schaue Zeitungsausschnitte der lokalen Presse durch,<br />
aus den direkt davor liegenden Tagen.<br />
Eine der Zeitungen berichtete, dass sich Esmundo<br />
auf eine Reise nach Lima vorbereitete; zum Treffen einer<br />
Kommission, die sich aus Gegnern des Konzerns und<br />
seiner Praktiken und aus Vertretern des Ministeriums<br />
zusammensetzte. Es ging um den Abbau der Lagerstätten<br />
des Hügels San Cirilo. Esmundo und die Dorfbewohner widersetzten<br />
sich diesem Plan. Ivan Salas, einer der örtlichen<br />
Aktivisten, hatte zuvor Alarm geschlagen; der Konzern<br />
Yanacocha-Newmont würde Gebirgsbauern bewaffnen, die<br />
sich auf seine Seite geschlagen hatten. Sie sollten auf ihre<br />
Nachbarn schießen, weil diese es ablehnten, dem Konzern<br />
ihr Land zu verkaufen und weil sie sich dem Abbau der Lagerstätten<br />
widersetzten. „Wir haben es mit einer Bande zu<br />
tun, die mit dem für den Konzern tätigen Büro für Landerwerb<br />
zusammenarbeitet. Vor ein paar Wochen, als ein Ingenieur<br />
gekommen ist, um topografische Untersuchungen<br />
durchzuführen, hat die gleiche Bande auf ihn geschossen<br />
und ihn an der Arbeit gehindert.“<br />
Die Konzernvertreter sagten, das seien Lügen.<br />
Die konzernnahen Zeitungen berichteten, bei Esmundos<br />
Ermordung sei es um einen „Landkonflikt“ und um die „Begleichung<br />
von Rechnungen“ gegangen.<br />
Jemand erinnerte daran, dass ein paar Monate zuvor,<br />
nach dem Mordanschlag auf den Aktivisten und Konzernkritiker<br />
Isidro Llanos, der Vertreter von Yanacoch-Newmont<br />
öffentlich erklärte, der Aktivist sei an einem Herzinfarkt
gestorben. In Wirklichkeit ist Isidro Llanos bei einem Zusammenstoß<br />
von protestierenden Arbeitern mit Sicherheitsleuten<br />
des Konzerns und der Polizei erschossen worden.<br />
Es ist Marco, der mir am meisten über Esmondo und die<br />
Umstände seiner Ermordung erzählt.<br />
Er war kein typischer, armer Bergbauer aus der Region<br />
von Cajamarca, sagt Marco. Esmondo war gebildet, Tierarzt<br />
von Beruf. Er besaß ein ziemlich großes Stück Land, eine<br />
kleine Viehherde und war Milchproduzent.<br />
Als der Konzern damit begann, etwas oberhalb des Dorfes<br />
Yanacachilla neue Lagerstätten abzubauen, gründete<br />
Esmundo eine Front für Umweltschutz. No pasaran! Als<br />
Antwort holte der Konzern Leute, die nicht aus der Region<br />
stammten und wie die Ureinwohner der Anden aussahen.<br />
Sie fingen an, sich in dem Gebiet oberhalb des Dorfes anzusiedeln.<br />
Dann gründeten sie eine „Konkurrenz-Front“ für<br />
Umweltschutz und Entwicklung – eine typische Strategie<br />
des Konzerns, der später sagen konnte: schaut wie viele<br />
Ortsansässige uns unterstützen. Die „Importierten“ hatten<br />
Waffen und Walkie-Talkies, und agierten wie eine organisierte<br />
Gruppe.<br />
Der Konflikt eskalierte, als Esmundo sein Vieh an den<br />
Lagunen tränken wollte, die sich auf dem von den Ankömmlingen<br />
besetzen Boden befanden. Das Eigentumsrecht<br />
erstreckt sich nicht auf die Lagunen; die Landbesitzer,<br />
auf deren Gebiet sie sich befinden, sind verpflichtet, zum<br />
Beispiel Bauern, die ihr Vieh tränken wollen, den Zugang<br />
dorthin zu ermöglichen. Doch die „neuen Siedler“ scherte<br />
das nicht.<br />
Esmundo bekam Drohungen: Misch dich nicht in die<br />
Angelegenheiten der Mine ein. Er wurde aufs gröbste beschimpft.<br />
Eines Tages wurde er von bewaffneten Männern verprügelt.<br />
Er fuhr zum Polizeirevier in Chanta Alta, zwei<br />
Stunden vom Dorf entfernt, um Anzeige zu erstatten. Fahr<br />
zum Richter, sagten die Polizisten, nach Cajamarca, und sie<br />
lachten.<br />
Andere eingeschüchterte Bauern hörten, wie die Männer<br />
aus der bewaffneten Gruppe prahlten, sie seien unantastbar,<br />
weil sie unter dem Schutz von Yanacocha-Newmont stünden.<br />
Kurz danach wurde Esmundo erschossen.<br />
Der Mordanschlag, sagt Marco, erinnert an die typisch<br />
kolumbianische oder brasilianische Art, sich eines unbequemen<br />
Anführers einer Gemeinschaft zu entledigen. Das<br />
Projekt der Ausbeutung neuer Lagerstätten wurde gestoppt.<br />
Die „importierten“ Bergbauern sowie die von ihnen gegründete<br />
Front für Entwicklung verschwanden im Nichts.<br />
Esmundos Dorf, eine kleine Gemeinschaft von damals<br />
fünfundvierzig Familien, war traumatisiert. Angst griff<br />
um sich, Misstrauen und Argwohn. Das Verbrechen hat<br />
diese Menschen gebrochen, sagt Marco. Esmundos engster<br />
Kampfgefährte, Genaro López, ist nach Cajamarca umgesiedelt.<br />
Er hält sich von allen öffentlichen Aktivitäten fern und<br />
will über den Tod des Freundes nicht sprechen.<br />
Esmundos Frau ist mit dem Kind weggezogen. Man weiß<br />
nicht wohin.<br />
Laut den Erzählungen der Leute war Esmundo ein außergewöhnlicher<br />
Mensch; der „zweite Anführer der lokalen<br />
Dorfgemeinschaft“ (nach Marco Arana). Hilfsbereit, charismatisch,<br />
intelligent. Deshalb war er politisch unbequem.<br />
Geradezu gefährlich.<br />
Die Presse und die Bulletins der Protestbewegungen erinnern<br />
daran, dass er in den letzten Jahren der sechste Anführer<br />
aus der Region Cajamarca war, der ermordet wurde.<br />
2003: José Llajahuanca aus San Ignacio.<br />
2004: Juan Montenegro aus Santa Cruz.<br />
2005: Reinberto Herrera und Melanio Garcia aus San<br />
Ignacio.<br />
2006: Isidro Llanos aus Combayo.<br />
Jeder von ihnen starb unter anderen Umständen, doch<br />
fast immer waren die Täter unbekannt. Isidro Llanos hatte<br />
im Konzern einen Streik wegen sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen<br />
organisiert. Er wurde während einer Schlägerei<br />
der Streikenden mit den Sicherheitsleuten des Konzerns<br />
und der Polizei erschossen.<br />
Esmundo wurde das Opfer einer geplanten, kaltblütigen<br />
Hinrichtung.<br />
Man könnte über die Motive spekulieren. Ein Motiv<br />
drängt sich aber wie von selbst auf, auch wenn man es zu<br />
verdrängen versucht. Kann man einen Zufall ausschließen?<br />
Zumindest nicht ganz. Doch wer sollte Esmundo umbringen<br />
wollen? Und warum?<br />
Und hier glaubt niemand an Zufälle oder das Begleichen<br />
von Rechnungen.<br />
Düstere Orte und tragische Ereignisse rufen manchmal<br />
merkwürdige und unerwartete Assoziationen hervor. Es<br />
ist einige Jahre her, da hatte ein Dichter in einem anderen<br />
Teil der Welt ein Gedicht über ein Ungeheuer geschrieben.<br />
Jetzt, da ich versuche, die Atmosphäre in Cajamarca wiederzugeben,<br />
erscheint es mir, als ob das Gedicht diesen Ort<br />
beschreiben würde: Unbekannte Täter. Opfer. Anschuldigungen,<br />
die an Paranoia grenzen. Keine Beweise. Unsicherheit.<br />
Angst.<br />
[...]<br />
Dank der Aussagen von Esmondos Schwester konnte die<br />
Polizei die Namen der Mörder schnell ermitteln: die Brüder<br />
Aguinaldo und Fortunato Rodriguez. Am Tatort war noch<br />
ein dritter Mann gewesen, doch man ließ die Anschuldigungen<br />
gegen ihn fallen.<br />
Als die Polizisten den Hauptmörder festnehmen wollten,<br />
kam es zu einer Schießerei. Aguinaldo starb auf der Stelle.<br />
Die Umstände lassen den Verdacht aufkommen, man wollte<br />
den Täter erst gar nicht verhaften. Sollte er sterben, damit<br />
er vor Gericht nicht aussagt?<br />
Mirtha ist an Informationen gekommen, die uns vermuten<br />
lassen, dass es so sein könnte. Der Täter war ein in der<br />
Gegend bekannter Auftragskiller, der Hinrichtungen ausführte.<br />
Ein Tag vor seinem Tod rief er den Congressman<br />
Werner Cabrery an und sprach mit seinem Assistenten<br />
Ivan Salas. Aguinaldo kündigte an, er werde sich der Polizei<br />
stellen und sagen, wer der Auftraggeber für den Mord<br />
an Esmondo gewesen sei. Als man ihn am nächsten Tag zu<br />
fassen versucht, kommt er ums Leben.<br />
Aus dem Polnischen von Joanna Manc
KATARZYNA<br />
PAWLAK<br />
EINMAL CHINA UND ZURÜCK<br />
ALLTAGSNOTIZEN AUS<br />
DEM REICH DER MITTE<br />
Katarzyna Pawlak ist Soziologin, Übersetzerin<br />
und Koautorin eines Lehrbuches für Chinesisch.<br />
Sie ist Reisende und Bloggerin – aus ihrem Blog<br />
www.zachinyludowe.net, den sie während ihres<br />
Studienaufenthalts in China geführt hat, entstand<br />
ihr vorliegendes Buch. Sie hat in Taipeh,<br />
Peking und Shanghai gelebt. Am liebsten reist<br />
sie ohne Eile durch China.<br />
Im Wörterbuch wird das Wort „Ausländer“ ins Chinesische<br />
mit wàiguórén übersetzt, sprich: „ein Mensch aus einem äußeren<br />
Land“. Das klingt neutral. Aber die Chinesen benutzen<br />
meist lieber den Ausdruck lăowài, was so viel heißt wie „alter<br />
Äußerer“. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Lăowài<br />
klingt wie: „du bist nicht von hier, und du wirst es nie sein“.<br />
„,Mama, schau mal, da kommt ein lăowài. Der Knirps zeigt<br />
auf mich und seine Mutter lacht, so klein und schon so schlagfertig“,<br />
schreibt Pawlak. „,Aah, ein lăowài‘ – die Arbeiter und<br />
eine Gruppe jugendliche Sprösslinge zeigen mit dem Finger<br />
auf mich. Nach diesem Ausruf folgt zumeist im Falsett: ,Helloooo!<br />
Okeey?’ Dann Gekicher. Und dann laufen sie weg.“<br />
Der Autorin, die mit diesem Begriff versehen wird, fällt<br />
auf, dass ihr nach zwei Monaten aus dem Spiegel jemand<br />
entgegenschaut, den sie vorher nicht kannte. „Das ist nicht<br />
mehr Kasia, die Polin, die (im Grunde noch junge) Frau, die<br />
Doktorandin, sondern ein großer, blasser ‚alter Äußerer‘ mit<br />
‚strohfarbenem Haar und einem riesigen Zinken‘.“ Dieses Gefühl<br />
der Fremdheit erfährt jeder Ausländer in China. Wenn<br />
er zum tausendsten Mal gefragt wird, ob er China mag und<br />
ob ihm das Essen schmeckt, selbst wenn er seit Jahren hier<br />
wohnt, wird er versuchen, die Chinesen davon zu überzeugen,<br />
dass er kein „alter Äußerer“ sondern ein Mensch ist.<br />
Die Autorin versucht es auch. Doch nach einem spannenden<br />
Referat, das sie fließend auf Chinesisch an der Universität in<br />
Shanghai hält, vernimmt sie verwunderte Fragen, ob sie wisse,<br />
wer Konfuzius war und – natürlich – ob sie chinesisches<br />
Essen mag.<br />
In ihrer Beschreibung des Reiches der Mitte nimmt die Autorin<br />
chinesische Wörter zu Hilfe, wie beispielsweise benben<br />
zu. Das ist ein sich herumtreibender Stamm, sprich, Arbeitsmigranten,<br />
die nirgendwo sesshaft werden. Oder yi zu – das<br />
Ameisenvolk: arme Chinesen aus der Provinz, die an den Peripherien<br />
Pekings und Shanghais leben.<br />
„Einmal China und zurück“ ist eine überaus amüsante und<br />
ungeheuer intelligente Beschreibung des zeitgenössischen<br />
China. Die Autorin ist studierte Soziologin und Sinologin, sie<br />
hat einen ausgezeichneten Schreibstil und die Gabe des passenden<br />
Ausdrucks sowie der treffsicheren Pointe.<br />
Pawlak hat zwei Jahre in Shanghai und Peking verbracht,<br />
sie hat den Chinesen im Zug und auf der Straße sowie in den<br />
Bergen und während des chinesischen Neujahrsfestes Gesellschaft<br />
geleistet. Sie hat mit ihnen ferngesehen und chinesische<br />
Zeitungen gelesen. Sie hat zugesehen, wie sie Sonnenblumenkerne<br />
essen, wie sie ganze Litaneien englischer<br />
Wörter pauken und im Zug spucken, dass man kein trockenes<br />
Plätzchen für seinen Rucksack findet.<br />
Lassen Sie sich von der leichten Form nicht beirren. „Einmal<br />
China und zurück“ ist ein gutes Stück solider soziologischer<br />
Arbeit. Es besteht aus kleinen Traktaten über das<br />
chinesische Fernsehen und das Internet, über das konfuse<br />
Hùkŏu-System (Wohnsitzkontrolle), das Gesundheitssystem,<br />
soziale Ungleichheiten, die Mitgift, die in China von den Männern<br />
eingebracht wird, die Rolle der Frau und viele andere<br />
Themen.<br />
KATARZYNA PAWLAK<br />
„ZA CHINY LUDOWE”<br />
DOM WYDAWNICZY PWN<br />
WARSZAWA 2013<br />
127×200, 248 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7705-322-5<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
DOM WYDAWNICZY PWN<br />
Maria Kruczkowska
EINMAL CHINA<br />
UND ZURÜCK<br />
ALLTAGSNOTIZEN AUS<br />
DEM REICH DER MITTE<br />
ALS ICH<br />
eine Wohnung zur Miete suchte und in den Agenturen meinen<br />
finanziellen Rahmen nannte, bot man mir Wohnungen<br />
in „alten Plattenbauten“ an: „Das heißt, wie alt?“ „Etwa<br />
fünfundzwanzig Jahre“. Ich hatte in Warschau in einem der<br />
ersten Exemplare der realsozialistischen Bauweise gewohnt,<br />
einem soliden Koloss in Muranów mit so dicken Wänden,<br />
dass Titanbohrer versagten, und ich dachte bei mir, dass es<br />
lächerlich sei, ein dreißigjähriges Gebäude „alt“ zu nennen,<br />
und verstand das Problem gar nicht (oder wollte es nicht<br />
verstehen; jeder, der einmal sehr weit weg gelandet ist und<br />
länger bleiben will, weiß, unter welchen Bedingungen man<br />
sein Domizil wählt). Die Leute sagten vorsichtig, die Qualität<br />
sei nicht die beste. Ich dachte, dass es vielleicht keinen<br />
Fahrstuhl gibt oder dass andere Attraktionen auf mich<br />
warten, die für die polnischen Plattenbauten typisch sind<br />
– schlechte akustische Isolierung, alte Fenster oder schiefe<br />
Wände. Und wie das so ist, habe ich mir gedacht, dass<br />
diese ganzen Dinge, mit denen man konfrontiert sein kann,<br />
wenn man in einem Gebäude mit nicht allzu hoher Qualität<br />
wohnt, mir natürlich erspart bleiben werden. Entweder<br />
nehmen sie die Gestalt kleiner, nicht genauer präzisierter<br />
Reparaturen an, eines lächelnden Handwerkers, kleiner<br />
Nägelchen oder Dichtungen, die für jemanden, der sich mit<br />
einem Koffer in einer Fünfundzwanzig-Millionen-Stadt<br />
befindet und vollkommen allein und ohne ein Zuhause ist,<br />
absolut inhaltslos sind. Im Übrigen: ein Dach über dem Kopf,<br />
Strom, Gas (beinahe mit Entzücken habe ich die Nachricht<br />
aufgenommen, dass hier überall Gas installiert ist, dass<br />
man keine Gasflaschen schleppen muss, wie einst in meiner<br />
Wohnung in Taiwan) und Wasser. Was braucht man mehr?<br />
Zumal ich eine Wohnung fand (in der ich jetzt sitze und<br />
schreibe; vielleicht geht sie heute doch nicht in die Luft?),<br />
die schön, sauber, hell und sympathisch ist. Im Treppenhaus<br />
sieht es natürlich anders aus: alte Eimer, kaputte Möbel,<br />
ein Kanarienvogelkäfig ohne Kanarienvogel und Momo,<br />
der Bobtail des Nachbarn – ich habe fast gar nicht erkannt,<br />
dass das ein Bobtail ist, er ist rasiert, damit ihm nicht so<br />
heiß wird. Er schläft im Treppenhaus, weil es in der Einzimmerwohnung<br />
zu eng ist.<br />
Noch mehr hat mir die Wohnsiedlung selbst gefallen, die<br />
sich ungefähr folgendermaßen zusammensetzt:<br />
a) ein Dutzend abgeblätterter Wohnblöcke mit einer<br />
Million Anbauten + Bewohnern (im Umkreis der<br />
Siedlung laufen sie in ordentlichen Pyjamas mit lustigen<br />
Mustern herum, passend – wovon ich mich bald<br />
überzeugen sollte – zur Jahreszeit: im Frühling und<br />
im Sommer aus Baumwolle, im Herbst und im Winter<br />
aus dickerem Steppmaterial).
) ein Markt, wo man außer Gemüse, Gewürze und Tofu<br />
auch lebendige Hühner und Tauben kaufen kann.<br />
Man kann sie sofort schlachten lassen.<br />
c) der bereits erwähnte Herr, der lebendige Frösche<br />
in einem Nylonnetz verkauft. SSL, die Taiwanesin<br />
(mit rotem Haar und einem Lächeln über das ganze<br />
Gesicht), die ich im Unterricht kennenlerne und sofort<br />
sympathisch finde, stiftet mich dazu an, einen<br />
zu kaufen, als Haustier. Als ich den Froschmann fürs<br />
Erste nach dem Preis für einen Frosch frage, fragt der<br />
zurück: „Du meinst einen jīn, 300 Gramm? Gleich ausnehmen?“<br />
d) der ebenfalls bereits erwähnte Herr, der alles Mögliche<br />
verkauft und alle möglichen Dienstleistungen anbietet<br />
(bis zum Ende meines Aufenthalts in Shanghai<br />
sehe ich nur den leeren Behälter, die Straße ist blutüberflutet,<br />
und der Mann hält eine unheilvolle blutige<br />
Klinge in der Hand).<br />
e) das Revolutionäre Straßenkomitee (so nenne ich es,<br />
zu Ehren der Sensationslüsternen und der Denunzianten<br />
der Komitees aus den Zeiten der Kulturrevolution;<br />
Ersatzbezeichnung: Alten-Rat). Seine Mitglieder<br />
sitzen auf kleinen Hockern an den Hauptkreuzungen<br />
von Alleen und passen auf. Graues Haar, Pyjamas,<br />
Spielkarten, neben ihnen schnauft ein alter Hund.<br />
„Der ist morgens aus ihrem Haus gekommen, obwohl<br />
sie nicht verheiratet sind.“ „Die hat einen fast noch<br />
guten Fernseher weggeworfen, ist wohl reich geworden,<br />
bestimmt durch krumme Dinger.“<br />
f) kleine Geschäfte und kleine Kneipen, darunter Kneipen,<br />
die von vier Generationen der Hui geführt werden.<br />
Die Hui-Frauen tragen schwarze Spitzentücher<br />
auf dem Kopf und schreien ihre schmutzigen Kinder<br />
an, die zwischen den Hockern herumkrabbeln. Sie bereiten<br />
das köstlichste Hammelfleisch mit Kümmel zu,<br />
und die Männer (Bärtchen, ein rundes weißes Mützchen<br />
auf dem Kopf) machen mithilfe einer Serie malerischer<br />
Box- und Armbewegungen die besten Nudeln<br />
der Welt. Zum Opferfest schlachten sie einen Hammel<br />
und färben dabei den Fußweg rot.<br />
g) eine Katzenhorde, darunter eine gestreifte Katze (angeblich<br />
hatte einst ein Nachbar sie eingelassen, vor<br />
dessen Tür sie zwei Tage lang miaut hatte, und sie<br />
hatte sofort sechs Kätzchen geworfen).<br />
man auf einer langen Liste gestanden hatte, eine Nähmaschine<br />
und ein kleines Plastikradio waren der Gipfel der<br />
Träume, ein Zeichen des Schicksals, dass sich alles fügen<br />
würde, dass alles in eine gute Richtung geht. Die kleine Stabilisierung,<br />
die kleine heile Welt.<br />
Heute atmen diese Siedlungen noch, noch sind sie lebendig,<br />
aber das ist ein Leben in einer Sackgasse der allgegenwärtigen<br />
und übermächtigen fāzhăn. Zunächst zerfällt<br />
eine Anlage nach der anderen, eine Treppe nach der anderen,<br />
ein Treppenhaus nach dem anderen. Und dann genügen<br />
ein paar Tage, eine Woche, und die Wäsche, der Basar,<br />
die Hühner und die Hui sind fort und die Fenster sind leer.<br />
Dann wird ein Wohnblock nach dem anderen von seinem<br />
Skelett abgetrennt, die Skelette zerfallen zu Staub, und an<br />
ihrer statt wachsen die Wohnungen der neuen Welt empor:<br />
shāngpĭnfáng – marktgerecht. Ohne Pyjama, ohne den Mann<br />
mit der Klinge, ohne die gestreifte Katze, aber dafür mit monitoring,<br />
einem kleinen Springbrunnen und einem unterirdischen<br />
Parkhaus. Vielleicht sogar mit einem Schwimmbad?<br />
Bevor jedoch dieser Prozess in meinem Wohngebiet<br />
einsetzt, verschimmelt zunächst in einer der kleinen<br />
Wohnungen in dem Gebäude mit dem kahlgeschorenen<br />
Bobtail innerhalb von zwei Tagen buchstäblich die ganze<br />
Wand – gleichmäßig grün, wie Gras, nur senkrecht („Die<br />
Dachrinne ist in der Wand, wie soll das also anders sein?!“,<br />
klärt mich der ansässige Meister auf, einer der vielen, die<br />
ein Jahr lang durch meine vier Wände ziehen). Und jetzt?<br />
Jetzt strömt Gas aus, scheußlich. Es hat sich buchstäblich<br />
innerhalb von Minuten etwas gelöst. Der Zufluss lässt sich<br />
nicht zudrehen, weil der Gasstrang nicht durch das Treppenhaus<br />
verläuft, sondern durch meine Wohnung, mitten<br />
durch meine Küche; so hat man früher gebaut, um Kosten<br />
für die Installationen und Zeit zu sparen. Die entfernte<br />
Stimme vom Gas-Notdienst (er sitzt weit weg in Sicherheit,<br />
bestimmt in einem neuen Wolkenkratzer oder einem<br />
marktgerechten Gebäude, der Schlaumeier!), den ich voller<br />
Panik anrufe, weist an, alle Fenster zu öffnen, die Tür zum<br />
Zimmer zu schließen, in dem ich schlafe, und bis morgen<br />
früh abzuwarten, bis sie mit einem neuen Rohr oder einem<br />
neuen Zähler kommen.<br />
Ich habe überhaupt keine Lust, aber ich werde wohl tanzen<br />
gehen, die ganze Nacht.<br />
Aus dem Polnischen von Antje Ritter-Jasińska<br />
Also scheinbar ist alles in Ordnung. Doch was ist hier<br />
besonders? All das sind Relikte aus einer Welt, die nach<br />
und nach verschwindet, die niemand mehr retten will,<br />
schließlich steht sie dem unerbittlichen Recht der fāzhăn<br />
– der Entwicklung – im Weg. „Ältere Bauweise“ bedeutet in<br />
diesem Falle, zu einer älteren Epoche zu gehören, die nach<br />
anderen Regeln und einer anderen Logik als die heutige<br />
funktioniert. Das war es, was meine Gesprächspartner mir<br />
vermitteln wollten. Meine Wohnung ist ein Überbleibsel<br />
einer Welt, in der einem eine Wohnung zustand. Sie war<br />
sowohl eine Verpflichtung gegenüber dem Bürger, als auch<br />
der Ausdruck des guten Willens des Staates und dessen mit<br />
dem Bürger am engsten verbundenen Nervenendes, der<br />
danwei (die kleinste Einheit, die Dienststelle). Diese Wohnungen<br />
unterlagen nicht den Kriterien und den Prinzipien<br />
des Marktes, weil es diese noch nicht gab. Dafür musste es<br />
viele Wohnungen geben und zwar jetzt, gleich, sofort. Wer<br />
würde bei einer so großen Mission nach ihrer Qualität fragen,<br />
umso mehr als sie umsonst sind? Eine Wohnung von<br />
danwei, ein Fahrrad der Marke yongjiu – Ewigkeit –, für das
WOJCIECH<br />
TOCHMAN<br />
ELI, ELI<br />
Wojciech Tochman (geb. 1969). Journalist und<br />
Schriftsteller sowie einer der bekanntesten<br />
übersetzten polnischen jungen Reporter. Seine<br />
Reportagen sind ins Englische, Französische,<br />
Schwedische, Finnische, Russische, Dänische und<br />
Bosnische übersetzt. Mit Zum Beispiel einen Stein<br />
essen war er im Finale für den polnischen Literaturpreis<br />
Nike und für den Prix Témoin du Monde,<br />
ausgezeichnet wurde er von Radio France International.<br />
Gemeinsam mit Paweł Goźliński und<br />
Mariusz Szczygieł leitet er das Polnische Reportageinstitut<br />
in Warschau.<br />
Das neue Buch von Wojciech Tochman – oder genauer gesagt<br />
von Wojciech Tochman und Grzegorz Wełnicki, denn die<br />
Fotografien des letzteren spielen nicht nur eine illustrative<br />
Rolle, sondern sind in gewisser Weise treibende Kraft für die<br />
Handlung und unverzichtbarer Teil der Erzählweise dieser<br />
Reportage – ist trotz seines geringen Textumfanges ein vielschichtiges<br />
und überaus anspruchsvolles Werk.<br />
Im Vordergrund steht die Geschichte über die erschreckenden<br />
Slums im philippinischen Manila mit einigen markanten<br />
Protagonisten, die sich über ihr Leben im klaren sind,<br />
und mit dem unglücklichen, von unbekannter Krankheit geplagten<br />
Baummädchen – eine Begegnung, mit der das Buch<br />
beginnt. Mit diesen Mikroerzählungen schafft Tochman ein<br />
breiteres Bild, das Bild der von der Gesellschaft ausgeschlossenen<br />
Armen, die von ihrem eigenen Staat und den wohlhabenderen<br />
Nächsten betrogen werden, wobei – wovon der Autor<br />
überzeugen will – zur Not und Kriminalität auch die Amerikaner,<br />
die auf den Philippinen einen Militärstützpunkt haben,<br />
entscheidend beitragen, ebenso die dominante katholische<br />
Kirche mit ihrem wahrhaft pharisäerhaften Antlitz.<br />
Genauso wichtig ist aber auch das Niveau der von den philippinischen<br />
Erfahrungen des Reporters und des Fotografen<br />
stimulierten doppelten Meta-Narration. Sie beruht zum einen<br />
auf dem Nachsinnen über Möglichkeiten, von außen in diese<br />
oder ähnliche Welten der permanenten Not einzugreifen<br />
– eher durch Einzelpersonen denn durch Institutionen. Was<br />
kann ich eigentlich für diese Menschen tun?, scheint sich<br />
Tochman zu fragen. Er antwortet mit einer Beschreibung dessen,<br />
was passiert ist, als er und Wełnicki es im Rahmen ihrer<br />
bescheidenen Möglichkeiten versuchen.<br />
Das zweite Problem ist die Frage des quasipornografischen<br />
Status’ des Bildes und der Berichte über Menschen in Not,<br />
sprich eine recht fundamentale ethische Frage all derer, die<br />
von dieser Not erzählen und sie zeigen. Dies betrifft selbst die<br />
einfachsten und offensichtlichsten Dinge: „Wenn ein Buch erfolgreich<br />
ist“, so Tochmann, „macht der Autor eine Lesereise<br />
im Inland, und wenn es sehr gut läuft, auch im Ausland, denn<br />
er wird von Bibliotheken, Kulturhäusern, Hochschulen, Buchmessen<br />
und Literaturfestivals eingeladen. Er sitzt vor einem<br />
vollen oder fast vollen Saal. Er spricht über menschliche Not,<br />
über Demütigung, Angst und Verachtung. Über Ungerechtigkeit,<br />
Ungleichheit und Ausbeutung. Er ist weise, aber das ist<br />
nicht seine eigene Weisheit. Oft sind es Gedanken derer, mit<br />
denen er gesprochen hat, während er an dem Thema gearbeitet<br />
hat. Ein Reporter existiert ohne Menschen nicht.“<br />
Das Buch Eli, Eli, dessen Titel sich aus den Worten Christi<br />
am Kreuz zusammensetzt, ist voller Schmerz, Zorn und Verzweiflung.<br />
Es stellt Fragen, die man vielleicht nicht unbedingt<br />
so beantwortet muss, wie der Autor es tut, von denen man<br />
sich aber nicht frei machen kann.<br />
Marcin Sendecki<br />
WOJCIECH TOCHMAN<br />
„ELI, ELI”<br />
CZARNE, WOŁOWIEC 2013<br />
190×240, 152 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7536-519-1<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
POLISHRIGHTS.COM
ELI, ELI<br />
Es sind<br />
keine glücklichen Kinderaugen, die uns anschauen. Ein Gesicht<br />
hinter einem Gitter, einem weißen Gitter aus einem alten<br />
Kühlschrank, das aus einem Junk-Shop hierhergebracht<br />
wurde. Feuchte, misstrauische, unbewegliche Augen. Das<br />
ist Pia. Drei Jahre alt, Hautgeschwüre, sie spricht nicht, sie<br />
kann sich kaum bewegen und lächelt selten. Sie sitzt in einem<br />
schwarzen Loch, das ihr Zuhause ist. Ein übelriechender<br />
Schrank, kleiner als zwei Meter, zurechtgezimmert aus<br />
Sperrholz und Lumpen. Ihr jüngerer Bruder, auf dem Foto<br />
rechts, lächelt nie. Das ist Buboy. Er verzieht das Gesicht<br />
und kratzt sich. Er hustet. In der Nähe wacht die Hand der<br />
Großmutter. Oder eher der Urgroßmutter. Sie ist fast achtzig,<br />
die Mutter der Kinder ist zwanzig. Über mindestens<br />
eine Generation gibt es keine Informationen. Aber keiner<br />
von uns fragt nach solchen Einzelheiten, keiner will seinen<br />
Kopf damit belasten. Das sind verlassene Kinder, sagt unser<br />
Fremdenführer. Die Mutter ist drogensüchtig, keiner weiß,<br />
ob sie lebt und wo. Der Vater sitzt im Gefängnis. Es ist nur<br />
die Großmutter da, die nichts hat und kaum spricht. Wahrscheinlich<br />
wird sie nicht mehr lange leben. Eine traurige<br />
Geschichte, ein trauriger Anblick.<br />
Wir sind in einer recht zahlreichen Gruppe gekommen,<br />
um die Armut zu fotografieren. Wir sind aus Madrid, Paris,<br />
Frankfurt, Warschau, London, Moskau, Tel Aviv, Sydney,<br />
Toronto und New York eingeflogen. Vereinfacht ließe sich<br />
sagen: aus dem Fernen Westen. Wir sind in der Adriatico-Straße<br />
abgestiegen, hier sind lauter Weiße, im Hostel<br />
Frendly’s haben wir unser Gepäck abgeworfen, in der Rezeption<br />
haben wir den Aushang für Entdecker gefunden,<br />
der unter dem Zeichen von Lonely Planet steht: True Manila!<br />
Das wahre Gesicht von Manila! Entdecke eine für Touristen<br />
unzugängliche Stadt! Free of charge! Fünf Uhr nachmittags<br />
im Where2Next, das Hostel nebenan.<br />
Veranstalter des Ausfluges ist Edwin N., ein Mann, der<br />
auf die vierzig zugeht.<br />
°<br />
Edwin N.s Geschichte:<br />
„… ich war neun Jahre alt und hatte einen festen Tagesplan.<br />
Gegen Mittag sammelte ich eine Stunde lang Müll,<br />
Plastik und Gerümpel, um ein Uhr ging ich in die Schule,<br />
dann nahm ich um fünf Uhr vom Lieferanten die Abendzeitung<br />
Red Light District entgegen, ich schlief ein bisschen auf<br />
dem Asphalt, mit dem Kopf auf den Zeitungen, aber dann<br />
musste ich los und bis fünf Uhr morgens über den versmogten<br />
highway laufen und Zeitungen verkaufen, um sechs<br />
Uhr kam die Morgenzeitung, highway bis neun Uhr, dann<br />
endlich zwei Stunden schlafen, aufwachen, Müll, Plastik,<br />
Schrott, Schule …
… in unsere Straße kommen keine white people, die trauen<br />
sich nicht. Eines Tages sehe ich zwei, einen Mann und<br />
eine Frau, hatten sich verlaufen, sie sahen wirklich interesting<br />
aus, ich konnte meine Augen von ihrer weißen Haut<br />
nicht losreißen, ich rief ihnen zu „Hey Joe!“, das war das<br />
einzige, was ich auf Englisch konnte, sie fotografierten<br />
mich, lächelten und gingen weiter. Ich lass mich nicht einfach<br />
so fotografieren, dachte ich mir, so für umsonst, und<br />
lief ihnen nach, sie wohnten weit weg, das waren christliche<br />
Missionare, ich weiß nicht mehr, hier bei uns gibt es<br />
massenweise Leute mit Jesus auf den Lippen, sie schenken<br />
jedem Kind einen Lutscher und wollen gleich seine Seele,<br />
die hier wollten nicht, deshalb freundete ich mich mit ihnen<br />
an, sie nahmen mich mit ins Wendy’s auf einen Hamburger,<br />
zeigten mir das Kino, einen amerikanischen Film,<br />
dafür zeigte ich ihnen das wahre Manila, dann reisten sie<br />
ab, vorher gaben sie mir Briefpapier und stamps, sie sagten,<br />
ich sollte ihnen schreiben, auf Englisch, dann kamen sie<br />
zurück, schenkten mir eine Gitarre und brachten mir bei,<br />
sie zu spielen, sie hatten hier ein schönes Haus, voller <strong>Bücher</strong>,<br />
sie fotografierten mich wieder, das sind die einzigen<br />
Fotos, die ich aus meiner Kindheit habe, dann reisten sie<br />
wieder aus, ich ging zur Schule, Vater schlug mich jeden<br />
Tag, heftig und ins Gesicht, ich beschloss, mich selbst zu<br />
retten, da war ich schon etwa dreizehn, ich lief weg von<br />
Zuhause, erhielt meine Briefe nicht, der Kontakt mit den<br />
Missionaren brach ab …<br />
… als ich neunzehn war, schloss ich die Mittelschule ab,<br />
von irgendetwas musste ich leben, ich verkaufte auf dem<br />
highway Zigaretten, Mutter verkaufte gebrauchte Kleidung<br />
und half mir, und ich half ihr, es hing vom Tag ab, wer mehr<br />
verdiente, ich studierte an der Universität Kriminologie,<br />
ich wollte Polizist werden, ich habe sieben Schwestern,<br />
die mussten beschützt werden, aber ich eigne mich dazu<br />
nicht, ich bin zu nervös, und ein policeman hätte hier auch<br />
kein Leben gehabt, ich hatte noch immer Angst vor meinem<br />
Vater, deshalb brach ich das Studium nicht ab, ich arbeitete<br />
in einem Videoshop, putzte in einem Kino nach den<br />
Vorführungen, eine fürchterliche Tätigkeit, ich schrubbte<br />
Klos und Fußböden im Robinson, hard job, drei Leute auf ein<br />
riesiges Handelshaus, wir wurden nicht bezahlt, der Arbeitgeber<br />
verschwand, was sollte ich machen, ich verkaufte<br />
im Wendy’s Burger, von vier Uhr morgens bis zehn Uhr in<br />
the evening, Arbeit und Studium am laufenden Band einige<br />
Jahre lang, ich lernte auch klassische Gitarre an der Musikschule,<br />
wir hatten an der Universität eine Band, doch woher<br />
dafür Zeit und Kraft nehmen, ich war sechsundzwanzig geworden,<br />
ich beendete mein Studium, ich heiratete, wir haben<br />
zwei Kinder, meine Tochter heißt Jessica, zu Ehren der<br />
amerikanischen Missionarin, und mein Sohn heißt Timmi,<br />
wie ein hier bekannter Schauspieler aus einer soap opera …<br />
… endlich eröffnete ich meinen eigenen Titanic Video<br />
Shop, wo sich mein betrunkener Vater jeden Tag auf dem<br />
Fußboden erbrach, deshalb ging Titanic nach einem Jahr<br />
unter, ich hatte verschiedene Geschäfte, sie gingen alle<br />
nacheinander ein, uns hat hier niemand beigebracht, wie<br />
man Unternehmen führt, in der Onyx-Straße gelingt nichts,<br />
no success, du verschuldest dich und fällst in einen Abgrund,<br />
I was happy, ich spielte in einem Film, das war nicht einfach,<br />
ich spielte den Anführer einer Gang und wurde umgebracht,<br />
dann lächelte ich in einer Kaffeewerbung, man rief mich<br />
hier Double Espresso, endlich landete ich im Frendly’s in der<br />
Adriatico-Straße, da sind viele Ausländer, sie reisten ein,<br />
reisten aus, ließen offene Kühlschränke mit Marmelade<br />
und Käse zurück, man ging dorthin, um sich zu ernähren,<br />
jemand fragte mich, wo ich wohne, ich dachte mir, dass mir<br />
einst weiße Menschen geholfen hatten, und dass ich ihnen<br />
heute helfen werde …<br />
… ich zeige ihnen free of charge meine wahre city, es wäre<br />
nicht fair, cash dafür zu nehmen, dass man Armut zeigt …<br />
… bevor wir losgehen, bereiten wir immer Plastiktüten<br />
mit Nahrungsmitteln vor, ein bisschen Reis und eine Büchse<br />
Sardinen, keiner der white people zahlt dafür, wir ziehen<br />
durch die Slums und verteilen das, jeder hat mehrere Tüten,<br />
jeder muss sich über den Notleidenden beugen, ihm in die<br />
Augen schauen und ihm das geben, so bringen wir den Ausländern<br />
bei, dass die Philippinen nicht nur eine grüne Insel<br />
und der türkisfarbene Ocean sind, dass wir hier auch eine<br />
andere Welt haben, eine dunkle und stinkende Welt, manche<br />
sind steif vor Verlegenheit, zum ersten Mal in ihrem<br />
Leben geben sie einem Armen etwas zu essen, ohne Worte,<br />
obwohl wir usually hier Englisch sprechen, haben manche<br />
keine gemeinsame Sprache mit den Armen, andere weinen,<br />
noch andere geben mit ihren photos an, und manche sagen<br />
über uns solche Dinge, dass man sich schämen müsste, das<br />
zu wiederholen …<br />
… wenn wir fertig sind, nehme ich meine Mütze und<br />
bitte um eine Spende, dafür essen wir dann in the evening<br />
gemeinsam im Hostel, und das, was übrig bleibt, teilen wir<br />
durch zwei, der eine Teil wird für die Bildung der Kinder<br />
in der Onyx bestimmt, den zweiten Teil geben wir für die<br />
Nahrungsmittel für die nächste Gruppe aus, wir kaufen Reis<br />
und Sardinen, vielleicht noch etwas anderes, erst kam eine<br />
Gruppe, dann die zweite, die zehnte, ein Fotograf aus Polen,<br />
er hieß Gregory, er sagte, nenn diese Führungen True Manila,<br />
das tat ich, dann kam die zwanzigste, dreißigste, die<br />
sechzigste, wir haben ein Facebook-Profil, ich mache das<br />
gern, ich zeige gern den Weißen unsere Armut, ich mag<br />
die großen weißen Frauen, white people vertrauen mir, sie<br />
gehen mit mir sogar bis hierher, zu Unrecht, schließlich<br />
könnte ich ein Bandit sein, ich wohne in der Onyx, oder ein<br />
Messerstecher, Geld her und fuck off, aber zu eurem Glück<br />
bin ich OK, ich bin ein Kind der Onyx, kein Mörder, kein<br />
Dieb, kein Terrorist, wir sind normale Penner, wir werden<br />
hier zahlreich geboren, wir sammeln Schrott, damit wir<br />
uns Reis kaufen können, wir sterben jung, schaut her und<br />
fotografiert unser Leben ohne Furcht, ohne Gewissensbisse,<br />
unsere Onyx gehört euch!<br />
Aus dem Polnischen von Antje Ritter-Jasińska
ANGELIKA<br />
KUŹNIAK<br />
PAPUSZA<br />
Angelika Kuźniak Angelika Kuźniak (geb. 1974),<br />
Journalistin und Reporterin, drei Mal mit dem<br />
Grand Press-Preis ausgezeichnet. Ihr 2009 erschienener<br />
Reportagenband Marlena, der Marlene<br />
Dietrichs letzten Jahren gewidmet ist, wurde<br />
vom Publikum sehr positiv aufgenommen.<br />
Die Geschichte von Bronisława Wajs, genannt Papusza, ist<br />
fremdartig und exotisch. Die am Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
geborene Zigeunerin und Dichterin wurde als ein folkloristisches<br />
Schmuckstück gesehen – ein wenig wie „eine Frau<br />
mit Bart“. Die Gestalt aus dem Raritätenkabinett faszinierte,<br />
doch wurde sie ernst genommen? War sie eine „Zigeunerdichterin“<br />
oder einfach nur „Dichterin“? Aus Angelika Kuźniaks<br />
Buch geht klar hervor, was Papuszas Persönlichkeit geformt<br />
hat; die Welt des Zigeunerlagers war der Stoff, aus dem sie<br />
gemacht war, aber auch die Populärliteratur! Eine geborene<br />
„Perle“, ein Zigeunerkind, das neugierig auf die Welt war und<br />
das – gegen seine eigentliche Bestimmung – zuerst lesen und<br />
dann schreiben lernte, um schließlich alle Romane und Erzählungen<br />
zu verschlingen, die es in die Finger bekam.<br />
Papusza bedeutet Puppe – dieser inoffizielle Name ist auf das<br />
Aussehen des Mädchens zurückzuführen (Angelika Kuźniak<br />
benutzt Papusza statt Bronka und gibt damit ihrer Heldin nicht<br />
nur eine Stimme, sondern taucht sie in die Welt ihrer „eigenen“<br />
Tradition). Aber in Kuźniaks Erzählung hat der Name Papusza<br />
auch eine ernste Bedeutung – das Geschlecht, die soziale<br />
Herkunft, die familiären Beziehungen hatten zur Folge, dass<br />
Bronka Wajs in einem wörtlichen und damit dramatischen<br />
Sinne zur Puppe wurde: sie wurde von Hand zu Hand gereicht<br />
und reagierte wie ein Automat auf Anweisungen. Ihr zweiter<br />
Mann, der viel ältere Dionizy, hatte sie entführt und zur Heirat<br />
gezwungen. Papuszas Rettung war die Liebe zu dem jungen Witold,<br />
doch als er verschwand, trieb es sie in den Wahnsinn. Solche<br />
Geschichten machen sich recht gut in einem literarischen<br />
Text. Kuźniak zeigt, was passiert, wenn so eine Anziehung der<br />
Herzen – eine so große, wahrhaft „romantische“ Liebe gegen<br />
den Rest der Welt – zur Wirklichkeit wird.<br />
Die Autorin analysiert – taktvoll und behutsam, wie aus<br />
dem Hintergrund – Papuszas Geschichte und stellt Fragen,<br />
ohne Antworten zu suggerieren. Sie beschreibt die Beziehung<br />
zur Mutter, die für das Mädchen eine Autorität ist, die<br />
aber Papuszas Entscheidung, Dionizy – der sie misshandelt<br />
und vergewaltigt – zu verlassen, nicht unterstützt. Es ist eine<br />
Mutter, deren Rücken voller Narben von Peitschenhieben ist<br />
und die selbst an der Überzeugung festhalten, und ihr Kind<br />
glauben lassen muss, ein anderes Leben sei unmöglich (Papu-<br />
sza erzählt, dass der Mann einer Zigeunerin alles machen darf,<br />
ohne dass jemand protestiert, weil das der Brauch ist; sie erinnert<br />
sich, wie sie mit anderen Kindern „Zuhause“ spielte und<br />
das Wichtigste dabei das Schlagen der „Ehefrau“ war). Wie in<br />
einem klassischen Gewaltmuster gibt das Opfer dem Handeln<br />
des Peinigers einen Sinn. Die Mutter hilft der Tochter nicht, als<br />
diese der Macht des misshandelnden Ehemanns entkommen<br />
will, weil sie den Sinn des eigenen Schicksals und die Weltordnung,<br />
in der sie lebt, nicht in Frage stellen kann. Papusza lernt<br />
mit der Zeit, dass sie als Person nichts bedeutet: Sie ist nur die<br />
Funktion fremden Seins. Dionizy Wajs, der den Grundsätzen<br />
der Zigeunergemeinschaft treu bleibt, hat das Recht auf seiner<br />
Seite und Papusza ist eine Marionette in seinen Händen. Wajs<br />
hat aus einer Perspektive außerhalb dieser Gemeinschaft viele<br />
Verbrechen begangen, doch niemand war daran interessiert,<br />
Papusza zu retten; das Lesen war ihre Rettung. Papusza hat in<br />
ihren Liedern sowohl die zerstörte mündliche Kultur der zur<br />
Sesshaftigkeit gezwungenen Zigeuner als auch die Erinnerung<br />
an die Vernichtung dieses Volks bewahrt.<br />
Angelika Kuźniak zeichnet in Papusza ein vielschichtiges<br />
Porträt: das einer Dichterin, Leserin, Tochter, Mutter, Ehefrau,<br />
Künstlerin und Geliebten. Papuszas Gestalt schillert, hört<br />
nicht auf, zu verblüffen. „Dumm“ in den Augen des gierigen<br />
und grausamen Ehemanns; „eine Verräterin“ in den Augen der<br />
Zigeunergemeinschaft; „ein großes, wildes Naturtalent“ in den<br />
Augen der polnischen Dichter; machtlos, schwach, verzweifelt<br />
und wütend – so sieht sie sich selbst. Die Erzählung von der<br />
„verfluchten Dichterin“, die sowohl Ruhm einbrachte als auch<br />
große Scham hervorrief, dieses Buch über einen unfassbar<br />
starken Menschen könnte eine Diskussion entfachen. Vor allem<br />
aber könnte es Papuszas Lieder bekannt machen – nicht<br />
als exotische „Schmuckstücke“, sondern als Lyrik, die von einer<br />
Ära und ihren Erfahrungen Zeugnis ablegt.<br />
ANGELIKA KUŹNIAK<br />
„PAPUSZA”<br />
CZARNE, WOŁOWIEC 2013<br />
133×215, 200 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7536-501-6<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
POLISHRIGHTS.COM<br />
Anna Marchewka
PAPUSZA<br />
Den Tag,<br />
an dem sie anfing schreiben zu lernen, wird Papusza nie<br />
vergessen. So sagt sie es und lächelt (auf der Tonaufnahme<br />
hört man dieses Lächeln ganz deutlich).<br />
Die Mutter weckte sie „genau mit der Sonne“. Die kleine<br />
Papusza stand auf, ging aus dem Zelt nach draußen und<br />
glättete ihren zerknitterten Rock.<br />
Sie kann sich nicht erinnern, ob es an diesem Tag die<br />
Mutter war, die ihr die Zöpfe geflochten hat. Und ob sie<br />
ihr über den Kopf streichelte. (Obwohl es eigentlich keine<br />
Zärtlichkeiten gab. „Sie hatte es zu schwer, um mich, die<br />
Älteste, an sich zu drücken.“) Papusza erinnert sich, dass<br />
sich die Mutter vor sie stellte und zwei Mal sagte: „Du darfst<br />
dir eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Eine Zigeunerin<br />
darf nicht mit leeren Händen zum Lager zurückkehren.“ Sie<br />
spürte, dass das hieß: sei gerissen und falsch.<br />
Papusza bindet eine Schürze über den Rock. Sie hat sie<br />
selbst genäht, mit Kreuzstich. Unter ihr baumeln die noch<br />
leeren „Diebestaschen“. Alles, um sich zu schützen; man<br />
muss die Beute von der Schürze trennen. Von der Taille abwärts<br />
ist eine Frau unrein. Unrein wird auch alles, was sie<br />
berührt, und sei es nur mit ihrem Rockzipfel. Die Macht, die<br />
Papusza in den Schmutz ziehen könnte, wirkt noch nicht<br />
(sie ist erst zehn, vielleicht zwölf Jahre alt), doch es ist besser,<br />
sich abzusichern.<br />
Im Lager bleiben die Alten und Kinder zurück. Und die<br />
Männer. Man sagt, dass Gott sie an einem Sonntag schuf.<br />
Und auch noch mit Armen, die verschieden lang sind. Es<br />
reicht, beide zur linken Seite auszustrecken, und es stellt<br />
sich heraus, dass der rechte gerade bis zum Ellbogen des<br />
linken reicht. Ist doch klar: mit solchen Armen kann man<br />
nicht arbeiten.<br />
Es hängt von der Schläue der Zigeunerinnen ab, ob man<br />
etwas für den Kochtopf haben wird.<br />
Grodno. Ein paar Kilometer zu Fuß vom Lager entfernt.<br />
In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts war<br />
es ein recht großer Ort. Fast sechzigtausend Einwohner<br />
(sechzig Prozent Polen, siebenunddreißig Prozent Juden,<br />
drei Prozent Weißrussen). Hier gibt es Telefone, Elektrizität<br />
(seit 1912) und eine Eisenbrücke (1909), ein paar Schulen,<br />
ein Theater, eine russisch-orthodoxe Kirche aus dem zwölften<br />
Jahrhundert, eine Pfarrkirche, zwei Festungen und eine<br />
Synagoge.<br />
Auf dem Markt war fruchtbares Gedränge. Rufe, Schreie.<br />
Es wurde mit allem möglichen gehandelt. Mit Gottesmüttern<br />
und mit Jesus unter den Aposteln. Mit Sonnenblumenkernen,<br />
Hühneraugensalben, Kienspan, Schuhwichse, Töpfen,<br />
Schleifsteinen und Talgkerzen. Man konnte Bastschuhe,<br />
Kartoffelkörbe und sogar Stühle kaufen. Man konnte sich
an Ort und Stelle einen Zahn ziehen lassen (davon gibt es<br />
Fotos in den Archiven). Jemand erzählte auf dem Markt Geschichten;<br />
von Räubern, Drachen und bösen Kindern, die<br />
ihre Mutter verjagten. Zigeunerinnen lasen aus den Karten<br />
oder aus der Hand, was am nächsten Tag passieren würde,<br />
in zehn Jahren, in hundert. Sie sahen die Vergangenheit, die<br />
guten und die bösen Taten. Sie zeichneten auf den Händen<br />
ihrer Klientinnen das Kreuzzeichen mit der Münze, die sie<br />
von ihnen bekommen hatten und sagten: „Die ganze Wahrheit<br />
kennt Gott allein, und die Zigeunerin so viel, wie in den<br />
Karten steht.“<br />
Papusza war geschickt, schnell füllte sie ihre Taschen.<br />
Äpfel, Kartoffeln, ein bisschen Tabak. Nichts Großes, aber<br />
– was ihr erst nach der Rückkehr ins Lager klar wurde – es<br />
reichte, um vom Stiefvater nicht verdroschen zu werden.<br />
Sie trieb sich an den Ständen herum. Sprach mit jedem<br />
Straßenköter, den sie auf dem Weg traf.<br />
Mitten auf dem Marktplatz tanzte ein Bär auf den Hinterpfoten.<br />
Seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als<br />
man den Bärenführern verboten hatte, die Stadt zu betreten,<br />
war das ein seltener Anblick. Die Akademie in Smorgon, wo<br />
sie früher dressiert wurden, war auch schon geschlossen.<br />
(Statt des Bodens gab es in einem Raum einen Kachelofen,<br />
der so aufgeheizt war, dass er rot glühte. Der Zigeuner führte<br />
den Bären hinein und fing an, Geige zu spielen. Der Bär,<br />
der sich an den Vorderpfoten verbrühte, stellte sich auf die<br />
Hinterpfoten, die mit Lappen umwickelt waren.)<br />
Dass man die Buchstaben in der Schule lernen kann, davon<br />
hatte Papusza schon früher gehört. Aber erst an diesem<br />
Tag sah sie Kinder mit <strong>Bücher</strong>n und rannte ihnen hinterher.<br />
„Verjagt ham sie mich. Sagtn ich bin Diebin. Die Pest.<br />
Nicht alle Leut sind edelmütig. Und vor dem, was man hört,<br />
kann man nicht weglaufen. Und auch nicht vor dem, was<br />
man sieht. Das geht von selbst in die Ohren und Augen rein.<br />
Was sollt ich machn? Hab in Demut ertragn und gelittn.“<br />
Einen halben Tag stand sie vor den Fenstern der Schule.<br />
„Und als die Kinder herauskamen, hab ich mein Mut zusammengenommen<br />
und sie gebetn, dass sie mir zeign ein<br />
paar Buchstaben.“<br />
Sie waren einverstanden, aber nicht ohne Bezahlung.<br />
Papusza hatte das Stehlen ganz normal gelernt. Bei der<br />
Mutter.<br />
Eine einfache Sache. „Man wirft mit der linken Hand<br />
Korn oder Brotkrümel neben die eigenen Füße und ruft<br />
gleichzeitig die Hühner herbei. Wenn der Schwarm herankommt<br />
und mit dem Fressen beschäftigt ist, greift die<br />
Zigeunerin mit einer entschiedenen, blitzschnellen Bewegung<br />
der rechten Hand nach dem Tier, das ihr am nächsten<br />
ist. Der Griff erfolgt von oben, an den Hals, in der Nähe des<br />
Kopfes, wobei das Huhn gleichzeitig zur Erde gedrückt wird.<br />
Der an der Gurgel gepackte Vogel wandert in ein vorher<br />
vorbereitetes Versteck und wenn der Täter will, greift er<br />
nach dem nächsten Stück, da der mit Fressen beschäftigte<br />
Schwarm die drohende Gefahr nicht bemerkt. Auch das bereits<br />
gefangene Tier schlägt keinen Alarm.“ (So wurde das<br />
1964 in den Akten der Staatsanwaltschaft beschrieben.)<br />
Papusza war vier Jahre alt, als sie zum ersten Mal ein<br />
Huhn tötete. „Ich hab mir ein Bündel geschnürt, der Mutter<br />
die Karten gestohln, bin vier Kilometer gelaufn und hab<br />
mich verirrt. Irgendein Bauer hat mich gefundn, nahm mich<br />
auf dem Wagen bis zum Dorf mit. Ich schau; auf seinem Hof<br />
laufn Hühner herum. Da schnappte ich eins, wickelte es eng<br />
in ein großen Lappen ein und es erstickte.“<br />
„Denn die Ordnung der Welt ist einfach“, erklärt Papusza.<br />
„Was auf dem Feld wächst, das hat der Herrgott gesät,<br />
und was scharrt und schnattert, gedeiht nach dem Willn<br />
Gottes für alle Menschn. Der Herrgott hat viele Hühnchen<br />
geschaffn und für die Zigeuner reicht es auch.“<br />
Ein Hühnchen – eine Lektion.<br />
Papusza wartete jeden Tag vor der Schule auf die Kinder.<br />
Danach schrieb sie mit einem Stock im Sand oder mit<br />
einem verrußten Holzstückchen auf Zeitungen: A, b, c und<br />
den Rest der Buchstaben. Wie in einer Fibel.<br />
So ging es ein paar Tage lang, bis es den Kindern langweilig<br />
wurde.<br />
Und da erinnerte sie sich an einen Laden nicht weit vom<br />
Markt, wo sie manchmal Süßigkeiten kaufte. Ein dunkler,<br />
langer Korridor, kaum Licht, wie an der Eingangstür. Hinter<br />
dem Tresen die Ladenbesitzerin, eine Jüdin.<br />
„Ich ging mit der Zeitung zu ihr und bat sie: ‚Zeig mir,<br />
Frau, wie man liest.‘<br />
Sie sagte, ich soll ein fettes Huhn für den Schabbat mitbringn<br />
und eine Fibel kaufn.“<br />
Der Unterricht war kurz, immer nach Ladenschluss.<br />
Papusza‘s Mutter gefiel das nicht. Sie sagte immer wieder:<br />
„Diese <strong>Bücher</strong> sind nichts wert, mit ihnen wird das Gehirn<br />
vergiftet. Davon kommt die Dummheit.“<br />
Der Stiefvater schlug Papusza.<br />
„Die Zigeuner im Lager spucktn mich an, zeigtn mit den<br />
Fingern auf mich, lachtn über mich: ‚Na? Jetzt wirst du<br />
wohl eine Frau Lehrerin sein! Für was brauchst du denn<br />
dieses Lernen?‘ Sie zerrissn die Zeitungen, Seite für Seite,<br />
und warfn sie ins Feuer. Sie verstandn nicht, dass man das<br />
für sich selbst tun muss, für ein Stück Brot. Ich kann heute<br />
nämlich mit meinem Namen unterschreibn und mache<br />
keine Kreuzchen. Und ich bin stolz darauf, dass ich, eine<br />
ungebildete Zigeunerin, lesn kann. Ich hab mich damals im<br />
Wald leise ausgeweint und dann machte ich einfach weiter.“<br />
Sie lernte schnell.<br />
„Nach ein paar Wochen konnte ich es schon. Die Jüdin<br />
küsste mich, weil ich so gelehrig war.“ (Papusza lächelt<br />
wieder.) „Ich konnte gut lesn, aber nicht schreibn, weil ich<br />
wenig geschriebn hab und nicht wusste, dass mir das in Zukunft<br />
nützlich sein wird. Und dann, als ich vierzehn war,<br />
nahm mich der Stiefvater auf den Niemen mit. Er spielte im<br />
Orchester von Dyźko Geige und Kontrabass. Mit dem Schiff<br />
sind wir herumgefahrn. Erst hab ich aus der Hand und den<br />
Karten gelesn und dann las ich ein Buch, ich weiß nicht<br />
mehr was für eins. Da kam eine elegante Dame und sagte:<br />
‚Ein Zigeunermädchen kann lesen? Sehr schön!‘<br />
Ich hab laut gelacht, wie ein Kind, bis mir die Tränen in<br />
die Augen kamen. Sie hat mich nacheinander nach allem<br />
gefragt, und ich hab geantwortet. Am Ende küsste sie mich<br />
und ging. Und ich war stolz und hab danach noch mehr<br />
gelesn, bis mir die Augen schmerztn. Gute und schlechte<br />
Sachen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich lesn sollte.“<br />
Papusza schrieb sich in einer Bibliothek ein.<br />
„In Mikulinice bei Przeworsk. Die habn mir ein Buch ausgeliehn,<br />
aber kein schönes, so Kinderkram, Märchen, und<br />
ich wollt da sogar nicht mehr hingehn. Aber die Wirtin, bei<br />
der wir eine Kammer hattn, sagte, ich soll Die Gräfin Cosel,<br />
Herr Thaddäus und Die Brotausträgerin nehmen.<br />
Ich hab viele <strong>Bücher</strong> von Leuten gelesn, denen ich wahrgesagt<br />
hab: Tarzan bei den Affen, Der rothaarige Jason, Die<br />
schöne Schwester. Und am meisten mochte ich Geschichten<br />
über Ritter und die große Liebe.“<br />
Aus dem Polnischen von Joanna Manc
FILIP<br />
SPRINGER<br />
TRIEBMITTEL<br />
Filip Springer (geb. 1982), Journalist, Reporter<br />
und Fotograf, gilt als einer der bemerkenswertesten<br />
polnischen Reportageautoren. Er studierte<br />
Anthropologie und Ethnologie und arbeitet seit<br />
2006 als Reporter. Zaczyn [Triebmittel] ist sein<br />
drittes Buch; noch in diesem Jahr erscheint ein<br />
weiterer Reportageband zum Thema Architektur<br />
aus seiner Feder. Dieses neueste Buch soll den Titel<br />
Wanna z kolumnadą [Badewanne mit Kolonnade]<br />
tragen.<br />
Wer waren Zofia und Oskar Hansen? „Die Hansens waren die<br />
Antwort auf das Ende der Welt“, so lauten in Triebmittel die<br />
Worte Joanna Mytkowskas, der Direktorin des Museums für<br />
Moderne Kunst in Warschau. Aber welche Bedeutung hatte,<br />
und wer war dieses Ehepaar, das nach seinen Raumrevolutionen<br />
verschwand wie vorsätzlich vergessen? Filip Springer<br />
weiß, dass die spannendsten Geschichten im Schatten zu<br />
finden sind, am Rand von allem anderen, und dass leere Orte<br />
wahre Sensationen hervorbringen können. In Triebmittel potraitiert<br />
Springer vor allem den Don Quijote des Linearsystems<br />
LSC und der Offenen Form.<br />
Obgleich Oskar Hansen immer betonte, dass er alles, was er<br />
tat, zusammen mit seiner Frau getan habe, erscheint Springer<br />
dennoch Ersterer (als weitaus offenere, deutlicher umrissene<br />
Gestalt) als der wichtigere von beiden. Oskar Hansens Lebenslauf<br />
und der seiner Vorfahren könnten als Vorlage für einen<br />
Abenteuerfilm dienen. Millionärsenkel, feiner Pinkel – pflegte<br />
Zofia Hansen lachend zu sagen, wenn sie nach der linken Gesinnung<br />
ihres Mannes gefragt wurde. Die geradezu wundersame<br />
Lebensreise des Oskar Hansen (Kriege, Bankrott, Bravour,<br />
wunderbare Errettungen, Weltbürgertum), der fähig war, sich<br />
auf das Unmögliche zu stürzen, scheint ihren Hintergrund im<br />
Lebenslauf des cholerischen Großvaters, der sich einen riesigen<br />
finanziellen Erfolg erarbeitete, der reiselustigen, zum Bruch<br />
mit gesellschaftlichen Konventionen bereiten Eltern, des Bruders<br />
Erik und eben der Ehefrau zu haben, die dem Architekten<br />
nicht nur sozialistische Ideen einpflanzte und diese zum Wachsen<br />
brachte, sondern ihn auch aus Notlagen rettete, indem sie<br />
wie ein Handbuch der Vernunft auf ihn einsprach.<br />
Das Projekt der dezentralen „Neumöblierung“ Polens war<br />
nicht zur Gänze durchführbar – gewisse Bestandteile des Linearsystems<br />
werden aber heute verwirklicht, wie Springer<br />
findet, aus einer Notwendigkeit heraus, aber auch chaotisch.<br />
Das Projekt LSC sollte, um die Worte zu verwenden, mit denen<br />
Hansen 1976 in Zachęta auf die Vorwürfe Marek Budzyńskis<br />
antwortete, eben ein Triebmittel für künftige Veränderungen<br />
sein. Und solche Menschen portraitiert Springer – Menschen,<br />
die verstehen, dass nur der Griff nach etwas Größerem als den<br />
gefahrlosen Gewohnheiten die Chance auf Entwicklung bietet.<br />
Undurchführbares anzugehen ist die grundlegende Aufgabe<br />
ernsthafter Menschen, die ihr eigenes Leben (und das Leben<br />
anderer) ernstnehmen. In den Bauprojekten der Hansens (besonders<br />
den unverwirklichten) ist der Plan zum Aufbau einer<br />
Bürgergesellschaft erkennbar, einer Gemeinschaft von Individuen,<br />
die so handeln, dass sie bei ihrer eigenen Entwicklung<br />
ihren Mitbürgern nicht schaden. Hansens waren überzeugt davon,<br />
dass es kein Standardhaus gebe, dass jeder Bauplan auf die<br />
Bedürfnisse, den Beruf, die Interessen des konkreten Menschen<br />
zugeschnitten sein sollte.<br />
Triebmittel greift auch das Problem der Unverstandenheit und<br />
Ablehnung auf, denen die Hansens in polnischen Kreisen begegneten,<br />
während ihre Arbeiten zugleich in Westeuropa große<br />
Anerkennung fanden. Es sind Stimmen zu hören, die meinen,<br />
Hansen habe einen Fehler begangen, als er nach Polen<br />
zurückgekehrt sei, da ihn hier das Scheitern erwartete, dort<br />
aber Ruhm, Ehre und das große Geld. Joanna Mytkowska fegt<br />
diese Spekulationen lachend beiseite: Hansens antikommerzielle,<br />
antimarktwirtschaftliche Einstellung hätte ihm gar keine<br />
Zusammenarbeit mit Investoren erlaubt, die ihn bezahlt und<br />
Vorgaben gemacht hätte; für Hansen, einen waschechten Idealisten,<br />
waren selbst die kleinsten Änderungen in seinen Bauplänen<br />
nicht hinnehmbar. Seine berühmt-berüchtigten Abgänge<br />
unter Türenknallen waren wenig erfolgversprechend...<br />
Und die Hansen-Schülerin merkt noch etwas Wichtiges an:<br />
dass Dezentralisierungspläne nur in einer zentral verwalteten<br />
Gesellschaft die Chance hatten, wenigstens teilweise realisiert<br />
zu werden.<br />
FILIP SPRINGER<br />
„ZACZYN”<br />
KARAKTER, KRAKÓW 2013<br />
150×205, 264 PAGES<br />
ISBN: 978-83-62376-24-7<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
POLISHRIGHTS.COM<br />
Anna Marchewka
TRIEBMITTEL<br />
BERGAMO<br />
„Es fällt mir schwer zu glauben, dass der Schöpfer der neuen<br />
Architektur, einer der Schöpfer des Purismus, diese<br />
mithilfe von Stoffen – Verkaufsgegenständen – zu humanisieren<br />
versucht. Diese ganze sogenannte Renaissance des<br />
französischen Stoffes halte ich für eine Bewegung, die zu<br />
kommerziellen Zwecken ins Leben gerufen wurde, und um<br />
Kapital aus ihr zu schlagen. Eine Bewegung, in die die großen<br />
Künstler mit hineingezogen, und in deren Namen sie<br />
ausgenutzt werden sollen. […] Die Architekten des CIAM<br />
sollten dem entgegenwirken und die Humanisierung der<br />
modernen Architektur auf den ihr entsprechenden Wegen<br />
suchen“, wettert Oskar vom Rednerpult herab und<br />
richtet seine Worte an den, der ihn wenige Monate zuvor<br />
unter seinem Dach beherbergt, mit einem Abendessen bewirtet<br />
und ihm seine Bilder gezeigt hat. Als Oskar endet,<br />
bricht der ganze Raum in Beifall aus. Corbu, der bis dahin<br />
schweigend zugehört hat, applaudiert gemeinsam mit den<br />
anderen.<br />
Pierre Jeanneret hat Oskar hergeholt. Nicht eigentlich<br />
hergeholt, sondern Oskar vielmehr nahegelegt, er müsse<br />
unbedingt nach Bergamo zum CIAM VII kommen, dem 7.<br />
Internationalen Kongess der Modernen Architektur, und<br />
sich anhören, was dort <strong>Neue</strong>s über die Architektur der<br />
Gegenwart gesagt werde. Und Oskar hat die Aufforderung<br />
angenommen, obwohl er sich die Reise gar nicht leisten<br />
kann. Als er in Italien ankommt, hat er nicht einen Groschen<br />
in der Tasche. Er schläft im Park, wäscht sich an einem<br />
Springbrunnen, isst nur Brot und Weintrauben. Als<br />
Jeanneret sich in der ersten Pause zwischen den Debatten<br />
über sein Hotel beschwert und ihn fragt, wie er wohne, antwortet<br />
Oskar: „Ich habe mich billig und bequem einrichten<br />
können.“<br />
Mit seinem Auftritt hat er sich allerdings etwas weit<br />
vorgewagt; er wollte schließlich gar nicht sprechen. Er<br />
hat es nur nicht ausgehalten, Le Corbusier über Gobelins<br />
und deren Nützlichkeit in der Architektur reden zu hören.<br />
Deshalb hat er um Gehör gebeten, sich an das Redenerpult<br />
gestellt und ausgesprochen, was er dachte. Nun geht er ganz<br />
benommen zu seinem Platz zurück und ist sich nicht recht<br />
bewusst, was gerade geschehen ist. Er, Oskar Hansen, ein<br />
Niemand in leicht zerknautschtem Jacket, der sich nach dieser<br />
Besprechung auf einer Parkbank in der Nähe schlafen<br />
legen wird, hört den Applaus gar nicht. Ein paar Minuten<br />
später lädt Jacqueline Tyrwhitt ihn ein, an der CIAM-Sommerakademie<br />
in London teilzunehmen. Oskar sagt zu, auch<br />
wenn er keine Ahnung hat, wie er von der polnischen Regierung<br />
eine Reiseerlaubnis nach London bekommen will.
London<br />
Ob er Englisch könne – er verneint. Wie alt er sei – siebenundzwanzig.<br />
Wann er sein Architekturstudium abgeschlossen<br />
habe – er sei erst im dritten Studienjahr. An ihren Mienen<br />
sieht er, dass sie ihm nicht glauben. Sie sagen, er sei ein<br />
kommunistischer Propagandist. Oskar weiß nicht, was er<br />
ihnen antworten soll.<br />
Sie – das sind die britischen Journalisten. Sie sind gekommen,<br />
um das Urteil der Jury über die Arbeiten der CI-<br />
AM-Sommerakademie zu erfahren. Es ist der Juli 1949, und<br />
Oskar hat schon fast die Lust an England verloren.<br />
Er ist mit beinahe zweiwöchiger Verspätung hier eingetroffen,<br />
weil die britische Botschaft in Paris ihm kein Visum<br />
ausstellen wollte. An der Grenze haben sie ihn beim Anblick<br />
seines Papp-Reisenecessaires gleich kontrolliert, seinen<br />
Pass durch die Lupe beäugt. Wohin und warum er fahre,<br />
wollten sie wissen. Dabei stand in dem Brief, den er aus<br />
London bekommen hat, alles schwarz auf weiß geschrieben.<br />
Schließlich haben sie ihn durchgelassen.<br />
Mit Verspätung meldet er sich in der Schule an und<br />
bekommt einen Projektauftrag. Er darf zwischen einer<br />
Wohnsiedlung, einem Bürogebäude, einem Verkehrsknotenpunkt<br />
oder einem Theater wählen. Seine Wahl fällt auf<br />
die Siedlung. Die anderen haben sich zu Gruppen zusammengetan,<br />
doch er arbeitet allein. Er zeichnet neun weiße<br />
Gebäude rund um einen „sozialen Raum“. Dort platziert er<br />
zwei Kindergärten und einen Park für die Allgemeinheit.<br />
Schulen, Handels- und Dienstleistungspavillons verlegt er<br />
nach außerhalb, ähnlich verfährt er mit dem Autoverkehr.<br />
Er schafft es, seine Arbeit noch vor dem Termin abzugeben.<br />
An seinem letzten freien Tag besichtigt er London, hauptsächlich<br />
Galerien und Museen.<br />
Als er die Entscheidung der Jury hört, kann er seinen Ohren<br />
nicht trauen. Er bekommt eine Auszeichnung für die<br />
– wie er von den Juroren erfährt – Verdopplung der Bevölkerungsdichte<br />
in der Siedlung bei gleichzeitiger Bewahrung<br />
von deren „hohem Nutzwert“. Seine Arbeit macht großen<br />
Eindruck auf Ernesto Nathan Rogers, der ihm kurzerhand<br />
eine Assistenzstelle im Royal Institute of British Architects<br />
in London anbietet. Die Türen zur großen Architektur (und<br />
zum großen Geld) stehen für Oskar Hansen weit offen. Er<br />
jedoch entscheidet sich zur Rückkehr nach Polen.<br />
Rogers ist erstaunt, fragt: „Weißt du, was dort ist?“<br />
Oskar weiß es. Er erklärt dem Engländer in so einfachen<br />
Worten, wie er kann:<br />
„Dort sind Ruinen, dort warten sie auf mich“, und Rogers<br />
tippt sich an die Stirn:<br />
„Das, was du hier präsentiert hast, lässt sich dort nicht<br />
machen.“<br />
Aber das weiß Oskar eben noch nicht.<br />
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes
MAŁGORZATA<br />
REJMER<br />
BUKAREST,<br />
STAUB UND BLUT<br />
Małgorzata Rejmer (geb. 1985), Doktorandin<br />
der Warschauer Universität am <strong>Instytut</strong> Kultury<br />
Polskiej (Institut für Polnische Kultur). Ihr literarisches<br />
Debüt Toksymia im Jahr 2009 wurde für<br />
Nagroda Literacka Gdynia(Literarischer Preis<br />
Gdynia) nominiert. Der Reportagenband Bukarest.<br />
Staub und Blut wird von den Rezensenten<br />
sehr gut bewertet.<br />
Die Reise in die rumänische Hauptstadt, nach der das Buch<br />
Bukarest, Staub und Blut entstanden ist, war kein Abstecher für<br />
ein paar Tage und auch kein kurzes Abenteuer. Małgorzata<br />
Rejmer verbrachte dort (mit Pausen) zwei Jahre, und sie sagt,<br />
dass sie wieder hinfahren würde. Aus ihren Texten geht hervor,<br />
dass sie solide Feldforschung betrieben hat; sie mietete<br />
heruntergekommene Wohnungen, um diesen Ort auf eine<br />
möglichst intensive Art zu erfahren, machte Besichtigungen,<br />
sprach mit Menschen, las viel. Doch ihr Buch ist nicht<br />
nur eine Sammlung von Reisebildern. Rejmer präsentiert<br />
uns eine Zusammenstellung von kulturhistorischen Texten,<br />
die Antworten auf Fragen ermöglicht – Fragen, auf die man<br />
(wahrscheinlich) nicht antworten kann oder sogar nicht antworten<br />
darf. Mutig stellt die Autorin eine Diagnose auf – die<br />
Rumänen nähmen demütig ihr Schicksal hin (oft sei es der<br />
Tod), sie begehrten nicht auf, fänden sich ab, kämpften und<br />
diskutierten nicht. Die Volksballade Das Schäflein (laut Nichita<br />
Stănescu – die rumänische Illias und Odyssee, für Herta Müller<br />
dagegen ist es das rumänische Nibelungenlied), und der Ausspruch<br />
„Asta e, cesăfaci?“ („So ist es nun mal, was willst du<br />
machen?“) lassen die Autorin verstehen, wie die Herrschaft<br />
von Nicolae Ceauşecu überhaupt möglich war.<br />
Rejmer erkundet in Bukarest die Kultur der Anderen, eine<br />
östliche Kultur – die vor allem wegen ihrer Grausamkeit fasziniert,<br />
wegen ihrer Wildheit und der Schönheit des Hässlichen.<br />
Sie schreibt: „... das <strong>Neue</strong> gefällt mir nicht besonders.<br />
Ich mag lieber die alten Schichten.“ Und weiter: „Ich spüre die<br />
Macht der Stadt, unter der der Wahnsinn lauert.“ Sie greift<br />
in die „Eingeweide“ des Ortes, denn die interessieren sie am<br />
meisten. Extreme Verhältnisse (Chaos, gigantische Ausmaße)<br />
erscheinen ihr für die Texte am nützlichsten. Für Rejmer ist<br />
das Merkwürdige, das von der Norm abweichende, das Eigentümliche<br />
und Totale besonders interessant. Die Autorin ist berauscht<br />
von diesem Land ohne Eigenschaften – einem Land,<br />
das wie Knetmasse geformt und von Hand zu Hand weitergereicht<br />
wird. Das niedergebrannt, wieder aufgebaut und in<br />
Blut gebadet wurde, sich aber immer noch hält. Sie versucht,<br />
diese östliche Wildheit zu verstehen, zu erklären und zu erzählen,<br />
sie muss also für sich einen Standort wählen und eine<br />
Haltung gegenüber der „anderen“ Seite einnehmen. Rejmer<br />
wählt die Form des Essays, der diesen strategischen Standort<br />
„rechtfertigt“, doch man könnte auch fragen, ob dieser<br />
menschliche Faktor im Text eine Schwäche oder eine Stärke<br />
ist. Bezeichnend ist auch, dass Rejmer ihrem Buch den Titel<br />
Bukarest gab, anstatt zum Beispiel Mein Bukarest. Das ist ein<br />
mutiger Versuch, „das Ganze“ auszusprechen, und zwar auf<br />
die einzig „wahre“ Art und Weise...<br />
Man kann Bukarest, Staub und Blut den Erkenntniswert nicht<br />
absprechen – es ist ein wichtiges Buch, das an den nicht weit<br />
zurückliegenden Alptraum erinnert. Rejmer schreibt über<br />
Dinge, die man nicht vergessen darf; über Umerziehung durch<br />
Folter, über ein totalitäres System, über ein Dekret, das die<br />
Empfängnisverhütung verbietet und über die damit verbundenen<br />
Tragödien. In den Körpern der Frauen, die dazu gezwungen<br />
wurden zu gebären, oder die nach illegalen Abtreibungen<br />
ausbluteten, sieht Rejmer das Wesen des totalitären<br />
Rumäniens von Nicolae Ceauşescu; als sie über den Film 4 Monate,<br />
3 Wochen und 2 Tage von Cristian Mungiu schreibt, unterstreicht<br />
sie das quälende Verlangen des Regisseurs, von dem<br />
Leid, dem Elend und der Unterdrückung Zeugnis abzulegen.<br />
Das Buch von Małgorzata Rejmer lässt die Erinnerung wieder<br />
aufleben und es ermöglicht, weite Bereiche der neuesten Geschichte<br />
zu entdecken – einer Geschichte, von der wir nichts<br />
wissen wollen, weil das bequemer und leichter ist. Rejmers<br />
literarisches Debüt Toksymia von 2010 hat viel Wirbel verursacht<br />
und die Hoffnung geweckt, dass wir eine neue, interessante<br />
Schriftstellerin haben. Das zweite Buch ist bestimmt<br />
kein leichter Test. Doch Rejmer bestätigt mit Bukarest, Staub<br />
und Blut, dass der Trubel um Toksymia berechtigt war. Die Autorin<br />
wechselte den Verleger und veränderte die Form, doch<br />
es beschäftigt sie immer noch dasselbe: die exotische, nicht<br />
offensichtliche Schönheit der ungezähmten Welt.<br />
MAŁGORZATA REJMER<br />
„BUKARESZT”<br />
CZARNE, WOŁOWIEC 2013<br />
125×195, 272 PAGES<br />
ISBN: 978-83-7536-539-9<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
POLISHRIGHTS.COM<br />
Anna Marchewka
BUKAREST,<br />
STAUB UND BLUT<br />
Nicht<br />
weit von Râmnicu Vâlcea liegt die Stadt Piteşti. Dort stand<br />
ein Gebäude, in dem sich die Hölle befand. Ungefähr zur<br />
gleichen Zeit als Petre Radio hörte und die Hände seiner<br />
Frau küsste, wurde im Gefängnis von Piteşti ein Experiment<br />
durchgeführt, über das Alexander Solschenizyn im<br />
Archipel Gulag schreiben wird: „die grauenvollste Barbarei<br />
der heutigen Welt.“<br />
In Piteşti löst sich das Leiden vom Körper und von der<br />
Menschlichkeit ab. Sterbende Menschen heulen wie sterbende<br />
Tiere. Die Wände der Folterkammer sind schalldicht,<br />
die Gefängniswärter taub von den Schreien. Die Gefangenen<br />
werden so lange geschlagen, bis sie nichts mehr sehen<br />
und hören. Das, was von ihnen übrig bleibt, sind Urin-und<br />
Blutlachen, zerkrümelte Zähne, Haarbüschel, blutiger Auswurf.<br />
In der Pfütze bleibt noch etwas Mensch. Was daraus<br />
kriecht, diese sich auflösende Gestalt, das ist auch noch ein<br />
Rest Mensch.<br />
Nach Piteşti gelangen hauptsächlich junge Studenten,<br />
die in den dreißiger Jahren an die faschistische Eiserne<br />
Garde glaubten. Und Geistliche, die sind immer verdächtig.<br />
Manchmal verirrt sich ein Intellektueller in den Transport,<br />
ein Arzt oder Ingenieur, der zu viel weiß, oder zu wenig.<br />
Sein Pech. Der Kommunismus will diesen Menschen eine<br />
Chance geben. Sie fahren nach Piteşti zu Lektionen über<br />
den neuen Glauben, und das nennt man: „Umerziehung<br />
durch Folter.“<br />
Man kann auf viele Arten leiden, der körperliche<br />
Schmerz ist nur eine davon. Im Gefängnis fragen sie, wer<br />
deine Mutter war. Sie war eine gute, fleißige Frau, die ihr<br />
Haar zu einem Zopf flocht und sich um mich kümmerte. Die<br />
Wärter schlagen mit einem Metallknüppel solange zu, bis<br />
der Gefangene sagt: ich habe meine Mutter vergewaltigt.<br />
Meine Mutter hat mich vergewaltigt. Sie war eine Hure, der<br />
Hund fickte sie. Ich habe keine Mutter.<br />
Dann wird unter den anderen Gefangenen einer gesucht,<br />
der dem Geschlagenen nahe steht; ein Freund aus Studienzeiten,<br />
aus der Kindheit, ein Arbeitskollege. Oder einer, der<br />
ihm bis dahin geholfen hat, in Piteşti durchzuhalten. Zwei<br />
Gefangene stehen sich gegenüber. Beide haben einen Knüppel<br />
in der Hand. Sie müssen sich gegenseitig blutig schlagen,<br />
oder die Wärter fangen damit an – sie haben Übung und die<br />
richtige Überzeugung.<br />
Wenn der Gefangene um Gnade fleht, schlagen ihm die<br />
Wärter die Zähne aus. Wenn er keinen Knüppel in die Hand<br />
nehmen will, dann schlägt ihm der Freund die Zähne aus<br />
und die Wärter reißen ihm die Fingernägel aus. Alle Grundsätze<br />
unserer Welt gelten in der Hölle nicht. Entweder bist<br />
du der Folterer oder du wirst gefoltert. Zehn Wärter schla-
gen zehn Gefangene und töten dabei einen oder zwei, damit<br />
der Rest darüber nachdenkt, was ihr Leben bedeutet.<br />
Diejenigen, die an göttliche Barmherzigkeit glaubten,<br />
dürfen nicht einmal die Spur von Barmherzigkeit zeigen.<br />
Diejenigen, die glaubten, der Mensch sei gut, müssen zusehen,<br />
wie das Böse ausartet. Diejenigen, die ihr Leben Gott<br />
gewidmet haben, müssen ihn verfluchen und die eigenen<br />
Exkremente wie eine Hostie in den Mund nehmen.<br />
Ihre Seele muss erlöschen, so wie ein vertrockneter<br />
Baum eingeht. Sie werden gebrochen und dann vernichtet,<br />
in ihnen bleibt nichts außer Leid. In dieser Sinnlosigkeit<br />
wird die Saat des Marxismus gesät. Es kommt vor, dass diese<br />
Wracks, die durch nichts mehr an Menschen erinnern,<br />
immer noch Widerstand leisten. Wenn sie nicht nachgeben,<br />
werden sie getötet.<br />
Petre hatte zu viel Glück gehabt, und die Beamten der<br />
Staatsgewalt kamen, um die Rechnung zu begleichen. Manchen<br />
im Dorf gefiel der Bus nicht, mit dem Petre die Leute herumfuhr.<br />
Da hat mal der Nachbar im Kommissariat vorbeigeschaut<br />
und sagte dort, er habe so ein Gefühl, dass der mit dem<br />
Fahrzeug Radio Freies Europa hören würde. Die Beamten gingen<br />
hin. Prüften nach. Ein Radioempfänger war da – das hieß,<br />
Petre hörte den Sender. Ein Landbesitzer, der Eigentümer<br />
eines Kraftfahrzeugs und eines Hauses mit drei Zimmern.<br />
Als 1949 die Kollektivierung begann, klopften sie an jede<br />
Tür; zusammen mit der Miliz gingen die von den Kommissionen<br />
herum. 1962 - als es nichts mehr gab, das sie den Menschen<br />
noch hätten wegnehmen können - hörten sie auf, an<br />
die Türen zu hämmern, weil jetzt alles dem Staat gehörte.<br />
Diejenigen, die am meisten besaßen, landeten hinter Gittern<br />
oder in der Zwangsarbeit. Im Gefängnis halfen ihnen<br />
die Wärter, dem Schmerz zu entkommen, das heißt, wahnsinnig<br />
zu werden. Nach ein paar Jahren kamen die Leute<br />
nur noch als menschliche Fetzen wieder raus. Sie hatten Aggressionsausbrüche<br />
und Panikattacken. Sie sprachen nicht<br />
mehr und erlaubten nicht, dass man sie anfasste. Ein Bett<br />
war kein Bett mehr, das Essen kein Essen mehr, nur das<br />
Schreien war Schreien. Als sie starben, bekreuzigten sich<br />
ihre Ehefrauen mit Erleichterung und die Nachbarn sagten:<br />
„Seine Qualen sind zu Ende, soll er in Frieden ruhen.“<br />
Petre Raduca bekam zehn Jahre. Die Staatsbeamten<br />
kamen zu ihm nach Hause und schauten sich die Zimmer,<br />
die Teppiche und den Eichentisch mit der Spitzendecke<br />
an. Damit es nicht hieß, der Staat sei böswillig, erlaubten<br />
sie Petres Frau, ein kleines Zimmer und eine Außenküche<br />
in ihrem eigenen Haus zu bewohnen. In den übrigen zwei<br />
Räumen machte sich – wie eine Henne auf ihren Eiern - die<br />
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft breit, die<br />
den Menschen ihr Eigentum wegnehmen und daraus Allgemeinbesitz<br />
machen sollte, das heißt Staatsbesitz, den sie<br />
überwachte. Das größte Zimmer wurde zu einem Lebensmittelladen<br />
umgebaut. Elena Raduca öffnete manchmal die<br />
Haustür, ging entlang des Hauses und blieb vor dem Fenster<br />
stehen, aus dem sie so oft auf den Garten und die Straße geschaut<br />
hatte. Sie kaufte Öl und Brot, ging zurück auf die andere<br />
Seite des Hauses und legte die Einkäufe auf den Tisch<br />
ihrer winzigen Küche. Zuerst gewöhnte sie sich das Weinen<br />
ab, dann gewöhnte sie sich ab, über alles nachzudenken.<br />
Als Elena eines Tages die Haustür öffnete, hatte sie den<br />
Eindruck, dass der Tod in Gestalt von zwei greisen, ausgetrockneten<br />
Figuren mit glänzenden Augen zu ihr gekommen<br />
war; als ob eine Urkraft, die nie erlischt, sie gelenkt<br />
hätte, obwohl das Alter ihre Körper bereits in Besitz genommen<br />
und angefressen hatte. Ihre Hände waren mit blauen<br />
Flecken bedeckt, die kreidebleichen Augenlider faltig und<br />
die zahnlosen Unterkiefer nach hinten verschoben.<br />
Die zierlichen Gestalten verschwanden fast unter den<br />
schwarzen, mit einer Kordel zusammengeschnürten Kutten,<br />
aber ihre Augen waren hellblau, wie ein zartes verblasstes<br />
Gewebe, und in ihnen war kein Tod.<br />
Elena verbeugte sich vor den Mönchen und machte das<br />
Kreuzzeichen.<br />
Darauf verbeugten sie sich noch tiefer.<br />
Sie schaute auf diese gebrochenen Menschen mit ihren<br />
verrotteten, vom Hunger verwüsteten Körpern.<br />
Obwohl seit dem Experiment in Piteşti zehn Jahre vergangen<br />
waren, wurde den Verurteilten in rumänischen<br />
Gefängnissen immer noch befohlen, ihre Mitgefangenen<br />
zu foltern. Alle wurden geschlagen, ohne Ausnahme. Die<br />
Wärter kannten keine Gnade, und beim Anblick von Blut<br />
gerieten sie noch mehr in Rage.<br />
Die Mönche schoben in ihren zahnlosen Mündern die<br />
Worte langsam hin und her:<br />
„Das müssen Sie wissen.“<br />
Sie waren zu dritt in einer Zelle gewesen – Petre und die<br />
beiden. Er war bereits seit vier Jahren im Gefängnis. Vier<br />
Jahre hatte er in einer feuchten Leere gelebt, auf Holzbrettern,<br />
mit einer Wunde, die nicht heilen wollte. Petre war<br />
stur, er wollte überleben, jammerte nicht. Ihm fehlte nur<br />
die Musik, dieses Radio, dessentwegen er ins Gefängnis gekommen<br />
war.<br />
Petre war schon fast fünfzig, aber die Mönche waren viel<br />
älter. Eines Tages saß Petre auf den Brettern und passte auf,<br />
dass die Mönche ohne Pause kerzengerade dastanden – von<br />
morgens bis in die Nacht. Am zweiten Tag saß einer der<br />
Mönche und die anderen standen. Am dritten Tag saß der<br />
zweite Mönch und bewachte die beiden anderen Gefangenen.<br />
Ein Mal in drei Tagen warst du der Folterknecht, zwei<br />
Mal das Opfer.<br />
Das ist der grauenvollste Moment – wenn man sich mit<br />
seiner eigenen Bestialität konfrontieren muss. Wenn man<br />
sich selbst hassen oder gleichgültig werden muss. Während<br />
des Experiments in Piteşti kehren diejenigen, die sich auflehnen,<br />
an den Punkt zurück, an dem die „Maske heruntergerissen“<br />
und die Persönlichkeit zerstört wird. Sie verbringen<br />
Monate in Einzelzellen, versuchen Selbstmord zu<br />
begehen. Schließlich werden alle gebrochen.<br />
Constantin Barbu, einer von denen, die überlebt haben,<br />
sagt in dem Buch Memorialul Durerii (Mahnmal des Leidens):<br />
„Ich denke, sogar in der Hölle gibt es nicht solche Methoden,<br />
wie sie in Piteşti angewandt wurden. Selbst dort nicht. Es<br />
gibt Dinge, die sich der menschliche Verstand nicht vorstellen<br />
kann.“<br />
Eines Tages, als er an der Reihe war, der Folterknecht<br />
zu sein, hielt es Petre nicht mehr aus. Vor ihm standen die<br />
bärtigen und abgemagerten Mönche mit herunterhängenden<br />
Köpfen. Ihre Knie zitterten.<br />
„Ich flehe euch an“, sagte er, „setzt euch. Ich nehme die<br />
Schuld auf mich, aber setzt euch.“<br />
Alle drei setzten sich. Sie weinten. Der Wärter kam in<br />
die Zelle und schlug Petre einfach mit der Faust ins Gesicht.<br />
Er zerrte ihn nach draußen. Ein paar Tage lang haben die<br />
Mönche ihren Mitgefangenen nicht gesehen.<br />
Als Petre zurückkam, hatte er kein Alter mehr. Seine<br />
Haare und sein Schnurrbart waren weiß wie die Bärte der<br />
Mönche. Die Wärter hatten ihm die Zähne ausgeschlagen.<br />
Alles an ihm hatte sich verändert; sein Gang, sein Blick. Er<br />
sprach nicht mehr.<br />
Aus dem Polnischen von Joanna Manc
GOMBROWICZ<br />
MIŁOSZ<br />
SZYMBORSKA<br />
MROŻEK
WITOLD<br />
GOMBROWICZ<br />
KRONOS<br />
Witold Gombrowicz (1904-1969), einer der herausragenden<br />
polnischen Schriftsteller des<br />
20. Jahrhunderts, Verfasser von in mehr als<br />
35 Sprachen übersetzten Erzählungen, Romanen<br />
und Dramen, sowie eines dreibändigen Tagebuchs,<br />
das weltweit als Juwel der Tagebuchliteratur<br />
gilt. Seit Jahren kursierten Legenden und<br />
Gerüchte um Kronos, aber nur wenige kannten<br />
das Manuskript tatsächlich; kurz nach Erscheinen<br />
avancierte das private Tagebuch zum Bestseller.<br />
Kronos, das sind bislang unbekannte, privat-intime Aufzeichnungen<br />
von Witold Gombrowicz. An sich schon faszinierend,<br />
unterscheiden sie sich radikal von den hochsophistischen<br />
Prosawerken – auch denen in Tagebuchform – die<br />
Gombrowicz selbst zum Druck freigegeben hat.<br />
Kronos hätte wohl auf ein paar Dutzend Druckseiten Platz<br />
gefunden, der vorliegende Band umfasst jedoch fast fünfhundert.<br />
Der editorisch problematische Text – davon wird<br />
sich jeder überzeugen, der ihn zur Hand nimmt – wurde mit<br />
unerlässlichen Fußnoten, Reproduktionen und Kommentaren<br />
versehen. Und mit einem so instruktiven wie anrührenden<br />
Vorwort von Rita Gombrowicz. Ihr ist es zu verdanken,<br />
dass Kronos in dieser umfassenden Form erscheinen konnte,<br />
wenngleich es Teile enthält, die für sie sehr schmerzhaft<br />
sein müssen. So erklärt sich auch die Emphase, mit der sie<br />
beispielsweise schreibt: „Witold, der in den Kriegsjahren<br />
in extremer Armut lebt, erinnert mich bisweilen an Hiob.”<br />
Anders verhält es sich mit einem weiteren Schlüsselsatz der<br />
Autorenwitwe. Wenn sie schreibt: „Kronos ist die beharrliche<br />
Suche nach den Fundamenten der eigenen Existenz”,<br />
wird man hellhörig, rührt sie hier doch an das Wesentliche,<br />
wie erstaunlich, enttäuschend, empörend, beängstigend<br />
oder desillusionierend dies auch empfunden werden mag.<br />
Gombrowicz begann höchstwahrscheinlich um den Jahreswechsel<br />
von 1952 zu 1953 mit der Arbeit an Kronos und setzte<br />
sie fast bis zu seinem Tod fort, wenn er (vermutlich in der<br />
Retrospektive) die wichtigsten (oder erwähnenswerten) Ereignisse<br />
jedes Monats notierte und jeweils zum Jahresende<br />
eine kurze „Bilanz” zog. Am Anfang steht jedoch der Versuch<br />
einer mit dem Jahr 1922 beginnenden Rekonstruktion,<br />
die zumeist noch stärker im Telegrammstil der Jahre vor<br />
Kronos gehalten ist.<br />
Diese Rekonstruktion ist wahrhaftig eindrucksvoll. Auffällig<br />
ist, dass sich Gombrowicz in Kronos auf wenige Themen<br />
beschränkt (eben jene „Fundamente der eigenen Existenz”).<br />
Dabei handelt es sich vor allem um Rechnungen und anstehende<br />
Haushaltsdinge, etwas lakonisch dargestellte<br />
Beziehungen zum persönlichen Umfeld, detaillierte Ausführungen<br />
über gesundheitliche Probleme, Erfolge und<br />
Niederlagen weniger künstlerischer als kommerzieller Natur,<br />
Übersetzungen, „Prestigegewinn” und nicht zuletzt um<br />
das erotische Leben, dargeboten in (bei guter Gesundheit<br />
und günstigen Umständen hohen) Zahlen zum Geschlechtsverkehr<br />
mit den verschiedensten Partnern. Die Erotik muss<br />
Gombrowicz ungeheuer wichtig gewesen sein, dabei aber<br />
reine Physiologie ohne romantische Verbrämung. So ist in<br />
der Bilanz des Jahres 1955 zu lesen: „Erot: ordentlich, eher<br />
gemäßigt, 15.” Bezeichnend ist, dass Gombrowicz gerade der<br />
Erotik in seiner Rekonstruktion der Vorkriegsjahre so viel<br />
Raum gibt und dass er diese Form dafür wählt. In einer von<br />
mehreren Versionen seiner Notizen ist beispielsweise zu<br />
lesen: „1939. 5, 6. 2 Nutten aus der Mokotowska, C. aus dem<br />
Zodiak. 9 Nutten. 7. Tänzerin aus Wilno (Sommer). Freundin<br />
der Brezas und Boys (Sommer). 8. (J. Wilerówna). Nutte<br />
mit Tripper. 9. Jungfrau. Außerdem: J. aus Praga, Franek, M.<br />
im Kino, vielleicht die Narbuttówna. Und die mit den Füßen<br />
in Gummigaloschen”.<br />
Dieselbe „Sachlichkeit” spricht auch aus den weiteren oben<br />
genannten Gombrowicz-Themen in seinen Notizen für den<br />
Eigenbedarf. Hat er sich nun, ist man geneigt zu fragen, sich<br />
selbst so vorgestellt, hat er sich so (nur so?) seiner erinnert,<br />
nur dies als das für ihn Wesentliche festgehalten? Darin ist<br />
Kronos eben so faszinierend – auch wenn man nicht gerade<br />
Sympathie für den Autor entwickelt sondern eher das Bedürfnis<br />
nach Distanz.<br />
Und noch ein letztes: Dieses Tagebuch, das keines ist,<br />
enthält nicht eine einzige Einlassung über „das Seelische”,<br />
die Eschatologie oder Metaphysik jeglicher Couleur. In zwei<br />
Einträgen zwingt einem die brutale Sachlichkeit jedoch den<br />
Gedanken an das Ende auf: Im Schlusssatz der Bilanz des<br />
Jahres 1961 („Gesundheit: ordentlich, Atmung schlecht, Tod<br />
immer näher.”) und an entsprechender Stelle 1966: „Ich<br />
kämpfe mit zahllosen Krankheiten, ich krepiere, mit Rita<br />
geht es insgesamt besser, aber nicht immer … Mein Gott,<br />
mein Gott, wie lange?”<br />
Irgendwo zwischen Kronos und dem restlichen Œuvre ist<br />
Witold Gombrowicz zu finden, wie er wirklich war. Vielleicht<br />
aber auch ganz woanders.<br />
Marcin Sendecki<br />
WITOLD GOMBROWICZ „KRONOS”<br />
WYDAWNICTWO LITERACKIE<br />
KRAKÓW 2013<br />
145×205, 460 PAGES<br />
ISBN: 978-83-08-05106-1<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
THE WYLIE AGENCY<br />
RIGHTS SOLD TO: CHINA (SHANGHAI<br />
99) AND CZECH REPUBLIC (TORST)
WISŁAWA<br />
SZYMBORSKA<br />
REVOLVERGLANZ<br />
Wisława Szymborska (1923-2012), Lyrikerin, Essayistin<br />
und Feuilletonistin; erhielt 1996 den Literaturnobelpreis,<br />
wurde in mehr als vierzig Sprachen<br />
übersetzt; veröffentlichte 13 Gedichtbände,<br />
die fast ausnahmslos als Meisterwerke angesehen<br />
werden.<br />
Revolverglanz zeichnet ein detailliertes Bild der inoffiziellen<br />
Wisława Szymborska, die nicht jene „Gedichte für die<br />
Welt” schreibt, die ihr den Nobelpreis eingebracht haben,<br />
sondern literarischen Schabernack für Freunde und den<br />
Eigenbedarf.<br />
Die Früchte dieser vergnüglichen Arbeit wurden zwar<br />
schon früher öffentlich, etwa in Reimereien für große Kinder<br />
(Rymowanki dla dużych dzieci, Kraków 2002), noch nie<br />
jedoch so erschöpfend wie im vorliegenden Band. Revolverglanz<br />
sei, so schreibt der Dichter, Philologe, Freund<br />
Szymborskas und ihrer schriftstellerischen Vergnügungen<br />
Bronisław Maj in seinem schalkhaften, zum wissenschaftlichen<br />
Kommentar stilisierten Vorwort „eine riesige,<br />
von ausgesprochenem Formenreichtum geprägte und<br />
aus sämtlichen Epochen ihres Schaffens – im Wortsinne:<br />
von den ersten bis zur letzten! – sich speisende Sammlung<br />
unbekannter Werke Wisława Szymborskas”. Tatsächlich<br />
eröffnet der Band mit Juvenilia – Kinderreimen, Bildchen<br />
und kurzen Briefen der kleinen Wisława, um schließlich zu<br />
enden mit dem (so die Herausgeber) „letzten Kurzgedicht<br />
Wisława Szymborskas, das sie im Krankenhaus nach ihrer<br />
Operation im Dezember 2011 schrieb, wenige Wochen vor<br />
ihrem Tod”. Das Gedicht lautet folgendermaßen: „Die Niederlande<br />
haben sich weise gezeigt, / sie wissen, was zu tun<br />
ist, / wenn die natürliche Beatmung streikt!” Damit hat die<br />
Verfasserin der Rufe an Yeti ein unverkennbar dramatisches,<br />
dabei aber typisch distanziert-humorvolles, poetisches<br />
„letztes Wort” gesprochen.<br />
Zwischen den ersten literarischen Gehversuchen und<br />
der letzten Krankenhausnotiz entfaltet sich vor dem Leser<br />
der gesamte Mikrokosmos Szymborskas literarischer<br />
Scherze, die neben der chronologischen Ordnung auch<br />
nach Genres (zumeist Erfindungen der Autorin) und Themen<br />
gruppiert sind. (Die Suche nach Äquivalenten für Erzeugnisse<br />
aus dem Hause Szymborska wie moskaliki, lepieje,<br />
adoralia etc. in anderen Sprachen dürfte für Übersetzer<br />
eine echte Herausforderung sein – und ein großer Spaß<br />
obendrein). Dabei handelt es sich nicht allein um Gedichte,<br />
erwähnt seien nur die zauberhaften „Briefe eines Parkplatzwächters”,<br />
die „Märchen aus dem Leben toter Dinge”<br />
von 1949 oder der titelgebende Text, ein Auszug aus einer<br />
Krimiromanze, der wohl aus dem Jahr 1935 datiert!<br />
Erwähnt sei noch, dass nicht allein der Text den Band<br />
so reizvoll macht. Im Grunde handelt es sich um ein Album,<br />
reich illustriert mit Fotografien, Reproduktionen von<br />
Zeichnungen und Faksimiles zahlreicher Manuskripte und<br />
Typoskripte der Dichterin.<br />
Marcin Sendecki<br />
WISŁAWA SZYMBORSKA<br />
“BŁYSK REWOLWRU”<br />
AGORA<br />
WARSZAWA 2013<br />
190×245, 142 PAGES<br />
ISBN: 978-83-2681-248-4<br />
TRANSLATION RIGHTS: FUNDACJA<br />
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
CZESŁAW<br />
MIŁOSZ<br />
DIE BERGE<br />
DES PARNASS<br />
Czesław Miłosz (1911-2004), Dichter, Prosaautor,<br />
Essayist und Übersetzer. Literaturnobelpreis<br />
1980, in 42 Sprachen übersetzt. Ehrendoktorwürde<br />
zahlreicher Universitäten in den USA und in<br />
Polen, Ehrenbürger Litauens und Krakaus.<br />
Die Berge des Parnass ist nach den Romanen Das Gesicht der<br />
Zeit und Tal der Issa aus den 1950er Jahren Czesław Miłosz'<br />
dritter und letzter Versuch in der erzählenden Prosa. Die<br />
Anfänge liegen wohl im Jahr 1967, besonders intensiv arbeitete<br />
er in den Jahren 1970 und 1971 an diesem Text, um<br />
ihn, ebenfalls 1971, schließlich doch zu verwerfen. Auszüge<br />
aus dem unvollendeten Werk bot Miłosz 1972 der Pariser<br />
„Kultura” an, aber Jerzy Giedroyć zeigte sich skeptisch und<br />
druckte sie nicht ab. Erst jetzt wurde das mehrere Dutzend<br />
Seiten starke Typoskript – fünf ausgewählte Kapitel aus<br />
einer längeren Manuskriptfassung, ergänzt um die Einleitung<br />
– veröffentlicht.<br />
In mindestens dreierlei Hinsicht ist dieser Text bemerkenswert:<br />
Zum ersten haben wir es laut Untertitel mit Science-Fiction<br />
zu tun, was Anreiz genug sein sollte, sich mit<br />
Miłosz' Unternehmen zu befassen, schließlich ist eine solche<br />
„Suche nach der geräumigeren Form“ ein verheißungsvolles<br />
Unterfangen. Zum zweiten, und das hängt mit dem ersten<br />
Punkt zusammen, liefert Miłosz als Prosaiker und Kommentator<br />
seiner Prosa zahlreiche Ergänzungen zum bereits<br />
Bekannten. Und drittens lohnen bislang unbekannte Zeilen<br />
eines Nobelpreisträgers die aufmerksame Lektüre, selbst<br />
wenn sie Fragment geblieben sind, und, wie er selbst einräumt,<br />
ein Dokument seines künstlerisches Scheiterns.<br />
Czesław Miłosz hatte bekanntlich von der modernen<br />
Prosa, zumal aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,<br />
keine besonders hohe Meinung. Er fand, sie habe sich „von<br />
der Welt der Dinge und der menschlichen Beziehungen losgelöst“,<br />
und „der zeitgenössische Roman ist, geschult an Bewusstseinsströmen,<br />
inneren Monologen etc. und gepeinigt<br />
von strukturalistischen Theorien so weit gegangen, dass<br />
er kaum noch an das erinnert, was einmal unter Roman<br />
verstanden wurde“, heißt es in der Einleitung zu Die Berge<br />
des Parnass. Die neue Prosa hat also Miłosz zufolge verloren,<br />
was sie einst belebte und aufblühen ließ: die Fähigkeit,<br />
zu Herz und Gewissen weiter Leserkreise durchzudringen,<br />
Wahrheiten zu verkünden und allgemeinverständliche<br />
Debatten anzustoßen. In der wissenschaftlichen Fantastik<br />
erkannte Miłosz jedoch das Genre, in dem die Tugenden der<br />
ursprünglichen, „altmodischen“ Prosa noch lebendig sind,<br />
und das, zumindest in seiner klassischen Ausprägung, besser<br />
als die elitäre Poesie dazu angetan ist, das traditionelle<br />
Gespräch mit dem Publikum aufzunehmen. Das gilt beispielsweise<br />
für Stanisław Lems Solaris, das Miłosz in dem<br />
Maße schätzte, wie er die späteren Genreexperimente Lems<br />
und – Ironie der Geschichte! – dessen Suche nach einer geräumigeren<br />
Form für die Science-Fiction kritisierte.<br />
Miłosz stürzte sich in die Science-Fiction, um seiner<br />
Sorge um die zivilisatorische Entwicklung der Menschheit<br />
Ausdruck zu verleihen. Er skizzierte ein Bild der Welt am<br />
Ende des 21. Jahrhunderts, in der technischer Fortschritt<br />
zwanghaften, sinnlosen Konsum generiert und die Bindungen<br />
innerhalb der Gesellschaft auflöst, die von einer elitären<br />
Technokratenkaste regiert wird. In dieser Welt, die der Verstand<br />
um den Sinn und an ihre Grenze gebracht hat, entsteht<br />
jedoch die Keimzelle einer quasireligiösen Renaissance, ein<br />
Häuflein Andersdenkender, das, angeführt von einem gewissen<br />
Efraim, nach Hoffnung und nach einem Ausweg aus<br />
der allgemeinen Gleichgültigkeit und Ohnmacht sucht.<br />
Wie das Ganze ausgeht, wissen wir nicht. Miłosz hat<br />
lediglich eine erste, zuweilen sehr plastische Skizze seiner<br />
Welt entworfen, eine erste, zuweilen sehr reizvolle Einführung<br />
ausgewählter Figuren – eine Handlung (was sonst hätte<br />
die Emotionen der Leser galvanisieren sollen?) konnte er<br />
nicht in Gang setzen. Vermutlich verlor er auch deshalb das<br />
Interesse an diesem Stoff. Der Autor selbst findet in der unbedingt<br />
lesenswerten Einleitung, die zeigt, wie altmodisch<br />
und wie erzmodern das Scheitern plausibel gemacht wird,<br />
eine raffinierte Erklärung für seinen Rückzug. Sämtliche<br />
Abenteuer, Kontexte, Bezüge und die erstaunlichen Fortsetzungen<br />
der Berge des Parnass spricht Agnieszka Kosińska in<br />
ihrem aufschlussreichen Nachwort an. Und damit niemand<br />
auf die Idee kommt, Die Berge des Parnass könnten ein reiner<br />
Prosatext sein, ist die 1968 in der „Kultura“ veröffentlichte<br />
Liturgie Efraims beigefügt. Versehen mit einem „Kommentar<br />
zur Erklärung, wer Efraim war“, zeigen die mit biblischen<br />
Gleichnissen durchsetzten rituellen Inkantationen Miłosz<br />
ganz in seinem Element.<br />
Die Berge des Parnass sind wahrlich ein faszinierendes<br />
Stück Literatur.<br />
CZESŁAW MIŁOSZ<br />
„GÓRY PARNASU”<br />
WYDAWNICTWO KRYTYKI<br />
POLITYCZNEJ<br />
WARSZAWA 2012<br />
145×205, 128 PAGES<br />
ISBN: 978-83-63855-01-7<br />
TRANSLATION RIGHTS:<br />
THE WYLIE AGENCY<br />
Marcin Sendecki
MAŁGORZATA I.<br />
NIEMCZYŃSKA<br />
MROŻEK. STRIPTEASE<br />
EINES NEUROTIKERS<br />
Małgorzata I. Niemczyńska (geb. 1982), Rezensentin<br />
und Journalistin der „Gazeta Wyborcza“<br />
und des Magazins „<strong>Książki</strong>. Magazyn do czytania“,<br />
in dem sie zu literarischen Themen publiziert<br />
und Interviews mit Schriftstellern, Musikern<br />
und Filmschaffenden veröffentlicht.<br />
Die erste Biografie zu Sławomir Mrożek nach dessen Tod<br />
ist keine Biografie im engeren Sinne. Mrożek. Striptease eines<br />
Neurotikers von Małgorzata I. Niemczyńska ist eher ein<br />
glänzend geschriebener und hervorragend dokumentierter<br />
Atlas der Konstellationen um den Autor von Polizei, Der<br />
Schneider oder Schlachthof, um den auf näheren oder weiter<br />
entfernten Umlaufbahnen zahlreiche weitere Planeten,<br />
Monde und Sterne ihre Kreise ziehen und durch ihr Kraftfeld<br />
die Position des Planeten Mrożek auf der Himmelskarte<br />
ständig neu bestimmen.<br />
Die Objekte der Mrożek-Konstellation sind Menschen<br />
und Orte, angefangen mit Borzęcin bei Krakau, wo der<br />
Autor geboren wurde und den Krieg erlebte. Von Mrożek<br />
selbst nur beiläufig erwähnt, hat diese Genesis, wie Striptease<br />
eines Neurotikers darlegt, den Autor maßgeblich beeinflusst.<br />
Dabei war dieser Einfluss, wie so vieles in seinem<br />
Leben, paradoxer Natur. Denn Mrożek hat nicht versucht,<br />
sich wie andere Autoren seiner Generation literarisch oder<br />
auf der Bühne mit seinen Kriegserinnerungen auseinanderzusetzen.<br />
Er hat dazu geschwiegen und ihnen erst 1980<br />
in Zu Fuß Gestalt gegeben. Doch war ihm wohl eher an einem<br />
verspäteten Dialog mit dem Vater gelegen als an der<br />
Geschichte selbst.<br />
Zu den charakteristischen Vorgehensweisen von Striptease<br />
eines Neurotikers zählt, dass es über das Leben Mrożeks<br />
erzählt, biografische Spuren aber auch in seinen Werken<br />
und in den Biografien Dritter sucht, die ihn mit ihrer Persönlichkeit,<br />
ihren Gefühlen und ihrer Intelligenz geprägt<br />
haben und vice versa. Daher treten in Niemczyńskas Buch<br />
bisweilen andere Figuren in den Vordergrund, etwa Witold<br />
Gombrowicz, aus dessen geistigem Schatten Mrożek sich<br />
lange Zeit zu befreien suchte, was eigentlich nicht gelingen<br />
konnte, war doch der Kampf um das außergewöhnliche Ich<br />
beider „Lebenswerk“. Nicht zu vergessen auch Stanisław<br />
Lem (man lese Striptease eines Neurotikers parallel zur Korrespondenz<br />
der beiden Schriftsteller), der mit Mrożek bei<br />
allen Unterschieden ihrer literarischen Universen in seiner<br />
Haltung zu Mensch und Welt erstaunlich viel gemein hatte<br />
– diese Haltung hat fast etwas Misanthropisches, abgesehen<br />
vielleicht von der Liebe zur Motorisierung. Małgorzata<br />
I. Niemczyńska ist es wohl zuallererst um ein emotionales<br />
Bildnis des Autors zu tun, das besonders eindringlich wird,<br />
wenn sie von seinen Frauen erzählt: der nahezu vergessenen,<br />
aber offenbar höchst interessanten Malerin Maria<br />
Obremba (deren Zwillingsschwester die erste Frau Andrzej<br />
Wajdas war, damit waren Wajda und Mrożek eine Zeit lang<br />
verschwägert) und der Mexikanerin Susana Osorio Rosas.<br />
Das emotionale Porträt markiert den finstersten Teil in<br />
Niemczyńskas Buch, der freilich allen bekannt war, die<br />
Mrożeks Tagebuch in Gänze bewältigt haben.<br />
Es gibt aber noch eine weitere Frau, die im Leben<br />
Mrożeks eine entscheidende Rolle gespielt hat und ihn<br />
vielleicht besser kannte als viele seiner Freunde. Striptease<br />
eines Neurotikers beginnt nämlich mit einer eigenwilligen<br />
Rekonstruktion von Sławomir Mrożeks Rückkehr aus der<br />
Aphasie bzw. mit der mühevollen Arbeit, ihn neu zu modellieren.<br />
Die Protagonistin dieses Teils ist Mrożeks Therapeutin<br />
Beata Mikołajko, die bei Niemczyńska zur stillen Heldin<br />
avanciert. Das Buch schließt mit einem Interview, einem<br />
der letzten, die Mrożek gab, nachdem er Polen endgültig<br />
in Richtung Nizza verlassen hatte. Damit ist ein starker<br />
Schlusspunkt unter den Abgang eines Autors gesetzt, der<br />
offenbar die Auseinandersetzungen, die er jahrzehntelang<br />
mit sich selbst ausgefochten hat, wenn nicht in Wohlgefallen<br />
auflösen, so doch ad acta legen konnte.<br />
Neben Erzählungen über den Autor, sein näheres Umfeld<br />
(auch das nahe, praktisch nie das allernächste) und<br />
seine fast durchweg vorübergehenden Aufenthaltsorte<br />
(empfohlen sei das fantastische Kapitel über das Krakauer<br />
Schriftstellerhaus, in dem seinerzeit u.a. Szymborska, Kisielewski,<br />
Słomczyński, Gałczyński oder Różewicz lebten)<br />
wartet Małgorzata I. Niemczyńskas Buch mit zahlreichen<br />
spannenden Entdeckungen und Erinnerungen zum Frühwerk<br />
Mrożeks auf. Genannt seien hier nur sein Superheldencomic<br />
oder der gemeinsam mit Bruno Miecugow verfasste<br />
(und in der Werkausgabe nicht enthaltene) Roman<br />
über Senator McCarthy. Die Autorin erwähnt auch den<br />
Filmschaffenden Mrożek, eine heute völlig vergessene Seite<br />
des Autors von Liebe auf der Krim (nicht einmal in umfassenden<br />
Datenbanken wie filmweb oder imdb wird er geführt).<br />
Wir werden noch mit zahlreichen biografischen Werken<br />
von Mrożek-Forschern und -Freunden zu tun bekommen –<br />
Striptease eines Neurotikers hat die Messlatte hoch gelegt.<br />
Paweł Goźliński<br />
MAŁGORZATA I. NIEMCZYŃSKA<br />
„MROŻEK. STRIPTIZ NEUROTYKA”<br />
AGORA<br />
WARSZAWA 2013<br />
170×220, 250 PAGES<br />
ISBN: 978-83-268-1276-7<br />
TRANSLATION RIGHTS: AGORA
NEUE BÜCHER AUS POLEN<br />
HERBST 2013<br />
©Das Polnische Buchinstitut, Krakau 2013<br />
Redaktion: Izabella Kaluta, Andre Rudolph<br />
Texte von: Paweł Goźliński, Maria Kruczkowska,<br />
Anna Marchewka, Dariusz Nowacki, Patrycja<br />
Pustkowiak, Marcin Sendecki, Kazimiera<br />
Szczuka, Małgorzata Szczurek<br />
Übersetzung: Joanna Manc, Lisa Palmes,<br />
Antje Ritter-Jasińska, Heinz Rosenau,<br />
Renate Schmidgall, Paulina Schulz,<br />
Benjamin Voelkel, Thomas Weile<br />
Weitere Informationen über die Polnische<br />
Literatur auf www.bookinstitute.pl<br />
Eine englische Ausgabe dieses Katalogs unter<br />
dem Titel New Book From Poland Fall 2013<br />
kann über das Buchinstitut bezogen werden.<br />
Graphik und Satz:<br />
Studio Otwarte, www.otwarte.com.pl
www.bookinstitute.pl