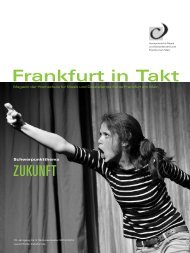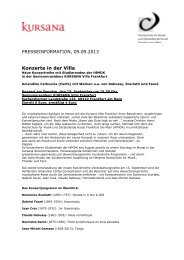O-Töne Februar 2010.indd - HfMDK Frankfurt
O-Töne Februar 2010.indd - HfMDK Frankfurt
O-Töne Februar 2010.indd - HfMDK Frankfurt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
O-Töne 8. Jahrgang | Nr. 1 | 4. <strong>Februar</strong> 2010<br />
Laura Linnenbaum, Daniel Schauf und Gabriel von Zadow versuchen sich am Genre Komödie<br />
„Lachtheater“, ganz professionell<br />
Komödie? Und das im LAB, einem Ort<br />
experimenteller Formen? Meistens<br />
rümpfen wir die Nase, denn das so<br />
genannte Lachtheater dient für viele<br />
„nur“ der mehr oder weniger intelligenten<br />
Unterhaltung, geschrieben aus rein<br />
szenischen und selten literarischen<br />
Gesichtspunkten. Es beruht auf Kalkül und<br />
Konstruktion.<br />
Das „Wie“, Fragen nach Rhythmus,<br />
Timing, Tempo, stehen für die Regie<br />
handwerklich im Vordergrund. Manche<br />
Stücke, etwa die von Feydeau, Labiche,<br />
Ayckbourne oder Frayn, gleichen eher<br />
Ikea-Bauanleitungen. Damit scheinen sie<br />
die „künstlerische Freiheit“ der Regisseure<br />
erheblich einzuschränken. Dennoch bildet<br />
„Komödie“, neben „Realismus“, „Klassik/<br />
Antike“, „Moderne“ und „Postmoderne/<br />
Dekonstruktion/Gegenwartsdramatik“ eine<br />
Säule im Rahmen der Ausbildung.<br />
Szenenfoto aus den Proben zum Komödienabend am 11. <strong>Februar</strong> im „LAB <strong>Frankfurt</strong>“, dem neuen<br />
Proben- und Aufführungsort der Hochschule in der Schmidtstraße 12. Foto: Sophie Linnenbaum<br />
Das Lachen soll uns<br />
nicht vergehen<br />
Das Lachen soll uns auch weiterhin nicht<br />
vergehen. Und - Volker Klotz führt dies in<br />
seinem Buch „Bürgerliches Lachtheater“<br />
sehr überzeugend aus – das Theater ist<br />
eher in der Lage als andere Künste wie<br />
Musik oder Malerei, die Leute auf gezielt<br />
ästhetischem Weg zum Lachen zu bringen.<br />
Die Studierenden sollen also lernen, mit<br />
der Entstellung gewohnter Abläufe und<br />
Verhaltensweisen (Situationskomik),<br />
der Entstellung von empfundenem<br />
„Schönen“ (Typenkomik) und der Brechung<br />
gemeinsamer historischer und sozialer<br />
Erfahrungen (Über- oder Untertreibung)<br />
zu arbeiten. Dazu muss er natürlich<br />
Gesellschaft genau kennen, damit diese<br />
im oft kritischen Erkennen über sich selber<br />
lacht.<br />
Gefragt sind genaue handwerkliche<br />
Anweisungen und eine klare Setzung von<br />
szenischen Wirkungen. Zu entdecken ist<br />
das Paradox der Freiheit innerhalb einer<br />
vorgegebenen Form und die Erzielung<br />
von Reaktionen im Hier und Jetzt.<br />
Zu lernen ist aber auch, dass eine<br />
Aneinanderreihung von szenischen<br />
Einfällen noch kein Ganzes ergibt.<br />
Der Regisseur bekommt in der<br />
Arbeit direkt zurückgespiegelt, was<br />
„funktioniert“ und was nicht.<br />
Zu unserer Arbeitsweise:<br />
Wir haben versucht, eine möglichst<br />
genaue Simulation einer<br />
professionellen Arbeitssituation<br />
nachzuvollziehen. Die Studierenden<br />
mussten ein Stück auswählen,<br />
die Auswahl begründen und eine<br />
konzeptuelle Strichfassung innerhalb<br />
einer festen Aufführungsdauer<br />
(maximal 30 Minuten pro Stück)<br />
erstellen. Jeder bekam ein Budget<br />
für Schauspieler und Ausstattung,<br />
Teams (Bühne und Dramaturgie)<br />
mussten gebildet und in einem<br />
„Vorsprechmarathon“ Entscheidungen<br />
für eine optimale Besetzung getroffen<br />
werden. Die Proben begannen am 11.1.<br />
2010 im LAB in der Schmidtstrasse,<br />
Premiere ist am 10. <strong>Februar</strong> 2010. Die<br />
Produktionen werden von mir betreut,<br />
wobei die Regel gilt: Der Dozent<br />
spricht nur mit den Regisseuren, nicht<br />
mit den Schauspielern.<br />
Was wir erwarten können, sind drei<br />
völlig verschiedene „Beziehungskisten“:<br />
Laura Linnenbaum hat sich<br />
das Stück „Indien“ von Josef Hader/<br />
Alfred Dorfer vorgenommen, ein<br />
Roadmovie über ein ungleiches Paar<br />
von Unsympathen, die sich langsam<br />
näher kommen. Daniel Schauf<br />
überprüft Dario Fo/Franca Rames<br />
Stück „Offene Zweierbeziehung“<br />
auf seine heutige Bühnen- und<br />
Beziehungstauglichkeit und<br />
Gabriel von Zadow wagt sich an<br />
Samuel Becketts Roman „Mercier und<br />
Camier“, eine eher leise Geschichte,<br />
die nach dem Sinn des Lebens fragt.<br />
Prof. Hans-Ulrich Becker<br />
Donnerstag, 11. <strong>Februar</strong><br />
Freitag, 12. Feburar, jeweils 20 Uhr,<br />
Ort: LAB <strong>Frankfurt</strong>, Schmidtstr. 12