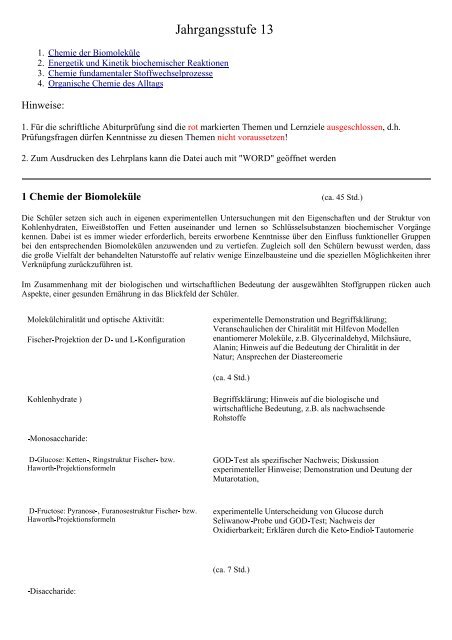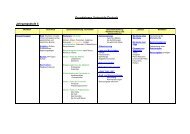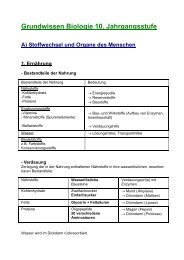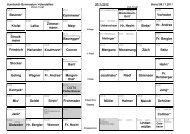Lehrplan der K13 - Humboldt-gym.de
Lehrplan der K13 - Humboldt-gym.de
Lehrplan der K13 - Humboldt-gym.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Glucose:<br />
Fructose:<br />
,<br />
,<br />
Probe<br />
Test;<br />
Endiol<br />
Jahrgangsstufe 13<br />
1. Chemie <strong><strong>de</strong>r</strong> Biomoleküle<br />
2. Energetik und Kinetik biochemischer Reaktionen<br />
3. Chemie fundamentaler Stoffwechselprozesse<br />
4. Organische Chemie <strong>de</strong>s Alltags<br />
Hinweise:<br />
1. Für die schriftliche Abiturprüfung sind die rot markierten Themen und Lernziele ausgeschlossen, d.h.<br />
Prüfungsfragen dürfen Kenntnisse zu diesen Themen nicht voraussetzen!<br />
2. Zum Ausdrucken <strong>de</strong>s <strong>Lehrplan</strong>s kann die Datei auch mit "WORD" geöffnet wer<strong>de</strong>n<br />
1 Chemie <strong><strong>de</strong>r</strong> Biomoleküle (ca. 45 Std.)<br />
Die Schüler setzen sich auch in eigenen experimentellen Untersuchungen mit <strong>de</strong>n Eigenschaften und <strong><strong>de</strong>r</strong> Struktur von<br />
Kohlenhydraten, Eiweißstoffen und Fetten auseinan<strong><strong>de</strong>r</strong> und lernen so Schlüsselsubstanzen biochemischer Vorgänge<br />
kennen. Dabei ist es immer wie<strong><strong>de</strong>r</strong> erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lich, bereits erworbene Kenntnisse über <strong>de</strong>n Einfluss funktioneller Gruppen<br />
bei <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Biomolekülen anzuwen<strong>de</strong>n und zu vertiefen. Zugleich soll <strong>de</strong>n Schülern bewusst wer<strong>de</strong>n, dass<br />
die große Vielfalt <strong><strong>de</strong>r</strong> behan<strong>de</strong>lten Naturstoffe auf relativ wenige Einzelbausteine und die speziellen Möglichkeiten ihrer<br />
Verknüpfung zurückzuführen ist.<br />
Im Zusammenhang mit <strong><strong>de</strong>r</strong> biologischen und wirtschaftlichen Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> ausgewählten Stoffgruppen rücken auch<br />
Aspekte, einer gesun<strong>de</strong>n Ernährung in das Blickfeld <strong><strong>de</strong>r</strong> Schüler.<br />
Molekülchiralität und optische Aktivität:<br />
Fischer Projektion <strong><strong>de</strong>r</strong> D und L Konfiguration<br />
experimentelle Demonstration und Begriffsklärung;<br />
Veranschaulichen <strong><strong>de</strong>r</strong> Chiralität mit Hilfevon Mo<strong>de</strong>llen<br />
enantiomerer Moleküle, z.B. Glycerinal<strong>de</strong>hyd, Milchsäure,<br />
Alanin; Hinweis auf die Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> Chiralität in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Natur; Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> Diastereomerie<br />
(ca. 4 Std.)<br />
Kohlenhydrate )<br />
Begriffsklärung; Hinweis auf die biologische und<br />
wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utung, z.B. als nachwachsen<strong>de</strong><br />
Rohstoffe<br />
¡<br />
Monosacchari<strong>de</strong>:<br />
¢ ¢ ¢<br />
D Ketten Ringstruktur Fischer bzw.<br />
¢<br />
Haworth Projektionsformeln<br />
¡<br />
GOD Test als spezifischer Nachweis; Diskussion<br />
experimenteller Hinweise; Demonstration und Deutung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Mutarotation,<br />
D<br />
¢<br />
¢ ¢<br />
Pyranose Furanosestruktur Fischer bzw.<br />
¢<br />
Haworth Projektionsformeln<br />
experimentelle Unterscheidung von Glucose durch<br />
¡ ¡<br />
Seliwanow und GOD Nachweis <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
£ £<br />
Oxidierbarkeit; Erklären durch die Keto Tautomerie<br />
(ca. 7 Std.)<br />
£<br />
Disacchari<strong>de</strong>:
zw.<br />
glykosidischen<br />
barkeit;<br />
£<br />
glykosidische Bindung Erkennen <strong>de</strong>s Prinzips; Vergleichen <strong>de</strong>s Maltose und<br />
£<br />
Trehalose Verknüpfungstyps: Auswirkung auf das<br />
Reduktionsvermögen; Anwen<strong>de</strong>n und Einüben im weiteren<br />
Unterricht;<br />
Maltose und Cellobiose Herausstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> α<br />
£<br />
β<br />
£<br />
Bindung;<br />
£<br />
Saccharose experimentelle Untersuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Oxidier Vergleich<br />
mit <strong>de</strong>m neutralisierten Hydrolysat; Nachweis <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Hydrolyseprodukte; Ableiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Strukturformel;<br />
Demonstration und Deutung <strong><strong>de</strong>r</strong> Inversion<br />
(ca. 6 Std.)
¢<br />
Molekülstruktur<br />
¤<br />
Verknüpfung<br />
¥<br />
Bauprinzip,<br />
Base<br />
,<br />
gewinnung,<br />
und<br />
Polysacchari<strong>de</strong>:<br />
Stärke, Glykogen, Cellulose<br />
Aufzeigen <strong>de</strong>s Zusammenhangs zwischen Molekülstruktur,<br />
¡<br />
Eigenschaften und bio logischer Be<strong>de</strong>utung; Unterschei<strong>de</strong>n<br />
von Amylose, Amylopektin und Glykogen; Überblick über die<br />
¡<br />
wirtschaftliche Be <strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> Cellulose; Eingehen auf einen<br />
wichtigen technischen Prozeß und seine Umweltproblematik,<br />
¡ ¡<br />
z.B. Zellstoff Papierherstellung und recycling<br />
(ca. 5 Std.)<br />
Aminocarbonsäuren und Proteine<br />
und Eigenschaften<br />
von Aminocarbonsäuren: Löslichkeit,<br />
£ £<br />
Aggregatzustand, Säure Verhalten<br />
Überblick über Vorkommen<br />
Vorstellen einiger natürlicher Aminosäuren; Hinweis auf die<br />
Gruppeneinteilung; Erarbeiten <strong>de</strong>s gemeinsamen Bauprinzips;<br />
Anwen<strong>de</strong>n von Kenntnissen zur Chiralität; experimentelle<br />
Untersuchung physikalischer und chemischer Eigenschaften;<br />
¤<br />
Erarbeiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Zwitterion Struktur und ihres<br />
Ampholytcharakters; isoelektrischer Punkt und Prinzip <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Elektrophorese<br />
(ca. 7 Std.)<br />
durch Peptidbindung Erfassen <strong><strong>de</strong>r</strong> Peptidbindung als Ergebnis einer Kon<strong>de</strong>nsation;<br />
¤<br />
Beschreiben <strong>de</strong>s mesomeren Charakters und <strong><strong>de</strong>r</strong> Raum struktur<br />
¥<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Peptidgruppe; Durchführen <strong><strong>de</strong>r</strong> Biuret Probe und Deuten<br />
ihres Ergebnisses<br />
Eigenschaften und Be<strong>de</strong>utung von<br />
Proteinen: Aminosäuresequenz, Kettenkonfortnation<br />
¥<br />
Vorstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> (α Helix (Keratin, Wolle) und <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Faltblattstruktur (Fibroin, Sei<strong>de</strong>); Eingehen auf höhere<br />
Strukturen und ihre Stabilisierung; Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> Protei<strong>de</strong>;<br />
Denaturierung, Hydrolyse<br />
Durchführen und Auswerten von Experimenten; Hinweis auf<br />
¥<br />
mo<strong><strong>de</strong>r</strong>ne Verfahren zur Proteinisolierung und analyse;<br />
Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> biologischen Be<strong>de</strong>utung, z.B. als Enzym,<br />
Nährstoff, Giftstoff<br />
(ca. 8 Std.)<br />
Fette und fette Öle<br />
Bauprinzip und Eigenschaften: Esterbindung<br />
allgemeiner Aufbau eines heteroaci<strong>de</strong>n Triacylglycerins<br />
¦ ¦<br />
(Palmitin Stearin Ölsäure als Fettsäuren);<br />
Auswirkungen verschie<strong>de</strong>ner Fettsäurereste<br />
Hydrolyse<br />
Erklären von Erweichungsintervall und Konsistenz; Nachweis<br />
<strong>de</strong>s ungesättigten Charakters;<br />
Durchführen <strong><strong>de</strong>r</strong> Fettverseifung
¢<br />
Eigenart<br />
£<br />
Struktur<br />
¦<br />
Vorkommen und Be<strong>de</strong>utung Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> biologischen Be<strong>de</strong>utung als Nähr und<br />
Speicherstoffe; Hinweis auf die Fetthärtung und ihre<br />
wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utung; Fette als nachwachsen<strong>de</strong> Rohstoffe<br />
(ca. 8 Std.)<br />
2 Energetik und Kinetik biochemischer Reaktionen (ca. 16 Std.)<br />
Ausgehend von einfachen Experimenten erfassen die Schüler grundlegen<strong>de</strong> Gesetzmäßigkeiten Der Thermodynamik und<br />
übertragen diese auf biochemische Reaktionen. Sie wer<strong>de</strong>n sich <strong><strong>de</strong>r</strong> Notwendigkeit und zentralen Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Biokatalyse für das ganze Stoffwechselgeschehen in Lebewesen bewusst und lernen, die Wirkungsweise <strong><strong>de</strong>r</strong> Enzyme mit<br />
Hilfe einfacher Mo<strong>de</strong>ll vorstellungen zu beschreiben.<br />
Grundlagen <strong>de</strong>s Energieumsatzes<br />
Freie Enthalpie als "Triebkraft" chemischer<br />
Reaktionen: Prinzip <strong>de</strong>s Enthalpieminimums und<br />
¡<br />
Entropie maximums<br />
Aufgreifen und Erweitern von Grundkenntnissen,<br />
Unterschei<strong>de</strong>n zwischen thermodyna misch und kinetisch<br />
kontrollierten Reaktionen<br />
experimentelle Einführung zur Unterscheidung von Freier<br />
¢<br />
Enthalpie, Enthalpie und Entropie; Interpretieren <strong><strong>de</strong>r</strong> Gibbs<br />
¢<br />
Helmholtz Gleichung; Hinweis auf <strong>de</strong>n Zusammenhang<br />
zwischen ∆G und ∆E bei Redoxreaktionen<br />
biologischer Systeme: energetische<br />
Koppelung Fließgleichgewicht<br />
schematische Darstellung (Formelschema) <strong><strong>de</strong>r</strong> Verknüpfung<br />
exergonischer und en<strong><strong>de</strong>r</strong>gonischer Stoffwechselreaktionen<br />
¢<br />
über das ATP/ADP System; Anwen<strong>de</strong>n im weiteren<br />
Unterricht; Herausarbeiten <strong>de</strong>s Unterschieds zwischen<br />
Fließgleichgewicht und chemischem Gleichgewicht<br />
(ca. 7 Std.)<br />
Biokatalyse<br />
Aufgreifen und Erweitern von Grundkenntnissen;<br />
und Be<strong>de</strong>utung von Enzymen: Demonstration einer Enzymreaktion, z.B. Stärkeabbau;<br />
Proteinnatur<br />
Cofaktoren<br />
Verwendung<br />
experimenteller Nachweis;<br />
Herausstellen ihrer Be<strong>de</strong>utung; NAD + bzw. Häm als Beispiel<br />
für ein Coenzym bzw. eine prosthetische Gruppe (nur<br />
Formelschema);<br />
Hinweis auf <strong>de</strong>n Einsatz von Enzymen, z.B. in Medizin,<br />
Analytik, Biotechnologie<br />
(ca. 3 Std.)
£<br />
Be<strong>de</strong>utung<br />
£<br />
Wirkung<br />
und<br />
Schloß<br />
Wert<br />
Wirkungsweise von Enzymen:<br />
Substrat<br />
¡<br />
Wirkungsspezifität Durchführen und Auswerten von Experimenten; Deuten mit<br />
Hilfe einer bildhaften Mo<strong>de</strong>ll vorstellung, ("Schlüssel Schloß<br />
Prinzip");<br />
Abhängigkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> Aktivität von <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Substratkonzentration<br />
Ermitteln und Auswerten einer Substratsättigungskurve;<br />
Interpretieren mit Hilfe <strong><strong>de</strong>r</strong> Theorie vom Enzym Substrat<br />
Komplex, Michaelis Konstante als Maß für die Substrat<br />
affinität eines Enzym,<br />
¢<br />
Abhängigkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> Aktivität von Milieufaktoren Aufzeigen <strong>de</strong>s Einflusses von Temperatur, pH und<br />
Schwerrnetallionen<br />
Hemmung <strong><strong>de</strong>r</strong> Aktivität<br />
Vorstellen je eines Beispiels für isosterische und allosterische<br />
¢ ¢<br />
Hemmung; Anwen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s "Schlüssel Prinzips";<br />
Hinweis auf die Wirkung von Aktivatoren<br />
(ca. 6 Std.)<br />
3 Chemie fundamentaler Stoffwechselprozesse (ca. 22 Std.)<br />
Die gewonnenen Erkenntnisse über Eigenschaften und Struktur ausgewählter Biomoleküle sowie <strong>de</strong>n Ablauf von<br />
Reaktionen unter <strong>de</strong>n beson<strong><strong>de</strong>r</strong>en Bedingungen <strong>de</strong>s Organismus ermöglichen <strong>de</strong>n Schülern nun eine gezielte<br />
Auseinan<strong><strong>de</strong>r</strong>setzung mit Fragen <strong><strong>de</strong>r</strong> Energiebindung und Energiefreisetzung in Lebewesen. Ausgehend von einem<br />
Überblick über die wesentlichen Vorgänge <strong><strong>de</strong>r</strong> Assimilation und Dissimilation sollen die Schüler Grundprinzipien <strong>de</strong>s<br />
Stoffwechselgeschehens, wie die Glie<strong><strong>de</strong>r</strong>ung in Teilschritte o<strong><strong>de</strong>r</strong> die Einschaltung von Kreisprozessen, begreifen. Das<br />
Wissen um die fundamentale Be<strong>de</strong>utung dieser Vorgänge für <strong>de</strong>n Stoffkreislauf in Ökosystemen soll die Schüler auch in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Wahrnehmung von Umweltverän<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen sensibilisieren.<br />
Energiebindung und Stoffaufbau durch<br />
Photosynthese<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Photosynthese Bewußtmachen von Be<strong>de</strong>utung und Umfang <strong><strong>de</strong>r</strong> weltweiten<br />
£<br />
Biomasseproduktion und Sauerstoff freisetzung; Hinweis auf<br />
<strong>de</strong>n Kohlenstoffkreislauf.<br />
von Außenfaktoren: experimenteller Nachweis <strong>de</strong>s Einflusses von Außenfaktoren<br />
auf die Stärkebildung bzw. Sauerstofffreisetzung;<br />
Beleuchtungsstärke, Lichtqualität<br />
experimentelle Untersuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Blattfarbstoffe, z.B.<br />
chromatographische Trennung, Absorptionsmessung;<br />
Vergleichen von Absorptionsspektrum <strong>de</strong>s Chlorophylls und<br />
Aktionsspektrum <strong><strong>de</strong>r</strong> Photosynthese
¤<br />
anaerober<br />
¢<br />
Fixierung<br />
¤<br />
Körpers,<br />
3<br />
£<br />
Körpers<br />
phosphat<br />
£<br />
Körper;<br />
3<br />
phosphat<br />
18<br />
14<br />
3<br />
phosphat<br />
3<br />
Kohlenstoffdioxidgehalt, Temperatur<br />
Diskussion von Befun<strong>de</strong>n, die auf das Vorliegen<br />
lichtabhängiger und lichtunabhängiger Reaktionssysteme<br />
hinweisen,<br />
(ca. 6 Std.)<br />
Lichtreaktionen: Photopigmente<br />
Entwickeln einer Übersicht; Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Funktion <strong>de</strong>s<br />
Chlorophylls: Lichtabsorption, Anregung, Ionisierung;<br />
Elektronentransport<br />
Wasser als Elektronendonator; NADP + , als Elektronenakzeptor<br />
(vereinfachte Darstellung);<br />
Photophosphorylierung<br />
Bildung von ATP; Formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong> Bruttogleichung;<br />
¡ ¡<br />
Quantenbedarf, Vorstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> 0 Tracermetho<strong>de</strong><br />
(ca. 3 Std.)<br />
¡<br />
Dunkelreaktionen:<br />
C0 2<br />
Bindung an einen C 5<br />
£<br />
Spaltung <strong>de</strong>s C 6<br />
Körpers;<br />
£ £ £<br />
Reduktion Reaktion von Glycerinsäure zu Glycerinal<strong>de</strong>hyd<br />
phosphat unter Verbrauch von ATP und NADPH/H + ;<br />
£<br />
Glucosebildung Bildung <strong>de</strong>s C 6<br />
und Rückbildung <strong>de</strong>s C0 2<br />
Akzeptors<br />
(stark vereinfachte Darstellung); Erarbeiten <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
£ £<br />
Bruttogleichung; Vorstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> C Tracermetho<strong>de</strong>;<br />
Aufzeigen <strong>de</strong>s Wirkungsgra<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Gesamtprozesses<br />
£<br />
(ca. 3 Std.)<br />
Energiefreisetzung und Stoffabbau durch Gärung<br />
und biologische Oxidation<br />
Hinweis auf <strong>de</strong>n langwierigen und mühsamen Weg <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Aufklärung dieser Stoffwechselprozesse<br />
Abbau <strong><strong>de</strong>r</strong> Glucose:<br />
Glykolyse<br />
experimentelle Untersuchung einer Gärungsreaktion und<br />
Erstellen <strong><strong>de</strong>r</strong> Bruttogleichung; wesentliche Schritte:<br />
Aktivierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Glucose durch Phosphorylierung, Spaltung<br />
¤ ¤<br />
<strong>de</strong>s C 6<br />
Oxidation von Glycerinal<strong>de</strong>hyd zu<br />
¥ ¥<br />
Glycerinsäure unter Bildung von ATP und<br />
NADH/H + ; Brenztraubensäure als Endprodukt;<br />
Weiterreaktion <strong><strong>de</strong>r</strong> Brenztraubensäure<br />
Bildung von Milchsäure bzw. Ethanol unter Rückbildung von<br />
NAD + ; formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong> Bruttogleichung; Energiebilanz;<br />
Hinweis auf die wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> Gärungen;<br />
Bewußtmachen <strong><strong>de</strong>r</strong> physiologischen Wirkung <strong>de</strong>s Alkohols<br />
(ca. 5 Std.)
¥<br />
aerober<br />
¢<br />
Produkte<br />
¢<br />
Synthese<br />
und<br />
ausschnitte;<br />
Abbau <strong><strong>de</strong>r</strong> Glucose: Bildung aktivierter<br />
Essigsäure<br />
(Glykolyse: vgl. anaerober Abbau); oxidative Decarboxylierung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Brenztraubensäure an einem Multienzymkomplex;<br />
Citronensäurezyklus<br />
Abspaltung von Kohlenstoffdioxid und Bildung von<br />
NADH/H + und FADH 2<br />
(kein <strong>de</strong>tailliertes Schema);<br />
Atmungskette Wasserstoff und Elektronentransport; Bildung von Wasser<br />
und Rückbildung von NAD + und FAD; Formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Bruttogleichung; Energiebilanz und Wirkungsgrad; Hinweis auf die<br />
zentrale Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Citronensäurezyklus innerhalb <strong>de</strong>s<br />
Stoffwechselgeschehens<br />
(ca. 5 Std.)<br />
4 Organische Chemie <strong>de</strong>s Alltags (ca 37 Std.)<br />
¡<br />
Die Alltagsbe<strong>de</strong>utung organisch chemischer Syntheseprodukte stellt sich am Beispiel <strong><strong>de</strong>r</strong> Tensi<strong>de</strong>, Farbstoffe und<br />
Kunststoffe nochmals eindrucksvoll dar. Die Schüler erkennen, in welchem Maße diese Stoffe, die durch die<br />
Erschließung neuer Rohstoffquellen und gezielte Syntheseverfahren entwickelt wer<strong>de</strong>n konnten, unsere Lebenswelt<br />
prägen. Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Auseinan<strong><strong>de</strong>r</strong>setzung mit einigen dieser Synthesemöglichkeiten greifen die Schüler auf bereits bekannte<br />
Reaktionsabläufe zurück und festigen so elementare Kenntnisse.<br />
Beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s am Beispiel <strong><strong>de</strong>r</strong> Kunststoffe und <strong><strong>de</strong>r</strong> mo<strong><strong>de</strong>r</strong>nen Waschmittel sollen sie auch die Umweltproblematik dieser<br />
Produkte begreifen und hieraus die Bereitschaft zu verantwortlichem Han<strong>de</strong>ln entwickeln.<br />
Kunststoffe<br />
exemplarisches Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Alltagsbe<strong>de</strong>utung;<br />
Begriffsklärung; Abgrenzen gegen an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Werkstoffe;<br />
Hinweis auf abgewan<strong>de</strong>lte natürliche Polymere und<br />
Verbundwerkstoffe<br />
¢<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Petrochemie als Ausgangsstoffe Erdgas Erdölprodukte als Rohstoffe für die industrielle<br />
Kunststoffsynthese; Hinweis auf alternative Rohstoffquellen,<br />
z.B. Kohle, nachwachsen<strong>de</strong> Rohstoffe<br />
(ca. 3 Std.)<br />
durch Polyreaktionen: radikalische<br />
Polymerisation Polykon<strong>de</strong>nsation Polyaddition<br />
Demonstration an je einem Beispiel; Vergleichen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
¢<br />
Verknüpfungsprinzipien; For mulieren charakteristischer<br />
£<br />
£<br />
Strukturformel Erkennen von Polyestern, Poly<br />
ami<strong>de</strong>n und Phenolharzen als Polykon<strong>de</strong>nsate; ggf.<br />
Ansprechen <strong><strong>de</strong>r</strong> Copolymerisate; Hinweis auf Gefahren durch<br />
£<br />
Vinylchlorid bei <strong><strong>de</strong>r</strong> technischen PVC Herstellung<br />
(ca. 5 Std.)
£<br />
Struktur<br />
¡<br />
Molekülbau<br />
¢<br />
Synthese<br />
und<br />
und Eigenschaften: Thermoplast<br />
Duroplast Elastomer<br />
Untersuchen und Deuten <strong><strong>de</strong>r</strong> unterschiedlichen thermischen<br />
und mechanischen Eigenschaften; ggf. Hinweis auf<br />
Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln<br />
(ca. 3 Std.),<br />
Verarbeitung und Verwendung Aufzeigen von Möglichkeiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Nachbe handlung am<br />
Beispiel von PVC (Weichmachung) und Polyamid<br />
(Verstrecken); Veranschaulichen einiger<br />
Verarbeitungsmöglichkeiten und probleme bei therrno und<br />
duroplastischen Kunststoffen; exemplarisches Ver<strong>de</strong>utlichen<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> vielseitigen Verwendbarkeit und wirtschaftlichen<br />
Be<strong>de</strong>utung<br />
¡<br />
Abfallproblematik Kunststoffabfälle als Teil von Haus Gewerbemüll;<br />
Probleme mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Deponierung und Verbrennung; Erkennen<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> Abfallvermeidung und <strong><strong>de</strong>r</strong> Möglichkeiten<br />
<strong>de</strong>s Recyclings; Einbeziehen aktueller Entwicklungen<br />
(ca. 6 Std.)<br />
organische Farbmittel<br />
Begriffsklärung: Farbe, Farbmittel, Farbstoff, Bewußtmachen<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> ästhetischen Dimension<br />
und Farbigkeit: Aufgreifen von Vorkenntnissen ;<br />
Anregung <strong>de</strong>lokalisierter Elektronensysteme<br />
durch Licht<br />
Demonstration <strong><strong>de</strong>r</strong> Lichtabsorption farbiger Lösungen; ggf.<br />
Aufnahme eines Absorptionsspektrums<br />
¢<br />
chromophore, auxochrome und antiauxo chrome<br />
Gruppen<br />
Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Wirkung an Beispielen; Deuten <strong>de</strong>s<br />
Farbwechsels, z.B. bei Protonierung bzw. Deprotonierung von<br />
Indikatoren<br />
(ca. 4 Std.)<br />
von Azofarbstoffen Demonstrationsversuche; Aufzeigen <strong>de</strong>s Einflusses<br />
verschie<strong>de</strong>ner Kupplungskomponenten; Formulieren <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Diazotierung und Azokupplung (kein Mechanismus); ggf.<br />
Vorstellen einer weiteren Farbstoffklasse<br />
Textilfärbung (Pr)<br />
Erkennen <strong><strong>de</strong>r</strong> Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> "Echtheiten" für die Eignung als<br />
Textilfarbstoff; praktische Durchführung von Textilfärbungen;<br />
£<br />
Hinweis auf unterschiedliche Bindungen zwischen Farbstoff<br />
£<br />
molekül und Faser; Ansprechen von Naturfarbstoffen ( B);<br />
£<br />
histor ische Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> Farbstoffe für die <strong>de</strong>utsche<br />
chemische Industrie<br />
(ca. 6 Std.)
Tensi<strong>de</strong> und Waschmittel<br />
Seifen als waschaktive Substanzen: Zusammenhang<br />
zwischen <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s amphiphilen Seifenanions<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> Waschwirkung<br />
Hinweis auf geschichtliche Aspekte; Verseifung von Fetten:<br />
klassische und mo<strong><strong>de</strong>r</strong>ne Verfahren; Demonstration <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Grenzflächenaktivität; Untersuchen <strong><strong>de</strong>r</strong> Nachteile wässriger<br />
¡<br />
Seifenlösungen: alkalische Reaktion, Säure und<br />
Härteempfindlichkeit<br />
(ca. 4 Std.)<br />
Alkylbenzolsulfonate als Beispiel für synthetische<br />
Tensi<strong>de</strong><br />
Waschmittel und Umweltschutz<br />
Ableiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Tensidwirkung aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Molekülstruktur; Hinweis<br />
¢<br />
auf kationaktive und nicht ionogene Tensi<strong>de</strong><br />
Nachweisen einiger Komponenten eines mo<strong><strong>de</strong>r</strong>nen<br />
Vollwaschmittels; Aufzeigen <strong><strong>de</strong>r</strong> Be<strong>de</strong>utung wichtiger<br />
Waschhilfsstoffe; Gespräch über die Gewässerbelastung durch<br />
Waschmittel und über Möglichkeiten zu <strong><strong>de</strong>r</strong>en Reduzierung;<br />
Hinweis auf <strong>de</strong>n Tensi<strong>de</strong>insatz in an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Bereichen, z.B.<br />
Körperpflege<br />
(ca. 6 Std.)