TiHo Bibliothek elib - Tierärztliche Hochschule Hannover
TiHo Bibliothek elib - Tierärztliche Hochschule Hannover
TiHo Bibliothek elib - Tierärztliche Hochschule Hannover
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
STAND DER FORSCHUNG<br />
Anfälle von mesialen Abschnitten wie z.B. dem Hippocampus aus (BERTRAM 2009).<br />
Hierbei ist das Zusammenspiel des Schläfenlappens mit der Amygdala und dem<br />
Hippocampus wichtig. Diese Teile des Gehirns spielen für Emotionen und die<br />
Ausbildung des Gedächtnisses eine große Rolle (MCDONALD & WHITE 1993),<br />
weshalb es bei TLE-Patienten zu Störungen der Gedächtnisleistung und der Psyche<br />
kommen kann.<br />
Die TLE ist im überwiegenden Maß nur schwer zu behandeln, da die Hälfte<br />
der Betroffenen trotz Therapie nicht anfallsfrei wird. Das Phänomen der<br />
Pharmakoresistenz tritt sehr gehäuft auf, 30-45 % der Patienten reagieren nicht auf<br />
die verabreichten Medikamente (TAVAKOLI et al. 2011). Einzelne Studien gehen von<br />
bis zu 75 % pharmakoresistenten Epilepsiepatienten aus (SPENCER 2002;<br />
SCHMIDT & LÖSCHER 2005).<br />
2.1.3 Therapie<br />
Die Therapie erfolgt ausschließlich symptomatisch, wobei die meist dauerhafte<br />
Gabe von Antiepileptika Mittel der Wahl ist. Diese Medikamente können ihre Wirkung<br />
nur entfalten, wenn sie die BHS passieren. Es handelt sich dabei um relativ kleine (<<br />
500 Da) und lipophile Moleküle, sodass die BHS gut überwunden werden kann. Die<br />
Wirkungsweise erfolgt dabei im Wesentlichen über eine verstärkte synaptische<br />
Inhibition oder aber über die Modulation spannungsabhängiger Ionenkanäle<br />
(ROGAWSKI & LÖSCHER 2004). Das Ziel der Behandlung ist die völlige<br />
Anfallsfreiheit, dabei sollen möglichst wenige oder keine Nebenwirkungen auftreten.<br />
Die dauerhafte Therapie beginnt i.d.R. mit einem einzelnen Antiepileptikum<br />
(Monotherapie), wie zum Beispiel mit Phenytoin, Phenobarbital, Topiramat und<br />
Levetiracetam. Bei einigen Patienten können aber weiterhin Anfälle auftreten.<br />
Deshalb werden häufig weitere Therapeutika eingesetzt, die den jeweiligen<br />
Wirkmechanismus ergänzen und zur Anfallsfreiheit führen sollen. Dabei ist zu<br />
beachten, dass einige Antiepileptika wie z.B. Carbamazepin, Phenobarbital und<br />
Phenytoin potentielle Induktoren des Cytochrom-P 450 -Systems sind. Sie werden<br />
deshalb schneller abgebaut und können nicht ihre volle Wirkung entfalten. Andere<br />
Antiepileptika hingegen können Enzyme, die an der Glucuronidierung beteiligt sind,<br />
hemmen (Valproat). Neuere Antiepileptika wie Topiramat und Levetiracetam zeigen<br />
keine oder nur sehr wenige solcher Wechselwirkungen (SCHMIDT & LÖSCHER<br />
2009).<br />
6


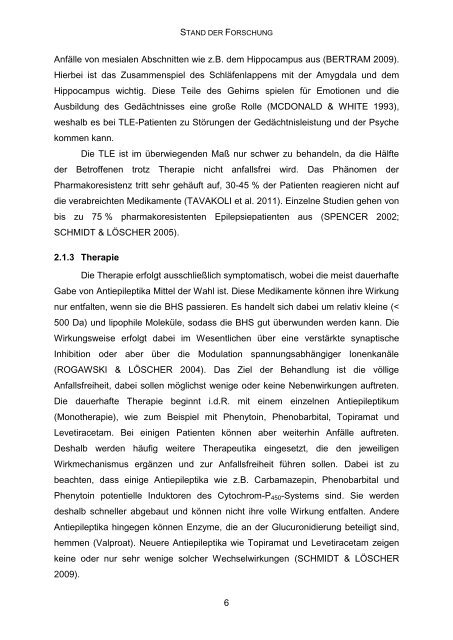


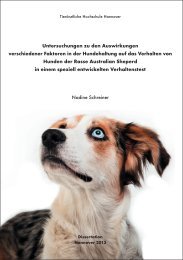



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






