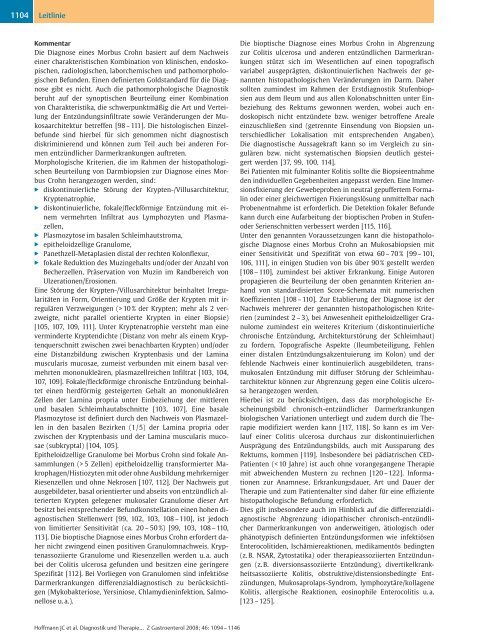Morbus Crohn der DGVS
Morbus Crohn der DGVS
Morbus Crohn der DGVS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1104<br />
Leitlinie<br />
Kommentar<br />
Die Diagnose eines <strong>Morbus</strong> <strong>Crohn</strong> basiert auf dem Nachweis<br />
einer charakteristischen Kombination von klinischen, endoskopischen,<br />
radiologischen, laborchemischen und pathomorphologischen<br />
Befunden. Einen definierten Goldstandard für die Diagnose<br />
gibt es nicht. Auch die pathomorphologische Diagnostik<br />
beruht auf <strong>der</strong> synoptischen Beurteilung einer Kombination<br />
von Charakteristika, die schwerpunktmäßig die Art und Verteilung<br />
<strong>der</strong> Entzündungsinfiltrate sowie Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Mukosaarchitektur<br />
betreffen [98 –111]. Die histologischen Einzelbefunde<br />
sind hierbei für sich genommen nicht diagnostisch<br />
diskriminierend und kçnnen zum Teil auch bei an<strong>der</strong>en Formen<br />
entzündlicher Darmerkrankungen auftreten.<br />
Morphologische Kriterien, die im Rahmen <strong>der</strong> histopathologischen<br />
Beurteilung von Darmbiopsien zur Diagnose eines <strong>Morbus</strong><br />
<strong>Crohn</strong> herangezogen werden, sind:<br />
E diskontinuierliche Stçrung <strong>der</strong> Krypten-/Villusarchitektur,<br />
Kryptenatrophie,<br />
E diskontinuierliche, fokale/fleckfçrmige Entzündung mit einem<br />
vermehrten Infiltrat aus Lymphozyten und Plasmazellen,<br />
E Plasmozytose im basalen Schleimhautstroma,<br />
E epitheloidzellige Granulome,<br />
E Panethzell-Metaplasien distal <strong>der</strong> rechten Kolonflexur,<br />
E fokale Reduktion des Muzingehalts und/o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Anzahl von<br />
Becherzellen, Präservation von Muzin im Randbereich von<br />
Ulzerationen/Erosionen.<br />
Eine Stçrung <strong>der</strong> Krypten-/Villusarchitektur beinhaltet Irregularitäten<br />
in Form, Orientierung und Grçße <strong>der</strong> Krypten mit irregulären<br />
Verzweigungen (> 10 % <strong>der</strong> Krypten; mehr als 2 verzweigte,<br />
nicht parallel orientierte Krypten in einer Biopsie)<br />
[105, 107, 109, 111]. Unter Kryptenatrophie versteht man eine<br />
vermin<strong>der</strong>te Kryptendichte (Distanz von mehr als einem Kryptenquerschnitt<br />
zwischen zwei benachbarten Krypten) und/o<strong>der</strong><br />
eine Distanzbildung zwischen Kryptenbasis und <strong>der</strong> Lamina<br />
muscularis mucosae, zumeist verbunden mit einem basal vermehrten<br />
mononukleären, plasmazellreichen Infiltrat [103, 104,<br />
107, 109]. Fokale/fleckfçrmige chronische Entzündung beinhaltet<br />
einen herdfçrmig gesteigerten Gehalt an mononukleären<br />
Zellen <strong>der</strong> Lamina propria unter Einbeziehung <strong>der</strong> mittleren<br />
und basalen Schleimhautabschnitte [103, 107]. Eine basale<br />
Plasmozytose ist definiert durch den Nachweis von Plasmazellen<br />
in den basalen Bezirken (1/5) <strong>der</strong> Lamina propria o<strong>der</strong><br />
zwischen <strong>der</strong> Kryptenbasis und <strong>der</strong> Lamina muscularis mucosae<br />
(subkryptal) [104, 105].<br />
Epitheloidzellige Granulome bei <strong>Morbus</strong> <strong>Crohn</strong> sind fokale Ansammlungen<br />
(> 5 Zellen) epitheloidzellig transformierter Makrophagen/Histiozyten<br />
mit o<strong>der</strong> ohne Ausbildung mehrkerniger<br />
Riesenzellen und ohne Nekrosen [107, 112]. Der Nachweis gut<br />
ausgebildeter, basal orientierter und abseits von entzündlich alterierten<br />
Krypten gelegener mukosaler Granulome dieser Art<br />
besitzt bei entsprechen<strong>der</strong> Befundkonstellation einen hohen diagnostischen<br />
Stellenwert [99, 102, 103, 108 –110], ist jedoch<br />
von limitierter Sensitivität (ca. 20 – 50 %) [99, 103, 108–110,<br />
113]. Die bioptische Diagnose eines <strong>Morbus</strong> <strong>Crohn</strong> erfor<strong>der</strong>t daher<br />
nicht zwingend einen positiven Granulomnachweis. Kryptenassoziierte<br />
Granulome und Riesenzellen werden u. a. auch<br />
bei <strong>der</strong> Colitis ulcerosa gefunden und besitzen eine geringere<br />
Spezifität [112]. Bei Vorliegen von Granulomen sind infektiçse<br />
Darmerkrankungen differenzialdiagnostisch zu berücksichtigen<br />
(Mykobakteriose, Yersiniose, Chlamydieninfektion, Salmonellose<br />
u. a.).<br />
Die bioptische Diagnose eines <strong>Morbus</strong> <strong>Crohn</strong> in Abgrenzung<br />
zur Colitis ulcerosa und an<strong>der</strong>en entzündlichen Darmerkrankungen<br />
stützt sich im Wesentlichen auf einen topografisch<br />
variabel ausgeprägten, diskontinuierlichen Nachweis <strong>der</strong> genannten<br />
histopathologischen Verän<strong>der</strong>ungen im Darm. Daher<br />
sollten zumindest im Rahmen <strong>der</strong> Erstdiagnostik Stufenbiopsien<br />
aus dem Ileum und aus allen Kolonabschnitten unter Einbeziehung<br />
des Rektums gewonnen werden, wobei auch endoskopisch<br />
nicht entzündete bzw. weniger betroffene Areale<br />
einzuschließen sind (getrennte Einsendung von Biopsien unterschiedlicher<br />
Lokalisation mit entsprechenden Angaben).<br />
Die diagnostische Aussagekraft kann so im Vergleich zu singulären<br />
bzw. nicht systematischen Biopsien deutlich gesteigert<br />
werden [37, 99, 100, 114].<br />
Bei Patienten mit fulminanter Kolitis sollte die Biopsieentnahme<br />
den individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Eine Immersionsfixierung<br />
<strong>der</strong> Gewebeproben in neutral gepuffertem Formalin<br />
o<strong>der</strong> einer gleichwertigen Fixierungslçsung unmittelbar nach<br />
Probenentnahme ist erfor<strong>der</strong>lich. Die Detektion fokaler Befunde<br />
kann durch eine Aufarbeitung <strong>der</strong> bioptischen Proben in Stufeno<strong>der</strong><br />
Serienschnitten verbessert werden [115, 116].<br />
Unter den genannten Voraussetzungen kann die histopathologische<br />
Diagnose eines <strong>Morbus</strong> <strong>Crohn</strong> an Mukosabiopsien mit<br />
einer Sensitivität und Spezifität von etwa 60 – 70 % [99 – 101,<br />
106, 111], in einigen Studien von bis über 90 % gestellt werden<br />
[108 – 110], zumindest bei aktiver Erkrankung. Einige Autoren<br />
propagieren die Beurteilung <strong>der</strong> oben genannten Kriterien anhand<br />
von standardisierten Score-Schemata mit numerischen<br />
Koeffizienten [108 – 110]. Zur Etablierung <strong>der</strong> Diagnose ist <strong>der</strong><br />
Nachweis mehrerer <strong>der</strong> genannten histopathologischen Kriterien<br />
(zumindest 2 – 3), bei Anwesenheit epitheloidzelliger Granulome<br />
zumindest ein weiteres Kriterium (diskontinuierliche<br />
chronische Entzündung, Architekturstçrung <strong>der</strong> Schleimhaut)<br />
zu for<strong>der</strong>n. Topografische Aspekte (Ileumbeteiligung, Fehlen<br />
einer distalen Entzündungsakzentuierung im Kolon) und <strong>der</strong><br />
fehlende Nachweis einer kontinuierlich ausgebildeten, transmukosalen<br />
Entzündung mit diffuser Stçrung <strong>der</strong> Schleimhautarchitektur<br />
kçnnen zur Abgrenzung gegen eine Colitis ulcerosa<br />
herangezogen werden.<br />
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das morphologische Erscheinungsbild<br />
chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen<br />
biologischen Variationen unterliegt und zudem durch die Therapie<br />
modifiziert werden kann [117, 118]. So kann es im Verlauf<br />
einer Colitis ulcerosa durchaus zur diskontinuierlichen<br />
Ausprägung des Entzündungsbilds, auch mit Aussparung des<br />
Rektums, kommen [119]. Insbeson<strong>der</strong>e bei pädiatrischen CED-<br />
Patienten (< 10 Jahre) ist auch ohne vorangegangene Therapie<br />
mit abweichenden Mustern zu rechnen [120 – 122]. Informationen<br />
zur Anamnese, Erkrankungsdauer, Art und Dauer <strong>der</strong><br />
Therapie und zum Patientenalter sind daher für eine effiziente<br />
histopathologische Befundung erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e auch im Hinblick auf die differenzialdiagnostische<br />
Abgrenzung idiopathischer chronisch-entzündlicher<br />
Darmerkrankungen von an<strong>der</strong>weitigen, ätiologisch o<strong>der</strong><br />
phänotypisch definierten Entzündungsformen wie infektiçsen<br />
Enterocolitiden, Ischämiereaktionen, medikamentçs bedingten<br />
(z. B. NSAR, Zytostatika) o<strong>der</strong> therapieassoziierten Entzündungen<br />
(z.B. diversionsassoziierte Entzündung), divertikelkrankheitsassoziierte<br />
Kolitis, obstruktive/distensionsbedingte Entzündungen,<br />
Mukosaprolaps-Syndrom, lymphozytäre/kollagene<br />
Kolitis, allergische Reaktionen, eosinophile Enterocolitis u. a.<br />
[123 –125].<br />
Hoffmann JC et al. Diagnostik und Therapie… Z Gastroenterol 2008; 46: 1094–1146