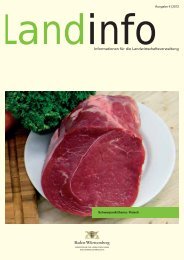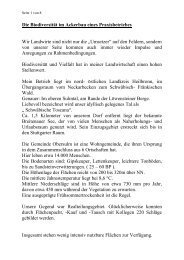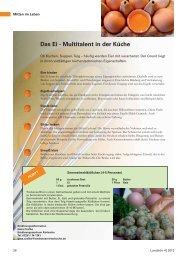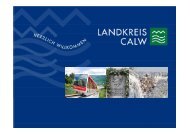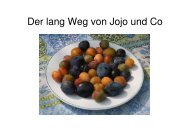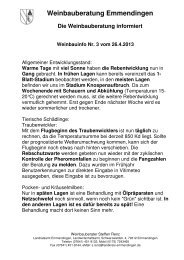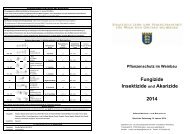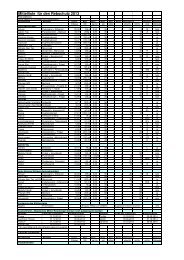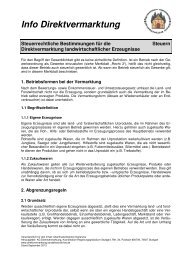Versuche zur Offenhaltung der Landschaft - Infodienst ...
Versuche zur Offenhaltung der Landschaft - Infodienst ...
Versuche zur Offenhaltung der Landschaft - Infodienst ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schwerpunktthema Ländlicher Raum/ <strong>Landschaft</strong> Landinfo 4/2007<br />
Prof. Dr. Karl-Friedrich Schreiber, ehemals Institut für <strong>Landschaft</strong>sökologie <strong>der</strong> Uni Münster<br />
<strong>Versuche</strong> <strong>zur</strong> <strong>Offenhaltung</strong> <strong>der</strong> <strong>Landschaft</strong><br />
1975 wurden im Auftrag und mit Unterstützung des Landwirtschaftsministeriums im Gefolge <strong>der</strong> ersten<br />
großen Brachewelle Ende <strong>der</strong> 60er/Anfang <strong>der</strong> 70er Jahre vom Taubergrund bis zum Albtrauf, von<br />
<strong>der</strong> Alb über die oberen Gäue bis zum Nordschwarzwald und bis in die Höhen des Südschwarzwaldes<br />
14 Versuchsflächen in Grünlandbrachen fast aller landwirtschaftlichen Problemgebiete eingerichtet.<br />
Sie sollten dazu dienen, verschiedene extensive Pflegemaßnahmen <strong>zur</strong> <strong>Offenhaltung</strong> <strong>der</strong> Kulturlandschaften<br />
Baden-Württembergs im standörtlich-räumlichen Vergleich über einen längeren Zeitraum zu<br />
testen und kostengünstige und zugleich ökologisch sinnvolle Pflegeempfehlungen nicht nur für<br />
Grenzstandorte abzuleiten.<br />
Als Pflegevarianten <strong>zur</strong> <strong>Offenhaltung</strong><br />
wurden verschiedene Mulchtermine<br />
- von Mulchen 2x jährlich<br />
bis Mulchen jedes 3. Jahr - eingeführt,<br />
ferner extensive Beweidung<br />
mit Ziegen, Schafen, Rin<strong>der</strong>n und<br />
Pferden, kontrolliertes Brennen<br />
jährlich und jedes 2. Jahr und Mähen<br />
mit Abräumen; darüber hinaus<br />
wurde in je<strong>der</strong> Versuchsanlage eine<br />
Parzelle mit <strong>der</strong> ungestörten<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Vegetation, die<br />
sog. Sukzession, eingerichtet als<br />
Beispiel für das, was entstehen<br />
kann, wenn man die Fläche sich<br />
selbst überlässt.<br />
Einige weitere Sukzessionsparzellen<br />
wurden in den größeren Versuchsflächen<br />
für einen gezielten<br />
Eingriff in die Gehölzentwicklung<br />
durch Auf-den-Stock-setzen vorgesehen,<br />
wenn Sträucher und/<br />
o<strong>der</strong> Bäume zu stärkeren Störungen<br />
des Aufwuchses <strong>der</strong> Grasnarbe<br />
führen sollten.<br />
Die Vielzahl <strong>der</strong> Versuchsflächen,<br />
<strong>der</strong> Fächer an Pflegemaßnahmen<br />
und insbeson<strong>der</strong>e die Länge <strong>der</strong><br />
Versuchsdurchführung und Untersuchung<br />
<strong>der</strong> Bestandsentwicklungen<br />
auf verschiedenen Standorten<br />
haben zu erstaunlichen, häufig<br />
erst in den letzten Jahren deutlich<br />
werdenden und vielfach gar nicht<br />
erwarteten Ergebnissen geführt,<br />
über die aus Zeitgründen nur aus<br />
dem vegetationskundlichen Bereich,<br />
nicht aber über Fauna und<br />
Boden berichtet wird.<br />
Gehölzentwicklung bei<br />
unterschiedlichem<br />
Management<br />
Abbildung 1:<br />
14<br />
Sukzession<br />
Grundsätzlich müssen wir davon<br />
ausgehen, dass in dem ehemaligen<br />
Waldland Mitteleuropa alle<br />
sich selbst überlassenen offenen<br />
Flächen sich auch heute – in welchen<br />
Zeiträumen auch immer – mit<br />
Ausnahme von Extremstandorten<br />
wie<strong>der</strong> zum Wald entwickeln.<br />
Noch in den 70er Jahren glaubte<br />
man, dass diese Entwicklung relativ<br />
rasch nach dem Brachfallen<br />
auch auf Grünlandbrachen einsetzen<br />
würde. Aber schon die Parzellen<br />
<strong>der</strong> „ungestörten Sukzession“<br />
zeigten von Anfang an sehr<br />
unterschiedliche Tendenzen. Einige<br />
waren, wie allgemein erwartet,<br />
schon bald, vielfach bereits ein<br />
Jahr nach Versuchsbeginn, mit<br />
den ersten Baum- o<strong>der</strong> Strauch-<br />
Heistern besetzt und haben sich<br />
konsequent in den Folgejahren bis<br />
zu einem ± dichten Waldbestand<br />
von inzwischen 15-20 m Höhe ge-
Landinfo 4/2007<br />
Schwerpunktthema Ländlicher Raum/ <strong>Landschaft</strong><br />
schlossen o<strong>der</strong>, wie an ehemaligen<br />
Rebhängen des Taubergrundes,<br />
bis zu 5 m hohe undurchdringliche<br />
Schlehengebüsche gebildet.<br />
Die Einwan<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Gehölzsamen<br />
(korrekt = Diasporen) erfolgte<br />
vornehmlich durch Wind o<strong>der</strong> Vögel,<br />
die Ausbreitung in <strong>der</strong> Fläche<br />
vielfach durch Wurzelausläufer,<br />
insbeson<strong>der</strong>e bei den Sträuchern,<br />
die, wie insbeson<strong>der</strong>e die Schlehe,<br />
mit dieser Strategie häufig auch<br />
von außen in die Parzellen eindrangen.<br />
In an<strong>der</strong>en Sukzessionsparzellen<br />
verlief dieser Prozess viel langsamer<br />
und häufig in Schüben, die<br />
von „Stillstandsphasen“ unterbrochen<br />
waren; während dieser Zeiten<br />
fand im wesentlichen nur ein<br />
Höhenwachstum <strong>der</strong> vorhandenen<br />
Gehölze, aber keine weitere Ansiedlung<br />
statt. Der Zusammenschluss<br />
zu Gehölzgruppen verlief<br />
sehr unregelmäßig und langsam.<br />
Auch heute nach 30 Jahren verfügen<br />
diese Parzellen noch über viel<br />
offenes Grünland. Schließlich gibt<br />
es aber auch Parzellenstücke, in<br />
denen seit 30 Jahren nicht einmal<br />
in Ansätzen eine Gehölzansiedlung<br />
stattgefunden hat. Das heißt,<br />
dass brachgefallenes Grünland<br />
keineswegs immer rasch von Gehölzen<br />
besiedelt wird, son<strong>der</strong>n<br />
Jahrzehnte als Offenland in seinem<br />
Zustand beharren kann. Nur:<br />
Eine solche Entwicklung ist nicht<br />
vorhersagbar! Selbst in <strong>der</strong> gleichen<br />
Versuchsanlage können sich<br />
zwei auf Steinwurf voneinan<strong>der</strong><br />
entfernte und eingezäunte Parzellen<br />
völlig unterschiedlich verhalten.<br />
Dabei scheint <strong>der</strong> Zufall eine<br />
nicht unerhebliche Rolle zu spielen.<br />
Es muss im übrigen unbedingt<br />
darauf hingewiesen werden, dass<br />
ein Keimen von Gehölzsamen<br />
mitnichten an offene Stellen o<strong>der</strong><br />
Maulwurfshaufen im Grünland gebunden<br />
ist, wie man damals<br />
fälschlicherweise prognostizierte.<br />
In unseren <strong>Versuche</strong>n haben die<br />
meisten Keimlinge in einer mehr<br />
o<strong>der</strong> weniger dichten Grasnarbe<br />
gestanden. Beson<strong>der</strong>s träge verlief<br />
die Gehölzansiedlung in den<br />
Hochlagen des Südschwarzwaldes;<br />
dort hat vielmehr die Blaubeere<br />
inzwischen den größten Teil<br />
<strong>der</strong> Sukzessionsparzelle als<br />
Zwergstrauchheide besetzt.<br />
Eine für den Forstmann wahrscheinlich<br />
nicht überraschende<br />
Entwicklung nahmen die Parzellen<br />
<strong>der</strong> „gelenkten Sukzession“, in<br />
denen die Gehölze auf den Stock<br />
gesetzt werden mussten, weil sie<br />
den Grünlandbestand zu stark zu<br />
beeinflussen begannen. Solange<br />
wir in den ersten Jahren dieses<br />
Eingriffs noch Tormona in einem<br />
Dieselgemisch auf den Stock<br />
streichen konnten, gab es kein<br />
Problem, die Gehölze starben ab.<br />
Als wir Mitte <strong>der</strong> 80er Jahre diese<br />
Maßnahme einstellten, begannen<br />
sich vor allem bei den Pionierholzarten<br />
wie Esche und Berg-<br />
/Spitzahorn nach dem Absägen<br />
zahlreiche kräftige Stockausschläge<br />
zu bilden, die bereits im ersten<br />
Jahr bis zu 2 m in die Höhe schossen.<br />
Nach wenigen Jahren bildeten sie<br />
3-5 m hohe, häufig von einem<br />
Brombeerverhau durchzogene,<br />
schnell immer dichter werdende,<br />
undurchdringliche und flächendeckende<br />
nie<strong>der</strong>waldartige Gebüsche,<br />
die schließlich jedes 2., spätestens<br />
jedes 3. Jahr wie<strong>der</strong> auf<br />
den Stock gesetzt werden mussten.<br />
Diese immer kostenintensiver<br />
werdende Maßnahme (bis zu über<br />
600 Mann-Arbeitsstunden/ ha!)<br />
stellten wir schließlich in den betroffenen<br />
Parzellen um 2002 ein.<br />
Es wurde im Winterhalbjahr<br />
nochmals aller Gehölzaufwuchs<br />
bodengleich abgesägt und <strong>der</strong> jeweils<br />
noch grüne, unverholzte<br />
Neuwuchs von 60-80 cm Höhe 2x<br />
jährlich problemlos gemulcht. Inzwischen<br />
hat sich auf diesen Flächen<br />
die zumindest in Spuren<br />
noch vorhandene Grünlandvegetation<br />
wie<strong>der</strong> zu einer sich schließenden<br />
Grasnarbe entwickelt. Es<br />
sieht so aus, als würden wir mit<br />
dieser allerdings längerfristigen<br />
Maßnahme eine Rodung <strong>der</strong> Flächen<br />
umgehen können, denn Intensität<br />
und Höhe des Stockausschlags<br />
gehen deutlich <strong>zur</strong>ück,<br />
zahlreiche Stöcke sind inzwischen<br />
schon abgestorben.<br />
Mulchen<br />
Einen durchschlagenden Erfolg in<br />
<strong>der</strong> Gehölzbekämpfung zeigt das<br />
„Mulchen 2x und 1x jährlich“.<br />
Aber schon das größere Intervall<br />
„Mulchen jedes 2. Jahr“, erst<br />
recht „Mulchen jedes 3. Jahr“ erlaubt<br />
z. B. <strong>der</strong> Esche durch die<br />
ungestörte Stoffbildung in einer<br />
o<strong>der</strong> zwei Vegetationsperioden in<br />
Einzelexemplaren ein Überleben,<br />
wenn auch nur als Heister, die<br />
durch Stockausschlag allmählich<br />
breiter werden. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
Sträucher wie die Schlehe verdichten<br />
sich durch erfolgreiche Wurzelbrutbildung<br />
langsam auf <strong>der</strong><br />
Fläche, wenn sie auch nie die<br />
Größe unbehin<strong>der</strong>ter Schlehengebüsche<br />
erreichen. Erfolgreich kann<br />
eine Fläche nur durch einen jährlichen<br />
Mulchschnitt offen gehalten<br />
werden. Das betrifft vor allem gehölzwüchsige<br />
Gebiete wie den<br />
Taubergrund.<br />
Kontrolliertes Brennen<br />
Auch das „kontrollierte Brennen<br />
jährlich“ hält in <strong>der</strong> Regel eine<br />
Fläche frei von Gehölzen, insbeson<strong>der</strong>e<br />
von Bäumen, aber weitgehend<br />
auch von Sträuchern und<br />
Zwergsträuchern. Nur an den gehölzwüchsigen<br />
Hängen des Taubergebietes<br />
ist die Schlehe im<br />
Laufe <strong>der</strong> Zeit auch in die jährlich<br />
gebrannte Parzelle eingedrungen,<br />
schlägt immer wie<strong>der</strong> aus dem<br />
Stock o<strong>der</strong> dem nur teilweise verbrannten<br />
Stämmchen aus und bildet<br />
Wurzelbrut. Es sind aber bis<br />
jetzt immer nur einzeln stehende<br />
Heister, die kaum höher als 60cm<br />
werden und in dem meist höheren<br />
Grünlandbestand kaum auffallen.<br />
Ähnliches ist auch an den Muschelkalkhängen<br />
<strong>der</strong> Täler <strong>der</strong><br />
Hohenloher Ebene und ihrem Umfeld<br />
zu erwarten. Das „kontrollierte<br />
Brennen jedes 2. Jahr“ hat jedoch<br />
we<strong>der</strong> Schlehen, noch Heckenrosen<br />
o<strong>der</strong> Brombeeren daran<br />
gehin<strong>der</strong>t, bis zu 2 m hohe Gebüsche<br />
auf <strong>der</strong> Brandparzelle auszubilden.<br />
Auch beim kontrollierten<br />
Brennen ist nur <strong>der</strong> jährliche Einsatz<br />
des Feuers hinsichtlich des<br />
Offenhaltens ± Erfolg versprechend<br />
gewesen. In den Hochlagen<br />
des Südschwarzwaldes haben<br />
15
Schwerpunktthema Ländlicher Raum/ <strong>Landschaft</strong> Landinfo 4/2007<br />
sich zwar keine Bäume und Sträucher,<br />
aber Zwergsträucher (Blaubeeren)<br />
ausgebreitet.<br />
Extensive Beweidung<br />
durch verschiedene<br />
Tierarten<br />
We<strong>der</strong> Schafe, noch Rin<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />
Pferde sind in <strong>der</strong> Lage, Grünland<br />
auf Dauer gehölzfrei zu halten.<br />
Vielmehr sind im Laufe <strong>der</strong> Zeit<br />
Strukturen auf den Weiden entstanden,<br />
wie wir sie von den früheren<br />
Triftweiden her kennen: Hier<br />
und dort eine Baumgruppe o<strong>der</strong><br />
ein Baum, umgeben o<strong>der</strong> durchwachsen<br />
von meist durch Vögel<br />
verbreiteten Sträuchern, oft in wenigen<br />
Jahren von Brombeeren<br />
durchwuchert, die die Weidefläche<br />
immer weiter einengen. Nicht nur<br />
im Südschwarzwald mussten diese<br />
Weideflächen schon mehrmals<br />
„geschwendet“, d.h. wie früher<br />
auch, die vorhandenen Gehölze<br />
mit Säge, Sense und/o<strong>der</strong> Feuer<br />
beseitigt werden. Allein die Ziegen<br />
- auch Burenziegen - sind in <strong>der</strong><br />
Lage gewesen, auch schon bestehenden<br />
Gehölzbestand meist in<br />
Kürze zu vernichten. Ziegen brauchen<br />
neben Gras und Kraut diese<br />
Art von Nahrung, deshalb gehen<br />
sie immer wie<strong>der</strong> an Gehölze und<br />
fressen nicht nur Blätter und Stängel,<br />
son<strong>der</strong>n ringeln auch die Rinde<br />
bis zum Absterben von Baum<br />
und Strauch.<br />
Umwandlung <strong>der</strong> Grünlandgesellschaften<br />
in Saumgesellschaften<br />
erwarten musste. Aber nach kurzer<br />
Zeit wechselte die Entwicklungsrichtung<br />
wie<strong>der</strong> zu den Grünlandgesellschaften,<br />
insbeson<strong>der</strong>e<br />
nährstoffanspruchsvollere Arten,<br />
wie <strong>der</strong> Glatthafer, aber auch<br />
Kräuter, bestimmten standortsbezogen<br />
bald wie<strong>der</strong> das Bild. Eine<br />
gewisse Eutrophierung <strong>der</strong> Bestände<br />
ist durchaus deutlich.<br />
Statt <strong>der</strong> nicht nur in Ansätzen<br />
vorhandenen Johanneskrautflur ist<br />
z. B. bei Melchingen auf <strong>der</strong> Alb<br />
eine über zwei Jahrzehnte recht<br />
stabile, wie<strong>der</strong> sehr stark durch<br />
den Glatthafer dominierte Berg-<br />
Fettwiese geworden, in <strong>der</strong> sich<br />
stellenweise Brennnessel und<br />
Giersch breit gemacht haben. Auf<br />
den Halbtrockenrasen fand teilweise<br />
ein sich wie<strong>der</strong>holen<strong>der</strong><br />
Wechsel in <strong>der</strong> Dominanz zwischen<br />
<strong>der</strong> Aufrechten Trespe und<br />
<strong>der</strong> Fie<strong>der</strong>zwenke statt. Überhaupt<br />
ist eine starke Dynamik in Raum<br />
und Zeit, ein jährlicher Artenwechsel<br />
<strong>der</strong> Dominanzmuster in den<br />
meisten Sukzessionsparzellen die<br />
Regel gewesen. Fast alle Bestände<br />
gehören heute noch zu den<br />
Grünlandgesellschaften i.w.S., ein<br />
grundsätzlicher Wandel hat nicht<br />
stattgefunden, auch wenn die Bestände<br />
artenärmer geworden und<br />
bestimmte Arten, unter ihnen beson<strong>der</strong>s<br />
die Rosettenpflanzen, fast<br />
völlig verschwunden sind! Ähnlich<br />
verhält es sich naturgemäß in den<br />
Offenlandbereichen <strong>der</strong> Parzellen<br />
<strong>der</strong> gelenkten Sukzession, sofern<br />
noch kein Eingriff in den Gehölzbestand<br />
erfolgt ist. Lediglich im<br />
Hochschwarzwald wurden die Flügelginsterweiden<br />
bei ungestörter<br />
Sukzession weitgehend durch<br />
Zwergstrauchheiden ersetzt.<br />
Mulchen in verschiedenen<br />
Intervallen<br />
Die ursprüngliche Sorge, auch das<br />
kleingehäckselte Mulchgut würde<br />
durch das Liegenbleiben die<br />
Grasnarbe verän<strong>der</strong>n, hat sich in<br />
Südwestdeutschland nicht bewahrheitet!<br />
3-4 Wochen nach dem<br />
ersten Schnitt Ende Juni ist auch<br />
eine Mulchmasse von über 60<br />
dt/ha Trockensubstanz weitgehend<br />
durch Regenwürmer und<br />
mikrobielle Aktivität verschwunden.<br />
Die Ursache liegt an <strong>der</strong> kontinentalen<br />
Klimatönung des Gebietes<br />
mit häufigen Durchgängen <strong>der</strong><br />
Bodenfeuchtigkeit durch den Optimalbereich,<br />
auf den die Mikroorganismen<br />
jeweils mit explosionsartiger<br />
Vermehrung und Aktivität reagieren,<br />
ein Ursachenkomplex,<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Gras- und<br />
Krautschicht als Reaktion<br />
auf das Management<br />
Ungestörte Sukzession<br />
Schon bald nach Versuchsbeginn<br />
verän<strong>der</strong>te sich - ohne jeglichen<br />
Einfluss durch Gehölze - die Zusammensetzung<br />
<strong>der</strong> Grasnarbe in<br />
den Sukzessionsparzellen. Auf<br />
den Halbtrockenrasen und trockenen<br />
Glatthaferwiesen nahm, sofern<br />
im Bestand, meist die Fie<strong>der</strong>zwenke<br />
deutlich zu o<strong>der</strong> wan<strong>der</strong>te<br />
ein. Auch an<strong>der</strong>e so genannte<br />
Saumarten - zu denen die Fie<strong>der</strong>zwenke<br />
im weiteren Sinne<br />
auch gehört - vermehrten sich anfänglich<br />
so stark, dass man eine<br />
16<br />
Bild 1:<br />
Ungestörte Sukzession am Standort Oberndorf
Landinfo 4/2007<br />
Schwerpunktthema Ländlicher Raum/ <strong>Landschaft</strong><br />
<strong>der</strong> z. B. auch hinsichtlich des<br />
Wasserhaushaltes zu dem breiten<br />
Fächer an Glatthaferwiesengesellschaften<br />
von <strong>der</strong> trockenen Salbei-<br />
Glatthaferwiese bis <strong>zur</strong> feuchten<br />
Seggen-Glatthaferwiese geführt<br />
hat, während im atlantischen<br />
Nordwesten Deutschlands nur ein<br />
schmaler Ausschnitt davon im<br />
mittleren Bereich vorkommt. Auch<br />
die Mulchschicht bleibt dort trotz<br />
<strong>der</strong> Häckselung beim Mulchen viel<br />
länger auf <strong>der</strong> Grasnarbe liegen,<br />
erst recht natürlich langhalmiges<br />
Material. Ein eindeutiges Zeichen<br />
für den raschen Abbau des<br />
Mulchgutes in Südwestdeutschland<br />
ist neben <strong>der</strong> immer wie<strong>der</strong><br />
bestätigten Beobachtung die deutliche<br />
Zunahme von lichtbedürftigen<br />
Rosettenpflanzen, die unter<br />
einer länger liegen bleibenden<br />
Schicht in <strong>der</strong> Regel absterben.<br />
Diese Zunahme hat bereits in den<br />
ersten Jahren begonnen und sich<br />
stetig fortgesetzt. Auch die meist<br />
lichtbedürftigen Armutszeiger haben<br />
sich in den an Obergräsern<br />
ärmer gewordenen, offeneren Beständen<br />
stark vermehrt, es ist zu<br />
keiner Eutrophierung, son<strong>der</strong>n e-<br />
her zu einer Ausmagerung gekommen!<br />
Die Erträge lassen<br />
trotz starker periodischer<br />
Schwankungen keinen Düngungseffekt<br />
des Mulchens erkennen.<br />
Ein Nährstoffaustrag findet<br />
nicht statt. Das gilt für alle<br />
Mulchvarianten. Mulchen ist also<br />
eine sehr erfolgreiche und<br />
zugleich kostenlose Maßnahme<br />
für das Recycling <strong>der</strong> jährlich<br />
aufwachsenden organischen<br />
Substanz an Ort und Stelle, die<br />
man, wenn sie nicht mehr weiter<br />
verwendet werden kann, auf diesem<br />
Weg ökologisch risikolos entsorgt.<br />
Auch die Behauptung, Mulchen<br />
würde zu einer Abnahme des<br />
Kräuteranteils <strong>der</strong> Grasnarbe und<br />
einer einseitigen För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Gräser führen, kann vielfach wi<strong>der</strong>legt<br />
werden, insbeson<strong>der</strong>e für<br />
das „Mulchen 2x jährlich“ mit<br />
dem ersten Schnitt frühestens Ende<br />
Juni. In den meisten Parzellen<br />
ist das Gegenteil eingetreten.<br />
Zwar kann es in den ersten Jahren<br />
durchaus zu einer Kräuterabnahme<br />
kommen, aber ein Urteil über<br />
diese Zeit ist zu kurz gegriffen!<br />
Erst in den letzten 3-4 Jahren ist<br />
bis auf das ehemalige Weinbergsgrünland<br />
im Taubergrund <strong>der</strong><br />
Kräuteranteil in allen an<strong>der</strong>en 2x<br />
gemulchten Parzellen z.T. extrem<br />
stark angestiegen. Es haben sich<br />
fast überall bunte, arten- und<br />
kräuterreiche Wiesen entwickelt!<br />
Allerdings konnte <strong>der</strong> nur<br />
noch ansatzweise vorhandene<br />
Weide-Halbtrockenrasen auf <strong>der</strong><br />
Schwäbischen Alb, dessen Abgrenzung<br />
zu den Mäh-<br />
Halbtrockrasen ohnehin schwierig<br />
war, durch das Mulchen nicht erhalten<br />
werden, son<strong>der</strong>n ist zu einer<br />
ihm nahe stehenden artenreichen<br />
Trespenwiese geworden. Die<br />
Flügelginsterweiden des Südschwarzwaldes<br />
sind jedoch durch<br />
das Mulchen nicht nur in ihrem<br />
Ausgangszustand erhalten worden,<br />
son<strong>der</strong>n haben sich durch<br />
Zunahme <strong>der</strong> bestimmenden Arten<br />
verbessert; selbst die Arnika hat<br />
sich inzwischen deutlich herdenförmig<br />
ausgebreitet. Die Gefahr<br />
einer Verstrauchung durch Blaubeeren<br />
ist mit dem zweimaligen<br />
Mulchschnitt sehr nachhaltig und<br />
vollständig gebannt worden.<br />
Etwas weniger auffällig ist diese<br />
Entwicklung beim „Mulchen 1x<br />
jährlich“. Den geringsten Zuwachs<br />
an blütenreichen Kräutern<br />
zeigen bisher die Parzellen „Mulchen<br />
jedes 2. Jahr“ und „Mulchen<br />
jedes 3. Jahr“, die im Blütenflor<br />
gegenüber den jährlich gemulchten<br />
Flächen deutlich abfallen.<br />
Aber insgesamt ist auch bei<br />
diesen Intervallen in den meisten<br />
Fällen keine weitere Vergrasung<br />
gegenüber dem Ausgangszustand<br />
eingetreten! Vor allem beim Mulchen<br />
jedes 3. Jahr findet eher zwischen<br />
den Schnitten eine Sukzessionsentwicklung<br />
statt - von <strong>der</strong><br />
auch die eingedrungenen Gehölze<br />
profitieren, wie wir sahen - , aber<br />
nach erfolgtem Schnitt breiten sich<br />
spontan die immer noch vorhandenen<br />
typischen Grünlandpflanzen<br />
wie<strong>der</strong> aus. In den Hochlagen des<br />
Südschwarzwaldes ist bei einer<br />
sehr trägen Entwicklung <strong>der</strong> Unterschied<br />
zwischen den verschiedenen<br />
Mulchintervallen allerdings<br />
nur sehr gering. Die Flügelginsterweiden<br />
haben auch beim Mulchen<br />
jedes 2. und 3. Jahr eine<br />
deutliche Zunahme des Flügelginsters<br />
selbst zu verzeichnen,<br />
Arnika breitet sich ebenfalls aus.<br />
Der Unterschied <strong>zur</strong> Sukzession,<br />
inzwischen weitgehend zu einer<br />
Blaubeer-Zwergstrauchheide geworden,<br />
zeigt deutlich, dass das<br />
Mulchen die befürchtete Ausbreitung<br />
<strong>der</strong> Blaubeeren auch durch<br />
die beiden größeren Mulchintervalle<br />
weitgehend verhin<strong>der</strong>n und den<br />
Verbiss durch Rin<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Schafe<br />
auf den Flügelginsterweiden weitgehend<br />
ersetzen kann.<br />
Mähen mit Abräumen<br />
Es besteht kein Zweifel, dass diese<br />
das alte, bis zu den 50er Jahren<br />
des letzten Jahrhun<strong>der</strong>ts praktizierte<br />
Mahdsystem mit Schnittzeitpunkten<br />
um Mitte bis Ende Juni<br />
imitierende Maßnahme im Sinne<br />
des Natur- und <strong>Landschaft</strong>sschutzes<br />
die beste - weil traditionelle -<br />
Wiesenpflege darstellt. Die Bestände<br />
werden nach den Ertragsermittlungen<br />
am schnellsten ausgehagert,<br />
sofern dies möglich ist.<br />
Sie werden obergrasärmer, niedrigwüchsiger<br />
und lichter, wie die<br />
Mulchparzellen. Großenteils haben<br />
sich blütenreiche Bestände<br />
entwickelt, aber auch hier gibt es<br />
grasbetonte „Ausnahmen“. Das<br />
Hauptproblem stellt die aufwändige<br />
Beseitigung des gemähten und<br />
aus <strong>der</strong> Parzelle gebrachten Aufwuchses<br />
dar.<br />
Kontrolliertes Brennen<br />
Der Einfluss des kontrollierten<br />
Brennens (möglichst kaltes Mitwindfeuer<br />
bei tiefen Temperaturen,<br />
hoher relativer Luftfeuchtigkeit<br />
und Feuchte <strong>der</strong> unteren Streulagen,<br />
um außerhalb <strong>der</strong> Vegetationsperiode<br />
ca. 2/3 <strong>der</strong> Streu abzubrennen,<br />
ohne die Grasnarbe<br />
stark zu schädigen) auf die Vegetationsentwicklung<br />
ist mit vielen<br />
Überraschungen verbunden gewesen.<br />
Zunächst hat sich beim<br />
„kontrollierten Brennen jährlich“<br />
meist schnell eine sog. „Pyrophytenflur“<br />
entwickelt mit Arten, die<br />
sich hauptsächlich durch unterirdische<br />
Wurzelausläufer, die <strong>zur</strong><br />
Sprossbildung befähigt sind, ausbreiten<br />
und durch das Feuer kaum<br />
in ihrer Vitalität beeinträchtigt werden.<br />
Dazu zählt auf trockeneren<br />
17
Schwerpunktthema Ländlicher Raum/ <strong>Landschaft</strong> Landinfo 4/2007<br />
Standorten die Fie<strong>der</strong>zwenke, auf<br />
feuchten Standorten das Rohrglanzgras.<br />
Beide Arten neigten auf<br />
den Brandparzellen zu starker Blüten-<br />
und Fruchtbildung, die man<br />
normalerweise sonst nicht beobachten<br />
kann. Anfänglich schien<br />
die Fie<strong>der</strong>zwenke eine beinahe alles<br />
überdeckende Dominanz zu<br />
erreichen. Später setzten sich<br />
auch an<strong>der</strong>e Gräser, wie <strong>der</strong><br />
Rotschwingel und selbst die Aufrechte<br />
Trespe, wie<strong>der</strong> gegenüber<br />
<strong>der</strong> Fie<strong>der</strong>zwenke durch.<br />
Auch verschiedene Kräuter, z. B.<br />
Wiesensalbei, Knolliger und<br />
Scharfer Hahnenfuss, Wiesen-<br />
Flockenblume, Arznei-Schlüsselblume,<br />
Margerite, ja sogar <strong>der</strong><br />
Zwergstrauch Färberginster, aber<br />
auch Teufelsabbiß und Arznei-<br />
Baldrian, dehnten sich immer<br />
mehr aus. Offenbar haben diese<br />
Arten eine Art Gewöhnungsprozess<br />
durchlaufen, denn sie wurden<br />
immer zahlreicher. In den letzten<br />
Jahren sind daraus vielfach, wie<br />
beim Mulchen 2x jährlich, bunte<br />
Blumenwiesen geworden. Auffällig<br />
sind aber in etlichen Parzellen<br />
die starken Schwankungen in <strong>der</strong><br />
Deckung <strong>der</strong> krautigen Leguminosen.<br />
Ursprünglich haben sich die gebrannten<br />
Bestände wegen des erhöhten<br />
Wärmegenusses im Frühjahr<br />
durch Einstrahlung auf die<br />
dunkle Oberfläche früher entwickelt,<br />
in den Anfangsjahren machte<br />
dies fast einen Monat Vorsprung<br />
aus. Inzwischen sind diese<br />
Wiesen trotz <strong>der</strong> geschwärzten<br />
Oberflächen nicht mehr früher,<br />
son<strong>der</strong>n sogar 14 Tage bis 3 Wochen<br />
später in <strong>der</strong> Blüte als die<br />
Mulchparzellen, was den oben genannten<br />
„Gewöhnungsprozess“ offenbar<br />
unterstreicht. Sie bleiben<br />
auch niedriger und noch offener,<br />
die geschätzten Erträge geringer<br />
als auf den Mulchparzellen, eine<br />
Eutrophierung durch die in <strong>der</strong><br />
Asche verbleibenden Nährstoffe<br />
findet nicht statt!. Auch auf den<br />
Feucht- und Nasswiesen- Parzellen<br />
scheint sich <strong>der</strong> dominierende<br />
Rohrglanzgrasbestand in den beiden<br />
letzten Jahren zu lockern und<br />
umzuwandeln. Die Sumpfdotterblume<br />
ist dort bis heute im Frühjahr<br />
aspektbildend vertreten.<br />
Bild 2:<br />
Bracheversuch Oberstetten, Parzelle 1x jährlich Flämmen:<br />
Der auf dem Bild sichtbare Teil <strong>der</strong> Parzelle wurde lange<br />
Zeit nur alle 2 Jahre gebrannt, was aber nicht ausgereicht<br />
hat, um die deutlich sichtbare Schlehe von <strong>der</strong> Fläche fernzuhalten,<br />
so dass diese seit einigen Jahren auch jährlich<br />
gebrannt wird<br />
Beim „kontrollierten Brennen jedes<br />
2. Jahr“ haben sich die Bestände<br />
von Anfang an weniger verän<strong>der</strong>t,<br />
aber auch hier ist es <strong>zur</strong> Etablierung<br />
von Kräutern gekommen. Im<br />
Versuch Oberstetten im Taubergrund<br />
ist die jedes 2. Jahr gebrannte<br />
Fläche die blumenreichste<br />
Parzelle, umrahmt von den dort<br />
gräserbetonten Mulchparzellen.<br />
Der Einfluss extensiver Beweidung<br />
auf die Zusammensetzung<br />
<strong>der</strong> Grasnarbe<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Auswirkung<br />
extensiver Beweidung durch Ziegen,<br />
Schafe, Rin<strong>der</strong> und Pferde<br />
auf die Grasnarbe und ihre Zusammensetzung<br />
halten sich am<br />
meisten im Rahmen des Bekannten.<br />
In den höheren Lagen des Südschwarzwaldes<br />
sind die durch einen<br />
solchen Weidegang entstandenen<br />
Flügelginsterweiden erhalten<br />
geblieben. In den tieferen Lagen<br />
folgten die Rotstraußgrasweiden,<br />
teilweise bei <strong>der</strong> Ziegenbeweidung<br />
mit starker Anreicherung<br />
des Klappertopfes. Lediglich auf<br />
<strong>der</strong> Alb sind die ursprünglich enzianreichen<br />
Weide-Halbtrockenrasen<br />
in St. Johann verarmt, eine<br />
Erneuerung aus <strong>der</strong> Samenbank<br />
im Boden konnte nicht erfolgen,<br />
weil keine entsprechenden Samen<br />
mehr vorhanden waren.<br />
Der fehlende Weidegang <strong>der</strong><br />
betreffenden Schafherde über<br />
noch artenreiche Kalk-<br />
Halbtrockenrasen (z. B. in Naturschutzgebieten)<br />
verhin<strong>der</strong>t zugleich<br />
eine Wie<strong>der</strong>einbringung erwünschter<br />
Arten durch die Schafe<br />
selbst. Auch für die an<strong>der</strong>en von<br />
Schafen beweideten Flächen gilt,<br />
etwas abgemil<strong>der</strong>t, Ähnliches. Erst<br />
recht funktionieren jedoch die alten<br />
Ausbreitungsmechanismen, z.<br />
B. über Verfütterung entsprechenden<br />
Heus und durch Stallmist, auf<br />
den Rin<strong>der</strong>- und Pferdeweiden<br />
nicht mehr, so dass diese Beweidung<br />
nur zu einer Erhaltung des<br />
Ausgangszustandes von 1975<br />
führt.<br />
18
Landinfo 4/2007<br />
Schwerpunktthema Ländlicher Raum/ <strong>Landschaft</strong><br />
Schlussfolgerungen<br />
Erfolgreiches Offenhalten <strong>der</strong><br />
brachfallenden Kulturlandschaften<br />
ist mit nur mit wenigen extensiven,<br />
einigermaßen kostenerträglichen<br />
Maßnahmen möglich, wenn eine<br />
normale landwirtschaftliche Verwendung<br />
durch Ackerbau o<strong>der</strong><br />
Grünlandnutzung und -pflege nicht<br />
mehr lohnt o<strong>der</strong> nicht durchgeführt<br />
werden kann. Aber im Gegensatz<br />
zu den meisten Ackerbrachen<br />
muss ein jahrelanges Brachestadium<br />
von Grünland keineswegs<br />
zwangsläufig bald zu einer Bewaldung<br />
o<strong>der</strong> Verstrauchung führen.<br />
Nur ist eine solche Entwicklung<br />
kaum vorhersagbar. Die Grasnarbe<br />
bzw. Krautschicht von Grünlandbrachen<br />
behält über Jahrzehnte<br />
einen großen Teil ihres<br />
früheren Artenspektrums. Eine<br />
Rückführung in nutzbares Grünland<br />
scheint nach Auf-den-Stocksetzen<br />
durch anschließendes Mulchen<br />
2x jährlich ohne Rodung<br />
möglich zu sein.<br />
Das Mulchen 2x bis 1x jährlich hat<br />
sich für den gesamten süddeutschen<br />
Raum als eine die Bestände<br />
eher aushagernde, sehr erfolgreiche<br />
Maßnahme <strong>zur</strong> Erhaltung und<br />
Verbesserung hinsichtlich des Artenspektrums<br />
früherer Extensiv-<br />
Wiesen und <strong>der</strong> Verhin<strong>der</strong>ung des<br />
Gehölzwuchses herausgestellt. Es<br />
ist mit Abstand weniger aufwändig<br />
als das Mähen mit Abräumen und<br />
ohne Recycling-Probleme. Der Erfolg<br />
zeigt sich allerdings meist<br />
nicht nach wenigen Jahren. Erst in<br />
den letzten 3-4 Jahren <strong>der</strong> inzwischen<br />
30-jährigen <strong>Versuche</strong> ist <strong>der</strong><br />
„endgültige“ (?) Durchbruch zu<br />
Wiesengesellschaften erfolgt, die<br />
früheren Zuständen in <strong>der</strong> ersten<br />
Hälfte des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts ähneln,<br />
<strong>der</strong>en Artenspektrum aber<br />
ohne Wie<strong>der</strong>ansiedlungsmaßnahmen<br />
kaum, zumindest vorerst<br />
nicht erreichen!<br />
Das übersteigt zwar den üblichen<br />
Planungshorizont von 25 Jahren,<br />
zeigt aber auch nachdrücklich und<br />
überdeutlich, wie wichtig diese<br />
Langfristversuche sind – in Mitteleuropa<br />
als einziges Beispiel mit ihrer<br />
den Vergleich erlaubenden<br />
Vielzahl sowie <strong>der</strong> standörtlichen<br />
und vegetationskundlichen Vielfalt<br />
in Baden-Württemberg. Ein frühes<br />
Abbrechen <strong>der</strong> <strong>Versuche</strong> hätte -<br />
wie zahlreiche Beispiele aus <strong>der</strong><br />
Bundesrepublik zeigen - bei allen<br />
Maßnahmen, insbeson<strong>der</strong>e beim<br />
Mulchen wie beim kontrollierten<br />
Brennen, zu einer völlig falschen<br />
landschaftspflegerischen Beurteilung<br />
geführt, die lange genug, verbunden<br />
mit Vorurteilen, das Meinungsbild<br />
im Naturschutz beherrschte.<br />
Dazu gehört das wissenschaftlich<br />
unzulässige Vorgehen, aus den<br />
Ergebnissen nur eines <strong>Versuche</strong>s<br />
gleich allgemeingültige Regeln ableiten<br />
und vertreten zu wollen. Unsere<br />
<strong>Versuche</strong> zeigen deutlich,<br />
dass selbst bei gleichen Standortsbedingen<br />
zwei auf <strong>der</strong>selben<br />
Fläche gelegene Bezugsparzellen<br />
o<strong>der</strong> Dauerquadrate einan<strong>der</strong> wi<strong>der</strong>sprechende<br />
Ergebnisse liefern<br />
können. Erst recht schlagen dabei<br />
u. U. regionale Differenzierungen<br />
zu Buche, wie z. B. beim Klima<br />
zwischen Nordwest- und Süddeutschland,<br />
das ganz unterschiedliche<br />
Bedingungen für die<br />
Geschwindigkeit <strong>der</strong> Zersetzung<br />
des Mulchgutes schafft. Und diese<br />
hat einen nachhaltigen Einfluss<br />
auf das Artenspektrum.<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Offenhaltung</strong>sversuche und Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH)<br />
Die <strong>Offenhaltung</strong>sversuche können z. T auch genutzt werden um Fragestellungen die sich aus <strong>der</strong> EU-Flora-<br />
Fauna-Habitat-Richtlinie, <strong>der</strong> Gebietsausweisung und <strong>der</strong> Erstellung von Pflege- und Entwicklungs- bzw. Management-Plänen,<br />
dem Verschlechterungsverbot, <strong>der</strong> Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes etc.<br />
ergeben zu beantworten.<br />
Die Universität Regensburg, Institut für Botanik, hat im Jahr 2006 eine Untersuchung <strong>der</strong> Vegetationsentwicklung<br />
<strong>der</strong> <strong>Offenhaltung</strong>sversuche unter Berücksichtigung <strong>der</strong> FFH-Arten und charakteristischen Arten <strong>der</strong> FFH-<br />
Lebensraumtypen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in einem Skript nachzulesen.<br />
In Baden-Württemberg kommen 53 <strong>der</strong> FFH-Lebensraumtypen (LRTs) vor, davon sind 13 - darunter die Artenreichen<br />
Borstgrasrasen - als prioritär eingestuft. Die FFH-Richtlinie sieht für die „gemeinten Flächen“ ein<br />
Verschlechterungsverbot vor bzw. verpflichtet das Bundesland <strong>zur</strong> Sicherung eines „günstigen Erhaltungszustandes“<br />
nach Fläche und Qualität <strong>der</strong> ausgewiesenen LRTs, was durchaus auch eine gewisse räumliche Dynamik<br />
beinhalten kann. Eine Wie<strong>der</strong>herstellungspflicht entsteht für das Bundesland, wenn sich eine FFH-Art<br />
o<strong>der</strong> ein FFH-LRT in einem FFH-Gebiet insgesamt in einem schlechten Erhaltungszustand befinden. Mittel<br />
<strong>zur</strong> Umsetzung unter Einbindung <strong>der</strong> FlächenbewirtschafterInnen bieten in Baden-Württemberg die För<strong>der</strong>instrumente<br />
MEKA (Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich) und LPR (<strong>Landschaft</strong>spflegerichtlinie).<br />
Darüber hinaus können weitere (freiwillige) Entwicklungsmaßnahmen z. B. mit Hilfe von LIFE-, LEADER-, IN-<br />
TERREG-Programmen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> naturschutzgesetzlichen Eingriffsregelung finanziert werden.<br />
19