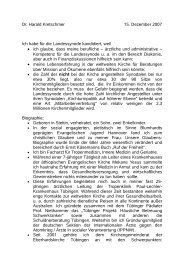Heft 2/2005 - Offene Kirche Württemberg
Heft 2/2005 - Offene Kirche Württemberg
Heft 2/2005 - Offene Kirche Württemberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
OFFENE KIRCHE<br />
Evang. Vereinigung<br />
in Württemberg<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Nr.<br />
2<br />
Juni<br />
<strong>2005</strong><br />
Familie – quo vadis?<br />
Stephanie Salethi<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Wir alle wissen, dass sich Familien<br />
in ihren Formen verändern, dass die<br />
traditionelle Großfamilie die Ausnahme<br />
geworden ist und Familien<br />
heute ganz anderen Bedingungen<br />
und Zwängen unterworfen sind als<br />
noch zu Großmutters Zeiten. Doch<br />
wie sieht der Familienalltag in den<br />
verschiedenen Formen moderner<br />
Familien heute aus? Ist die Familie<br />
noch ein Zukunftsmodell? Was<br />
leisten Familien, woran leiden sie<br />
und was brauchen sie?<br />
In der Arbeit mit Familien zeigt sich der<br />
vielfach beschriebene Wandel von<br />
Familien auf ganz konkreter Ebene.<br />
Auch wenn die Familie mit Mutter,<br />
Vater und Kind oder Kindern noch die<br />
häufigste Form des familiären Zusammenlebens<br />
darstellt, kann man nicht<br />
darüber hinwegsehen, dass der Anteil<br />
der Alleinerziehenden und der Patchworkfamilien<br />
in den letzten Jahren<br />
deutlich gestiegen ist.<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Aus dem Inhalt:<br />
○<br />
Familie<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Genozid<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Weltwasserkrise<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Notsituationen<br />
Anita Z., Mutter zweier Kinder im Alter<br />
von 11 und 14 Jahren, zieht ihre Kinder<br />
alleine groß. Die Kinder essen in der<br />
Schule, die Mutter arbeitet als Krankenschwester<br />
in einer Klinik. Zum Vater<br />
haben die Söhne keinen Kontakt,<br />
vermissen ihn auch nicht. Doch was<br />
passiert, wenn Frau Z. krank wird und<br />
in die Klinik muss? Zum Vater wollen<br />
die Kinder nicht, Großeltern sind auch<br />
nicht in der Nähe. Frau Z. hat Glück, sie<br />
wohnt in einem Mehrfamilienhaus und<br />
kann in Notfällen mit nachbarschaftlicher<br />
Unterstützung rechnen. Zusammen<br />
mit dem professionellen Angebot<br />
der Familienpflege kann sie die Notsituation<br />
in diesem Fall überbrücken.<br />
Das Beispiel zeigt aber, dass Familien in<br />
ihrem Wandel auf neue Netzwerke und<br />
Unterstützungssysteme angewiesen<br />
sind.<br />
Frau Susanne A. hat vier Kinder. Drei<br />
Kinder aus erster Ehe, ein Kind mit<br />
ihrem Lebensgefährten, mit dem sie in<br />
nichtehelicher Gemeinschaft zusammenlebt<br />
– eine Patchworkfamilie.<br />
Typisch für diese Familien sind der<br />
häufig große Altersabstand zwischen<br />
den Kindern aus erster Ehe und dem<br />
gemeinsamen Kind der derzeitigen<br />
Lebenspartner. Auch Frau A. wird<br />
krank, das häufig sehr anstrengende<br />
Zusammenleben mit den vier Kindern<br />
geht an ihre Reserven, sie muss zu einer<br />
www.<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong> Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> .de , E -mail: Redaktion@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong> OFFENE KIRCHE .de, Interentredaktion@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong> Seite .de 1
psychosomatischen Kur. Wer soll sich<br />
um die Kinder kümmern? In diesem Fall<br />
springt der Vater der drei Kinder aus<br />
erster Ehe ein. Bald schon zeigt sich<br />
aber, dass er und der neue Lebensgefährte<br />
seiner Frau dies nicht gemeinsam<br />
bewältigen können.<br />
Karin K. ist verheiratet und hat zwei<br />
Kinder im Alter von drei und fünf<br />
Jahren. Ihr Mann ist ganztags berufstätig,<br />
sie versorgt den Haushalt und die<br />
Kinder. Die Großeltern wohnen, wie bei<br />
den meisten Familien heutzutage, weit<br />
weg. Bei Frau K. wird Brustkrebs<br />
diagnostiziert. Zu Beginn der Krankheit<br />
kann sich der Vater vermehrt um die<br />
Kinder kümmern. Da ihn jedoch die<br />
Sorge um seinen Arbeitsplatz umtreibt,<br />
kann er es sich nicht leisten, all zu oft<br />
zu Hause zu bleiben. Auch diese Familie<br />
benötigt Unterstützung, um ihren Alltag<br />
zu meistern.<br />
Drei ganz normale Familien in ganz<br />
normalen Krisen? Jedenfalls keine<br />
Ausnahmen, sondern Situationen, wie<br />
sie in Familien häufig vorkommen.<br />
Familien sind in ihren verschiedenen<br />
Formen heute vielfältigen Risiken<br />
ausgesetzt und müssen neue Formen<br />
des Umgangs mit Krisensituationen<br />
finden. Sie brauchen neue Netzwerke,<br />
wo traditionelle Formen der gegenseitigen<br />
Unterstützung weggebrochen sind.<br />
Großeltern wohnen oft nicht mehr um<br />
die Ecke oder sind nicht mehr bereit,<br />
einen Großteil Ihrer Zeit der Betreuung<br />
der Enkel zu widmen. Paarbeziehungen<br />
werden brüchiger. Über 200 000 Paare<br />
lassen sich in Deutschland jedes Jahr<br />
scheiden. Viele Familien müssen<br />
häufiger den Wohnort wechseln, da von<br />
den ArbeitnehmerInnen Mobilität<br />
erwartet wird. Nachbarschaftliche<br />
Beziehungen haben nicht mehr dieselbe<br />
Tragfähigkeit wie früher. Insbesondere<br />
in der Anonymität einer Großstadt<br />
bleiben Notsituationen, in die Familien<br />
geraten können, häufig unerkannt.<br />
Chancen der Patchworkfamilie<br />
Im Spiegel all dieser Entwicklungen<br />
stellt sich die Frage, was Familie heute<br />
ist und wie wir Familien bei der Bewältigung<br />
ihrer Lebensschwierigkeiten<br />
unterstützen können. Kinder wachsen<br />
in den unterschiedlichsten Formen des<br />
Editorial<br />
Liebe Leserin,<br />
lieber Leser,<br />
◆ bei der Sommersynode wird das Thema<br />
„Zukunftsmodell Familie“ behandelt. Dazu<br />
haben wir Fachfrauen befragt, aber auch<br />
festgestellt, dass sich schon die VikarInnen<br />
1969 mit der „Eheproblematik“ herumgeschlagen<br />
haben. Nun sind wir gespannt, was<br />
die Synode dazu beitragen wird, dass es<br />
Familien – in welcher Form auch immer – in<br />
Zukunft besser geht. Es sollten auch<br />
Fachmänner mitdiskutieren! Am besten<br />
Menschen, die in den Gemeinden für<br />
Familien da sind oder Angebote vermissen.<br />
Und was ist mit Alleinlebenden? Fast die<br />
Hälfte unserer Gesellschaft? Ich bin gespannt,<br />
ob das auch einmal ein Synodenthema<br />
wird.<br />
◆ Diesmal müssen wir einiges in eigener<br />
Sache loswerden. Erstens: Unsere Homepage<br />
wurde runderneuert. Wer Internet hat,<br />
möge dies unter www.<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
begutachten. Pressemitteilungen sind da<br />
ebenso zu finden wie Vorträge, die anlässlich<br />
der Mitgliederversammlungen oder der<br />
AMOS-Preis-Verleihungen gehalten wurden.<br />
Auch OK-<strong>Heft</strong>e kann man nachlesen, zum<br />
Beispiel den Artikel über den <strong>Kirche</strong>nkreis<br />
Stuttgart, der durch ein technisches Versehen<br />
verunglückt war (worum wir Dekan<br />
Ehrlich um Verzeihung bitten). Natürlich<br />
sind Veranstaltungen angekündigt, sofern<br />
wir davon erfahren. Also, schauen Sie nach –<br />
auch ob Ihre Adresse stimmt – und tragen<br />
Sie sich ein, wenn Sie den elektronischen<br />
Newsletter erhalten möchten. Schreiben Sie<br />
uns bitte unter Internetredaktion@<strong>Offene</strong>-<br />
<strong>Kirche</strong>.de.<br />
◆ Zweitens: Auch wir müssen sparen. Unser<br />
Geschäftsführer und Finanzminister Reiner<br />
Stoll-Wähling hat herausgefunden, dass sich<br />
das Porto halbiert, wenn wir das OK-<strong>Heft</strong><br />
exakt in jedem Quartal versenden. Das ist<br />
ein Argument, bedeutet aber, dass wir <strong>Heft</strong> 3<br />
vor den Sommerferien fertig haben müssen,<br />
damit es im September herauskommen<br />
kann. Das ist wichtig für AutorInnen!<br />
◆ Und nochmal Finanzen: Große, dicke<br />
Bitte an alle, ihren Mitgliedsbeitrag zu<br />
überweisen – sofern noch nicht geschehen –<br />
und evtl. eine AMOS-Preis-Spende springen<br />
zu lassen. Letztere muss auf dem Überweisungsträger<br />
als solche gekennzeichnet<br />
sein. Die Kontonummern finden Sie auf der<br />
Rückseite.<br />
Aus unserer Redaktion hat sich Gerlinde<br />
Maier-Lamparter verabschiedet, die dem<br />
Team seit 1991 angehörte und dank ihrer<br />
Personenkenntnisse immer gute Tipps geben<br />
konnte. Wir wünschen Ihr alles Gute und<br />
uns eine/n neue/n RedakteurIn.<br />
Ihnen erholsame Ferien und viele neue<br />
Eindrücke – auch aus unserem <strong>Heft</strong>!<br />
Ihre Renate Lück<br />
Inhalt<br />
Familie<br />
Quo vadis?<br />
....................................... Seite 1<br />
Von Wunschbild und Wirklichkeit<br />
....................................... Seite 3<br />
Genozid<br />
Die Armenier<br />
....................................... Seite 5<br />
Assyrer und Aramäer<br />
....................................... Seite 7<br />
Sonderpfarrämter<br />
Kirchliche Arbeit in der Polizei<br />
....................................... Seite 9<br />
Globalisierung<br />
Wasserprivatisierung .....................................Seite 11<br />
<strong>Kirche</strong>ngeschichte<br />
Esslinger Erklärung von 1969<br />
.....................................Seite 13<br />
Christoph Blumhardt d.Ä.<br />
.....................................Seite 15<br />
OFFENE KIRCHE<br />
.....................................Seite 18<br />
Buchbesprechungen Leserbriefe<br />
.....................................Seite 21<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Seite 2 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
Zusammenlebens mit Erwachsenen und<br />
anderen Kindern auf. Jede siebte<br />
Familie, so Schätzungen, lebt heute als<br />
Patchworkfamilie. Dabei unterscheiden<br />
sich diese Familien sehr in ihrer Größe,<br />
in ihrer Form sowie in der Art des<br />
Zusammenlebens. Gemeinsam ist allen,<br />
dass sie sich neu zusammenfinden<br />
müssen und wichtige Fragen des<br />
Zusammenlebens geklärt werden<br />
müssen. Akzeptieren meine Kinder<br />
meinen neuen Partner? Wo verbringen<br />
die Kinder Ostern oder Weihnachten?<br />
Wie sind die Besuchszeiten geregelt?<br />
Gleichzeitig bieten gerade Patchworkfamilien<br />
häufig auch neue Chancen.<br />
Plötzlich bekommt das Einzelkind<br />
Geschwister, die Mutter oder der Vater<br />
einen neuen Partner. Kinder wachsen in<br />
neuen Formen des Zusammenlebens mit<br />
all ihren Kompliziertheiten und Schattenseiten<br />
auf und lernen damit umzugehen.<br />
Letztendlich geht es darum, diese<br />
Formen des Zusammenlebens nicht nur<br />
kritisch zu beäugen, sondern auch die<br />
Chancen und Potenziale zu erkennen,<br />
die in Veränderungen liegen. Nur mit<br />
diesem Blickwinkel kann die Familie ein<br />
Zukunftsmodell sein, denn vom Mythos<br />
der heilen Familie, im Sinn einer<br />
traditionellen Familie, werden wir uns<br />
über kurz oder lang verabschieden<br />
müssen. Der gesellschaftliche Wandel<br />
bringt unweigerlich einen Wandel der<br />
Beziehungen mit sich, das Zusammenleben<br />
ist vielfach komplizierter und<br />
schwieriger geworden.<br />
Bei aller Veränderung bleibt aber die<br />
Tatsache, dass Eltern die Verantwortung<br />
für ihre Kinder tragen, für welche Form<br />
des Zusammenlebens sie sich auch<br />
entscheiden. Vielleicht sollte man<br />
„Familie“ zukünftig nicht mehr über die<br />
Vollständigkeit der im Haushalt lebenden<br />
Familienmitglieder definieren,<br />
sondern über Verantwortung für Kinder,<br />
der Eltern in den verschiedensten<br />
Formen versuchen gerecht zu werden.<br />
Die Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit<br />
und Angenommensein ändert sich<br />
bei allem äußeren und inneren Wandel<br />
nicht. Wo diese Sehnsucht ein Zuhause<br />
findet, dort ist Familie, in welcher Form<br />
auch immer.<br />
Dr. Stephanie Saleth ist Ausschussmitglied<br />
der Evangelischen Hausund<br />
Familienpflege, Delegierte der<br />
Frauenarbeit der Evangelischen<br />
Landeskirche und Mutter zweier<br />
Kinder im Alter von fünf und neun<br />
Jahren.<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Familie – vom idealen Wunschbild<br />
und der riskanten Wirklichkeit<br />
Familie – Problemzone der Erziehung?<br />
Die Familie ist in der Krise, und mit ihr<br />
die Erziehung. Schuld daran, so die<br />
öffentliche Meinung, seien in der Regel<br />
die Eltern, denn Erziehung ist nun<br />
einmal Privatsache. Aber der öffentlichen<br />
Krisendebatte vom Verfall der<br />
Familie stehen auch andere Meinungen<br />
gegenüber. Entgegen allen anders<br />
lautenden Behauptungen ist die Familie<br />
immer noch die dominierende Lebensform.<br />
In Westdeutschland lebten im Jahr<br />
2000 rund 80 Prozent aller Kinder unter<br />
18 Jahren bei ihren miteinander verheirateten<br />
Eltern. In Ostdeutschland waren<br />
es 69 Prozent . Auch in der subjektiven<br />
Einschätzung von Jugendlichen steht<br />
Familie hoch im Kurs. Misst man die<br />
Wertschätzung des Familienlebens an<br />
der Zustimmung zur eigenen Erziehung,<br />
zeigt sich eine hohe Übereinstimmung<br />
zwischen Eltern und Kindern. Etwa 75<br />
Prozent der befragten Kinder und<br />
Jugendlichen würden ihre eigenen<br />
Kinder später ähnlich erziehen wie sie<br />
selbst erzogen worden sind. Noch nie<br />
seit den 70er Jahren war die Übereinstimmung<br />
zwischen Eltern und Kindern<br />
so ausgeprägt wie heute. Also kein<br />
Anlass zur Aufregung?<br />
Familie – ein uneindeutiger Begriff?<br />
Was ist eigentlich eine Familie? Im<br />
Allgemeinen meint man dabei die so<br />
genannte Kern- oder Kleinfamilie von<br />
Eltern und Kindern. Diese Vorstellung<br />
hat eine Entstehungsgeschichte. Sie<br />
reicht zurück in die zweite Hälfte des<br />
18. Jahrhunderts, in die beginnende<br />
Industrialisierung und die Durchsetzung<br />
der Klassengesellschaft. Unser heutiges<br />
Familienmodell entstand mit dem<br />
Bürgertum. Sein Kennzeichen war die<br />
Trennung von Beruf und Zuhause,<br />
öffentlich und privat. Die männliche<br />
Arbeit war Erwerbsarbeit in einer<br />
arbeitsteiligen und funktional organisierten<br />
Öffentlichkeit, während die Frauen<br />
für Haushalt und Kinder im privaten<br />
Wohnraum zuständig waren. Kapital des<br />
Bürgertums war seine Bildung. Bildung<br />
war Statussicherung in einer sich<br />
wandelnden Gesellschaft für eine Klasse<br />
ohne Besitz oder politische Macht.<br />
Ursula Pfeifferi<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Deshalb erhielten Kindheit, Erziehung<br />
und Unterricht einen besonderen<br />
Stellenwert. Prototypisches Beispiel für<br />
diese Familienform waren die evangelischen<br />
Pfarrhäuser des 19. Jahrhunderts.<br />
Zurück zur Frage nach der Familie<br />
heute. In der Wissenschaft gibt es keine<br />
„richtige“ Definition von Familie.<br />
Trotzdem gibt es Merkmale, mit denen<br />
Familien beschrieben werden können,<br />
etwa so: als überschaubare Gruppe von<br />
mindestens zwei Generationen, die<br />
dauerhaft, nah und intim zusammenlebt<br />
und die eine Umwelt bildet, in der die<br />
jüngere Generation sich entwickeln und<br />
in die Gesellschaft hineinwachsen kann.<br />
Neu ist, dass heute aufgrund der<br />
gestiegenen Lebenserwartung in der<br />
Regel drei, oft vier, manchmal sogar fünf<br />
Familiengenerationen gleichzeitig leben.<br />
Das gab es bisher noch nie.<br />
Familie – riskante Balance zwischen<br />
den Widersprüchen der Gesellschaft<br />
Die Kulturgeschichte zeigt, dass es<br />
generationsübergreifende Formen des<br />
Zusammenlebens schon immer gab. In<br />
Untersuchungen wurden Männer und<br />
Frauen, die in Familien oder familienähnlichen<br />
Lebensgemeinschaften lebten,<br />
nach den „Familienbildern“ gefragt, an<br />
denen sie sich selber orientieren. Bei<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 3
vielen prägt noch immer das alte<br />
Bild der um den Tisch versammelten<br />
Familie ihre Vorstellung, also ein<br />
Bild für Geborgenheit, Gemütlichkeit,<br />
Gemeinschaft und Solidarität,<br />
Harmonie und Frieden. Für nicht<br />
wenige Menschen ist das bis heute<br />
das archetypische Familienbild. Diese<br />
Bilder entstammen vielfach<br />
keineswegs der Lebenswirklichkeit<br />
der eigenen Familien oder früheren<br />
Erfahrungen. Oft stehen sie für<br />
Wünsche und Phantasien, auch<br />
für explizite Gegenbilder zur eigenen<br />
Erfahrung. Diese Idealvorstellung von<br />
Familie droht uns heute zu überfordern.<br />
Aus einem Leitbild kann dann ein<br />
Leidbild werden.<br />
Familie: Kindzentriert oder –<br />
dezentriert?<br />
Zwei gegenläufige Trends bestimmen<br />
heute das Leben von Heranwachsenden:<br />
einerseits sind sie der Mittelpunkt ihrer<br />
Familie und der Gesellschaft, andererseits<br />
sind sie im Weg, stören sie den<br />
Trend zur Mobilität und Unabhängigkeit.<br />
Die erstgenannte Entwicklung kam<br />
mit der bürgerlichen Familie und<br />
brachte die bürgerliche Kindheit. Wie im<br />
Zuge von Aufklärung und Idealismus<br />
vieles besser werden sollte, so auch die<br />
Kindheit. Kinder rückten in den Mittelpunkt<br />
der Familie. Heute beteiligen sich<br />
neben der Familie noch viele andere<br />
Spezialisten, Erzieher, Psychologen,<br />
Lehrer, Ärzte, Wissenschaftler, Mediziner,<br />
Trainer, Elternbildner, Ratgeberautoren<br />
und Medienprogrammgestalter<br />
an der möglichst optimalen Entwicklung<br />
von Kindern und Jugendlichen. Ihren<br />
Höhepunkt findet diese Entwicklung<br />
derzeit in der Reproduktionsmedizin.<br />
Die ungeteilte Aufmerksamkeit der<br />
Eltern auf das eine „Projekt“ Kind<br />
beginnt mit dem richtigen Zeitpunkt für<br />
sein erwünschtes Erscheinen. Seine<br />
Lebenschancen steigen aus Sicht junger<br />
Eltern dann, wenn sie nicht geteilt<br />
werden müssen, mit Geschwistern zum<br />
Beispiel, alles andere erscheint „verantwortungslos“<br />
in den Augen vieler Eltern<br />
heute.<br />
Es gibt aber auch das Gegenteil: Kinder<br />
werden aus dem Mittelpunkt der<br />
Familie verdrängt. Der wird zum<br />
Umschlagplatz unterschiedlichster<br />
Interessen, über die verhandelt und für<br />
die gekämpft werden muss. Immer<br />
mehr Kinder machen die Erfahrung,<br />
dass sie auch am Rande der Gesellschaft<br />
stehen. Ihre Familien leben in Armut,<br />
bedingt durch Arbeitslosigkeit, Krankheit<br />
oder Kinderreichtum. Rund eine<br />
Million Kinder unter 18 Jahren sind<br />
Sozialhilfeempfänger. Sie können<br />
finanziell nicht mithalten, das beeinflusst<br />
ihre Sozialbeziehungen und ihren<br />
zukünftigen Platz in der Gesellschaft.<br />
Wen wundert es, dass es immer weniger<br />
Kinder gibt? Und wie wird die alternde<br />
Gesellschaft mit der Minderheit ihrer<br />
Kinder und Jugendlichen<br />
umgehen? Der Preis kostbarer<br />
und knapper Güter ist bekanntlich<br />
hoch, das ist eine alte<br />
Erfahrung.<br />
Familie: Keimzelle oder<br />
Krisenherd der Gesellschaft?<br />
Die Familie soll „Keimzelle“<br />
der Gesellschaft sein, sie soll<br />
das leisten, was wir die<br />
Sozialisation in die Gesellschaft<br />
nennen. Aber ihr Ziel ist nicht<br />
ihr Weg. Das Leben in der<br />
Familie folgt anderen Spielregeln<br />
als das gesellschaftliche<br />
Leben. Dort, in der Familie,<br />
stehen die Beziehungen, das<br />
Zusammenleben und die<br />
Individualität der Mitglieder,<br />
die räumliche und emotionale<br />
Nähe, die gegenseitige Solidarität<br />
im Vordergrund. In der<br />
modernen Gesellschaft oder in<br />
der Schule dagegen geht es um eine<br />
spezielle Sache oder um bestimmte<br />
Ziele, um begrenzte Zusammenarbeit,<br />
zeitlich und der Sache nach, um Distanz<br />
zum Persönlichen und Individuellen,<br />
um Leistung und Konkurrenz im<br />
Wettbewerb, um begrenzte Positionen<br />
und Gratifikationen. Vergleicht man<br />
beides, erscheint die Familie mit ihren<br />
Strukturen nicht in die Gesellschaft zu<br />
passen, sie wirkt wie eine zurückgebliebene<br />
vormoderne Lebensform. Kein<br />
Wunder also, dass von der Krise der<br />
Familie heute so oft die Rede ist. Dabei<br />
werden Zweifel laut, ob sie den gesellschaftlichen<br />
Erwartungen an ihre<br />
Erziehungsleistung zur Vorbereitung<br />
auf das spätere Leben in der<br />
Gesellschaft im gewünschten<br />
Umfang noch nachkommt. Aber<br />
das ist nur die eine Seite. Auf eine<br />
andere will ich am Schluss noch<br />
hinweisen. Adorno hat das, was ich<br />
meine, so ausgedrückt: „manchmal<br />
will es scheinen, als wäre die<br />
unselige Keimzelle der Gesellschaft,<br />
die Familie, zugleich auch<br />
die hegende Keimzelle des kompromisslosen<br />
Willens zur anderen. Mit<br />
der Familie zerging der Widerstand, der<br />
das Individuum zwar unterdrückte, aber<br />
auch stärkte, wenn nicht gar hervorbrachte.<br />
Das Ende der Familie lähmt die<br />
Gegenkräfte.“ Nicht um Anpassung also,<br />
sondern um Widerstand geht es hier,<br />
um einen Widerstand, der Ausdruck<br />
eigener Urteilsfähigkeit ist. Und diese, so<br />
Adorno, lernt man eben nur da, wo es<br />
Gegensätze gibt, an denen ein eigenes<br />
Urteil entstehen kann, zum Beispiel in<br />
einer Familie, in der nicht alles glatt<br />
geht. Dass diese Urteilsfähigkeit sich<br />
dann auch als Gegenkraft gegen gesellschaftliche<br />
Zustände artikulieren kann,<br />
das war nach Auschwitz für Adorno<br />
eine überlebenswichtige Funktion der<br />
Familie für die Gesellschaft. Brauchen<br />
wir das heute nicht mehr?<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Die OK-Synodale Dr. Ursula Pfeiffer<br />
ist Professorin an der Pädagogischen<br />
Hochschule Weingarten.<br />
Seite 4 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
Genozid<br />
Die Armenier<br />
Hagop-Jan Avedikjan und Benjamin Aynali<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Herkunft<br />
Die Armenier besitzen eine dreitausendjährige<br />
Geschichte. Über ihre Herkunft<br />
gibt es verschiedene wissenschaftliche<br />
und mythologische Aussagen. Die Bibel<br />
sieht in den Armeniern Nachfahren<br />
Noahs, der ja mit seiner Arche am<br />
heiligen Berg der Armenier, am Ararat<br />
landete. Die Armenier selbst sehen es<br />
anders: Ihre ältesten Überlieferungen<br />
berichten von einem Stammvater Hajk,<br />
der auf der Flucht vor dem Tyrannen Bel<br />
aus Mesopotamien in das armenische<br />
Hochland gelangte. Nach dem Stammvater<br />
„Hajk“ nennen sich die Armenier<br />
„Hay“ und ihr Land „Hayastan“ (deshalb<br />
heißt unser Vereinsheim in Salach<br />
„HAY-DUN“ = Haus der Armenier). Die<br />
wissenschaftlichen Theorien besagen:<br />
Die Armenier, wie wir sie heute kennen,<br />
setzen sich aus unterschiedlichen<br />
Völkergruppen zusammen. Das wichtigste<br />
Element bildeten die Urartäer, ein<br />
im Hochland von Armenien ansässiges<br />
Volk, das seine politische und kulturelle<br />
Blüte im 7. bis 9. Jahrhundert v. Chr.<br />
erreichte. Ihr Name lebt u.a. im Wort<br />
„Ararat“ („Ararat“ bedeutet im Assyrischen<br />
„Urartu“) fort, zu dem die<br />
Armenier dagegen „Massis“ sagen. Das<br />
Zentrum des Urartäischen Reiches<br />
befand sich am Wan-See in der heutigen<br />
Ost-Türkei, wo man noch die eindrucksvollen<br />
Befestigungsanlagen und kunstvollen<br />
Bewässerungskanäle, die Ruinen<br />
ihrer Paläste und Burgen der ehemaligen<br />
Urartäer-Metropole Tuschpa sehen<br />
kann. Die zweite wichtige, an der<br />
Bildung des armenischen Volkes<br />
beteiligte Gruppe sind Indoeuropäer, die<br />
vermutlich ab dem 8. Jahrhundert v. Chr.<br />
von der Balkanhalbinsel nach Kleinasien<br />
einwanderten. Diese Indoeuropäer<br />
vermischten sich mit den Urartäern,<br />
wobei sie deren Kultur und Elemente<br />
der Sprache übernahmen. Das Dritte<br />
sind Einflüsse der kaukasischen Sprachen<br />
und Kulturen.<br />
Die armenische Schrift und Sprache<br />
Bis Anfang des 5. Jahrhunderts n. Chr.<br />
hatten die Armenier kein eigenes<br />
Alphabet. Sie benutzten die griechische,<br />
syrische und persische Schrift je nachdem,<br />
wer das Land beherrschte. Als<br />
Armenien im Jahre 387 durch einen<br />
Friedensvertrag zwischen Kaiser<br />
Theodosius und dem Perserkönig<br />
Schapur III. aufgeteilt wurde, galt<br />
in Westarmenien Griechisch als<br />
Hof- und <strong>Kirche</strong>nsprache und in<br />
Ostarmenien Persisch als Hof- und<br />
Syrisch als <strong>Kirche</strong>nsprache.<br />
Der königliche Sekretär Mesrop Maschtots,<br />
berühmt für seine Kenntnisse der<br />
griechischen, persischen und syrischen<br />
Sprache, vollendete nach achtjähriger<br />
Arbeit aufgrund des phönizischen<br />
Alphabets das armenische Alphabet mit<br />
36 Buchstaben (heute sind es 38). Das<br />
war im Jahre 406. Im Jahre 434 beendete<br />
Maschtots seine Übersetzung der<br />
gesamten Bibel. Damit wurde das<br />
Armenische nicht nur Volks- sondern<br />
auch Schrift- und <strong>Kirche</strong>nsprache. (410<br />
schuf M. Maschtots für die Georgier,<br />
423 für die kaukasischen Albaner ein<br />
eigenes Alphabet.) Mit Hilfe der Schrift<br />
vollzog sich eine stürmische Entwicklung<br />
der armenischen Literatur, so dass<br />
die erste Hälfte des 5. Jh. das Goldene<br />
Zeitalter der armenischen Literatur<br />
genannt wird.<br />
Altarmenisch, Grabar genannt, ist noch<br />
heute die <strong>Kirche</strong>nsprache in der Armenisch<br />
Apostolischen <strong>Kirche</strong>. Mittelarmenisch<br />
(11. bis 15. Jh) diente als<br />
Kanzlei- und Umgangssprache am Hofe<br />
des armenischen Königreiches Kilikien.<br />
Die Neuarmenische Sprache entwickelte<br />
sich in Ost- und Westarmenisch. Das<br />
Ostarmenische ist heute die offizielle<br />
Regierungs-, Universitäts- und Umgangssprache<br />
in der Armenischen Republik.<br />
An die fünf Millionen Menschen<br />
sprechen heute Ostarmenisch. Die aus<br />
der Türkei vertriebenen Armenier und<br />
ihre Nachkommen sprechen heute in<br />
der Diaspora Westarmenisch, wobei die<br />
<strong>Kirche</strong>n, Schulen und die Presse<br />
wirksame Hilfen zur Erhaltung der<br />
Sprache leisten. Gut drei Millionen<br />
Menschen sprechen Westarmenisch.<br />
Die Armenische <strong>Kirche</strong><br />
Das Christentum wurde schon sehr früh<br />
in Armenien verbreitet. Die Armenische<br />
<strong>Kirche</strong> führt ihren Ursprung auf die<br />
Apostel Bartholomäus und Thaddäus<br />
(vgl. Matth. 10.3) zurück, die um 50 bis<br />
60. n. Chr. als Prediger nach Armenien<br />
Hagop-Jan Avedikjan (links) und Benjamin Aynal<br />
kamen und dort den Märtyrertod<br />
fanden. Auf das Wirken der Apostel<br />
Christi bezieht sich die Armenische<br />
<strong>Kirche</strong> in ihrer offiziellen Bezeichnung<br />
als „Armenisch-Apostolisch Orthodoxe<br />
<strong>Kirche</strong>“. Historisch nur wenig fassbar ist<br />
die Person Gregor des Erleuchters<br />
(Krikor Lusaworitsch). Er kam als<br />
Missionar nach Armenien. Dabei stieß<br />
er auf den entschiedenen Widerstand<br />
des armenischen Königes Tridates III.<br />
Der Überlieferung nach wurde Gregor<br />
arrestiert und nach 13-jähriger Einkerkerung<br />
aus dem Gefängnis befreit.<br />
Danach soll er König Tridates III. von<br />
einer unheilbaren Krankheit geheilt<br />
haben. Daraufhin bekehrte sich der<br />
König und ließ seine Herrscherfamilie<br />
sowie alle seine Untertanen taufen. Im<br />
Jahre 301 erklärte er das Christentum<br />
zur Staatsreligion Armeniens. Die<br />
Armenier sind daher das Volk mit der<br />
ältesten christlichen Staatskirche der<br />
Welt, denn im Römischen Imperium<br />
wurde das Christentum erst im Jahre<br />
311, mithin zehn Jahre später, durch<br />
Kaiser Konstantin (280 – 337) zur<br />
„allein berechtigten Religion im Reich“<br />
erhoben.<br />
Die armenische <strong>Kirche</strong> anerkennt die<br />
Beschlüsse der Ökumenischen Konzile<br />
von Nizäa (325), von Konstantinopel<br />
(381) und von Ephesus (431). Das<br />
Dogma des vierten Konzils, das 451 in<br />
Chalcedon abgehalten wurde, wonach<br />
Christus zwei Naturen besessen habe,<br />
nämlich eine menschliche und eine<br />
göttliche, wurde von der Armenischen<br />
<strong>Kirche</strong> nicht anerkannt. Bis heute hält<br />
sie an der Einnaturlehre fest. Sie bildet<br />
auch dogmatisch eine selbständige<br />
<strong>Kirche</strong> innerhalb des orthodoxen<br />
Flügels. Nachdem die Armenische<br />
<strong>Kirche</strong> ihre Unabhängigkeit erklärt hatte,<br />
entwickelte sie ihre eigene Tradition. Sie<br />
anerkennt weder den Papst noch den<br />
ökumenischen Patriarchen, sondern nur<br />
den Katholikos, das Oberhaupt der<br />
Armenischen <strong>Kirche</strong>, als die oberste<br />
Instanz. Der Sitz des Katholikos änderte<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 5
sich mit der jeweiligen politischen Lage.<br />
Lange war der Amtssitz auf der Insel<br />
Akhtamar im Wan-See. Als in Kilikien<br />
ein neues armenisches Königreich<br />
gegründet wurde, verlegte man das<br />
Katholikosamt nach Kilikien in die<br />
Hauptstadt Sis. Es gab aber auch Zeiten,<br />
wo sich verschiedene Katholikosate<br />
gegenüberstanden und den Rechtsanspruch<br />
streitig machten. Im Jahre 1441<br />
wurde Etschmiadsin (heute in Armenien)<br />
endgültig zum Hauptsitz des<br />
Katholikos gewählt und ist es bis heute<br />
geblieben. Im Jahre 1924 sah sich der<br />
greise Katholikos Sahak von Sis gezwungen<br />
auszuwandern, da die Armenier<br />
während des Ersten Weltkrieges in der<br />
Türkei fast ganz ausgerottet worden<br />
waren. Heute besteht in Antilias nahe<br />
der Stadt Beirut ein Katolikosat, das<br />
auch ein großes Priesterseminar betreibt.<br />
Geschichte<br />
Einen tiefen Einschnitt in seiner Geschichte<br />
erlebte Armenien im 7. Jahrhundert<br />
durch die Entstehung des Islam,<br />
bei dessen rascher Ausbreitung im<br />
vorderen Orient arabische Stämme bald<br />
auch nach Armenien gelangten. Von<br />
Osten her drangen im 11. Jahrhundert<br />
die Seldschuken nach Armenien ein und<br />
überfielen u. a. seine berühmte Hauptstadt<br />
Ani. Mitte des 11. Jahrhunderts<br />
wurde das armenische Volk aus seinem<br />
Stammland vertrieben und wanderte<br />
nach Kilikien aus (heutige Südtürkei).<br />
Armenien war für das Abendland immer<br />
das christliche Bollwerk gegen den<br />
Islam. Im Mittelalter leistete das Fürstentum<br />
Kilikien den europäischen Kreuzzüglern<br />
wirksame Unterstützung. Als<br />
Dank wurde das Fürstentum durch<br />
Kaiser Heinrich Vl. und Segen des<br />
Papstes Celestin III. zum armenischen<br />
Königreich erhoben. Es leistete allem<br />
Bedrängen erfolgreich Widerstand, bis es<br />
1375 unter dem Ansturm der islamischen<br />
Mamelucken endgültig zusammenbrach.<br />
Die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts<br />
fügte dem armenischen Volk<br />
und seiner <strong>Kirche</strong> schwere Verluste zu.<br />
Zwar wurde nach der Aufteilung Ost-<br />
Armeniens zwischen den Persern und<br />
dem zaristischen Russland im östlichen<br />
Landesteil eine sog. Polejenie (1836)<br />
erlassen und für die im Osmanischen<br />
Reich lebenden orthodoxen Armenier<br />
ebenfalls die Anerkennung als eigene<br />
„Nation“ („Millet“ im damaligen<br />
osmanischen Sinne eine Art religiöskonfessionelle<br />
Volksgruppe) im Jahre<br />
1863 erreicht. Jedoch verhinderte dies<br />
nicht die Massaker, die von Sultan<br />
Abdul-Hamit II. 1894 bis 1896 aus<br />
religiösen Gründen veranlasst wurden.<br />
Während dieser Massaker kamen<br />
300.000 Armenier ums Leben. Vielleicht<br />
das schrecklichste war das<br />
Massaker in Urfa am 28./29. Dezember<br />
1895. Etwa 3.000 armenische Männer,<br />
Frauen und Kinder hatten in der<br />
Kathedrale Zuflucht gesucht, in die<br />
jedoch Soldaten eindrangen. Nachdem<br />
die Türken viele unbewaffnete Opfer<br />
niedergeschossen hatten, trugen sie<br />
Stroh herbei, begossen es mit Petroleum<br />
und setzten es in Brand. Konsul Fitzmaurice<br />
schrieb später darüber: „Die<br />
Pfeiler der Empore und das Holzgebälk<br />
standen sofort in Flammen, worauf die<br />
Türken die Treppe zur Empore mit<br />
ähnlichem brennbaren Material blockierten.<br />
Sie ließen die um ihr Leben ringende<br />
Menschenmenge ein Opfer der<br />
Flammen werden. Mehrere Stunden<br />
lang durchzog der Geruch brennenden<br />
Fleisches die Stadt“. 1909 fanden<br />
weitere Massaker in Kilikien statt, vor<br />
allem in der Stadt Adana; hier wurden<br />
30.000 Armenier bestialisch getötet.<br />
Die größte Katastrophe brach während<br />
des ersten Weltkrieges aus. Das jungtürkische<br />
Regime unter dem Triumvirat<br />
von Enver-, Talat- und Djemal-Pascha<br />
verübte aus nationalistischen Motiven<br />
den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts,<br />
wobei 1915/1916 1,5 Millionen<br />
Armenier durch Mord und brutale<br />
Deportationen („Todesmärsche“) ums<br />
Leben kamen. Ihr Hab und Gut, Grund<br />
und Boden wurden beschlagnahmt, die<br />
armenischen <strong>Kirche</strong>n und Schulen<br />
zerstört. Es bedeutete Zwangsislamisierung,<br />
Vergewaltigung armenischer<br />
Frauen, Zerstreuung der Armenier auf<br />
der ganzen Welt.<br />
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges,<br />
am 28. Mai 1918, wurde die Armenische<br />
Republik ausgerufen. Jedoch hatte<br />
diese Republik in Trans-Kaukasien ein<br />
sehr kurzes Leben: Am 29. November<br />
1920 marschierte die Rote Armee ein<br />
und Armenien wurde sowjetisiert. Diese<br />
kleinste Republik der Sowjet-Union<br />
wurde kurz vor Ende der UdSSR, am<br />
21. September 1991, durch Volksentscheid<br />
wieder unabhängig. Das armenische<br />
Gebiet von „Berg-Karabach“, das<br />
Anfang der zwanziger Jahre von Stalin<br />
an die Aserbaidschanische Sowjet-<br />
Republik angegliedert wurde, ist zwar<br />
seitens der Karabach-Armenier befreit<br />
worden, aber die Frage des Berg-<br />
Karabach ist bis heute noch nicht gelöst.<br />
Armenische Gemeinde e.V. Baden-<br />
Württemberg<br />
Durch Verfolgung, Vertreibung und<br />
Massenvernichtung um die Jahrhundertwende<br />
wurde unser Volk in die ganze<br />
Welt verstreut. Viele Armenier haben in<br />
zahlreichen europäischen Ländern, u. a.<br />
auch Deutschland bzw. Baden-Württemberg,<br />
eine neue Heimat gefunden.<br />
Unsere Gemeindemitglieder sind<br />
zumeist aus der Türkei stammende<br />
armenische Volksangehörige, die in den<br />
60er und 70er Jahren als Gastarbeiter,<br />
vor allem als Handwerker und Akademiker,<br />
nach Deutschland kamen. In Baden-<br />
Württemberg leben etwa 4.500 Armenier,<br />
die sich längst etabliert haben und<br />
deutsche Staatsangehörige sind. Als<br />
Christen fühlen wir uns in Deutschland<br />
sicher und sehr wohl. „Wenn drei<br />
Armenier zusammen sind, dann gründen<br />
sie erst eine <strong>Kirche</strong>, dann eine<br />
Schule und danach eine Zeitung“, heißt<br />
ein armenisches Sprichwort. Obwohl<br />
das nicht in dieser Reihenfolge geschah,<br />
gründeten wir 1974 zuerst mit ein paar<br />
Freunden in Göppingen einen Verein.<br />
Der damalige Kreisverein betreut heute<br />
alle in Baden-Württemberg und West-<br />
Bayern lebenden Armenier. 1983 haben<br />
wir in Göppingen-Bartenbach die erste<br />
Armenische <strong>Kirche</strong> in Deutschland<br />
einweihen können. Die Evangelische<br />
Gemeinde Bartenbach hat uns hierfür<br />
dankenswerterweise ihre alte St. Otmar-<br />
<strong>Kirche</strong> überlassen. In unserer Surp-<br />
Khatsch-<strong>Kirche</strong> (Heilige-Kreuz-<strong>Kirche</strong>)<br />
finden jeden Monat zweimal Gottesdienste<br />
statt.<br />
Da unser Verein ein großes Einzugsgebiet<br />
hat und wir kein eigenes Vereinsheim<br />
besaßen, waren wir gezwungen,<br />
uns an verschiedenen Orten meistens in<br />
Gaststätten zu treffen. Gott sei Dank<br />
haben wir im Februar 1998 in Salach-<br />
Bärenbach von der Gemeinde Salach das<br />
ehemalige Schützenhaus erwerben<br />
können. Hier werden unsere armenischen<br />
Bräuche aufrechterhalten (Muttersprache,<br />
Volkstänze, Volks- und Kinderlieder).<br />
Außerdem betreuen wir in<br />
unserem Vereinsheim sozial Schwache,<br />
Kranke, Rentner, ältere und alleinstehende<br />
Menschen sowie Jugendliche.<br />
Wir wollen in diesem Land nicht nur<br />
Gast bleiben, sondern in diesem Gebäude<br />
auch für unsere deutschen Freunde<br />
Gastgeber sein.<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Avedikjan ist Gründer und jetziger Ehrenpräsident<br />
der Armenischen Gemeinde<br />
e.V. Baden-Württemberg, Aynal ist Erster<br />
Vorsitzender der Gemeinde<br />
Seite 6 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
24. April 1915 – ein Trauma auch<br />
für Assyrer und Aramäer<br />
Anerkennung als „Völkermord“<br />
Bei den Assyrern spricht man von<br />
„Shato d’ sheifo“, vom „Jahr des<br />
Schwertes“ und jeder Assyrer weiß, dass<br />
es sich hier sich um die Vernichtung<br />
seines Volkes 1915 handelt. Die Öffentlichkeit<br />
bei uns weiß, wenn überhaupt,<br />
vor allem von dem Völkermord an den<br />
Armeniern, weniger davon, dass auch<br />
die Assyrer und Aramäer, die syrischen<br />
Christen im Tur Abdin im Südosten der<br />
Türkei, in gleicher Weise Ziel dieser<br />
Vernichtung durch die damals regierenden<br />
Jungtürken waren. In vielen<br />
Gedenkveranstaltungen wurde in vielen<br />
Ländern an das Massaker der Armenier<br />
erinnert, weniger an das der Assyrer<br />
und Aramäer. Beide, Armenier und<br />
Assyrer fordern bis heute ihr Recht.<br />
Beide setzen sich dafür ein – was bis<br />
heute in vielen Ländern noch nicht<br />
geschehen ist – dass die Vertreibung von<br />
Armeniern und Assyrern mit Hunderttausenden<br />
Toten ein „Völkermord“ war<br />
und so auch anerkannt wird, vor allem<br />
von der Türkei.<br />
Tilman Zülch von der „Gesellschaft für<br />
bedrohte Völker“ schrieb in einem<br />
offenen Brief an die Abgeordneten des<br />
Deutschen Bundestages am 20. April<br />
<strong>2005</strong>, einen Tag vor der Behandlung<br />
eines Antrags der CDU/CSU im Bundestag<br />
zu den Vertreibungen und Massakern<br />
an den Armeniern vor 90 Jahren:<br />
„16 nationale Gesetzgeber, unter ihnen<br />
die französische Nationalversammlung,<br />
die italienische Abgeordnetenkammer,<br />
das kanadische House of Commons, die<br />
russische Staatsduma, das amerikanische<br />
Repräsentantenhaus oder der Vatikan,<br />
haben sich nicht davor gescheut, durch<br />
Entschließungen oder Gesetze diese<br />
Verbrechen als Völkermord (Genozid)<br />
an bis zu 1,4 Millionen Armeniern und<br />
bis zu 500.000 assyrisch aramäischen<br />
Horst Oberkampfi<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Am 24. April jährte sich zum 90. Mal der Völkermord an den armenischen<br />
Christen. 1,4 Millionen Armenier sollen bei diesem Völkermord ums Leben<br />
gekommen sein. Aber nicht nur die Armenier, sondern auch die Assyrer,<br />
Aramäer und Chaldäer sind von diesem Genozid betroffen gewesen. Die Zahl<br />
der Getöteten geht in die Hunderttausende. Wie der Missionar Dr. Johannes<br />
Lepsius, der Gründer der deutschen Orientmission in seinen Berichten damals<br />
erwähnte, handelte es sich nicht nur um eine Vernichtung der Armenier,<br />
sondern um eine Ausrottung der Christen. Die Jungtürken wollten das Land<br />
„türkisieren“, also gleichsam säubern von allen ethnischen und religiösen<br />
Minderheiten, die anders waren als sie.<br />
Christen international zu bestätigen. Im<br />
übrigen haben gerade deutsche Persönlichkeiten<br />
– so der Missionar Dr.<br />
Johannes Lepsius, der jüdische Dichter<br />
Franz Werfel oder der Gründer des<br />
Wandervogels, Hoffmann – die Weltöffentlichkeit<br />
damals alarmiert oder den<br />
Genozid an den Armeniern bekannt<br />
gemacht.“ Im Antrag der CDU/ CSU<br />
wurde der Begriff „Völkermord“ nicht<br />
verwendet. Die deutsche Bundesregierung<br />
schweigt bis auf den heutigen Tag,<br />
vielleicht aus Rücksicht auf die vielen<br />
türkischen Mitbürger in unserem Land<br />
und aus Rücksicht auf die guten politischen<br />
und wirtschaftlichen Kontakte zur<br />
Türkei. Das damalige deutsche Reich<br />
hatte übrigens 1915 ebenfalls gute<br />
Beziehungen zur damaligen türkischen<br />
Regierung und schwieg zu den Vorgängen,<br />
von denen es Kenntnis haben<br />
musste.<br />
Zivilcourage eines syrischen Pfarrers<br />
In der Türkei ist es bis auf den heutigen<br />
Tag äußerst schwierig bis gefährlich,<br />
vom Völkermord an den Armeniern und<br />
Assyrern zu sprechen. Die Türkei beruft<br />
sich auf den § 312 des türkischen<br />
Rechts, in dem sinngemäß steht: Wer<br />
von Völkermord redet, begeht Landesverrat<br />
und wird hart bestraft. Aktuell<br />
wurde dies im Interview, das der<br />
syrische Pfarrer Yussuf Akbulut aus<br />
Diyarbakir im Oktober 2000 privat der<br />
türkischen Zeitung Hürriyet gab und das<br />
auch als Video heimlich aufgezeichnet<br />
und dann im türkischen Fernsehen<br />
gezeigt wurde. Er sagte dort u.a., dass<br />
die Behauptungen über den Völkermord<br />
an den Armeniern richtig seien, und<br />
dass auch seine Glaubensbrüder davon<br />
betroffen gewesen sind. „Nicht nur die<br />
Armenier, auch die Syrer sind damals<br />
mit der Begründung, dass sie Christen<br />
sind, dem Völkermord ausgesetzt<br />
gewesen. Die Syrer wurden in Scharen<br />
ermordet. Und bei diesem Massaker<br />
wurden die Kurden genutzt.“ Dank der<br />
Beteiligung von Beobachtern aus dem<br />
Ausland wurde Pfarrer Akbulut am<br />
5.4.2001 in der dritten Verhandlung<br />
schließlich freigesprochen. Der Vorwurf<br />
wegen angeblicher Volksverhetzung<br />
wurde überraschend fallen gelassen.<br />
Damit ist aber das Problem des Völkermordes<br />
an armenischen und syrischen<br />
Christen von 1915 noch längst nicht<br />
erledigt. Die türkische Regierung und<br />
die türkische Gesellschaft werden sich,<br />
wenn sie in die EU wollen, diesem<br />
besonderen Problem ihrer Vergangenheitsbewältigung<br />
stellen müssen. Schon<br />
lange wird gefordert, alle historischen<br />
Fakten und Dokumente der Öffentlichkeit<br />
zugänglich zu machen, damit die<br />
Vorgänge von 1915 aufgearbeitet und<br />
neu bewertet werden können. Dann<br />
müssen auch die Bestimmungen aus<br />
dem „Lausanner Vertrag“ von 1923<br />
anerkannt werden, in denen den<br />
nichtmuslimischen Bürgern der Türkei<br />
Gleichstellung, religiöse Freiheit und<br />
Toleranz zugestanden werden. Leider ist<br />
die heutige Realität in der Türkei noch<br />
weit entfernt von diesem damals<br />
wegweisenden Vertrag.<br />
Begegnungen mit Zeitzeugen<br />
Im Rahmen meiner Besuche im Tur<br />
Abdin und im Nordirak bin ich 1999 im<br />
armenischen Dorf Azverok im Nordirak<br />
auf Nachkommen von Überlebenden<br />
gestoßen, die 1915 ihr Leben retten<br />
konnten und in den heutigen Nordirak<br />
geflüchtet waren. Unsere Landeskirche<br />
hat diesen armenischen Christen den<br />
Bau einer <strong>Kirche</strong> ermöglicht, um ihren<br />
Glauben wieder feiern zu können, denn<br />
1991 wurde ihre <strong>Kirche</strong> vom irakischen<br />
Diktator<br />
Saddam<br />
zerstört.<br />
Vor Jahren<br />
begegnete ich<br />
im Dorf<br />
Ayinvert im<br />
Tur Abdin<br />
einer alten<br />
Frau – sie ist<br />
inzwischen<br />
gestorben –<br />
die mir<br />
folgendes<br />
erzählte: „Sieh dir diese <strong>Kirche</strong> an. Sie<br />
war 1915 Zufluchtsort von tausenden<br />
von Christen, die ihr Leben vor den<br />
Jungtürken retten konnten“. Sie hielt<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 7
inne und schaute uns traurig an, dann<br />
sagte sie: „Ich war ein Kind und weiß<br />
noch, wie die Menschen sich damals in<br />
unsere <strong>Kirche</strong> flüchteten. Ich kann das<br />
nicht vergessen. Die Angst von damals<br />
steckt in mir bis heute; sie steckt in uns<br />
allen, die wir Christen sind und im Tur<br />
Abdin leben“. Ich stand einer Zeitzeugin<br />
gegenüber, die das „Jahr des Schwertes“<br />
miterlebt hatte.<br />
Neue Entwicklung: Rückkehr<br />
Jahre nach dieser Begegnung gibt es<br />
eine neue und hoffnungsvolle Entwicklung<br />
im Tur Abdin, die sicher ein neues<br />
Kapitel nach all den dunklen Jahren<br />
aufschlägt – vor Jahren hätte niemand<br />
auch nur davon geträumt: Familien, die<br />
ihr Land und ihre Dörfer vor 20 oder 30<br />
Jahren aus Angst verlassen haben,<br />
kehren wieder zurück an den Ort, wo<br />
ihre Wurzeln liegen. „Rückkehr“ ist das<br />
geheime Zauberwort, das gegenwärtig<br />
unter den Assyrern und Aramäer im<br />
westlichen Ausland heiß und kontrovers<br />
diskutiert wird. Die politische Situation<br />
ist entspannter und ruhiger geworden,<br />
die ehemaligen militärischen Auseinandersetzungen<br />
zwischen PKK und<br />
türkischem Militär sind beendet, die<br />
Anstrengungen der Türkei, in die EU zu<br />
kommen, sind auch im Tur Abdin von<br />
den syrischen Christen zu spüren. Was<br />
noch fehlt, ist eine Garantie ihrer<br />
Menschenrechte, so wie sie im Lausanner<br />
Vertrag 1923 festgelegt wurden,<br />
und damit auch eine Anerkennung als<br />
religiöse und ethnische Minderheit. Das<br />
wird aber hoffentlich noch Wirklichkeit<br />
werden!<br />
Die Assyrer heute führen ihre Existenz auf<br />
die altorientalischen Völker der Assyrer,<br />
Chaldäer und Aramäer in Mesopotamien,<br />
dem heutigen Irak zurück. Sie sind Christen<br />
und gehören vor allem vier <strong>Kirche</strong>n an:<br />
„Der Heiligen <strong>Kirche</strong> des Ostens“ (assyrische<br />
<strong>Kirche</strong>, nestorianisch), der „<strong>Kirche</strong><br />
von Antiochien“ (jakobitisch oder syrisch<br />
orthodox), der Chaldäisch Katholischen<br />
<strong>Kirche</strong> und der Syrisch Katholischen <strong>Kirche</strong>.<br />
Wenn von „syrischen Christen“ gesprochen<br />
wird, dann erinnern wir uns an<br />
die ursprüngliche Bezeichnung „Süriani“<br />
für die „ersten Christen“ in Antiochia<br />
(Apost.. 11, 26). Sie sprechen bis heute<br />
einen Dialekt des Aramäischen, der Muttersprache<br />
Jesu.<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Pfarrer i.R. Horst Oberkampf<br />
berichtet unter www.nordirakturabdin.de<br />
über seine Reisen in<br />
die Türkei und den Nordirak<br />
Getürkte Realitäten<br />
Pünktlich zum 90-jährigen Gedenken<br />
des Genozids an den Armeniern ist ein<br />
Buch erschienen, das den gegenwärtigen<br />
Stand der historischen Forschung in<br />
spannender Weise darstellt. Allerdings<br />
führt der Titel insofern in die Irre, als die<br />
Aktionen der armenischen Untergrundorganisation<br />
„Operation Nemesis“<br />
mit dem Attentat auf führende türkische<br />
Kriegsverbrecher nur die Einführung<br />
und den Schluss ausmachen. Im<br />
Hauptteil wird ausführlich mit schrecklichen<br />
Details geschildert, wie schon<br />
1895, aber dann vor allem ab 1915<br />
Armenier in den verschiedensten<br />
Landesteilen systematisch vertrieben<br />
und vernichtet wurden. Rolf Hosfeld<br />
arbeitet insbesondere die deutsche<br />
Beteiligung heraus, da das Kaiserreich<br />
alle kritischen Nachrichten unterdrückte,<br />
um im Ersten Weltkrieg den wichtigen<br />
Bundesgenossen nicht zu verlieren.<br />
Es wird aber auch klar, dass die türkische<br />
Rechtfertigung, es habe sich um<br />
notwendige Kriegshandlungen gehandelt,<br />
nur Zweckpropaganda ist. Denn<br />
der Wille zur Vernichtung ist viel älter.<br />
Der Krieg war eine willkommene<br />
Gelegenheit, unbehelligt von den<br />
Großmächten mit einer unbequemen<br />
Minderheit endlich „aufzuräumen“. Der<br />
historisch interessierte Leser, der einige<br />
Schriften von Johannes Lepsius oder<br />
Armin T. Wegner kennt, erfährt noch<br />
Neues. So kennen viele den Roman von<br />
Franz Werfel „Die vierzig Tage des<br />
Musa Dagh“, aber nicht die tatsächliche<br />
Geschichte. Sein wichtigster Zeitzeuge<br />
und Organisator des Widerstands war<br />
nämlich der protestantische Pastor<br />
Dikran Andreasian. So setzt der Autor<br />
vielen Menschen ein Denkmal, deren<br />
Namen keiner mehr kennt.<br />
Das „Nachspiel“ des Völkermords ist<br />
mindestens so deprimierend wie die<br />
Mordgeschichten selbst. Nachdem sich<br />
die Hauptverantwortlichen abgesetzt<br />
hatten, verurteilte sie ein osmanisches<br />
Gericht zum Tode. Von den siebzehn<br />
Todesurteilen werden aber nur drei<br />
vollstreckt. Die Vorstellung des zuständigen<br />
Staatsanwalts bei der Eröffnung des<br />
Hauptverfahrens geht nicht in Erfüllung:<br />
„Die unschuldig Ermordeten werden<br />
wieder auferstehen“. Mustafa Kemal,<br />
genannt Atatürk, löst die Gerichte, die<br />
sich mit dem Völkermord befassen,<br />
1920 auf. In seiner Tradition wird das<br />
Verbrechen bis heute von der türkischen<br />
Regierung geleugnet. Die Hauptverantwortlichen<br />
wurden rehabilitiert und mit<br />
Ehren beigesetzt. Zuletzt erhält 1996<br />
der ehemalige Kriegsminister des<br />
Osmanischen Reiches, Enver Pascha, auf<br />
dem Freiheitshügel in Istanbul ein<br />
posthumes Staatsbegräbnis. Initiator der<br />
Rehabilitierung Envers war übrigens der<br />
damalige islamistische Bürgermeister<br />
von Istanbul und jetzige Ministerpräsident<br />
Recap Tayyip Erdogan. Doch es<br />
gibt auch kritische Stimmen. Der<br />
türkische Journalist Murat Belge bekennt:<br />
„Wir haben die ethnischen<br />
Säuberungen erfunden“. Er fügt hinzu:<br />
„Ich behaupte, die Fortsetzung der<br />
Leugnungspolitik der Türkei widerspricht<br />
ihren nationalen Interessen. Der<br />
Grund für diese Behauptung ist sehr<br />
einfach: weil sie falsch ist. Jede Politik,<br />
die auf falschen Prämissen beruht, ist<br />
dazu verdammt, über kurz oder lang in<br />
sich zusammenzufallen.“<br />
Die Leugner des Völkermordes kann<br />
man fragen, wo denn die Armenier<br />
geblieben seien, deren Siedlungsgebiete<br />
man noch aufspüren kann. 1913 lebten<br />
im Osmanischen Reich auf dem Gebiet<br />
der heutigen Türkei 1.834.900 Armenier,<br />
zur Zeit der Gründung der Türkischen<br />
Republik 1923 waren es noch<br />
300.000, heute sind es 60.000. Selbst<br />
wenn man Auswanderung einbezieht,<br />
schwanken die Opferzahlen zwischen<br />
800.000 und 1,4 Millionen. Der Autor<br />
nennt viele Dörfer und Städte, wo<br />
Armenier gelebt haben. Kein moderner<br />
Reiseführer erwähnt das. Sollte man<br />
nicht einmal einen „alternativen<br />
Baedeker“ herausgeben, mit dem der<br />
heutige Tourist die Spuren der Opfer<br />
finden kann? Bisher muss man sich mit<br />
dem nur antiquarisch erhältlichen Buch<br />
von Johannes Lepsius „Der Todesgang<br />
des Armenischen Volkes“ von 1927<br />
begnügen, der alle Orte detailliert<br />
auflistet.<br />
In jedem Dorf der Türkei gibt es mindestes<br />
ein Denkmal für den Massenmörder<br />
Mustafa Kemal. Wann wird es dort ein<br />
einziges Denkmal für die umgekommenen<br />
Armenier geben? Wann werden<br />
Türken auch hierzulande Trauer und<br />
Scham über den Genozid an den<br />
Armeniern ausdrücken? Sollte man<br />
nicht auch bei uns wie in der kleinen<br />
mutigeren Schweiz die Leugnung dieses<br />
Genozids unter Strafe stellen?<br />
Wolfgang Wagner<br />
Rolf Hosfeld, Operation Nemesis.<br />
Die Türkei, Deutschland und der<br />
Völkermord an den Armeniern.<br />
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln<br />
<strong>2005</strong>, 351 Seiten, 19,90 Euro.<br />
Seite 8 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
Kirchliche Arbeit in der Polizei<br />
Eva-Maria Agsteri<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Gehört die <strong>Kirche</strong> in die Polizei? Was hat sie dort überhaupt zu suchen,<br />
nachdem die Zeiten der Vergangenheit angehören, in denen Thron und Altar<br />
oft mehr unheilige denn heilige Verbindungen eingegangen sind? Was ist der<br />
Evangelischen Landeskirche in Württemberg an der „Kirchlichen Arbeit in der<br />
Polizei“ so wichtig, dass sie seit 1962 Jahr für Jahr in die damit verbundenen<br />
Aufgaben investiert? Das heißt vor allem in die Gehälter der beiden hauptamtlichen<br />
PolizeipfarrerInnen und der nach den Kürzungsrunden übrig gebliebenen<br />
einen Sekretärin sowie den bis zum kommenden Sommer begrenzten<br />
halben Dienstauftrag eines Pfarrers z. A., der in einem entscheidenden<br />
Entwicklungsstadium den Ausbau der Notfallseelsorge konzeptionell und<br />
strukturell voranbringen soll (siehe OK 1/2003).<br />
Ich will diesen Fragen mit dem Blick auf<br />
drei Säulen kirchlicher Arbeit in der<br />
Polizei nachgehen.<br />
1. Polizeiseelsorge<br />
Als ich vor viereinhalb Jahren die<br />
Aufgabe der Polizeiseelsorgerin auf der<br />
geschäftsführenden Stelle im Polizeipfarramt<br />
unserer Landeskirche übernommen<br />
habe, wurde mir sehr schnell<br />
deutlich, dass die Frage nach dem, was<br />
die <strong>Kirche</strong> eigentlich in der Polizei zu<br />
suchen hat, nicht getrennt werden kann<br />
von der Erkenntnis, was <strong>Kirche</strong> dort<br />
finden kann: Menschen, die überwiegend<br />
mit den dunklen, schmutzigen,<br />
blutenden, stinkenden, verlogenen,<br />
ohnmächtig aggressiven und skrupellos<br />
gewaltbereiten sowie oft im wahrsten<br />
Sinn himmelschreienden Seiten unserer<br />
Gesellschaft in Berührung sind. Stellvertretend<br />
für uns alle und in einem Maß,<br />
dass der einzelne Polizist, die einzelne<br />
Polizistin manchmal nicht mehr weiß,<br />
wie er, wie sie das aushalten kann.<br />
Diesen Menschen ist die <strong>Kirche</strong> in<br />
seelsorglicher Bringschuld verpflichtet.<br />
Seelsorge heißt für uns PolizeipfarrerInnen,<br />
den Bediensteten in der Polizei den<br />
Rücken zu stärken sowohl in persönlichen<br />
Krisen als auch in belastenden<br />
Situationen ganzer Organisationseinheiten.<br />
Etwa wenn ein Kollege sich<br />
das Leben genommen hat (womöglich in<br />
den Diensträumen und mit der Dienstwaffe),<br />
nach extrem belastenden<br />
Einsätzen an Unfallorten, wenn – Gott<br />
sei Dank ist das selten, dann aber meist<br />
unter skandalierenden Blicken – Polizisten<br />
die Schusswaffe benutzt haben oder<br />
sie in Ausübung ihres Dienstes Opfer<br />
von Gewalt geworden sind. Polizeiseelsorge<br />
heißt auch: Schuld und<br />
Schuldgefühle mit PolizistInnen auszuhalten<br />
und daran mitzuwirken, dass ein<br />
Leben mit dem, was nicht mehr rückgängig<br />
gemacht werden kann, neu<br />
möglich wird. Das fängt nicht erst beim<br />
oft schwer traumatisierenden Gebrauch<br />
der Pistole an. Wer mit Verletzung und<br />
Tod in schrecklichen Ausprägungen so<br />
hautnah und häufig im Kontakt ist wie<br />
im Streifendienst und in entsprechenden<br />
Abteilungen der Kriminalpolizei, kann<br />
heftig umgetrieben werden von der<br />
Frage nach Gottes A(b)nwesenheit.<br />
Einige PolizistInnen verzweifeln daran.<br />
Manche entledigen sich in zynischer<br />
Schutzhaltung aller religiösen Deutungsversuche<br />
und wieder andere spüren in<br />
diesen Grenzsituationen menschlichen<br />
Lebens eine Berührung mit dem, was<br />
das Leben wesentlich macht und mit der<br />
leisen oder laut drängenden Frage nach<br />
dem, was das Leben eigentlich trägt.<br />
Wir PolizeipfarrerInnen wagen immer<br />
wieder stellvertretend das Vertrauen,<br />
dass jenseits unseres begrenzten Horizontes<br />
Gottes Anwesenheit in den<br />
Leidenden und Getöteten geglaubt<br />
werden kann. Dieses Vertrauen bringen<br />
wir ein. Nicht selten unter eigenen<br />
seelischen Qualen und immer wieder<br />
selbst ohnmächtig, traurig oder wütend<br />
angefochten. Aber vor allem auch<br />
bereichert durch das, was wir an<br />
Standfestigkeit von den Menschen im<br />
Polizeidienst lernen können. Wir<br />
versuchen in gut evangelischer Manier,<br />
eine „Kultur des Schmerz-Aushaltens“<br />
(Dr. Raphael Behr, bei der Ökumenischen<br />
Jahrestagung 2002, zwei Tage<br />
nach dem Flugzeugabsturz am Bodensee)<br />
zu entwickeln und in die Polizei<br />
einzubringen. Dass dies der Polizei gut<br />
tut, wird uns oft bestätigt. Im Grunde<br />
stellt sich in diesem Zusammenhang die<br />
Frage nicht wirklich, was bzw. wen<br />
unsere <strong>Kirche</strong> in der Polizei zu suchen<br />
hat. Von Haus aus <strong>Kirche</strong>nferne oder<br />
PolizeischülerInnen in der Vesperkirche<br />
dem Glauben entfremdete Menschen<br />
tun in belastenden Situationen selten<br />
von sich aus den Schritt in eine Ortsgemeinde,<br />
die für sie weit weg ist von<br />
dem, was auf der Straße passiert.<br />
Aufsuchend präsent zu sein, wo andere<br />
ihren Kopf und ihr mutiges, wie ihr<br />
geängstetes Herz den Katastrophen<br />
unserer Welt hinhalten und so nicht<br />
selten selbst Teil der Katastrophe<br />
werden, sieht die <strong>Kirche</strong> als ihre<br />
Aufgabe an. Vor allem dort, wo Gottesbilder<br />
zerbrechen (müssen), sich<br />
finsterste Täler auftun und der Boden<br />
unter den Füßen wankt.<br />
Prof. Dr. Isolde Karle machte bei der<br />
Ökumenischen Jahrestagung für Polizei<br />
und <strong>Kirche</strong> 2004 darauf aufmerksam,<br />
dass wir in der Polizei auf Menschen<br />
treffen, die unsere christlich-jüdische<br />
Tradition gut kennt. In den Klage- und<br />
Rachepsalmen kommen sie zu Wort: Die<br />
ohnmächtig Wütenden und Gekränkten;<br />
die, die ahnen, dass weder die eigene<br />
noch weltlich-staatliche Macht ihrem<br />
verletzten Gerechtigkeitsempfinden<br />
Genugtuung verschaffen kann. Die<br />
<strong>Kirche</strong> begegnet – wenn sie sich auf die<br />
Menschen in der Polizei einlässt – sehr<br />
oft denen, die Jesus selig gepriesen hat:<br />
denen, die hungern und dürsten nach<br />
Gerechtigkeit. Der Schatz und der<br />
Schutz des Seelsorgegeheimnisses ist in<br />
einer Organisation, deren Mitarbeitende<br />
dem Strafverfolgungszwang unterworfen<br />
sind, eine besonders große Chance.<br />
Die Arbeit der Polizeiseelsorge hat<br />
meiner Einschätzung nach in den<br />
letzten Jahrzehnten gezeigt, wie viel<br />
Entlastung und welche not-wendige<br />
Würdigung Menschen erfahren, wenn<br />
ihre seelischen Qualen ohne Wertung<br />
ernst- und wahrgenommen werden. Ein<br />
neues Online-Seelsorge-Angebot für die<br />
Polizei will auch niederschwellig die<br />
Möglichkeiten dazu öffnen. Ein Netzwerk<br />
polizeiinterner Hilfsangebote ist in<br />
den letzten Jahren entstanden. In den<br />
Kriseninterventions-Teams der Polizei<br />
sind die Polizeiseelsorgen beider großen<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 9
<strong>Kirche</strong>n integriert. Die internen Angebote<br />
entlasten die Seelsorgearbeit in ihrer<br />
Beratungsfunktion, die allein durch die<br />
geographische Ausdehnung der Zuständigkeit<br />
und in ihrer Fülle immer wieder<br />
grenzwertig belastend war und ist.<br />
So kann die Seelsorge ihre Schwerpunkte<br />
in Zukunft hoffentlich noch etwas<br />
erweitern und mehr spirituell stärkende<br />
Angebote einbringen. Die ökumenisch<br />
verantwortete Fastenwanderung für<br />
Studierende an der Fachhochschule war<br />
überbucht, die so genannten Sportexerzitien<br />
eines katholischen Kollegen<br />
sind es seit Jahren. Ein erstmals vom<br />
Evangelischen Polizeipfarramt ausgeschriebenes<br />
Schweigeseminar im Stift<br />
Urach wurde in der ersten Woche der<br />
Ausschreibung intensiv nachgefragt. Ich<br />
denke, dass es auch eine spirituelle<br />
Aufgabe sein wird, noch mehr als bisher<br />
schon nebenher, bewusst Räume zur<br />
Versöhnung zwischen Polizei und<br />
Bevölkerung zu schaffen, Gräben zu<br />
überwinden. Ich denke etwa an Polizisten,<br />
die in Mutlangen eingesetzt waren,<br />
und denen, die dort demonstriert haben.<br />
2. Berufsethik<br />
Kirchliche Arbeit in der Polizei geschieht<br />
in einer „Organisation mit Gewaltlizenz“<br />
(Jan Philipp Reemtsma), in der<br />
sich die Frage nach der „Kultur des<br />
Gewaltmonopols“ immer neu stellt.<br />
„Eine kontroverse Debatte über die<br />
Kultur des Gewaltmonopols unterscheidet<br />
...eine demokratisch legitimierte<br />
Polizei von anderen Polizeien. Und der<br />
<strong>Kirche</strong> steht es gut zu Gesicht, diese<br />
Kontroverse zu befördern bzw. zu<br />
moderieren“, so der ehemalige Polizist<br />
und Soziologe Raphael Behr. Wie das<br />
Gewaltmonopol in unserer Gesellschaft<br />
durch die Polizei wahrgenommen wird,<br />
ist eine entscheidende Frage für die<br />
Qualität des Zusammenlebens in einer<br />
Demokratie, in der die Achtung der<br />
Menschenwürde nicht angetastet<br />
werden soll und einklagbar ist. Im<br />
Verhaltenskodex für Beamte mit<br />
Polizeibefugnissen (1979 bei der<br />
Vollversammlung der UN verabschiedet)<br />
heißt es: „Beamte mit Polizeibefugnissen<br />
sollen Gewalt nur anwenden, wenn dies<br />
unbedingt notwendig ist und in dem<br />
Ausmaß, wie dies in Ausübung ihrer<br />
Pflicht notwendig ist“.<br />
Was heißt das für eine junge Polizistin,<br />
die bis aufs Äußerste gereizt und<br />
gedemütigt worden ist? Was heißt das<br />
für einen gestandenen Polizisten, den<br />
angesichts eines erkennbar gefährlichen<br />
Gegenübers die berechtigte Angst<br />
überfällt? Was bedeutet das im Rahmen<br />
einer Organisation, in der Einzelne ihre<br />
Kraft und Akzeptanz zum Durchhalten<br />
überwiegend durch den Rückhalt in der<br />
eigenen Gruppe, die in ihnen geltenden<br />
Normen und Regeln erfahren („cop<br />
culture“)? Solchen und anderen Fragen<br />
geht die Kirchliche Arbeit in der Polizei<br />
in ihren berufsethischen Angeboten<br />
nach: Wie überbringe ich eine Todesnachricht?<br />
Wie verhalte ich mich an<br />
einem Ort, an dem Menschen verletzt<br />
sind oder sterben? Wie kann ich einen<br />
angemessenen Umgang mit Opfern<br />
gestalten? Wie können wir seelisch<br />
gesund bleiben oder wieder werden?<br />
Wie können Frauen ihre Stärke in der<br />
Polizei leben? Sich das Leben nehmen?<br />
Wie geht Polizei mit all dem um, was<br />
Abschiebungen mit sich bringen?<br />
Berufsethik ist Teil eines vernetzten<br />
Gesamtsystems der polizeilichen Ausund<br />
Fortbildung. Der Unterricht an den<br />
Polizeischulen und an der FH in<br />
Villingen-Schwenningen sowie an der<br />
Akademie der Polizei in Freiburg findet<br />
gemäß der 2002 unterzeichneten<br />
Vereinbarung zwischen den <strong>Kirche</strong>n<br />
und dem Land Baden-Württemberg<br />
statt. Durch die Vergütungen meines<br />
berufsethischen Unterrichts an der<br />
Polizeischule in Göppingen und der FH<br />
in Villingen-Schwenningen wird ein Teil<br />
der Kosten für das Polizeipfarramt<br />
refinanziert.<br />
3.Gremienarbeit auf politischer Ebene<br />
Viele Probleme, die den PolizeipfarrerInnen<br />
in ihrer Seelsorge begegnen, haben<br />
auch eine politische Dimension und<br />
müssen darum auf der politischen Ebene<br />
und mit der Polizeiführung besprochen<br />
werden. Alle vier <strong>Kirche</strong>n in Baden-<br />
Württemberg verantworten gemeinsam<br />
diese Arbeit und haben sich dafür<br />
Strukturen gegeben im Kontakt mit der<br />
Polizeiführung. Auf Bundesebene haben<br />
sowohl die Evangelische wie die<br />
Katholische <strong>Kirche</strong> entsprechende<br />
Gremien. So hat z.B. die Evangelische<br />
Landeskirche in Württemberg zwei<br />
Stimmen in der Konferenz Evangelischer<br />
PolizeipfarrerInnen in Deutschland<br />
(KEPP). Jüngste Frucht der KEPP-Arbeit<br />
war ein Weihnachtsgottesdienst für die<br />
PolizeibeamtInnen, die im Kosovo<br />
Dienst tun.<br />
Der Zusammenarbeit von <strong>Kirche</strong> und<br />
Polizei wird oft mit Vorbehalt begegnet,<br />
außerhalb wie innerhalb der Polizei. Ich<br />
möchte mit einem Auszug aus einer<br />
Rede, die ich bei der Unterzeichnung<br />
der neuen Vereinbarung zwischen Land<br />
und <strong>Kirche</strong> in Löwenstein gehalten<br />
habe, schließen. Sie greift diesen<br />
Vorbehalt auf: „Eine Partnerschaft ist<br />
kein unangemessener Schulterschluss,<br />
wie immer wieder argwöhnisch vermutet<br />
wird. Bei einer Partnerschaft kann<br />
sich im Gegensatz zum Schulterschluss<br />
wirkliche Begegnung ereignen. Die<br />
Kultur von <strong>Kirche</strong> und Polizei können<br />
sich begegnen. Es ist Raum für Solidarität<br />
und Kritik. Was eine Partnerschaft im<br />
Gegensatz zum Schulterschluss auszeichnet,<br />
hat der im Libanon geborene<br />
Philosoph Kahil Ghibran in einem Text<br />
folgendermaßen beschrieben:<br />
... lasst Raum zwischen euch.<br />
Und lasst die Winde des Himmels<br />
zwischen euch tanzen...<br />
Steht nicht zu nah beisammen,<br />
denn die Säulen des Tempels stehen für<br />
sich,<br />
und die Eiche und die Zypresse wachsen<br />
nicht<br />
im Schatten der anderen.<br />
Die Vereinbarung lässt Raum zwischen<br />
der <strong>Kirche</strong>nkultur und der Kultur in der<br />
Polizei. So kann etwas weiterwachsen<br />
zwischen uns, was sich seit 40 Jahren<br />
zu entfalten begonnen hat. Ob die<br />
Winde des Himmels zwischen uns<br />
tanzen können, sagt die Vereinbarung<br />
nicht. Hoffen können wir es.“<br />
Mit der Kirchlichen Arbeit in der Polizei<br />
ist es wie mit der Notfallseelsorge:<br />
Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie<br />
erfinden, sagte sinngemäß ein polizeiliches<br />
Mitglied im neu geschaffenen<br />
Beirat unserer Landeskirche für die<br />
Kirchliche Arbeit in der Polizei. Man<br />
müsste sie erfinden, auch, damit <strong>Kirche</strong><br />
nah bei denen ist, die Jesus selig preist.<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
<strong>Kirche</strong>nrätin Agster bietet Vorträge<br />
in Gemeinden an zum Thema:<br />
„Was tut die <strong>Kirche</strong> in der Polizei?“<br />
Der Text der Vereinbarung zwischen<br />
Land und <strong>Kirche</strong>n kann beim Ev.<br />
Polizeipfarramt bezogen werden (bitte<br />
einen frankierten Umschlag beilegen).<br />
Kontakt: Evangelisches Polizeipfarramt,<br />
Ecklenstraße 20, 70184 Stuttgart<br />
Tel.: (07 11) 46 20 01; Email: Eva-<br />
Maria.Agster@t-online.de<br />
Seite 10 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
Auf dem Weg zu einer Lösung der<br />
Weltwasserkrise?<br />
Auf dem Milleniumsgipfel der Vereinten<br />
Nationen wurden die so genannten<br />
Millenium Development Goals (MDG)<br />
beschlossen. Eines der Ziele lautet, dass<br />
bis zum Jahr 2015 die Anzahl der<br />
Menschen ohne Zugang zu ausreichendem<br />
und sauberem Trinkwasser halbiert<br />
werden soll. Derzeit leiden etwa 1,2<br />
Milliarden Menschen weltweit unter<br />
unzureichendem Trinkwasserzugang.<br />
Will man dieses Ziel tatsächlich erreichen,<br />
müssen jeden Tag 280.000<br />
Menschen einen Zugang zu Trinkwasser<br />
erhalten – eine stolze Zahl. Und die<br />
Vereinten Nationen sind sich durchaus<br />
bewusst, dass dieses Ziel nicht im<br />
Vorbeigehen eben mal so mitgenommen<br />
werden kann. Das Jahr 2003 haben die<br />
Vereinten Nationen zum UN-Jahr des<br />
Süßwassers deklariert, ein Jahr später<br />
hat der UN-Generalsekretär Kofi Annan<br />
einen Wasserbeirat ins Leben gerufen,<br />
der ihn und seine Organisation dabei<br />
unterstützen soll, nach Wegen aus der<br />
Bernhard Wiesmeieri<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Am 22. März <strong>2005</strong> begann die neue UN-Wasserdekade „Water for Life“. Zehn<br />
Jahre lang sollen alle Anstrengungen der Vereinten Nationen sowie der Staaten<br />
darauf ausgerichtet werden, die Wasserkrise in den Griff zu bekommen.<br />
Während die internationale Wasserbewegung immer größer wird, wird über<br />
die Lösungsansätze weiter heftig gestritten. „Brot für die Welt“ hat mit seiner<br />
Kampagne „Menschenrecht Wasser“ schon vor zwei Jahren das Thema<br />
aufgegriffen und maßgeblich an der nationalen und internationalen Vernetzung<br />
der Wasserbewegung mitgestrickt. Ebenso wichtig ist es aber auch, das Thema<br />
Wasser hierzulande auf die Agenda zu bringen und politische Entscheidungsträger<br />
dafür zu gewinnen, sich für das Menschenrecht auf Wasser stark zu<br />
machen.<br />
globalen Wasserkrise zu suchen. Und<br />
wieder ein Jahr später haben die Vereinten<br />
Nationen die Wasserdekade „Water<br />
for Life“ eröffnet. Eindringlich weist die<br />
Staatengemeinschaft darauf hin, dass die<br />
Lösung der Wasserkrise den Schlüssel<br />
zur Armutsbekämpfung und zu neuen<br />
Entwicklungschancen darstellt. Dabei ist<br />
die Verkündung einer UN-Wasserdekade<br />
noch lange keine Erfolgsgarantie.<br />
Die erste Wasserdekade von 1980 bis<br />
1989 hatte sich sogar zum Ziel gesetzt,<br />
am Ende der Dekade allen Menschen<br />
ausreichendes Wasser zur Verfügung zu<br />
stellen. Sie war kläglich gescheitert.<br />
Auch zum jetzigen Zeitpunkt ist längst<br />
nicht klar, ob die MDGs erreicht<br />
werden können. Im September wird in<br />
New York eine erste Evaluierung dazu<br />
stattfinden. Schon zuvor haben UNICEF<br />
und WHO eine erste Zwischenbilanz<br />
gezogen. Das Ergebnis: Auch fünf Jahre<br />
nach der Verkündung der MDGs sind<br />
über eine Milliarde Menschen ohne<br />
Wasserzugang. Erfolgen in manchen<br />
Staaten Asiens stehen massive Probleme<br />
in den meisten afrikanischen Ländern<br />
gegenüber.<br />
Wie so oft wird dabei auch ums Geld<br />
gestritten. Die Angaben, wie viel Kosten<br />
mit einer Lösung der Wasserkrise<br />
verbunden sind, gehen dabei enorm<br />
auseinander. Während der Weltwasserrat,<br />
der eng mit der Weltbank und<br />
großen privatwirtschaftlichen Unternehmen<br />
liiert ist, von einem Volumen von<br />
rund 100 Mrd. US-Dollar spricht,<br />
wurden auf der Süßwasserkonferenz in<br />
Bonn im Dezember 2001 schon ein<br />
Zehntel dieses Betrages als ausreichend<br />
betrachtet. Im Mittelpunkt steht dabei<br />
die Frage, ob große, teure und technologieintensive<br />
Maßnahmen, unter<br />
Berücksichtigung der Privatwirtschaft<br />
von Nöten sind oder eben lokal angepasste<br />
Niedrigkostenlösungen. Klar ist<br />
indes, dass Geld nötig sein wird. In<br />
einer Studie, die er für die Vereinten<br />
Nationen erstellt hat, hat Geoffrey Sachs<br />
gefordert, dass sich die internationale<br />
Entwicklungshilfe schrittweise erhöhen<br />
muss – anders sei die Krise nicht zu<br />
meistern. Bis zum Jahr 2010 sollten alle<br />
Staaten ihre Gaben auf mindestens 0,55<br />
Prozent des Bruttosozialproduktes<br />
steigern. In Deutschland liegt der Anteil<br />
derzeit bei ca. 0,34 Prozent – und<br />
Finanzminister Eichel hat erst vor<br />
kurzem nochmals betont, dass eine<br />
Erhöhung nicht in Frage kommt.<br />
Menschenrecht oder Ware?<br />
An der von Weltbank, verschiedenen<br />
bilateralen Entwicklungsgebern und<br />
nicht zuletzt vom Weltwasserrat (Der<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 11
Weltwasserrat organisiert zusammen mit<br />
Weltbank und anderen die alle drei<br />
Jahre stattfindenden Weltwasserforen;<br />
dort sind auch die Global Player im<br />
Wasserbereich stark vertreten.) favorisierten<br />
Privatisierung der Wasserversorgung,<br />
als Lösungsansatz scheiden sich<br />
die Geister. Noch ist der Anteil privatisierter<br />
Wasserversorgungseinrichtungen<br />
geringer als zehn Prozent, dennoch<br />
sehen viele Unternehmen hierin einen<br />
zukunftsträchtigen Markt. Die bisher<br />
damit gesammelten Erfahrungen zeigen,<br />
dass die Skepsis vieler Privatisierungskritiker<br />
durchaus berechtigt ist. Ob in<br />
Manila, der Hauptstadt der Philippinen,<br />
in Cochabamba (Bolivien) oder Buenos<br />
Aires – überall hat die Privatisierung<br />
ähnliche Ergebnisse gebracht: Das<br />
Wasser wurde erheblich teurer, die<br />
Investitionen der privaten Akteure<br />
blieben weit hinter den Erwartungen<br />
zurück und die Qualität und der Service<br />
wurden schlechter. Erfahrungen, die<br />
zum Teil auch in den Industrieländern<br />
gemacht wurden. In England stiegen die<br />
Preise nach der Privatisierung 1989, in<br />
Atlanta (USA) wurden 400 von 700<br />
MitarbeiterInnen vom privaten Akteur<br />
entlassen, was zu einer Verschlechterung<br />
des Service geführt hat und in<br />
Berlin haben RWE und Veolia bei der<br />
Teilprivatisierung der Wasserwerke eine<br />
jährlich festgeschriebene Rendite von<br />
acht Prozent mit dem Land Berlin<br />
vereinbart – und das, obwohl Berlin<br />
ohnehin zu den am höchsten verschuldeten<br />
deutschen Bundesländern gehört.<br />
Aktuell erregt der Fall von El Alto in der<br />
Wasserszene Aufmerksamkeit. Die<br />
EinwohnerInnen der zweitgrößten<br />
bolivianischen Stadt in der Nähe der<br />
Hauptstadt La Paz haben im Januar den<br />
privaten Versorger aufgefordert, die<br />
Konzession zurückzugeben. Hintergrund<br />
waren enorme Preisanstiege bei<br />
den Wasseranschlüssen. Dabei ist auch<br />
die deutsche Entwicklungszusammenarbeit<br />
in die Kritik geraten. Nach<br />
Auskunft bolivianischer Nichtregierungsorganisationen<br />
hat die deutsche Botschaft<br />
darauf gedrängt, dass der ausländische<br />
Anbieter (SUEZ) weiter Anteile<br />
an der Wasserversorgung der Stadt<br />
behält – ansonsten würden sie die Stadt<br />
nicht mehr unterstützen. Der Ausgang<br />
ist noch völlig unklar. Pikant ist der Fall<br />
auch deswegen, weil<br />
El Alto von den Privatisierungsbefürwortern<br />
und nicht zuletzt vom<br />
Bundesministerium für<br />
wirtschaftliche Zusammenarbeit<br />
und Entwicklung<br />
als gelungenes<br />
Erfolgsbeispiel<br />
einer Wasserprivatisierung<br />
gelobt worden<br />
war.<br />
Wasserbewegung<br />
Die Zivilgesellschaft,<br />
die sich dagegen<br />
wehrt, dass auch<br />
Wasser zunehmend zu<br />
einer Handelsware<br />
wird, ist in den letzten<br />
Jahren stetig gewachsen<br />
– national wie<br />
international. „Brot für<br />
die Welt“ ist seit<br />
Beginn seiner Kampagne<br />
„Menschenrecht<br />
Wasser“ ein wichtiger<br />
Akteur der internationalen<br />
Wasserbewegung. Ausgehend<br />
vom Peoples World Water Forum in<br />
Delhi, bei dem im Januar 2004 über<br />
300 Aktive aus über 60 Ländern<br />
zusammengetroffen waren, vernetzten<br />
sich die lokalen und regionalen Gruppen.<br />
In Lateinamerika gründete sich das<br />
Netzwerk Red Vida, bei dem auch<br />
Partnerorganisationen von „Brot für die<br />
Welt“ aktiv sind, um das Menschenrecht<br />
auf Wasser auf ihrem Kontinent<br />
durchzusetzen. Erster Erfolg: In Uruguay<br />
entschieden sich die Menschen bei<br />
einem Referendum mit großer Mehrheit<br />
dafür, das Menschenrecht auf Wasser in<br />
die Verfassung aufzunehmen. Auf dem<br />
alternativen Weltwasserforum in Genf,<br />
das vom 16. bis 19. März <strong>2005</strong> stattfand,<br />
diskutierten TeilnehmerInnen aus<br />
aller Welt über Strategien zur Lösung<br />
der Wasserkrise, die auf dem menschenrechtsorientierten<br />
Ansatz basieren.<br />
Auch in Deutschland hat „Brot für die<br />
Welt“ gemeinsam mit anderen Organisationen<br />
eine Aktion ausgearbeitet, die<br />
einen Schutzdeich gegen Wasserprivatisierung<br />
bauen will. Gefordert wird<br />
u.a., dass die Entwicklungshilfegelder<br />
für die Verbesserung der Situation der<br />
Armen ausgegeben werden sollen und<br />
nicht, um Unternehmen beim Aufbau<br />
neuer Wassermärkte zu unterstützen.<br />
Wasser soll obendrein aus internationalen<br />
Handelsvereinbarungen ausgenommen<br />
bleiben und die EU soll darauf<br />
verzichten, Liberalisierungsforderungen<br />
im Wassersektor an andere Länder zu<br />
stellen.<br />
Neben der Netzwerkarbeit und der<br />
Lobbyarbeit hat „Brot für die Welt“ aber<br />
auch mit der Kampagne das Ziel, die<br />
Menschen hierzulande über die Wasserkrise<br />
zu informieren. Mit Erfolg: Viele<br />
<strong>Kirche</strong>ngemeinden haben in den<br />
vergangenen zwei Jahren das Thema<br />
„Wasser“ aufgegriffen und es auf lokaler<br />
Ebene umgesetzt. Viele Gemeinden<br />
fragen die Materialien nach, die im<br />
Rahmen der Kampagne entstanden sind.<br />
Und nachdem auf der letzten EKD-<br />
Synode der Beschluss gefasst wurde, die<br />
Kampagne zu unterstützen und <strong>Kirche</strong>ngemeinden<br />
aufgefordert werden, die<br />
Kampagne aufzugreifen, werden sich<br />
sicher noch mehr dafür einsetzen, dass<br />
Wasser das bleibt, was es ist: Gottes<br />
Gabe und ein Menschenrecht.<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Der Politologe Bernhard Wiesmeier<br />
arbeitet bei Brot für die Welt in der<br />
Kapagne „Menschenrecht Wasser“<br />
Seite 12 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
<strong>Kirche</strong>ngeschichte<br />
„Ist überall, wo Gott drauf steht,<br />
auch Gott drin?“<br />
Ein Gespräch mit Dr. Klaus W. Müller, einem der<br />
Mitautoren der Esslinger Erklärung von 1969<br />
Die verdrängte Frage nach der Mitte<br />
der Schrift<br />
Wir leiden unter den Erwartungen, die<br />
ein Großteil der Gemeinde an unser<br />
Verständnis der Bibel heranträgt. Wir<br />
können die Bibel nicht von vornherein<br />
als normatives Wort Gottes betrachten.<br />
Sie hat und gewinnt ihre Autorität nur<br />
durch ihre jeweilige Überzeugungskraft<br />
in der konkreten Situation.<br />
Unser Reden und Handeln als Theologen<br />
können wir nicht selbstverständlich<br />
aus der Bibel ableiten, sondern müssen<br />
uns in erster Linie an der gegenwärtigen<br />
gesellschaftlichen und individuellen<br />
Not orientieren. Bei der Bemühung,<br />
diese Not zu wenden, verstehen wir die<br />
Bibel als einen Gesprächspartner unter<br />
anderen. Das hätte etwa zur Folge, dass<br />
im Gottesdienst nicht mehr einer das<br />
Wort Gottes verkündigen kann, sondern<br />
dass in einem Gespräch gemeinsam<br />
nach dem in der Situation Notwendenden<br />
gesucht werden muss.<br />
(Presseerklärung der Württembergischen<br />
Vikarskonferenz 1969, in: akid<br />
4/69, S. 26)<br />
Für Müller hat sich die Lage, was das<br />
Verständnis der Bibel angeht, nicht<br />
wesentlich geändert. Der Spagat zwischen<br />
wissenschaftlicher Ausbildung an<br />
iHarry Waßmanni<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Die Esslinger Erklärung gehört in ihre Zeit. Sie atmet die Atmosphäre von 1968<br />
und 1969. Das macht Klaus W. Müller gleich zu Beginn unseres Gespräches<br />
deutlich. Er erinnert an die Gründung der „Kritischen <strong>Kirche</strong>“ (später „<strong>Offene</strong><br />
<strong>Kirche</strong>“), an den Rücktritt des von Konservativen im Vorfeld des Stuttgarter<br />
<strong>Kirche</strong>ntags „gemobbten“ Synodalpräsidenten Oskar Klumpp, an die heftigen<br />
Diskussionen um das Schriftverständnis auf dem Stuttgarter <strong>Kirche</strong>ntag und an<br />
die Synodenbegleitung „von oben“: Wie von der Besucherempore aus spontan<br />
erstellte Flugblätter die Redebeiträge kommentierten und die Synodalen z.T.<br />
„per Luftpost“ erreichten. Auch die Wahl von Helmut Claß zum Bischof gehört<br />
für Müller in das Umfeld der Esslinger Erklärung. Er galt als Brückenmensch,<br />
als einer, der es unternahm, die StudentInnen und VikarInnen ernst zu<br />
nehmen. Nach Müllers Erinnerung wollte die Esslinger Vikarskonferenz<br />
einen Beitrag zu einem angemessenen Verständnis des fragwürdig gewordenen<br />
und mißbrauchten Begriffs der Autorität erarbeiten. Dabei seien zwei Kernbereiche<br />
für die jungen TheologInnen besonders wichtig gewesen: 1. Wie ist<br />
die Autorität der Bibel zu beschreiben? und 2. Welche Autorität kommt<br />
bürgerlichen Lebensformen zu – und wie verhält sich dazu die kirchliche<br />
Kasualpraxis?<br />
der Uni und dem weit verbreiteten<br />
Bibelverständnis in der Gemeinde ist bis<br />
heute für die angehenden PfarrerInnen<br />
belastend. Genau das war der Ausgangspunkt<br />
und die Baustelle von Esslingen.<br />
Müller: „Solange das<br />
hermeneutische<br />
Problem nicht offen<br />
verhandelt wird,<br />
bestehe der gleiche<br />
Leidensdruck für<br />
PfarrerInnen weiter.“<br />
Ein offenes Gespräch<br />
über das Verständnis<br />
der Bibel aber<br />
bräuchte gegenseitiges<br />
Vertrauen, das<br />
Annehmen des<br />
Anderen als Christ<br />
und Christin. Vertrauen<br />
kann man nicht<br />
einfordern, es muss<br />
wachsen können. Es<br />
müsse „Arrangements<br />
für Vertrauen<br />
geben“, aber eben<br />
daran, so Müller,<br />
mangele es bis heute.<br />
Zwar habe sich die<br />
Theologie und<br />
Predigtpraxis weithin<br />
auf eine allegorische Bibellektüre<br />
eingelassen. Müller beobachtet auch so<br />
etwas wie eine „Wiederentdeckung der<br />
Erzählung“. Dies sei begrüßenswert,<br />
weil Erzählungen den menschlichen<br />
Erfahrungen besonders nahe sind, um<br />
die es beim Glauben geht. Aber sowohl<br />
im Blick auf Erzählungen als auch<br />
insbesondere, wenn es um ethische<br />
Texte geht, sei das hermeneutische<br />
Problem weiter virulent. Wie verstehen<br />
wir heute den biblischen Dualismus von<br />
Gut und Böse? Oder Phänomene wie<br />
den Bann in der Bibel? Die Mythen und<br />
die Wunderberichte. Buchstäblich?<br />
Allegorisch? Für uns nicht bindend? Für<br />
Müller ist an solche Texte immer und<br />
immer wieder die Frage neu zu stellen:<br />
„Ist überall, wo Gott drauf steht, auch<br />
Gott drin?“ Diese Frage ernst zu<br />
nehmen, heißt für ihn, „nach der Mitte<br />
der Schrift (Bibel) zu fragen“. Aber eben<br />
darüber gibt es bis heute unter den<br />
verschiedenen Bibellesarten in unserer<br />
<strong>Kirche</strong> keine Verständigung.<br />
Der Satz: „Bei der Bemühung, diese Not<br />
zu wenden, verstehen wir die Bibel als<br />
einen Gesprächspartner unter anderen“<br />
und die Wendung „müssen uns in<br />
erster Linie an der gegenwärtigen<br />
gesellschaftlichen und individuellen Not<br />
orientieren“ – seien übrigens nicht aus<br />
seiner Feder und der Grund dafür, dass<br />
er selbst nicht für diese Resolution<br />
gestimmt habe. Beides sei in der Endredaktion<br />
hinzugefügt worden und in<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 13
der Öffentlichkeit aufgespießt worden,<br />
als würde hier die Geringschätzung der<br />
Bibel durch die VikarInnen erkennbar.<br />
Dass es den VikarInnen aber vielmehr<br />
um eine begründete Autorität der Bibel<br />
ging und nicht um ein autoritär verordnetes<br />
„Die Bibel hat doch recht“, das sei<br />
damals nicht begriffen worden.<br />
Die VikarInnen haben sich in Esslingen<br />
1969 durchaus nicht als antiautoritäre<br />
TheologInnen verstanden, sondern seien<br />
auf der Suche nach einer Autorität<br />
gewesen, die davon lebt, dass etwas<br />
überzeugt und einleuchtet. Nicht das<br />
Evangelium als Autorität in Gestalt der<br />
Unterwerfung oder der Preisgabe der<br />
Vernunft, sondern als eine Autorität, die<br />
getragen ist von der Erwartung und der<br />
Erfahrung: Es wird einleuchten. Das sei<br />
auch der Knackpunkt gewesen für ihre<br />
vehemente Kritik an der kirchlichen<br />
Trauung.<br />
Ehe ohne geistlichen Grund<br />
Die Arbeitsgruppe ,,Theologie, Soziologie<br />
und Therapie“ hat unter Aufnahme<br />
von Gedanken der ,,Celler Konferenz“<br />
unter anderem den gesellschaftlichen<br />
Bezug der kirchlichen Amtshandlungen<br />
diskutiert. Dort wurde das Grundproblem<br />
am Beispiel der kirchlichen<br />
Trauung erörtert. Dabei kam man in der<br />
Arbeitsgruppe zu folgenden Ergebnissen:<br />
1 a) Die kirchliche Trauung neben der<br />
bürgerlichen Eheschließung wirkt als<br />
Sanktionierung der letzteren. Die<br />
Institution Ehe wird dadurch zur<br />
göttlichen Ordnung erhoben und so der<br />
Diskussion entzogen.<br />
b) Die Überhöhung der Ehe zur gottgewollten,<br />
unauflöslichen Ordnung hat<br />
u. a. die Diskriminierung von Geschiedenen<br />
zur Folge.<br />
c) Die gegenwärtige Traupraxis der<br />
<strong>Kirche</strong> dient dazu, die Problematik der<br />
Ehe in der heutigen Gesellschaft zu<br />
verschleiern, statt zu ihrer Klärung<br />
beizutragen.<br />
d) Dieser Mißstand kann durch Traugespräche<br />
und Eheberatung höchstens<br />
verdeckt, nicht aber behoben werden,<br />
solange an der kirchlichen Trauung<br />
selbst festgehalten wird.<br />
2. Aus den angegebenen Gründen sollte<br />
die gegenwärtig praktizierte Form der<br />
kirchlichen Trauung nicht weitergeführt<br />
werden.<br />
3. Der Beitrag der <strong>Kirche</strong> zur Lösung<br />
der Eheproblematik müßte darin<br />
bestehen, zu einer sachgemäßen<br />
Diskussion beizutragen. Das könnte in<br />
Gesprächen und Seminaren geschehen,<br />
sofern sie ohne gesellschaftlichen Druck<br />
nicht als<br />
Vorbedingung<br />
einer<br />
kirchlichen<br />
Trauung,<br />
und mit<br />
fachlich<br />
geschulten<br />
Gesprächspartnern<br />
geführt<br />
werden.<br />
(Presseerklärung<br />
der Württembergischen Vikarskonferenz<br />
1969, in: akid 4/69, S. 26)<br />
Diese Passage, so vermuteten die<br />
VikarInnen damals fälschlich, würde<br />
mehr Widerspruch auslösen als die<br />
erste. Aber ihre Kritik der kirchlichen<br />
Trauung ging im Streit um ihr Bibelverständnis<br />
unter. Beim Streit um die<br />
kirchliche Trauung ging es nach Müller<br />
zunächst gar nicht um Theologie. Die<br />
standesamtliche Trauung hatte aus der<br />
Sicht der „Esslinger“ die kirchliche<br />
Trauung verdrängt oder auch überflüssig<br />
gemacht. Man verwahrte sich vehement<br />
gegen eine religiöse Überhöhung<br />
staatlich regulierter Lebensordnungen.<br />
Was Ehe soll, darauf fand die 68-er<br />
Generation in der Theologie keine<br />
Antwort. Sie bewunderten die Therapeuten<br />
und waren von deren Weisheit<br />
überwältigt. Seine Generation, so<br />
Müller, war von einem großen Zutrauen<br />
zur Humanwissenschaft erfasst und von<br />
einem ebenso großen schlechten<br />
Gewissen, „nur Theologe zu sein“.<br />
Wenige seines Jahrgangs seien dann<br />
auch im Pfarramt angekommen.<br />
Müller bemerkt heute demgegenüber<br />
eine witzige Verkehrung: Gerade die<br />
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften –<br />
nunmehr staatlich anerkannt – drängten<br />
nach einer religiösen Weihe. Was aber<br />
1968 und in Folge nicht gelang war, die<br />
Gemeinschaft von Frau und Mann –<br />
auch in der Gestalt der Ehe – in ihrer<br />
religiösen Weisheit zu ergründen. Das<br />
blieb offen. Es gehe in Partnerschaften<br />
doch um Verbindlichkeit und Verlässlichkeit,<br />
es gehe um das, was Menschen<br />
beglückt und fördert. Genau das, so<br />
Müller, sei theologisch (weisheitlich) zu<br />
durchdringen und ist eine bis heute<br />
bleibende Aufgabe. Im Herabsetzen<br />
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften<br />
und nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften<br />
äußere sich heute „Angst vor dem<br />
Fremden, Angst vor Wandel und<br />
Unsicherheit im Blick auf Lebensorientierung“.<br />
Das Bedürfnis nach<br />
einem festen Reglement ist zwar<br />
erkennbar und verständlich. Es wird<br />
daraus aber eine heikle Geschichte,<br />
wenn mit Lebensorientierungen Macht<br />
über andere ausgeübt wird.<br />
Gemeinsame Erklärungen über die<br />
Grundlagen unseres Glaubens helfen so<br />
lange nicht weiter, solange man sich<br />
nicht angstfrei gegenseitig befragen<br />
kann: „Was meinst du damit? Wie<br />
verstehst du das?“ Für Klaus W. Müller<br />
steckt ein Weg zu einem solchen<br />
gegenseitigen Verstehen verschiedenartiger<br />
Lebenspraxis in dem apokryphen<br />
Wort Jesu bei Lukas 6, 4, wo es heißt:<br />
„An diesem Tage sah Jesus einen Mann,<br />
der am Sabbat arbeitete. Er sprach zu<br />
ihm: Mensch, selig bist du, wenn du<br />
weißt, was du tust. Wenn du es aber<br />
nicht weißt, bist du verflucht und ein<br />
Gesetzesübertreter.“ (Codex Cantabrigiensis).<br />
Zugleich, und das steht am<br />
Ende des Gesprächs, wundert sich<br />
Müller, mit welchem Pathos heute über<br />
Ziele und Reformen von <strong>Kirche</strong> gestritten<br />
wird, kommt es ihm doch so vor, als<br />
hätten sie seinerzeit diese ganzen<br />
Überlegungen schon einmal angestellt.<br />
Aber jede Generation geht neu heran.<br />
Als Leiter des Pfarrseminars sieht er<br />
heute junge TheologInnen heranwachsen<br />
mit einem großen Horizont und<br />
Verstehensmöglichkeiten für ganz<br />
verschiedene Lebenssituationen. Bleibt<br />
zu hoffen, dass ein engstirniges Bibelverständnis<br />
diesen Nachwuchs nicht aus<br />
dem Amt treibt.<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Harry Waßmann ist Pfarrer in<br />
Tübingen<br />
Seite 14 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
<strong>Kirche</strong>ngeschichte<br />
Das Reich Gottes und das<br />
Heil des Menschen<br />
Zum 200. Geburtstag von Johann Christoph<br />
Blumhardt am 16. Juli<br />
Christian Buchholzi<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Möttlingen im frühen 19. Jahrhundert<br />
Möttlingen ist ein kleines Dorf am Rand<br />
des Nord-Schwarzwaldes zwischen Weil<br />
der Stadt und Liebenzell. Armut und<br />
Begrenztheit bestimmen das Leben:<br />
Kleinste Bauernhöfe, wenige Handwerker,<br />
Hausierertätigkeit im Winter. Die<br />
Religiosität ist geprägt von exzessiver<br />
Frömmigkeit, getragen von biblizistischem<br />
Pietismus, scharf ablehnender<br />
Kritik der Aufklärungstheologie und des<br />
Rationalismus. Dämonenglaube, Zauberei<br />
und der Glaube an das Numinose im<br />
Alltag ergeben eine Mischung aus<br />
biblischem Christentum und heidnischer<br />
Volksreligiosität. Viele erwarten die nahe<br />
Wiederkunft Christi. Manche wandern<br />
deshalb nach Palästina oder (über<br />
Korntal) nach Osteuropa aus. Doch die<br />
meisten kompensieren die ersehnte<br />
Hoffnung durch eine spannungsgeladene<br />
Frömmigkeit. Psychische und<br />
körperliche Probleme haben zum Teil<br />
hierin ihre Ursachen. Zu Beginn der<br />
Industrialisierung wird von Doris<br />
Blumhardt eine „Industrieschule“<br />
(Strick- und Nähschule) und 1844 von<br />
Joh. Christoph Blumhardt eine Kleinkinderschule<br />
gegründet und von<br />
Gottliebin Dittus geleitet.<br />
Blumhardts Vorgänger, Christoph<br />
Gottlieb Barth (1799-1862), ist ein<br />
hochgebildeter, weltoffener Mann,<br />
kommt aber in Seelsorge und Predigt bei<br />
der Dorfbevölkerung nicht an. Er hat<br />
Kontakte zur Brüdergemeinde in<br />
Herrnhut, hat die Reformpädagogik von<br />
Johann Friedrich Oberlin (1740-1826)<br />
studiert und ist durch die Gründung des<br />
„Vereins zur Rettung verwahrloster<br />
Kinder“ in Beuggen/Süd-Baden berühmt<br />
geworden. Nachdem er – so sagt er<br />
selbst – „die Gemeinde zu Tode gepredigt“<br />
hat, leitet er schließlich den von<br />
ihm gegründeten Verlagsverein in Calw.<br />
Johann Christoph Blumhardt stammt aus<br />
einer Stuttgarter Bäckersfamilie, von<br />
deren pietistischer Frömmigkeitspraxis<br />
stark geprägt. Trotz des frühen Todes<br />
des Vaters kann er dank eines königlichen<br />
Stipendiums in Tübingen Theologie<br />
studieren. Im Evangelischen Stift gilt<br />
er als strebsam und umfassend gebildet.<br />
Nach kurzem Vikariat in Dürrmenz bei<br />
Mühlacker lehrt er von 1830 bis 1837<br />
an der Missionsschule in Basel Hebräisch<br />
und das „Nebenfach der Nützlichen<br />
Kenntnisse“. In Basel verlobt er<br />
sich mit Doris Köllner aus Sitzenkirch.<br />
Blumhardt kehrt nach Württemberg<br />
zurück, um eine Pfarrstelle zu bekommen.<br />
Kurze Zeit ist er Vikar in Iptingen<br />
bei Vaihingen/Enz. Paul Schempp<br />
(1900-1959), notiert 100 Jahre später<br />
als Pfarrer in Iptingen über Blumhardts<br />
seelsorgerliche Arbeit: „Johann Christoph<br />
Blumhardt war ein Zeuge der Bibel<br />
und das heißt ein Zeuge Jesu Christi.<br />
Mehr wollte er nicht sein; dies aber<br />
wollte er ganz sein. So durchzieht sein<br />
Denken und Leben eine gewaltige<br />
Sehnsucht nach neuen Gottesoffenbarungen,<br />
nach Pfingstzeiten der <strong>Kirche</strong>,<br />
nach deutlichen Machterweisen und<br />
Siegeszügen Jesu und eine ebenso große<br />
Wehmut über die Dürftigkeit und<br />
Magerkeit der <strong>Kirche</strong> und der Gemeinden.“<br />
1838 kommt Blumhardt in das leer<br />
gepredigte Möttlingen. Durch intensive<br />
Hausbesuche und Seelsorge, Unterricht<br />
und Vorträge sowie einfache und klare<br />
Predigten will er das Eis brechen. Aber<br />
die „Gleichgültigkeit war schon so groß,<br />
dass das Dorf schrecklich gelähmt war<br />
durch krassen Aberglauben, der auf Leib<br />
und Seele verderblich wirkte“, so sein<br />
Sohn später. „Ein Tun Gottes musste<br />
helfen, wenn geholfen werden sollte.“<br />
1840 ziehen vier elternlose Geschwister<br />
namens Dittus (auch eine Bäckersfamilie)<br />
in ein ärmliches Häuschen in<br />
der Dorfmitte. Damals eher einem Stall<br />
ähnlich, ist es heute ein kleines Museum.<br />
Ein Spruch am Fensterladen (noch<br />
sichtbar) charakterisiert die religiöse<br />
Stimmung der Zeit: „O Mensch bedenk<br />
die Ewigkeit – und spotte nicht der<br />
Gnadenzeit – denn das Gericht ist nicht<br />
mehr weit.“ Gottliebin, die älteste der<br />
Geschwister, lange körperlich und<br />
seelisch kränkelnd, sucht zögernd<br />
Kontakt zum neuen Pfarrer, als ihre<br />
Leiden sie tiefer belasten. Sie ist fasziniert<br />
von dem jungen Mann und<br />
glänzenden Pfarrer und abgestoßen<br />
zugleich. Oft weist sie ihn bei seinen<br />
Besuchen ab. Sie hängt noch stark an<br />
dem Vorgänger, der sie zur Leiterin der<br />
dörflichen Spinnabende für junge Leute<br />
berufen hatte. Die manchmal zwielichtige<br />
Atmosphäre legt sich auf alle Beteiligten.<br />
Es entwickelt sich eine gereizte und<br />
diffuse Beziehung zwischen Blumhardt<br />
und Gottliebin, die zu keiner Klärung<br />
findet. Blumhardt akzeptiert die Situation<br />
und Gottliebins Verhalten. Er drängt<br />
sich nicht auf. So nimmt eine Krankheits-<br />
und Heilungsgeschichte ihren<br />
Lauf, die unter ernst zu nehmenden<br />
Zeugen geschehen, gut und vielfältig<br />
berichtet, als „Krankheitsgeschichte der<br />
Gottliebin“ in religiöser Erbauungsliteratur<br />
wie auch in der theologischen<br />
und medizinischen Wissenschaft<br />
bekannt ist.<br />
Therapie der Gottliebin<br />
Nie wollte Blumhardt aus seiner Erfahrung<br />
etwas Besonderes machen. Aber er<br />
wird angefeindet durch Ärzte, im<br />
Kollegenkreis und bei der <strong>Kirche</strong>nleitung.<br />
So schreibt er einen ausführlichen<br />
Bericht für das königliche Konsistorium<br />
(die damalige <strong>Kirche</strong>nleitung), der<br />
wiederum unter Vertrauensbruch an die<br />
Öffentlichkeit gelangt und durch<br />
Blumhardt dann verschiedentlich<br />
ergänzt und erweitert wird. Später<br />
nimmt er in seiner Predigt- und Seel-<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 15
sorgearbeit ausdrücklich darauf Bezug.<br />
Diese Heilungsgeschichte prägt sein<br />
Lebenswerk und seine Theologie wie die<br />
seines Sohnes Christoph Friedrich<br />
Blumhardt entscheidend; sie wird zum<br />
integralen Bestandteil ihres Denkens,<br />
Glaubens und Handelns. Rückblickend<br />
sagt Blumhardt ein Jahr vor seinem Tod<br />
in einer Weihnachtspredigt: „Es sind<br />
heute 36 Jahre her, da ich auf der<br />
Kanzel stand in Möttlingen. Ich bin<br />
damals mit einem Triumphgefühl<br />
aufgetreten, da mir der Psalm, den<br />
Maria sang (Lk1,46ff), sehr wertvoll<br />
gewesen ist. Denn es war am Tag,<br />
nachdem ich mit einem eigentlichen<br />
schweren Kampf fertig geworden war.<br />
Das war ein persönlicher Kampf mit den<br />
Persönlichkeiten der Finsternis, da wir<br />
miteinander einunddreiviertel Jahre<br />
gerungen haben, um zu sehen, wer der<br />
Herr würde. So hat der Gedanke an<br />
Jesus, den Anfänger und Vollender des<br />
Glaubens, der nach blutigem Kreuzestod<br />
zur Rechten Gottes erhöht worden ist,<br />
mich stark erhalten; und zuletzt hat<br />
auch die Finsternis ausrufen müssen,<br />
vielleicht zum ersten Mal: Jesus ist<br />
Sieger! Und damit bin ich fertig gewesen.<br />
Jesus war Sieger. Und alle seine<br />
Feinde mussten es laut schreien, so dass<br />
es fast durch den ganzen Ort gehört<br />
wurde: Jesus ist Sieger! Ihr könnt euch<br />
denken, mit welchen Gefühlen ich dann<br />
…auf die Kanzel trat, da alles voll<br />
Erwartung war, wie es noch mit dem<br />
Kampf hinauslaufen würde. Aber kühn<br />
und mutig konnte ich sagen: Es ist<br />
gewonnen!“<br />
In seiner Analyse zu Beginn der Begleitung<br />
stellt Blumhardt sachlich fest:<br />
„Gibt’s eine Zauberei und Hexerei, ist’s<br />
nicht Sünde, sie unangetastet ihr Spiel<br />
treiben zu lassen? Mit solcherlei Gedanken<br />
arbeitete ich mich im Glauben an<br />
die Kraft des Gebetes auch in diese<br />
Sache, bei welcher kein anderer Rat<br />
sonst übrig war, hinein und ich rief der<br />
Kranken zu: Wir beten, sei’s, was es<br />
wolle. Wir probieren’s. Wir verspielen<br />
wenigstens nichts mit dem Gebet. Der<br />
Herr wird tun, was er verheißt.“<br />
Blumhardt erkennt in der Krankheit eine<br />
„Herausforderung an Gott, ein Zeichen<br />
zu tun“ und stellt sich (zusammen mit<br />
den Kranken) dieser Herausforderung<br />
durch intensives und schlichtes Gebet.<br />
Fast nüchtern kann er nach aller<br />
Anspannung formulieren: „Nun schien<br />
die Macht und Kraft des Dämons mit<br />
jedem Augenblick gebrochen zu werden.<br />
Er wurde immer stiller und<br />
ruhiger, konnte immer weniger Bewegungen<br />
machen und verschwand zuletzt<br />
ganz unmerklich, wie das Lebenslicht<br />
eines Sterbenden erlischt…“<br />
Beim Versuch, dieses Ereignis und<br />
Blumhardts Weg zu verstehen und<br />
einzuordnen, fallen verschiedene<br />
Elemente auf, die die neuzeitliche<br />
Sehnsucht nach Spiritualität auf eine<br />
ganzheitlich-geistliche Weise korrigiert:<br />
1. Nicht Blumhardt ist der eigentlich<br />
Agierende: Die Energie der Krankheit<br />
wird umgelenkt. Die Kranke kommt zu<br />
sich selbst und zu ihren ursprünglichen<br />
Kräften. Er schafft „Quartier“, wie<br />
später der Sohn formuliert, für den<br />
Menschen und für Gottes Wirken.<br />
2. Die Heilung geschieht im Raum des<br />
Vertrauens. „Der Heiland kommt nicht<br />
als der große Kaputtmacher, sondern als<br />
der große Seligmacher.“ Die Öffentlichkeit<br />
bleibt während der Heilung ausgeschlossen,<br />
eine heftige Kritik an heutigen<br />
Heilungsspektakeln.<br />
3. Alles zielt auf das Christusbekenntnis:<br />
„Jesus ist Sieger“. Diese Heilung –<br />
wie später auch alle anderen – sind<br />
Anzeichen für den erhofften endgültigen<br />
Sieg. In dem einzigen Lied, das in<br />
unserem Gesangbuch von Blumhardt d.<br />
Ä. aufgenommen ist (EG 375), heißt es<br />
programmatisch: „Dass Jesus siegt,<br />
bleibt ewig ausgemacht.“<br />
4. Blumhardt hält aus. Er gibt – fast<br />
kindlich – nicht auf: Der Gebetskampf<br />
scheint der rote Faden zu sein. Die<br />
Wiederentdeckung der elementaren<br />
Dimension des Gebets, die unsere<br />
Wirklichkeit mehr als berührt, verbietet<br />
Gebetsfloskeln und oberflächliches<br />
Ritual. Blumhardt hält nichts vom<br />
„Andächteln“.<br />
5. Blumhardt nimmt die körperliche<br />
Dimension des Glaubens und die<br />
eigenartige Mächtigkeit der Volksreligion<br />
ernst. „Das Evangelium…ist eine<br />
Kraft.“ Blumhardt interpretiert den<br />
Vorgang als Befreiung: „Die Menschen<br />
bedürfen keiner Bekehrung – denn auch<br />
mit Sünden hatten sie sich nicht von<br />
Gott abkehren wollen – sondern nur<br />
einer Befreiung.“<br />
6. Die medizinische Versorgung durch<br />
den Arzt bleibt Teil der ganzheitlichen<br />
Heilung. „Ich arbeite…einer ärztlichen<br />
Behandlung (wenn sie noch nötig und<br />
verlangt wird) auf die heilbringende<br />
Weise vor.“<br />
7. Der Glaube kann auch heute Wunder<br />
wirken, die nicht auf die Zeit des<br />
historischen Jesus beschränkt sind.<br />
Unser Wirklichkeitsverständnis bleibt<br />
begrenzt.<br />
8. Theologisch ist interessant, dass<br />
Blumhardt nicht nur die synoptischen<br />
Berichte über Heilungswunder auf<br />
seiner Seite hat, sondern auch einen<br />
Grundstrom paulinischer Gedanken<br />
aufnimmt. Die urchristlichen und<br />
prophetischen Zeugen des Glaubens<br />
sind seine Vorbilder.<br />
Deutungen<br />
In der fachkundigen Deutung dieser<br />
Geschichte haben sich nach dem<br />
zweiten Weltkrieg vor allem die Psychotherapeuten<br />
Joachim Scharfenberg und<br />
Gaetano Benedetti (Basel) einen Namen<br />
gemacht: Sie gelten als herausragende<br />
Brückenbauer zwischen Theologie/<br />
Seelsorge und Psychotherapie und als<br />
Vorläufer der klinischen Seelsorge in der<br />
heutigen Pfarrerausbildung: Arzt und<br />
Seelsorger haben ihre je eigene Kompetenz,<br />
die es zu respektieren und in<br />
konstruktiver Zusammenarbeit zu<br />
gestalten gilt. So auch in der tiefenpsychologischen<br />
Interpretation unseres<br />
„Falles“. Nicht Gottliebin sondern der<br />
„Dämon“ steht im Zentrum des „Kampfes“.<br />
Blumhardt tritt als Seelsorger und<br />
Gesprächstherapeut an die Stelle der<br />
Schwachen, weil sie ihrer inneren<br />
Zerrissenheit nicht mehr Herr wird. Er<br />
setzt sich ihr und der ganzen zerstörerischen<br />
Konfliktsituation aus. In dem<br />
„maßvollst gehaltenen Gespräch“ öffnet<br />
sich die Situation, Neues kann wachsen,<br />
damit „von oben her etwas kommen“<br />
kann. Gottliebins Stummheit wird in<br />
Sprachfähigkeit gewandelt. Gefestigt<br />
wird dieser Prozess dadurch, dass<br />
Blumhardt sie danach in die Großfamilie<br />
des Pfarrhauses einbindet. Sie erhält<br />
zudem eine wichtige Funktion im Dorf.<br />
Die Folgen<br />
Rasch wird der Vorfall bekannt – im<br />
Dorf, in der Umgebung, im Land und<br />
darüber hinaus. Öffentliche und intrigante<br />
Beschuldigungen gegen Blumhardt<br />
tragen dazu bei. Im Dorf beginnt<br />
eine spontane Buß- und Erweckungsbewegung:<br />
Einzelne, Eheleute, ganze<br />
Familien kommen zu Blumhardt zur<br />
Seelsorge, zur Beichte. Tränen fließen.<br />
Glaube wird gestärkt. Die Gottesdienste<br />
sind überfüllt. Das Pfarrhaus wird zum<br />
aus allen Nähten platzenden Gasthaus<br />
der Mühseligen und Beladenen. Blumhardt<br />
versteht sich dabei nicht als der<br />
große Heiler, sondern er sehnt sich bei<br />
all dem Trubel und aller bewegten<br />
Frömmigkeit nach „Ausstrahlungen der<br />
Herrlichkeit und Freundlichkeit Jesu<br />
Christi“. „Es war mir, als ob ich in eine<br />
ganz neue, mir völlig unbekannte<br />
Seite 16 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
Sphäre hineingezogen würde, in<br />
welcher heilige Geisteskräfte sich<br />
regten.“ Neid und Anfeindungen von<br />
seiten der Pfarrerschaft wachsen, ziehen<br />
doch viele Gemeindeglieder Sonntag für<br />
Sonntag aus ihren Dörfern und Städten<br />
in Kutschen und auf Bauernwagen nach<br />
Möttlingen. Manchmal scheint halb<br />
Stuttgart unterwegs zu sein. Ebenso<br />
häufen sich ganz konkrete Erwartungen<br />
vieler Heilung Suchender. Blumhardt<br />
wird auch von Menschen und Gemeinden<br />
außerhalb Württembergs angefragt<br />
und besucht. Die <strong>Kirche</strong>nleitung wirft<br />
ihm vor, sich in ärztliche und außerparochiale<br />
Angelegenheiten einzumischen.<br />
Der Rückhalt im Dorf nimmt im<br />
Lauf der Jahre ab. Erste Ideen, an<br />
anderer Stelle und in einer anderen<br />
<strong>Kirche</strong> zu wirken, nehmen Gestalt an.<br />
König Wilhelm I. will ihn aber unbedingt<br />
in Württemberg halten.<br />
Nachdem Blumhardt verschiedene<br />
Versuche, seine ausufernde Arbeit<br />
selbständiger gestalten zu können,<br />
erfolglos und enttäuscht abgebrochen<br />
hat, besichtigen seine Frau Doris und<br />
Gottliebin Dittus das heruntergekommene<br />
königliche Kurhaus in Bad Boll, das<br />
zum Verkauf steht, um größere und<br />
attraktivere Räumlichkeiten zu finden.<br />
1852 übernimmt Blumhardt für die<br />
stattliche Summe von 25.000 Gulden<br />
(es gab schon genügend Sponsoren) von<br />
der württembergischen Regierung das<br />
einstmalige „herzogliche Wunderbad“<br />
aus dem Jahr 1595 mit dem weiträumigen<br />
Grund und Boden. Das Bad –<br />
1824 unter dem Königspaar Wilhelm I.<br />
und Pauline restauriert – war von den<br />
„oberen Ständen“ nicht mehr angenommen<br />
und aufs Neue verfallen. Eine erste<br />
Umstrukturierung im Kurhaus ist<br />
programmatisch: Der Tanzsaal wird zum<br />
Gottesdienst-Saal (heute Festsaal und<br />
immer noch Ort für den sonntäglichen<br />
Gottesdienst der Herrnhuter Brüdergemeine).<br />
Nach anfänglichen Schwierigkeiten<br />
setzt sich die Möttlinger Erweckungs-<br />
und Heilungsbewegung in Bad<br />
Boll fort: Menschen aus allen Ständen<br />
(vornehmlich aber Begüterte und<br />
Einflussreiche) suchen Kontakt zu<br />
Blumhardt.<br />
Eine Sehnsucht nach dem „Heiligen“<br />
oder sogar nach dem „heiligen Mann“?<br />
– so fragen wir heute kritisch. Blumhardt<br />
selber hat das ähnlich problematisiert,<br />
andererseits aber seine geistliche<br />
Verantwortung aufgrund seiner Erfahrungen<br />
wahrnehmen wollen. Wie<br />
Paulus konnte er nicht anders: Tröstung,<br />
Heilung, körperliche Genesung, unmittelbaren<br />
und brieflichen Rat sowie<br />
gottesdienstliche und seelsorgerliche<br />
Begleitung suchen die Menschen und<br />
finden dies zum größten Teil bei<br />
Blumhardt persönlich, in der bergenden<br />
Atmosphäre des Kurhauses, in der dort<br />
erlebten Gemeinschaft. Nie wollte<br />
Blumhardt aus seinem Kurhaus eine<br />
„Gebetsheilanstalt“ werden lassen. Aber<br />
es sollte zum Zeugnis werden für den<br />
sichtbaren und greifbaren Weg des<br />
Reiches Gottes in dieser Welt. Deshalb<br />
ist auch die Übersetzung der beiden<br />
Wilhelm und Pauline wiedergebenden<br />
Buchstaben W und P, im Sinn (der<br />
beiden!) Blumhardts – Warten und<br />
Pressieren: Wir warten auf das Reich<br />
Gottes und wir bemühen uns gleichzeitig<br />
darum, ihm hier in unserer Welt<br />
Gestalt zu geben.<br />
1872 stirbt die Weggefährtin Gottliebin:<br />
An ihrem Sterbebett wird den Versammelten<br />
(erneut) die Gewissheit vermittelt:<br />
„Jesus siegt“. Dieses elitäre Bewusstsein<br />
mit dem kämpferischen<br />
Grundton prägt weiter die Wege der<br />
Beteiligten. Im Frühjahr 1880 erkrankt<br />
Blumhardt an einer Lungenentzündung.<br />
Im Stil hebräischer Patriarchen versammelt<br />
er seine Söhne um sich und<br />
verpflichtet sie zum Dienst an der<br />
begonnenen Aufgabe: „Ich segne dich<br />
zum Siegen“ spricht er auf dem Sterbebett<br />
Christoph Friedrich zu, der widerwillig<br />
Theologie studierte und nie den<br />
Vater beerben wollte. Als einfacher<br />
Mitarbeiter hat er – nach verschiedenen<br />
Vikariaten (u.a. in Dürnau bei Bad Boll)<br />
– über zehn Jahre in der Landwirtschaft<br />
des Kurhauses den Stall gemistet, Milch<br />
gemolken und in der Hausverwaltung<br />
mitgearbeitet. Nun ist er in die geistliche<br />
und strukturelle Pflicht genommen.<br />
Fragen und Perspektiven<br />
Ob sich die modernen Heilungsbewegungen<br />
auf Blumhardt berufen können,<br />
ist mehr als zweifelhaft, obgleich sie auf<br />
die körperliche Dimension von Religion<br />
und besonders des christlichen Glaubens<br />
verweisen. Aber der Lärm, der medial<br />
um sie erzeugt wird, verdeckt meist das<br />
freundliche und Mut machende Gebot<br />
der Heilung im NT (Mk 16 u.ö.), das<br />
stets intime Seelsorge mit erlebbarer<br />
Veränderung des Alltags verbindet.<br />
Das Kurhaus existiert noch. Es ist jetzt<br />
Teil der „Diakonie Stetten“, unserer<br />
großen diakonischen Einrichtung in<br />
Württemberg. Das Haus selber wird als<br />
Rehabilitationsklinik für verschiedene<br />
Krankheiten – dank der Schwefel- und<br />
Mineralquelle und der Schiefer-Fango-<br />
Anwendungen – geführt und mit einem<br />
ausgesprochen seelsorgerlich-geistlichen<br />
Angebot ergänzt. Ein „Geistliches<br />
Zentrum“ rundet das moderne Angebot<br />
ab – ganz in der Tradition der beiden<br />
Blumhardts und im Geist der Schenkungsurkunde<br />
von 1920, als das Haus<br />
und der gesamte Besitz von der Blumhardt-Familie<br />
an die Herrnhuter Brüdergemeine<br />
überging: „Bad Boll soll ein<br />
Haus sei, wo der Heiland regiert, in dem<br />
man nach dem Reiche Gottes trachtet<br />
und sich um sein Wort sammelt. Es soll<br />
eine Stätte sein, von der Segen ausströmt<br />
in weite Kreise des Volkes, wo<br />
Arme und Reiche sich in einem Geiste<br />
zusammenfinden, wo Mühseligen und<br />
Beladenen eine Stätte geboten wird, von<br />
der aus sie neu gestärkt wieder hinaustreten<br />
können in den Kampf des Lebens,<br />
und wo Liebe und Barmherzigkeit<br />
wohnen.“<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Christian Buchholz, Schuldekan für<br />
Göppingen und Kirchheim/Teck.<br />
Veranstaltungshinweise:<br />
Sonntag, 7. August, Pilgerweg in<br />
Erinnerung an die beiden Blumhardts<br />
durchgeführt in Bad Boll. Informationen<br />
und Anmeldungen:<br />
www.evanggemeindeblatt.de/<br />
email:redaktion@evanggemeindeblatt.de/<br />
Tel: (07 11) 6 01 00-74<br />
Internationale Tagung über Johann<br />
Christoph Blumhardt: 7. bis 9. Oktober<br />
in der Evangelischen Akademie Bad<br />
Boll. Informationen und Anmeldungen:<br />
www.ev-akademie-boll.de/<br />
email:monika.doludda@ev-akademieboll.de,<br />
Tel: (0 71 64) 79-342<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 17
Bezirk Schorndorf<br />
Ein neues Afrika<br />
scheint möglich<br />
Präsidentin des ökumenischen<br />
Weltrates setzt aufs Positive:<br />
Friede, Demokratie, mehr Rechte<br />
für Frauen<br />
Aids, Kriege, Völkermord, Hunger – das<br />
sind die Stichworte, die spontan zum<br />
Thema „Afrika“ fallen. Alles richtig,<br />
stimmt Dr. Agnes Abuom zu. Und doch:<br />
Ein neues, ein anderes Afrika scheint<br />
möglich; erste Anzeichen von Frieden,<br />
Demokratie und mehr Rechten für<br />
Frauen lassen hoffen. Die Präsidentin<br />
des ökumenischen Weltrates setzt aufs<br />
Positive.<br />
Was die Kenianerin auf Einladung der<br />
Volkshochschule Schorndorf vor rund<br />
50 Gästen von Afrika zu erzählen<br />
wusste, schien manchem Zuhörer als zu<br />
weich gezeichnet, zu optimistisch. Ein<br />
Einwand, den Dr. Agnes Abuom leicht<br />
entkräften kann: „Wenn du ein Pferd<br />
jeden Tag schlägst, wird es müde“,<br />
sprich: Wo keine Hoffnung, ist kein<br />
Vertrauen in die Zukunft, kann nichts<br />
wachsen.<br />
Aus Sicht der Repräsentantin der<br />
afrikanischen <strong>Kirche</strong>n wächst vieles zur<br />
Zeit in Afrika. Die Afrikaner sind, und<br />
das ist neu, bereit, die Verantwortung<br />
für die Geschicke des Kontinents selbst<br />
zu übernehmen, übersetzt Helmut Hess<br />
die englischen Worte der Referentin.<br />
Hess zeichnet bei „Brot für die Welt“ für<br />
Afrika zuständig und hat Agnes Abuom<br />
bereits zum zweiten Mal nach Schorndorf<br />
geholt. Seit ihrem letzten Besuch<br />
vor vier Jahren hat sich in Afrika viel<br />
zum Guten verändert. Das darf nicht<br />
verschweigen, wer ein realistisches Bild<br />
von Afrika zeichnen will, sagt die<br />
Historikerin und zählt auf: Im Sudan<br />
keimt neue Hoffnung für Frieden –<br />
okay, die verfeindeten Parteien haben<br />
nicht zum ersten Mal ein Friedensabkommen<br />
unterzeichnet. Doch kehren<br />
jetzt junge Flüchtlinge in ihre Heimat<br />
zurück, voll Schwung und willens, das<br />
Land neu aufzubauen, demokratische<br />
Strukturen zu etablieren. Nachhaltiger<br />
Friede indes wird nur gelingen, sofern<br />
die uralten Werte erhalten bleiben.<br />
Noch ein Beispiel für Hoffnungsschimmer:<br />
In Somalia gibt’s seit kurzem eine<br />
gewählte Regierung. Ein Viertel der<br />
Parlamentssitze entfällt auf Frauen – ein<br />
riesiger Fortschritt auch hier. Wie in<br />
Ruanda, wo ganz langsam demokratische<br />
Strukturen Einzug halten und<br />
immer mehr Frauen an die Macht<br />
gelangen. Noch so ein Hoffnungszeichen:<br />
Eine neue Partnerschaft für<br />
afrikanische Zusammenarbeit kümmert<br />
sich um eine eigenständige wirtschaftliche<br />
Entwicklung Afrikas. Eine Kenianerin<br />
hat jüngst den Friedensnobelpreis<br />
erhalten. Menschen engagieren sich mit<br />
neuem Schwung, neuer Energie nicht<br />
zuletzt für eine spirituelle Erneuerung:<br />
Die Würde jedes Mannes, jeder Frau<br />
wieder in den Mittelpunkt rücken, das<br />
versteht die Kenianerin darunter. Das<br />
Leben feiern, darum geht es doch, um<br />
diese Stimmung – die sich keiner<br />
vermiesen lassen soll von der Politik<br />
oder auch der <strong>Kirche</strong>. Kritik an der<br />
<strong>Kirche</strong>, die sie vertritt, scheute Abuom<br />
in Schorndorf nicht: Wo in einem Jahr<br />
weit mehr als zwei Millionen Menschen<br />
an Aids sterben. So wie 2004 in Afrika,<br />
muss <strong>Kirche</strong> endlich lernen, offen über<br />
Sexualität zu sprechen.<br />
Lösungsansätze gedeihen<br />
Die Probleme liegen auf der Hand,<br />
Lösungsansätze gedeihen – Bundespräsident<br />
Horst Köhler hat vor seiner Reise<br />
nach Afrika kürzlich gesagt, am Schicksal<br />
Afrikas entscheide sich die Menschlichkeit<br />
der Welt, und damit die Verantwortung<br />
der westlichen Welt für diesen<br />
Kontinent unterstrichen. Der Welt bleibt<br />
auch gar nichts anderes übrig, als<br />
Verantwortung zu übernehmen. Die<br />
Wiege der Menschheit liegt in Afrika<br />
und, so Abuom, „die Zukunft Afrikas ist<br />
Voraussetzung fürs Überleben der<br />
Menschheit insgesamt“.<br />
Schorndorfer Nachrichten vom<br />
9. 3. <strong>2005</strong> – Andrea Wüstholz<br />
Pressemitteilung<br />
Dank an Kling-de Lazzer<br />
Frauenkandidatur ein Erfolg –<br />
Konservative Synodenmehrheit<br />
fehlt das Selbstbewusstsein<br />
anderer Synoden<br />
Die <strong>Offene</strong> <strong>Kirche</strong>, Evangelische<br />
Vereinigung in Württemberg (OK),<br />
dankt Frau Dekanin Dr. Kling – de<br />
Lazzer für ihre Bereitschaft und den<br />
Mut zur Kandidatur als erste Bischöfin<br />
der Evangelischen <strong>Kirche</strong> in Württemberg.<br />
Die OK begrüßt die überzeugenden<br />
Vorstellungen, die Frau Kling-de<br />
Lazzer für eine <strong>Kirche</strong> der Zukunft<br />
entwickelt hat. Die OK wird auch<br />
weiterhin engagiert dafür arbeiten,<br />
Frauen den Weg in kirchliche Leitungsämter<br />
zu ebnen. Die OK fordert die<br />
anderen Kräfte in der Synode auf, das<br />
ihre auf diesem Weg beizutragen.<br />
Als Erfolg wertet es die <strong>Offene</strong> <strong>Kirche</strong>,<br />
dass es gelungen ist, eine Frau für das<br />
höchste Leitungsamt der evangelischen<br />
<strong>Kirche</strong> zu nominieren. Darüber hinaus<br />
hat Frau Dr. Kling-de-Lazzer dazu<br />
beigetragen, das Argument, es gäbe<br />
keine geeigneten Frauen für dieses Amt,<br />
endgültig zu entkräften.<br />
Festzuhalten ist, dass die konservative<br />
Mehrheit der Synode noch weit vom<br />
Selbstbewusstsein der Synoden entfernt<br />
ist, die Frauen wie Maria Jepsen, Bärbel<br />
Wartenberg-Potter oder Margot Kässmann<br />
zu Bischöfinnen gewählt haben.<br />
Auch unserer <strong>Kirche</strong> hätte es wohl<br />
angestanden, mit einer anerkannten<br />
Frau über ihre engen Grenzen hinaus<br />
Profil zu zeigen und damit im Konzert<br />
der EKD einmal wieder eine prägende<br />
Rolle zu spielen. Vor allem die Gruppe<br />
„Evangelium und <strong>Kirche</strong>“ muss sich<br />
vorhalten lassen, zur Frauenpolitik nur<br />
wohlfeile Fensterreden zu halten.<br />
Eine Bischöfin wäre überdies ein<br />
ermutigendes Zeichen für eine gleichgestellte<br />
Gemeinschaft von Frauen und<br />
Männern in der <strong>Kirche</strong> gewesen,<br />
insbesondere aber für die vielen Christinnen<br />
in unserer <strong>Kirche</strong>, die das Gemeindeleben<br />
garantieren und auf deren<br />
Einsatz sich Pfarrerinnen und Pfarrer<br />
zusammen mit der <strong>Kirche</strong>nleitung<br />
selbstverständlich verlassen. Es wird ein<br />
wichtiges Anliegen der OK bleiben, zu<br />
ändern, dass die vielen, die <strong>Kirche</strong><br />
tragenden Frauen, einem ungeschriebenen<br />
<strong>Kirche</strong>ngesetz zufolge überwiegend<br />
von Männern in Leitungsämtern regiert<br />
werden.<br />
Dem neuen Bischof Frank July gratuliert<br />
die <strong>Offene</strong> <strong>Kirche</strong> und wünscht ihm<br />
eine glückliche Hand und Gottes Segen<br />
für seine Amtsführung. Sie warnt davor,<br />
erste Äußerungen Julys nach seiner<br />
Wahl etwa zu Gemeindestrukturen,<br />
Akademien oder Landeskirche Baden-<br />
Württemberg als Festlegungen zu<br />
werten. Solche Fragen bedürfen einer<br />
gründlichen und breiten Diskussion,<br />
bevor sie entscheidungsreif sind.<br />
Albrecht Bregenzer<br />
Pressestelle <strong>Offene</strong> <strong>Kirche</strong><br />
Seite 18 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
AMOS Preis-<br />
Verleihung<br />
Mitschnitt aus der Erlöserkirche<br />
in Stuttgart, vom 20. Februar <strong>2005</strong><br />
Der gesamte Mitschnitt besteht aus zwei<br />
CDs<br />
CD1: AMOS-Preis für Café Strichpunkt<br />
Stuttgart<br />
◆ Laudatio: Der Stuttgarter<br />
Aidsseelsorger Petrus Ceelen<br />
◆ Ein Portrait von Stefanie Meineke in<br />
SWR1, Sonntagmorgen, 20.02.<strong>2005</strong><br />
Dauer 44:37, Preis 7,50 Euro<br />
CD2: AMOS-Preis für Halina Bortnowska,<br />
Journalistin und Menschenrechtlerin,<br />
Polen<br />
◆ Laudatio: Bundestagspräsident<br />
Wolfgang Thierse<br />
◆ SWR4 Radio Stuttgart, Nachrichten,<br />
Kurzbeitrag von Silke Arning,<br />
◆ Schlusswort: Dr. Erhard Eppler<br />
Dauer 53:43, Preis 7,50 Euro<br />
Beide CDs kosten zusammen 15 Euro<br />
Bestelladresse:<br />
Geschäftsstelle <strong>Offene</strong> <strong>Kirche</strong><br />
Reiner Stoll-Wähling<br />
70435 Stuttgart, Ilsfelder Str. 9<br />
Telefon: (0711) 5 49 72 11<br />
Fax: (0711) 3 65 93 29<br />
E-Mail: geschaeftsstelle@offene-kirche.de<br />
Thema: Warum OK wählen?<br />
Bezirksverantwortlichen-Versammlung<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
Eine stattliche Runde fand sich am<br />
19. März <strong>2005</strong> im Gemeindehaus<br />
der Stuttgarter Erlöserkirche ein,<br />
um sich über das Profil, das Erscheinungsbild<br />
und die Zusammenarbeit<br />
innerhalb der OK auszutauschen.<br />
Außerdem sollten Themen für die<br />
nächste <strong>Kirche</strong>nwahl gefunden<br />
werden.<br />
Die meisten BezirksvertreterInnen und<br />
LK-Mitglieder kamen aus dem Großraum<br />
Stuttgart. Der Süden fehlte. Dass<br />
es „in der Fläche“ wenig OK-Mitglieder<br />
gäbe, dem widersprach Geschäftsführer<br />
Reiner Stoll-Wähling: „Die kleinen<br />
Kreise haben zugenommen, in den<br />
Städten werden es weniger.“ Dem<br />
schlossen sich sofort Überlegungen an,<br />
wie man die OK-SympathisantInnen<br />
dazu bringen könnte, das nächste Mal<br />
zur Wahl zu gehen. Liegt die mangelnde<br />
Wahlbeteiligung daran, dass die <strong>Kirche</strong>nwahl<br />
den <strong>Kirche</strong>nmitgliedern zu wenig<br />
bewusst ist? Müsste das Profil der OK<br />
geschärft werden? Müsste denjenigen,<br />
die in ihrer Gemeinde nicht angesprochen<br />
werden – also in Gruppen und<br />
Aktionen nicht vorkommen – gesagt<br />
werden, dass sie in der OK gut aufgehoben<br />
wären? Besonders Jugendliche<br />
sollten gewonnen werden.<br />
Profil schärfen<br />
Bei dieser Diskussion ging es auch um<br />
die Wortwahl: Mit der Vokabel „<strong>Kirche</strong>nferne“<br />
schließe die „Lebendige<br />
Gemeinde“ Menschen aus der so<br />
genannten Kerngemeinde aus. In der<br />
OK sollte besser von <strong>Kirche</strong>nkritischen<br />
oder <strong>Kirche</strong>ndistanzierten gesprochen<br />
werden. Der gesellschaftliche Trend sei<br />
gegen die OK, wurde behauptet. Die<br />
Menschen hätten heute andere Probleme<br />
als die OK-GründerInnen. Gerechtigkeit<br />
etwa sei ein aktuelles Thema, zu<br />
dem die Landeskirche nichts vorbringt.<br />
Der Mensch müsse im Mittelpunkt<br />
stehen, also die Themen „Arbeits-<br />
In Fensterhülle stecken<br />
und einsenden an:<br />
OFFENE KIRCHE<br />
Geschäftsstelle Reiner Stoll-Wähling<br />
Ilsfelder Straße 9<br />
70435 Stuttgart<br />
Telefon (07 11) 5 49 72 11<br />
Telefax (07 11) 3 65 93 29<br />
email: geschaeftsstelle@offene-kirche.de<br />
Antwort<br />
OFFENE KIRCHE<br />
Geschäftsstelle<br />
Stoll-Wähling<br />
Ilsfelder Straße 9<br />
70435 Stuttgart<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 19
losgkeit“, „Menschenrechte“ u.ä. Die<br />
OK müsste dabei mehr Mut zur Opposition<br />
aufbringen und zeigen, „dass wir<br />
eine andere <strong>Kirche</strong> wollen“. Für Themen<br />
auf die Straße zu gehen, müsse<br />
aber auch Spaß<br />
machen. Ziel sei die<br />
Öffnung der<br />
Gemeinden für<br />
kritische Theologie,<br />
sozial-diakonische<br />
Aufgaben und<br />
echte Integration<br />
der <strong>Kirche</strong>nmitglieder<br />
(das sind<br />
alle, die <strong>Kirche</strong>nsteuer<br />
zahlen!). Die<br />
OK-PfarrerInnen<br />
sollten sichtbar<br />
dabei helfen.<br />
Die Frage, ob die<br />
OK die Bischofswahl verloren habe,<br />
wurde überwiegend verneint. Denn<br />
damit, dass sie eine Frau aufstellte, habe<br />
sie Profil<br />
gezeigt.<br />
Trotzdem<br />
waren die<br />
Synodalen<br />
enttäuscht,<br />
dass so<br />
wenige<br />
Frauen aus<br />
den anderen<br />
Gesprächskreisen<br />
im<br />
ersten<br />
Wahlgang für<br />
die<br />
Kandidatin<br />
gestimmt<br />
haben.<br />
Zukunft<br />
Ein großes Thema war die Zukunft der<br />
OK im Zuge der Sparmaßnahmen. Unter<br />
der Moderation des Gemeindeberaters<br />
Hans-Martin Härter überlegten die<br />
Anwesenden in Gruppen, wie man die<br />
Probleme angehen könnte, wie sich die<br />
OK jetzt zeigt und wie sie in Zukunft<br />
sein sollte. Die Aufgabe: die OK kritisch,<br />
evangelisch und widerständig als<br />
Opposition zu präsentieren. Da auch<br />
kirchliche Sparmodelle nicht immer<br />
gerecht seien, bekräftigte Rainer<br />
Weitzel: „Wir werden uns nicht wegducken<br />
können, sondern müssen genau<br />
darüber Auskunft geben, wie wir uns<br />
die Zukunft vorstellen.“<br />
Renate Lück<br />
OFFENE KIRCHE – kompetent, kritisch, kreativ<br />
Antwort per Fax: 07 11/3 65 93 29<br />
Ja, ich will die OFFENE<br />
KIRCHE kennen lernen:<br />
Senden Sie mir bitte ausführliches<br />
Informationsmaterial<br />
zu:<br />
❑ Ein kostenloses Jahresabo der<br />
Zeitschrift OFFENE KIRCHE<br />
❑ Das OFFENE KIRCHE Wahlprogramm<br />
2001-2007<br />
❑ Nennen Sie mir bitte den Namen<br />
eines Ansprechpartners in der<br />
für mich zuständigen Bezirksgruppe<br />
Ja, ich will die OFFENE<br />
KIRCHE unterstützen:<br />
❑ Ich werde hiermit Mitglied der<br />
OFFENEN KIRCHE mit Stimmrecht<br />
bei den jährlichen Mitgliederversammlungen<br />
und kostenlosem Bezug<br />
der Zeitschrift OFFENE KIRCHE:<br />
Mitgliedsbeitrag jährlich mindestens Euro<br />
50,-, Paare stufen sich selbst ein<br />
zwischen mindestens Euro 50,- und Euro<br />
100,-; in Ausbildung Euro 15,-.<br />
❑ Ich abonniere hiermit die<br />
Zeitschrift OFFENE KIRCHE,<br />
4 Ausgaben jährlich, Euro 15,-jährlich<br />
❑ Ich bestelle das Themenbuch<br />
der OFFENEN KIRCHE: „...und<br />
strecke mich’ aus nach dem,<br />
was da vorne ist“ (Themen für die<br />
Evangelische Landeskirche in Württemberg)<br />
Euro 10,- zuzüglich Porto.<br />
Absender:<br />
................................................................<br />
Name<br />
................................................................<br />
Straße<br />
................................................................................<br />
PLZ Ort<br />
................................................................................<br />
Telefon Fax<br />
................................................................................<br />
email:<br />
................................................................................<br />
Geburtstag(freiwillig) Beruf (freiwillig)<br />
OFFENE KIRCHE<br />
Evangelische Vereinigung in Württemberg<br />
Pfarrerin Kathinka Kaden, Vorsitzende,<br />
Schillerstr. 29, 73340 Schalkstetten<br />
Tel. (0 73 31) 4 22 28, Fax (0 73 31) 4 07 68<br />
E-mail: Vorsitzende@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Internet: www.offene-kirche.de<br />
Seite 20 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
Bezirk Marbach<br />
Seid Täter des Wortes<br />
und nicht nur Hörer, wodurch ihr<br />
euch selbst betrügt.<br />
Freitag, 14. Oktober <strong>2005</strong>, 19.00<br />
Uhr, Evangelisches Gemeindehaus<br />
Benningen, In den Hofäckern<br />
◆ warum die Welt auf unsere Mitwirkung<br />
rechnen kann, oder<br />
◆ der Versuch, eine Außenansicht des<br />
Christseins zu skizzieren.<br />
Referent und Gesprächspartner: Pfarrer<br />
Wolfgang Wagner, Studienleiter an der<br />
Evangelischen Akademie Bad Boll.<br />
Frauenarbeit<br />
Wachsende <strong>Kirche</strong>?!<br />
Notwendiger Wandel?!<br />
Welche Auswirkungen haben diese<br />
Projekte der Landeskirche auf die Arbeit<br />
der Frauen?<br />
Das Frauenwerk lädt zu einem Prälaturarbeitstag<br />
ins Gästehaus der Diakonieschwesternschaft<br />
in Herrenberg ein, und<br />
zwar Donnerstag, den 21. Juli <strong>2005</strong> von<br />
13.45 bis 18 Uhr.<br />
Anmeldung bis spätestens 13. Juli unter<br />
(07 11) 20 68-222 oder<br />
Marianne.Trinkle@elk-wue.de<br />
Buchbesprechung<br />
Vernichtet<br />
Das groß angelegte, kirchengeschichtlich<br />
notwendige und theologisch wichtige<br />
Werk der beiden <strong>Kirche</strong>nhistoriker<br />
Röhm (früher in der religionspädagogischen<br />
Aus- und Fortbildung Württembergs<br />
tätig) und Thierfelder (jetzt<br />
emeritierter PH-Professor von Heidelberg)<br />
ist durch einen weiteren Band<br />
ergänzt worden: Beide Autoren, die vor<br />
über zwanzig Jahren durch die Konzipierung<br />
einer außergewöhnlichen<br />
Ausstellung zum Thema „Evangelische<br />
<strong>Kirche</strong> zwischen Kreuz und Hakenkreuz“<br />
EKD-weit bekannt und geschätzt<br />
wurden, haben es sich zur Lebensaufgabe<br />
gemacht, jene dunkle Zeit der<br />
Verfolgung und Vernichtung so aufzuarbeiten,<br />
dass Einzelschicksale im Zusammenhang<br />
von politischen und theologischen<br />
Entscheidungen gesehen und<br />
nachvollziehbar werden. So wachsen<br />
Kenntnis- und Problembewusstsein. Aus<br />
Betroffenheit wird religiöse und politische<br />
Perspektive. Aus selektiver Wahrnehmung<br />
wird eine Gesamtschau, die<br />
die bloße moralische Deutung zu<br />
kirchlicher und gesellschaftlicher<br />
Konsequenz heute lenkt. Viele Details in<br />
diesem dem Prozess der Verfolgung und<br />
Vernichtung der Juden von 1941 bis<br />
1945, sowie den sehr bedeutenden<br />
Hilfsmaßnahmen einzelner Personen<br />
und kirchlicher Stellen gewidmeten<br />
Buch sind erschreckend und beschämend<br />
– so z.B. die furchtbaren Begriffe<br />
„Judensternträger“ und „Sternverordnung“<br />
(ganz im Gegensatz zu dem<br />
autobiografischen Buch von Inge<br />
Auerbacher, Ich bin ein Stern), die<br />
Verweigerung des Abendmahls für<br />
„nichtarische“ Christen, die erzwungenen<br />
Ehescheidungen… Dass es Zeichen<br />
der Solidarität gab (vor allem in den<br />
skandinavischen Ländern und den<br />
protestantischen Gebieten Frankreichs –<br />
neben der berühmten „Pfarrhauskette“)<br />
braucht nicht verschwiegen zu werden<br />
– darf aber nie ein Alibi für eine müde,<br />
introvertierte und angepasste Christenheit<br />
sein. Diese „Lichter in der Dunkelheit“<br />
(S.161) sollten in gegenwärtiger<br />
oberflächlicher Diskussion und auch an<br />
den Stammtischen dazu führen, genauer<br />
hinzusehen und hinzuhören – die<br />
wenigen Dokumente zu beachten, die<br />
Lebenswege und die Verzweiflung von<br />
Opfern und Helfern dahinter zu verstehen<br />
und der Opfer zu gedenken, um<br />
deretwillen sich etwa der schlichte<br />
Berliner Polizist Mattick am Rand seiner<br />
Existenz bewegte, wenn er jüdische<br />
Flüchtlinge im Pfarrhaus der schwedischen<br />
Gesandtschaft in Berlin deckte. So<br />
wird dieses Studierbuch zu einer<br />
heilsamen Lektüre, weil es aus dem<br />
erschrockenen Schweigen zu reflektiertem<br />
Handeln in der Gegenwart führt,<br />
weil es Vorbilder und stellvertretende<br />
Zeugen und Zeuginnen nennt, an denen<br />
wir Heutige uns messen müssen.<br />
Eindrucksvoll ist der Schluss des Bandes,<br />
wo der schwere Weg von Dora Veit<br />
nachgezeichnet wird, die sich als junge<br />
Jüdin aus dem Stuttgarter Raum taufen<br />
ließ, eine kirchliche Ausbildung durchlief<br />
und nach Verfolgung und Emigration<br />
in der Nachkriegszeit nicht nur<br />
Boden unter die Füße bekam sondern in<br />
der württembergischen Landeskirche<br />
eine bedeutende Rolle in Schule und<br />
Bildungsarbeit übernahm. Und dennoch<br />
darf der gewaltsame von Deutschen<br />
verursachte Tod nicht übersehen<br />
werden – etwa im Schicksal des holländischen<br />
Jungen Klaus Seckel, der –<br />
vergleichbar dem Tagebuch der Anne<br />
Frank – von vielerlei Freunden und<br />
Institutionen zunächst behütet seine<br />
täglichen Notizen machen konnte, aber<br />
dessen letzter Satz vor der tödlichen<br />
Deportation im Sommer 1943 lautet:<br />
„Meine Pflanzen sind sehr gewachsen –<br />
sie vertrocknen gerade – wenig Zeit“!<br />
Eberhard Röhm und Jörg Thierfelder<br />
haben (wieder) eine Lernhilfe geschrieben<br />
– und das ist weit mehr als eine<br />
Sammlung von kommentierten Dokumenten<br />
und Originalen – eine Hilfe,<br />
sich der Vergangenheit heilend zu<br />
erinnern. Dafür sei ihnen beiden<br />
gedankt.<br />
Christian Buchholz<br />
Eberhard Röhm, Jörg Thierfelder,<br />
Juden-Christen-Deutsche – Band 4/<br />
I:1941-1945 „Vernichtet“, Calwer<br />
Verlag Stuttgart 2004, ISBN 3-7668-<br />
3887-3, 19,90 Euro.<br />
Buchbesprechung<br />
Spätlese bei Ernst Fuchs<br />
Äußerlich schlicht – aber inhaltlich<br />
bedeutungsschwer und manche Wurzeln<br />
aktueller Pfarrertheologie klärend –<br />
kam dieser kleine Gedenkband zum<br />
100. Geburtstag von Ernst Fuchs 2003<br />
daher. Ein eigenwilliger und kantiger,<br />
intellektuell anspruchsvoller und dem<br />
Predigen verpflichteter Theologe und<br />
Sie<br />
Auch<br />
können in der<br />
OFFENEN KIRCHE<br />
werben!<br />
Fordern Sie Ihre Mediadaten an<br />
bei: SAGRAL<br />
Kommunikationsagentur<br />
im Bereich der <strong>Kirche</strong>n<br />
Fax: (0 71 21) 50 60 18<br />
E-mail: SAGRAL@t-online.de<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 21
Hochschullehrer, der schwäbische<br />
Gemeindepfarrer und Kämpfer für den<br />
herausfordernden Weg der <strong>Kirche</strong> im<br />
Naziregime (dies vor allem sei dankbar<br />
nach dem Jubiläumsjahr von Barmen<br />
vermerkt) und während der Nachkriegszeit,<br />
wird mit diesem Buch bedacht.<br />
Eine ganze Generation ist durch ihn<br />
mitgeprägt worden – so auch Eberhard<br />
Jüngel und – hier im Ländle – Robert<br />
Schuster, die beide bei ihm promoviert<br />
haben! Von diesen beiden sind interessante<br />
biografische und theologische<br />
Beiträge veröffentlicht – aber auch von<br />
Jörg Thierfelder die historische Einordnung<br />
seines Lebenswerks oder von<br />
Christoph Demke (bis 1997 Bischof der<br />
<strong>Kirche</strong>nprovinz Sachsen) eine Auseinandersetzung<br />
um das Vollmachtsverständnis<br />
von Jesus, äußerst informative<br />
knappe Werkstattberichte von jüngeren<br />
Theologen, die kundig zu einzelnen<br />
Themenkreisen der Arbeit von Fuchs<br />
hinführen, lesenswert die Originaltexte<br />
von Predigten, ein Briefwechsel mit<br />
Rudolf Bultmann, Vorträge und – als<br />
kirchengeschichtliches Kleinod – eine<br />
Darstellung der Position der Bekennenden<br />
<strong>Kirche</strong> von 1937, das Urteil über<br />
den Gleichklang von existentialer<br />
Bibelinterpretation in Seelsorge und<br />
Verkündigung bei Fuchs sowie die<br />
ausgezeichnete Einführung in das<br />
„sakramentale“ Textverständnis und ein<br />
älterer Beitrag, der dem „Überfluss<br />
Gottes“ nachdenkt und die „Nötigung<br />
zur Predigt“ als Grundbewegung der<br />
Theologie von Ernst Fuchs bezeichnet.<br />
Das alles klingt wie aus fernen Zeiten.<br />
Ob es uns Heutigen Ansporn zu „intellektueller<br />
Redlichkeit“ und stimmiger<br />
Frömmigkeit, zu vertiefter Predigt-<br />
Bemühung für Pfarrerinnen, Pfarrer und<br />
Gemeindemitglieder sein kann? Ernst<br />
Fuchs und der Gedenkband werden –<br />
nach aufmerksamer und anspruchsvoller<br />
Lektüre – dazu beitragen und einer um<br />
sich greifenden Theologievergessenheit<br />
unsrer Tage abhelfen.<br />
Christian Buchholz<br />
Christian Möller (Hg.), Freude an<br />
Gott – Hermeneutische Spätlese bei<br />
Ernst Fuchs, Waltrop 2003, ISBN 3-<br />
89991-012-15, 374 Seiten, 20 Euro.<br />
Buchbesprechung<br />
Notwendige Abschiede<br />
„Es wackelt alles!“ soll 1896 der junge<br />
Ernst Troeltsch den Freunden der<br />
„christlichen Welt“ zugerufen haben.<br />
Damit meinte er die Bedrohung von<br />
Theologie und <strong>Kirche</strong> durch das historische<br />
Denken, die Auflösung der Offenbarung<br />
Gottes in historische, literarische,<br />
soziologische und religionsgeschichtliche<br />
Vorgänge und also<br />
letztendlich in ein Nichts. Da berührt es<br />
schon seltsam, wenn ein emeritierter<br />
Professor für Praktische Theologie so tut,<br />
als seien die „notwendigen Abschiede<br />
von überlieferten Glaubensvorstellungen“<br />
irgendwie neu. Gleichwohl<br />
müht er sich auf 341 Seiten damit ab<br />
und hat für Vorschläge „auf dem Weg<br />
zu einem glaubwürdigen Christentum“<br />
(3. Teil) nur noch Potenz für ganze 34<br />
Seiten. Das erinnert doch etwas an<br />
einen Hochspringer, der erstmal das<br />
ganze Stadion umrundet und sich dann<br />
wundert, dass er keine Kraft mehr<br />
findet, um über die Latte zu kommen.<br />
Dennoch muss man Jörns dankbar sein,<br />
dass er die gegenwärtige Befindlichkeit<br />
ausführlich erforscht, nicht zuletzt<br />
durch eigene Umfragen. Eine solche<br />
empirisch-kritische Theologie ist viel zu<br />
selten. Andererseits könnten die dargestellten<br />
Differenzen zur offiziellen<br />
kirchlichen Lehre (was immer das ist)<br />
nicht nur der religiösen Autonomie des<br />
modernen Zeitgenossen entspringen,<br />
sondern auch ihre Ursache haben in<br />
einer von ihm selbst beklagten „sich<br />
unter uns ausbreitenden Gottesvergessenheit“.<br />
So wird also erst einmal<br />
Abschied genommen von der reformatorischen<br />
Grundvorstellung „allein die<br />
Schrift!“. Ob seine Abschiede von<br />
„Erwählungs- und Verwerfungsvorstellungen“<br />
oder „von der Vorstellung<br />
einer wechselseitigen Ebenbildlichkeit<br />
von Gott und Mensch“ dem gegenwärtigen<br />
Stand des jüdisch-christlichen<br />
Dialogs entsprechen, sei dahingestellt.<br />
Fatal ist es aber, wenn er wieder die alte<br />
Gegensätzlichkeit von „jüdischer Bibel“<br />
(AT) und „christlicher Bibel“ (NT)<br />
bemüht. Seit Marcion (2. Jahrhundert)<br />
versucht die Christenheit, die ganze<br />
Bibel als Heilige Schrift zu lesen und<br />
allerdings auch zu interpretieren. Für<br />
Evangelische gilt der Maßstab „was<br />
Christum treibet“ (Martin Luther).<br />
Dabei bleiben nun einmal wesentliche<br />
Vorstellungen wie etwa Jesu Tod als<br />
Sühneopfer von Anfang an umstritten.<br />
Es kommt wohl darauf an, wie man mit<br />
dem Streit darum in der <strong>Kirche</strong> umgeht.<br />
Zwischen Verketzerung und Gleichgültigkeit<br />
muss ein verantwortungsvoller<br />
Umgang mit der tradierten Überlieferung<br />
gefunden werden. In seinem Buch<br />
fällt mir dazu ein überaus kritischer<br />
Blick auf die Bibel, aber ein relativ<br />
unkritischer auf Islam und östliche<br />
Religionen auf. Es ist schon kühn, die<br />
Warnung vor Synkretismus eine „inzestuöse<br />
Theologie“ zu nennen. Da das<br />
Christentum keine Stammesreligion ist,<br />
hat es schon immer Anregungen aus<br />
anderen Kulturen aufgenommen. Es<br />
kommt aber theologisch darauf an, alles<br />
zu prüfen und nur das Gute zu behalten.<br />
Gleichwohl enthält das Buch viele<br />
wertvolle Gedanken, die man mit<br />
Zustimmung liest. So ist es sicherlich<br />
richtig, dass „die Arbeit am religiösen<br />
Gedächtnis der Menschheit“ bei der<br />
eigenen Religion beginnen muss.<br />
Mittlerweile haben viele Theologen<br />
benachbarte Gebiete geistlich aufgearbeitet<br />
und auch die Religionswissenschaft<br />
in der Theologie beheimatet. Es<br />
ist erstaunlich, dass Jörns davon wenig<br />
diskutiert. Überhaupt zeigt das Literaturverzeichnis,<br />
dass er vor allem auf die<br />
aktuelle Situation eingeht. Die großen<br />
Meister der evangelischen liberalen<br />
Theologie werden ignoriert. Friedrich<br />
Heiler beispielsweise wird nur indirekt<br />
aus Sekundärquellen zitiert, Rudolf Otto<br />
überhaupt nicht. Bei seinen Vorschlägen<br />
fällt auf, dass kirchliche Praxis in ihrer<br />
Breite vieles längst verwirklicht. Ein<br />
„Tag der Schöpfung“ wird beispielsweise<br />
in vielen Gemeinden gefeiert,<br />
interreligiöse Dialoge gehören insbesondere<br />
in den Schulen zum Alltag. Die<br />
ganze Breite der diakonischen Arbeit,<br />
wo sich die <strong>Kirche</strong> gewissermaßen am<br />
weitesten „in die Welt“ hinaustraut,<br />
wird kaum erwähnt. Vor allem aber<br />
vermisst man den Gesprächspartner der<br />
Gegenposition. Es gibt ja nicht ohne<br />
Grund in den <strong>Kirche</strong>n eine eher evan-<br />
Seite 22 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>
gelikale Reaktion, die sich nicht zuletzt<br />
bei jungen Leuten eines großen Zuspruchs<br />
erfreut. Zwar spricht Jörns<br />
häufig von der weltweiten Ökumene,<br />
doch bleibt sein Horizont ziemlich<br />
deutsch. Aber auch ein heimischer<br />
Theologe wie Klaus Berger, der jüngst<br />
mit seinem Jesusbuch die exegetischen<br />
Grundlagen neu dargestellt hat, wird<br />
nicht recht ernst genommen. So legt<br />
man dieses vielfach anregende Buch<br />
letztendlich doch mit gemischten<br />
Gefühlen aus der Hand.<br />
Wolfgang Wagner<br />
Klaus-Peter Jörns: Notwendige<br />
Abschiede, auf dem Weg zu einem<br />
glaubwürdigen Christentum. Gütersloher<br />
Verlagshaus, Gütersloh 2004,<br />
ISBN: 3-579-06408-8, 416 Seiten,<br />
24,95 Euro.<br />
Buchbesprechung<br />
Buddhismus verstehen<br />
Wer das Buch von Ulrich Dehn „Das<br />
Klatschen der einen Hand“ von 1999<br />
kennt, wird enttäuscht sein. Denn es ist<br />
mit geringen Veränderungen und einem<br />
zusätzlichen Kapitel lediglich mit einem<br />
neuen Titel in einem neuen Verlag<br />
wieder aufgelegt worden. Es ist nicht<br />
sehr aufrichtig, dass dies lediglich in<br />
wenigen Zeilen der Einleitung mitgeteilt<br />
wird. Man wundert sich auch, dass der<br />
Autor sich nicht herausgefordert fühlte,<br />
die Veränderungen in den letzten fünf<br />
Jahren mit einzubeziehen. So ist nicht<br />
nur die Zahl der Anhänger von damals<br />
70 000 auf derzeit ca. 170 000 gestiegen,<br />
sondern die Entwicklung des<br />
Buddhismus in Deutschland hat sich<br />
institutionalisiert und christlich-buddhistische<br />
Dialoge haben auf <strong>Kirche</strong>ntagen<br />
und in Akademien zugenommen. Der<br />
Dalai Lama beispielsweise ist nicht nur<br />
in der Lüneburger Heide und in Graz<br />
aufgetreten, sondern auch auf dem<br />
Ökumenischen <strong>Kirche</strong>ntag in Berlin.<br />
Dies hat erregte Diskussionen zur Folge<br />
gehabt, über die der Autor nichts<br />
mitteilt. So beschränkt er beispielsweise<br />
„Deutschlands buddhistische Geschichte“<br />
auf die Pioniere des letzten Jahrhunderts.<br />
Interessant ist dabei die etwas<br />
ausführlichere buddhistische Beeinflussung<br />
Richard Wagners. Aber aus der<br />
Gegenwart wird lediglich Sylvia Wetzel<br />
erwähnt, die nicht unbedingt typisch ist<br />
für die heutige Diskussion. Ihre Zeitschrift<br />
„Lotusblätter“ heißt längst<br />
„Buddhismus aktuell“ und hat eine<br />
andere Schriftleitung. Bei der Darstellung<br />
des klassischen Buddhismus<br />
beschränkt sich der Autor weiterhin<br />
wesentlich auf den japanischen Zen-<br />
Buddhismus, wo er sich besonders gut<br />
auskennt, und den tibetischen Buddhismus.<br />
Kaum erwähnt wird der Theravada-Buddhismus,<br />
der sozusagen die<br />
Urform tradiert und insbesondre von der<br />
Deutschen Buddhistischen Union<br />
gepflegt wird. Nur gestreift wird der<br />
Amida-Buddhismus, obwohl insbesondere<br />
die evangelisch-theologische<br />
Fakultät Marburg seit Jahren mit den<br />
Vertretern dieser Richtung akademische<br />
Dialogveranstaltungen durchführt.<br />
Angesichts der anschwellenden buddhistischen<br />
Veröffentlichungen in Deutschland<br />
wäre auch eine Auseinandersetzung<br />
mit diesen Publikationen hilfreich.<br />
Wirklich neu ist das 11. Kapitel „Buddhismus<br />
und Gewaltfreiheit – mit einem<br />
Blick auf das Christentum“. Leider<br />
erwähnt der Verfasser nicht, dass er<br />
diese Gedanken in Grundzügen bereits<br />
2002 auf einer Tagung der evangelischen<br />
und katholischen Akademie<br />
vorgetragen hat. (Buddhas Weg nach<br />
Westen, Protokolldienst 22/03 der Ev.<br />
Akademie Bad Boll).<br />
Wichtig für den Dialog ist seine Erkenntnis,<br />
dass auch der Buddhismus durchaus<br />
gewaltsames Verhalten hervorbringen<br />
konnte und kann: „Die häufig zu<br />
hörende Behauptung, es habe in der<br />
Geschichte des Buddhismus keine<br />
buddhistisch legitimierte Gewalt und<br />
keine buddhistisch legitimierten Kriege<br />
gegeben, ist unzutreffend“. Leider<br />
enthält auch diese Neuausgabe am<br />
Schluss kein Verzeichnis der verwendeten<br />
Literatur, die lediglich in den<br />
Anmerkungen nachgewiesen wird. So<br />
übersieht man leicht, dass ja bereits M.<br />
v. Brück und W. Lai (Buddhismus und<br />
Christentum. Geschichte, Konfrontation,<br />
Dialog, München 1997) ein grundlegendes<br />
Werk zu unserer Thematik vorgelegt<br />
haben.<br />
Wolfgang Wagner<br />
Ulrich Dehn: Buddhismus verstehen,<br />
Versuche eines Christen.<br />
Verlag Otto Lembeck, Frankfurt<br />
2004. ISBN: 3-87476-458-3, 210<br />
Seiten, 16 Euro.<br />
Das Zitat<br />
„Die evangelikalen Strömungen<br />
bilden in den USA selbst<br />
eine Bastion des christlichen<br />
Fundamentalismus, und verschiedene<br />
Anzeichen deuten<br />
darauf hin, dass unter dem<br />
Druck der religiösen Rechten<br />
die USA den pluralistischen<br />
Weg verlassen. (...) Der<br />
fundmentalistische Protestantismus<br />
ist in den Sog einer<br />
extremistischen Häresie geraten,<br />
deren Neigung zu Manipulation<br />
und Politisierung<br />
nicht nur Agnostikern Sorge<br />
bereitet, sondern auch Gläubige<br />
aller Konfessionen beunruhigen<br />
muss. Ähnlich wie<br />
im islamischen Fundamentalismus<br />
wird Religion für profan-reaktionäre<br />
Zielsetzungen<br />
missbraucht."<br />
Prof. Dr. Claus Leggewie, Gießen,<br />
(Aus Politik und Zeitgeschichte, 7/<br />
<strong>2005</strong>)<br />
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />
OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong> OFFENE KIRCHE<br />
Seite 23
Leserbriefe<br />
Zur Landesbischofswahl:<br />
Über die Qualitäten der Bischofskandidaten<br />
steht mir kein Urteil zu.<br />
Dass die Kandidatin von der Landessynode<br />
nur für halb so qualifiziert<br />
gehalten wurde, wird sicher von vielen<br />
Frauen als Demütigung empfunden<br />
werden. Es wird manche Frauen in<br />
Württemberg abschrecken, für kirchliche<br />
Ämter zu kandidieren. Anderswo<br />
sind die Chancen für Frauen sicherlich<br />
größer. So wurde vor kurzem die erste<br />
Bischöfin der Evangelisch-methodistischen<br />
<strong>Kirche</strong> gewählt. Wahrscheinlich<br />
war es ein Fehler der Bewerberin, mehr<br />
Intellektualität zu fordern. Das lassen<br />
sich Männer nicht gerne sagen. Hier<br />
wurde wieder mal Mut zur Offenheit<br />
nicht belohnt. Wer nicht aneckt,<br />
gewinnt.<br />
Noch problematischer ist für mich, dass<br />
Medien und Öffentlichkeit das Wahlergebnis<br />
entsprechend der Zuordnung<br />
der KandidatIn zu „Gesprächskreisen“<br />
ziemlich genau vorhersagen konnten. Es<br />
scheint demnach eine Gesinnungswahl<br />
gewesen zu sein, bei der wie im Bundestag<br />
kollektiv nach Fraktionen abgestimmt<br />
wurde. Unabhängige Geister mit<br />
eigenständigem Profil scheinen wohl<br />
auch in dieser Synode Mangelware zu<br />
sein. So setzt sich im kirchlichen Bereich<br />
die demokratiefeindliche Praxis fort,<br />
Ausgrenzung und Vereinsamung um der<br />
eigenen Überzeugung willen nicht mehr<br />
riskieren zu können, seitdem wir<br />
autoritäre Herrscher wie Kohl, Strauß,<br />
Schröder und Fischer in einer Demokratie<br />
dulden.<br />
Hansbernhard Mistele, Heilbronn<br />
Zu „Evang. Stimme in Europa“,<br />
<strong>Offene</strong> <strong>Kirche</strong> 1/<strong>2005</strong>:<br />
Dieter Heidtmann berichtet von seiner<br />
Arbeit als Vertreter der Gemeinschaft<br />
der evangelischen <strong>Kirche</strong>n Europas in<br />
Brüssel. Dass das Thema „Europa“ im<br />
OK-Presseorgan Raum findet, ist sehr zu<br />
begrüßen. Bedauerlich ist allerdings,<br />
dass es zum Bericht Heidtmanns von<br />
Seiten der OK-Redakteure keine Nachfragen<br />
und Rückfragen gegeben hat.<br />
Dabei wäre es doch interessant gewesen,<br />
von „unserem Mann in Brüssel“ zu<br />
erfahren, ob es bezüglich der künftigen<br />
EU-Verfassung außer im Zusammenhang<br />
mit der Frage des Gottesbezugs in der<br />
Präambel und der Anerkennung der<br />
Rechtsstellung der <strong>Kirche</strong>n (Artikel 1.<br />
52) noch andere Versuche der Einflussnahme<br />
von kirchlicher Seite gegeben<br />
hat. Wenn es den evangelischen<br />
<strong>Kirche</strong>n in Europa laut Beschluss der<br />
Vollversammlung ihrer Vertreter 2001<br />
in Belfast darum geht, „die theologischen<br />
und ethischen Aspekte und<br />
humanitären Konsequenzen politischer<br />
Entscheidungen aus der Sicht des<br />
Evangeliums“ in Brüssel zur Sprache zu<br />
bringen, dann wäre doch wohl zuallererst<br />
zu den Inhalten der Verfassung<br />
selbst eine Äußerung von kirchlicher<br />
Seite zu erwarten. Doch ist es nach<br />
meiner Wahrnehmung leider so, dass<br />
die „Evangelische Stimme in Europa“<br />
gerade an dieser zentralen Stelle<br />
beharrlich schweigt. Damit wird auch<br />
ein Rückkoppelungs-Potential von einer<br />
an sich begrüßenswerten Sonderpfarrstelle<br />
an die heimische kirchliche<br />
Basis verschenkt. Kein Wort also zu den<br />
gravierenden demokratischen Defiziten<br />
dieses Verfassungs-Entwurfs. Kein Wort<br />
zu der Frage, ob diese Verfassung von<br />
kirchlicher Seite als grundgesetzkompatibel<br />
angesehen werden kann.<br />
Das kirchliche „Wächteramt“ scheint<br />
nur im Sinne des „wir sind (als <strong>Kirche</strong>)<br />
für uns selber da“ wahrgenommen zu<br />
werden. Und das trotz des schönen<br />
Editorials von Hans-Peter Krüger. –<br />
Doch weiter: Kein Wort von Dieter<br />
Heidtmann zu den einseitig neoliberalen<br />
Konturierungen dieser Verfassung. Gab<br />
es da nicht einmal eine EKD-Denkschrift<br />
unter dem Titel „Für eine Zukunft in<br />
Solidarität und Gerechtigkeit“? Das war<br />
1997. Nun zitiert Herr Heidtmann zwar<br />
Römer 14.17.19! Doch wie wirkt dieses<br />
Zitat angesichts der verfassungspolitischen<br />
Realität, die da in Straßburg und<br />
Brüssel geschaffen wird und angesichts<br />
der kirchlichen Stimmenthaltung!?<br />
Übrigens auch kein Wort zur Frage<br />
eines künftigen Europa mit einer – von<br />
der Verfassung geforderten – sehr viel<br />
stärkeren militärischen Ausrichtung, mit<br />
weltweiten Ambitionen! (Siehe auch:<br />
„Europäische Sicherheits-Strategie“ /<br />
ESS). Das macht für die Zukunft Angst<br />
und darum stünde es m. E. der OK gut<br />
an, sich diesem Themenkomplex in<br />
einer der nächsten Informations-<br />
Nummern eingehender zu widmen. Es<br />
ist doch eigenartig: Wir rufen gegenwärtig<br />
die 60 Jahre zurückliegenden<br />
Ereignisse vom Kriegsende und der<br />
Nazi-Diktatur in Erinnerung. Wir<br />
nehmen gleichzeitig aber nicht wahr,<br />
dass wir verfassungspolitisch die Lektionen<br />
aus dem 20. Jahrhundert (zumal als<br />
Christen in Deutschland) geradezu<br />
fahrlässig verdrängen und verleugnen.<br />
Christian Horn, Schwäbisch Hall<br />
Impressum<br />
Die Zeitschrift OFFENE KIRCHE wird herausgegeben<br />
vom Leitungskreis der OFFENEN KIRCHE:<br />
Vorsitzende:<br />
Kathinka Kaden, Pfarrerin, Schillerstr. 29,<br />
73340 Schalkstetten<br />
Tel. (0 73 31) 4 22 28, Fax (0 73 31) 4 07 68<br />
Kontakt: Vorsitzende@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Stellvertretender Vorsitzender:<br />
Rainer Weitzel, Berater, Weilstetter Weg 40<br />
70567 Stuttgart, Tel. (07 11) 7 19 63 06<br />
Kontakt: St.Vorsitzender@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Weitere Leitungskreismitglieder:<br />
Albrecht Bregenzer, Frickenhausen<br />
Kontakt: Albrecht.Bregenzer@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Cornelia Brox, Krankenschwester, Lenningen, MdLs<br />
Kontakt: Cornelia.Brox@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Gisela Dehlinger, Pfarrerin, Heilbronn<br />
Kontakt: Gisela.Dehlinger@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Markus Grapke, Pfarrer z.A., Zuffenhausen<br />
Kontakt: Markus.Grapke@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Renate Lück, Journalistin, Sindelfingen<br />
Kontakt: Renate.Lück@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Michael Kannenberg, Pfarrer, Künzelsau<br />
Kontakt: Michael.Kannenberg@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Dr. Martin Plümicke, Dozent, Reutlingen<br />
Kontakt: Martin.Plümicke@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Reiner Stoll-Wähling, Volkswirt (FH), Stuttgart<br />
Rechner: und Geschäftsstelle<br />
gleichzeitig Bestelladresse der OFFENEN KIRCHE<br />
Reiner Stoll-Wähling,<br />
Ilsfelder Straße 9, 70435 Stuttgart<br />
Tel.: (07 11) 5 49 72 11, Fax: 3 65 93 29<br />
Kontakt: Geschaeftsstelle@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Konten :<br />
Kreissparkasse Ulm, Nr. 1661 479 (BLZ 630 500 00)<br />
Postgiro Stuttgart Nr. 1838 50-703 (BLZ 600 100 70)<br />
Redaktionskreis:<br />
V.i.S.d.P.: Renate Lück, Journalistin, Sindelfingen<br />
Friedrich-Ebert-Straße 17/042<br />
Hans-Peter Krüger, Pfarrer und Kommunikationswirt<br />
Jan Dreher-Heller, Theologe und Kommunikationswirt,<br />
Reutlingen<br />
Wolf-Dieter Hardung, Dekan i.R., Tübingen<br />
Die Zeitschrift OFFENE KIRCHE erscheint nach<br />
Bedarf, aber mindestens viermal im Jahr. Für<br />
Mitglieder der OFFENEN KIRCHE ist das<br />
Bezugsgeld im Mitgliedsbeitrag eingeschlossen. Alle<br />
anderen BezieherInnen bezahlen jährlich 15 Euro.<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die<br />
Meinung des/der VerfasserIn wieder und stellen<br />
nicht unbedingt die Meinung der HerausgeberInnen<br />
oder der Redaktion dar.<br />
AutorInnen:<br />
Eva-Maria Agster, <strong>Kirche</strong>nrätin, Langenau<br />
Hagop-Jan Avedikjan, Göppingen-Salach<br />
Benjamin Aynal, Reutlingen<br />
Christian Buchholz, Schuldekan, Dürnau<br />
Horst Oberkampf, Pfarrer i.R., Bad Saulgau<br />
Dr. Ursula Pfeiffer, Professorin, Tübingen<br />
Dr. Stephanie Saleth, Altdorf<br />
Wolfgang Wagner, Pfarrer, Bad Boll<br />
Harry Waßmann, Pfarrer, Tübingen<br />
Bernhard Wiesmeier, Politologe, Stuttgart<br />
Anzeigen, Gestaltung, Herstellung: SAGRAL –<br />
Satz, Grafik, Layout – Kommunikationsagentur im<br />
Bereich der <strong>Kirche</strong>n, Reutlingen<br />
Kontakt: SAGRAL@t-online.de<br />
Druck: Grafische Werkstätte der<br />
BruderhausDiakonie, Reutlingen<br />
Versand: Behinderten-Zentrum (BHZ), Stuttgart-<br />
Fasanenhof<br />
Quellennachweis: Seiten 1: epd-Bild; Seite 2: Marcks,<br />
Löwensteiner Cartoon Service (LCS); Seite 3:<br />
Tomaschoff (LCS); Seite 4: Küstenmacher (LCS),<br />
epd-Bild, Capra; Seite 5: Avedikjan; Seite 7: Oberkampf;<br />
Seite 9: Jan Kempe; Seiten 11, 12: Jörg<br />
Böthling, Brot für die Welt; Seiten 13, 14: Radius-<br />
Verlag; Seiten 15, 17: Buchholz; Seiten 19, 20: Lück.<br />
Wir bitten ausdrücklich um Zusendung von Manuskripten,<br />
Diskussionsbeiträgen, Informationen,<br />
Anregungen und LeserInnenbriefen. Die Redaktion<br />
behält sich das Recht der Kürzung vor.<br />
Redaktionsadresse:<br />
Redaktion@<strong>Offene</strong>-<strong>Kirche</strong>.de<br />
Mittnachtstr. 211<br />
72760 Reutlingen<br />
Fax: (0 71 21) 50 60 18<br />
Seite 24 OFFENE KIRCHE<br />
Nr. 2, Juni <strong>2005</strong>