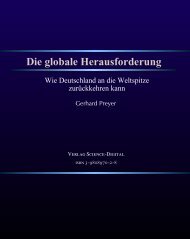Josef Bordat (Berlin) - Philosophia online
Josef Bordat (Berlin) - Philosophia online
Josef Bordat (Berlin) - Philosophia online
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine<br />
Wege!“ (Röm 11,33). Nach Karl Barth gibt es in diesem Sinne keine Lösung des Theodizee-<br />
Problems. Wir sind nicht berechtigt, Gott anzuklagen. Daraus folgt dann, wenn man weiter an<br />
Gott glauben will, zum zweiten das bedingungslose Vertrauen auf Gott. Hans Küng führt dazu<br />
in seinem Werk Christ sein aus, dass unbedingtes und restloses Vertrauen zu Gott, trotz der<br />
Unfähigkeit, das Rätsel des Leids und des Bösen lösen zu können, dem leidenden,<br />
zweifelnden, verzweifelten Menschen einen letzten Halt gebe und sich das Leid damit zwar<br />
nicht ursächlich „erklären“, aber doch bestehen lasse.<br />
Fatalismus à la Barth ist natürlich eine mögliche Lösung, aber es fällt trotz allem schwer,<br />
diese als eine zu verstehen, welche die Theodizee-Frage zum Verstummen bringt. Denn es ist<br />
eher so, dass schlicht gefordert wird, sie nicht zu stellen. Sie wird zur Ketzer-Frage erklärt -<br />
auf mehr läuft dieser Ansatz nicht hinaus. Küngs Vertrauen scheint kaum besser, doch gibt es<br />
hier zumindest eine Perspektive für das leidende Individuum. Die Frage nach dem Ursprung<br />
des Bösen wird zwar auch umgangen, aber zumindest wird dem leidenden Individuum ein<br />
Ausweg aufgezeigt, der auf die Überwindung des Leids ausgerichtet ist.<br />
Daran schließt der dritte Ansatz an. Die Depotenzierung des Gottesbegriffs betreibt auch den<br />
Perspektivwechsel von der Ursachenforschung zur Bewältigung des Übels und nimmt den<br />
Menschen in die Verantwortung.<br />
Der jüdische Philosoph Hans Jonas, der den Vernichtungslagern des Dritten Reiches selbst<br />
nur knapp entrann, beschreibt in seinem Büchlein Der Gottesbegriff nach Auschwitz (1984)<br />
eben jenen Gott als den, welcher um der Verstehbarkeit Willen seine Allmacht radikal<br />
einschränkt. Ein allmächtiger Gott, der nicht zu verstehen ist, bereitet Jonas mithin mehr<br />
Schwierigkeiten, als ein Gott, der zwar nicht mehr allmächtig ist, aber verstehbar bleibt.<br />
Die Aufgabe der Allmacht geschieht dabei im Zuge der Schöpfung. Damit wir zu existieren<br />
beginnen können, hört Gott partiell zu existieren auf. Der Schöpfer-Gott bindet sich selbst in<br />
seine Schöpfung ein und unterwirft sich gleichermaßem dem Leiden seiner Geschöpfe. Gott<br />
begibt sich damit in eine Schicksalsgemeinschaft mit dem Menschen. Aus Allmacht wird<br />
Ohnmacht. Zu hoffen bleibt ihm nur, so Jonas, dass der Mensch diese selbstindizierte<br />
Interdependenz von Schöpfer und Geschöpf in Verantwortung annimmt und sich mit Gott und<br />
für Gott darum bemüht, das Leid aus der Schöpfung – so weit es ihm möglich ist – zu<br />
entfernen. Also nicht mehr Wo warst Du, Gott?, sondern: Wo waren wir Menschen? Gott hat<br />
keine anderen Hände als unsere, ist ein bekanntes Diktum der Theologin Dorothee Sölle. Mit<br />
diesen sollen wir am Aufbau der unfertigen Schöpfung (Berger) mitwirken.