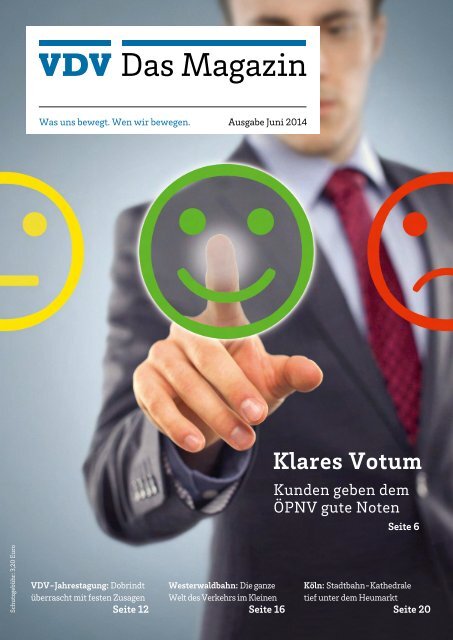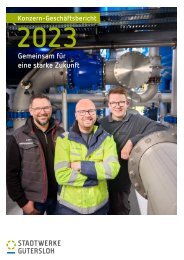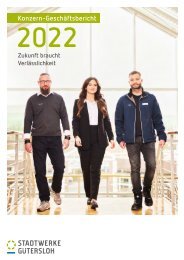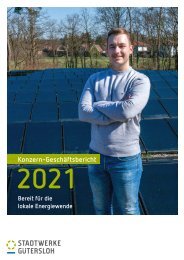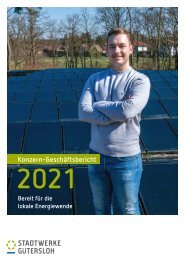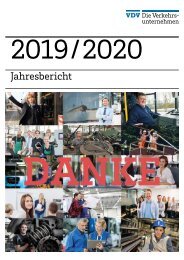VDV Das Magazin Ausgabe Juni 2014
Das Verbandsmagazin des VDV ist die redaktionelle Plattform für Unternehmen des Öffentlichen Personen- und Schienengüterverkehrs in Deutschland. Konzept und Realisierung: AD HOC PR, Gütersloh.
Das Verbandsmagazin des VDV ist die redaktionelle Plattform für Unternehmen des Öffentlichen Personen- und Schienengüterverkehrs in Deutschland.
Konzept und Realisierung: AD HOC PR, Gütersloh.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Was uns bewegt. Wen wir bewegen. <strong>Ausgabe</strong> <strong>Juni</strong> <strong>2014</strong><br />
Klares Votum<br />
Kunden geben dem<br />
ÖPNV gute Noten<br />
Seite 6<br />
Schutzgebühr: 3,20 Euro<br />
<strong>VDV</strong>-Jahrestagung: Dobrindt<br />
überrascht mit festen Zusagen<br />
Seite 12<br />
Westerwaldbahn: Die ganze<br />
Welt des Verkehrs im Kleinen<br />
Seite 16<br />
Köln: Stadtbahn-Kathedrale<br />
tief unter dem Heumarkt<br />
Seite 20
Inhalt<br />
24 Kombibus: In der Uckermark stärkt<br />
der Linienverkehr die Wirtschaft.<br />
20 Verkehrskathedrale: Heumarkt<br />
beeindruckt Kölner U-Bahn-Nutzer.<br />
12 <strong>VDV</strong>-Jahrestagung: Die Branche<br />
diskutiert in Berlin mit der Politik.<br />
28 Klare Ansage: Software kann<br />
professionelle Sprecher ersetzen.<br />
16 Westerwaldbahn: Mikrokosmos<br />
des Öffentlichen Verkehrs<br />
3 Editorial<br />
Den Worten Taten folgen lassen<br />
4 <strong>VDV</strong> im Bild<br />
„Talent im ÖPNV“ ausgezeichnet<br />
6 Titelstory<br />
Kundenbarometer: Nutzer geben<br />
Verkehrsunternehmen gute Noten.<br />
12 Aus dem Verband<br />
Alexander Dobrindt überrascht auf<br />
der <strong>VDV</strong>-Jahrestagung mit Zusagen.<br />
16 Unterwegs im Netz<br />
Westerwaldbahn: Busse und Bahnen<br />
zwischen Coils und Kosten<br />
2 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Editorial<br />
Den Worten<br />
Taten<br />
folgen lassen<br />
Die erste gute Nachricht vorweg: 98 Prozent aller<br />
Deutschen halten eine funktionierende Infrastruktur<br />
für wichtig oder sehr wichtig. <strong>Das</strong> ist das Ergebnis<br />
einer neuen Forsa-Studie. Die Bürger haben erkannt,<br />
welch bedeutende Rolle die Verkehrswege für Wirtschaft<br />
und Wohlstand spielen. Noch vor einem Jahr<br />
war das ganz anders: Damals waren vielen die Risiken,<br />
die sich aus dem langjährigen Investitionsstau<br />
ergeben, längst nicht bewusst.<br />
Und auch eine weitere Studie macht uns Mut.<br />
<strong>Das</strong> ÖPNV-Kundenbarometer <strong>2014</strong> hat gezeigt:<br />
83 Prozent der Nutzer sind zufrieden oder sogar sehr<br />
zufrieden mit dem Angebot der Verkehrsunternehmen.<br />
In fast allen Kategorien konnte sich die Branche<br />
verbessern, teils sogar deutlich. <strong>Das</strong> spiegelt sich auch<br />
in den aktuellen Fahrgastzahlen für das erste Quartal<br />
<strong>2014</strong> wider: 2,5 Milliarden Menschen haben unsere<br />
Bahnen und Busse genutzt – 1,2 Prozent mehr als im<br />
Vorjahreszeitraum. <strong>Das</strong> Wachstum geht also weiter,<br />
auch im Schienengüterverkehr.<br />
Um dieser Entwicklung weiter gerecht zu werden,<br />
müssen wir viel tun. Schon heute reichen die Kapazitäten<br />
an Knotenpunkten kaum noch aus – teilweise<br />
können die Unternehmen ihren eigenen Ansprüchen<br />
nicht gerecht werden. Hinzu kommen der Zustand der<br />
Infrastruktur und die offenen Finanzierungsfragen.<br />
Um diese Herausforderungen zu meistern, benötigen<br />
wir die Unterstützung der Politik. Die hohen Belastungen<br />
des Schienenverkehrs durch die geplante<br />
neue EEG-Umlage waren ein klarer Rückschlag.<br />
Doch jüngst gab es wieder positivere Signale. Auf der<br />
<strong>VDV</strong>-Jahrestagung Ende Mai in Berlin hat Alexander<br />
Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale<br />
Infrastruktur, zugesagt, noch in <strong>2014</strong> die Zukunft<br />
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes klären<br />
zu wollen. Auch für die Regionalisierungsmittel will<br />
er schnell eine Lösung finden, ebenso ein höheres<br />
Bußgeld für Schwarzfahrer durchsetzen. <strong>Das</strong> ist ein<br />
gutes Zeichen. Lange genug haben wir über die Probleme<br />
und ihre Lösungen diskutiert. Jetzt müssen wir<br />
handeln.<br />
Herzlichst Ihr<br />
Oliver Wolff<br />
20 Hintergrund<br />
Kölner U-Bahn-Station Heumarkt<br />
ist in ihrer Architektur einzigartig.<br />
24 Unterwegs im Netz<br />
Kombibus bringt Uckermärker<br />
enger zusammen.<br />
28 Hintergrund<br />
Hinter den Computerstimmen in<br />
Bus und Bahn steckt immer noch<br />
ein Mensch.<br />
30 Abgefahren<br />
Jazz‘n Roll: Feiern in der U-Bahn<br />
„<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“ finden<br />
Sie auch im Internet als<br />
E-Paper unter:<br />
www.vdv.de/das-magazin<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 3
„Kinder an die Macht“ hat gut lachen<br />
Keine Frage: Die Mitglieder des Vereins „Kinder an die Macht“ – hier interviewt von<br />
Moderatorin Judith Schulte-Loh – hatten auf der <strong>VDV</strong>-Jahrestagung gute Laune. <strong>Das</strong><br />
wundert nicht. Schließlich ist ihr zweiter Vorstand Henry Schulz (l.) stellvertretend für alle<br />
als „Talent im ÖPNV <strong>2014</strong>“ geehrt worden. Der Verein organisiert ehrenamtlich Ferienfreizeiten<br />
für Kinder und Jugendliche. Für dieses Engagement spendierte die Deutsche Bahn<br />
einen Reisegutschein. <strong>VDV</strong>-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff (r.) versprach zudem, 2015<br />
als Helfer eine Freizeit zu begleiten. Mehr zur Tagung und den Preisträgern ab Seite 12.<br />
4 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
<strong>VDV</strong> im Bild<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 5
Titelstory<br />
83<br />
Prozent<br />
der ÖPNV-Nutzer sind mit dem<br />
Angebot der Verkehrsunternehmen<br />
zufrieden oder sehr zufrieden.<br />
<strong>Das</strong> hat das aktuelle Kundenbarometer<br />
ergeben.<br />
6 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Titelstory<br />
Kunden vergeben<br />
gute Noten<br />
Top-Noten in der Kundenbeziehung und eine verbesserte Gesamtbewertung:<br />
Im ÖPNV-Kundenbarometer <strong>2014</strong> von TNS Infratest haben Nutzer des<br />
Öffentlichen Personennahverkehrs deutschlandweit repräsentativ Angebot<br />
und Service beurteilt. <strong>Das</strong> Fazit: 83 Prozent der Befragten sind zufrieden.<br />
„Ein so hoher Anteil zufriedener Fahrgäste<br />
– das ist ein Ergebnis, auf das die<br />
Verkehrsunternehmen stolz sein können“,<br />
sagt <strong>VDV</strong>-Präsident Jürgen Fenske:<br />
„Und es zeigt, dass die Nutzer unser Angebot<br />
wertschätzen.“ <strong>Das</strong> gute Abschneiden<br />
sei dabei keine Eintagsfliege. „Auch<br />
in den Vorjahren haben sich die Unternehmen<br />
auf einem fast ebenso hohen<br />
Niveau bewegt.“ <strong>Das</strong>s die Angebote<br />
Top-Noten erteilten<br />
die Nutzer für die<br />
schnelle Beförderung.<br />
Bei der Pünktlichkeit<br />
gab es ein<br />
„eher gut“.<br />
Zeitliche Entwicklung der Globalzufriedenheit<br />
2,3<br />
2,4<br />
2,5<br />
2,6<br />
2,7<br />
2,8<br />
2,9<br />
2,95<br />
2,91<br />
2,88 2,87<br />
2,84<br />
2,78<br />
2,85<br />
2,92 2,91 2,92<br />
2,83<br />
20<br />
3,0<br />
3,1<br />
3,2<br />
3,3<br />
3,04<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
2003<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 <strong>2014</strong><br />
ÖPNV-Branchendurchschnitt<br />
Veränderung in Prozent-Punkten zum Vorjahr<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 7
Titelstory<br />
1,0<br />
1,2<br />
1,4<br />
1,6<br />
1,8<br />
2,0<br />
2,2<br />
2,4<br />
2,6<br />
2,8<br />
3,0<br />
3,2<br />
3,4<br />
3,6<br />
3,8<br />
4,0<br />
2012<br />
<strong>2014</strong><br />
Gesamt<br />
17<br />
2,83<br />
Globalzufriedenheit: bessere Noten in den<br />
Ballungsräumen und bei den Täglich- und Vielfahrern<br />
13<br />
2,72<br />
Zufriedenheit<br />
Skala von 1 bis 5<br />
1 = vollkommen zufrieden<br />
5 = unzufrieden<br />
19<br />
2,88<br />
Ballungsraum<br />
Regionen<br />
Großstadt<br />
Umland<br />
20<br />
2,95<br />
ÖPNV-Nutzungshäufigkeit<br />
tgl./<br />
fast tgl.<br />
mind. 1x/<br />
Woche<br />
mind. 1x/<br />
Monat seltener<br />
n=1.326 n=630 n=164 n=510 n=327 n=320 n=235 n=422<br />
2012<br />
<strong>2014</strong><br />
Enttäuschte Kunden<br />
Anteil in Prozent<br />
(Skala 4 oder 5)<br />
17<br />
2,76<br />
13<br />
2,73<br />
14<br />
2,86<br />
20<br />
2,95<br />
0 %<br />
20 %<br />
40 %<br />
60 %<br />
80 %<br />
100 %<br />
Veränderung 2012/<strong>2014</strong><br />
signifikante Verbesserung<br />
signifikante Verschlechterung<br />
28<br />
Teilbereiche<br />
erzielten in der Umfrage<br />
bessere Noten als im<br />
Vergleichsjahr 2012. Nur<br />
vier Leistungskategorien<br />
schnitten schlechter ab.<br />
des ÖPNV gut ankommen, lässt sich auch<br />
außerhalb der Umfrage durch die neuesten<br />
Fahrgastzahlen belegen. Im ersten<br />
Quartal dieses Jahres haben demnach 2,5<br />
Milliarden Menschen die öffentlichen<br />
Verkehrsmittel genutzt – ein Plus von<br />
1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.<br />
Die aktuellen Zahlen hat der <strong>VDV</strong><br />
auf seiner Jahrestagung Ende Mai in Berlin<br />
vorgestellt.<br />
Gesamtnote 2,83: In der repräsentativen<br />
Umfrage konnten die 1.326 Teilnehmer<br />
Noten zwischen Eins („vollkommen<br />
zufrieden“) und Fünf („unzufrieden“)<br />
vergeben. Im Gesamtpaket erhielten der<br />
Öffentliche Personennahverkehr und<br />
seine Dienstleistungen eine 2,83. Damit<br />
liegt die sogenannte Globalzufriedenheit<br />
deutlich über dem Durchschnitt von 2013<br />
(2,92) und 2012 (2,91). Besonders gut<br />
Die ÖPNV-Nutzer haben auch die<br />
Fahrkartenautomaten bewertet. Hier<br />
sehen die Kunden noch Verbesserungsbedarf.<br />
8 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Titelstory<br />
schneidet der ÖPNV in Ballungsräumen<br />
sowie generell bei Täglich- und Vielfahrern<br />
ab. Hier erhielt er Noten zwischen<br />
2,72 und 2,76. <strong>Das</strong> heißt, 83 bis 87 Prozent<br />
der Nutzer sind zufrieden.<br />
Auch der Blick ins Detail enthüllt viel<br />
Gutes. In 28 von 32 Einzelkategorien –<br />
aufgeteilt auf sechs Themenfelder – erzielten<br />
die Verkehrsunternehmen bessere<br />
Noten als im Vergleichszeitraum 2012.<br />
Am deutlichsten stieg dabei die Zufriedenheit<br />
mit dem Handy-Ticket: und zwar<br />
um 4,4 Prozent durch einen Ausbau des<br />
Angebots. Mit 3,04 liegt die Bewertung<br />
zwar noch im Mittelfeld. Die Verkehrsunternehmen<br />
bauen ihr Angebot in diesem<br />
Bereich jedoch immer weiter aus.<br />
Eine weitere Verbesserung in den kommenden<br />
Jahren gilt als wahrscheinlich.<br />
Kundenbeziehung gut bewertet: Die<br />
Gesamtrangliste führen die Einzel-<br />
kategorien aus dem Leistungspaket „Kundenbeziehung“<br />
an, die vor allem Auskunft<br />
und Beratung umfassen. Die mobilen Informationen<br />
für das Smartphone erzielten<br />
mit 2,52 die beste Note überhaupt. Die<br />
Fahrplanauskunft im Internet liegt mit<br />
2,62 auf Platz drei, der gedruckte Fahrplan<br />
zu Hause auf fünf (2,67). Den guten Positionen<br />
zum Trotz: In allen drei Kategorien<br />
schnitten die Verkehrsbetriebe schlechter<br />
ab als 2012. Der Fahrplan zu Hause musste<br />
sogar das deutlichste Minus überhaupt in<br />
Kauf nehmen – er sackte in der Kundenzufriedenheit<br />
um 6,8 Prozent nach unten.<br />
Aufwärts ging es hingegen für die persönliche<br />
Beratung in den Kundenzentren:<br />
Sie stieg um mehr als ein Prozent auf 2,63.<br />
„Deutlich wird, dass die Fahrplanauskunft<br />
im Internet und die persönliche Beratung<br />
gleich bewertet werden – Letztere schätzen<br />
die Kunden besonders“, urteilt dazu<br />
Jens Wieseke, stellvertretender Vorsitzender<br />
des Berliner Fahrgastverbands IGEB:<br />
Die Freundlichkeit des Personals beurteilten die<br />
Kunden mit einer 2,92 und somit besser als 2012.<br />
„Zufriedenheit zeigt sich an der Zahl der Jobtickets“<br />
Der Software- und IT-Dienstleister Datev, Nürnberg, setzt schon seit 1991 auf ÖPNV-Abos für seine Mitarbeiter. „<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong><br />
<strong>Magazin</strong>“ sprach mit Klaus Fleischmann (Foto), der als Teamleiter Personalabrechnung auch für die Jobtickets zuständig ist.<br />
» Herr Fleischmann,<br />
bereits 2.500 Datev-<br />
Mitarbeiter am<br />
Standort Nürnberg<br />
nutzen das VGN-<br />
Firmenabo. Was<br />
macht Ihr Angebot<br />
so attraktiv?<br />
<strong>Das</strong>s mehrere unserer<br />
Standorte sehr innenstadtnah<br />
und in U-Bahn-Nähe liegen, ist natürlich ein<br />
großer Vorteil. Die hohe Teilnahmequote von 50 Prozent ist<br />
eine Voraussetzung dafür, dass wir unseren Mitarbeitern ein<br />
pauschales verbundweites Firmenabo des Verkehrsverbunds<br />
Großraum Nürnberg bieten können. Mit diesem Modell<br />
kostet das Firmenabo für Mitarbeiter, die den Tarif 10-T für<br />
ihre Fahrten nutzen müssen, statt circa 2.300 Euro nur noch<br />
880 Euro pro Jahr. Mit Zuschüssen zum Firmenabo machen<br />
wir es auch für die Mitarbeiter attraktiv, die näher am<br />
Arbeitsplatz – zum Beispiel in Nürnberg – wohnen, öffentliche<br />
Verkehrsmittel zu nutzen.<br />
» Inwiefern profitiert Datev von diesem Angebot?<br />
Es ist für unsere Mitarbeiter und das Unternehmen eine<br />
Win-win-Situation. Der ÖPNV ist uns mit Blick auf Klimaschutz<br />
und Nachhaltigkeit wichtig. Zudem haben wir ein<br />
gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn, weil wir die Parkplatzsituation<br />
entlasten. Nicht zuletzt ist das Firmenabo für<br />
uns ein Imagefaktor und Instrument, mit dem wir Bewerbern<br />
zeigen können, was Datev an Zusatzleistungen zu bieten hat.<br />
» Wie zufrieden sind Ihre Mitarbeiter mit dem ÖPNV?<br />
Wir halten beim Firmenabo unsere Quote von 50 Prozent<br />
beziehungsweise bauen sie aus. <strong>Das</strong> zeigt uns, dass die Mitarbeiter<br />
zufrieden sind. Und sollte es einmal Probleme geben,<br />
haben wir bei der VAG Nürnberg einen direkten Ansprechpartner,<br />
an den wir uns wenden können. Dort wird uns<br />
schnell und unbürokratisch geholfen.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 9
Titelstory<br />
Diese Noten vergaben die ÖPNV-Nutzer in den<br />
Einzelkategorien (Auswahl)<br />
mobile Informationen<br />
für das Smartphone<br />
Schnelligkeit der<br />
Beförderung<br />
Fahrplanauskunft im<br />
Internet<br />
persönliche Beratung<br />
in den Kundenzentren<br />
Linien- und<br />
Streckennetz<br />
Sicherheit im<br />
Fahrzeug – tagsüber<br />
Pünktlichkeit und<br />
Zuverlässigkeit<br />
elektronisches<br />
Ticket<br />
Freundlichkeit des<br />
Personals<br />
Taktfrequenz<br />
Platzangebot im<br />
Fahrzeug<br />
Fahrkartenautomaten<br />
Sauberkeit und Gepflegtheit<br />
der Haltestellen<br />
Preis-Leistungs-<br />
Verhältnis<br />
2,52<br />
2,59<br />
2,62<br />
2,63<br />
2,69<br />
2,73<br />
2,84<br />
2,88<br />
2,92<br />
2,97<br />
3,03<br />
3,29<br />
3,34<br />
3,53<br />
Information bei Störungen<br />
und Verspätungen 3,58<br />
sehr gut<br />
gut<br />
eher gut<br />
durchschnittlich<br />
eher schlecht<br />
schlecht<br />
sehr schlecht<br />
„Daraus sollten die Verkehrsunternehmen<br />
ihre Schlüsse ziehen und neue Wege in<br />
der persönlichen Beratung gehen. Denkbar<br />
wäre beispielsweise eine Beratung per<br />
Skype, also per Video-Telefonat, anstatt<br />
anonym über ein Callcenter.“<br />
Die vorderen Plätze teilen sich die Kategorien<br />
aus dem Paket Kundenbeziehung<br />
mit dem Verkehrsangebot im Allgemeinen:<br />
Auf Platz zwei der Gesamtwertung<br />
sehen die Nutzer die Schnelligkeit in der<br />
Beförderung (2,59 nach 2,61 in 2012), auf<br />
Platz sieben das Linien- und Streckennetz<br />
(2,69/2,78).<br />
Erfreulich fallen die Ergebnisse mit Blick<br />
auf die Sicherheit aus – ein Aspekt, der<br />
immer wieder Gegenstand öffentlicher<br />
Diskussionen ist. In den Fahrzeugen<br />
sowie an den Haltestellen fühlen sich die<br />
Kunden sicherer als noch 2012 – vor allem<br />
tagsüber (Plätze acht und neun). Abends<br />
liegen die Werte trotz der teils deutlichen<br />
Verbesserung weiter im letzten Viertel:<br />
Die Sicherheit in Fahrzeugen erhielt<br />
mit 3,16 ein „schlecht“, die Sicherheit an<br />
Haltestellen ein „sehr schlecht“ (3,38).<br />
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0<br />
Ein gut ausgebautes Linien- und Streckennetz bringt die Nutzer schnell<br />
ans Ziel. Dafür gab es die Note „gut“.<br />
Sich per Smartphone über den Fahrplan informieren<br />
zu können, kommt bei Kunden sehr gut an.<br />
10 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Titelstory<br />
„Wir sind auf dem richtigen Weg, aber es<br />
gibt immer noch viel zu tun“, sagt Jürgen<br />
Fenske. „Viele Menschen haben ein subjektiv<br />
schlechteres Sicherheitsempfinden,<br />
als es nach Faktenlage nötig wäre.“<br />
Auf den letzten Plätzen dominieren neben<br />
der Sicherheit am Abend außerdem die<br />
Leistungspakete „Haltestellen und Stationen“<br />
sowie „Tarif“. An 32. und somit<br />
letzter Stelle landeten die Informationen<br />
im Störungs- und Verspätungsfall – hier<br />
sind so wenig Kunden zufrieden wie in<br />
keiner anderen Kategorie (Note 3,58). Nur<br />
wenig besser beurteilten die Nutzer das<br />
Preis-Leistungs-Verhältnis (3,53) sowie<br />
das Tarifsystem (3,43), die sich jedoch<br />
beide um etwa zwei Prozent verbessern<br />
konnten. „Dieses Feedback deckt sich<br />
weitgehend mit dem, was wir von Fahrgästen<br />
erhalten“, bestätigt Jens Wieseke:<br />
„Informationen bei Verspätungen und das<br />
Preis-Leistungs-Verhältnis sind Klassiker.“<br />
Er hat auch gleich ein Beispiel parat:<br />
„Wenn Sie auf einem Bahnsteig stehen<br />
und auf dem dynamischen Schriftanzeiger<br />
erscheint die bloße Info ‚Zug fällt aus‘ –<br />
das reicht nicht. Da muss mehr kommen.“<br />
Die Methodik<br />
2.233 Interviews hatte TNS Infratest zwischen März und<br />
April <strong>2014</strong> geführt – davon 1.326 mit ÖPNV-Nutzern. Als<br />
Zufriedenheit definierte das Institut dabei das Vergleichsergebnis<br />
zwischen den Erwartungen des Kunden und seiner<br />
wahrgenommenen Leistung. Je größer die empfundene<br />
Differenz, desto unzufriedener war er mit dem ÖPNV.<br />
Insgesamt wurden sechs Leistungspakete mit verschiedenen<br />
Unterkategorien analysiert: Kundenbeziehung,<br />
Angebot, Tarif, Haltestellen und Stationen, Sicherheit<br />
sowie Verkehrsmittel.<br />
„Deutlich wird, dass die Fahrplanauskunft<br />
im Internet und die persönliche<br />
Beratung gleich bewertet werden –<br />
Letztere schätzen die Kunden besonders.“<br />
Jens Wieseke, Fahrgastverband IGEB<br />
Freundlichkeit des Personals: Ballungsräume,<br />
Großstädte, Täglich- und Vielfahrer mit deutlich<br />
besseren Beurteilungen<br />
1,0<br />
1,2<br />
1,4<br />
1,6<br />
1,8<br />
2,0<br />
2,2<br />
2,4<br />
2,6<br />
2,8<br />
3,0<br />
3,2<br />
3,4<br />
3,6<br />
3,8<br />
4,0<br />
2012<br />
<strong>2014</strong><br />
Gesamt<br />
14<br />
2,92<br />
14<br />
2,96<br />
Zufriedenheit<br />
Skala von 1 bis 5<br />
1 = vollkommen zufrieden<br />
5 = unzufrieden<br />
11<br />
2,82<br />
Ballungsraum<br />
Regionen<br />
Großstadt<br />
Umland<br />
15<br />
2,92<br />
ÖPNV-Nutzungshäufigkeit<br />
tgl./<br />
fast tgl.<br />
mind. 1x/<br />
Woche<br />
mind. 1x/<br />
Monat seltener<br />
n=1.257 n=593 n=157 n=507 n=322 n=309 n=220 n=406<br />
2012<br />
<strong>2014</strong><br />
Enttäuschte Kunden<br />
Anteil in Prozent<br />
(Skala 4 oder 5)<br />
15<br />
2,92<br />
14<br />
2,89<br />
16<br />
3,00<br />
12<br />
2,91<br />
0 %<br />
20 %<br />
40 %<br />
60 %<br />
80 %<br />
100 %<br />
Veränderung 2012/<strong>2014</strong><br />
signifikante Verbesserung<br />
signifikante Verschlechterung<br />
Die Fahrgäste legen Wert auf gute Informationen und<br />
eine persönliche Beratung durch die Mitarbeiter.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 11
Aus dem Verband<br />
Hochkarätiges Podium (v.l.): <strong>VDV</strong>-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff, Staatssekretär Michael Odenwald, Landesverkehrsminister Reinhard Meyer,<br />
Deutsche-Bahn-Chef Rüdiger Grube und Städtetagspräsident Dr. Ulrich Maly diskutierten unter der Leitung von Moderatorin Judith Schulte-Loh.<br />
DiePolitik muss<br />
jetzt umsetzen<br />
Der Öffentliche Verkehr bewegt Deutschland, aber er ist aus der Spur geraten. Offene<br />
Finanzierungsfragen oder die EEG-Umlage – der Bedarf ist erkannt. Jetzt muss<br />
umgesetzt werden. <strong>Das</strong> war die zentrale Botschaft der <strong>VDV</strong>-Jahrestagung, die der<br />
Verband direkt der Bundesregierung mit auf den Weg gegeben hat. Verkehrsminister<br />
Alexander Dobrindt und sein Staatssekretär Michael Odenwald waren zu Gast<br />
und machten handfeste Zusagen bei GVFG und erhöhtem Beförderungsentgelt.<br />
12 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Aus dem Verband<br />
Alexander Dobrindt (o.) versprach, eine GVFG-Nachfolgeregelung<br />
zeitnah zu klären. Zuvor hatte Verbandspräsident Jürgen Fenske (r.) die<br />
<strong>VDV</strong>-Jahrestagung eröffnet. Rund 1.000 Teilnehmer hatten sich zu der<br />
Veranstaltung angemeldet.<br />
Eine funktionierende Infrastruktur macht Wohlstand<br />
erst möglich, sie bildet die Basis jeder Wertschöpfung.<br />
„Öffentlicher Verkehr – Wirtschaftsfaktor und Lebensqualität“<br />
war dann auch das Motto der Tagung in<br />
Berlin. Doch diese Rolle droht der ÖV bald nicht mehr<br />
zu erfüllen. Die Probleme liegen auf der Hand: Der<br />
Bund will erst 2015 eine Nachfolgeregelung für das<br />
auslaufende Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz<br />
(GVFG) angehen. Auch die Zukunft der Regionalisierungsmittel<br />
ist noch ungewiss. Für Ausbau und Erhalt<br />
der Infrastruktur reichen die Mittel nicht aus. Dazu<br />
kommen die Probleme des ÖPNV im ländlichen Raum<br />
sowie die Belastungen des Schienenverkehrs durch<br />
die EEG-Umlage. „Sind wir auf der Spur?“, fragte<br />
<strong>VDV</strong>-Präsident Jürgen Fenske und antwortete: „Nein.“<br />
Er gab Verkehrsminister Dobrindt deswegen gleich<br />
mehrere Forderungen mit auf den Weg: Korrektur des<br />
EEG, ausreichende Finanzmittel für Erhalt und Aus-<br />
bau der Infrastruktur sowie die<br />
Durchsetzung eines erhöhten Beförderungsentgelts<br />
für Schwarz-<br />
Jahr zu einer Entscheidung<br />
„Es muss noch in diesem<br />
fahrer. Vor allem beim GVFG kommen, wie es mit dem<br />
bestehe dringender Handlungsbedarf.<br />
„Es ist die tragende Säule müssen es fortsetzen.“<br />
GVFG weitergeht. Wir<br />
unseres täglichen Angebots und<br />
Bundesminister Alexander Dobrindt<br />
darf nicht enden. Die Verhandlungen<br />
erst 2015 zu beginnen, ist<br />
zu spät“, sagte Fenske. <strong>Das</strong> fand auch Rüdiger Grube,<br />
Vorstandschef der Deutschen Bahn AG, der Gastgeberin<br />
der Tagung. „Wir dürfen die nächsten dreieinhalb<br />
Jahre nicht mit Konzepten verschwenden“, mahnte<br />
er auch mit Blick auf die Infrastrukturfinanzierung<br />
allgemein: „Wir müssen endlich umsetzen.“<br />
Mit dieser Einschätzung sind die Verkehrsunternehmen<br />
nicht allein. Einer neuen Forsa-Studie zufolge<br />
halten 98 Prozent aller Deutschen eine funktio-<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 13
Aus dem Verband<br />
Gala-Abend in „The Station“: Fast 1.000 Gäste waren zu dem Fest gekommen (o.).<br />
Kabarettist Horst Evers (o. r.) warf dabei einen humorvollen Blick auf den Personenverkehr<br />
und berichtete von seinen ganz speziellen Erfahrungen im Zug – unter anderem<br />
zur Freude von Rüdiger Grube und BVG-Chefin Sigrid Evelyn Nikutta (r., vorn).<br />
nierende Infrastruktur für wichtig bis sehr wichtig. Viele<br />
seien bereit, einen Beitrag zu leisten, etwa in Form eines<br />
umgewandelten Solidaritätszuschlags (siehe Infobox).<br />
„Berechtigt“ nannte Dobrindt die Forderungen der<br />
Verkehrsunternehmen. In der Vergangenheit habe die<br />
Politik fälschlicherweise geglaubt, man könne Infrastruktur<br />
und Wohlstand entkoppeln. <strong>Das</strong>s genau das<br />
nicht der Fall sei, zeige eine McKinsey-Studie. Infrastruktur,<br />
Wachstum, Wohlstand – diese drei bildeten<br />
gleichsam eine Fortschrittspyramide. „So eine Studie ist<br />
das überzeugendste Argument“, sagte Dobrindt mit Blick<br />
auf das Ringen um die Finanzmittel. Er überraschte die<br />
Verkehrsunternehmen zudem mit handfesten Zusagen:<br />
„Es muss noch dieses Jahr zu einer Entscheidung<br />
kommen, wie es mit dem GVFG weitergeht. Wir müssen<br />
es fortsetzen und ausbauen.“ Auch bei den Regionalisierungsmitteln<br />
müsse man zu einem Ergebnis kommen.<br />
Studie: Mehrheit will „Soli“ in Infrastrukturzulage umwandeln<br />
In puncto Bußgeld für Schwarzfahrer legte er ein klares<br />
Bekenntnis ab. „Ich sage zu, dass wir zu einer Erhöhung<br />
kommen. Wie hoch, ist noch offen.“<br />
In der anschließenden Podiumsdiskussion erläuterte<br />
Dobrindts Staatssekretär Odenwald, warum beim erhöhten<br />
Beförderungsentgelt noch nichts passiert ist. Die<br />
Verkehrspolitiker seien sich einig, „aber diese Frage ist<br />
vielschichtiger. Es gibt andere Auffassungen bei Sozialund<br />
Rechtspolitikern. Wir wollen aber eine abgestimmte<br />
Auffassung über alle Länderkabinette hinweg.“ Schleswig-Holsteins<br />
Verkehrsminister Reinhard Meyer,<br />
Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, sah das<br />
anders: „Im Moment spielen wir<br />
Schwarzer Peter bei Schwarzfahrern.<br />
Wir haben das schon vor einem Jahr<br />
beschlossen und den Bund gebeten, es<br />
auf den Weg zu bringen.“<br />
Die Mehrheit der Deutschen befürwortet eine Umwandlung des Solidaritäts- in einen Infrastrukturzuschlag,<br />
um den Erhalt der Verkehrswege zu finanzieren. Einer repräsentativen Forsa-Umfrage<br />
zufolge sind 52 Prozent der Bürger für diesen Vorschlag. Besonders groß ist die Zustimmung bei den<br />
18- bis 29-Jährigen: Hier sprachen sich 72 Prozent für eine solche Zulage aus. „<strong>Das</strong> zeigt, dass die<br />
Bürger bereit sind, einen finanziellen Beitrag zu zahlen“, beurteilte <strong>VDV</strong>-Präsident Jürgen Fenske<br />
das Ergebnis. Der <strong>VDV</strong> unterstützt die Idee des neuen Zuschlags – schon ein Teilbetrag des Solis<br />
würde ausreichen. Die Forsa-Studie zeigt auch: <strong>Das</strong> Thema Infrastruktur ist in der Bevölkerung<br />
angekommen. Nur drei Prozent der Deutschen halten sie für ausreichend finanziert, 68 Prozent<br />
sprechen sich dafür aus, zusätzliche Mittel aus dem laufenden Steueraufkommen für die Verkehrswege<br />
bereitzustellen. Ein Drittel hält eine weitere Nutzerfinanzierung durch Autofahrer, etwa die<br />
Pkw-Maut, für ein mögliches Instrument.<br />
Neben dem erhöhten Beförderungsentgelt<br />
waren in der Podiumsdiskussion<br />
vor allem die Infrastrukturfinanzierung<br />
und insbesondere das GVFG<br />
wichtige Themen. Egal ob Umwandlung<br />
des Solis, eine Ausweitung der<br />
Maut oder Spezialfonds: Ideen gibt es,<br />
sie müssen nur umgesetzt werden. „Es<br />
braucht konkrete Verabredungen und<br />
eine mittelfristige Finanzplanung“,<br />
betonte <strong>VDV</strong>-Hauptgeschäftsführer<br />
Oliver Wolff mit Blick auf das GVFG:<br />
14 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Aus dem Verband<br />
Henry Schulz als „Talent im ÖPNV“ geehrt<br />
„Kinder an die Macht“: <strong>Das</strong> ist nicht nur der Titel des Klassikers<br />
von Herbert Grönemeyer. Es ist auch der Name eines Berliner<br />
Vereins, der seit 1995 Freizeiten für Kinder und Jugendliche<br />
zum Selbstkostenpreis anbietet. Möglich macht<br />
das ein engagiertes, ehrenamtliches Team.<br />
Stellvertretend für alle wurde jetzt einer<br />
seiner Mitgründer auf der <strong>VDV</strong>-Jahrestagung<br />
geehrt: Henry Schulz, zweiter<br />
Vorstand des Vereins und Mitarbeiter<br />
der Berliner Verkehrsbetriebe,<br />
ist „Talent im ÖPNV <strong>2014</strong>“.<br />
Grönemeyers Song klang aus den<br />
Lautsprechern, als Henry Schulz<br />
(Foto, l.) die Bühne betrat. Er<br />
und seine Mitstreiter hatten den<br />
Verein seinerzeit mit dem Ziel der<br />
„sinnvollen Freizeitgestaltung von<br />
Kindern und Jugendlichen“ gegründet.<br />
Mehrere 1.000 junge Teilnehmer<br />
haben sie schon begleitet. Die Idee ist<br />
nicht einfach aus dem Nichts entstanden:<br />
Schon in den 80er-Jahren hatten Henry Schulz<br />
und seine Kollegen die Kinderferienlager der BVG mit<br />
betreut, die 1992 aber eingestellt werden mussten. „Danach sind<br />
wir bei anderen Ferienlagern mitgefahren“, erinnerte sich der<br />
51-Jährige: „Aber das war nicht das, was wir gewohnt waren. 50<br />
Kinder und ein Betreuer – das war nicht unser Standard.“ Die<br />
Konsequenz war ein eigener Verein. Dort ist das Verhältnis nun<br />
10:1. Doch all das geht nur mit hohem ehrenamtlichen Engagement<br />
aller Beteiligten. Logisch also, dass Henry Schulz nicht allein<br />
zur Preisverleihung kam: Die Auszeichnung nahmen<br />
mit ihm zusammen drei Betreuerinnen und zwei<br />
Mädchen entgegen (Foto). Letztere nehmen<br />
regelmäßig an den Freizeiten teil. Wie viele<br />
Vereine leidet aber auch „Kinder an die<br />
Macht“ unter dem Schwund freiwilliger<br />
Helfer. „Es gibt immer weniger<br />
Menschen, die Interesse haben,<br />
ehrenamtlich zu arbeiten“, bedauerte<br />
Schulz. Zumindest für 2015 kann<br />
er sich jedoch über einen zusätzlichen<br />
Helfer freuen: <strong>VDV</strong>-Hauptgeschäftsführer<br />
Oliver Wolff versprach<br />
während der Ehrung spontan, eine<br />
Ferienfreizeit ins Zillertal zu begleiten.<br />
„Der Einsatz des Vereins ist gesellschaftlich<br />
wegweisend“, lobte er zudem.<br />
Dem schloss sich Ulrich Homburg, Vorstand Personenverkehr<br />
der Deutschen Bahn, an. „Ich weiß aus<br />
meinem eigenen Umfeld, wie viel Engagement erforderlich<br />
ist, um so etwas aufrecht zu erhalten.“ Um dem Verein die Arbeit<br />
zu erleichtern, überreichte er im Auftrag der DB einen Reisegutschein<br />
über 1.000 Euro.<br />
Weitere Informationen unter: www.kinder-an-die-macht-ev.de<br />
„Deswegen bin ich gespannt auf die Länderhaushalte.<br />
Die stehen jetzt vor der Frage, was sie für 2020 einstellen.“<br />
Meyer forderte bei den Regionalisierungsmitteln<br />
eine „vernünftige Dynamisierung. 1,5 Prozent reichen<br />
nicht“. Eine nicht ausreichende Finanzierung beklagte<br />
auch Städtetagspräsident Dr. Ulrich Maly. Er warnte<br />
davor, „sehenden Auges in ein Investitionsloch“ zu fallen,<br />
und mahnte, dass der ÖPNV für die Nutzer bezahlbar<br />
bleiben müsse. „Wir nähern uns bei der Einzelfahrt der<br />
magischen Schwelle von drei Euro.“ Harsche Kritik gab<br />
es an den Plänen des Bundes, die Busspuren künftig für<br />
Elektroautos zu öffnen. Eine „Schnapsidee“, urteilte Oliver<br />
Wolff. „Damit wäre das Thema Beschleunigung des<br />
ÖPNV in den Großstädten erledigt.“<br />
In den drei Fachforen gingen die Diskussionen später<br />
weiter. Über Vorgaben und Realität bei der Umsetzung<br />
der Barrierefreiheit im ÖPNV sprachen Vertreter von<br />
Bund, Bahn, <strong>VDV</strong> und Städtetag. Der neue Bundesver-<br />
kehrswegeplan und seine Chancen für die künftige<br />
Verkehrswegeplanung waren Thema im Forum Eisenbahnverkehr.<br />
Im Fachforum Technik zeigten Vertreter<br />
aus Politik, Verkehrsunternehmen und Verbänden neue<br />
Möglichkeiten im Vertrieb auf.<br />
Einen ganz anderen, humoristischen Blick auf den Personenverkehr<br />
warf der Berliner Autor und Kabarettist<br />
Horst Evers während des Gala-Abends im ehemaligen<br />
Postbahnbahnhof „The Station“. Dem Vielfahrer hatten es<br />
vor allem dauertelefonierende Mitfahrer im Zug angetan.<br />
Der Öffentliche Verkehr ist manchmal eben eine Herausforderung<br />
– für die Macher wie für die Reisenden.<br />
Weitere Infos, Dokumentationen,<br />
Vorträge und Bilder finden Sie auch im Internet:<br />
www.vdv.de/jahrestagung.aspx<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 15
Hintergrund<br />
Unterwegs im Netz<br />
Zwischen<br />
Coils und Kosten<br />
Busse, Bahnen, Güterzüge – und ein eigenes Schienennetz: Im<br />
Nordosten des Bundeslandes Rheinland-Pfalz betreibt die<br />
Westerwaldbahn einen Mikrokosmos des Öffentlichen Verkehrs.<br />
16 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Unterwegs im Netz<br />
70.000<br />
Tonnen<br />
befördert die Westerwaldbahn<br />
pro Jahr auf ihrer rund 18 Kilometer<br />
langen Stammstrecke.<br />
Für manchen mittelständischen<br />
Betrieb ist sie die Nabelschnur zum<br />
Rest der Welt und in die Märkte.<br />
Mit silbern glänzender Aluminium-Fassade fügt sich<br />
der Gebäudekomplex des Betriebshofes eher futuristisch<br />
in die ländliche Hügelweite des Westerwaldes<br />
ein. Wie ein Ausguck überragt ein Turm die Dächer<br />
des Hallen-Ensembles: eine Reminiszenz an hundert<br />
Jahre Bahngeschichte – der Wasserturm, an dem einst<br />
Dampfloks gespeist wurden. Wer die Westerwaldbahn<br />
auf einen Blick verstehen will, sollte sich hier, in der<br />
vor knapp einem Jahrzehnt erbauten Anlage am Rande<br />
des Dörfchens Bindweide, die Waschstraße zeigen<br />
lassen. Sie ist multifunktional, geeignet für Bus und<br />
Bahn: In den Hallenboden ist ein Gleis eingelassen,<br />
Lokführer oder Busfahrer manövrieren ihr Gefährt<br />
in die richtige Position. Dann geben sie über eine<br />
Tastatur den Fahrzeugtyp ein, und schon rotieren die<br />
blauen Bürsten passgenau an der Außenhaut.<br />
Striktes Kostenbewusstsein und durchdachte Effizienz<br />
– das sind Tugenden zum Überleben, weiß Horst<br />
Klein. Der 63-Jährige ist ebenfalls multifunktional:<br />
Geschäftsführer der Westerwaldbahn GmbH, einer<br />
hundertprozentigen Tochter des<br />
Landkreises Altenkirchen, und als<br />
Eisenbahnbetriebsleiter zugleich<br />
oberster Verantwortlicher für den<br />
Schienenverkehr. Neben weiteren<br />
Verpflichtungen seines Jobs ist er<br />
ehrenamtlicher Bürgermeister in<br />
seiner nahen Heimatgemeinde, erst<br />
kürzlich mit großer Mehrheit wiedergewählt,<br />
und einer der Vizepräsidenten<br />
des <strong>VDV</strong>.<br />
Für die Westerwaldbahn – kurz Weba – mit gerade<br />
einmal 70 Beschäftigten ist der Betriebshof in Bindweide<br />
Herz und Kopf zugleich. Rund sechs Millionen<br />
Euro haben sich Kreis und Land den Neubau kosten<br />
lassen. Klein: „Hier läuft das Busnetz zusammen, hier<br />
haben wir Werkstatt-Kapazitäten für unsere Schienenfahrzeuge,<br />
hier sitzt das Management. Mit der<br />
Konzentration auf diesen Standort haben wir wertvolle<br />
Infrastruktur gerettet.“<br />
„Bund und Land müssen sich<br />
zu einer dauerhaften Finanzierung<br />
der Schieneninfrastruktur<br />
durchringen.“<br />
Horst Klein,<br />
Geschäftsführer Westerwaldbahn<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 17
Unterwegs im Netz<br />
Die Firmenzentrale liegt an der eingleisigen<br />
„Stammstrecke“ der Weba: Gut 18 Kilometer, die in<br />
Scheuerfeld im Siegtal an der Bahnstrecke Köln –<br />
Siegen beginnen und sich über Bindweide bis nach<br />
Weidefeld winden. Seit Jahrzehnten fahren hier nur<br />
Güterzüge, bewegen etwa 70.000 Tonnen Fracht im<br />
Jahr. Wichtigster Kunde: ein lokaler Büromöbel-Hersteller,<br />
der seine Produkte im Werk als Stückgut in<br />
eigens für ihn beschafften Schiebewandwagen verpackt<br />
und in seine Märkte befördert.<br />
Obwohl die Stammstrecke nur dem Güterverkehr<br />
dient, rollen immer wieder auf ihr auch in Rot, Gelb<br />
und Silber gehaltene Nahverkehrstriebzüge. Es sind<br />
Züge der Weba, die von ihren nicht weit entfernten<br />
Einsatzgebieten zu Instandhaltungsarbeiten in den<br />
Betriebshof überführt werden. So betreibt die Weba<br />
seit 20 Jahren die zehn Kilometer lange „Daadetalbahn“,<br />
die am nahen Bahnknoten Betzdorf an der Sieg<br />
beginnt. „Nach der Bahnreform konnten wir in den<br />
SPNV, den Schienenpersonennahverkehr, einsteigen“,<br />
berichtet Weba-Chef Klein: „Zu Konditionen, von denen<br />
wir heute nur noch träumen können.“ Die Strecke<br />
ging für eine symbolische D-Mark an die Weba. Die<br />
Deutsche Bahn, die als Bundesbahn den Betrieb im Tal<br />
der Daade eingestellt hatte, beteiligte sich großzügig<br />
an der Reaktivierung. Und Rheinland-Pfalz finanzierte<br />
zwei Triebwagen der Baureihe VT 628.<br />
Hundert Jahre Bahngeschichte<br />
Hinzu kam dann die Hellertalbahn Betzdorf – Haiger<br />
– Dillenburg, die sich eine Bietergemeinschaft von<br />
Weba, Hessischer Landesbahn und Siegener Kreisbahn<br />
in einer europaweiten Ausschreibung sicherte.<br />
Die Weba ist dort seit 1999 Betriebsführer und setzt<br />
drei moderne Triebwagen vom Typ GTW 2/6 ein. Seit<br />
2004 betreibt die Weba gemeinsam mit der Hessischen<br />
Landesbahn in der Gesellschaft Vectus mit<br />
28 Lint-Triebzügen zwischen Au an der Sieg und<br />
Wiesbaden, Koblenz, Limburg den SPNV und leistet<br />
2,4 Millionen Zugkilometer im Jahr. Beide Engage-<br />
Am heutigen<br />
Betriebssitz der<br />
Westerwaldbahn<br />
wurde im<br />
19. Jahrhundert<br />
aus der „Grube<br />
Bindweide“ Eisenerz<br />
befördert<br />
und von 1881 bis 1913 mit einer Schmalspurbahn ins<br />
Siegtal transportiert. 1913 wurde die heutige Stammstrecke<br />
in Regelspur eröffnet. Der Kreis Altenkirchen<br />
wurde 1914 Eigentümer der Bahn. Bis 1942 blieb die<br />
Weba eine reine Güterbahn. In den Kriegsjahren kam<br />
dann Personenverkehr hinzu, allerdings nur bis 1959.<br />
Seit 1994 betreibt die Weba den SPNV auf der Daadetalbahn.<br />
Derzeit ist sie auch noch Kooperationspartner bei<br />
Vectus und der Hellertalbahn. Im Güterverkehr hat die<br />
Weba neben den eigenen Aktivitäten seit 1998 einen Kooperationsvertrag<br />
mit DB Schenker Rail und führt für die<br />
Konzerntochter Zugbildungsaufgaben in Betzdorf durch.<br />
Bunter Bahnentreff Betzdorf: Hier starten die Hellertalbahn (l.),<br />
die Daadetalbahn (Mitte) und die Züge der Kooperation Vectus.<br />
Die Buslinien der Weba dienen weit überwiegend dem Schülerverkehr.<br />
Im Westerwald ist das Auto Nahverkehrsmittel Nummer 1.<br />
18 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Unterwegs im Netz<br />
Moderne Infrastruktur für Instandhaltung: Im Betriebshof Bindweide wartet die<br />
Weba Straßen- und Schienenfahrzeuge. Auch ihre Partner nutzen die Anlage.<br />
Zugpferd für schwere Lasten: Im Betriebshof Bindweide<br />
wird eine Diesellok für den Güterverkehr fit gemacht.<br />
ments stehen allerdings vor dem Aus, bedauert Klein:<br />
„Bei unserem Eigentümer, dem Kreis Altenkirchen,<br />
gab es keine politische Mehrheit für eine weitere<br />
Bewerbung um diese Leistungen. Man fürchtet finanzielle<br />
Risiken, die den Kreis überfordern könnten.“ Die<br />
Triebzüge werden dennoch weiter in den Betriebshof<br />
kommen: Die Weba wird für die Hessische Landesbahn<br />
Werkstattleistungen übernehmen.<br />
Vor einer ungewissen Zukunft steht der Busverkehr.<br />
„Rund 80 Prozent unseres Aufkommens ist<br />
Schülerverkehr, und das mit abnehmender Tendenz“,<br />
beschreibt Klein. Betrieben wird ein 250 Kilometer<br />
langes Konzessionsnetz. „<strong>Das</strong> geht noch bis 2018, und<br />
dann muss etwas passieren. Wenn es durch weitere<br />
Kostensenkungen nicht gelingt, die Eigenwirtschaftlichkeit<br />
zu erhalten, wird es wohl nur über gemeinwirtschaftliche<br />
Verkehre gehen, mit Ausschreibungen<br />
in Linienbündeln, die dann gute und weniger nachgefragte<br />
Strecken zusammenbringen.“<br />
Die buchstäblich gewichtigste Verkehrsleistung der<br />
Weba kommt nie am Betriebshof Bindweide vorbei.<br />
Für den Stahl verarbeitenden mittelständischen<br />
Konzern Schütz Industrial Services in Selters und<br />
Siershahn liefert die Weba den wichtigsten Rohstoff:<br />
Jeden Monat kommen auf der Schiene 20.000 Tonnen<br />
Coils in den Westerwald, die in Finnentrop in Südwestfalen<br />
und anderen Stahlwerken auf die Reise<br />
geschickt werden. Für die Transporte, die Monat für<br />
Monat etwa 1.000 Lkw-Fahrten ersetzen, drehte die<br />
Weba ein vergleichsweise großes Rad: Sie übernahm<br />
von DB Netz 33 Kilometer Strecke von Altenkirchen<br />
nach Selters, holte den stillgelegten südlichen<br />
Abschnitt von 13 Kilometern aus dem Dornröschenschlaf<br />
und reaktivierte ihn für 1,5 Millionen Euro.<br />
Über DB-Schienen hatten die Transporte zuvor<br />
einen Laufweg von 314 Kilometern – jetzt nur noch<br />
130 Kilometer.<br />
In Freude und Stolz über diese Verkehrsleistung<br />
mischt sich bei Horst Klein die Sorge, wie es weitergehen<br />
kann. „Während sich der SPNV durch die<br />
Bestellerentgelte selbst finanziert, müssen wir den<br />
Schienengüterverkehr eigenwirtschaftlich betreiben.<br />
Als EVU, als Eisenbahnverkehrsunternehmen,<br />
können wir das kostendeckend. Aber wir sind ja auch<br />
Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber. Und mit den Trassenpreisen<br />
für zwei werktägliche Züge können wir die<br />
Infrastruktur nicht erhalten.“ Es ist das Dilemma aller<br />
NE-Bahnen, der nicht bundeseigenen Eisenbahnen,<br />
weiß der Weba-Chef: Bund und Land müssten sich<br />
dringend gemeinsam zu einer dauerhaften Finanzierung<br />
der Schienenwege durchringen.<br />
Weitere Informationen unter: www.westerwaldbahn.de<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 19
Hintergrund<br />
78.000<br />
Kubikmeter<br />
So groß ist der überbaute Raum<br />
im Heumarkt. <strong>Das</strong> entspricht etwa<br />
einem Fünftel des Kölner Doms –<br />
und macht die U-Bahn-Haltestelle<br />
zur größten in Köln.<br />
Kühn geschwungene Linien, transparentes Erscheinungsbild: <strong>Das</strong> macht die Architektur des Heumarkts aus. Die Ladenzeile bildet den Mittelpunkt der Station.<br />
In der<br />
Tiefe<br />
des<br />
Raumes<br />
schwebt eine Wolke<br />
Seit wenigen Monaten ist in Köln die neue Station Heumarkt im Betrieb –<br />
ein ÖPNV-Bauwerk, so grandios wie einzigartig. In der Domstadt macht<br />
schon das Wort von einer unterirdischen Kathedrale die Runde.<br />
20 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Hintergrund<br />
Hell und offen: Die<br />
Fahrgäste können das<br />
jeweils andere Stockwerk<br />
des Heumarkts<br />
einsehen. Die Ebenen<br />
sind optisch miteinander<br />
verknüpft.<br />
Ausbau Nord-Süd Stadtbahn<br />
Der Bau der Kölner Nord-Süd Stadtbahn zählt derzeit zu den größten Infrastruktur-<br />
und Städtebauprojekten Deutschlands. Durch die bessere Anbindung<br />
der südlichen Stadtteile an die Innenstadt und den Hauptbahnhof verkürzt sich<br />
die Fahrzeit zwischen dem Breslauer Platz an der Nordseite des Hauptbahnhofs<br />
und dem Chlodwigplatz im Herzen der Südstadt von 16 auf acht Minuten.<br />
Nach mehr als 30 Jahren Planungs- und Bauzeit befindet sich der Ausbau der<br />
letzten Stationen in der Endphase. Finanziell bedingte Umplanungen, neue<br />
Brandschutzvorschriften und der Einsturz des Stadtarchivs, bei dem zwei<br />
Menschen ums Leben kamen, hatten das Projekt immer wieder verzögert.<br />
Wenn Prof. Ulrich Coersmeier über die<br />
neuen Stationen der Kölner Nord-Süd<br />
Stadtbahn spricht, gerät er ins Schwärmen.<br />
„Hier entsteht eine Perlenkette<br />
– aber mit ganz unterschiedlichen Perlen.“<br />
Diejenige Perle, die der Architekt<br />
mit seinem Team geschaffen hat, ist<br />
vielleicht die funkelndste und mit Sicherheit<br />
die dickste. Die im Dezember<br />
in Betrieb gegangene Station Heumarkt<br />
zählt zu den spektakulärsten Bauwerken<br />
im deutschen ÖPNV. Chrom, Stahl,<br />
Beton und Glas prägen das transparente<br />
Erscheinungsbild. Der überbaute Raum<br />
von insgesamt rund 78.000 Kubikmetern<br />
– das entspricht etwa einem Fünftel des<br />
Kölner Doms – macht den Heumarkt zur<br />
größten und mit seiner Bauwerkssohle<br />
28,50 Meter unter der Oberfläche gleichzeitig<br />
zur tiefsten U-Bahn-Haltestelle<br />
der Stadt.<br />
An der Oberfläche ist hiervon nichts<br />
zu erahnen: Eine Schneise aus zwei<br />
Stadtbahngleisen inmitten einer mehrspurigen<br />
Straße trennt die Süd- von der<br />
Innenstadt. Verkehrslärm und Abgase<br />
nerven. Aber schon auf der Rolltreppe<br />
am eher unscheinbaren Eingang an der<br />
Cäcilienstraße beginnt das Architekturerlebnis.<br />
„Wichtig sind die Wege“, erläutert<br />
Ulrich Coersmeier: „Wir wollten, dass<br />
die Fahrgäste vom Licht geleitet werden,<br />
und für sie einen Wechsel schaffen.“<br />
<strong>Das</strong> gelingt an diesem Eingang über zwei<br />
Bereiche, die wie Trichter hintereinander<br />
liegen und auf der Fahrt nach oben<br />
ins Tageslicht münden. In umgekehrter<br />
Richtung eröffnet sich nach einer kurzen<br />
Fahrt auf der Rolltreppe und wenigen<br />
Metern Fußweg ein mehr als 100 Meter<br />
langes und 13 Meter hohes Gewölbe. Der<br />
Vergleich mit dem Blick in eine Kathedrale<br />
drängt sich auf und wird in Köln<br />
seit der Eröffnung der Station Mitte Dezember<br />
gern genutzt.<br />
Straßenbahnen sind auf dieser Ebene<br />
nicht zu sehen. Die Züge der verlängerten,<br />
in Nord-Süd-Richtung verlaufenden<br />
Linie 5 verkehren ein weiteres<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 21
„Wichtig sind die Wege.<br />
Wir wollten, dass die<br />
Fahrgäste vom Licht<br />
geleitet werden.“<br />
Prof. Ulrich Coersmeier, Architekt<br />
Stockwerk tiefer. Aber allein durch die<br />
Architektur der Station wirken die Linien<br />
optisch präsent. Die kühn geschwungene<br />
Halle und ihre mit Edelstahlelementen<br />
verkleidete Deckenkonstruktion folgen<br />
dem Verlauf der derzeit noch oberirdisch<br />
geführten Stadtbahn-Gleise. Wenn eines<br />
Tages die Kölner Stadtbahn vollständig<br />
ausgebaut ist, sollen hier die Züge in Ost-<br />
West-Richtung rollen. Bis dahin bleibt<br />
das auf dieser Ebene bereits eingebaute<br />
Gleisbett abgedeckt. Den Mittelpunkt<br />
der Halle bildet eine elliptische Ladenzeile,<br />
deren Glasscheiben scheinbar ein<br />
Chromdach tragen. „Wie eine Wolke<br />
scheint dieses Element im Raum zu<br />
schweben“, so Ulrich Coersmeier. Voraussichtlich<br />
im Spätsommer können<br />
Fahrgäste hier einkaufen.<br />
Architektonisch und gefühlt liegt hier<br />
der Mittelpunkt der gesamten Station:<br />
An dieser Stelle kreuzen sich die rund 22<br />
Meter unter der Erdoberfläche liegende<br />
Nord-Süd- und die zukünftige Ost-<br />
West-Strecke. „Die diagonale Kreuzung<br />
ist das Hauptmotiv der Planung“, erläutert<br />
Coersmeier: „<strong>Das</strong>s die Strecken im spitzen<br />
Winkel aufeinander zulaufen, spiegelt<br />
sich in der gesamten Station bis hin zur<br />
Deckenkonstruktion wider.“ Beide Ebenen<br />
sind optisch miteinander verknüpft,<br />
Fahrgäste können das jeweils andere<br />
Stockwerk einsehen. Die Übersichtlichkeit<br />
schafft ein Gefühl von Sicherheit.<br />
Von hinten beleuchtete Glaswände auf<br />
der unteren Ebene und in den verbindenden<br />
Räumen vermitteln Transparenz und<br />
geben dem Bau seine Leichtigkeit.<br />
Zehn Jahre wurde an dem rund 90 Millionen<br />
Euro teuren Bauwerk gearbeitet.<br />
Eine Investition mit Weitblick: „Hätten<br />
wir diese Station kleinlich bemessen,<br />
würde sich das später als teurer Fehler<br />
herausstellen“, verdeutlicht Ulrich<br />
Coersmeier. „Der Heumarkt wird eines<br />
Tages einer der wichtigsten Umsteigepunkte<br />
im ÖPNV Kölns sein und<br />
das zentrale Bindeglied zwischen der<br />
Alt- und Südstadt“, erläutert auch Jürgen<br />
Fenske, Vorstandsvorsitzender der<br />
Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) und<br />
<strong>VDV</strong>-Präsident: „Mit diesem Bauwerk<br />
sind wir auf das zukünftige Wachstum<br />
der Fahrgast- und Einwohnerzahlen<br />
gut vorbereitet.“ Prognosen zufolge sollen<br />
nach der Gesamtinbetriebnahme,<br />
die nach dem Unglück am Stadtarchiv<br />
Die Bedeutung der Nord-Süd Stadtbahn<br />
Die Halle und ihre Deckenkonstruktion folgen in ihrem Verlauf<br />
den derzeit noch oberirdisch geführten Stadtbahn-Gleisen.<br />
Während im gesamten Kölner Stadtgebiet das Verhältnis zwischen<br />
der Nutzung des ÖPNV und der Nutzung des Individualverkehrs annähernd<br />
ausgewogen ist, nutzt nur ein Drittel der Südstadt-Bewohner<br />
den ÖPNV, zwei Drittel jedoch den Individualverkehr. Die Folge<br />
sind Staus, Lärm und Luftverschmutzung in der Südstadt. Gleichzeitig<br />
wird die Nord-Süd Stadtbahn einen Beitrag zur Entlastung des<br />
Innenstadttunnels zwischen Appellhofplatz und Poststraße leisten.<br />
Durch den fährt in der Spitzenzeit alle 120 Sekunden eine Bahn.<br />
22 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Hintergrund<br />
Zahlen, Daten, Fakten<br />
Umbauter Raum: 78.100 Kubikmeter<br />
Stockwerke: 3<br />
Tiefe der Bauwerkssohle:<br />
28,50 Meter (Technik- und Betriebsräume)<br />
Tiefe der Gleisebene Nord-Süd: 21,40 Meter<br />
Tiefe der Gleisebene Ost-West: 14,50 Meter<br />
Fahrtreppen: 14<br />
Feste Treppen: 9<br />
Aufzüge: 2<br />
Anschluss an den Bahnsteig der<br />
drei oberirdischen Linien 1, 7, 9.<br />
frühestens 2019 erfolgen kann, an<br />
Werktagen etwa 95.000 Menschen am<br />
Heumarkt ein- und aussteigen und<br />
davon 50.000 umsteigen. Bis dahin<br />
wird auf der Nord-Süd Stadtbahn in<br />
zwei Teilabschnitten gefahren: zwischen<br />
Breslauer Platz und Heumarkt<br />
im Norden sowie ab 2016 von Severinstraße<br />
bis Bonner Wall im Süden. Zwischen<br />
Heumarkt und Severinstraße liegt<br />
die Unglückstelle am Waidmarkt. Sie<br />
kann vor 2019 nicht saniert und fertiggestellt<br />
werden.<br />
Mit der sogenannten Teilinbetriebnahme<br />
Nord zwischen Breslauer Platz und<br />
Heumarkt gelang Mitte Dezember die<br />
Verknüpfung der Linie 5 mit den<br />
Linien 1, 7 und 9 auf der oberirdischen<br />
Ost-West-Achse. Im zweiten Teilabschnitt<br />
der Nord-Süd Stadtbahn sollen<br />
die im Bau befindlichen Haltestellen<br />
Severinstraße, Kartäuserhof, Chlodwigplatz<br />
und Bonner Wall bis Ende dieses<br />
Jahres fertiggestellt und im Sommer<br />
2016 eröffnet werden.<br />
Schon jetzt ist für viele Fahrgäste der<br />
Umstieg am Neumarkt, Hauptbahnhof<br />
oder in Deutz überflüssig geworden.<br />
Wenn die Nord-Süd Stadtbahn durchgehend<br />
befahrbar ist, werden Kunden<br />
aus dem linksrheinischen Kölner Süden<br />
eine komfortable Anbindung an die<br />
Innenstadt sowie an die westlichen<br />
Stadtteile Ehrenfeld und Ossendorf beziehungsweise<br />
die östlichen in Richtung<br />
Deutz erhalten.<br />
Vollständig abgeschlossen wird das<br />
Projekt aber erst sein, wenn die Ost-<br />
West-Linien unter die Erde verlagert<br />
sind und die Innen- und Südstadt näher<br />
zusammenrücken können. Erst dann<br />
kommt die städtebauliche Dimension<br />
des Vorhabens vollständig zum Tragen.<br />
Mit diesem Konzept hatten Ulrich<br />
Coersmeier und sein Team vor mehr als<br />
20 Jahren einen Architekturwettbewerb<br />
gewonnen. Die Herausforderung und<br />
den Zeitrahmen des Gesamtvorhabens<br />
umreißt der 72-jährige Architekt, der<br />
in der Südstadt wohnt, wie folgt: „Es ist<br />
spannend, für Zeiten zu planen, die man<br />
vielleicht selber nicht erleben wird.“<br />
www.kvb-koeln.de<br />
Architekt Prof. Ulrich Coersmeier (l.) und<br />
Jürgen Fenske, KVB-Vorstandsvorsitzender<br />
und <strong>VDV</strong>-Präsident, in der neuen U-Bahn-<br />
Station.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 23
Unterwegs im Netz<br />
44<br />
Einwohner<br />
leben im Landkreis Uckermark<br />
auf einem Quadratkilometer.<br />
Auf der gleichen Fläche<br />
sind es in Berlin fast 4.000.<br />
Uckermark rückt<br />
durch den Kombibus<br />
näher zusammen<br />
24 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Unterwegs im Netz<br />
Transportkette: Busfahrer Jörg Wewiorra bescheinigt Nancy Dräger die Annahme<br />
der blauen Kühlbox, verlädt die Sendung in seinen Frachtraum und bringt sie bis<br />
nach Gramzow. Dort übernimmt sein Kollege Erhard Krüger die Ware (gr. Bild).<br />
Frische Lebensmittel und andere Sendungen<br />
kommen in der Uckermark mit<br />
dem Linienbus zu ihren Empfängern. Der<br />
im Jahr 2012 als Modellprojekt gestartete<br />
Kombibus trägt mittlerweile dazu bei, regionale<br />
Wirtschaftskreisläufe aufzubauen<br />
und zu festigen – ein Zukunftsmodell für<br />
den ÖPNV im ländlichen Raum, das Schule<br />
machen könnte.<br />
Im uckermärkischen Bandelow herrscht Mittagshitze.<br />
Vor der Bauernkäserei Wolters wartet Mitarbeiterin<br />
Nancy Dräger bei 30 Grad auf den Bus.<br />
Kaum ein Auto kommt vorbei, schon eher ein paar<br />
Radler, die an der jungen Frau mit dem Handwagen<br />
und der blauen Kühlbox vorbeifahren. Ein kleiner<br />
See, ein paar Häuser entlang der Straße, hinter den<br />
Häusern riesige Felder und jede Menge Gegend: typisch<br />
Uckermark. Im gleichnamigen Landkreis teilen<br />
sich 44 Einwohner einen Quadratkilometer. Auf<br />
der gleichen Fläche sind es in Berlin fast 4.000. Im<br />
äußersten Nordosten Brandenburgs leben 130.000<br />
Menschen – nach Unesco-Kriterien gilt das als nicht<br />
bevölkertes Gebiet. Schon bald gibt es hier mehr<br />
über 60- als unter 30-Jährige. Bis 2030 verliert der<br />
Landstrich ein weiteres Viertel seiner Bevölkerung.<br />
Demographischer Wandel in nüchternen Zahlen.<br />
Vor Ort bedeutet das jedoch: Erst fehlen den Geschäften<br />
die Kunden, danach fehlen den Kunden die<br />
Geschäfte. Wo weniger Menschen leben, wird die<br />
Versorgung schwieriger und teurer. <strong>Das</strong> gilt auch für<br />
den Erhalt der Infrastruktur und des ÖPNV.<br />
Den Busverkehr in der Region schultert die Uckermärkische<br />
Verkehrsgesellschaft (UVG). Eines ihrer<br />
Fahrzeuge hält pünktlich um 11.57 Uhr direkt vor<br />
der Käserei in Bandelow. Fahrer Jörg Wewiorra<br />
steigt aus, begrüßt Nancy Dräger und unterschreibt<br />
die Papiere. Ziel der Ware ist der Hofladen des Guts<br />
Kerkow bei Angermünde. Nachdem er die blaue<br />
Kühlbox in den Laderaum geschoben hat, fährt Jörg<br />
Wewiorra weiter Richtung Prenzlau. Mit an Bord<br />
sind eine Handvoll Schüler, eine Seniorin und eine<br />
Reisegruppe aus Berlin. Auf Einladung der Bundesvereinigung<br />
Logistik wollen die Teilnehmer wissen,<br />
wie sich der Kombibus in der Praxis bewährt.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 25
Unterwegs im Netz<br />
Aus der Milch uckermärkischer<br />
Kühe stellt die Bauernkäserei<br />
Wolters den Uckerkaas her.<br />
Der Käse und andere regionale Produkte werden in den Hofläden<br />
der Uckermark sowie in Berlin und Umgebung verkauft.<br />
„Wir sind eine Art Wirtschaftsförderung:<br />
ein<br />
Bindeglied zwischen Produzenten<br />
und dem Markt.“<br />
Lars Boehme,<br />
UVG-Geschäftsführer<br />
Pieter Wolters, Inhaber der Käserei und<br />
Produzent des Uckerkaas, hatte ihnen<br />
zuvor erläutert, welche Vorteile der<br />
Kombibus den Herstellern regionaler<br />
Lebensmittel bietet: „Preiswerte Transportmöglichkeiten<br />
zu finden, ist für uns<br />
ein Problem.“ Die Wege in der Region<br />
sind weit, und viele Produzenten können<br />
es sich nicht leisten, Mitarbeiter dafür<br />
abzustellen oder eigene Fahrzeuge anzuschaffen.<br />
„Durch den Kombibus gibt es<br />
jetzt ein System, mit dem wir gut leben<br />
können“, sagt Wolters. Innerhalb des<br />
Landkreises liefert der Bus zehn Kilogramm<br />
Ware oder Gepäck zum Preis von<br />
fünf Euro. Taggleich schafft das kein<br />
Logistikdienstleister – wenn so kleine<br />
Mengen überhaupt angenommen werden.<br />
Insgesamt können die Absender mit dem<br />
Bus bis zu 250 Kilogramm pro Lieferung<br />
verschicken, verteilt auf mehrere Stücke.<br />
Bald sollen für noch größere Transportmengen<br />
Anhänger beschafft werden.<br />
Pieter Wolters hat sich mit anderen regionalen<br />
Produzenten zusammengetan<br />
und das Netzwerk Q-Regio aufgebaut.<br />
Innerhalb der Uckermark beliefert die<br />
Handelsgesellschaft per Kombibus ihre<br />
Läden in Templin und Prenzlau sowie<br />
weitere Partner wie den Hofladen von<br />
Gut Kerkow. Nicht zuletzt wird so auch<br />
die Versorgung der Uckermärker mit<br />
heimischen Produkten sichergestellt.<br />
Anfang des Jahres hat Q-Regio sein<br />
Netzwerk erweitert. Im Nachtsprung<br />
erreichen die zuvor per Bus beim Fruchtund<br />
Lebensmittelgroßhändler Geko angelieferten<br />
Waren Geschäfte in und um<br />
Berlin.<br />
Seitdem die Anschubförderung Ende<br />
2013 ausgelaufen ist, muss sich Kombibus<br />
als eigenes Geschäftsfeld bewähren.<br />
Bislang noch, so UVG-Geschäftsführer<br />
Lars Boehme, „ein zartes Pflänzchen,<br />
das aber sichtbar wächst und in das wir<br />
investieren“. Gegenüber dem Vorjahr<br />
will Kombibus seinen Umsatz <strong>2014</strong> auf<br />
15.000 Euro fast verdoppeln und 2017<br />
kostendeckend fahren. Denn über den<br />
ÖPNV der im Besitz des Landkreises<br />
befindlichen UVG darf der Gütertransport<br />
nicht subventioniert werden. Auch<br />
Lars Boehme betont die Bedeutung für<br />
die Region: „Wir sind eine Art Wirtschaftsförderung:<br />
ein Bindeglied zwischen<br />
Produzenten und dem Markt.“<br />
<strong>Das</strong> Modell könnte schon bald auch in<br />
anderen Regionen starten. „Mittlerweile<br />
26 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Unterwegs im Netz<br />
Prenzlau<br />
Uckermark<br />
Templin<br />
Angermünde<br />
Schwedt<br />
BRANDENBURG<br />
BERLIN<br />
Brandenburg: Im äußersten Nordosten des Bundeslandes leben 130.000 Menschen.<br />
Nach Kriterien der Unesco gilt die dünn besiedelte Region als nicht bevölkertes Gebiet.<br />
interessieren sich Busunternehmen in<br />
Südthüringen und im östlichen Nordrhein-Westfalen<br />
für die Einführung des<br />
Kombibusses“, erläutert Anja Sylvester<br />
von der Berliner Beratungsgesellschaft<br />
Interlink, die zusammen mit der Fahrplangesellschaft<br />
B&B (Oelsnitz) und<br />
Raumkom (Trier) das Konzept entwickelt<br />
und die UVG bei der Markteinführung<br />
begleitet hat.<br />
In der Uckermark hat Fahrer Jörg<br />
Wewiorra unterdessen mit seiner Linie<br />
413 den zentralen Omnibusbahnhof von<br />
Prenzlau erreicht, einen von mittlerweile<br />
fünf Umladeknoten im Kombibus-Netz,<br />
die nach der Einführung des Integralen<br />
Taktfahrplans optimierte Anschlüsse in<br />
alle Richtungen ermöglichen. „<strong>Das</strong> ist<br />
nicht nur für die Fahrgäste gut“, erläutert<br />
Constantin Pitzen von der Fahrplangesellschaft<br />
B&B: „Je besser die Anschlüsse<br />
funktionieren, desto besser lässt sich<br />
Frachtraum vermarkten und desto stärker<br />
sinkt der Zuschussbedarf für den<br />
Busverkehr.“ Jörg Wewiorra muss noch<br />
nicht umladen. Um 13.15 Uhr setzt er<br />
seine Fahrt als Linie 431 nach Gramzow<br />
fort, wo er knapp 30 Minuten später<br />
eintrifft und am dortigen Knoten unter<br />
anderem mit der Linie 450 nach Angermünde<br />
verknüpft ist. Dort übergibt er an<br />
seinen Kollegen Erhard Krüger, der die<br />
Fracht und die Reisegruppe Richtung<br />
Angermünde zum Gut Kerkow bringt. Die<br />
blaue Box hat an diesem heißen Tag ihren<br />
Zweck erfüllt. Gut gekühlt kommt der<br />
Uckerkaas nach zwei Stunden Fahrzeit<br />
an und wird sofort in die Verkaufstheke<br />
gelegt. Aber wäre die Reisegruppe aus<br />
Berlin nicht mit an Bord gewesen, hätte<br />
Fahrer Erhard Krüger auf dieser Tour<br />
heute wohl allein im Bus gesessen ...<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.WirbewegenSie.de<br />
Modellprojekt<br />
Kombibus<br />
Neue Wege testen, wie der ÖPNV im<br />
ländlichen Raum wirtschaftlicher<br />
arbeiten kann: <strong>Das</strong> war das Ziel des<br />
vom Bundesinnenministerium<br />
initiierten Modellprojekts Kombibus.<br />
Den Aufbau der Nahversorgung im<br />
ländlichen Raum hat sich zudem<br />
ein Projekt im Rahmen des Landzukunft-Modellvorhabens<br />
des<br />
Bundesministeriums für Ernährung<br />
und Landwirtschaft zum Ziel gesetzt.<br />
Am Prenzlauer Bahnhof (Foto) haben Fahrgäste per Bus und<br />
Bahn Anschluss in alle Richtungen (kl. Foto oben).<br />
Dieser Kombibus<br />
macht Werbung<br />
in eigener Sache.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 27
Hintergrund<br />
Haltestelle Rathaus Fünffensterstraße in Kassel mit<br />
dynamischer Fahrzielanzeige und Außenansage:<br />
„Linie Acht. Richtung Kaufungen Papierfabrik.“<br />
Vor jedem Halt eine<br />
klare Ansage<br />
Haltestellenansagen in öffentlichen<br />
Verkehrsmitteln werden<br />
nur noch selten vom Fahrzeugführer<br />
selbst gesprochen. Die Technik ist<br />
so ausgereift, dass dies automatisch<br />
geschieht. Viele Verkehrsunternehmen<br />
setzen dabei auf eine<br />
Text-to-Speech Software.<br />
Ding Dong. „Wir begrüßen Sie in der Linie<br />
Acht Richtung Papierfabrik. Nächste<br />
Haltestelle: Rathaus Fünffensterstraße.“<br />
Dies ist nur eine von knapp 70.000 Haltestellenansagen<br />
täglich, die die Fahrgäste<br />
der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG)<br />
in Bus, Straßenbahn oder RegioTram an<br />
einem gewöhnlichen Werktag hören. Die<br />
Stimme spricht in der Regel pünktlich,<br />
fehlerfrei und stets in derselben Tonlage.<br />
Die meisten Verkehrsunternehmen setzen<br />
auf einen professionellen Sprecher,<br />
die eingesprochenen Ansagen werden<br />
dann von einem Speichermedium in<br />
den einzelnen Fahrzeugen abgespielt.<br />
Die Arbeit mit professionellen Stimmen<br />
ist jedoch aufwendig. Änderungen im<br />
Linienverlauf oder bei den Fahrgastinformationen<br />
erfordern neue Ansagen.<br />
„Für einen Termin mit unserer Spreche-<br />
28 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Hintergrund<br />
U-Bahn-Stimmen der Welt<br />
Oslo<br />
Helsinki<br />
Moskau<br />
Nowosibirsk<br />
Quelle: „XX XY Männer und Frauen – Grafiken erklären die Unterschiede“<br />
Stockholm<br />
Toronto Montreal<br />
Kopenhagen<br />
London Amsterdam<br />
Berlin<br />
Chicago Boston<br />
Warschau<br />
San Francisco<br />
Brüssel<br />
New York<br />
Philadelphia<br />
Los Angeles<br />
Prag<br />
Washington, D.C.<br />
Atlanta<br />
Paris<br />
Wien<br />
Lausanne<br />
Miami<br />
Santo Madrid<br />
Rom<br />
Domingo<br />
Mexiko-Stadt<br />
Lissabon Barcelona<br />
Lima<br />
Medellín<br />
Santiago de Chile<br />
weibliche Stimme<br />
männliche Stimme<br />
abwechselnd weibliche<br />
und männliche Stimme<br />
Buenos Aires<br />
Rio de Janeiro<br />
Sao Paulo<br />
Kiew<br />
Bukarest<br />
Sofia<br />
Ankara<br />
Athen<br />
Algier<br />
Teheran<br />
Taschkent<br />
Tiflis<br />
Almaty<br />
Baku<br />
Jerewan<br />
Kairo<br />
Johannesburg<br />
Delhi<br />
Dubai<br />
Kalkutta<br />
Bangkok<br />
Singapur<br />
Perth<br />
Peking<br />
Shanghai<br />
Seoul<br />
Taipeh<br />
Kaohsiung<br />
Manila<br />
Kuala Lumpur<br />
Sydney<br />
Tokio<br />
rin im Studio haben wir früher immer<br />
Sprachaufträge gesammelt, um sie dann<br />
gebündelt aufzunehmen“, erklärt Claudio<br />
Frare vom Fachbereich Controlling und<br />
Kommunikation der KVG: „Daher mussten<br />
wir auf eine neue Aufnahme teilweise<br />
mehrere Monate warten. Hinzu kam, dass<br />
unsere Geräte völlig veraltet waren.“<br />
Um dieses zeitintensive Procedere mit<br />
möglichst wenig Aufwand im eigenen<br />
Haus zu bewerkstelligen, entwickelte<br />
Frare sogar ein neues Abspielgerät und<br />
begab sich auf die Suche nach einer geeigneten<br />
Computerstimme. „<strong>Das</strong> war gar<br />
nicht so einfach, ich habe viele Dinge<br />
ausprobiert, aber die Stimmen klangen<br />
alle sehr nach einem Roboter.“ Dann<br />
stieß er aber auf die Vorlesesoftware der<br />
Münchner Firma Linguatec, mit deren<br />
Hilfe er seitdem mit wenig Zeitaufwand<br />
neue MP3-Dateien erstellt. Diese werden<br />
nachts mit einem USB-Stick oder<br />
einer SD-Karte auf die Bordcomputer der<br />
Fahrzeuge überspielt. Neuere Fahrzeuge<br />
verfügen mittlerweile über Rechner, auf<br />
die sich die Dateien in Echtzeit über GPRS<br />
oder WLAN überspielen lassen. „Im ÖPNV<br />
gibt es immer auch Außengeräusche.<br />
Daher fällt es gar nicht so sehr auf, dass<br />
wir eine Computerstimme verwenden. Ich<br />
finde, sie klingt nicht wie eine synthetische<br />
Roboterstimme“, erklärt Frare.<br />
Dank professioneller Sprachsynthese<br />
hat die Qualität der Aussprache und der<br />
Satzmelodie in den vergangenen Jahren<br />
Fortschritte gemacht. „Aufgrund der stärkeren<br />
IT-Vernetzung und des Zwangs zur<br />
Automatisierung von Abläufen registrieren<br />
wir ein zunehmendes Interesse von<br />
ÖPNV-Unternehmen an unserer Software“,<br />
erklärt Reinhard Busch, Geschäftsführer<br />
von Linguatec Sprachtechnologien.<br />
So beherrscht die Stimme „Anna“ in der<br />
neuesten Version des Programms „Voice<br />
Reader Studio“ aus dem Jahr <strong>2014</strong> neben<br />
Deutsch die Sprachen Englisch, Spanisch,<br />
Italienisch und Französisch. Haltestellen<br />
wie „Charles-de-Gaulle-Platz“ spricht sie<br />
fehlerfrei aus. „Wir benutzen für unsere<br />
Software professionelle Sprecher, die über<br />
40 Stunden Text im Tonstudio aufnehmen“,<br />
verrät Reinhard Busch. Hinter der<br />
Computerstimme verbirgt sich also weiterhin<br />
ein Mensch.<br />
Die Software „Voice Reader Studio“ von<br />
Linguatec – hier ein Screenshot der Kasseler<br />
Verkehrs-Gesellschaft – kann Fahrgastinformationen<br />
schnell und einfach in eine<br />
Audiodatei umwandeln.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 29
Abgefahren<br />
Jazz‘n Roll: Feiern<br />
in der U-Bahn<br />
Musik in der U-Bahn muss nicht aus den<br />
Kopfhörern des Sitznachbarn kommen.<br />
Der Beweis: der Jazztrain (Fotos), der am<br />
13. September wieder über die Ringlinie<br />
der Hamburger Hochbahn rollt. Acht Stunden<br />
lang spielen 35 Bands und 150 Musiker<br />
in der Bahn. Auch woanders kommt der<br />
Rhythmus zum Zug – in Köln jetzt durch<br />
den Kulturverein Jack in the Box und die<br />
Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB). „Unser<br />
Vorbild ist die Pariser Metro“, erklärt Projektleiter<br />
Benno Schnatz. Dort gebe es seit<br />
1977 ein Projekt, das Musik in die U-Bahn<br />
und ihr Umfeld integriert. In der Domstadt<br />
wollen die Macher erst einmal klein anfangen:<br />
Zum sogenannten Kölner „Tag des guten<br />
Lebens“ treten Musiker in den Bahnhöfen<br />
und Bahnen in Köln-Ehrenfeld (31. August)<br />
und Sülz (21. September) auf. Statt Jazz gibt<br />
es jedoch Klassik und Weltmusik.<br />
www.jazztrain-hamburg.de<br />
www.koelnerbox.de<br />
Gewinn<br />
Preisausschreiben<br />
Drei Bildbände verlost<br />
In der <strong>Ausgabe</strong> 2/<strong>2014</strong><br />
fragten wir, welche<br />
Künstler die Duisburger<br />
U-Bahn-Station König-<br />
Heinrich-Platz gestaltet<br />
haben. Die Antwort:<br />
Gerhard Richter und Isa<br />
Genzken. Dafür gewannen<br />
Ansgar Kortenjan, S. Tiegel<br />
und Marianne Breton je ein<br />
Exemplar des Fotobands<br />
„Unter Grund“.<br />
Termin<br />
16. und 17. Oktober <strong>2014</strong><br />
Connected 8.0 in Osnabrück<br />
Aus der <strong>VDV</strong>-Personal- und Unternehmensbörse<br />
wird Connected 8.0 – der Karriere-Treffpunkt<br />
Öffentlicher Verkehr. Hier präsentieren sich<br />
Verkehrsunternehmen und -verbünde 200 Studierenden<br />
unterschiedlicher Fachrichtungen.<br />
www.vdv-akademie.de/tagungen-seminare/<br />
der-karriere-treffpunktbr-oeffentlicher-verkehr.html<br />
Termin<br />
17. und 18. November <strong>2014</strong><br />
7. <strong>VDV</strong>-Marketing-<br />
Kongress in Hamburg<br />
Der digital vernetzte Kunde ist<br />
eine neue Herausforderung für das<br />
Marketing. Der Kongress zeigt, wie<br />
man Kunden durch neue Vertriebsstrategien<br />
erreichen kann.<br />
www.vdv.de/termine.aspx<br />
Die nächste<br />
<strong>Ausgabe</strong> von<br />
„<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“<br />
erscheint Ende<br />
August <strong>2014</strong>.<br />
Impressum<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong><br />
Herausgeber:<br />
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (<strong>VDV</strong>),<br />
Kamekestraße 37-39, 50672 Köln,<br />
Tel. 02 21/5 79 79-0<br />
E-Mail: info@vdv.de,<br />
Internet: www.vdv.de<br />
Redaktion <strong>VDV</strong>:<br />
Lars Wagner (V.i.S.d.P.),<br />
Pressesprecher und Leiter Presse- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Anschrift der Redaktion:<br />
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (<strong>VDV</strong>),<br />
Redaktion „<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“,<br />
Leipziger Platz 8, 10117 Berlin,<br />
magazin@vdv.de<br />
Realisierung, Text und Redaktion:<br />
AD HOC PR, Gütersloh: Stefan Temme (Lt.), Elena Grawe,<br />
Judith Kantner, Christian Horn<br />
Mitarbeit:<br />
Eberhard Krummheuer<br />
Gesamtleitung und Anzeigen:<br />
Christian Horn (AD HOC PR)<br />
Tel. 0 52 41/90 39-33 | horn@adhocpr.de<br />
Grafik-Design:<br />
Volker Kespohl (Volker.Kespohl ı Werbung Münster)<br />
Lars Haberl (AD HOC PR, Gütersloh)<br />
Produktion und Druck:<br />
Druckhaus Rihn, Blomberg<br />
Anzeigenpreise:<br />
Laut Mediadaten <strong>2014</strong><br />
Bildnachweise:<br />
Titelmotiv: Fotolia (Montage).<br />
ddp-images: 26, 30; Michael Fahrig: 2, 4/5, 12, 13, 14, 15;<br />
Fotolia: 6; Ole Häntzschel/Matthias Stolz: 29 (Infografik);<br />
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft: 2, 28, 29; Volker Kespohl:<br />
7, 8, 10, 11 (Infografiken/Bilder Fotolia); KVB: 2, 20, 21, 22,<br />
23; Micha Pawlitzki & Edition Panorama: 30; Oliver Ruhnke:<br />
30; Stefan Temme: 2, 24, 25, 26, 27; <strong>VDV</strong>: 3, 7, 8, 9, 10, 11;<br />
Westerwaldbahn: 2, 16, 17, 18, 19<br />
„<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“ erscheint alle zwei Monate (sechsmal<br />
im Jahr). Alle im <strong>Magazin</strong> erscheinenden Beiträge und<br />
Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Außerhalb der<br />
Grenzen des Urheberrechts ist die Verwertung ohne die<br />
Zustimmung des Herausgebers nicht zulässig. <strong>Das</strong> gilt vor<br />
allem für Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie die elektronische<br />
Speicherung und Verarbeitung.<br />
Für Anregungen, Themenvorschläge, Lob und Kritik erreichen Sie uns unter magazin@vdv.de<br />
30 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
InnoTrans <strong>2014</strong><br />
23. – 26. SEPTEMBER · BERLIN<br />
Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik<br />
Innovative Komponenten · Fahrzeuge · Systeme<br />
innotrans.de<br />
THE FUTURE<br />
OF<br />
MOBILITY
ksp.de<br />
Für Sie machen wir<br />
es wieder weiß!<br />
Ihr Spezialist im Forderungsmanagement<br />
Wir sagen danke für eine erfolgreiche<br />
<strong>VDV</strong>-Jahrestagung <strong>2014</strong>.<br />
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2015.<br />
Mit dem richtigen „Waschprogramm“ zum Erfolg.<br />
Die Rechtsanwälte von KSP sind die Spezialisten für die Beitreibung offener<br />
Forderungen für Verkehrsgesellschaften (z.B. erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE),<br />
Abonnement und Schadensersatz). Profitieren Sie von einem anwaltlichen Partner,<br />
der Forderungsmanagement als Instrument der Kundenbindung versteht!<br />
Weitere Informationen unter 040 - 450 65 - 550 oder ksp.de