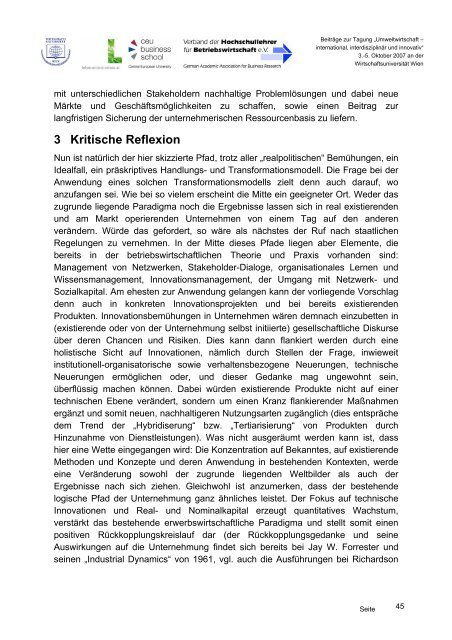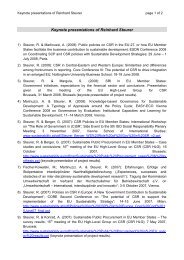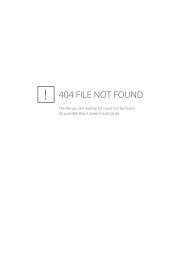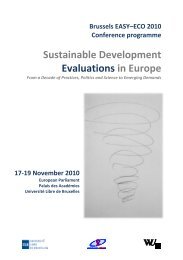umweltwirtschaft - Research Institute for Managing Sustainability
umweltwirtschaft - Research Institute for Managing Sustainability
umweltwirtschaft - Research Institute for Managing Sustainability
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beiträge zur Tagung „Umweltwirtschaft –<br />
international, interdisziplinär und innovativ“<br />
3.-5. Oktober 2007 an der<br />
Wirtschaftsuniversität Wien<br />
mit unterschiedlichen Stakeholdern nachhaltige Problemlösungen und dabei neue<br />
Märkte und Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, sowie einen Beitrag zur<br />
langfristigen Sicherung der unternehmerischen Ressourcenbasis zu liefern.<br />
3 Kritische Reflexion<br />
Nun ist natürlich der hier skizzierte Pfad, trotz aller „realpolitischen“ Bemühungen, ein<br />
Idealfall, ein präskriptives Handlungs- und Trans<strong>for</strong>mationsmodell. Die Frage bei der<br />
Anwendung eines solchen Trans<strong>for</strong>mationsmodells zielt denn auch darauf, wo<br />
anzufangen sei. Wie bei so vielem erscheint die Mitte ein geeigneter Ort. Weder das<br />
zugrunde liegende Paradigma noch die Ergebnisse lassen sich in real existierenden<br />
und am Markt operierenden Unternehmen von einem Tag auf den anderen<br />
verändern. Würde das ge<strong>for</strong>dert, so wäre als nächstes der Ruf nach staatlichen<br />
Regelungen zu vernehmen. In der Mitte dieses Pfade liegen aber Elemente, die<br />
bereits in der betriebswirtschaftlichen Theorie und Praxis vorhanden sind:<br />
Management von Netzwerken, Stakeholder-Dialoge, organisationales Lernen und<br />
Wissensmanagement, Innovationsmanagement, der Umgang mit Netzwerk- und<br />
Sozialkapital. Am ehesten zur Anwendung gelangen kann der vorliegende Vorschlag<br />
denn auch in konkreten Innovationsprojekten und bei bereits existierenden<br />
Produkten. Innovationsbemühungen in Unternehmen wären demnach einzubetten in<br />
(existierende oder von der Unternehmung selbst initiierte) gesellschaftliche Diskurse<br />
über deren Chancen und Risiken. Dies kann dann flankiert werden durch eine<br />
holistische Sicht auf Innovationen, nämlich durch Stellen der Frage, inwieweit<br />
institutionell-organisatorische sowie verhaltensbezogene Neuerungen, technische<br />
Neuerungen ermöglichen oder, und dieser Gedanke mag ungewohnt sein,<br />
überflüssig machen können. Dabei würden existierende Produkte nicht auf einer<br />
technischen Ebene verändert, sondern um einen Kranz flankierender Maßnahmen<br />
ergänzt und somit neuen, nachhaltigeren Nutzungsarten zugänglich (dies entspräche<br />
dem Trend der „Hybridiserung“ bzw. „Tertiarisierung“ von Produkten durch<br />
Hinzunahme von Dienstleistungen). Was nicht ausgeräumt werden kann ist, dass<br />
hier eine Wette eingegangen wird: Die Konzentration auf Bekanntes, auf existierende<br />
Methoden und Konzepte und deren Anwendung in bestehenden Kontexten, werde<br />
eine Veränderung sowohl der zugrunde liegenden Weltbilder als auch der<br />
Ergebnisse nach sich ziehen. Gleichwohl ist anzumerken, dass der bestehende<br />
logische Pfad der Unternehmung ganz ähnliches leistet. Der Fokus auf technische<br />
Innovationen und Real- und Nominalkapital erzeugt quantitatives Wachstum,<br />
verstärkt das bestehende erwerbswirtschaftliche Paradigma und stellt somit einen<br />
positiven Rückkopplungskreislauf dar (der Rückkopplungsgedanke und seine<br />
Auswirkungen auf die Unternehmung findet sich bereits bei Jay W. Forrester und<br />
seinen „Industrial Dynamics“ von 1961, vgl. auch die Ausführungen bei Richardson<br />
Seite 45